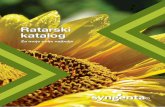Katalog Sonderausstellung VorZeitBild
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Katalog Sonderausstellung VorZeitBild
2
VorZeitBildRekonstruktion in der Archäologie
Herausgeber:
Abteilung für Vorgeschichte Naturhistorische Gesellschaft Nürnberg e. V.
Mitarbeiter:
Thomas Trauner
Hans Trauner
Norbert Graf
Ausstellungsbezug:
Texte zur Sonderausstellung vom 6.2.2011 bis zum 30.6.2011
im Naturhistorischen Museum Nürnberg
Layout:
Susanne Groß
© 2012 Naturhistorische Gesellschaft Nürnberg e. V.
Alle Rechte vorbehalten
3
Inhalt
VorZeitBild – Eine Einführung 5 Arne Kimmig
Welchen Sinn hat die Rekonstruktionsarbeit in der Archäologie? 12 Thomas Trauner
Historie der Rekonstruktionen 16 Thomas Trauner
Vorgehensweisen in der Erstellung von Rekonstruktionen 20 Thomas Trauner
Fallstricke der Rekonstruktionsarbeit 24 Thomas Trauner
Darsteller in der Vorgeschichte 27 Hans Trauner
Rekonstruktion einer keltischen Ausstattung 29 Hans Trauner
Rekonstruktion von Keramikgefäßen 32 Bettina Kocak
Die Speerschleuder – Von der Steinzeitwaffe zum modernen Sportgerät 36 Wulf Hein
Eiszeitkleidung Lendenschutz und Flatterfell – Was trug der Rentierjäger wirklich? 39 Wulf Hein
Lederkleidung eines eiszeitlichen Jägers 43 Wulf Hein
Rekonstruktionen außerhalb der wissenschaftlichen Welt 45 Thomas Trauner
Zusammenfassung und Ausblick 49 Thomas Trauner
5
Wenn man sich dem Thema der Ausstellung „VorZeitBild“ nähern will, lohnt es sich, die Vorzeitbilder des klassischen Griechenlands und der römischen Kul-tur zu untersuchen. Anhand des Bildes, das sich die antiken Kulturen von ihrer Vorzeit machten, lassen sich exemplarisch Parallelen zu Fragen der Genese und Funktion von Vorzeitbildern und Rekonstruktionen der Vergangenheit ziehen, die bis heute aktuell sind.
Das Schiff des Theseus
Zur Erläuterung des ersten Beispiels sei an die zum Gründungsmythos Athens gehörende Geschichte von Theseus und Minotaurus erinnert: Theseus, Sohn des Königs Ägeus von Athen, wurde als einer von sieben Jünglingen und Jungfrau-en als Tribut der Athener nach Kreta geschickt, um dem im Labyrinth des kreti-schen Königs Minos lebenden Minotaurus, ein Mischwesen, halb Mensch, halb Stier, zum Opfer dargebracht zu werden. Die kretische Königstochter Ariadne verliebte sich in Theseus und zeigte ihm, wie er mit Hilfe eines Fadens aus dem Labyrinth herausfinden könnte. Theseus und die anderen Jugendlichen bega-ben sich in das Labyrinth, Theseus tötete den Minotaurus, und sie flohen zurück nach Athen. Von Athen waren sie als Zeichen der Trauer mit schwarzen Segeln abgefahren und hatten vereinbart, dass sie im Falle einer unversehrten Rück-kehr weiße Segel hissen würden. Das wurde vergessen, und der sehnsuchtsvoll am Kap Sounion wartende Ägeus stürzte sich von den Klippen ins Meer, als er am Horizont das Schiff mit schwarzen Segeln auftauchen sah. Trotzdem wurden Theseus und seine Begleiter von den Athenern mit großem Jubel begrüßt und er übernahm die Herrschaft in Athen.
Abgesehen davon, dass dieser Mythos für die Athener ein reales historisches Er-eignis darstellte, ist der im Rahmen der Ausstellung „VorZeitBild“ interessieren-de Aspekt, dass in Athen das Schiff des Theseus über viele Jahre als Echtheits-beleg für die Ereignisse der Vergangenheit ausgestellt wurde, wie uns Plutarch berichtet (Plutarch, Vita Thesei 23):
„Das Schiff, auf dem Theseus mit den Jünglingen losgesegelt und auch sicher zurückgekehrt ist, eine Galeere mit 30 Rudern, wurde von den Athenern bis zur Zeit des Demetrios Phaleros aufbewahrt. Von Zeit zu Zeit entfernten sie daraus alte Planken und ersetzten sie durch neue intakte.
VorZeitBild Eine Einführung
Hallstatt - D - Ausstattung NHG
6
Das Schiff wurde daher für die Philosophen zu einer ständigen Veranschauli-chung zur Streitfrage der Weiterentwicklung; denn die einen behaupteten, das Boot sei nach wie vor dasselbe geblieben, die anderen hingegen, es sei nicht mehr dasselbe.“
Plutarchs Zitat zeigt weiterhin, dass die Athener das Schiff in Stand hielten und zur Schau stellten, genauso wie heute in den Museen die materiellen Zeugnisse der Vergangenheit gepflegt, gegebenenfalls ergänzt und den Besuchern prä-sentiert werden, damit sie sich ein Bild von der Vergangenheit machen können. Wie Plutarch andeutet, ist das „Schiff des Theseus“, ein Beispiel für ein philoso-phisches Paradox, das die Frage behandelt, wie lange ein Gerät das ursprüng-liche Gerät bleibt, wenn man nach und nach seine Komponenten austauscht; eine Frage, die man sich auch heute noch beim Betrachten restaurierter und rekonstruierter Ausstellungsobjekte stellen kann.
Die Casa Romuli
Die Römer hatten einen ganz besonderen Erinnerungsort, an dem sie sich ein Bild von den Zeiten ihrer Stadtgründung machen konnten. Auf dem Palatin, ei-nem der sieben Hügel Roms, auf dem Kaiser Augustus und andere römischen Kaiser ihre Residenz hatten, befand sich die Casa Romuli, in der Vorstellung der Römer die Hütte des mythischen Stadtgründers Romulus. Wie uns Plutarch (Vita Romuli, 20) und andere antike Geschichtsschreiber (z. B. Dionysos von Halikarn-assos 1, 79, 11) berichten, war die Casa Romuli eine Holzpfosten-Konstruktion, deren Wände aus Flechtwerk und Lehmverputz bestanden; das Dach war mit Stroh gedeckt. Ähnlich dem Schiff des Theseus wurde die Casa Romuli von den Römern als Beleg für den Gründungsmythos der Stadt Rom angesehen und warf ein Bild auf Roms Vergangenheit oder, wie man heute sagen würde, auf die Anfänge der Eisenzeit auf der italischen Halbinsel.
Plutarch mag angesichts seines Wissens über das Schiff des Theseus darüber nachgedacht haben, ob die Hütte das Original oder eine Rekonstruktion war. Die Römer scheint diese Frage nicht bewegt zu haben: Jedenfalls bauten sie die Hütte jedes Mal, wenn sie durch Brand zerstört worden war, als originalgetreue Rekonstruktion wieder auf und nutzten sie weiterhin als rituellen Ort, an dem sie der Gründung Roms gedachten.
7
Noch heute werden auf dem Palatin der Casa Romuli zugeschriebene Pfosten-löcher gezeigt. Ob es sich hier um einen realen Schauplatz des Mythos handelt, kann nicht beantwortet werden. Aber es ist zu erwähnen, dass bei archäologi-schen Grabungen nahe der Casa Romuli Reste einer eisenzeitlichen Siedlung mit den Pfostenlöchern mehrerer Häuser gefunden wurden, die in die Jahre 800 bis 700 v. Chr. datiert wurden, ein Zeitraum, in den die sagenhafte Gründung Roms 753 v. Chr. fiele.
Das Vorzeitbild bei Homer
Homers große Epen Ilias und Odyssee lassen sich als eine literarische Rekon-struktion einer längst vergangenen Zeit lesen und sind damit ein weiteres Bei-spiel für die Überlieferung eines antiken Vorgeschichtsbilds. Von Homer im 8. Jh. v. Chr. schriftlich niedergelegt, entwerfen diese Epen ein Bild einer Zeit von ca. 400 Jahren vorher, wie es detailgenauer kaum sein kann. Dieses literarische Bild von der bronzezeitlichen mykenischen Kultur, war nicht nur das Vorzeitbild der antiken Griechen und Römer von dieser Epoche, sondern prägt auch heute noch die Vorstellung von den „alten Griechen.“
Aber entspricht diese literarische Rekonstruktion auch den realen Verhältnissen im mykenischen Kulturkreis? Hier stößt man exemplarisch auf Probleme und Fragen, die sich als Leitfaden durch die Ausstellung VorZeitBild ziehen: wie nä-hern sich Rekonstrukteure dem originalen Leben der Vorzeit und wie nahe kom-men sie diesem? Ist das Bild, das sie von der Vorzeit entwerfen und im Museum vermitteln, ein plausibles Abbild der realen Verhältnisse der damaligen Zeit?
Spätestens seit Schliemanns Entdeckungen Trojas und Mykenes kann man Ho-mers Epen nicht mehr als reine Märchen ohne jeden Wahrheitsgehalt abtun. Seit Schliemann klopfen die Altertumswissenschaften Ilias und Odyssee nach ihrem realen Bezug, ihrer Plausibilität und ihren falschen Aussagen ab. Dabei spielt die Archäologie, welche die materiellen Befunde liefert, die zentrale Rolle. Schon Schliemann hat durch die Ausgrabungen Trojas und Mykenes frappie-rende Belege für die Übereinstimmungen mit Homer gegeben, allein durch die Tatsache, dass sich diese Orte bestimmen ließen.
8
Dies gilt auch für andere in der Ilias erwähnte Orte: In dem so genannten Schiffs-katalog zählt Homer die Orte auf (Ilias, II. Gesang, Vers 494-759), die Schiffe ge-gen Troja entsendet hatten. Archäologen konnten mittlerweile alle diese Orte lokalisieren, und erstaunlicherweise fanden sie an jedem dieser Orte einen Pa-last oder eine Siedlung der mykenischen Kultur. Manche der aufgezählten Orte waren zu Homers Zeiten bereits verschwunden. Das ist ein starker Beleg für ei-nen realen bronzezeitlichen Bezug der Ilias.
Ein weiterer bekannter Beleg für den bronzezeitlichen Bezug ist der von Homer in der Ilias folgendermaßen beschriebene Eberzahnhelm (Ilias, X. Gesang, Vers 260-265):
„... gab dem Odysseus Bogen und Köcher,Samt dem Schwert; und bedeckte des Königes Haupt mit dem Helme,Auch aus Leder geformt: inwendig mit häufigen RiemenWölbt‘ er sich, straff durchspannt; und auswärts schienen die HauerVom weißzahnigen Schwein, und starreten hiehin und dorthin,Schön und künstlich gereiht; und ein Filz war drinnen befestigt.“
Überreste eines solchen Helms wurden in einem Grab in der Nähe von Mykene gefunden. Bronzezeitliche Darstellungen von Eberzahnhelmen fand man an ei-nem kleinen elfenbeinernen Reliefkopf aus einem Kammergrab in Mykene und auf einer delischen bronzezeitlichen Reliefplatte.
Neben diesen und anderen Übereinstimmungen gibt es aber auch Diskrepan-zen zwischen Homers epischer Beschreibung der mykenischen Bronzezeit und den archäologischen Befunden: Im Gegensatz zu Homer ist heute bekannt, dass die Mykener eine Schrift hatten, und dass zumindest ein Teil der mykenischen Upper Class schreiben konnte. Das Wissen über die Schriftkultur Mykenes war schlichtweg innerhalb von 400 Jahren verloren gegangen.
Eine weitere Diskrepanz entdeckt man, wenn man bei Homer liest, welche Tätig-keiten die vor Troja versammelten bronzezeitlichen Könige zu Hause ausübten: Homer beschreibt sie als Besitzer von Ackerland und Herden, die sie bebauen bzw. hüten ließen. Ihre Frauen, die Königinnen, saßen laut Homer vor dem Web-stuhl oder hielten sich in den Schlafgemächern auf.
9
Die mächtigen Befestigungsanlagen von Mykene und Tiryns, die prächtigen Pa-läste und die darin gefundenen königlichen Schätze zeigen aber auf, dass die Herrscher der mykenischen Kultur eine viel größere Machtfülle als die homeri-schen Helden besaßen, die im Vergleich dazu zu Dorfhäuptlingen oder Provinz-fürsten verblassen. Auch ist es unvorstellbar, dass sich mykenische Königinnen mit hausfraulichen Tätigkeiten befassten.
Wie konnte es in den 400 Jahren nach dem Niedergang der mykenischen Kul-tur bis zur Niederschrift der Ilias zu solchen Fehlwahrnehmungen der Vergan-genheit kommen? Um diese Fragen beantworten zu können, muss man wissen, dass dem Untergang der mykenischen Hochkultur die so genannten „dunklen Jahrhunderte“ folgten, die mit einem ökonomischen, sozialen und kulturellen Niedergang verbunden waren. Über diese Zeit wurde die Erinnerung an die Vergangenheit durch mündliche Überlieferung weitergegeben. Das kann man sich so vorstellen, dass Barden, im Griechischen Rhapsoden ( „Zusammennäher von Liedern“) genannt, die Hel-dentaten besangen und im Laufe der Jahrhunderte mal da was änderten, dort was wegließen und an anderer Stelle die Lieder mit Eindrücken aus ihrem ak-tuellen Umfelde bereicherten und ausschmückten. Mit Ilias und Odyssee hin-terließ Homer ein lange nachwirkendes Bild der griechischen Bronzezeit, das in manchen Bereichen dem archäologischen Befund entspricht, in anderen eher die Zeit der „dunklen Jahrhunderte“ beschreibt oder völlig an der bronzezeitli-chen Realität vorbeigeht.
Auch heute noch bedeutet die Rekonstruktion eines vergangenen Lebensbil-des eine Annäherung an die vergangene Wirklichkeit, aber obwohl zeitlich wei-ter entfernt als Homer, können wir dank der archäologischen Forschungen in-zwischen ein weitaus realistischeres Bild der mykenischen Bronzezeit zeichnen.
Gründungsmythen und nationale Vorzeitbilder
Das Schiff des Theseus und die Casa Romuli dienten als Belege für die Histori-zität der Gründungsmythen der Polis Athen bzw. der Stadt Rom und des römi-schen Reiches. Dessen bewusst hat sich Kaiser Augustus, der sich als zweiter Stadtgründer Roms empfand, seinen Palast auf dem Palatin neben der Casa Ro-muli bauen lassen.
10
In wohl allen Nationalstaaten Europas sind nationale Gründungsmythen zu fin-den, die ein Versuch sind, den Nationalgedanken tief in der Vergangenheit zu verankern, die nationale Einheit zu festigen und den Menschen ein Gefühl der nationalen Zusammengehörigkeit zu geben. Deutschlands Germanenmythos beruhte auf dem Bild, das Tacitus von den Germanen zeichnete, und Arminius, der Sieger gegen die Römer in der Varus-Schlacht, wurde von national Gesinn-ten unter dem Namen Hermann der Cherusker als der Gründer der deutschen Nation angesehen.
Unter der Nazi-Herrschaft wurde die Archäologie dazu funktionalisiert, den ras-sistischen Germanenwahn „wissenschaftlich“ zu begründen, und das Vorzeit-bild der Menschen in diesem Sinne zu beeinflussen. Vor diesem Hintergrund ist die Interpretationsstarre verständlich, die sich nach der Befreiung in der vor-geschichtlichen Forschung der Nachkriegszeit breit machte. Sie befasste sich zwar ausführlich und verdienstvoll mit den materiellen Hinterlassenschaften vorzeitlicher Kulturen, verhielt sich aber gegenüber dem Entwurf vorzeitlicher Lebensbilder skeptisch bis ablehnend.
Vielleicht ist es kein Zufall, dass seit dem Einzug von Asterix und Obelix in die Bücherregale – der erste Band in deutscher Sprache erschien 1968 – ein mehr und mehr entkrampfter Umgang mit der Vorgeschichte einsetzte. Dieser ist in erster Linie auf die aktive Aufarbeitung der Nazi-Vergangenheit in der Bundes-republik zurückzuführen. So konnte man im Hermann-Jahr 2009 sehen, dass die Entmythologisierung und Entnationalisierung Deutschlands so weit fort-geschritten ist, dass Archäologen und Rekonstrukteure heutzutage entspannt, aufgeklärt und in vollem Bewusstsein der Fallstricke wieder Bilder von der Vor-zeit präsentieren können.
Abhängig von der Vollständigkeit oder Lückenhaftigkeit der archäologischen Quellen kommen die Vorzeitbilder der vergangenen Realität mehr oder weni-ger nahe. Sie erheben keinen Anspruch auf Wahrheit über die Vergangenheit und sind durch neue wissenschaftliche Erkenntnisse jederzeit revidierbar. Aber diese Bilder sind auch nicht falsch, doch sie dürfen und müssen danach hinter-fragt werden, was an ihnen archäologisch belegbar oder nur plausibel ist, oder wie die Rekonstrukteure Lücken im archäologischen Befund in ihren Modellen und Lebensbildern überbrücken.
11
An der Ausstellung Beteiligte
Die Ausstellung VorZeitBild verdankt ihr Entstehen den Rekonstrukteuren Hans Trauner und Thomas Trauner. Von ihnen stammen die Idee und das Konzept der Ausstellung. In vielen ehrenamtlichen Stunden verfassten sie Tafel-texte, wählten Bilder aus, besorgten Leihgaben und führten die Ausstellung er-folgreich zur Vollendung. Sie brachten nicht nur ihr immenses archäologisches Wissen ein, sondern auch zahlreiche Modelle, die sie in den vergangenen Jah-ren entwickelt und realisiert haben. Susanne Groß hat ihre Erfahrung bei der Gestaltung der Tafeln, Prospekte und Plakate eingebracht. Zusätzlich übernahm sie die Werbe- und Pressearbeit. Ein-zelne Tafeln und Vitrinen wurden von Bettina Kocak, Wulf Hein und Norbert Graf gestaltet. Die Ausstellung lebt durch die ansprechenden und außergewöhnlichen Aus-stellungsobjekte. Hochwertige Leihgaben stellten Norbert Graf, Wulf Hein, Bettina Kocak, Knut Starringer, das Archäologische Museum Kehlheim und das Erlanger Institut für Ur- und Frühgeschichte zur Verfügung. Die Naturhistorische Gesellschaft Nürnberg und deren Abteilung für Vorge-schichte finanzierten die Ausstellung.Allen, die zum erfolgreichen Zustandekommen der Ausstellung VorZeitBild bei-getragen haben, sei an dieser Stelle herzlich gedankt.
Arne Kimmig Obmann der Abteilung für Vorgeschichte der Naturhistorischen Gesellschaft Nürnberg e.V.
12
Die Archäologie ist eine Geistes-wissenschaft. Sie bedient sich jedoch vieler anderer Wissen-schaften wie zum Beispiel der Anthropologie, der Biologie, der Ethnologie und auch der Erkennt-nisse aus den techni-schen Bereichen. Diese sind vor allem dann notwendig, wenn es sich um Aussagen zur Herstellung, Funktion und Bedeutung von Artefakten, also von Menschen hergestellten Fundstücken, handelt.
Artefakte kommen praktisch aus allen Bereichen des menschlichen Tuns und Handelns. Es kann sich um Schmuck, um Werkzeug, um Statussymbole, um Kleidung, um Gefäße handeln, aber auch um Dinge, die für uns jetzt le-bende Menschen nur noch schwer einzuordnen sind, wie zum Beispiel um Geräte, deren Zweckbestimmung vielleicht im geistigen oder religiösen Bereich lagen.
Welchen Sinn hat die Rekonstruktionsarbeit
in der Archäologie?
Neolithischer Kamm (zur Körperpflege oder Webkamm?)
Hallstattzeitlicher Bronzehelm
13
Zu diesen Artefakten gibt es demnach viele, oft verschiedene, manchmal so-gar widersprüchliche Theorien oder Erklärungen, die für sich genommen, zwar logisch sind, aber insgesamt nicht immer zu einem eindeutigen Schluss führen. Erschwerend kommt hinzu, dass die allermeisten Artefakte nicht vollständig sind.
Oft sind sie nur bruchstückhaft erhal-ten. Teile, welche die Funktion erklären könnten, fehlen. Die Einlagerung in den Boden oder in feuchte oder nas-se Umgebung verändert das Erschei-nungsbild wesentlich, Schmuckstücke lassen ihre ursprüngliche Schönheit nur noch erahnen.
Archäologische Rekonstruktionsarbeit versucht, diese Erklärungslücken zu schließen. Der augenfällige Vorteil ist, dass die rekonstruierten Artefakte nun leichter verständlich sind. Ihr Erscheinungsbild entspricht dem ursprünglichen Zustand und man kann die vervollständigten Rekonstruktionen nun auch in ih-ren Zusammenhang, beispielsweise eine Fibel als Gewandschließe, stellen.
Damit ergibt sich eine greifbare Nähe auch für das interessierte Publikum.
Neolithischer Kamm (zur Körperpflege oder Webkamm?)
Neolithischer Köcher und Pfeile
14
Mit den Rekonstruktionen erhält man auch Aussagen zu Herstellungsme-thode und zur Verwendbarkeit der Stücke. Ein Bronzeschwert, das in der Zusammensetzung der Originalbron-ze, mit der Hand gegossen und ausge-schmiedet wurde, zeigt die Belastbar-keit und die Führbarkeit dieser Waffe.Damit lassen sich dann letztlich vor-handene Theorien zur Verwendung und Bedeutung der Stücke überprü-fen oder neue Aussagen machen.
Ein Schwert, das sich nur schlecht füh-ren lässt, vielleicht kopflastig ist und am Griff nicht besonders stabil gebaut ist, war dann wohl eher ein Statussym-bol als tatsächlich eine Waffe.
Thomas Trauner
Bau eines bronzezeitlichen Blockhauses mit Bronze-Werkzeug
Neolithischer Feuersteindolch
15
Neolithischer Bohrer mit Hornsteinspitze
Neolithische Erntesichel
Steinzeitlicher Schmuck aus gediegen verarbeitetem Kupfer
Steinzeitlicher Kupferstichel
16
Schon mit Beginn der wissenschaftlichen Archäologie Ende des 19.Jahrhunderts entstanden „Lebensbilder“ aus der Vorgeschichte. Gebäude, Waffen, Werkzeuge und Schmuck wurden rekonstruiert. Mit kompletten Darstellungen versuchte man, den damals lebenden Menschen quasi wieder auferstehen zu lassen.
Diese Rekonstruktionen dienten verschiedenen Zwecken. Zum einen machten sie, wie heute, die Fundstücke begreifbar und vermittelten ein Bild über die in der Vorgeschichte handelnden Menschen. Sie popularisierten die Ergebnisse der Archäologie und weckten damit Interesse an einer Vergangenheit, die keine schriftlichen Zeugnisse hinterließ.
Dieses Interesse für die einheimische Vorgeschichtsforschung war gerade im 19. und Anfang des 20. Jh. wichtig, da sich bis zu dieser Zeit die Geschichtsfor-
schung, orientiert am humanistischen Bildungsideal, auf Hochkulturen der Römer, Griechen, Ägypter
und des Zweistromlandes konzentrierte.
Teilweise ist zum Beispiel unser Bild der Germanen oder Kelten noch
heute von den Eindrücken beeinflusst, die römi-
sche oder griechische Quellen uns vermit-
teln.
Historie der Rekonstruktionen
Urnenfelderzeitlicher Kultgegenstand, ca. 1.000 v. Chr. Rekonstruktion: Reichsbund für Vorgeschichte, 1941
17
Zum zweiten wurden die damals neuen Er-kenntnisse über die europäische Vorgeschichte schon früh zu politischen Aussagen und Vor-stellungen missbraucht.
Die Nationalisierung Europas ab der Mitte des 19. Jh. führte zu letztlich nicht haltbaren Aus-sagen über die territoriale Verbreitung der Nationen. Vorgeschichtliche Kulturen wurden damit „nationalisiert“.
Seitdem gelten bei einem Großteil der Bevöl-kerung auch heute noch Gallier als „Franzosen“, Germanen als „Deutsche“ oder Römer als „Itali-ener“.
UFA Standfoto Natur und Liebe, 1926Plakat zur Aufführung von Grabbes Hermannsschlacht auf der Waldbühne Heessen bei Hamm, 1937
Hallstattzeitlicher Mann, RGZM 1941
18
Die jeweils bekannten Führer wurden als nationale Helden in das nationalisti-sche Pantheon aufgenommen. Cäsar, Vercingetorix oder Arminius standen als Leitfiguren für ein heldisches und aggressives Geschichtsverständnis.
Ein weiterer Einflussfaktor auf das damalige Geschichtsbild war der Kolonialis-mus, der durch seine Entdeckung „primitiver“ Kulturen ein scheinbares Bild der Kulturen der Vorgeschichte lieferte. So dienten die Pfahlbausiedlungen Asiens und der Südsee als Vorbilder für die Rekonstruktionen der Uferrandsiedlungen des Alpenraumes. In vielen Ländern wurde und wird versucht, die Archäolo-gie zu funktionalisieren, den nationalen Gründungsmythos oder die nationale Identität historisch zu belegen.
Übung am Steilgeschütz auf der Saalburg im Taunus, 1910
Bronzezeitliche Beinberge (Beinschmuck), Rekonstruktion: Reichsbund für Vorgeschichte
19
In pervertierter Form haben die Machthaber des sogenannten Dritten Reiches in Deutschland die Vorgeschichtsforschung missbraucht und zur Begründung ihres menschenfeindlichen und rassistischen Menschenbildes herangezogen. Sämtliche Fakten der auf „deutschem Boden“ vorhandenen Vorgeschichte wur-den von den Nazis ins „Germanische“ umgedeutet. Erklärungsmodelle und Bil-der der Vorzeit kamen praktisch ausschließlich aus der sozialdarwinistischen, rassistischen und machtpolitischen Vorstellungswelt der Machthaber.
Dieser Missbrauch führte nach dem Zweiten Weltkrieg zumindest in den beiden deutschen Staaten zu extremer Zurückhaltung bei der Rekonstruktion von vor-geschichtlichen Menschenbildern. Die Menschen wurden hinter ihren Artefakten zurückgedrängt, sie wurden le-diglich zu Trägern ihrer Kulturen. Erst in den späten Achtzigern des vergange-nen Jahrhunderts befreite sich die vorgeschichtliche Archäologie von dieser Zurückhaltung. Vor allem die Neubauten zahlreicher Archäologischer Museen förderten neue Ideen zur Didaktik. Die archäologische Forschung verlangte parallel dazu nach neuen Erklärungsansätzen zur Technik und Verwendung bestimmter Fundgegenstände. Thomas Trauner
Bronzezeitliche Plattenfibel, Rekonstruktion: Reichsbund für Vorgeschichte
Katalog der Universität Erlangen zu Rekonstruktionen des Reichsbundes
20
Trotz der langjährigen Geschichte der Rekonstruktionsarbeit existiert bislang kein einheitliches methodisches Konzept. Es bleibt also die Aufgabe des einzel-nen Rekonstrukteurs, alle vorliegenden Gesichtspunkte und Fakten zu berück-sichtigen, die zur Gestaltung und Verwendung einer Rekonstruktion notwendig sind.
Ausgangspunkt jeder Rekonstruktion sind die vorliegenden Fakten. Dabei han-delt es sich in erster Linie um die Fundstücke. Diese sind mehr oder weniger vollständig erhalten. Sie müssen deshalb ausreichend restauriert sein oder zu-mindest in allen vorhandenen Teilen vorliegen.
Eine zeichnerische Rekonstruktion kann ausreichen, aber nur dann, wenn sich fehlende Teile technisch zwingend und logisch ergänzen lassen, wie zum Bei-spiel bei Keramik. Des Weiteren sollten möglichst sichere Aussagen zu den ver-wendeten Materialen möglich sein.
Funktion, Verwendung und Bedeutung der Fundstücke ergeben sich nur unter Beachtung weiterer Informationen. Mancher Schmuck, manche Waffe lassen sich relativ leicht interpretieren, wenn sie zum Beispiel in der Originallage in einem Körpergrab gefunden und dokumentiert wurden.
Vorgehensweisen in der Erstellung von Rekonstruktionen
Latène - A - Fibel aus der Weiskircher Werkstatt Original und Rekonstruktion
21
Grundriß eines endneolithischen Hauses in Pestenacker (Oberbayern)
Modell 1/25 nach Hausgrundriß Pestenacker
22
Bei vielen Stücken ist das aber nicht der Fall. Hinzugezogen werden deshalb Vergleichs-funde. Sie gleichen dem in Frage stehenden Fund, sind zeitgleich und stammen idealer-weise aus derselben Region. So lässt sich die Form eines aus vergänglichen Materialen ge-fertigten Schwertgriffes erschließen, wenn ein Vergleichsfund mit einem Griff aus Metall vorliegt.
Zusätzlich stehen oft zeitgenössische Abbil-dungen zur Verfügung. So liegen zum Beispiel Menschendarstellungen für praktisch jeden Zeitabschnitt der Vorgeschichte vor, von den Frauenfigurinen der Altsteinzeit bis zu figürli-chen Darstellungen der Kelten.
Diese Abbildungen sollten von der in Frage stehenden Kultur selbst stammen. Darstellun-gen durch andere Kulturen bergen immer die Gefahr, dass schon Interpretationen vorliegen.
Aber auch Darstellungen aus der in Frage stehenden Kultur bedürfen einer vor-sichtigen Interpretation, die unter anderem den Darstellungsstil und den Zweck der Darstellung berücksichtigt. Trotzdem bleiben Lücken.
Geklärt wird, ob eine solche Lücke für die Rekonstruktion geschlossen werden muss oder nicht. In manchen Fällen ist dies nicht unbedingt nötig. Ist das Ziel jedoch zum Beispiel eine komplette Menschendarstellung oder ein funktio-nales Hausmodell, sollten oder müssen die Lücken geschlossen werden. Ließe man alles weg, was nicht direkt durch Funde belegt werden kann, entstünde der Eindruck, diese Details seien damals nicht vorhanden gewesen.
Schwert aus Kemmathen bei Forchheim, Hallstatt C, Original und Rekonstruktion (PStS)
23
Es wäre zum Beispiel unsinnig, für Menschen der Mittelsteinzeit keine Kleidung darzustellen, weil bislang keine eindeutigen Kleidungsres-te dieser Zeit vorliegen. Der gangbarste Weg zur Vervollständigung einer Rekonstruktion ist der Analogieschluss. Hierbei ist bei der Auswahl des Vergleiches Vorsicht geboten. Idealerweise stammt der Vergleich wieder aus derselben Kultur und aus derselben Region. In einigen Fällen lassen biolo-gische oder technische Notwendig-keiten Schlüsse zu. Im Zweifelsfall ist jedoch immer die einfachste Lösung vorzuziehen. Zu vermeiden sind in jedem Falle zusätzliche Theorien, die den Rekonstruktionsvorschlag erst möglich machten. Und zum Schluss: der gesunde Menschen-verstand.
Liegt zum Beispiel nur ein linker Schuh vor, ist der Schluss, dass auch rechte Schuhe getragen wur-den, sehr eingängig.
Andererseits sollte man kein Se-gelflugzeug in der Jungsteinzeit fordern, auch wenn die notwendi-gen Materialien, Leinen, Schnüre, Leim und Holz damals schon be-nutzt wurden.
Thomas Trauner Hallstattzeitliche Dame, Hallstatt D
24
1. Rohstoffe und Fertigungsmethoden
Der wichtigste Schritt zur gelungenen Rekonstruktion eines Artefaktes ist die Auswahl der richtigen Rohstoffe und Herstellungsmethode. Schon kleine Än-derungen in den Werkstoffen oder beim Bearbeiten der Rohstoffe können zu wesentlichen Unterschieden im Erscheinungsbild oder in der Funktion führen. Beispielsweise stehen heute für den Bogenbau bestimmte Hölzer nicht mehr in der damaligen Qualität zur Verfügung, da heute ein anderes Klima herrscht als zum Zeitpunkt der Herstellung des Originals.
Moderne, technisch reine Metallmischungen, wie zum Beispiel für Bronzegüsse notwendig, ergeben unter Umständen Objekte, die belastbarer sind, als es die ursprünglichen Artefakte waren.
Fallstricke der Rekonstruktionsarbeit
Das Hauptproblem bei der Rekonstruktionsarbeit bleibt, dass jede Rekonstruk-tion von heute lebenden Menschen mit heutigen zur Verfügung stehenden Mit-teln erstellt wird. Dies führt zu folgenden Fallstricken:
Linienbandkera-mische Figurine, 5.500 v. Chr.
25
2. Menschenbild des Rekonstrukteurs
Trotz der scheinbar technisch „neu-tral“ herstellbaren Objekte spielt das jeweilige Geschichts- und Men-schenbild des Rekonstrukteurs eine wesentliche Rolle. Nicht jede zu prä-historischen Zeiten optimale Lösung entspricht den heutigen Vorstellun-gen, sie werden heute leicht entwe-der unter- oder überschätzt.
Vor allem dann, wenn Fundstücke nicht vollständig erhalten sind, oder wenn ein offenkundiger Erklärungs-ansatz nicht möglich ist, werden die-se Lücken allzu leicht aus modernem Wissen heraus geschlossen oder, im anderen Extrem, mit unbegründeten Vorstellungen über den angeblichen „Primitivismus“ der damaligen Men-schen gefüllt.
Dies verdanken wir in erster Linie der Fortschrittsgläubigkeit des 19. und 20. Jahrhunderts. Die rasante Technologieentwicklung dieser Zeit verursachte die Vorstellung einer scheinbar zielgerichteten Entwicklung und ständigen Verbes-serung der Technik. Die „Rückrechnung“ dieser Vorstellung verursachte die Idee einer in der Vorgeschichte nur schlecht oder kaum entwickelten Technik, die letztlich nur dem Versuch und Irrtum oder dem Zufall entsprang.
Andererseits führen Artefakte, deren Herstellung uns bislang unklar ist, zur oft heillosen Überschätzung der vorgeschichtlichen Technik und zur Legendenbil-dung in Sachen „geheimes Wissen“. Hinzugezogen werden dabei oft Einflüsse von außen, seien es irgendwelche Wanderbewegungen oder gar außerirdische Einflüsse.
Rekozeichnung Museum Halle Linienbandkeramischer Bauer in der klassischen Pose eines Massai, Kenia
26
3. Analogieschlüsse
Das dritte Problem ist die Auswahl der Vergleiche bei notwendigen Analogie-schlüssen. Diese Auswahl hängt aber wieder stark vom vorhandenen Men-schen- und Geschichtsbild des Rekonstrukteurs ab. Ein klassischer Fallstrick sind hierbei Vergleiche aus dem völkerkundlichen Bereich, die unser Bild über frem-de Kulturen stark prägen.
Wissen wir zum Beispiel, dass in einem bestimmten Zeitab-schnitt die Menschen nicht sess-haft waren und Kleidung aus Leder getragen haben, ist der gedankliche Schritt zu den Prä-riekulturen des 19. Jh. in Nord-amerika verführerisch kurz.
Lebensbild eines Neandertalers
27
Ungefähr seit Mitte der 1990er Jahre beschäftigen sich verschiedene Gruppie-rungen mit der Darstellung der Vorgeschichte. Besonders beliebt ist die Be-schäftigung mit keltischen Themen, jedoch sind seit einigen Jahren auch stein-zeitliche Darstellungen und Darstellungen anderer Zeitabschnitte zu finden.
Die Mehrzahl der Darsteller betreiben ernsthafte Rekonstruktionsarbeit auf Ba-sis der aktuellen Erkenntnisse, wobei es auch Gruppierungen gibt, die eher dem esoterischen Bereich oder schlicht dem eines etwas seltenen Freizeitvergnü-gens ohne wirklich fachlichen Hintergrund zuzurechnen sind.
Darsteller in der Vorgeschichte
Von der Jungsteinzeit bis zu den Römern: Gruppen auf dem Keltenfest der NHG in Landersdorf
Darstellungen der Urnenfelderzeit (späte Bronzezeit)
Darstellungen der Hallstattzeit
Darstellungen der frühen La-Tène-Zeit
28
Die von den Darstellern gefundenen praktischen Lösungen in den Rekonst-ruktionen sind oft verblüffend, da hier ein breites Spektrum an persönlichen Hintergründen und Qualifikationen vorhanden ist. Eine ganze Reihe sehr über-zeugender Lösungen im Detail haben profunde handwerkliche Kenntnisse und Erfahrungen als Basis, die den doch eher theoretischen Ansatz der Fachwissen-schaft perfekt ergänzen.
Eine tatsächliche Verknüpfung der Ansätze findet jedoch nur im Ausnahmefall statt. Die Darsteller verfügen in den seltensten Fällen über eine Dokumentati-onsmethodik, der Wissenschaftsbetrieb steht ihnen nicht nur deshalb häufig skeptisch gegenüber. Durch den mangelnden fachlichen Kontakt geht jedoch Wissen auf beiden Seiten verloren bzw. muss oft wiederholt neu aufgebaut werden. Ein von beiden Seiten anerkanntes Publikationsorgan ist noch nicht gefunden. Der große Vorteil liegt jedoch deutlich in der populären, leicht verständlichen Form der Auseinandersetzung mit der Vorge-schichte und dem Schaffen konkreter Lebensbilder. Nicht um-sonst nennt sich diese Form der Geschichtsvermittlung im englischen Sprachraum „Living History“, ein entsprechender deutscher Begriff hat sich noch nicht gefunden.
Eine gewisse Gefahr besteht in der Vermittlung festgefüg-ter Bilder, die unkommentiert bleiben, insbesondere dann, wenn die Darstellungen sich ausschließlich gegenseitig befruchten, ohne jeweils die Quellen qualifiziert und kritisch zu Rate zu ziehen. Hans Trauner
Keltische Darsteller auf dem Keltenfest im Vorgeschichts-museum Kelheim
Urnenfelderzeitliche Darstellung
29
Seit Mitte der 1960er Jahre verfügt die NHG über Funde, die aus einer Sand-grube bei Weißenbrunn (Gemeinde Leinburg) stammen. Die Bergungs-umstände waren nicht optimal, die Funde sind teilweise nur fragmenta-risch erhalten.
Die Funde ermöglichen eine Ver-gleichsdatierung: Es handelt sich um das Grab eines Mannes, der in der Periode „La-Tène A“, also um 450 v.Chr. beerdigt wurde. Die Funde umfassen die Reste ei-ner Fibel des Certosa-Typs, eines kästchenförmigen Gürtelverschlusses, zweier Eisenringe sowie eines völlig verrosteten und in eine Vielzahl kleiner und kleins-ter Einzelteile zerbrochenen Schwertes und dessen eiserner Scheide.
Rekonstruktion der Funde
Am einfachsten gestaltete sich die Rekonstruktion des Gürtelverschlusses sowie der eisernen Ringe. Sie waren am wenigsten fragmentiert und konnten so als unmittelbare Vorbilder für die nachgeschmiedeten Repliken dienen. Die Trage-weise der Ringe am Gürtel ergibt sich aus einer Vielzahl von Vergleichsfunden, die das Schema von (mindestens) zwei Ringen am Gürtel zeigen.
Rekonstruktion einer keltischen Ausstattung
Latènezeitlicher Gürtelhaken und Gürtelringe im Original
Darstellung auf einer Schwertscheide aus Hallstatt
30
Die Fibel ist nur teilweise erhalten, der Fibeltyp jedoch anhand des Bruchstücks eindeutig dem Typ Certosa, ei-nem klassischen Fibeltyp dieser Zeit, zuzuordnen. Für die Rekonstruktion wurde deshalb ein vollständiges Originalexemplar dieses Typs aus dem Bestand des Museums abgeformt und in Bronze nachgegossen.
Das eiserne Schwert steckte bei der Beerdigung in einer Scheide aus Eisenblech. Das Eisen ist völlig durchoxidiert, die Objekte sind in mehrere Hundert Einzelteile zerfallen. Die formgebenden Abschnitte wie Ortband (unterer Scheidenabschluss), Ösenbe-schlag für den Trageriemen und Befestigungsnieten konnten jedoch identifiziert werden.
Die Maße des Schwertes ergeben sich aus Vergleichs-funden, Schwerter dieser Zeitstellung schwanken in der Gesamtlänge um die 60 cm, sind also relativ kurz.
Original des Ösenbeschlags undVergleichsfund eines Schwertes vom Dürrnberg
Latenezeitlicher Tonschieferkopf von Msecké Zehrovics Frühlatenezeitlicher Mann
31
Rekonstruktion der Bekleidung
Für diesen Zeitabschnitt verfü-gen wir erstmals über bildliche Darstellungen, die durch die Kel-ten selbst angefertigt wurden.
• Rock: Grundlage des Schnittes der Oberbekleidung sind Darstellungen, die Männer in Jacken mit langen Rockschössen zeigen. Solche Darstellungen fin-den sich auf einer Schwertscheide, die im Gräberfeld in Hallstatt zu Tage kam, einer Figurenfibel vom Dürrnberg (beides Salzburger Land) sowie einer Figurine aus Südtirol. Letztere trägt getrennte doppelte Rockschösse, die sich auch auf Darstellungen auf sog. Situlen (Bronzegefässe) wiederfinden.
• Hose: Erstmals in der Geschichte der mitteleuropäischen Bekleidung treten zu dieser Zeit Hosen auf. Grundlage der Rekonstruktion sind wiederum die Dar-stellungen der Schwertscheide sowie der Figurenfibel. Der genaue Schnitt ist unbekannt, klar ist lediglich, dass Beine und Unterkörper bedeckt sind.
• Schuhe: Ebenfalls vom Dürrnberg bei Hal-lein stammen eine ganze Reihe von Fibeln, die Schuhe darstellen und als Vorbild für die Replik dienen. Die genaue Konstruktion ist nicht bekannt, jedoch haben praktische Trageversuche eine hohe Funktionalität er-geben.
• Stoffe: Aus den Salzbergwerken in Hallstatt und vom Dürrnberg stammt eine erhebliche Anzahl von Geweberesten, die einen Rückschluss auf Material, Webart und Färbung ermöglichen. Im Gegensatz zum populären Bild des Kelten in karierter Kleidung weisen diese Gewebereste eher auf Stoffe mit Streifenmus-ter oder ungemusteter Machart hin. Hans Trauner
Figurenfibel Dürrnberg Votivfigur Südtirol
Schuhfibel vom Dürrnberg
32
Soll ein Keramikgefäß rekonstruiert werden, gibt es einige Punkte zu beachten:
Form und Größe festlegen:
Liegt das Stück in Fragmenten vor, wird das Muster oder die Form zeichnerisch rekonstruiert. Bei praktisch allen vorgeschichtliche Kulturen lassen sich durch-gängig Normierungen und Typisierungen in den Keramikformen feststellen. Es genügt manchmal eine einzelne Scherbe vom Rand oder Boden eines Gefäßes, um die ursprüngliche Form zu erschließen. Der individuelle Durchmesser des Gefäßes ergibt sich meist nach den geometrischen Regeln, die Höhe entweder nach Vergleichsfunden oder nach Anzahl und Beschaffenheit der vorliegenden Scherben.
Rekonstruktion von Keramikgefäßen
Topf-Varianten
Topf-Maße
33
Zeichnung Tellermaße
Die Tonfarbe:
Die mineralischen oder metallischen Zusätze, denen der Ton durch seine na-türlichen Lagerstätte ausgesetzt war, bestimmt seine Endfarbe (z.B.: viel Eisen = roter Ton). Das Farbspektrum der gefundenen Tone reicht deshalb von Gelb über Ocker, zu Braun bis Rot.
Zollernalbkreis Teller, Hallstattzeit: Fundzeichnung mit Maßen und Rekonstruktion
Landesmuseum Württemberg, Stuttgart; Foto Thomas Hoppe
Jettingen Teller
Zeichnerische Rekonstruktion
Rekonstruktion in Bearbeitung
34
Die Tonbeschaffenheit:Frisch abgebauter Lehm braucht Zusätze, eine sogenannte Magerung, damit er beim Brennen nicht reißt. Diese Magerung erkennt man an den Bruchstellen der Scherben. Möglich sind z.B. Sand oder andere mineralische Stoffe, aber auch organisches Material.
Töpfern: Da die schnelllaufende Töpferscheibe in Mitteleuropa erst ab ca. 500 v.Chr. ver-wendet wurde, werden viele Stücke in Aufbautechnik hergestellt. Das Gefäß kann entweder in der Plattentechnik oder der Spiraltechnik zusammengesetzt werden, oder aus einem Stück Ton ausgetrieben sein. Oft lässt sich anhand der vorliegenden Scherben die genauere Technik feststellen.
Oberflächenbearbeitung:Es können Teile grob geglättet, angeraut oder poliert worden sein. Muster wur-den eingeritzt, eingedrückt, gestempelt oder herausgeschnitten.. Die Bemalung wurde mit Engoben (dünn geschlämmter, mit Mineralien oder Metallen gefärb-ter Ton) vor dem Brand auf die lederharte Keramik aufgetragen. Ab der Späten Bronzezeit wurde auch Grafit eingesetzt, der poliert einen silber-metallischer Glanz ergibt. Diese Grafitierung hatte nicht nur optische Gründe. Durch den Grafit verteilt sich die an der Keramik beim Kochen anliegende Temperatur gleichmäßig über das Stück und verhindert damit Bruch oder Abplatzungen. Eingedrückte Muster wurden oft nach dem Brand mit Kalk ausgeschlämmt (Inkrustation).
Die Brennmethoden:Der Brand ist notwendig, um den Ton bruchfester und wasserbeständig zu ma-chen. Ist das getöpferte Stück staubtrocken, wird es möglichst langsam auf min-destens 800 Grad Celsius erhitzt. Die Dauer des Brennvorganges hängt vom gewünschten Ergebnis und von der Größe der Gefäße ab. Zwei verschiedene Töpferöfen konnten bislang nachgewiesen werden.
35
Der Gruben- oder Feldbrand:
In den Boden wird eine Grube gegra-ben. Dort hinein stapelt man Keramik und Holz. Das Ganze wird von oben entzündet und brennt langsam her-unter.
Hier hat die Keramik viele Schmauch- und Feuerspuren und ist fleckig bis gänz-lich schwarz, je nachdem wie viel Holzkohle beim Brand entstanden ist.
Wird der Brand am Schluss mit Erde zugedeckt und einige Zeit stehen gelassen, gelingt eine durchgängig schwarze Färbung. Die Brenntemperatur wurde wohl über die Farbe des Brenngutes eingeschätzt.
Der Lehmofen mit kuppelförmigem Gewölbe:Hier steigen die heißen Brenngase über einen durchlöcherten Boden (Lochten-ne) um die zu brennende Keramik herum und durch ein Loch in der Decke hin-aus. Hier wird von unten geheizt. Die Keramik hat wenig Schmauch- und Feuer-spuren. Hier erfolgt die Beobachtung der Brenntemperatur über die Form und Farbe des „Fuchses“, das sind die Abgase an der Lüftungsöffnung.
Bettina Kocak
Brennmethoden Lehmofen und Lochtenne
Randscherben Hallstattzeit Bodenscherbe Hallstattzeit
36
In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhun-derts wurden in französischen Höhlen mehrere mit Haken versehene Ge-weihgegenstände ausgegraben. Ihre Funktion konnte zu diesem Zeitpunkt noch nicht geklärt werden.
Einem irischen Forscher gelang es 1864, diese Geräte richtig zu interpre-tieren, ein Vergleich mit australischen Speerschleudern hatte ihn auf den richtigen Gedanken gebracht. Offen-sichtlich verfügten die eiszeitlichen Menschen bereits über ein derart aus-geklügeltes Jagdgerät.
Pfeil und Bogen waren also nicht die erste Fernwaffe in der Geschichte.
Sicher nachweisen lassen sich Speerschleudern nur anhand der gefundenen Hakenenden aus Geweih. Denkbar ist, dass es Vorläufer gegeben hat, die aus-schließlich aus Holz bestanden – ein Material, das sich jedoch im Boden sehr schlecht erhält.
Die Hochzeit der Speerschleuder liegt zwischen 14 500 und 12 500 B. P., die letz-ten Exemplare gab es um 11 500 B. P. Die europäischen Funde stammen über-wiegend aus Frankreich, aber auch aus der Schweiz und aus Deutschland.
Eine Speerschleuder besteht aus einem Haken aus Geweih und einem ver-mutlich hölzernen Schaft. Die Schleuder dient beim Werfen als Hebelarm-verlängerung. Dadurch können die Speere wesentlich weiter und mit großer Durchschlagskraft geworfen werden. Unsere Nachbauten sind allerdings Ideal-rekonstruktionen.
Die Speerschleuder Von der Steinzeitwaffe
zum modernen Sportgerät
Fundzeichnung des Originals und Rekonstruktion der Jungpaläolithischen Speerschleuder Grotte du Mas d’Azil, Dép. Ariège, Frankreich
37
Es wird sich wahrscheinlich nie ganz klären lassen, wie eine jungpaläolithische Schleuder ausgesehen hat, da es bisher nicht gelungen ist, ein Exemplar voll-ständig zu bergen. Die ethnographischen Belege für solche Jagdgeräte bei Völ-kern, die sie bis vor kurzem noch in Gebrauch hatten wie z.B. die Inuit (Eskimos) oder die australischen Aboriginies, unterscheiden sich im Aussehen sehr stark, abhängig von der Umgebung und dem Verwendungszweck.
Australische „Woomeras“ sind oft über einen Meter lang, die dazugehörigen Speere messen bis zu vier Meter – eine Ausrüstung, die für einen Arktisbewoh-ner, der vom Kajak aus Meersäuger jagt, völlig unbrauchbar wäre. Die Origi-nal-Hakenenden sind teils sehr schlicht und rein funktional gehalten, teils aber wunderschön figürlich geschnitzt, wobei überwiegend Pferde, Vögel und Stein-böcke dargestellt sind. Als Rohmaterial verwendete man fast ausnahmslos Rentiergeweih, ein Werk-stoff, der hart und elastisch ist, sich gut bearbeiten lässt und aufgrund seines Formenreichtums sehr gut geeignet ist. Zudem ist Rentiergeweih im Jungpa-läolithikum in schier unbegrenzten Mengen vorhanden – entweder als Teil der Jagdbeute oder jeweils als Abwurfstange.
Bewegungsablauf Impression eines Speerschleuderwett-bewerbes
38
Für das Ende, also den Funktionsbereich, an dem der Speer in die Schleuder ge-steckt wird, gibt es mindestens drei Möglichkeiten: zum Beispiel Hakenschleu-dern, Haken-Mulden-Schleudern oder Muldenschleudern.
Auch für die Gestaltung der Basis, d. h. die Verbindungsstelle zwischen Hake-nende und hölzernen Schaft, liegen verschiedene Formen vor. Entweder wurde die Basis ein- oder mehrfach mit einem Loch versehen, in eine Nut am Schaften-de eingeschoben und mit Bindematerial wie Sehnen, Pflanzenfasern oder Roh-haut aufgebunden oder aber ein- bzw. beidseitig abgeschrägt und mit einem Kleber aus Harz und Wachs am Schaftende eingeklebt.
Die Verbindung wurde evtl. mit Holz- oder Knochenstiften gesichert und zu-sätzlich durch eine Faserwicklung verstärkt. Ende der 1980er Jahre erlebte die Speerschleuder eine kleine „Renaissance“, als ein Kreis von Kölner Urgeschichts-studenten um den Prähistoriker Ulrich Stodiek steinzeitliche Speerschleudern nachbaute und damit einen Wettkampf inszenierte.
Seither hat diese Jagdwaffe viele Menschen in ihren Bann gezogen, mittlerweile kann man von März bis Oktober quer durch Europa fahren und jedes Wochenende an einem international besetzten Speerschleudertur-nier teilnehmen. Jährlich werden Europameisterschaften aus-getragen, es gibt sogar eine Weltrangliste. Der Weitwurfre-kord liegt bei über 180 Metern, die Trefferquote von gut Trainierten ist bei 15 bis 25 Metern erstaunlich hoch. Wulf Hein
Speerschleuder
39
In älteren Büchern und Filmen über die Eiszeit begeg-nen sie uns immer wieder: behaarte wilde Männer, die mit nichts weiter als einem knappen Schurz aus Leo-pardenfell bekleidet im Tiefschnee Mammute jagen. Bestenfalls sind die Steinzeitjäger in einen unordent-lichen Haufen Felle gehüllt und sehen aus wie Zottel-schrate, ihrer Beute ähnlicher als menschlichen Wesen.
Tatsächlich ist man jedoch mit einem Fellröckchen bei Minustemperaturen – gelinde gesagt – unpassend gekleidet, und wenn einem beim Jagen die Fellfetzen um Arme und Beine flattern, dürfte das eher hinderlich gewesen sein. Wie aber haben sich unsere altsteinzeit-lichen Vorfahren wirklich angezogen?
EiszeitkleidungLendenschurz und Flatterfell –
was trug der Rentierjäger wirklich?
Zur Herstellung verwendetes Werkzeug
Nadel und Ahle aus Beinknochen
Steinwerkzeug zum Schneiden von Leder
Paläolithischer Befund aus Sungir, Russland
40
Leider sind paläolithische Hosen und Jacken bisher nicht gefunden worden. Deshalb ist die Archäologie bei der Rekonstruktion von Kleidungsstücken auf Interpretationen, Analogieschlüsse und theoretische Annahmen angewiesen, Verfahren, die große Unsicherheiten beinhalten und keine wirklich belastbaren Fakten liefern können, aber zumindest eine modellhafte Annäherung an die da-malige Realität erlauben.
Um Kleidung herzustellen, benötigt man Tierhäute, die bei der Jagd anfielen. Wahrscheinlich wurden auch schon Pflanzenfasern und Tierhaare zu Geflechten und Geweben verarbeitet, aber es fehlen die Belege. Das Gerben von Leder war wohl schon zu Zeiten des Neandertalers üblich, dafür sprechen Anhaftungen von Eichenrindensud an Feuersteinschabern, mit denen man die Häute von Fett- und Fleischresten befreite und Gerbstoffe einarbeitete. Neben den vegeta-bilen Gerbungen mit Pflanzenextrakten dürften auch allen anderen heute noch gebräuchlichen Methoden wie das Gerben mit Tran, Hirn, Rauch oder Fett zur Anwendung gekommen sein. Die fertig gegerbten Häute wurden anschließend mit Feuersteinmessern zugeschnitten.
Die ältesten erhaltenen und als solche zweifelsfrei erkennbaren Kleidungsstü-cke stammen aus den Alpen und gehören in die ausgehende Jungsteinzeit des vierten Jahrtausend v.d.Z. „Ötzi“ und seine Kollegen trugen grasgefütterte Fell-schuhe mit Innengeflecht, Beinlinge mit Strapsen und Fellmäntel und -mützen. Diese „Mode“ kann aber nur als Anhaltspunkt dienen, denn die Rentierjäger lebten über 10.000 Jahre vorher. Die eiszeitlichen Höhlenmalereien scheiden als Quelle aus, denn Menschendarstellungen sind äußerst selten, Kleidung wird gar nicht abgebildet. Lediglich eine Kinderhand, in Sprühtechnik in einer süd-französischen Höhle abgebildet, erlaubt die Vermutung, dass der zugehörige Arm in einem Ärmel steckte. Auch die zahlreichen Frauenstatuetten, die ab ca. 35.000 v.d.Z. in Fundmaterial auftauchen, geben nur sehr spärliche Hinweise auf Kleidung.
41
Zuschnitt des Rentierleders mit Steinwerkzeug
Vernähen der Nahtlöcher mit Sehne und Knochennadel
Vorstechen der Nahtlöcher mit Knochenahle
Der Faden wurde aus gezwirnten Tiersehnen oder Darm hergestellt
42
Einige durchlochte Perlen aus Elfenbein und Geweih werden als Knöpfe oder Knebel angesprochen, bei der viel zitierten Bestattung von Sungir in Russland (ca. 23.000 v.d.Z.) fand man mehr als 5.000 Elfenbeinperlen, die in ihrer Position im Grab liegen blieben, während die weichen organischen Materialien verrot-teten. Mit etwas Sachverstand und Phantasie kann man damit den ungefähren Schnitt der Kleidung nachvollziehen. Zur Orientierung wird oft die Kleidung der Inuit herangezogen, denn ihre Kleidung ist perfekt an eisiges Klima angepasst.
Einen indirekten, aber umso sichereren Beweis für genähte Kleidung geben uns die zahllosen Nähnadeln, die ab etwa 20.000 zum Inventar der Fundplät-ze gehören. Sie wurden aus Beinknochen verschiedener Tiere hergestellt und sind teilweise extrem fein gearbeitet. Um damit dickes Leder nähen zu können, müssen die Löcher jedoch mit einer Ahle vorgestochen werden, die Nadel dient dann nur zum Durchführen des Fadens. Dieser wurde aus gezwirnten Tierseh-nen oder Darm hergestellt, nass vernäht zieht er sich beim Trocknen zusammen und sorgt so für dichte haltbare Nähte.
Doch auch ohne Nadel kann man Felle miteinander vernähen, indem man mit einer Ahle (Pfriem) Löcher vorsticht und dann einen Lederstreifen oder Sehnen-faden durch die Löcher durchpfriemelt. Der Neandertaler wird sich also auch ohne Knochennadel halbwegs eng anliegende Kleidung angefertigt haben, denn ohne einen zweckmäßigen Kälteschutz kann ein menschliches Wesen in nördlichen Breiten nicht überleben. Wulf Hein
43
Bei der Herstellung des Untergewandes und der Beinlinge des in der Ausstellung gezeigten Eiszeitjägers wurde wie folgt vorgegangen:
1. Verwendete Materialien und Gerbung:
Hauptmaterial: Ungespaltenes Hirsch-leder. Hirsche oder Hirschartige Tiere sind während der letzten Eiszeit nachweisbar. Gerbeart: Hirngerbung. Dabei wird das Leder mehrmals mit dem Gehirn des Tieres eingerieben. Um den Gerbe- prozess abzuschließen, wird das Leder über offenem Feuer geräuchert, dabei verschließen sich die Poren der Haut, es wird dadurch gegen Bakterieneinschlüsse unempfind-lich. Damit findet keine Zersetzung des Materials mehr statt.
Der Vorteil dieser Gerbeart ist auch, dass sich nur wenige Gerbstoffe im Leder einlagern, das Leder dadurch leichter bleibt.Nähgarn: Als Nähgarn wurden Hirsch- und Rehsehnen verwendet, die extrem stabil und dennoch geschmeidig genug sind, damit sie zum Verschluss und Verbinden der Nähkanten eingesetzt werden können. Sie kommen der Beständigkeit des Hauptmaterials sehr nahe.
Lederkleidung eines eiszeitlichen Jägers
44
2. Verarbeitung und Schnittform:
Es ist davon auszugehen, dass die Nähtechnik auch bereits in der Altsteinzeit sehr ordentlich und ausgeprägt präzise war. Die alltäglichen Anforderungen an die Kleidungsstücke machen eine Nahtführung notwendig, die haltbar und wit-terungsbeständig ausgeführt wurde. Deshalb ist auch von einigen nach innen gerichtet Nahteinschlägen auszugehen.
Die Schnittführung wurde relativ einfach gehalten. Die überwiegend möglichst gerade verlaufenden Schnittkanten lassen eine ausgesprochen gute Verwer-tung des Materials zu.Unterstützt wird diese Annahme auch durch Funde an eiszeitlichen Bestattun-gen, bei denen Schmuck in Form von Knochenperlen geradlinig an den Säumen der (vergangenen) Kleidungsstücken festgestellt wurden. Randstücke (Bauchstücke des Wildes) die in der Regel dünner ausfallen, wurden für Schnürungen (Beinabschluss, Ärmelabschluss, Verschluss des Halsteils oder als Teile für die Schrittabdeckung) verwendet.Somit war eine nahezu 100%-Verwertung des zur Verfügung stehenden Mate-rials gewährleistet.
3. Farbe:
Der Kittel wurde im Schulterbereich mit einer Ocker/Fettmischung eingefärbt. In eiszeitlichen Fundstellen ist Ocker ein relativ häufiges Fundmaterial. Die Einfärbung bietet einen zusätzlichen Wetterschutz für den Schulterbereich. Außerdem kommt sicher noch ein Verzierungseffekt hinzu. Die Einfärbung ist jedoch nur ein Vorschlag, konkrete Muster oder Farbtöne liegen archäologisch nicht vor. Wulf Hein
45
In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts kam in Europa der Nationalstaatsgedanke auf. Er verlang-te, dass dem Nationalstaat alle Angehörigen seines Volkes und nur diese angehörten. So wurde nach einer Einheit stiftenden Identität gesucht. Man fand in Italien mit den „Römern“, in Frankreich mit den „Kelten“ und in Deutschland mit den „Ger-manen“ Vorfahren, die als Ahnenvolk herhalten konnten. Bereits 1875, also kurz nach der Gründung des Deutschen Kaiserreichs und dem Sieg über Frankreich, wurde das Hermannsdenkmal errichtet.
Es erinnert an die Schlacht im „Teutoburger Wald“ 9 nach Chr. Motive aus dieser „glorreichen Zeit der Alten Teutschen“ fanden Eingang in die volkstüm-liche Literatur, das Liedgut und auf Abbildungen in den unterschiedlichsten Druckmedien.
Rekonstruktionen außerhalb der
wissenschaftlichen Welt
Theaterszene mit Germanen-Darstellern, ca. 1925
Französische Spielzeugfigur eines Galliers
46
Die germanische Kultur wurde sowohl im Kaiserreich als auch in der Zeit des Nationalsozialismus zu Propaganda-zwecken missbraucht. Daneben gab es aber auch durchaus ernsthafte Be-strebungen, Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen die deutsche Vor- und Frühgeschichte nahe zu bringen. Hier sind vor allem Zinnfiguren-Diora-men, Sammelbilderalben, Schulwand-tafeln sowie detailreich ausgeführte Gipsmodelle von Waffen, Werkzeugen und Schmuckgegenständen zu nen-nen.
Dagegen zeigen Abbildungen von „Germanen“ auf Ansichtskarten und Sammelbildern der Jahre 1880 bis zum 1. Weltkrieg meist Mischausstat-tungen von der Jungsteinzeit über die Bronzezeit bis zur Eisenzeit.
Die Bewaffnung der Männer zeigt Holzkeulen, Steinbeile, Bronzeschwer-ter und Antennendolche gelegentlich in der gleichen Szene.
Postkarte aus „Grosser Zeit“ 1914
Spielzeugfiguren einer Australopithicus-Familie
47
Ähnlich verhält es sich mit der Schmuckausstattung. Arm- und Beinbergen, Na-del- und Fibelschmuck, Amulettanhänger, Bronzescheiben umfassen oft einen Zeitrahmen von der Bronzezeit bis in die römische Kaiserzeit.
Die Männerbekleidung erschöpft sich manchmal im obligatorischen Bärenfell. Dazu trägt der Germane gern ein Kollier von Eberhauern oder Bärenkrallen. Ge-flügelte Helme dürfen ebenso wenig fehlen wie riesige Trinkhörnen und Luren als Blasinstrumente.
Frauen tragen meist ein schulterfreies, über der Brust gerafftes Kleid. Kinder sind entweder nackt oder mit etwas Hemdartigen bekleidet. Zu feierlichen Handlun-gen gehört ein weißhaariger, weiß gekleideter alter Mann mit Harfe. Hier hat man wohl Anleihen bei keltischen Druiden oder Barden genommen. Bei manchen Abbildungen verschwimmen die Grenzen zwischen ernsthaft ge-meinter Darstellung und Karikatur. Eindeutig letztere ist eine Postkartenserie des damals sehr populären Malers A. Thiele zur Varusschlacht.
Postkarte „Heimkehrende Germanen“, ca. 1920
48
Abgesehen von Zinnfiguren, ist Spielzeug mit vorgeschichtlichen Motiven aus der Zeit vor dem 2. Weltkrieg aus Deutschland nicht bekannt. Während Solda-ten, Tiere, Ritter, Cowboys und Indianer schon um 1900 aus einer speziellen Mo-delliermasse mit Drahtgerüst gepresst und dann bemalt wurden, sind Römer, Germanen, Franken, Hunnen und Wikinger aus Hartplastik erst ab ca. 1960 in die Spielzeugläden gekommen.
Heute ergänzen Neandertaler, Mammut, Säbelzahlkatze und Saurier das Figu-renspektrum – gelegentlich auch in einer 100 Millionen Jahre überbrückenden Zusammenstellung. Die Filmindustrie hat vorgeschichtliche, römische und frühgeschichtliche Themen gern in sogenannten „Sandalenfilmen“ wie Sparta-kus, Ben Hur, Kampf um Rom oder jüngst Troja und Alexander aufgegriffen.
Je nach Anspruch des Regisseurs und der Größe des Budgets wird mehr oder weniger auf Authenzität geachtet. Hier steht die Unterhaltung der
Zuschauer und der kommerzielle Erfolg im Vordergrund. Da darf man dann schon mal darüber hinwegsehen, dass auch in einem
so brillanten Film wie Ice Age wissenschaftlich nicht alles mit rechten Dingen zugeht.
Thomas Trauner
Spielfiguren von Playmobil
49
Zusammenfassung und Ausblick
Die Rekonstruktionsarbeit wird auch in Zu-kunft weiter eine wichtige Rolle in der Ar-chäologie spielen. Die Archäologie und die Museumsarbeit werden publikumswirksame und eingängige Darstellungsmethoden brau-chen, um auf ihre Ergebnisse und Belange hinzuweisen. Ebenso wird sich die Archäolo-gie zunehmend mit technischen Detailfragen, Verwendungsmöglichkeiten der Artefakte und wissenschaftlichen Experimenten be-schäftigten, um die geistes-wissenschaftlichen Aussagen zu untermauern.
Die zukünftige Entwicklung der archäologi-schen Forschungsmethoden werden mehr De-tails vorlegen können. Ebenso wird die Zusam-menarbeit mit den Nachbarwissenschaften der Archäologie zusätzliche Informationen liefern.
Drei Beispiele für die zukünftigen Entwicklun-gen seien stellvertretend genannt:
1. Die Rekonstruktion der individuellen Erscheinung eines Menschen der Vorgeschichte gelingt aufgrund der Forschungen aus der Kriminalistik und rekonst-ruierenden Medizintechnik immer besser. Gesichter lassen sich aufgrund der Schädelreste mittlerweile recht zuverlässig wiederherstellen.
Gesichtsrekonstruktion eines spätkeltischen Mannes, 1. Jh. n. Chr. , EnglandSpielfiguren von Playmobil
Gesichtsrekonstruktion eines mykenischen Mannes
50
2. Rekonstruktionen von Baustrukturen, einzelnen Gebäuden, ganzen Siedlun-gen oder Stadtteilen gelingen mit moderner Computertechnik schlüssig und logisch. Benutzt werden mittlerweile handelsübliche „Computer Aided Design“-Programme (CAD) aus dem Bereich der modernen Architekturtechnik oder Gra-phik.
3. Die Probengrößen, die zur Analyse verwendeter Werkstoffe gebraucht wer-den, werden immer kleiner. Damit sind solche Analysen preiswerter und auch dann möglich, wenn das Artefakt möglichst nicht beeinträchtig werden soll. Zum Teil sind auch jetzt schon zerstörungsfreie Analysen möglich.
Computergrafik: Tempel der Fortuna Augusta, Pompeji, 1. Jh. n. Chr.
51
In Zukunft werden Rekonstruktionen vorliegen, die auf sichereren Fakten und Details beruhen. Diese werden natürlich auch immer vom jeweiligen Zeitgeist beeinflusst bleiben.
Und zum Schluss:
Das Wissen über unsere schriftlose Vergangenheit nimmt im Moment laufend zu. Aber nur dann, wenn auch in Zukunft Interesse am realen Menschen der Vergangenheit bewahrt bleibt. Thomas Trauner
Computergrafik eines Warmwasserbades, Pompeji, 1. Jh. n. Chr.
52
Literatur- und Abbildungsnachweis
Die neue ArchäologieM. Forte et. al., Bergisch-Gladbach 1996
Mit dem Pfeil, dem BogenArchäologische Mitteilungen aus Nordwestdeutschland, Beiheft 16U.Stodiek et. al., Oldenburg 1996
Varusschlacht MythosAusstellungskatalog 2000 Jahre VarusschlachtDr. St. Berke et. al., Stuttgart 2009
Die KeltenDruiden. Fürsten. KriegerM.M. Grewenig et. al. ohne Ort, 2010
Das Archäologische Jahr in Bayern 1991Dr. I. von Quillfeld et. al. Stuttgart 1992
Der Mann aus dem EisA. Fleckinger et. al. Bozen 1998
Lebenswandel Früh- und MittelneolithikumDr. H. Meller, Halle 2008
Die BandkeramikerJ. Lüning et. al. Rahden, 2005
Das EU-Projekt Archaeolive und das archäolgische Erbe von HallstattDr. F.E. Barth et. al. Wien 2002
Mykene – Nürnberg - StonehengeBegleitbuch zur Ausstellung 2000/2001Dr. B. Mühldorfer et. al. Fürth 2000
Making Faces: Using Forensic and Archaeological Evidence John Prag et. al. Texas 1997
Weitere Abbildungen: Sammlung Norbert Graf Wulf Hein Hans Trauner NHG Bettina Kocak
53
Wir danken den Leihgebern
Archäologisches Museum der Stadt Kelheim
Institut für Ur- und Frühgeschichte Erlangen
Norbert Graf
Wulf Hein, www.archaeo-technik.de
Bettina Kocak, www.goldgrubenkeramik.de
Knut Starringer
Hans Trauner
Thomas Trauner