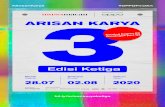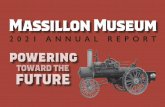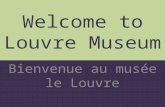jahresbericht 2019 - Museum Rietberg
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of jahresbericht 2019 - Museum Rietberg
Das Museum Rietberg ist eine Dienstabteilung des Präsidialdepartements der Stadt Zürich.
Der Druck dieses Jahresberichts wird finanziert durch die Rietberg-Gesellschaft.
Impressum
Titelbild
Folio aus dem Palam Bhagavata Purana
Indien, Delhi / Agra, 16. Jh.
Geschenk Sammlung Eva und Konrad Seitz
Museum Rietberg Zürich
Kürzel der Autorinnen und Autoren
BeJ Johannes Beltz
DeL Elena DelCarlo
FaL Laura Falletta
FiE Eberhard Fischer
FuP Peter Fux
GuN Nanina Guyer
HoT Tobias Hotz
HuJ Josef Huber
KrP Patrick Krüger
LaA Axel Langer
LuA Albert Lutz
ObM Michaela Oberhofer
PrA Alexandra von Przychowski
ReE Eva von Reumont
ScD Daniel Schneiter
Son Anja Soldat
SpC Caroline Spicker
SuA Alain Suter
TiE Esther Tisa Francini
TrK Khanh Trinh
WiC Caroline Widmer
VuR Rosine Vuille
Fotos
Alle Fotos von Rainer Wolfsberger; ausser:
S. 17, 106 Kathrin Schulthess
S. 21 Matthias Willi
S. 90 Véronique Hoegger
S. 104 Alain Suter
S. 107 oben, unten links Caroline Minjolle
S. 109 Thomas Cugini
S. 112 Anoop Sharma
S. 113 Umesh Kumar
S. 115 Bilal Masood Qureshi
S. 116 Martin Ledergerber
S. 117 Michaela Oberhofer
S. 120, 123 N’Guessan Clautaire Kouadio
S. 121, 126 Anja Soldat
S. 133 Mark Niedermann
Projektkoordination und Bildredaktion
Annette Bhagwati, Elena DelCarlo, Mark Welzel
Korrektorat
Gorica Jakovljevic
Gestaltung und Produktion
Karin Engler, Windisch
Satz
Claudia Rossi, Winterthur
Fotolithos
Albert Walker, Walker dtp. Winterthur
Druck
Koprint, Alpnach Dorf
Herausgeber
Museum Rietberg Zürich
Gablerstrasse 15, CH-8002 Zürich
T. 044 415 31 31, F. 044 415 31 32
www.rietberg.ch
3
Liebe Freundinnen und Freunde des Museums Rietberg
Am 1. November habe ich mein Amt angetreten. Als neue Direktorin des Museums Rietberg ist es mir eine grosse Freude, dem Jahresrückblick von Albert Lutz einige einleitende Worte voranstellen zu dürfen.
Bereits in den ersten Tagen lernte ich einen lebendigen, spannenden und vielfältigen Museumsalltag kennen, der das Rietberg auszeichnet und Kunstinte-ressierte wie Fachleute gleichermassen begeistert. Die Ausstellung «Surimono» stellte gedruckte Gedichtblätter aus der Schenkung Gisela Müller und Erich Gross vor; in den poetischen Bildern vereinen sich Haiku-Verse mit phantasiereichen Motiven der Shijo-Maltradition. Die enge Verbindung von Literatur und Bild war auch Thema der Ausstellung «Gitagovinda», in der einige der schönsten Miniatur-malereien der Künstler in Guler von der berühmten Liebesgeschichte zwischen dem Hirtenmädchen Radha und Gott Krishna erzählen.
Ein Höhepunkt war die Ausstellung «Fiktion Kongo – Kunstwelten zwischen Geschichte und Gegenwart», die ich am 21. November gemeinsam mit der Stadt-präsidentin Corine Mauch und dem scheidenden Direktor Albert Lutz eröffnen konnte. Bei der Gelegenheit lernte ich viele von Ihnen bereits persönlich kennen. Für das herzliche Willkommen und Ihre Unterstützung meinen besten Dank!
vorwort ANNET TE BHAGWATI
4
Im Mittelpunkt der Ausstellung «Fiktion Kongo» stand das Archiv des Kunst-ethnologen Hans Himmelheber, das auf seiner Reise in den Kongo 1938/39 ent-standen war und in den letzten Jahren als wunderbare Schenkung der Familie Himmelheber – Barbara und Eberhard Fischer, Susanne und Martin Himmelheber – Teil der Sammlung wurde. Mit mehr als 750 Objekten, 15’000 Fotografien und unzähligen Dokumenten ist es ein einzigartiges Zeugnis für die Forschung Hans Himmelhebers, wie auch für die Kunstwelten des Kongo in der Zeit belgischer Ko-lonialherrschaft, das künstlerische Schaffen in der DR Kongo, in der Côte d’Ivoire und in Liberia.
Die Ausstellung ist Teil eines mehrjährigen, durch den Schweizerischen Nationalfonds geförderten Forschungsprojektes, das in Kooperation mit der Univer-sität Zürich entwickelt wird. Erstmalig wurden in einer Kongo-Ausstellung histori-sche Meisterwerke zeitgenössischen Arbeiten und Fotografien gegenübergestellt. Sieben Künstlerinnen und Künstler aus dem Kongo und der Diaspora, darunter Michèle Magema, Sammy Baloji und Sinzo Anza, setzten sich in ihren Arbeiten mit der Person und dem Archiv Hans Himmelhebers auseinander. In einer beein-druckenden Stimmenvielfalt entfaltete sich die Ausstellung, im Dialog zwischen historischer und zeitgenössischer Kunst, Fotografien, Textilien, Interviews und Tage- bucheinträgen. Auch die Performance von Fiston Mwanza Mujila, Patrick Dunst und Christian Pollheimer während der Eröffnung, die Kooperation mit der kongo-le sischen Community in der Schweiz und die Künstlergespräche begeisterten und zeigten spannende Wege auf im Umgang mit Sammlungen aus kolonialen Kontexten. Die Sammlungen des Museums Rietberg auf diese Weise im Sinne des «living archive»-Gedankens immer wieder neu zu erschliessen und sie in Kooperationen, Gesprächen oder künstlerischen Arbeiten in einen lebendigen Austausch zu bringen, wird dem Haus auch in Zukunft ein zentrales Anliegen sein. Wir können schon jetzt gespannt sein auf die zweite Ausstellung zum Archiv Hans Himmelhebers, mit der das Forschungsprojekt 2022 seinen Abschluss findet.
Annette Bhagwati
5
Gerne nutze ich die Gelegenheit, liebe Mitglieder der Rietberg-Gesellschaft und liebe Freundinnen und Freunde des Museums, an dieser Stelle zu meinem letzten, im November zu Ende gegangenen Jahr als Direktor noch einige persönliche Bemerkungen sowie Worte des Danks anzufügen. Einmal mehr erwies sich, wie Sie beim Durchblättern dieses Jahresberichts unschwer erkennen können, das Jahr 2019 als ein mit Ausstellungen und Veranstaltungen reich bestücktes, und, was die Erweiterung der Sammlung betrifft, ertragreiches und erfreuliches Jahr. Und so möchte ich mich gleich zu Beginn bei allen, die mitgewirkt haben, uns finanziell und ideell unterstützt und uns Kunstwerke geschenkt oder vermittelt haben, von Herzen bedanken. Weiter hinten in diesem Bericht finden Sie jeweils bei den Projekten und Werkbeschreibungen die namentliche Erwähnung all unserer Gönnerinnen, Mäzene, Sponsoren sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Mit der Ausstellung «Nächster Halt Nirvana» ist dem Ausstellungteam, einer Koproduktion zwischen Kuratorium, Kunstvermittlung und Ausstellungs-
vorwort ALBERT LUTZ
6
design, eine innovative und didaktisch höchst anregende Ausstellung gelungen, in der man sich gerne aufhielt, sich wohl fühlte, und in der man auf spielerische Weise viel lernen und erfahren konnte. Es würde mich freuen, wenn es auch in Zukunft Ausstellungen dieser Art wieder zu sehen gäbe. Für mich persönlich war das Jahr geprägt durch mein Engagement für die Ausstellung «Spiegel – Der Mensch im Widerschein». Sie sollte ein weiteres Beispiel einer kulturvergleichen-den Ausstellung werden, eines Ausstellungstyps, den wir vor zwanzig Jahren mit der «Orakel»-Ausstellung erstmals ins Leben gerufen haben. Ich durfte, da wir einen grossen Zuspruch für diese Ausstellung von Sponsoren und Gönnerinnen erhalten haben, die Schau mit einer recht grossen Kelle anrichten. Rund hundert leihgebende Institutionen sowie die Mitarbeit von dreissig internen und externen Fachleuten haben eine historisch umfassende Präsentation einer Kunst- und Kulturgeschichte des Spiegels ergeben.
7
Ich habe meine Museumslaufbahn 1980 im Kunsthaus Zürich als Assistent von Helmut Brinker begonnen, der die erste grosse China-Ausstellung im Kunst-haus Zürich kuratiert hat. Ich schrieb die Ausstellungstexte und durfte dann bei-nahe sämtliche öffentlichen und privaten Führungen bestreiten – es waren an die einhundert. Weil man üblicherweise als Kurator einer Ausstellung nach der Vernissage gleich wieder mit neuen Projekten beschäftigt ist, überlässt man die Führungen jeweils gerne dem Team der Kunstvermittlung. Bei der «Spiegel»-Aus-stellung war dies anders. Ich hatte kein weiteres Projekt, aber Zeit und Lust, die Ausstellung, die ja recht komplex war, unserem Publikum zu vermitteln. So habe ich insgesamt hundert grosse und kleine Gruppen durch die Ausstellung geführt. Dies war für mich ein wunderbares bereicherndes Erlebnis am Schluss meiner Karriere. Die vielen Rückmeldungen, Anregungen und Fragen, der beinahe tägliche Kontakt mit den Besucherinnen und Besuchern waren anregend und erfüllend. So hat meine Karriere aufgehört, wie sie damals im Kunsthaus begonnen hat: mit vielen Führungen – so gesehen ein runder Abschied. Die dritte grosse Aus-stellung des Jahres, «Fiktion Kongo», zählt für mich zu den schönsten – und wie die «Nirvana»-Ausstellung – zu den innovativsten, in die Zukunft weisenden Aus-stellungen, die wir in den letzten Jahren bei uns realisiert haben. Auch hier hoffe ich, dass es in Zukunft wieder Ausstellungen dieser Art geben wird, Ausstellun-gen, bei denen Vergangenheit und Gegenwart dank der Mitwirkung zeitgenössischer Künstlerinnen und Künstler miteinander sinnreich verknüpft werden.
Nun beginnt mit Annette Bhagwati, die vom Stadtrat von Zürich auf Emp-fehlung der von der Stadtpräsidentin geleiteten Findungskommission zur neuen Direktorin ernannt wurde, eine neue Ära. Ich wünsche ihr gutes Gelingen und Freude an ihrer neuen Tätigkeit. Ich danke allen, die das Museum zu dem gemacht haben, was es heute ist, und ich bin überzeugt, dass sich das Museum weiterhin erfreulich entwickeln und mit neuen Ideen und Möglichkeiten aufwarten wird.
Schliesslich möchte ich mich bei allen bedanken, die die Veranstaltungen, die zu meinem Abschied stattgefunden haben, organisier t haben und dabei waren: bei Swiss Re für das schöne Bankett im Sommerpavillon, den Mitgliedern des Rietberg-Kreises für den wunderbaren Abschiedsabend im Muraltengut, bei den Mitgliedern der Rietberg-Gesellschaft und den Mitwirkenden am munteren Rietberg-Talk, der an meinem letzten Arbeitstag im Stadthaus stattgefunden hat, und schliesslich für das unvergleichlich fröhliche und zugleich sehr emotionale Abschiedsfest, das alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für mich bereitet haben.
Albert Lutz
9
3 Vorwort
10 Statistik 2019
11 Finanzen 2019
12 Gönner, Donatorinnen, Sponsoren
13 Ausstellungen 31 Die schönsten neuen Kunstwerke 70 Schenkungen, Legate, Stiftungen 82 Ankäufe 87 Leihgaben aus dem Museum 88 Ausstellungen auf Reisen
89 Veranstaltungen 105 Medienarbeit und digitale Kommunikation 106 Kunstvermittlung 109 Reisen 110 Kooperationen 128 Provenienzforschung 131 Schriftenarchiv 133 Bibliothek 134 Publikationen
135 Personalia 139 Im Andenken 140 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
149 Rietberg-Gesellschaft 150 Statuten 151 Jahresrechnung der Rietberg-Gesellschaft 2019
152 Bericht der Revisionsstelle
inhaltsverzeichnis
10
Besucherzahlen gesamt 2019: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90547(2012: 83’486 / 2013: 86’330 / 2014: 72’212 / 2015: 76’545 / 2016: 117’311 / 2017: 138’541 / 2018: 112’567)
Für die genauen Besucherzahlen der Sonderausstellungen siehe die jeweiligen Einträge unter «Aus-
stellungen».
Anzahl Veranstaltungen und Führungen 2019: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2006( 2012: 1167 / 2013: 1483 / 2014: 1381 / 2015: 1506 / 2016: 1974 / 2017: 1899 / 2018: 1837)
— Führungen und Anlässe: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1536
Öffentliche Führungen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319
Private Führungen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 606
Weitere Anlässe: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 611
— Workshops und Angebote:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 470
Workshops und Angebote für Schulen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327
Offene Werkstatt: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Workshops für Kinder, Jugendliche und Erwachsene: . . . . . . . . . . . . . . . 97
Japanisches Teezimmer: 83 Teezeremonien, 1239 Teilnehmerinnen und Teilnehmer
Offene Werkstatt: 733 Teilnehmerinnen und Teilnehmer
Lange Nacht: 3449 Besucherinnen und Besucher
statistik 2019
11
Die öffentlichen Beiträge an das Museum kommen ausschliesslich von der Stadt Zürich. Ziel der Betriebsführung ist es, mit dem städtischen Beitrag die Besoldung des Personals sowie die Kosten für den Betrieb und den Unterhalt der Gebäude zu finanzieren. Die Kosten für die Sonderausstellungen, Veranstaltungen und Events sowie für Anschaffungen von Kunstwerken sollen durch die Einnahmen aus Billettverkäufen, den Sponsoringbeiträgen und Spenden sowie aus dem Gewinn von Café und Shop wieder eingespielt werden. Das Museum Rietberg hat eine Vollkostenrechnung, d.h. alle Kosten, die das Museum Rietberg verursacht, auch im Bereich Unterhalt der Gebäude, Hauswartung etc., sind in die Rechnung inte-griert. Der Wert der geschenkten Kunstwerke (CHF 1‘636‘770) hingegen erscheint nicht in der Rechnung.
— Total Aufwand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CHF 13’459’330
— Total Erträge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 6’010’489
— Beitrag der Stadt Zürich, Saldo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 7’488’840
— Eigenfinanzierungsgrad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45%
Bei dieser Darstellung der Finanzzahlen sind die Kosten für die Nettomiete aller Liegenschaften
des Museums nicht eingerechnet. Diese Miete wird stadtintern verrechnet und schlägt mit CHF
2,4 Millionen zu Buche.
Weitere Kennzahlen zu den Einnahmen
— Erträge aus Eintritten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CHF 1’003’500
— Erträge aus Shop und Café . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 1’555’817
— Erträge aus Spenden und Sponsoring . . . . . . . . . . . . . . . . ” 2’560’271
— Gesamteinnahmen pro BesucherIn . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 28.27
(Gesamteinnahmen/Gesamtbesucherzahlen)
Erträge pro BesucherIn (wie viel Geld gibt eine Person pro Besuch durchschnittlich im Museum
aus; eingerechnet sind die Einnahmen aus Billettverkäufen, Shop und Café)
Kennzahlen zum PersonalDas Museum verfügt über 44,9 Stellenprozente. 5,8 Stellen werden privat finanziert. — Personalkosten insgesamt (inkl. fremdfinanzierte Stellen) . . . . . CHF 6’739’773
Kennzahlen zu den Ausgaben— Kosten Sonderausstellungen (inkl. Auf-/Abbau, Transport etc.) . . CHF 2’663’791
— Energiekosten (Gas, Elektro für alle fünf Häuser) . . . . . . . . . . . . ” 222’649
— Anzahl Nennungen des Museums in Medienberichten . . . . . . . . . . . . . 668
finanzen 2019
12
Herzlichen Dank an alle unsere Donatorinnen, Mazene und Sponsoren Rietberg-Gesellschaft, Rietberg-Kreis, Parrotia-Stif tung, Max Kohler Stif tung, Vontobel-Stiftung, Clariant Foundation, The Robert H. N. Ho Family Foundation, Meiyintang Foundation, Ernst Göhner Stiftung, Elena Probst-Fonds der Stiftung Accentus, Swiss Re, EDA – Schweizer Botschaft in Pakistan, Bundesamt für Kultur BAK, Schweizer Nationalfonds zur Förderung der wissenschaftlichen For-schung, Ganesha-Stiftung, UBS Kulturstiftung, Hamasil-Stiftung, Solidaritätsfonds Zentralamerika und Afrika, Japan Tobacco International, Credit Suisse, Pestalozzi Rechtsanwälte, Rahn + Bodmer Co., Diethelm Keller Management AG, Volkart Stif-tung sowie Eckhart und Marie-Jenny Koch-Burckhardt, Regula Brunner, Catharina Dohrn, Barbara und Eberhard Fischer, Dominik Keller und Martin Escher
Rietberg-KreisJeweils zu Beginn des Novembers steigt unter den Kuratorinnen und Kuratoren die Spannung. Denn am ersten Samstag im November entscheiden die Mitglie-der des Rietberg-Kreises in einer Abstimmung, welche Kunstwerke, die das Ku-ratorium an diesem Abend zum Ankauf vorschlägt, mit den Mitteln des Kreises angekauft werden können. Nach der Vorstellungsrunde und der Abstimmung im Museum erwartet die Mitglieder ein Abendessen im Muraltengut, wobei die mit Spannung erwartete «Rangverkündigung» den Höhepunkt des Abends bildet. Dank einer finanziellen Reserve im Rietberg-Fonds konnten dieses Jahr sämtliche Werke erworben werden, und sie sind alle hier in diesem Jahresbericht ausführlich beschrieben. Albert Lutz, der den Rietberg-Kreis vor 21 Jahren ins Leben gerufen hat, wurde am Ende des festlichen Mahls von der munteren Gesellschaft mit grossem Applaus als Direktor verabschiedet. Mit einer Spende von 3000 Franken unterstützen die knapp 70 Mitgliederpaare und Einzelmitglieder des Kreises das Museum, und einmal mehr möchten wir uns alle für die grosse Unterstützung be-danken. Möge der Rietberg-Kreis weiterhin gedeihen! Neue Mitglieder sind stets herzlich willkommen. Sowohl die Direktion wie auch das Sekretariat der Rietberg- Gesellschaft geben bei Anfragen gerne Auskunft. / LuA
Ehrenamtlich tatige MitgliederAuch dieses Jahr geht unser bester Dank an unsere ehrenamtlich in der Biblio-thek und im Shop tätigen Mitarbeiterinnen Catherine de Reynier, Frauke Freitag und Therese Marty. Ebenso danken wir Shrirang Mirajkar, der die indischen Kon-zerte organisiert und betreut, für sein grosses ehrenamtliches Engagement. / LuA
gönner / donatorinnen / sponsoren
13
Farbe bekennen – Textile Eleganz in Teheran um 190023. November 2018 –14. April 2019, Novartis-Saal
Die umfassende Sammlung persischer Textilien und Fotografien, die der Schweizer Kaufmann Emil Alpiger (1841–1905) während seiner Tätigkeit im Iran zusammen-getragen hatte, rief förmlich danach, der Öffentlichkeit präsentiert zu werden. Emil Alpiger hatte die meisten Kleidungsstücke, Wandbehänge und Stickereien auf dem Basar erworben. Nur wenige Stücke davon galten damals wohl bereits als «alt», die meisten waren brandneu und ungetragen. Entsprechend farben - prächtig und glanzvoll wirken sie, zumal sie über ein Jahrhundert lang in jener Reisekiste lagerten, in der sie nach Europa verschifft worden waren. Um diese
ausstellungen
14
Qualität für die Museumsbesucherinnen und -besucher unmittelbar erfahrbar zu machen, schuf das junge Gestaltungsteam eine farblich zurückhaltende, aber räumlich umso raffiniertere Architektur, die einen idealen Rahmen bot. Wichtiger Bestandteil der Inszenierung waren übermannshohe Vergrösserungen alter Schwarz-Weiss-Fotografien von iranischen Männern und Frauen aus der Samm-lung von Emil Alpiger, an denen sich ablesen liess, wie die Kleidungsstücke Ende des 19. Jahrhunderts in Teheran getragen worden waren. / LaA
Eintritte: Werden nicht separat erfasst; 32 private und 18 öffentliche Führungen, Workshops: 33
Kurator und Projektleiter: Axel Langer / wissenschaftliche Mitarbeit (Fotografie): Elahe Helbig /
Textilrestaurierung und -montage: Nanny Boller / Ausstellungsarchitektur: Cristian Zabalaga, Martin
Sollberger / Visuelle Kommunikation: Tiziana Bucher, Jacqueline Schöb / Beleuchtung: Rainer Wolfs-
berger / Kunstvermittlung: Maya Bührer, Vera Fischer
15
Die Frage der Provenienz. Einblicke in die Sammlungsgeschichte1. Dezember 2018 – 29. September 2019, Sammlungsintervention in der Dauerausstellung
Führungen: (Zahlen ab 1. Januar bis Ende Ausstellung): 28 private Führungen, 25 öffentliche
Führungen
Geplant war eine Laufzeit von sieben Monaten, am Schluss lief die Sammlungs-intervention, die die ganze Provenienzdebatte von Fragen zu Erwerbungen in kolonialen Zusammenhängen bis zu nationalsozialistischen Kunstraub hin auf-zeigte, zehn Monate lang. Die Dauerausstellung lockte zur Neuentdeckung von altbekannten und neu aus dem Schaudepot geholten Werken. Der Rundgang mit zehn Stationen ermöglichte einen Blick auf die Rückseite der Werke und auf sogenannte Provenienzmerkmale. Gleichzeitig wurden Objektbiografien greifbar gemacht, die auch die teilweise schwierigen Erwerbskontexte in den Herkunfts-ländern zur Diskussion stellten. Das Interesse an der Provenienzforschung ist nach wie vor ungebrochen. Es war in der Vergangenheit der Kunsthandel, der sich vorwiegend mit Provenienzfragen befasst hatte. Denn Provenienz steigert den Wert eines Objektes. Aber Provenienzforschung stärkt auch das Museum. Angesichts der medialen Aufmerksamkeit konnten wir unzählige Medienschaffende immer wieder durch «Die Frage der Provenienz» führen und wichtige Aufklärungs-arbeit leisten. Das Thema der Restitutionsfragen ist und bleibt komplex, weshalb es sorgfältig aufbereitete Information und persönliche Führungen braucht. / TiE
Kuratorin und Projektleitung: Esther Tisa Francini / Ausstellungsarchitektur: Sonja Koch, Martin
Sollberger / Visuelle Kommunikation: Mirijam Ziegler / Beleuchtung: Rainer Wolfsberger / Objekt-
montagen: Martin Ledergerber / Lektorat: Iris Spalinger, Mark Welzel / Bibliothek: Josef Huber /
Marketing, Kommunikation, Mediaplanung: Elena DelCarlo Leitung, Alain Suter, Nicola Morgan /
Veranstaltungen: Caroline Delley, Leitung, Daniel André, Monique Schuler / Führungen: Gabriela
Blumer Kamp, Damian Christinger, Linda Christinger, Eva Dietrich, Claudia Geiser, Daniela Müller
Mit grossem Dank an alle Kuratorinnen und Kuratoren des Museums Rietberg für die Zusammen-
arbeit.
16
Nächster Halt Nirvana – Annäherungen an den Buddhismus13. Dezember 2018 – 31. März 2019, Werner-Abegg-Saal
Wie bereits aus dem Beitrag im letzten Jahresbericht ersichtlich wurde, hob sich die Nirvana-Ausstellung in vielerlei Hinsicht von anderen Ausstellungen am Museum Rietberg ab. Zentrales Anliegen der Ausstellung war es, die Vielfalt buddhistischer Traditionen aus ganz unterschiedlichen Perspektiven, mit ganz verschiedenen Stimmen zu vermitteln. Dafür wartete die Ausstellung neben den Kunstwerken, die mehrheitlich aus der eigenen Sammlung stammten, mit einem breiten Vermittlungsangebot auf. Dieses umfasste thematische Entdeckungs-touren, multimediale Vertiefungen oder eine Lotos-Faltstation ebenso wie Work-shops, persönliche Begegnungen oder Führungen, um nur eine Auswahl zu nennen.
Doch wie würden die BesucherInnen der Nirvana-Ausstellung auf dieses Nebeneinander von Kunstwerken, Aktivitäten und Positionen reagieren? Das fragten sich auch die vier AusstellungsmacherInnen – ein gemischtes Team aus Kura torIn-nen und Kunstvermittlerinnen. Sie wollten wissen, wer ihre BesucherInnen waren, wie diese die Ausstellung wahrnahmen und wie sie die Ausstellung und ihre An-gebote für sich nutzten. Im Rahmen einer breit angelegten Evaluation ( Mitte Februar – Ende März 2019) füllten rund 1000 BesucherInnen (über 14 Jahre) einen zweiseitigen Fragebogen zur Nirvana-Ausstellung aus. Daneben wurden Kurz-interviews geführt, Beobachtungen angestellt, ExpertInnen befragt oder auch das Gästebuch ausgewertet.
Das Evaluationsergebnis bestätigte den von den AusstellungsmacherInnen in der Nirvana-Ausstellung gewählten Ansatz der Vielfalt als Möglichkeit, um eine von Diversität geprägte Gesellschaft anzusprechen. Vielfalt in den eingebrachten Kompetenzen des Ausstellungsteams, in den aufgegriffenen Inhalten, in den Ver-mitt lungsmethoden, in den Präsentationsformen und in der Objektauswahl sowie in den einbezogenen Stimmen und Perspektiven. Die Ausstellung vermochte ein breites Publikum zu begeistern. Unabhängig von Alter oder Geschlecht, unabhän-gig von Besuchsmotiven oder Vorkenntnissen zum Buddhismus und unabhängig davon, welche Angebote in der Ausstellung tatsächlich genutzt wurden – 99% der TeilnehmerInnen an der Fragebogenerhebung beurteilten die Ausstellung insge-samt als «sehr gut» (70%) oder «eher gut» (29 %). Das ist ein grossartiges Zeugnis für die Nirvana-Ausstellung.
Die vollständigen Ergebnisse der Ausstellungsevaluation wurden in dem Bericht «Nächster Halt Nirvana. Die Sonderausstellung durchleuchtet» zusam-men gestellt. Er wird auf Anfrage an Interessier te versendet. Zudem ist die Nirvana-Ausstellung in Filmen festgehalten worden. Der Film «Kunstvermittlung
17
in Bewegung» gibt spannende Einblicke in Ausstellungs- und Vermittlungsarbeit am Museum Rietberg. / BeJ, HaA, SpC, PrA
Mit Unterstützung der Robert H.N. Ho Familiy Foundation und des Förder-fonds Engagement Migros.
In Zusammenarbeit mit dem Centrum für Religionswissenschaftliche Studien an der Ruhr-Universität Bochum, dem Institut für Interaktive Technologien der Fach hoch-schule Nordwestschweiz, dem Eidgenössischen Departement für auswärtige Ange-legenheiten EDA und der Direktion für Entwicklung und Zusammen arbeit DEZA.
Eintritte total: 35’117 (ab 2019: 30’859) / Öffentliche Führungen total: 57 (ab 2019: 53) / Private
Führungen total: 103 (ab 2019: 85) / Weitere Vermittlungsangebote Freizeitbereich total: 37 (ab
2019: 32) / Vermittlungsangebote Bildungsbereich total: 82 (ab 2019: 78)
AusstellungsmacherInnen: Johannes Beltz, Anna Hagdorn, Caroline Spicker, Alexandra von
Przychowski / Ausstellungsarchitektur: Martin Sollberger / Foto, Beleuchtung: Rainer Wolfsberger /
Restaurierung-Konservierung: Martin Ledergerber / Registra rin: Andrea Kuprecht / Grafik: Coralie
Wipf, Mirijam Ziegler / Multimedia: Masus Meier, Sarai Aaron, Salomé Jost / Lektorat: Kathrin Feldhaus /
Korrektorat: Anne McGannon (E) / Übersetzung: Nigel Stephenson (E), Magali Pès Schmid
(F) / Kunstvermittlung: Caroline Spicker, Robert Ashley, Maya Bührer, Vera Fischer, Suy Ky Lim,
Yumi Mukai, Christiane Ruzek / Führungen: Gabriela Blumer Kamp, Damian Christinger, Linda
Christinger, Eva Dietrich, Claudia Geiser, Daniel Schneiter, Sylvia Seibold, Penelope Tunstall,
Christiane Voegeli, Monika Willi / Kunst sehen – Religion verstehen: Anna Hagdorn, Linda Christinger,
Sarah Smolka / Marketing und Kommunikation: Elena DelCarlo, Nicola Morgan, Alain Suter, Sina
Voigt / Public Relations: Nickl PR, Simone Nickl / Veranstaltungen: Caroline Delley, Monique Schuler
18
Spiegel – Der Mensch im Widerschein17. Mai – 22. September 2019, Novartis-Saal und Werner-Abegg-Saal
Die Vernissage an einem der raren, schönen Maiabende erfreute sich eines ausser-ordentlich grossen Publikums. Der Abend entwickelte sich zu einem fröhlichen und (jedenfalls für den seine letzte Ausstellung eröffnenden Direktor) sehr emo-tionalen Eröffnungsfest (das ihm in schönster Erinnerung bleiben wird).
«Spiegelungen im Wasser und der Mythos des Narziss» bildeten den Auftakt der Schau, und er veranschaulichte die Intentionen der Ausstellung: Der « Spiegel» in Kunst und Geschichte sollte in einer vielstimmigen, kulturübergreifenden und multimedialen Inszenierung präsentiert werden. So vereinte das erste Thema fünf unterschiedliche Werke: ein Video mit Spiegelungen in einem Waldweiher, eine klassizistische Marmorfigur des Narziss von John Gibson, eine Narziss- Illumination des 14. Jahrhunderts aus der British Library, das Ölbild «La Vanità» von Giovanni Segantini sowie ein Werk des Videokünstlers Bill Viola. Künstlerische und kulturelle Vielstimmigkeit zum einen und eine klare Ordnung mit zehn Themen zum anderen bildeten das Konzept: 1. Spiegel und Selbsterkenntnis; 2. Selbstbildnis und Spiegel (am Beispiel von fotografischen Selbstporträts von Künstlerinnen und Fotografin-nen), 3. Spiegel und der japanische Mythos der Göttin Amaterasu (mit einer Instal-lation der Modedesignerin Kazu Huggler), 4. Die Weltgeschichte des Spiegels (vom alten Ägypten bis heute), 5. Spiegel als Symbol der Weisheit und Eitelkeit, 6. Magie und Spiegel, 7. Mystik und Spiegel, 8. Der Spiegel als Waffe und Schutz, 9. Spiegel und Schönheit, 10. Durch den Spiegel in eine Parallelwelt.
220 Kunstwerke aus 95 Museen und Sammlungen weltweit, konnten so die wechselvolle handwerkliche und technologische Entwicklung wie auch die kulturelle und gesellschaftliche Tragweite dieses reflektierenden Mediums beleuchten. Er-freulich hoch war der Anteil an Werken aus der eigenen Sammlung, unter anderem chinesische Bronzespiegel, indische Kleider mit Spiegelstickereien, japanische Holzschnitte und indische Bilder. Vier in Indien eigens für die Ausstellung pro-duzierte Kurzfilme über die Verehrung und die Herstellung von Spiegeln an der Malabarküste in Indien, das grossformatig gezeigte Videokunstwerk des Balletts «Schwanensee» des nigerianischen Künstlers Yinka Shonibare sowie ein Video eines wie von Geisterhand entstehenden Schrif tkunstwerks des chinesischen Künstlers Lu Dadong zeigten filmisch die kulturelle Vielfalt des Spiegelthemas. Für Emotionen sorgten die über fünfzig nach Themen geordneten Spiegelszenen aus Spielfilmen, die in sechs «Kinoräumen» in der Ausstellung präsent waren. Gezeigt wurden Themen wie «Männer im Spiegel», «Spiegel in Fantasy- und Mystery-filmen», «Horror und Vampire» und «Melodrama». Für einmal waren im Museum
19
Rietberg auch Werke von grossen Namen der westlichen Kunst des 20. Jahrhun derts sowie der zeitgenössischen Kunst zu sehen: Salvador Dalí, Monir Farmanfarmaian, Sylvie Fleury, Anish Kapoor, William Kentridge, Fernand Léger, Roy Lichtenstein, Michelangelo Pistoletto und Gerhard Richter und viele andere.
Dank eines Förderbeitrags von Swiss Re konnte vor dem Museum ein Spiegel-Pavillon errichtet werden, in dem es unter anderem Mani Matters «Bim Coiffeur» zu hören gab und der insbesondere Kindern viel Freude bereitete. Zur Ausstellung erschien im Wienand Verlag in Köln ein Katalog mit Beiträgen von 33 Autorinnen und Autoren. In den Medien der Schweiz (Tagesschauberichte in allen Landesteilen, Tagespresse) sowie in deutschen, französischen und italie-nischen Zeitungen und Illustrierten erschienen prominente Ausstellungsbespre-chungen. / LuA
Sponsoren: Vontobel-Stiftung, Parrotia-Stiftung, Clariant Foundation, Swiss Re, Max Kohler Stif-
tung, Eckhart und Marie-Jenny Koch-Burckhardt, Bundesamt für Kultur BAK
Eintritte Total: 39’031 / Workshops: 48 / Führungen: 326
Kurator: Albert Lutz / Ausstellungsassistenz: Daniel Horn / Kuratorische Kooperation und Texte:
Michaela Oberhofer, Peter Fux, Axel Langer, Khanh Trinh, Alexandra von Przychowski, Caroline
Widmer, Eberhard Fischer, Harsha Vinay, Alois Haas, Christin Müller, Marius Kuhn, Andreas Beyer,
Paul Michel, Thomas Knöll, Eva Riediker-Liechti, Christian Loeben, Urs-Beat Frei, Felix Thürlemann,
Kazu Huggler / Weitere Katalogautorinnen und -autoren: Eduard Alter, Marta Boscolo, Elisabeth
Bronfen, Heidi Eisenhut, Andreas Isler, Robert Knöll, Michael Oppitz, Niklaus Peter, Liz Pieksma,
Raji Steineck, Paulina Szczesniak, Geshe Karma Tenzin, Peter von Matt sowie Moritz Daum, Uni-
versität Zürich, Psychologisches Institut – Entwicklungspsychologie: Säuglings- und Kindesalter /
Ausstellungsarchitektur: Martin Sollberger, Albert Lutz, Cristian Zabalaga / Grafik: Jacqueline Schöb,
Tiziana Bucher / Registrarin: Andrea Kuprecht / Restauratorische Betreuung: Martin Ledergerber,
Nanni Boller (Montierung Textilien) / Beleuchtung und Fotografie: Rainer Wolfsberger / Multimedia:
Masus Meier, Salomé Jost, Sarai Aron / Lektorat Ausstellungstexte: Mark Welzel / Kunstvermittlung:
Christiane Ruzek, Caroline Spicker, Vera Fischer / Führungen: Damian Christinger, Linda Christinger,
Eva Dietrich, Claudia Geiser, Gabriela Blumer Kamp, Daniel Schneiter, Sylvia Seibold, Penelope
Tunstall, Christiane Voegeli, Monika Willi / Kommunikation und Marketing: Elena DelCarlo, Alain
Suter, Nicola Morgan, Sina Voigt / PR: salaction, Daniela Bühe / Veranstaltungen und Events: Caroline
Delley, Monique Schuler
20
Gitagovinda – Indiens grosse Liebesgeschichte 24. Oktober 2019 – 16. Februar 2020
Das Gitagovinda (buchst. «das Loblied an Krishna») ist zu allererst ein zentrales Werk der Sanskrit-Kunstdichtung (kavya). Im 12. Jahrhundert vom Dichter Jaya-deva in Westbengalen verfasst, erzählt der Text von der leidenschaftlichen Liebe zwischen dem hinduistischen Gott Krishna und der Kuhhirtin Radha, mit allen Höhen und Tiefen, die eine solche Leidenschaft mit sich bringt. Das Gedicht bil-det einen Höhepunkt der indischen Literatur und wurde zum Vorbild späterer religiöser Dichtung. Literarisch herausragend ist der Text nicht nur dank der zahl-reichen Lautmalereien, Wortspielen und erfinderischen Reimschemata, die der Autor benutzt, sondern auch weil sich Jayadeva einer subtilen Erzähltechnik be-dient, um verschiedene Blickwinkel zum Ausdruck zu bringen.
Das Gitagovinda ist aber auch einer der Grundtexte der bhakti, einer re-ligiösen, mystischen Strömung im Hinduismus, die die Hingabe und Liebe zu einer Gottheit, in diesem Fall Krishna, in den Mittelpunkt stellt. Der Text fand eine sehr grosse Resonanz im ganzen indischen Subkontinent und bleibt bis heute eine Inspirationsquelle für alle Kunstarten. Zahlreiche Künstler haben im Laufe der Zeit ihre Bilder dazu gemalt.
So schufen die Maler Manaku und Nainsukh von Guler und ihre Söhne im 18. Jahrhundert zum Gitagovinda zwei Bildzyklen von grösster Bedeutung und Schönheit: zwei Serien von jeweils 151 Bildern, dazu ein ganzes Set von Zeich-nungen. Die Blätter sind heute auf der ganzen Welt verstreut. Das Museum Rietberg besitzt jedoch in seiner Sammlung drei Bilder der ersten Serie und 18 Bilder und 16 Zeichnungen der zweiten Serie. Dies war für Dr. Caroline Widmer, die Kuratorin für indische Malerei des Museums, der Anlass, ein Forschungsprojekt zu den beiden Serien durchzuführen, deren Ergebnisse nun in die Ausstellung zu den beiden Bildserien, und ihrem Zusammenhang mit Jayadevas Kunstgedicht, ein-flossen. Im Zentrum der Ausstellung standen die Bilder und Zeichnungen der sogenannten «zweiten Guler Gitagovinda-Serie von ca. 1775», die sich in der Kunst-welt grosser Bekanntheit erfreut. Aber die Kuratorin legte auch Wert darauf, Werke aus der ebenso bedeutenden früheren Serie, der sogenannten «ersten Guler Gitagovinda- Serie von 1730», die der Künstler Manaku geschaffen hat, in der Aus-stellung zu zeigen. Das Museum Rietberg ist sehr dankbar, dass es Werke dieser früheren Serie aus dem Government Museum and Art Gallery Chandigarh ausstel-len konnte. Dies wurde dank einer Kooperation zwischen verschiedenen Institu-tionen in Indien und dem Museum Rietberg möglich, die seit Jahren gepflegt wird.
21
Im Kern der Ausstellung stand das Verhältnis zwischen dem Kunstgedicht und den gemalten Meisterwerken. Der Text wurde den Besuchern durch Zitate aus der deutschen Übersetzung des Gitagovinda von Erwin Steinbach nähergebracht. Die Mehrdeutigkeit des Gedichts und der Bilder, die nicht nur eine Liebesgeschichte von Lust und Leid illustrieren, sondern auch von der mystischen Verbindung von Mensch und Gott erzählen, kam dadurch deutlich zum Vorschein. Zur Ausstellung hat Dr. Caroline Widmer einen Katalog verfasst, der von Arnoldsche Art Publishers herausgegeben wurde. Neben den Abbildungen sämtlicher Bilder in Originalgrösse beinhaltet er Erläuterungen zum Gitagovinda, zu den Erzählstrategien der Bild-serien und zu den Maltechniken der Künstler aus Guler.
22
Die Ausstellung wurde in einem ganz besonderen Kontext eröffnet. Wer hat schon von einer Vernissage ohne Kuratorin gehört? Jedoch war der Grund für die Ab-wesenheit von Caroline Widmer einer der schönsten: Knapp eine Woche zuvor war ihre Tochter, die kleine Julia, zur Welt gekommen.
Im Smaragd wurden die Gäste von Albert Lutz begrüsst. Ehrengast der Vernissage war der indische Botschafter, der eine kurze Rede über die Zusam-menarbeit zwischen dem Museum Rietberg und verschiedenen Museen und Institutionen in Indien hielt. Er begrüsste die Kooperation des Museums mit dem Government Museum und Art Gallery Chandigarh und freute sich sehr auf zukünftige gemeinsame Projekte. Danach, stellvertretend für die Kuratorin der Ausstellung, stellten Johannes Beltz und Rosine Vuille die Ausstellung kurz vor. An schlies send wurde auch die Ausstellung «Surimono» von Khanh Trinh eröffnet, und alle Gäste konnten sich in einem Rundgang durch die beiden Ausstellungen von zwei sehr unterschiedlichen und beeindruckenden künstlerischen Auffassungen vom Umgang mit Wort und Bild inspirieren lassen. / VuR
Führungen: 13 private und 19 öffentliche Führungen, Workshops: 17 (bis Ende Dezember)
Kuratorin und Projektleitung: Caroline Widmer / Ausstellungsassistenz: Rosine-Alice Vuille / Aus-
stellungstexte: Caroline Widmer / Ausstellungsgestaltung: Martin Sollberger / Grafik: Nicole Fleisch-
mann, Jacqueline Schöb / Beleuchtung: Rainer Wolfsberger / Registrarin: Andrea Kuprecht / Lektorat:
Mark Welzel / Bibliothek: Josef Huber / Marketing, Kommunikation, Mediaplanung: Elena DelCarlo
Leitung, Alain Suter, Nicola Morgan / Veranstaltungen: Caroline Delley, Leitung, Daniel André,
Monique Schuler / Führungen: Gabriela Blumer Kamp, Eva Dietrich, Daniel Schneiter, Penelope
Tunstall, Christine Voegli, Monika Willi
23
Fiktion Kongo – Kunstwelten zwischen Geschichte und Gegenwart22. November 2019 – 15. März 2020, Werner-Abegg-Saal
In den letzten Jahren hat das Museum Hunderte von Objekten aus der ehemaligen Privatsammlung des Ethnologen und Kunsthändlers Hans Himmelheber (1908–2003) sowie seinen fotografischen und schriftlichen Nachlass von seiner Familie geschenkt bekommen. Darunter befinden sich besonders schöne und einzigartige Stücke, die Himmelheber während seiner Reise 1938/39 in die Kolonie Belgisch Kongo (heute DR Kongo) erworben hatte. Zusammen mit seinen 1500 im Kongo aufgenommenen Fotografien zeugen die Kunstwerke von der Gestaltungskraft und den kulturellen Praktiken der damaligen Zeit.
24
2019, 80 Jahre nach Himmelhebers Kongo-Reise, war es also höchste Zeit, die erste grosse Kongo-Ausstellung in der Geschichte des Museums Rietberg zu realisieren. Die in der Ausstellung gezeigten Masken, Figuren, Stoffe, Alltagsgegen-stände und Fotografien aus der eigenen Sammlung wurden ergänzt durch Leih-gaben aus nationalen und internationalen Privat- und Museumssammlungen. Ein besonderes Anliegen war uns die Verortung der Kunstwerke und Fotografien in ihrem damaligen Kontext, dadurch wurden sie aus ihrem ethnografischen Präsens herausgelöst, und die Verflechtung des Kongo mit dem Rest der Welt trat offen-sichtlich zutage. Denn die farbigen Masken, Kraftfiguren und kunstvoll gestalteten Dinge des täglichen Gebrauchs sind nicht nur von herausragender ästhetischer Qualität, sondern sie zeugen auch von der Auseinandersetzung der Künstlerinnen und Künstler mit dem damaligen Zeitgeschehen. In ähnlicher Weise dokumentieren
25
die Fotografien die gesellschaftlichen Umbrüche während der Hochphase der belgischen Kolonialherrschaft.
Darüber hinaus ermöglichte es uns das reichhaltige Quellenmaterial, vor allem Himmelhebers Tagebuch der Kongo-Reise von 1938/39, die Entstehung der Sammlung zu thematisieren. In multimedialen Installationen, die Fotografien, Tage-bucheinträge und kritische Stimmen vereinten, erhielten Besucherinnen und Be-sucher die Möglichkeit, sich vertiefter mit der Reise von Himmelheber und den Objektgeschichten auseinanderzusetzen.
Ein weiterer Fokus lag in der Ausstellung auf der Einbindung aktueller Stim-men aus dem Kongo, um dadurch den einseitigen westlichen Blick auf die Kunst des Kongo zu vermeiden. In der Tradition Himmelhebers, der sich stets mit den zeitgenössischen Künstlerinnen und Künstlern auseinandersetzte, haben wir heu-tige Künstlerinnen und Künstler aus dem Kongo und der Diaspora eingeladen, sich mit dem Archiv von Hans Himmelheber zu beschäftigen. Die dabei entstan-denen, kritischen und eindrücklichen Beiträge von Sinzo Aanza, Sammy Baloji, Fiona Bobo, Michèle Magema, Yves Sambu und David Shongo thematisieren die Auswirkungen von Kolonialzeit, Welthandel und Kunstmarkt; zudem verbinden sie die Geschichte und Gegenwart des kongolesischen Kunstschaffens.
Während der intensiven Gespräche mit den Künstlerinnen und Künstlern fiel ein Satz besonders oft: «Le Congo, c’est une fiction.» Diese implizite Aufforderung, die Vergangenheit und Gegenwart des Kongo je nach Akteur, Zeit und Ort als konstruiert und imaginiert wahrzunehmen, sollte zum Leitgedanken unseres Pro-jektes werden. Entstanden ist eine Ausstellung, die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft ebenso miteinander verbindet wie alte und neue Kunst oder Objekte und Fotografien.
Der umfangreiche, von Claudio Barandun und Megi Zumstein gestaltete Katalog überzeugt durch die gelungene Grafik, die Objekte, Fotografie und Text zu einem Augenschmaus vereint. Dazu tragen auch die wunderbaren Fotografien von Rainer Wolfsberger bei, die die Objekte ins beste Licht rücken. Die beiden Essays der Kuratorinnen präsentieren die neuesten Forschungsergebnisse zu Hans Himmelheber. Ergänzt werden sie durch fachkundige Texte führender Ex-pertinnen und Experten zum Thema Kunst und Fotografie aus dem Kongo und der Diaspora.
Mit «Fiktion Kongo» betraten wir in vielerlei Hinsicht Neuland. Wir bedanken uns bei der Erbgemeinschaft von Hans Himmelheber sowie unseren Kolleginnen und Kollegen für ihre Unterstützung und den Besucherinnen und Besuchern für ihr positives Feedback. / GuN, ObM
Mit freundlicher Unterstützung des Rietberg-Kreises und Accentus
26
Eintritte bis Ende 2019: 6941 / Öffentliche Führungen: 9 / Private Führungen: 36 / Workshops: 15
Kuratorinnen: Michaela Oberhofer und Nanina Guyer / Assistenz: Laura Falletta und Daniela Müller /
Ausstellungsgestaltung: Martin Sollberger / Registrarin: Andrea Kuprecht / Ausstellungsgrafik:
Jacqueline Schöb, Helene Leuzinger / Multimedia: Inlusio Interactive, Masus Meier / Restaurierung
und Konservierung: Martin Ledergerber und Nanny Boller / Beleuchtung und Fotografie: Rainer
Wolfsberger / Übersetzung, Lektorat: Nigel Stephenson, Nicole Viaud, Mark Welzel / Katalog gestaltung:
Claudio Barandun, Megi Zumstein / Führungen: Damian Christinger, Linda Christinger, Gabriela
Blumer Kamp, Sylvia Seibold, Anja Soldat, Penelope Tunstall / Kunstvermittlung und Workshops:
Maya Bührer, Christiane Ruzek, Suy Ky Lim, Robert Ashley / Kommunikation, Marketing, Social
Media: Elena DelCarlo, Alain Suter, Nicola Morgan, Pascal Schlecht / Presse: Simone Nickl /
Events: Caroline Delley
27
«ZeitRäume. Zeitgenössische Miniaturmalerei aus Pakistan»21. Februar – 16. Juni 2019, Park-Villa Rieter
Eintritte: 3717
Führungen: 35
Kuratoren: Quddus Mirza und Caroline Widmer
Führungen: Linda Christinger, Gabriela Kamp Blumer, Daniel Schneiter
In der Ausstellung «ZeitRäume» zeigte das Museum Rietberg erstmals zeitgenös-sische Miniaturmalerei aus Pakistan. Junge Künstlerinnen und Künstler mit einem Abschluss im Hauptfach Miniaturmalerei schufen die Werke eigens für diese Schau und machten deutlich, dass Miniaturmalerei durchaus eine sehr lebendige und höchst kreative Kunst ist.
«ZeitRäume» leistete damit einen Beitrag zu einem künstlerischen Austausch, der kulturell, religiös, wirtschaftlich, politisch und über Sprachgrenzen hinweg relevant ist. Die zeitgenössischen Bilder entsprangen einer direkten Auseinander-setzung mit Werken aus der Sammlung des Museums Rietberg, sie wurden neu interpretiert und eröffneten so einen Dialog über Zeit und Raum hinweg.
In der Ausstellung erschienen alte und neue Malereien wie die Doppel-seiten eines Albums – so wie es seit dem 15. Jahrhundert in Persien und später in Mogulindien üblich war. Ein Album wird arabisch-persisch als moraqqa’ be-zeichnet, als etwas, das «zusammengeflickt» wurde: Allen Alben gemeinsam ist, dass immer zwei Bilder auf einer Doppelseite einander gegenübergestellt werden. Durch das vergleichende Betrachten erscheint jedes Werk in einem neuen Licht. So gesehen stellte «ZeitRäume» ein eigenes Album dar und schrieb die Geschichte einer jahrhundertealten Tradition fort. Der Besuch der Ausstellung lud dazu ein, historische Werke mit heutigen Augen zu sehen und neue Aspekte in ihnen zu entdecken.
Die Auswahl aus der Sammlung des Museums Rietberg Zürich berücksich-tigte Malereien aus dem 15. bis 18. Jahrhundert. Thematisch stand die Frage im Zentrum, wie Künstler aus vergangenen Jahrhunderten Raum und Zeit gestalteten und welche Perspektiven sich daraus ergeben. Entscheidend bei den Neuinter-pretationen war der Einbezug der heutigen Lebenswelt in Pakistan, aus der Sicht junger, globalisierter Frauen und Männer. Daraus ergab sich eine Vielfalt an künstlerischen Arbeiten, die in sich verschiedene Techniken vereinten und sehr persönliche Positionen beinhalteten.
Die Ausstellung gliederte sich in drei Themen, die unabhängig voneinander und in beliebiger Reihenfolge besucht werden konnten. Jeder Raum widmete sich einem Bereich: Konsumgesellschaft und Moderne (Raum 1); Religion und Imagi-
ausstellungen PARK-VILL A RIETER
28
nation (Raum 2); Umwelt, Konflikte und soziales Leben (Raum 3). Ein Thema schien die Kunstschaffenden besonders zu beschäftigen und zog sich deshalb wie ein roter Faden durch die gesamte Ausstellung: die Frau und ihre Rolle in der Ge-schichte und Gesellschaft.
Die Finissage der Ausstellung, in Anwesenheit des Projektinitiators Dr. Jo-hannes Beltz, der beiden Kuratoren, Prof. Quddus Mirza und Dr. Caroline Widmer, sowie Sehrish Mustafa, einer der beteiligten Künstlerinnen, bot die Gelegenheit der persönlichen Begegnung, war gleichzeitig die Vernissage der Begleitpublikation, in der sämtliche ausgestellten Werke abgebildet sind. Die Werke und Positionen der jungen Kunstschaffenden werden nochmals im Zusammenspiel mit den Samm-lungsstücken des Museums präsentiert. Das Konzept des moraqqa’ wurde auch hier aufgenommen und bildet so eine bleibende Erinnerung an ein aussergewöhn-liches und ganz besonderes Kooperationsprojekt zwischen dem Museum Rietberg und dem National College of Arts in Lahore. / WiC
29
Traumbild Ägypten – Frühe Fotografien von Pascal Sebah und Émile Béchard20. Juni – 20. Oktober 2019
Eintritte: 5225
Führungen: 21 private Führungen und 16 öffentliche Führungen
Kuratorin: Nanina Guyer
Führungen: Gabriel Blumer Kamp, Damian Christinger, Linda Christinger, Claudia Geiser
Erstmals waren in der Park-Villa Rieter historische Fotografien aus der eigenen Sammlung zu sehen. Umso mehr freuten uns der rege Besucherandrang und die vielen positiven Rückmeldungen zur Ausstellung «Traumbild Ägypten – Frühe Fotografien von Pascal Sebah und Émile Béchard». In der Ausstellung waren knapp sechzig qualitativ herausragende Originalabzüge der in Kairo tätigen Be-rufsfotografen Pascal Sebah (1823 –1886) und Émile Béchard (1844 –?) zu sehen. Ergänzt wurde die Ausstellung durch Arbeiten anderer in Ägypten tätiger Fotografen des späten 19. Jahrhunderts wie Felix Bonfils oder die Brüder Zaganki. Eine be-sondere Trouvaille war eine Fotografie von Wilhelm Hammerschmidt, die bereits um 1865 in Kairo aufgenommen wurde.
In den Bildern, die überwiegend aus der Zeit zwischen 1870 und 1880 stammten, begegneten wir dem damaligen abendländischen Blick auf den Orient: verhüllte Frauen, Moscheen oder Pyramiden. Nach der Eröffnung des Suez kanals 1869 florierte in Ägypten der Tourismus aus Europa, und Fotografien für Touristen wurden zu einem lohnenden Geschäft. Sebah und Béchard gehörten zu den ge-fragtesten Touristenfotografen in Ägypten. Pascal Sebah verstand es meisterhaft, mithilfe von Statisten ein regelrechtes Orienttheater zu inszenieren. Die Spezia-lität von Émile Béchard waren hingegen Fotografien von Tempelanlagen und Monumenten, die durch die Wahl der Perspektive und seinen Umgang mit Licht verblüfften.
Besucherinnen und Besucher wurden dazu eingeladen, genauer hinzu-schauen. Dann nämlich offenbarten die Fotografien selbst, mit welchen Tricks die Fotografen arbeiteten, um das Traumbild zu erschaffen: Bald einmal liessen sich versteckte Posierhilfen in Bildern ausmachen; dieselben Darsteller tauchten in unterschiedlichen Fotos auf; die Hintergründe entpuppten sich als Kulissen, und die starre Haltung des Krokodils verriet, dass es ausgestopft war. / GuN
30
Surimono – Gedichtblätter der Shijo-Schule24. Oktober 2019 – 9. Februar 2020
Eintritte: 1918 (bis Ende Dezember)
Führungen: 6 private Führungen und 10 öffentliche Führungen (bis Ende Dezember)
Kuratorin: Khanh Trinh
Führungen: Claudia Geiser, Silvia Seibold und Penelope Tunstall
Die Ausstellung präsentierte zum ersten Mal eine Auswahl von 94 Einzelblättern und zwei Alben aus der Sammlung Gisela Müller und Erich Gross, die das Museum Rietberg im 2018 als Schenkung erhalten hat (s. Jahresbericht 2018, S. 65–66). Im Zentrum standen die Haikai- oder Shijo-Surimono-Farbholzschnitte mit Gedich-ten und Illustrationen, die von Amateur-Dichterkreisen in Auftrag gegeben wur-den, um Ereignisse wie das Neujahr oder eine berufliche Beförderung zu zelebrie-ren. Die Gedichte sind Haikai, jene 17-silbigen japanischen Verse, die heute als Haiku internationale Bekanntheit erlangt haben. Illustriert wurden die Blätter von Künstlern, die im naturalistisch-dekorativen Malstil der Shijo-Schule arbeiteten.
Im Gegensatz zu den prächtigen, dramatischen kyoka-Surimono, die von berühmten Meistern der «Fliessenden Welt», ukiyo-e, gestaltet wurden, erhielten die Haikai- beziehungsweise Shijo-Surimono bis heute wenig Aufmerksamkeit. Es gibt nicht viele Forschungen über sie, und auf dem Kunstmarkt erzielen sie weit tiefere Preise als ihre augenfälligeren «Cousinen». Dies mag damit zusammen- hängen, dass die Akteure der Haikai-Surimono – die Dichter und Illustratoren – wenig bekannt sind. Viele der Blätter sind nicht signiert, und zu den identifizierten Poeten und Künstlern gibt es äusserst spärliche biografische Angaben.
Die Ausstellung präsentierte die Blätter unter einem kunsthistorischen As-pekt. In erster Linie interessierten uns die Materialität, Drucktechnik und Ikonografie. Nach einer Einleitung zu den verschiedenen Formaten und zum Produktionshergang wurden die Blätter nach Themen gruppiert. Die Besucher erfuhren dabei, welche schier unendlichen Möglichkeiten es gab, um die zwölf Tiere des Zodiaks dar-zustellen. So kann man beispielsweise den Ochsen, das zweite Zodiaktier, in den verschiedens ten Kontexten entdecken: als Bildrahmen, als Glücksbringer oder als Nutztier für die Feldarbeit. Weitere beliebte Motive für Haikai-Surimono, die meist zu Neujahr erschienen, waren Glück verheissende Speisen und Getränke wie die Bitterorange, die Meerbrasse oder der Sake. Humorvolle Darstellungen von Alltags-szenen, die mit dem Neubeginn des Jahres zu tun haben, geben uns einen Einblick in das Leben und Treiben der bürgerlichen Schicht Japans im 19. Jahrhundert.
Subtil in der Ausdruckskraft und poetisch in der Stimmung vermögen die Haikai-Surimono uns aufs Höchste zu erfreuen und begeistern. / TrK
31
Das Museum Rietberg ist und bleibt ein Sammlermuseum. Die grosszügigen Zu-wendungen von SammerInnen und DonatorInnen gehören zur DNA des Museums. Wir sind stolz auf diese Partnerschaft und möchten diese privilegierte Partner-schaft in Zukunft nicht nur weiter ausbauen, sondern auch sichtbarer machen.
Im Berichtsjahr gelangten insgesamt 626 Kunstwerke aus allen Teilen der Welt als Neuzugänge in die Sammlung des Museums. Die Sammlungen japanischer Druckgrafik von Gisela Müller und Erich Gross und indischer Miniaturmalerei von Eva und Konrad Seitz bescherte den grössten Zuwachs. Der Versicherungswert aller Neuzugänge beläuft sich auf über 2.5 Millionen CHF. Das ist ein beachtlicher Zugewinn für unsere Stadt und eine Stärkung unserer erstklassigen Sammlung.
Damit ist das Wichtigste schon gesagt, es soll aber noch einmal hervor geho-ben werden: Wie in den vergangenen Jahren kamen 572 von 626 Neueingängen als Schenkungen ins Museum (siehe S. 70). Die wichtigsten Schenkerinnen und Schenker seien hier genannt: Gisela Müller und Erich Gross, Eva und Konrad Seitz, Barbara und Eberhard Fischer, Catharina Dohrn sowie Nanni Reinhart. Wichtige Kunstwerke für unsere Sammlungen erhielten wir dazu von folgenden Personen: Christian Barblan, Ruth und Urs Eberhard, Sylvie Felix, Angès Kaeser, Ursula Kunz, Albert Lutz, Balan Nambiar, Angela Schader, Anjana Somany und Lisette van der Valk. Das Legat Ulrich Frey bescherte uns 16 peruanische Keramiken.
Wie in den vergangenen Jahren beobachteten die Kuratorinnen und Kura-toren des Museums aufmerksam den internationalen Kunstmarkt und griffen bei ausserordentlichen Angeboten nach sorgfältiger Abklärung zu: Dank der Beiträge des Rietberg-Kreises waren die Kuratorinnen und Kuratoren in der Lage, drei indische Malereien, eine kongolesische Maske, ein japanisches No-Gewand und ein persisches Bild bei anerkannten Kunsthändlern zu erwerben. Mit den Mitteln aus dem Legat von Gabriele Louise Aino Schnetzer gelang der Erwerb von zwei indischen Bildern sowie 16 japanischen No-Gewändern. Besonders erfreulich ist, dass das Museum seit 2019 wieder über ein städtisches Ankaufsbudget verfügt. Dieses stand den Kuratorinnen und Kuratoren zur Verfügung, um chinesische Tuschemalerei aus dem 18. Jahrhundert, eine persische Federschachtel, eben-falls aus dem 18. Jahrhundert, sowie Werke zeitgenössischer Künstler aus Indien, Pakistan und Indonesien zu erwerben.
Unsere Sammlung wächst also und gedeiht: An dieser Stelle können wir mit Freude berichten, dass im laufenden Kalenderjahr das Depot der chinesischen und japanischen Malerei/Grafik einen neuen Standort im Museum erhalten hat und unser neues städtisches Aussenlager in Oerlikon endlich bezogen wird. / BeJ
die schönsten neuen kunstwerke
32
IR AN
Federschachtel (qalamdan)Mohammad Sadeq (tätig um 1740 – um 1785) mit Werkstatt (?)
Iran, Schiras (?), datiert 1195 H. (1781/82)
Federschachtel: Papiermaché und Malerei unter Lack; Tintenfass (19. Jh. [?]):
Messing- und Weissblech, Filigré (Messingdraht), Messingperlen, Türkis;
Schutzhülle (20. Jh.): Wolle, gehäkelt; 3,5 × 23,7 × 3,7 cm; 2019.432 a–d
Provenienz: 1990er-Jahre, Kunsthandel, London, 1990er-Jahre bis 2019, britische
Privatsammlung; 1.5.2019, Sotheby’s, London, Arts of the Islamic World, L19220, Los 55
Ankauf mit Mitteln der Stadt Zürich
Mohammad Sadeq gehörte zusammen mit seinem Lehrer Mohammad ‘Alı Ashraf (tätig 1730er-Jahre bis um 1760) und seinem jüngeren Kollegen Mohammad Baqer (tätig um 1760 bis um 1790) zu den wichtigsten persischen Künstlern des 18. Jahr-hun derts, die sowohl für die Herrscher der Zand- wie auch der Afsharen-Dynastie tätig waren. Bekanntheit erlangten sie nicht zuletzt durch ihre Mitarbeit an dem sogenannten St. Petersburger Album, für die sie einige der Borten malten. Dank dieser Federschachtel sind nun alle drei Künstler mit je einem Werk in der Samm-lung des Museums vertreten.
Der Deckel und die Seitenwand der Federschachtel sind mit figürlichen Szenen bemalt. Auf dem Deckel erkennt man rechts den Besuch dreier Frauen bei einem Mystiker und links, durch eine Baumgruppe getrennt, drei Frauen und eine Dienerin beim Bad an einem Fluss. Auf den Seiten folgen das Zusammen-treffen eines Prinzen mit einer Gruppe von Frauen in einem improvisierten Zelt-lager und ein weiterer Besuch junger Frauen bei einem älteren Sufisheykh. Ganz offensichtlich spielen in jeder der vier Szenen drei Freundinnen eine zentrale Rolle, die von einer jungen Frau in rotem Gewand angeführt wird, die einen perlenge-säumten Edelstein über dem Scheitel trägt.
33
In Kenntnis anderer Lackarbeiten des Künstlers ist zu vermuten, dass die Szenen in einem Zusammenhang gelesen werden können. Dabei kann es sich um eine Bildserie zu einem literarischen Werk handeln oder aber um eine philosophische Spekulation. In dem vorliegenden Fall lässt sich feststellen, dass die Gruppe der drei Freundinnen beim Baden, bei der Visite eines Prinzen und dem Besuch eines Weisen dargestellt sind. Ohne eine abschliessende Interpretation zu wagen, lässt sich vorderhand vermuten, dass hier ein spiritueller Weg der drei Frauen nach-gezeichnet wird, der vom arglosen, oberflächlichen Vergnügen hin zur ernsthaften Suche nach mystischer Erfüllung führt.
Interessant sind die motivischen Bezüge zu anderen Werken, die Moham-mad Sadeq hier ins Werk setzt: So basiert die sitzende Badende, die sich ihrer Freundin zuwendet (Deckel), auf einer der Badenden auf der Innenseite einer Spiegelhülle von Mohammad Baqer (RAV 1010), die ihrerseits auf einer Illustration von Mohammad Zaman (tätig um 1663 –1693/94) im sogenannten Pierpont-Morgan- Khamseh von 1675 – 78 beruht (M.469, Fol. 90). Der Rückenakt gleich daneben basiert auf einer «Susanna im Bad» von ‘Alıqol ı Jebadar (tätig 1649 –1674/75) von ca. 1673 (Drouot, Paris, 23. Juni 1982, Nr. 7). Das gesattelte Pferd in Levade (Seitenwand) geht auf eine andere Federschachtel von Mohammad Zaman zu-rück, die 1084 H. (1672/73) entstanden war und die Sadeq bereits 1194 H. (1780/81) sowie ein weiteres Mal zwölf Jahre später, 1208 H. (1793/94) (Sackler Gallery of Art, Washington, S2014.17.25a–b bzw. Metropolitan Museum of Art, New York, 2014.257) zitierte. Das Landschaftsidyll mit Brücke gemahnt schliesslich an vergleichbare Szenen auf Hajj ı Mohammads berühmter Federdose in der Khalili-Sammlung in London und einer anderen qalamdan von dessen Neffen Mohammad ’Alı von 1112 H. (1700/01) (Ermitage, St. Petersburg, VR-126). / LaA
Literatur: Adle, Chahryar, Ecriture de l’Union: Reflets du temps des troubles. Œuvre picturale
(1081–1124/1673 – 1712) de Haj ı Mohammad, Paris, 1980.
Ivanov, Anatoly, «The Compiling and Decoration of the Album», in: Francesca von Habsburg und
Elena Kostioukovitch (Hrsg.), The St. Petersburg Muraqqa‘: Album of Indian and Persian Miniatures
from the 16th through the 18th Century and Specimens of Persian Calligraphy by ‘Imad al-Hasan ı,
Lugano und Milano: ARCH Foundation und Leonardo Arte, 1996, S. 19 – 32.
34
Kniende junge FrauVal ı Jan (Veli Can) zugeschrieben (tätig um 1580 – um 1600)
Iran, um 1580
Tinte, Pigmente und Gold auf Papier; 16 × 8,1 cm (Bildmass), 24,5 × 15,9 cm (Blattmass); 2019.436
Provenienz: frühes 20. Jh. Kunsthandel Istanbul; vor 1929 – 1940er-Jahre (?), Armenag Bey Sakisian;
1940er-Jahre (?) – 1981, Maurice Bouvier (1901–1981); 1981– 2019, Nachfahren von Maurice Bouvier;
15.5.2019, Artcurial, Paris, Archéologie et arts d’Orient, vente 3916, Los 292
Ankauf mit Mitteln des Rietberg-Kreises
Das zentrale, seitlich beschnittene Bild zeigt eine kniende junge Frau in einem malvenfarbenen Gewand aus Brokatstoff über einem grünen, bodenlangen Hemd, das nur am Knöchel erkennbar ist. Eine mehrfarbige Leibbinde, eine Mütze aus Goldbrokat mit pelzverbrämter Krempe und bestickte Lederstiefel ergänzen ihr modisch-elegantes Erscheinungsbild. Getragen wird die Komposition von dem Komplementärkontrast von Mauve und Schlammgrün, das subtil durch eine de-likate Palette abgetönter Farben erweitert ist. Inhaltlich spielt die Kleidung das Hauptthema, durch die die junge Frau charakterisiert wird. Eine sino-persische Wolke in der linken oberen Ecke und blühende Pflanzen am unteren Bildrand, die alle in Goldfarbe «hingetuscht» und durch einzelne Höhungen belebt sind, suggerieren eine Landschaft.
Solche Einzelfiguren vor leerem Hintergrund oder dezent anklingender Na-turszenerie tauchten nach der Mitte des 16. Jahrhunderts vermehrt in der persischen Malerei auf. Im Zentrum standen einerseits elegante junge Prinzen, Prinzessinnen oder hochrangige Höflinge wie Falkner, daneben finden sich aber auch Zentral-asiaten, Inder und später Mystiker und Derwische. Diese kleinformatigen, per-sön li chen und textunabhängigen Werke entstanden abseits der grossen Projekte illustrierter Handschriften. An Bedeutung gewannen solche Einzelblattkomposi-tionen in Qazv ın ab den 1570er-Jahren.
Val ı Jan, dem das Blatt zugeschrieben wird, emigrierte nachweislich in den frühen 1580er-Jahren nach Istanbul. Möglicherweise befand sich diese Arbeit in seinem Gepäck. Im frühen 18. Jahrhundert diente es einem osmanischen Maler als Vorbild für eine vollfarbige Komposition, auf der unsere junge Frau spiegelver-kehrt wiedergegeben ist (Bibliothèque nationale de France, Arabe 6076, Fol. 17v). Zu Beginn des 20. Jahrhunderts erwarb der armenischstämmige Kunsthistoriker Armenag Beg Sakisian das Blatt schliesslich in Istanbul, wie er in seinem frühen Standardwerk La Miniature persane du XIIe au XVIIe siècle von 1929 ausführt. Hier ist unser Werk auch besprochen und abgebildet (S. 125 sowie Taf. 43, Abb. 166). Nach Sakisians Tod gelangte die Miniatur auf noch ungeklärten Wegen in den
35
Besitz von Maurice Bouvier (1901–1981), einem Schweizer Juristen, der seit 1929 in Assiout und Kairo auf Einladung der ägyptischen Regierung tätig war und von 1943 bis 1960 in Alexandria gelebt hatte. Postume Bekanntheit erlangte Bouvier in erster Linie durch seine Sammlung ägyptischer Textilien aus frühislamischer Zeit, die auch in verschiedenen Ausstellungen zu sehen waren, so 1991 in Fribourg (Musée d’art et d’histoire), 1993 in Genf (Musée d’art et d’histoire) sowie 1994 und 2002 in Paris (Institut du monde arabe). / LaA
Literatur: Denny, W.B., «Dating Ottoman Turkish Works in the Saz Style», in: Muqarnas, Bd. 1, 1983,
S. 103 –121
Sakisian, Arménag Beg, La miniature persane du XIIe au XVIIe siècle: ouvrage accompagné de la re-
production de 193 miniatures dont deux en couleurs, Paris und Brüssel: Les Édition G. Van Oest, 1929
36
INDIEN
Dem Meister A der «Verstreuten Bhagavata-Purana-Serie» zugeschriebenDie Hirten feiern die Geburt KrishnasFolio zu Bhagavata Purana, Zehntes Buch, Kapitel 5.13.
Frühe Rajput-Malerei («Early Rajput Painting»), gemalt vom Vorsteher einer Malerwerkstatt
in Nordindien (aktiv in Delhi-Agra, Chittor oder Gwalior) um 1520–1530
Pigmentmalerei auf Papier, 18 × 23,8 cm.
2019.449
Auf der Borte links unten Reste einer Devanagari-Bildlegende und eventuell die Zahl 8,
auf der Rückseite vier Zeilen in Devanagri
Provenienz: Sammlung Konrad und Eva Seitz
Geschenk Rietberg-Kreis
Im fünften Kapitel des zehnten Buchs der Bhagavata Purana heisst es im 5. Ka-pitel Abschnitt 13 und 14: «Bei diesem grossen Festereignis, dem Erscheinen des göttlichen Krishna, dem Unendlichen, dem Höchsten Herrn des Universums, wurde auf vielerlei Instrumenten musiziert. Die lustigen Kuhhirten verspritzten und be-schmierten einander mit Joghurt, Milch, Butterschmalz und Wasser und bewarfen sich mit Butterkugeln.»
Das Bild, das diese Textstelle visualisiert, ist zweiteilig aufgebaut: Links ist es noch Nacht und regnet es aus dunklen Wolken. In einem Pavillon mit farbiger Fassade sitzt auf einem Kissen Nanda, der schon ergraute Anführer der Hirten, mit seiner Frau Yashoda, die den blauhäutigen Säugling Krishna an ihre Brust presst. Krishna ist in der selbigen Nacht geboren und noch nackt, wenngleich reich geschmückt dargestellt. Yashoda strahlt Mutterglück aus. Nanda sitzt mit angezogenen Knien, um die er seinen Schal geschlungen hat; er trägt ein hauch-dünnes knielanges Hemd und hält in seiner erhobenen rechten Hand ein kusha- Gras, womit er seine Bereitschaft andeutet, Rituale zur Geburtsfeier seines Sohnes durchzuführen und Opfergaben zu verteilen.
Man beachte im Haus die wundervollen Textilmuster von Deckenstoff und Kissen oder auch ihre detailliert wiedergegebenen Kostüme, so beispielsweise Yashodas transparentes Mieder und den Saum von Nandas Kittel. Man beobachte ferner beider reichen Schmuck mit Quasten, Nandas Fingerringe und sein Perlen-collier. Auffallend präzis gemalt ist auch Nandas Geste der erhobenen Rechten, seine weiss gemalten Finger- und Fussnägel. Man kann auch im Hintergrund von Yashodas Rücken noch erkennen, dass der Maler über ihren Kopf und Rücken einst ein zart durchscheinendes weisses Kopftuch gelegt hatte.
37
Auf der rechten Seite des Bildes jubilieren auf zwei übereinander gestellten Registern – oben vor rotem, unten vor grünem Hintergrund – unter aufgehängten, Glück verheissenden Mangoblättern ausgelassen die Hir ten. Junge und alte Männer tanzen zur Musik einer kleinen Kapelle bestehend aus einem Trommler und zwei Bläsern, von denen der eine sein Rohr mit beiden Händen fest umklammert, während der andere wohl eine shehnai-Klarinette spielt, denn er schliesst mit den Fingern seiner linken Hand Löcher. Der Trommler sitzt vor einer Kesselpauke auf einem flachen Kissen und trägt, wie noch ein einziger Tänzer, einen mit konzen-trischen Kreisen gemusterten, links geschlossenen grüngrundigen jama-Rock (und ist somit vielleicht ein muslimischer Musiker).
Die Figuren der sieben Tänzer sind grossartig zueinander komponiert und in schwungvoller Tanzbewegung festgehalten. Sie bilden zwei Paare und eine Dreiergruppe, die ihre Partner jeweils anschauen, deren Arme sich kreuzen oder hinterfangen, die sich meist an den Schultern berühren. Der Maler hat diese Tänzer als unterschiedlich alt und von verschiedenartiger Hautfarbe – von « weizenfarbig», gelblich-braun bis dunkelbraun – charakterisiert, sie tragen alle kleine weiss-schwarze Turbane, dazu lange weisse eng anliegende Hosen und fast durchsich-tige, am Oberkörper eng geschnittene, unter der linken Achsel geknüpfte und von der Taille aus leicht zipflig abstehende Blusenkittel und dazu einen Hüftschal mit roter, gelber oder schwarzer Borte bzw. Webkante. Ihr Schmuck beschränkt sich auf goldene Ohrringe, eine Halskette mit Brustamulett, ferner ein Collier mit
38
Bommel am Verschluss im Nacken und eine weisse Jasminblüten-Girlande. Wenn man aber genauer hinsieht, erkennt man, dass es doch auch grössere Unter-schiede gibt. So tragen die beiden Tänzer im oberen Register beispielsweise im Hüftgürtel Dolche mit markanten Griffen und prunkvollen Scheiden und ihre ja-ma-Kittel sind aus unterschiedlich feinen Stoffen gefertigt und auch nicht gleich-artig geschnitten. Auch fällt auf, dass der gross gewachsene Tänzer am rechten Bildrand einen sehr farbigen Kittel trägt.
Erstaunlich differenziert ist die subtile Bildkonstruktion dieser Tänzergruppe, bei einer Beschränkung sowohl der Palette von ungemischten Pigmentfarben (Weiss und Schwarz, Gelb, Grün, Rot, Rosa, Braun und wenig Blau) als auch stilistisch auf eine einzige Bildebene und einer Wiedergabe aller Gesichter im Profil. Unter diesen Umständen fällt die expressive Körperhaltung der Tänzer mit den stark abgewinkelten Knien und weit ausgreifenden Armen besonders auf. Recht unter-schiedlich hat der Maler ihre Zehen oder Füsse auf die Bodenkanten gesetzt und auch sorgfältig die Gesten ihrer Hände und auch ihre schwingenden Halsketten ausgeführt. Auffallend verschieden werfen die Tänzer mit erhobenen Händen ihre Butterbälle, und an manchen Gesichtern fällt eine feine Strichelung der Wan-genpartie auf, durch die ihnen Plastizität verliehen wird.
Aber auch die fünf, von allen Tänzern in den linken Händen gehaltenen Töpfe hat der Maler unterschiedlich geformt, repräsentieren sie doch Gefässtypen, die im Alltag für bestimmte Getränke vorbehalten sind, wie sie auch im Bhagavata- Purana-Text erwähnt werden, nämlich für Wasser, Buttermilch, Joghurt und Frisch-milch beziehungsweise die Schale für Butterschmalz. Und überall zwischen den Tanzenden erscheinen weisse und gelbe runde Flecke: Damit sind wohl die Butter-kugeln angedeutet, welche die Hirten in ihrem Übermut und ihrer Freude über die Geburt Krishnas um sich werfen. / FiE
Literatur: G.V. Tagare, The Bhagavata Purana, Part IV, Skandha X, Delhi 1978 (Reprint 1994); Daniel
Ehnbom, The Masters of the Dispersed Bhagavata Purana, in: Milo C. Beach, Eberhard Fischer
and B.N. Goswamy, 2011, Masters of Indian Painting Vol. 1, S. 77– 88.
39
Dem Meister I der «Verstreuten Bhagavata-Purana-Serie» zugeschriebenDer Dämonenkönig Bana fesselt mit Schlangenpfeilen Aniruddha, den Geliebten seiner Tochter Usha Folio zu Bhagavata Purana, 10. Buch, Kapitel 62.35
Frühe Rajput-Malerei («Early Rajput Painting»), Malerwerkstatt in Nordindien
(aktiv in Delhi-Agra, Chittor oder Gwalior?) um 1520–1530
Rand beschnitten, stark beschädigt. Farbe partiell abgerieben.
Aufschrift: Sa Nana (vermutlich Name eines einstigen Besitzers),
Spät grob nummeriert 342
Pigmentmalerei auf Papier, 18,2 × 23,9 cm.
2019.453
Provenienz: Sammlung Konrad und Eva Seitz
Geschenk Rietberg-Kreis
Einst wurde Krishnas Enkel Aniruddha im Schlaf entführt und durch Magie zur Prinzessin Usha, der Tochter des Dämonenkönig Bana, gebracht, wo beide ihr Liebesglück fanden – bis der König davon erfuhr:
Auf vorliegendem Bild eilt der Dämonenkönig Bana von links zum Pavillon seiner Tochter Usha. Er ist struppig bärtig, sein Auge rot angelaufen, sein Mund aufgerissen. Er ist dunkelhäutig, 20-armig und vierbeinig (Letzteres ist höchst aussergewöhnlich und vielleicht ein Versuch des Malers, das Vorwärtsstürmen des Dämonenfürsten deutlich zu machen). Der wild gewordene König war einst gekrönt, was noch in der Vorzeichnung im abgeriebenen Hintergrund zu erkennen
40
ist; er trägt grosse Ohrringe, ein vielteiliges Collier, ein Amulett an rotem Faden auf der Brust, goldene Bänder an seinen Armen, Ringe an Waden und den vier Fussknöcheln und viele Fingerringe. Der König scheint in grosser Eile aus seinen Privatgemächern aufgebrochen zu sein, trägt er doch nur ein rosa Tuch um die Schultern und ein dunkelrotes um die Hüften. Doch steckt ein gebogener Dolch in grüner Scheide im Gürtel, und er schultert ein blaues Langschwert mit weiss blitzender Klinge.
Auf gleicher Ebene wie der einherbrausende Dämonenkönig, aber vor ro-tem Hintergrund, steht auf einem Vordach des Palasts, dandyhaft und lächelnd, Aniruddha, der unrechtmässige Geliebte seiner Tochter Usha: Der blauhäutige Jüngling – laut Bhagavata Purana ein Liebling aller Frauen – ist reich geschmückt und mit einer Jasmin-Girlande bekränzt, wie wohl bis auf ein gelbes Lendentuch und einen über die Schultern geworfenen Schal nackt. In seinem goldenen Diadem steckt ein Büschel von Pfauenfedern, was ihn als Enkel Krishnas ausweist. Er hat seinen schweren, grob gemusterten Schlagstock sinken lassen, denn vier züngelnde Kobras umwinden seine Oberarme. Aniruddhas Brust (aber auch seine Stirn und Unterarme) zieren gelbe vishnuitische Zeichen aus Sandelholzpaste. Und die Schlangen? Diese sind magische Schlingen in Kobraform, die der Dämonenfürst um seinen jugendlichen Gegner geworfen hat, um ihn kampfunfähig zu machen und dann gefangen zu nehmen.
Im roten Liebespavillon sitzt derweil auf einem ovalen grünen Teppich die schöne Usha, allein gelassen und wie vor Schreck versteinert; der transparente weissgrundige Schal mit blauer Webkante ist ihr von der Schulter gefallen, ihr langes Haar ist aufgelöst, eine Strähne fällt ihr über den Busen. Ushas Rock ist besonders raffiniert gemustert: Am Taillenbund und an der unteren Borte ist er blau, sein Mittelfeld aber ist rot und rosa kariert. Mit dem ausgestreckten Zeige-finger ihrer rechten Hand zeigt Usha auf die leere Stelle, wo ihr Geliebter noch vor kurzem sass. Nur das vor ihr liegende quadratische Brett deutet noch an, dass die Verliebten traulich beim Würfeln vereint waren.
Am Zugang zu den Frauengemächern hat sich Aniruddha tapfer gegen die von König Bana ausgesandten Höflinge gewehrt, heisst es doch in BhP X. 62.34: «Wie ein grosser Eber, der all die ihn angreifenden Hunde wegkickt, schlug Aniruddha mit seiner Eisenkeule auf alle ein, die ihn angriffen und ihn festnehmen wollten. Von ihm in die Flucht geschlagen, rannten sie mit verbeulten Köpfen und gebrochenen Gliedmassen aus Ushas Palast.»
Das blutige Treiben ist virtuos dargestellt: Die zerschlagenen Körper der Angreifer türmen sich am Boden; bewusstlose und aus Kopfwunden bluttriefende Männer stürzen zur Erde und haben ihre Turbane verloren oder werden gerade
41
von Aniruddhas Eisenstange getroffen; ein Dreiertrupp hat den Rückzug schon angetreten.
Nun gilt es, noch kurz zu vermerken, inwieweit der Maler in diesem Bild auf seine Textvorlage eingegangen ist. Dies ist besonders wichtig, weil keine frühere Darstellung der Gefangennahme von Aniruddha bekannt ist und der Maler diese Bildgebung wohl weitgehend selbst «erfinden» musste. Dieser Teil der Romanze von Aniruddha und Usha wird im zehnten Buch der Bhagavata Purana detailreich geschildert. So heisst es von Aniruddhas kämpferischem Auftreten (BhP X. 62.33): «Als Aniruddha den wild dreinblickenden Bana hereinstürmen sah, ergriff er seinen eisernen Knüppel und nahm eine Stellung ein wie der Todesgott Yama, wenn er entschlossen ist, jeden Körper, der ihm entgegentritt, zu zermalmen. Und wenn König Bana sieht, wie Aniruddha seine Höflinge zurichtet, weiss er sofort Abhilfe zu schaffen (BhP X. 62.35) denn er fesselte Aniruddha mit Nagapasha, schlangen- gleichen Schlingen».
Besonders eindrücklich ist die Bemerkung der Überlieferung, was genau den Zorn von Ushas Vater über die «sexuelle Emanzipation» seiner Tochter aus-gelöst beziehungsweise gesteigert hat (BhP X. 62.32): «Bana brauste auf, als er sah, dass dieser Jüngling eine Jasminblüten-Girlande über der Brust hängen hatte und er auf dieser Flecken vom Safran erblickte, mit dem Ushas Busen (stets) eingerieben war, was nur von einer innigen Berührung der einander Gegen-übersitzenden stammen konnte.» Der Maler hat auf Aniruddhas Brust und Armen keine orangefarbene Safranflecken sondern drei waagrechte Striche gemalt. Hat der Maler damit suggerieren wollen, der König, ein grosser Verehrer Shivas, habe hier die Zeichen Vishnus gesehen und als Überbleibsel vom Liebesspiel seiner Tochter mit ihrem Geliebten missverstanden – oder hat der Maler prüde die vor-eheliche sexuelle Beziehung der Romanze abschwächen wollen?
Wie reagierte Usha auf die Verhaftung ihres Liebhabers? In BHP X, 62.36 heisst es, das 62. Kapitel abschliessend: «Usha war in grosser Trauer und Sorge, als sie Aniruddha so mit Schlangenschnüren gebunden sah; sie weinte laut und Tränen stürzten ihr aus den Augen.» Auch bei grösster Vergrösserung findet man leider auf dem Bild in Ushas hübschem Gesucht keine Andeutung von Tränen, wohl aber einen Schönheitsfleck auf dem Kinn.
Nach Daniel Ehnbom, dem besten Kenner dieser Serie, war ein noch nicht genauer identifizierter Maler verantwortlich für die Folios zu den Kapiteln 59 – 68 des 10. Buches der BhP und damit auch für die Anfertigung dieses Bildes. Seiner Meinung nach ersetzte dieser Maler in seinen Bildern kompositorisch starke Kurven und Diagonalanordnungen der zeitgleich mit ihm arbeitenden anderen Werk-stätten durch Stufenbildungen und platzierte meist seine Figuren – wie auch hier –
42
in rechteckige Farbfelder. Im Verhältnis zum Malstil von Meister A (s. vorheriges Bild) sind seine Figuren kantiger, ihre Körper sind weniger organisch-weich gezeichnet, ihre Gesichter flächiger und die Muster der Stoffe und auf den Gebäudefassaden summarischer ausgeführt als dies andere Maler damals taten. Dies gilt auch für die Kostüme der von Aniruddha verdroschenen Höflinge, aber auch für Banas und seine eigenen Kleiderstoffe.
Das vorliegende Bild ist stark beschädigt, aber nicht – wie viele andere Folios aus dieser umfangreichen Serie – später überarbeitet oder restauriert worden. Vor allem in den Randpartien sind viele Farbflächen abgerieben und geben so Teile der Vorzeichnung frei. Auch ist generell der Auftrag von Gelb und Weiss dünn geworden, ist das Weiss der Augen abgeplatzt, und das Rot hat fast überall seinen Glanz eingebüsst. Wegen seiner Dynamik und dem hier wohl zum ersten Mal gestalteten Thema der Liebe Ushas zu Krishnas Enkel Aniruddha ist das vorliegende aber ein wichtiges Bild. / FiE
Literatur: G.V. Tagare, The Bhagavata Purana, Part IV, Skandha X, Delhi 1978 (Reprint 1994); Daniel
Ehnbom, The Masters of the Dispersed Bhagavata Purana, in: Masters of Indian Painting, 2011,
S. 77–88
43
Miniaturen aus dem Bundelkhand, Geschenk Sammlung Eva und Konrad Seitz
Krishna versunken in einsames Denken an die Geliebte (RP VIII, 28)Folio 166 aus der dritten Orchha-Rasikapriya-SerieIndien, Orchha, 1610 –1615
Pigmentmalerei auf Papier; 2019.498
Provenienz: Sammlung Eva und Konrad Seitz, Wachtberg
Geschenk Sammlung Eva und Konrad Seitz
Krishna tötet Dhenuka, den EseldämonFolio 30 aus der Bir-Singh-Bhagavata-Purana-SerieIndien, Orchha, 1610 –1615
Pigmentmalerei auf Papier; 2019.476
Provenienz: Sammlung Eva und Konrad Seitz, Wachtberg
Geschenk Sammlung Eva und Konrad Seitz
Eine Krähe sucht Zuflucht bei RamaFolio 30 aus der ersten Orchha-Ramayana-SerieIndien, Orchha, ca. 1600
Pigmentmalerei auf Papier; 2019.475
Provenienz: Sammlung Eva und Konrad Seitz, Wachtberg
Geschenk Sammlung Eva und Konrad Seitz
Mit der Schenkung von Eva und Konrad Seitz ist eine bedeutende Sammlung von Miniaturmalerei aus dem Bundelkhand, einer Region im heutigen indischen Staat von Madhya Pradesh, ins Museum Rietberg gekommen. Bei der Schenkung handelt es sich um insgesamt 96 Bilder, die vom Ehepaar Seitz über eine Zeit-spanne von mehr als 40 Jahren gesammelt wurden. Einige Bilder wurden in Indien erworben, aber der grösste Teil auf dem internationalen Kunstmarkt.
Die Sammlung besteht mehrheitlich aus Bildern aus dem Bundelkhand, von Hofmalern, die im 16. und 17. Jahrhundert in Orchha und Datia tätig waren. Sie sind im frühen Stil der Region gemalt, mit typischen schematisierten Bild-kompositionen. Sie stammen aus sieben verschiedenen Bildserien und erlauben, die Entwicklung einzelner Malmotive nachzuverfolgen.
Drei dieser Bildserien illustrieren das Rasikapriya (buchst. «Die Vorlieben des Ästheten»), ein Werk zur Liebespoetik, das, wie oftmals in der Hofdichtung, mystische und weltliche Liebe vereint. Das Rasikapriya wurde von Keshavdas
44
(1555 –1617), Dichter am Hof von Orchha, in Brajbhasha, einer Dialektform des frühen Hindi, komponiert. Es genoss eine grosse Beliebtheit im Norden des indischen Subkontinents und wurde zum häufigen Malsujet, insbesondere im Fürstentum von Orchha. Anhand der Liebesgeschichte zwischen dem hinduis-tischen Gott Krishna und der Kuhhirtin Radha schildert Keshavdas alle Gefühle und Stimmungen, die zwei Liebende erleben können – und beschreibt dabei alle Typen von Heldinnen (nayika), die in der Liebesdichtung vorkommen. Das Rasikapriya ist eine Poetik und von der Ästhetiktheorie der rasa (Stimmungen) und bhava (Gefühle) beeinflusst. Dieses Werk malerisch wiederzugeben, ist dem-entsprechend eine Herausforderung. Die Hofmaler von Orchha entschieden sich für eine Reihe von ähnlichen Bildkompositionen: Eine Waldlichtung und ein Sommer-pavillon sind die beiden Orte, wo sich die drei Protagonisten – Krishna, Radha und Radhas Freundin – allein oder in wechselnden Konstellationen befinden. Durch die Gesten ihrer Hände und ihre Körperhaltung bringen sie die Gefühle und Stimmungen, die sie erleben – und die in den Betrachtenden erweckt werden sollen – zum Ausdruck. So sitzt zum Beispiel Krishna allein in der Waldlichtung, versunken in seiner Liebessehnsucht (2019.498). Die Tiere nehmen an seinem Kummer Anteil. Er drückt somit seinen Trennungsschmerz und sein Verlangen nach der Geliebten durch eine meditative Haltung aus.
Krishna und die Legenden um sein Leben waren beliebte Themen der Hofmaler von Orchha, wo der Krishnakult sehr verbreitet war. Unter den anderen
45
Bildserien der Schenkung illustrieren drei weitere Serien die Abenteuer des hin-duistischen Gottes: ein Manuskript zu Jayadevas Gitagovinda (ein Kunstgedicht über die Liebesgeschichte zwischen Radha und Krishna), eine Serie zum Bhagavata Purana (eine heilige Schrift des Krishnakults) und eine sogenannte Ragamala-Serie (Bildserie zu den Musikweisen und Stimmungen der Ästhetik, die meistens durch die Geschichte von Radha und Krishna malerisch geschildert werden). Be-sonders die Bhagavata-Purana-Serie erlaubte den Malern mehr Kreativität in den Bildkompositionen und den Sujets als die Rasikapriya-Serien (siehe 2019.476). Aber auch in der Ramayana-Serie (eine Illustration zu Valmikis Epos um den hin-duistischen Gott Rama) legen die Hofmaler von Orchha ihre Darstellungskraft und Imagination an den Tag (2019.475).
Zur Schenkung gehören, neben den Bundelkhandbildern, auch fünf Bilder aus der sogenannten Palam-Bhagavata-Purana-Serie, zwei Blätter aus einem jainis tischen Manuskript sowie vier Folios aus einem Sultanat-Shahnama (Buch der Könige). Das Museum Rietberg hat im Laufe der Jahre schon mehrere Blätter aus derselben Bhagavata-Purana-Serie und demselben Shahnama aus der Zeit des Gujarat-Sultanats (15. Jh.) erworben. Die neuen Bilder ergänzen somit diese Serien mit sehr schönen Stücken, die wir mit Freude in unserer Sammlung willkommen heissen dürfen. / VuR
46
Goda Putra (von raga megha)Folio aus der Guler-Ragamala-Serie von ca. 1790Meister der ersten Generation nach Nainsukh, ev. Ranjha
Indien, Pahari-Gebiet, Guler, um 1790
Pigmentmalerei mit Gold auf Papier; 2019.415
Provenienz: Alma Latifi Collection (1879–1959); 2013 Sotheby’s London, 9 October, 2013, lot 259;
2013–2019 Private Collection (USA); Carlton Rochell, Asian Art Gallery, New York
Ankauf aus Legat von Gabriele Louise Aino Schnetzer
Ausdruck der vielfältigen Verbindungen und gegenseitigen Einflüsse zwischen Dichtung, Musik und Malerei im indischen Subkontinent sind die sogenannten Ragamala-Serien, die verschiedene musikalische Stimmungen, die raga (buchst. «Farbe, Prägung, Stimmung, Zuneigung») bildlich wiedergeben. Sehr oft steht eine gedichtete Beschreibung des geschilderten raga auf der Rückseite der Bilder. Der raga megha (buchst. «Wolke») wird mit der Regenzeit assoziiert. Auf diesem Bild ist der Goda Putra, eine der «Modi» des raga megha, zu sehen. Jedoch scheint es sich hier um den Gott Rama als jungen Jäger zu handeln. Rama richtet seinen Pfeil auf ein Reh, das ihm aufgeregt den Kopf zuwendet. Die Dynamik der Be-wegung bringt die Spannung der Szene zur Geltung. Die Schlichtheit der Landschaft steigert die Spannung zwischen Jäger und Beute: Das Gras nimmt die Farbe des Abendrots an, das wunderbare Licht im Laub der Bäume und in der Wiese vermittelt eine sehr ruhige Stimmung, die mit dem Drama, das sich gerade ab-spielt, stark kontrastiert. Auch die zwei weissen Reiher, die im Fluss nach Fischen suchen, scheinen ganz unberührt.
Das Bild ist das Werk eines Künstlers aus der sogenannten «ersten Ge-neration nach Manaku und Nainsukh von Guler», deren Farbwahl, Arbeitsweise und Art, Gesichter zu malen, hier deutlich erkennbar ist. Mehrere talentierte Maler aus dieser Werkstatt wanderten am Ende des 18. Jahrhunderts nach Kangra, wo der Herrscher Sansar Chand (ca. 1765–1823) ein grosszügiger Mäzen für die bilden-de Kunst war. Beeinflusst von den neuen Landschaftsdarstellungen und vermutlich auch von lokalen Künstlern, entwickelten die Maler aus Guler eine sehr naturalis-tische Art, die auch in der Dynamik der Bewegungen der dargestellten Figuren zum Ausdruck kommt.
Der Goda Putra von raga megha wurde dank des Legats von Gabriele Louise Aino Schnetzer aus einer Privatsammlung in den USA erworben. Er bildet eine schöne Ergänzung zu mehreren Ragamala-Bildern aus der gleichen Serie, die das Museum im Laufe der Zeit sammeln konnte. / VuR
47
Dhanasri RaginiFolio aus der «Berlin-Bundi-Ragamala-Serie»Indien, Bundi, 1670
Pigmentmalerei mit Gold auf Papier; 2019.418
Provenienz: William K. Ehrenfeld collection, San Francisco (1934 – 2005);
Ludwig Habighorst; Francesca Galloway, London
Ankauf aus Legat von Gabriele Louise Aino Schnetzer
Vor ihrem Palast malt eine schöne junge Frau ein Porträt ihres Geliebten. Ihre Dienerin oder Vertraute unterstützt sie mit Ratschlägen. Hinter den beiden Frauen steht ein leeres Bett: Der Geliebte ist abwesend. Dies ist die traditionelle malerische
48
Darstellung der Dhansari Ragini, eine musikalische Weise, die am Abend gespielt wird. Sie steht für den Topos der Trennung der Geliebten und der Erwartung der Wiedervereinigung, der in der südasiatischen Dichtung äusserst beliebt ist. Die Dame blickt sanftmütig, während die Freundin gerade etwas Lustiges zu erzählen scheint und lächelt – vielleicht versucht sie, den Kummer ihrer Herrin zu vertreiben.
Das Bild gehört zu einer Ragamala-Serie aus Bundi, im heutigen indischen Bundesstaat Rajasthan, aus der schon mehrere Bilder in der Sammlung des Mu-seums vorhanden sind. Die ganze Serie spielt sich in demselben räumlichen Setting ab. Typisch für diese Serie sind die stilisierten spiraligen Wolken und die prachtvollen warmen Farben des Hintergrunds. Die Borte der Bilder sind mit sil-bernen Blumenmustern verziert.
Dieses Bild wurde dank des Legats von Gabriele Louise Aino Schnetzer bei der Francesca Galloway Galerie in London erworben. / VuR
49
König Janaka berichtet VishvamitraFolio 44 aus einer kleinen Ramayana-SerieMeister der zweiten Generation nach Nainsukh und Manaku von Guler
Indien, Pahari-Gebiet, Kangra, 1810 –1815
Pigmentmalerei mit Gold auf Papier; 2019.550
Provenienz: 1975–Juli 2019 Balthasar und Nanni Reinhart
Geschenk Nanni Reinhart-Schinz
«Da ich aber einmal einen Acker bearbeitete, wurde durch den Pflug ein Mägdlein von mir, der ich das Feld tüchtig umackerte, ans Licht gezogen; dieses nahm ich auf und gab ihm den Namen Sita.» So lautet die vom König Janaka erzählte Ge-schichte der Geburt Sitas im ersten Buch des Ramayana von Valmiki. Ganz unten links pflügt König Janaka das Land und findet ein kleines Mädchen, gekleidet in einen roten Sari. Sita ist also durch eine Wundergeburt der Erde entsprungen. Hier entspringt die Kleine aus einem matrizförmigen Gefäss, lächelnd aber steif, fast wie eine kleine Puppe. Oberhalb dieses ersten Teils der Geschichte sitzen König Janaka und seine Angehörigen zusammen mit Brahmanen unter dem könig-lichen Baldachin. Die Priester haben dem Kind ebenfalls ihren Segen gegeben. In einer dritten Palastszen, thront Janaka auf einer Terrasse, in lebendiger Unterhal-tung mit einem wandernden Asket – erkennbar an seiner Kleidung sowie an dem Gepäck, das neben ihm liegt. Handelt es sich hier um den Weisen Vishvamitra, dem Janaka laut der Überlieferung über die Wundergeburt berichtet? Es könnte gut sein, denn das kleine Mädchen sitzt in meditativer Haltung zwischen den beiden.
Im Hintergrund, auf Hügeln mit rötlichem Grass spielen sich weitere Szenen ab, mit Bauern auf den Feldern und Soldaten auf dem Weg zu einer Festung. Das Bild bezaubert durch seinen Reichtum an Details und durch die Feinheit der Ge-sichtsausdrücke der vielen Figuren. Malstil, Gesichter, Farbwahl und Stimmung erinnern stark an ein weiteres Bild der Museumssammlung aus einer Ramayana- Serie, das den Meistern der zweiten Generation nach Manaku und Nainsukh zu verdanken ist. Es ist höchst wahrscheinlich, das auch dieses Bild dieser Serie entstammt. Diese wunderschöne Darstellung von Sitas Geburt wurde dem Museum von Nanni Reinhart-Schinz geschenkt. / VuR
Valmiki, & Menrad, Joseph. Ramayana: Das Lied Vom Konig Rama; Ein Altindisches Helden gedicht
Des Valmiki in Sieben Buechern. München: Ackermann, 1897. Bd. I, S. 263 – 264.
50
Prinzessinen besuchen eine YoginiIndien, Mogul, Awadh, 1770–1780
Pigmentmalerei mit Gold auf Papier; 2019.551
Provenienz: 1970er – Sommer 2002 Sammlung Shahram Pahlavi, bis 1979 im Iran,
dann London/Paris; Sommer 2002 – 2013 Sammlung Mehdi Metghalchi, London;
Galerie Francesca Galloway, London; 2013 – 2019 Catharina Dohrn (Dauerleihgabe im MRZ)
Geschenk Catharina Dohrn
Mitten in der Nacht besucht eine Gruppe von Prinzessinnen oder Hofdamen eine Yogini (Asketin). Sie bringen ihr Opfergaben dar, und eine der Damen äussert ihr Anliegen. Die Yogini, in einem hellrosa Gewand und mit einem Rosenkranz in der linken Hand, hört ihr mit ungerührtem Gesicht zu, während ihre Schülerin, an einen Baum gelehnt, die Szene beobachtet. Im Hintergrund steht ein Reiter bei einem Brunnen und fragt Dorffrauen nach Wasser. Am Horizont eilt eine Soldaten-truppe zu einer brennenden Stadt. Ganz weit hinten im Dunkel der Nacht kann das Auge noch die Struktur eines Palasts ausmachen.
Durch die Arbeit mit Licht und Schatten vermittelt der Maler eine geheimnis-volle Stimmung, die uns mit vielen Fragen zurücklässt. Wer sind denn die vorneh-men Damen, warum besuchen sie mitten in der Nacht eine Asketin mit vermutlich tantrischen Kräften. Ist der Reiter auf dem Weg zur brennenden Stadt?
Es handelt es sich nicht um eine bekannte Episode aus einer Legende, sondern um mehrere beliebte Topoi in der sogenannten provinziellen Mogul malerei des 18. Jahrhunderts. Das Bild wurde im späteren Mogulstil, wahrscheinlich in einer Werkstatt des Königreichs von Awadh gemalt. Neben der raffinierten Per-spektive und dem Spiel mit Licht und Schatten sind auch die Feinheit der Details der Szene im Vordergrund und die Bildkomposition bemerkenswert. Diese Miniatur, bisher eine Dauerleihgabe in der Sammlung von Miniaturmalerei, wurde dem Mu-seum 2019 von Catharina Dohrn geschenkt. / VuR
52
Kampfszene mit BogenschützenFolio aus dem «jainesken» ShahnamaIndien, Gujarat, 15. Jh.
Pigmentmalerei auf Papier; 2019.446
Provenienz: Eva und Konrad Seitz
Geschenk Sammlung Eva und Konrad Seitz
Kai Khusrau vergibt Tus und schickt ihn mit der Armee nach TuranFolio aus dem «jainesken» ShahnamaIndien, Gujarat, 15. Jh.
Pigmentmalerei auf Papier; 2019.447
Provenienz: Sammlung Eva und Konrad Seitz
Geschenk Sammlung Eva und Konrad Seitz
Könige und Helden, Freunde, Erzfeinde, Krieg, Macht, Liebe, Mystik und Tod. Dies sind die Themen im Gründungsepos der persischen Kultur, dem Shahnama (buchst. «Chronik der Könige») des Dichters Ferdowsi. Es erstaunt daher nicht, dass dieses iranische Nationalepos auch in Zentralasien und im indischen Subkon ti nent – Gebiete, die stark vom persischen Einfluss geprägt sind – gros-sen Anklang gefunden hat. In der persischen Malerei wird das Shahnama nach einer bestimmten Ikonographie illustriert. Als der Text nach Südasien wanderte, wurde er auch im Auftrag muslimischer Patrons von lokalen Malern illustriert. So entstan den Manuskripte in anderen Malstilen, wie das sogenannte «jaineske» Shahnama aus der Gujarat-Sultanat-Zeit (15.–16.Jh.), aus dem diese zwei Bilder stammen. Wie Prof. B.N. Goswamy in seinem Buch zu diesem Manuskript darlegt, ähneln diese Miniaturen den Illustrationen von jainistischen Manuskripten aus der gleichen Region sehr.
«Krieg führen – die Iraner gegen die Turaner» lautet die rote Inschrift auf der ersten Manuskriptseite (2019.446). Die iranischen Soldaten bekämpfen die turanischen Bogenschützen. Das Bild ist symmetrisch aufgebaut, mit vier Reitern auf beiden Seiten. Nur einer der Iraner hält eine Keule statt einen Bogen. Handelt es sich um eine führende Figur oder um einen der grossen Helden des Epos? Nichts lässt darauf schliessen. Auch die Kettenhemden, Helme und die Ausrüstung der beiden Soldatengruppen sind ganz ähnlich. Bemerkenswert ist hier besonders die dynamische Bewegung der Figuren und die ausdrucksvollen Köpfe der Pferde.
Auf die zweiten Manuskriptseite (2019.447) sitzt ein Herrscher auf einem Thron unter einem Baldachin und Schirmen, im Gespräch mit einer Gruppe von drei Kriegern. Laut der roten Inschrift am Rand handelt es sich hier um den König
53
Kai Khusrau, der den Grosshelden Rustam empfängt. Rustam bringt Tus mit, den ehemaligen Heerführer der Iraner, der in Ungnade gefallen ist, nachdem die Armee mehrere Niederlagen hinnehmen musste. Auf Rustams Wunsch erhält er die könig-liche Vergebung. Die roten Inschriften, die überall auf den Blättern des Manuskripts zu finden sind, sind in einer anderen und wahrscheinlich späteren Handschrift als der Text selber. Sie geben Hinweise zu den Bildern, jedoch kann nicht davon ausgegangen werden, dass der Verfasser die Episoden richtig erkannt hat, so er-staunt es, dass Rustam ohne seinen legendären rötlichen Bart dargestellt ist.
Beide Bilder werden dem Museum vom Ehepaar Seitz, zusammen mit der Sammlung von Malerei aus dem Bundelkhand, geschenkt. Wir freuen uns sehr, somit neue Blätter aus diesem wunderschönen und wertvollen Manuskript in der Sammlung des Museums willkommen zu heissen. / VuR
Goswamy, B.N. A Jainesque Sultanate Shahnama and the Context of Pre-Mughal Painting in India.
Zürich: Museum Rietberg, 1988.
Firdausi, Warner, Arthur George, & Warner, Edmond. The Shahnama of Firdausi. Abingdon, England:
Routledge, 2002.
54
Meister der zweiten Generation nach Nainsukh von GulerKrishna bittet Radha um VergebungIndien, Werkstatt im Pahari-Gebiet, um 1825
Pigmentmalerei mit Gold auf Papier; Blatt 19,5 × 17,8, Bild: 14,7 × 13 cm, 2019.549
Provenienz: Sammlung Werner Reinhart (verm. Kauf Lahore, 1908 oder
spätestens Mumbai 1928; Sammlung Balthasar und Nanni Reinhart (1951– 2019)
Geschenk Nanni Reinhart-Schinz
Publiziert: Gradmann, Erwin, 1949, Abb. 11 (Orbis Pictus 6, Bern); B.N. Goswamy und
Eberhard Fischer, 1990, Pahari Meister, Nr. 159, Zürich (Museum Rietberg)
Früh am Morgen auf der Terrasse eines Palastes: Radha, in Begleitung einer Dienerin, sitzt gegen ein grosses Kissen gelehnt auf einem Teppich – vor ihr zwei flache Kissen und eine verschlossene Betelbüchse, ein Wasserkrug mit Wasch-becken. Sie ist in sich versunken, wirkt seelisch verletzt und abgewandt. Ihre rechte Hand hat sie mit abweisender Gebärde gegen den gelb-gewandeten, blau häutigen Krishna ausgestreckt. Dieser hat sich zu Boden geworfen und berührt mit seiner Stirn fast ihren Gewandsaum. Radhas Gesichtsausdruck ist streng, maskenhaft, Krishnas Augen hingegen scheinen leicht zu lächeln. Er ist wie ein dandyhafter Aristokrat mit einem Juwelen geschmückten Turban bekleidet und trägt dazu einen knöchellangen jama-Rock und ein etwas dunkleres, mit Goldfäden gemustertes Schultertuch. Seinen Händen ist ausser einem Hirtenstab auch eine Lotosblüte entfallen, die sich in den frühen Morgenstunden noch nicht geöffnet hat. Es mag wohl sein, dass die in der Spitze des Arkadenbogens gemalte voll erblühte Lotos-blume mehr als nur den Haken kaschieren soll, an dem die grüne Schnur zur Befestigung der rosa Jalousie befestigt ist, und dass der Maler diese zu der senk-recht unter ihr am Boden liegenden, ebenfalls gestielten, aber erschlafften Lotos-blüte in Beziehung setzen wollte. In jedem Fall fehlt dieses Deckenornament auf einem vergleichbaren Blatt (s. RVI 2134, Pahari Meister, Nr. 158).
Und was ist das Bildthema? Es handelt sich sicher um eine sogenannte vibhrama-hava-Szene: Die Geliebte hat die ganze Nacht auf ihren Geliebten ge wartet; er ist aber nicht gekommen, obwohl dies vereinbart war, und sie nimmt – wohl zu Recht und aus Erfahrung – an, dass er untreu war und bei einer anderen Frau genächtigt hat. Nun ist sie verärgert; aber es ist unwahrscheinlich, dass diese Verstimmung lange anhalten wird. In der Rolle des untreuen Mannes wird hier Krishna gezeigt, in derjenigen der leidenden, zürnenden, aber bald wieder ver-söhnlich gestimmten und liebenden Heroine seine ewige Geliebte Radha. / FiE
56
Jainistisches PataIndien, 1850 – 1900
Pigmentmalerei auf Baumwolle; 2019.437
Provenienz: 1960 – 1970 Mehra, Kunsthändler im Red Fort, Delhi, Indien;
1970 –1993 Bodo Schmitz, Sammler, Kronenberg, Taunus; 1993–2019 Bettina und Winfried
Wieland, private Sammler in Deutschland, Grafenau; Koller Zürich, 4. Juni 2019, Lot 466
Ankauf mit Mitteln der Stadt Zürich
Kontinuierlich wuchs die Sammlung an jainistischen Kunstwerken im Museum. Angefangen mit dem Interesse von Dr. Eberhard Fischer, der als erster Direktor des Museums eine erste Jaina-Ausstellung 1974 im Helmhaus in Zürich realisierte. Mit den Schenkungen der letzten Jahre besitzt das Museum heute eine wichtige Sammlung, die es zu zeigen gilt (Balbir/Beltz 2017). Die Idee, eine grosse Aus-stellung vorzubereiten, bekam neue Unterstützung durch die Kooperation mit dem CERES in Bochum (siehe S. 109). Denn der in Bochum arbeitende ausgewiesene Jaina-Spezialist Dr. Patrick Krüger zeigte grosses Interesse an einer Zusammen-arbeit. Nun ist es so weit: Ende 2022 oder 2023 wird das Rietberg eine grosse Sonderausstellung über die Kunst des Jainismus zeigen mit eigenen Beständen, aber auch mit Leihgaben aus Indien.
Dank der neuen städtischen Ankaufsmittel und der Expertise von Eberhard Fischer gelang es uns, ein wichtiges Kunstwerk für die Ausstellung zu erwerben. Es wird ein wichtiges Schlüsselwerk zum Thema Pilgern in der Ausstellung sein, denn es ist die Darstellung eines Pilgerweges.
Pilgern ist eine der zentralen rituellen Handlungen im Jainismus. Denn auf ihrer Wanderschaft besuchten jainistische Mönche und Nonnen die heiligen Stätten, die in den Legenden mit dem Leben und Wirken der Jainas verwoben waren; häufig war an diesen Stellen ein Schrein oder ein Tempel errichtet worden. Im Mittelalter entwickelten sich einige dieser Pilgerorte zu bedeutenden Wallfahrts-zentren, an denen mit der Zeit ausgedehnte Tempelkomplexe entstanden. Diese Anlagen wurden zunehmend auch von Laien aufgesucht, die entweder allein pil-gerten oder Gruppen wandernder Mönche begleiteten. Die Pilgerfahrt wurde auf diese Weise zu einem wichtigen Bestandteil der jainistischen Praxis. Die Herstel-lung sogenannter Tı rtha Pat·as (Skt. tirtha=Pilgerstätte; Skt. pata=Stoffbahn, Stoffbild), deren Betrachtung die Pilgerfahrt gewissermassen ersetzen konnte, zeigte schliesslich die Topographie der wichtigsten Pilgerstätten und die dort zu bewältigende Wallfahrt in bildlicher Form. Grossformatige Textilmalereien dieses Genres entstanden vor allem im 18. und 19. Jahrhundert in Gujarat und Rajasthan
57
und zeigen häufig die Tempelanlage von Shatrunjaya oder Kompositabbildungen verschiedener Pilgerzentren.
Das vorliegende Bild aus dem 19. Jahrhundert zeigt das Panorama einer Tempelfestung. Die Szenerie ist bestimmt durch die weitläufige Tempelanlage mit zahlreichen Gebäuden und Schreinen, die in eine von Tieren bevölkerte Gebirgs-landschaft eingebettet ist.
Auf dem Bild ist der Pilgerweg durch einen goldenen Farbauftrag markiert und setzt sich ab von den offenen Plätzen zwischen den Gebäuden, auf denen zahlreiche Pilger abgebildet sind. Die Malerei besticht durch eine besondere Detailfreude, die sich nicht allein auf die Tempelanlagen und die Pilger beschränkt, sondern auch die Landschaft einschliesst; dies zeigt sich insbesondere an den zahlreichen Tieren, welche innerhalb der persisch anmutenden Felsformationen in der oberen Bildzone platziert sind.
Der obere Abschnitt des Bildes wurde zu einem unbekannten Zeitpunkt aus getauscht oder ergänzt, wobei der angefügte Bildteil stilistisch mit der übrigen Malerei korrespondiert. An den Rändern wurde das Bild anscheinend beschnitten, auch fehlt hier die übliche Umrahmung mit floralem Dekor. / BeJ, KrP
Lit.: Nalini Balbir und Johannes Beltz, «Jain Art at the Museum Rietberg», Jaina Studies, CoJS
Newsletter, vol. 12, March 2017, S. 50 – 53.
58
JAPAN
No-Gewänder aus der ehemaligen Sammlung des Barons Fujita Denzaburo
No-Gewand vom Typ atsuita mit Dekor von Paulownia und Phoenixen auf rot-weiss-braun alternierenden FarbflächenJapan, Edo-Zeit, 2. Hälfte 18. bis Mitte 19. Jh.
Seide, Köperbindung mit zusätzlichen Schussfäden aus farbigen Seidenfäden; 2019.573
Provenienz: 1750–1870 verschiedene Daimyo-Familien; 1870 – 2019 Sammlung Baron Fujita
Denzaburo (1841–1912); 2019 –Okt 2019 Takeshi Kimura, Tokyo
Ankauf mit Mitteln des Rietberg-Kreises
In diesem Jahr ist dem Museum Rietberg durch die enge Beziehung zu japanischen Experten ein grosser Coup gelungen, und ein Konvolut von 18 prächtigen No-Gewändern aus der prestigereichen Sammlung des Barons Fujita Denzaburo (1841–1912) konnte erworben werden. In Japan werden No-Gewänder traditionel-lerweise in Schreinen, wohin sie gestiftet wurden, in Schauspieler-Familien oder in den Sammlungen von Feudalfürsten, die die grössten Förderer dieser Theater form waren, aufbewahrt und tradiert. Äusserst selten kommen sie auf den öffentlichen Kunstmarkt. Die angekauften Gewänder datieren in das 18. bis Ende des 19. Jahr-hunderts und präsentieren das gesamte Repertoire der No-Theaterkostüme.
Fujita, der aus einer Sake-Brauer-Familie in der Provinz Yamaguchi stammte, avancierte zu einer wichtigen Persönlichkeit in Politik und Wirtschaft des moder-nen Japans. Wie viele der bedeutenden Industriellen der Meiji-Zeit (1868 –1912) war er ein grosser Kunstliebhaber und -sammler. Seine umfangreiche Sammlung an chinesischer und japanischer Kunst bildet den Grundstock für das 1954 eröffnete Fujita Art Museum in Osaka, das heute noch von seinen Nachfahren geleitet wird. Die erworbenen No-Gewänder sind jedoch nicht Teil der Museumssammlung, sondern waren im Besitz der Familie geblieben. Gesammelt hat sie Baron Fujita in den späten 1870er–1890er-Jahren, als viele Feudalfürsten (daimyo) aufgrund der veränderten politischen Lage ihren Besitz veräussern mussten, um sich finanziell über Wasser zu halten. Die jüngsten Stücke wurden von Baron Fujita selbst für seinen privaten Gebrauch in Auftrag gegeben, da er ein passionierter No - Fan und Laienschauspieler war.
Seit dem 14. Jahrhundert sind No-Gewänder von der Mode des Adels be-einflusst. Die frühesten Kostüme waren eigentlich Kleidungsstücke von hochrangigen Samurai. Es war üblich, dass die Fürsten, als Zeichen ihrer Anerkennung einer
59
hervorragenden Aufführung, ihre aus kostbaren Brokatseiden bestehenden Roben auf die Bühne warfen, um die Schauspieler zu belohnen.
Aus ihnen entwickelten sich im Laufe der Zeit die verschiedenen Typen von Gewändern:
Choken, maiginu, happi und sobatsugi sind Obergewänder für Frauen- respektive Männerrollen; kariginu (einfach oder gefüttert) werden für Götter oder Hofbeamten verwendet; karaori sind für Frauenrollen bestimmt; das Gegenstück dazu sind atsuita; nuihaku und surihaku Untergewänder für Männer und Frauen, und hangiri sind Beinbekleidungen für Männerrollen.
Bei einer Aufführung werden die Gewänder kombiniert und geschichtet ge-tragen, um eine grosse Variation an Bühnenfiguren zu schaffen und um die Stimmung einer Szene und deren jahreszeitliche Einbettung zu evozieren. Eine korrekte Aus-wahl der verschiedenen Kostümteile war besonders wichtig, da sie nicht nur die visuelle Attraktion einer Aufführung ausmachen, sondern auch als Identifikations-merkmale für die verschiedenen Rollen in einem Stück dienen. / TrK
60
Surimono aus der Sammlung Gisela Müller und Erich Gross
Der Krieger Asahina Saburo schaut händeklatschend einem Oni zu, der einen Schal in eine Schlange verwandeltTotoya Hokkei (1780 –1850)
Japan, späte Edo-Zeit, 1833
Vielfarbendruck; 2019.67
Provenienz: Richard Kruml, London; Dezember 1979 – 2019 Gisela Müller und Erich Gross, Zürich
Geschenk Gisela Müller und Erich Gross
Stilleben mit Bonsai-Kiefer und Adonisröschen in Blau-Weissem-Porzellantopf, Handtuch, Waschbecken und WasserkanneKatsushika Hokusai (1760 –1849)
Japan, Edo-Zeit, 1822
Vielfarbendruck; 2019.202
Provenienz: Koller-Auktion, Zürich, Set 7156; Oktober 2008 – 2019 Gisela Müller
und Erich Gross, Zürich
Geschenk Gisela Müller und Erich Gross
Nach der grosszügigen Schenkung von 248 Haikai-Surimono im Jahr 2018, von denen ein Drittel in einer kleinen Kabinettausstellung in der Park-Villa Rieter zu sehen waren, hat Erich Gross dem Museum dieses Jahr weitere 408 kyoka-Surimono und Kalenderblätter (egoyomi) geschenkt. Die gut erhaltenen Blätter stammen aus dem 19. Jahrhundert. Als Illustratoren waren namhafte Künstler wie zum Beispiel Hokusai, Kunisada, Gakutei, Hokkei beteiligt.
Die Beschaffenheit und kulturelle Bedeutung der Surimono ist bereits im letzten Jahresbericht ausführlich besprochen worden. An dieser Stelle möchten wir daher eines der interessantesten Blätter näher vorstellen, um nochmals die Besonderheit der kyoka-Surimono hervorzuheben, die in der engen Verbindung zwischen Text und Bild liegt.
Für die heutigen Betrachter von Surimono, insbesondere wenn sie nicht über die Hintergründe der japanischen Kultur verfügen, bleibt der Genuss eines Blattes ein rein visuelles Erlebnis. Im 19. Jahrhundert jedoch, als diese kunstvoll gestalteten Gedichtblätter entstanden, bestand der Reiz für die Empfänger da-rin, nicht nur die literarischen, sondern auch die motivischen Anspielungen auf einem Werk zu entschlüsseln.
61
So sieht dieses Blatt (siehe Einladungskarte), das zu einer Serie von etwa 20 Surimono gehörte und vom berühmten Holzschnittmeister Katsushika Hokusai 1822 im Auftrag der Yomo-Dichtergruppe zur Feier des Pferde-Jahres gestaltet wurde, zunächst wie ein hübsches Stillleben aus: Kunstvoll arrangiert ist ein Blumen-topf aus Blau-Weissem-Porzellan mit einer Bonsai-Kiefer und einem Adonisröschen. Beide Pflanzen waren aufgrund ihrer Glück verheissenden Symbolik eine beliebte Neujahrsdekoration. Daneben steht ein niedriger Lackständer, an dem ein weisses Handtuch mit einem Landschaft-Muster befestigt ist. Im Vordergrund befinden sich ein Wasserbecken aus schwarz-lackiertem Holz und eine dazugehörige Kanne für heisses Wasser. Beide sind dekoriert mit einem in Goldlack gemalten Land-schaftsbild.
Die Bedeutung der Motive erschliesst sich erst mit dem Verständnis des Scherzgedichtes von Sansuiten Maumi, das in feiner Schrift in der oberen linken Ecke steht und wie folgt lautet:
62
Hatsuhikage In den ersten StrahlenNioteru haru ni der FrühlingssonneOmi no ya auf dem Biwa-SeeKagami no yama o glitzert auchMiru mo mabayuki das Spiegel-Gebirge
Der im Gedicht erwähnte Biwa-See ist Japans grösster Binnensee und viel gerühmt für seine landschaftliche Schönheit. Bereits seit dem 15. Jahrhundert wurde in An-lehnung an den chinesischen Topos «Die Acht Ansichten der Flüsse Xiao und Xiang» acht Ortschaften um den Biwa-See ausgewählt, die in Gedichten besungen und später in unzähligen Bildern verewigt wurden.
Wenn wir uns – mit diesem Wissen gewappnet – Hokusais Bildrätsel noch-mals genauer anschauen, werden wir alle acht Ansichten wiederfinden: Awazu als Muster auf dem Handtuch, der Berg Hira und die Tempel Mii und Ishiyama in der Landschaft auf dem Blumentopf, das Handtuch selbst suggeriert die Segel boote von Yabase. Die chinesische Brücke von Seta erscheint im Dekor des Beckens und der schwimmende Tempel von Katada auf der Kanne. Die Bonsai-Kiefer sym-bolisiert schliesslich die berühmte Kiefer von Karasaki.
Dank der grosszügigen Schenkung von Erich Gross besitzt das Museum Rietberg nun die wohl umfangreichste und qualitativ beste Surimono-Sammlung in Europa. Damit konnten wir bereits in diesem Jahr eine Ausstellung veranstalten. Eine weitere Schau mit circa 100 Exponaten ist im Government Museum and Art Gallery Chandigarh Ende 2020 geplant. / TrK
63
KONGO
Noch nicht identifizierter Tshokwe-SchnitzerMwana pwo, «Junge Frau»-Maske Südwest-Kongo, um 1935
Holz, Gras, Lehm, Metallringe; 2019.423
Provenienz: 1938 erworben in situ von Hans Himmelheber; 1939 Lore Kegel,
später Boris Kegel-Konietzko; 2019 Ankauf mit Mitteln des Rietberg-Kreises
Wir wissen kaum etwas über die verschiedenen Tshokwe-Schnitzer, die in der ersten Hälf te des 20. Jahrhunderts im Südwest-Kongo tätig waren. Als Hans Himmelheber 1938 drei Maskenbildner in dieser Region kennenlernte, war er von ihrer Eigenwilligkeit und ihren Gestaltungsfähigkeiten beeindruckt. Er berichtet, dass Tshokwe-Bildhauer, nachdem sie eine mehrjährige Lehrzeit durchlaufen hatten, gerne in Gesellschaft ihrer Kameraden schnitzten und dies dann mehr zum Zeitvertreib taten als um mit ihren Produkten Geld zu verdienen, weshalb sie sich beim Gestalten für jedes einzelne Werk meist gehörig Zeit liessen. Dennoch produzierten sie höchst professionell subtile und recht individuell gestaltete Masken und verzierte Gerätschaften.
Als 1938 Hans Himmelheber diese Maske kaufte, mag sie kaum ein Jahr-zehnt verwendet worden sein. Sie war eindeutig von einem erfahrenen, ja routinier-ten Bildhauer geschaffen, der, bei strikter Einhaltung der Symmetrie, sowohl mit scharfen Kanten als auch mit fast realistischen Details dieser mwana pwo, Maske mit den Gesichtszügen einer «jungen Frau», einen eigenständigen Ausdruck zu verleihen wusste.
Die besten pwo-Masken der Tshokwe-Schnitzer sind so etwas wie «Halb-Porträts», die neben einer generischen Bezeichnung als akishi oder Geistwesen stets einen Eigennamen haben, unter dem sie, wenn sie von ihren Besitzern er-folgreich getanzt werden, im Land bekannt sind. Diese Masken werden nach den Gesichtszügen schöner oder auch berühmter Frauen geschnitzt; sie zeigen somit stolze oder auch eitle Schönheiten, hübsche junge Mädchen oder auch angesehene Wahrsagerinnen und Führerinnen von Frauengruppierungen. Hierbei entsprechen die Maskengesichter dem allgemein vorherrschenden Schönheitsempfinden der Tshokwe; die Bildhauer ergänzten dieses typisierte Gesicht aber häufig um Züge, die ihnen bei einer bestimmten Frau aufgefallen waren und die sie bewunderten. So erzählte ein Tshokwe-Schnitzer 1938 Hans Himmelheber, dass er schon mal von seinem Model die Proportionen der Nase nicht nur abgeschaut, sondern «ge-stohlen» habe, indem er diese bei guter Gelegenheit mit einem Strohhalm mass
64
und dann auf sein Werk übertrug! Auf jeden Fall wird vom Publikum gewünscht, dass eine individuelle Note in solch einem weitgehend standardisierten Masken-gesicht aufblitzt.
Bei vorliegender Maske spricht alles für ein Jungmädchengesicht: so der volle Mund mit den leicht aufgeworfenen Lippen und den spitz zugefeilten Zähnen, das gerundete, kräftige Kinn, die fülligen Wangen, die sehr zierliche Stubsnase und in den konkaven Augenhöhlen die bis auf schmale Schlitze geschlossenen Augen unter sichelförmigen Brauen. Das Gesicht ist vielfach geschmückt mit symmetrisch eingravierten Tatauier-Mustern. Auf die Stirn ist – wie auf praktisch bei allen pwo-Masken – ein sogenanntes Portugieser- oder Faden-Kreuz einge-schnitten; an den Schläfen sitzen gebogene und auf den Wangen abgewinkelte Doppellinien, die in Kreisen enden. Sie werden als «fliessende Tränen» gedeutet. An die Ohrläppchen der Maske sind noch Ringe und in das Nasenbein ein Stäbchen gefügt: Solche Schmuckformen hat Hans Himmelheber auf Porträts von Tshokwe- Frauen fotografisch dokumentiert. Über der Stirn der Maske ist ein breites Band, wohl ein Haargeflecht imitierend, reliefartig ausgeschnitten und darüber die schön geflochtene Perückenkappe aus Gras und Lehm satt angebunden.
Die Maske ist sorgfältig geschnitzt, kantig mit dem Dechsel gehauen und abschliessend sorgfältig mit einem Messer geglättet; ihre rote Farbe erhielt sie, indem sie in Öl mit Oker-Erde gekocht wurde. Geschnitzte Details wie Lippen, Brauen und das Stirnband sind vor der Färbung mit einem glühenden Messerblatt geschwärzt und die winzigen Zähne mit Kalk geweisselt worden, was den leben-digen Ausdruck des Maskengesichts verstärkt.
Im Katalog «Fiktion Kongo» (Abb. 372 – 375) ist neben dieser pwo-Maske mit dem sanften Mädchengesicht eine chihongo-Maske mit dem Gesicht eines alten Mannes, erkennbar am kahlen Schädel, den eingefallenen Wangen, dem breiten Mund und klobigen Kinn, abgebildet; dazu sind noch Fotos von solchen Maskengestalten gesetzt, die Hans Himmelheber in der Herkunftsregion der vor-liegenden Maske 1938 in Aktion aufgenommen hat. / FiE
Literatur: Felix, Marc, Masks in Congo, Hongkong: Ethnic Art and Culture Ltd. 2016 Guyer Nanina
und Michaela Oberhofer, Fiktion Kongo, Zürich: Museum Rietberg – Scheidegger und Spiess
2019; Himmelheber, Hans, «Art et Artistes Batshiok», in Brousse 3, S. 17–31 Kinshasa: 1939; Neyt,
François, Fleuve Congo, Paris: Musée du quai Branly – Fonds Mercator 2010.
66
TrinkhornDemokratische Republik Kongo, Kete, vor 1939
Rinderhorn; 2019.439
Museum Rietberg Zürich, Geschenk Eberhard und Barbara Fischer
Provenienz: 1939 Hans Himmelheber, in situ erworben
2003–2019 Susanne Himmelheber
Im westlichen Waldland der Republik Kongo leben südlich vom Volk der Bushoong- Kuba die mit diesen verwandten Kete. Sie gelten als Nachfahren sehr früh in dieser Region niedergelassener Bantu-Gruppen. Hans Himmelheber hat hier vor allem kunstvoll verzierte Holzgefässe zum Aufbewahren von Rotholz erworben. «Sonst sah ich bei den (Ba)Kete nur noch ein prachtvolles, über und über ornamentiertes Kuhhorn, aus dem ihr Oberhäuptling seinen Palmwein trank.» (Himmelheber, 1960, S. 381, Abb. 30). Dieses fast metallisch-gelb glänzende Zebu-Stier-Horn mit den makellos eingeschnittenen Flechtornamenten und dem facettiert geschnitz ten Griffstück war somit einst ein wichtiges Herrschaftszeichen eines Kete- Fürsten und wurde vermut lich mehr zur Schau gestellt, als dass aus ihm effektiv ein Herrscher Palmwein trank.
Gewebemuster bildende Schlingen wie auf diesem Horn finden sich schon auf den frühesten, ins beginnende 17. Jahrhundert datierten Raphia- Plüschstoffen aus dem Königreich Kongo (z.B. im Pitt Rivers Museum in Oxford). Sie wurden ähnlich noch in den 1930er-Jahren bei den Kuba und Kete angefertigt – und damals auch von älteren Personen getragen. Auf Schachteln, Bechern, Krügen und Klistie-ren aus Holz sind sie häufig, auf viel schwerer zu beschnitzenden Hörnern hinge-gen selten. / FiE
Literatur: Himmelheber, Hans, Negerkunst und Negerkünstler,
Klickhardt und Biermann Braunschweig: Klickhardt und Biermann 1960.
67
Zierbeil eines Pende-SchnitzersDemokratische Republik Kongo, Pende, vor 1939
Holz; 2019.438
Geschenk Barbara und Eberhard Fischer / Susanne Himmelheber
Provenienz: 1938/39–2003 Hans Himmelheber, in situ erworben
2003–2019 Susanne Himmelheber
Dieses filigran geschnitzte, elegant und zerbrechlich wirkende hölzerne Beil mit einer schmalen Eisenklinge hat Hans Himmelheber 1938 in situ gekauft und als Abzeichen eines Pende-Schnitzers gedeutet (Himmelheber 1960, S. 28) – vermutlich wurde ihm dies so vom Verkäufer erläutert. Mehrere Beile sind als Herrschafts-embleme von den Pende und ihren Nachbarn, den Tshokwe, bekannt; Häuptlinge trugen sie über die linke Schulter gelegt, wenn sie auf Reisen waren, um so ihre gesellschaftliche Stellung erkennbar zu machen (Strother 2008, S. 107).
Im vorliegenden Werk ist die Axtklinge quer gestellt wie bei einem Dechsel («Querbeil») eines Holzbildhauers, der Meissel und Schlegel in einem ist, und der Schaft ist als Halbfigur geformt. Diese ist formal reduziert zu einem stabartigen Griff, der in einen leicht abgewinkelten Torso mit parallel verlaufenden stegartigen Armen – mit an den kaum kräftigeren Leib gelegten Händen – übergeht. Über einem überproportional langen Hals mit kräftigem Adamsapfel sitzt ein Kopf, mit ovalem «herzförmigem» Gesicht, mandelförmigen Augen und schmaler, langer Nase. In den lippenlosen Mund ist die langgezogene, leicht gebogenen Klinge eingedornt. Besonders schön ist die vom Hinterkopf herabhängende zweizopfige, an Antilopenhörner erinnernde Frisur, die der so zarten Figur Volumen verleiht.
Es ist wahrscheinlich, dass dieses Abzeichen eines selbstbewussten Pende- Schnitzers dessen Rang in der Gesellschaft verdeutlichen sollte. In der Figur, die in den Holzgriff integriert wurde, könnte zusätzlich noch ein magisch wirkender Hilfsgeist verbildlicht sein, dank dem der Bildhauer Aussergewöhnliches zu schaffen vermag. Es gibt eine mächtige Kraftfigur im Universitätsmuseum von Iowa, USA (Strother 2008, Pl. 41), deren Gesicht und Körper sehr ähnlich geschnitzt sind. Aber viele Details wie die langen Haarzöpfe, die dünnen, gewinkelten Arme und die linsenförmigen Augen sind stilistische Elemente, die häufiger bei Kunstwerken von Tshokwe- als von Pende-Bildhauern anzutreffen sind (vergl. Falgarettes- Leveau und Wastiau 2010, S. 149, 126). / FiE
Literatur: Falgayrettes-Leveau, Christiane und Boris Wastiau (Hrsg.), Angola: Figures de pouvoir,
Paris, Musée Dapper 2010; Himmelheber, Hans, Negerkunst und Negerkünstler, (Klinckhardt und
Biermann), Braunschweig, 1960; Strother, Zoë S. Pende, Mailand (Five Continents) 2008.
68
Künstler der SongyeGrosse nkishi-Kraftfigur in Gestalt eines würdigen Mannes Demokratische Republik Kongo, Songye oder Kalebue, vor 1939
Holz; 2019.440
Provenienz: 1939 Hans Himmelheber, in situ erworben
2003 Susanne Himmelheber
Geschenk Susanne Himmelheber, Eberhard und Barbara Fischer
Aussergewöhnlich ausdrucksvoll ist diese relativ grosse Statue eines bärtigen Mannes reifen Alters, die ein noch nicht identifizierter Songye-Bildhauer wohl um 1920 geschaffen hat. Dieser kompetente Schnitzkünstler war vermutlich recht er-folgreich, sind doch weitere Werke von seiner Hand oder seiner näheren Umgebung erhalten: so beispielsweise eine kleinere bartlose Männerfigur, ebenfalls 1939 in situ von Hans Himmelheber gekauft, die heute im Museum Rietberg aufbewahrt wird (Guyer und Oberhofer 2019, Abb. 30) und eine stark patinierte grössere Skulp-tur mit (später) ausgebrochenen Augen und leicht zur Seite gebogenem Kopf, die der Songye-Spezialist Pater François Neyt der «Songye-Stilregion der südlichen Milembwe und Belande» zuordnet (Neyt 2010, Nr. 165).
Einst war bei dieser Holzskulptur sowohl im Bauchnabel wie auch im Kopf Kraftsubstanz eingefügt. Auch war sie ab den Hüften stets mit einem Basttuch bekleidet, weshalb das Holz unterhalb der Taille kaum Spuren von regelmässiger Ölung noch von Alterung zeigt. Bevor man die Skulptur 1939 an Hans Himmelheber verkaufte, wurden die Kraftsubstanzen vom Bauch und auch aus dem Kopf weit-gehend entfernt; dabei ist ein Teil der Schädelkalotte weggebrochen.
Heute wirkt die Skulptur nicht mehr als «Kraftfigur», sondern als Kunstwerk! Man beachte, wie kraftvoll diese Männerfigur auf ihrem Sockel steht und wie selbstbewusst hier der Schnitzer bei ihrer Gestaltung nicht-realistische Proportio-nen zu einer imponierenden Lösung anwendete: Wenn man misst, ist das Verhält-nis der Beine zu Körper zu Kopf wie 2 × 3 × 4 – der Kopf mit Bart ist annähernd doppelt so lang wie die Beine! Die extrem verkürzten, fast waagrecht liegenden Oberschenkel enden kantig über stämmigen Unterschenkeln, was den Eindruck erweckt, die Figur würde federnd hocken, sei bereit, jederzeit sich zu voller Grösse aufzurichten. Den schmächtigen Rumpf zieren Andeutungen von Brustwarzen, und am durchgedrückten Schwabbelbauch liegen seitlich die Hände des nicht gerade athletischen Mannes an; die Verkürzung der Oberschenkel wiederholt sich in den ebenfalls waagrecht liegenden Unterarmen, die Kantigkeit der Knie in der Schulterbildung. Den kräftigen zylindrischen Hals verdeckt, bei en-face Ansicht, ein dreiteilig geflochtener Kinnbart, der knapp unter dem V-förmigen Mund mit
69
gleich breiten, stegartigen Lippen ansetzt und sich seitlich hinter den Wangen bis zu den Ohren hochzieht. Das «herzförmig» wirkende, relativ flache Gesicht vor dem voluminösen Kopf mit angedeutetem kurzem Haarschnitt prägt die langge-zogene schlanke, flügellose Nase, deren Kontur in die halbkreisförmigen Augen-brauenbögen übergeht. Die Brauen selbst waren einst leicht erhaben und mit feinen Schraffuren verziert. Die mächtigen Oberlieder der grossen runden Augen sind hälftig niedergeschlagen, was ihnen den Anflug eines schläfrigen – wenn man so will skeptischen – Lächelns verleiht. Grundsätzlich strahlt diese Figur die würdevolle Gelassenheit eines in Ehren alt gewordenen Würdenträgers oder gewitzten Ratgebers aus. In jedem Fall zeigt sie nicht, wie sonst viele andere nkishi-Kraftfiguren von Songye-Schnitzern, aufgestautes Aggressionspozential oder auch nur eine unheimliche Bereitschaft, Abwehrkräfte zu mobilisieren. / FiE
Literatur: Himmelheber, Hans, Zum Problem der anatomisch unrichtigen Proportionen in der
Neger kunst, Zeitschrif t für Ethnologie, 94,2 Braunschweig: 1969; François Neyt, La redoutable
statuaire songye d’Afrique central, Fonds Mercator, Antwerpen: 2004; Francois Neyt, Fleuve Congo,
Paris: Musée du quai Branly-Fonds Mercator 2010.
70
Iran
Qalamkar-Wandbehang
Iran (?), 19. Jh.
Baumwolle, Beizen- und Direktmalerei,
Beizen- und Direktdruckt; 2019.618
Provenienz: 1926 –1935 Wahrscheinlich
Ankauf in der Türkei durch Henri Martin
(1879 –1959), Chargé d’affaires, ab 1928
Ministre plénipotentiaire; 1935 –1959 Henri
Martin; 1959 – 2018 Familienbesitz, zuletzt
Agnès Kaeser, Nichte von Henri Martin
Geschenk Angès Kaeser
Indien
Ein Tirthankara reisst sich die Haare aus
Folio aus einem Kalpasutra-Manuskript
Indien, 15. Jh.
Papier; 2019.444a
Provenienz: Sammlung Eva und Konrad
Seitz, Wachtberg
Geschenk Sammlung Eva und Konrad Seitz
Stehender Tirthankara
Folio aus einem Kalpasutra-Manuskript
Indien, 15. Jh.
Papier; 2019.444b
Provenienz: Sammlung Eva und Konrad
Seitz, Wachtberg
Geschenk Sammlung Eva und Konrad Seitz
Kampfszene
Folio aus einem «jainesken» Shahnama
Indien, Gujarat, 15. Jh.
Pigmentmalerei auf Papier; 2019.445
Provenienz: Sammlung Eva und Konrad
Seitz, Wachtberg
Geschenk Sammlung Eva und Konrad Seitz
Kampfszene mit Bogenschützen
Folio aus einem «jainesken» Shahnama
Indien, Gujarat, 15. Jh.
Pigmentmalerei auf Papier; 2019.446
Provenienz: Sammlung Eva und Konrad
Seitz, Wachtberg
Geschenk Sammlung Eva und Konrad Seitz
Kai Khusrau vergibt Tus und schickt
ihn mit der Armee nach Turan
Folio aus einem «jainesken» Shahnama
Indien, Gujarat, 15. Jh.
Pigmentmalerei auf Papier; 2019.447
Provenienz: Sammlung Eva und Konrad
Seitz, Wachtberg
Geschenk Sammlung Eva und Konrad Seitz
Jal rat Kay Kaus davon ab, Mazandaran
zu überfallen
Folio aus einem «jainesken» Shahnama
Indien, Gujarat, 15. Jh.
Pigmentmalerei auf Papier; 2019.448
Provenienz: Sammlung Eva und Konrad
Seitz, Wachtberg
Geschenk Sammlung Eva und Konrad Seitz
Tanzszene
Folio aus dem Palam Bhagavata Purana
Indien, Delhi /Agra, 16. Jh.
Pigmentmalerei auf Papier; 2019.449
Provenienz: Sammlung Eva und Konrad
Seitz, Wachtberg
Geschenk Sammlung Eva und Konrad Seitz
Krishna gegen den Damon;
Krishna mit den Brahmanenfrauen
Folio aus dem Palam Bhagavata Purana
Indien, Delhi /Agra, 16. Jh.
Pigmentmalerei auf Papier; 2019.450
Provenienz: Sammlung Eva und Konrad
Seitz, Wachtberg
Geschenk Sammlung Eva und Konrad Seitz
Schlachtszene
Folio aus dem Palam Bhagavata Purana
Indien, Delhi /Agra, 16. Jh.
Pigmentmalerei auf Papier; 2019.451
Provenienz: Sammlung Eva und Konrad
Seitz, Wachtberg
Geschenk Sammlung Eva und Konrad Seitz
Schlachtszene mit Elefanten
(BhP X, 59.18-19)
Folio aus dem Palam Bhagavata Purana
Indien, Delhi /Agra, 16. Jh.
Pigmentmalerei auf Papier; 2019.452
Provenienz: Sammlung Eva und Konrad
Seitz, Wachtberg
Geschenk Sammlung Eva und Konrad Seitz
Banasura und Aniruddha
(BhP X, 62.33-35)
Folio aus dem Palam Bhagavata Purana
Indien, Delhi /Agra, 16. Jh.
Pigmentmalerei auf Papier; 2019.453
Provenienz: Sammlung Eva und Konrad
Seitz, Wachtberg
Geschenk Sammlung Eva und Konrad Seitz
Die Sakhi redet auf Krishna ein
(RP XIV, 30 & 32)
Folio aus der ersten Orchha-Rasikapriya-Serie
Indien, Orchha, 1592 –1595
Pigmentmalerei auf Papier; 2019.454
Provenienz: Sammlung Eva und Konrad
Seitz, Wachtberg
Geschenk Sammlung Eva und Konrad Seitz
Die Sakhi redet mit Krishna (RP XIV, 7)
Folio aus der ersten Orchha-Rasikapriya-Serie
Indien, Orchha, 1592 –1595
Pigmentmalerei auf Papier; 2019.455a
Provenienz: Sammlung Eva und Konrad
Seitz, Wachtberg
Geschenk Sammlung Eva und Konrad Seitz
schenkungen / legate / stiftungen
71
Die Sakhi macht Krishna Vorwürfe,
Szene vor Radhas Pavillon (RP XIV, 8 -9)
Folio aus der ersten Orchha-Rasikapriya-Serie
Indien, Orchha, 1592 –1595
Pigmentmalerei auf Papier; 2019.455b
Provenienz: Sammlung Eva und Konrad
Seitz, Wachtberg
Geschenk Sammlung Eva und Konrad Seitz
Die Sakhi redet auf Krishna ein
(RP XIV, 18-19)
Folio aus der ersten Orchha-Rasikapriya-Serie
Indien, Orchha, 1592 –1595
Pigmentmalerei auf Papier; 2019.456
Provenienz: Sammlung Eva und Konrad
Seitz, Wachtberg
Geschenk Sammlung Eva und Konrad Seitz
Die Sakhi redet auf Radha ein – Liebesleid
(RP I, 27-28)
Folio aus der ersten Orchha-Rasikapriya-Serie
Indien, Orchha, 1592 –1595
Pigmentmalerei auf Papier; 2019.457
Provenienz: Sammlung Eva und Konrad
Seitz, Wachtberg
Geschenk Sammlung Eva und Konrad Seitz
Die Sakhi redet auf die traurige Radha ein
(RP VI, 36-37)
Folio aus der ersten Orchha-Rasikapriya-Serie
Indien, Orchha, 1592 –1595
Pigmentmalerei auf Papier; 2019.458a
Provenienz: Sammlung Eva und Konrad
Seitz, Wachtberg
Geschenk Sammlung Eva und Konrad Seitz
Krishna zeigt Reue (RP VI, 35)
Folio aus der ersten Orchha-Rasikapriya-Serie
Indien, Orchha, 1592 –1595
Pigmentmalerei auf Papier; 2019.458b
Provenienz: Sammlung Eva und Konrad
Seitz, Wachtberg
Geschenk Sammlung Eva und Konrad Seitz
Die Sakhi redet auf Radha ein – Liebesleid
(RP III, 15-19)
Folio aus der ersten Orchha-Rasikapriya-Serie
Indien, Orchha, 1592 –1595
Pigmentmalerei auf Papier; 2019.459a
Provenienz: Sammlung Eva und Konrad
Seitz, Wachtberg
Geschenk Sammlung Eva und Konrad Seitz
Die Sakhi redet mit Krishna in einer
Waldlichtung (RP III, 20-21)
Folio aus der ersten Orchha-Rasikapriya-Serie
Indien, Orchha, 1592 –1595
Pigmentmalerei auf Papier; 2019.459b
Provenienz: Sammlung Eva und Konrad
Seitz, Wachtberg
Geschenk Sammlung Eva und Konrad Seitz
Radha zeigt Scheu und Schamhaftigkeit
(RP XIII, 7)
Folio aus der ersten Orchha-Rasikapriya-Serie
Indien, Orchha, 1592 –1595
Pigmentmalerei auf Papier; 2019.460
Provenienz: Sammlung Eva und Konrad
Seitz, Wachtberg
Geschenk Sammlung Eva und Konrad Seitz
Radha sitzt mit der Sakhi vor ihrem
Pavillon (RP VII, 12)
Folio aus der ersten Orchha-Rasikapriya-Serie
Indien, Orchha, 1592 –1595
Pigmentmalerei auf Papier; 2019.461a
Provenienz: Sammlung Eva und Konrad
Seitz, Wachtberg
Geschenk Sammlung Eva und Konrad Seitz
Definition der abhisandhita-Heldin, der
«Arroganten»: Die Heldin wurde wegen einem
Streit vom Geliebten getrennt (RP VII, 13-14)
Folio aus der ersten Orchha-Rasikapriya-Serie
Indien, Orchha, 1592–1595
Opake Wasserfarben auf Papier; 2019.461b
Provenienz: Sammlung Eva und Konrad
Seitz, Wachtberg
Geschenk Sammlung Eva und Konrad Seitz
Krishna besucht Radha, die im Pavillon
mit der Sakhi redet (RP V, 16)
Folio aus der ersten Orchha-Rasikapriya-Serie
Indien, Orchha, 1592 –1595
Pigmentmalerei auf Papier; 2019.462a
Provenienz: Sammlung Eva und Konrad
Seitz, Wachtberg
Geschenk Sammlung Eva und Konrad Seitz
Krishnas Versuch, Radha in den Wald
mitzunehmen (RP V, 17)
Folio aus der ersten Orchha-Rasikapriya-Serie
Indien, Orchha, 1592 –1595
Pigmentmalerei auf Papier; 2019.462b
Provenienz: Sammlung Eva und Konrad
Seitz, Wachtberg
Geschenk Sammlung Eva und Konrad Seitz
Radha als unerfahrenes Madchen
(RP III, 24-25)
Folio aus der ersten Orchha-Rasikapriya-Serie
Indien, Orchha, 1592 –1595
Pigmentmalerei auf Papier; 2019.463a
Provenienz: Sammlung Eva und Konrad
Seitz, Wachtberg
Geschenk Sammlung Eva und Konrad Seitz
Die Sakhi führt Radha zu Krishna
(RP III, 26-27)
Folio aus der ersten Orchha-Rasikapriya-Serie
Indien, Orchha, 1592 –1595
Pigmentmalerei auf Papier; 2019.463b
Provenienz: Sammlung Eva und Konrad
Seitz, Wachtberg
Geschenk Sammlung Eva und Konrad Seitz
Krishna nimmt Radha in die Arme (RP VI, 53)
Folio aus der ersten Orchha-Rasikapriya-Serie
Indien, Orchha, 1592 –1595
Pigmentmalerei auf Papier; 2019.464
Provenienz: Sammlung Eva und Konrad
Seitz, Wachtberg
Geschenk Sammlung Eva und Konrad Seitz
72
Die Sakhi führt Radha zu Krishna,
der vor seinem Pavillon sitzt (RP V, 12)
Folio aus der ersten Orchha-Rasikapriya-Serie
Indien, Orchha, 1592–1595
Pigmentmalerei auf Papier; 2019.465
Provenienz: Sammlung Eva und Konrad
Seitz, Wachtberg
Geschenk Sammlung Eva und Konrad Seitz
Krishna bemalt Radhas Fusssohlen
(RP VII, 1-5)
Folio aus der ersten Orchha-Rasikapriya-Serie
Indien, Orchha, 1592–1595
Pigmentmalerei auf Papier; 2019.466
Provenienz: Sammlung Eva und Konrad
Seitz, Wachtberg
Geschenk Sammlung Eva und Konrad Seitz
Krishnas Umarmung in der Waldlichtung
(RP XIV, 27-28)
Folio aus der ersten Orchha-Rasikapriya-Serie
Indien, Orchha, 1592 –1595
Pigmentmalerei auf Papier; 2019.467
Provenienz: Sammlung Eva und Konrad
Seitz, Wachtberg
Geschenk Sammlung Eva und Konrad Seitz
Krishna erinnert sich an die Geliebte
(RP XI, 11)
Folio aus der ersten Orchha-Rasikapriya-Serie
Indien, Orchha, 1592 –1595
Pigmentmalerei auf Papier; 2019.468a
Provenienz: Sammlung Eva und Konrad
Seitz, Wachtberg
Geschenk Sammlung Eva und Konrad Seitz
Die schlaflose Radha sehnt sich nach
Krishna (RP XI, 14)
Folio aus der ersten Orchha-Rasikapriya-Serie
Indien, Orchha, 1592 –1595
Pigmentmalerei auf Papier; 2019.468b
Provenienz: Sammlung Eva und Konrad
Seitz, Wachtberg
Geschenk Sammlung Eva und Konrad Seitz
Radha und Krishna im Pavillon (RP IX, 12-13)
Folio aus der ersten Orchha-Rasikapriya-Serie
Indien, Orchha, 1592 –1595
Pigmentmalerei auf Papier; 2019.469a
Provenienz: Sammlung Eva und Konrad
Seitz, Wachtberg
Geschenk Sammlung Eva und Konrad Seitz
Widerwillig lasst sich Radha von Krishna
vor dem Pavillon umarmen (RP IX, 16)
Folio aus der ersten Orchha-Rasikapriya-Serie
Indien, Orchha, 1592 –1595
Pigmentmalerei auf Papier; 2019.469b
Provenienz: Sammlung Eva und Konrad
Seitz, Wachtberg
Geschenk Sammlung Eva und Konrad Seitz
Hirten; Radha und Krishna in der Ecke
(RP V, 30)
Folio aus der ersten Orchha-Rasikapriya-Serie
Indien, Orchha, 1592 –1595
Pigmentmalerei auf Papier; 2019.470
Provenienz: Sammlung Eva und Konrad
Seitz, Wachtberg
Geschenk Sammlung Eva und Konrad Seitz
Die Sakhi ruft Radha zu Krishnas
Frühlingstanz
Folio aus einem Gitagovinda-Manuskript
Indien, Orchha, 1580 –1590
Pigmentmalerei auf Papier; 2019.471
Provenienz: Sammlung Eva und Konrad
Seitz, Wachtberg
Geschenk Sammlung Eva und Konrad Seitz
Radha in der Gottesferne
Folio aus einem Gitagovinda-Manuskript
Indien, Orchha, 1580 –1590
Pigmentmalerei auf Papier; 2019.472
Provenienz: Sammlung Eva und Konrad
Seitz, Wachtberg
Geschenk Sammlung Eva und Konrad Seitz
Rama erlöst Ahalya
Folio 17 aus der ersten Orchha-Ramayana-
Serie
Indien, Orchha, ca. 1600
Pigmentmalerei auf Papier; 2019.473
Provenienz: Sammlung Eva und Konrad
Seitz, Wachtberg
Geschenk Sammlung Eva und Konrad Seitz
Vor dem Einsteigen ins Fahrboot zum Exil
Folio 28 aus der ersten Orchha-Ramayana-
Serie
Indien, Orchha, ca. 1600
Pigmentmalerei auf Papier; 2019.474
Provenienz: Sammlung Eva und Konrad
Seitz, Wachtberg
Geschenk Sammlung Eva und Konrad Seitz
Die Krahe nimmt bei Rama Zuflucht
Folio 30 aus der ersten Orchha-Ramayana-
Serie
Indien, Orchha, ca. 1600
Pigmentmalerei auf Papier; 2019.475
Provenienz: Sammlung Eva und Konrad
Seitz, Wachtberg
Geschenk Sammlung Eva und Konrad Seitz
Krishna tötet Dhenuka, den Eselsdamon
Folio 30 aus der Bir-Singh-Bhagavata-
Purana- Serie
Indien, Orchha, 1610 –1615
Pigmentmalerei auf Papier; 2019.476
Provenienz: Sammlung Eva und Konrad
Seitz, Wachtberg
Geschenk Sammlung Eva und Konrad Seitz
Die Speisen bringenden Brahmanenfrauen
schauen den Blauen Gott
Folio 36 aus der Bir-Singh-Bhagavata-
Purana-Serie
Indien, Orchha, 1610 –1615
Pigmentmalerei auf Papier; 2019.477
Provenienz: Sammlung Eva und Konrad
Seitz, Wachtberg
Geschenk Sammlung Eva und Konrad Seitz
73
Krishnas und Balaramas theatralische
Flucht auf den Pravarsana Berg
Folio 65 aus der Bir-Singh-Bhagavata-
Purana-Serie
Indien, Orchha, 1610 –1615
Pigmentmalerei auf Papier; 2019.478
Provenienz: Sammlung Eva und Konrad
Seitz, Wachtberg
Geschenk Sammlung Eva und Konrad Seitz
Krishna überbringt Arjuna und Subhadra
ein Brautgeschenk
Folio 115 aus der Bir-Singh-Bhagavata-
Purana-Serie
Indien, Orchha, 1610 –1615
Pigmentmalerei auf Papier; 2019.479
Provenienz: Sammlung Eva und Konrad
Seitz, Wachtberg
Geschenk Sammlung Eva und Konrad Seitz
Radha als Shankhini-Heldin (RP III, 5-7)
Folio 32 aus der dritten Orchha-
Rasikapriya-Serie
Indien, Orchha, 1610 –1615
Pigmentmalerei auf Papier; 2019.480
Provenienz: Sammlung Eva und Konrad
Seitz, Wachtberg
Geschenk Sammlung Eva und Konrad Seitz
Die Madchenfrau in der Brautnacht
(RP III, 20–21)
Folio 36 aus der dritten Orchha-
Rasikapriya-Serie
Indien, Orchha, 1610 –1615
Pigmentmalerei auf Papier; 2019.481
Provenienz: Sammlung Eva und Konrad
Seitz, Wachtberg
Geschenk Sammlung Eva und Konrad Seitz
Die sich straubende Heldin, mugdha
shayana (RP III, 24–25)
Folio 39 aus der dritten Orchha-
Rasikapriya-Serie
Indien, Orchha, 1610 –1615
Pigmentmalerei auf Papier; 2019.482
Provenienz: Sammlung Eva und Konrad
Seitz, Wachtberg
Geschenk Sammlung Eva und Konrad Seitz
Radha als Handleserin (RP III, 30-31)
Folio 40 aus der dritten Orchha-
Rasikapriya-Serie
Indien, Orchha, 1610 –1615
Pigmentmalerei auf Papier; 2019.483
Provenienz: Sammlung Eva und Konrad
Seitz, Wachtberg
Geschenk Sammlung Eva und Konrad Seitz
Radha zeigt sich beleidigt (RP III, 55-56)
Folio 51 aus der dritten Orchha-
Rasikapriya-Serie
Indien, Orchha, 1610 –1615
Pigmentmalerei auf Papier; 2019.484
Provenienz: Sammlung Eva und Konrad
Seitz, Wachtberg
Geschenk Sammlung Eva und Konrad Seitz
Krishna erblickt Radha beim Butterquirlen
(RP IV, 7)
Folio 63 aus der dritten Orchha-
Rasikapriya-Serie
Indien, Orchha, 1610 –1615
Pigmentmalerei auf Papier; 2019.485
Provenienz: Sammlung Eva und Konrad
Seitz, Wachtberg
Geschenk Sammlung Eva und Konrad Seitz
Radhas Scheu, als sie Krishnas Portrait
erblickt (RP IV, 8)
Folio 64 aus der dritten Orchha-
Rasikapriya-Serie
Indien, Orchha, 1610 –1615
Pigmentmalerei auf Papier; 2019.486
Provenienz: Sammlung Eva und Konrad
Seitz, Wachtberg
Geschenk Sammlung Eva und Konrad Seitz
Liebestreffen unter dem Vorwand einer
Krankheit (RP V, 33)
Folio 94 aus der dritten Orchha-
Rasikapriya-Serie
Indien, Orchha, ca. 1610 –1615
Pigmentmalerei auf Papier; 2019.487
Provenienz: Sammlung Eva und Konrad
Seitz, Wachtberg
Geschenk Sammlung Eva und Konrad Seitz
Eine Umgebung, die Liebesgefühle fördert
(RP VI, 6)
Folio 99 aus der dritten Orchha-
Rasikapriya-Serie
Indien, Orchha, 1610 –1615
Pigmentmalerei auf Papier; 2019.488
Provenienz: Sammlung Eva und Konrad
Seitz, Wachtberg
Geschenk Sammlung Eva und Konrad Seitz
Krishna in der Rolle Radhas (RP VI, 23)
Folio 103 aus der dritten Orchha-
Rasikapriya-Serie
Indien, Orchha, 1610 –1615
Pigmentmalerei auf Papier; 2019.489
Provenienz: Sammlung Eva und Konrad
Seitz, Wachtberg
Geschenk Sammlung Eva und Konrad Seitz
74
Als der Sturm kommt, gibt Radha ihren
Hochmut auf (RP VI, 27-28)
Folio 106 aus der dritten Orchha-
Rasikapriya-Serie
Indien, Orchha, 1610 –1615
Pigmentmalerei auf Papier; 2019.490
Provenienz: Sammlung Eva und Konrad
Seitz, Wachtberg
Geschenk Sammlung Eva und Konrad Seitz
Krishna verschlagt es beim Anblick
Radhas die Sprache (RP VI, 32)
Folio 109 aus der dritten Orchha-
Rasikapriya-Serie
Indien, Orchha, 1610 –1615
Pigmentmalerei auf Papier; 2019.491
Provenienz: Sammlung Eva und Konrad
Seitz, Wachtberg
Geschenk Sammlung Eva und Konrad Seitz
Krishna schuldbewusst vor Radhas
Pavillon (RP VI, 35)
Folio 111 aus der dritten Orchha-
Rasikapriya-Serie
Indien, Orchha, 1610 –1615
Pigmentmalerei auf Papier; 2019.492
Provenienz: Sammlung Eva und Konrad
Seitz, Wachtberg
Geschenk Sammlung Eva und Konrad Seitz
Die Sakhi redet auf Radha ein (RP VI, 36-37)
Folio 112 aus der dritten Orchha-
Rasikapriya-Serie
Indien, Orchha, 1610 –1615
Pigmentmalerei auf Papier; 2019.493
Provenienz: Sammlung Eva und Konrad
Seitz, Wachtberg
Geschenk Sammlung Eva und Konrad Seitz
Radha in der Erwartung des Geliebten
(vasakasajja nayika), (RP VII, 10)
Folio 130 aus der dritten Orchha-
Rasikapriya-Serie
Indien, Orchha, 1610 –1615
Pigmentmalerei auf Papier; 2019.494
Provenienz: Sammlung Eva und Konrad
Seitz, Wachtberg
Geschenk Sammlung Eva und Konrad Seitz
Radha als garvabhisarika-Heldin (VII, 29)
Folio 142 aus der dritten Orchha-
Rasikapriya-Serie
Indien, Orchha, 1610 –1615
Pigmentmalerei auf Papier; 2019.495
Provenienz: Sammlung Eva und Konrad
Seitz, Wachtberg
Geschenk Sammlung Eva und Konrad Seitz
Die Sakhi spricht zu Krishna in der
Waldlichtung (RP VIII, 15-16)
Folio 157 aus der dritten Orchha-
Rasikapriya-Serie
Indien, Orchha, 1610 –1615
Pigmentmalerei auf Papier; 2019.496
Provenienz: Sammlung Eva und Konrad
Seitz, Wachtberg
Geschenk Sammlung Eva und Konrad Seitz
Nicht einmal das Vinaspiel erfreut sie mehr
(RP VIII, 25-26)
Folio 164 aus der dritten Orchha-
Rasikapriya-Serie
Indien, Orchha, 1610 –1615
Pigmentmalerei auf Papier; 2019.497
Provenienz: Sammlung Eva und Konrad
Seitz, Wachtberg
Geschenk Sammlung Eva und Konrad Seitz
Krishna versunken in einsames Denken an
die Geliebte (RP VIII, 28)
Folio 166 aus der dritten Orchha-
Rasikapriya-Serie
Indien, Orchha, 1610 –1615
Pigmentmalerei auf Papier; 2019.498
Provenienz: Sammlung Eva und Konrad
Seitz, Wachtberg
Geschenk Sammlung Eva und Konrad Seitz
Radhas verborgenes Liebesdelirium
(VIII, 35-36)
Folio 172 aus der dritten Orchha-
Rasikapriya-Serie
Indien, Orchha, 1610 –1615
Pigmentmalerei auf Papier; 2019.499
Provenienz: Sammlung Eva und Konrad
Seitz, Wachtberg
Geschenk Sammlung Eva und Konrad Seitz
Krishnas offenes Liebesdelirium (RP VIII, 39)
Folio 175 aus der dritten Orchha-
Rasikapriya-Serie
Indien, Orchha, 1610 –1615
Pigmentmalerei auf Papier; 2019.500
Provenienz: Sammlung Eva und Konrad
Seitz, Wachtberg
Geschenk Sammlung Eva und Konrad Seitz
Radhas verborgene Liebeskrankheit
(RP VIII, 45-46)
Folio 180 aus der dritten Orchha-
Rasikapriya-Serie
Indien, Orchha, 1610–1615
Pigmentmalerei auf Papier; 2019.501
Provenienz: Sammlung Eva und Konrad
Seitz, Wachtberg
Geschenk Sammlung Eva und Konrad Seitz
75
Marana: das letzte, zum Tode führende
Stadium des Liebesleids (RP VIII, 53-54)
Folio 185 aus der dritten Orchha-
Rasikapriya-Serie
Indien, Orchha, 1610 –1615
Pigmentmalerei auf Papier; 2019.502
Provenienz: Sammlung Eva und Konrad
Seitz, Wachtberg
Geschenk Sammlung Eva und Konrad Seitz
Krishnas verborgener grosser Unmut
(RP IX, 6-7)
Folio 188 aus der dritten Orchha-
Rasikapriya-Serie
Indien, Orchha, 1610 –1615
Pigmentmalerei auf Papier; 2019.503
Provenienz: Sammlung Eva und Konrad
Seitz, Wachtberg
Geschenk Sammlung Eva und Konrad Seitz
Die Sakhi spricht zu Krishna in der
Waldlichtung (RP IX, 12-13)
Folio 192 aus der dritten Orchha-
Rasikapriya-Serie
Indien, Orchha, 1610 –1615
Pigmentmalerei auf Papier; 2019.504
Provenienz: Sammlung Eva und Konrad
Seitz, Wachtberg
Geschenk Sammlung Eva und Konrad Seitz
Krishnas verborgener mittlerer mana
(Stolz), (RP IX, 18-19)
Folio 196 aus der dritten Orchha-
Rasikapriya-Serie
Indien, Orchha, 1610 –1615
Pigmentmalerei auf Papier; 2019.505
Provenienz: Sammlung Eva und Konrad
Seitz, Wachtberg
Geschenk Sammlung Eva und Konrad Seitz
Krishna ist dank Radhas Sanftheit wieder
wohlgesinnt (RP X, 5)
Folio 199 aus der dritten Orchha-
Rasikapriya-Serie
Indien, Orchha, 1610 –1615
Pigmentmalerei auf Papier; 2019.506
Provenienz: Sammlung Eva und Konrad
Seitz, Wachtberg
Geschenk Sammlung Eva und Konrad Seitz
Die Sakhi pladiert für Krishna (RP X, 11-12)
Folio 203 aus der dritten Orchha-
Rasikapriya-Serie
Indien, Orchha, 1610 –1615
Pigmentmalerei auf Papier; 2019.507
Provenienz: Sammlung Eva und Konrad
Seitz, Wachtberg
Geschenk Sammlung Eva und Konrad Seitz
Krishnas Kniefall (RP X, 16)
Folio 206 aus der dritten Orchha-
Rasikapriya-Serie
Indien, Orchha, 1610 –1615
Pigmentmalerei auf Papier; 2019.508
Provenienz: Sammlung Eva und Konrad
Seitz, Wachtberg
Geschenk Sammlung Eva und Konrad Seitz
Die Sakhi versucht Radha von ihrem
Hochmut (mana) abzulenken (RP X, 20-21)
Folio 209 aus der dritten Orchha-
Rasikapriya-Serie
Indien, Orchha, 1610 –1615
Pigmentmalerei auf Papier; 2019.509
Provenienz: Sammlung Eva und Konrad
Seitz, Wachtberg
Geschenk Sammlung Eva und Konrad Seitz
Krishnas verborgenes Liebesleid in der
Trennung (RP XI, 5)
Folio 216 aus der dritten Orchha-
Rasikapriya-Serie
Indien, Orchha, 1610 –1615
Pigmentmalerei auf Papier; 2019.510
Provenienz: Sammlung Eva und Konrad
Seitz, Wachtberg
Geschenk Sammlung Eva und Konrad Seitz
Sehnsüchtigt blickt Krishna in die Ferne,
wo die Geliebte weilt (RP XI, 11)
Folio 221 aus der dritten Orchha-
Rasikapriya-Serie
Indien, Orchha, 1610 –1615
Pigmentmalerei auf Papier; 2019.511
Provenienz: Sammlung Eva und Konrad
Seitz, Wachtberg
Geschenk Sammlung Eva und Konrad Seitz
Krishnas angstvolle Verworrenheit
(RP XI, 13)
Folio 222 aus der dritten Orchha-
Rasikapriya-Serie
Indien, Orchha, 1610 –1615
Pigmentmalerei auf Papier; 2019.512
Provenienz: Sammlung Eva und Konrad
Seitz, Wachtberg
Geschenk Sammlung Eva und Konrad Seitz
Krishnas Schlaflosigkeit (RP XI, 15)
Folio 225 aus der dritten Orchha-
Rasikapriya-Serie
Indien, Orchha, 1610 –1615
Pigmentmalerei auf Papier; 2019.513
Provenienz: Sammlung Eva und Konrad
Seitz, Wachtberg
Geschenk Sammlung Eva und Konrad Seitz
76
Die Frau des Goldschmieds redet auf
Radha in ihrem Liebesleid ein (RP XII, 21)
Folio 246 aus der dritten Orchha-
Rasikapriya-Serie
Indien, Orchha, 1610 –1615
Pigmentmalerei auf Papier; 2019.514
Provenienz: Sammlung Eva und Konrad
Seitz, Wachtberg
Geschenk Sammlung Eva und Konrad Seitz
Die Wanderasketin spricht zu Radha
(RP XII, 25)
Folio 250 aus der dritten Orchha-
Rasikapriya-Serie
Indien, Orchha, 1610 –1615
Pigmentmalerei auf Papier; 2019.515
Provenienz: Sammlung Eva und Konrad
Seitz, Wachtberg
Geschenk Sammlung Eva und Konrad Seitz
«Niemals, o Krishna, hast Du eine solche
Schönheit gesehen!» (RP XIII, 5)
Folio 257 aus der dritten Orchha-
Rasikapriya-Serie
Indien, Orchha, 1610 –1615
Pigmentmalerei auf Papier; 2019.516
Provenienz: Sammlung Eva und Konrad
Seitz, Wachtberg
Geschenk Sammlung Eva und Konrad Seitz
In Radhas Bett schlafen (RP V, 28)
Folio 89 aus der dritten Orchha-
Rasikapriya-Serie
Indien, Orchha, 1610 –1615
Pigmentmalerei auf Papier; 2019.517
Provenienz: Sammlung Eva und Konrad
Seitz, Wachtberg
Geschenk Sammlung Eva und Konrad Seitz
Radha im Liebeskummer vor ihrem Pavillon
(RP VII, 13-14)
Folio 132 aus der dritten Orchha-
Rasikapriya-Serie
Indien, Orchha, 1610 –1615
Pigmentmalerei auf Papier; 2019.518
Provenienz: Sammlung Eva und Konrad
Seitz, Wachtberg
Geschenk Sammlung Eva und Konrad Seitz
Die Sakhi pladiert für Krishna (RP VIII, 51)
Folio 184 aus der dritten Orchha-
Rasikapriya-Serie
Indien, Orchha, 1610 –1615
Pigmentmalerei auf Papier; 2019.519
Provenienz: Sammlung Eva und Konrad
Seitz, Wachtberg
Geschenk Sammlung Eva und Konrad Seitz
Radha vor ihrem Pavillon (RP XI, 10)
Folio 223 aus der dritten Orchha-
Rasikapriya-Serie
Indien, Orchha, 1610 –1615
Pigmentmalerei auf Papier; 2019.520
Provenienz: Sammlung Eva und Konrad
Seitz, Wachtberg
Geschenk Sammlung Eva und Konrad Seitz
«Zeig ihm doch endlich, dass Du ihn liebst!»
(RP IV, 16)
Folio 71 aus der vierten Orchha-
Rasikapriya-Serie
Indien, Orchha, ca. 1620
Pigmentmalerei auf Papier; 2019.521
Provenienz: Sammlung Eva und Konrad
Seitz, Wachtberg
Geschenk Sammlung Eva und Konrad Seitz
Bhairavi Ragini
Folio aus einer Parallelserie zur Bharat-Kala-
Bhavan-Ragamala-Serie
Indien, Orchha, ca. 1620
Pigmentmalerei auf Papier; 2019.522
Provenienz: Sammlung Eva und Konrad
Seitz, Wachtberg
Geschenk Sammlung Eva und Konrad Seitz
Bhairavi Ragini
Folio aus dem Datia-Ragamala
Indien, Orccha /Datia, 1625 –1627
Pigmentmalerei auf Papier; 2019.523
Provenienz: Sammlung Eva und Konrad
Seitz, Wachtberg
Geschenk Sammlung Eva und Konrad Seitz
Gaundakari Ragini: In Erwartung
des Geliebten
Folio aus dem Datia-Ragamala
Indien, Orccha-Datia, 1625 –1627
Pigmentmalerei auf Papier; 2019.524
Provenienz: Sammlung Eva und Konrad
Seitz, Wachtberg
Geschenk Sammlung Eva und Konrad Seitz
Malkos Raga
Folio aus einer Ragamala-Serie
Indien, Orchha, 1627 –1635
Pigmentmalerei auf Papier; 2019.525
Provenienz: Sammlung Eva und Konrad
Seitz, Wachtberg
Geschenk Sammlung Eva und Konrad Seitz
Rudra Pratap in seiner Majestat
Einzelblatt, evt. Folio aus einer
Kavipriya-Serie
Indien, Orchha, 1627 –1635
Pigmentmalerei auf Papier; 2019.526
Provenienz: Sammlung Eva und Konrad
Seitz, Wachtberg
Geschenk Sammlung Eva und Konrad Seitz
77
Monat Asadh: «Niemand verlasst
sein Haus im Monat Ashadh»
Folio aus einer Barahmasa-Serie
Indien, Orchha, 1630 –1635
Pigmentmalerei auf Papier; 2019.527
Provenienz: Sammlung Eva und Konrad
Seitz, Wachtberg
Geschenk Sammlung Eva und Konrad Seitz
Khambhavati Ragini
Folio 9 aus einer Ragamala-Serie
Indien, Orchha, 1627 –1635
Pigmentmalerei auf Papier; 2019.528
Provenienz: Sammlung Eva und Konrad
Seitz, Wachtberg
Geschenk Sammlung Eva und Konrad Seitz
Seta-Mallara Ragini
Folio 33 aus einer Ragamala-Serie
Indien, Orchha, 1627 –1635
Pigmentmalerei auf Papier; 2019.529
Provenienz: Sammlung Eva und Konrad
Seitz, Wachtberg
Geschenk Sammlung Eva und Konrad Seitz
Malkos Raga
Folio 7 aus einer Ragamala-Serie
Indien, Orchha, 1627 –1635
Pigmentmalerei auf Papier; 2019.530
Provenienz: Sammlung Eva und Konrad
Seitz, Wachtberg
Geschenk Sammlung Eva und Konrad Seitz
Krishna erkennt im Spiegel seine frühere
Geburt als Rama
Indien, Mewar, 1650/75
Pigmentmalerei mit Gold auf Papier; 2019.548
Provenienz: Enrico Isacco, Galerie Marco
Polo, Paris; 08.03.1977–26.04.2019 Barbara
und Eberhard Fischer
Geschenk Barbara und Eberhard Fischer
Krishna bittet Radha um Verzeihung
Meister der zweiten Generation nach
Nainsukh und Manaku von Guler
Indien, Pahari-Gebiet, Guler, um 1825
Pigmentmalerei mit Gold auf Papier; 2019.549
Provenienz: Sammlung Werner Reinhart
(1884–1951); Nanni Reinhart, Winterthur
Geschenk Nanni Reinhart-Schinz
König Janaka berichtet Vishvamitra
Folio 44 aus einer kleinen Ramayana-Serie
Meister der zweiten Generation nach
Nainsukh und Manaku von Guler
Indien, Pahari-Gebiet, Kangra, 1810 –1815
Pigmentmalerei mit Gold auf Papier; 2019.550
Provenienz: 1975 – Juli 2019 Balthasar und
Nanni Reinhart
Geschenk Nanni Reinhart-Schinz
Prinzessinen besuchen eine Yogini
Indien, Mogul, Awadh, 1770 –1780
Pigmentmalerei mit Gold auf Papier; 2019.551
Provenienz: 1970er – Sommer 2002
Slg. Shahram Pahlavi, bis 1979 im Iran, dann
London/Paris; Sommer 2002 – 2013 Sammlung
Mehdi Metghalchi, London; Galerie Francesca
Galloway, London; 2013 – 2019 Catharina
Dohrn (Dauerleihgabe im MRZ)
Geschenk Catharina Dohrn
Chamba Rumal
Indien, Himachal Pradesh, Chamba, 2018
Baumwolle; Stickerei: Seidengarn; 2019.419
Provenienz: 01.01.2018 – 01.05.2019 Delhi
Crafts Council
Geschenk Delhi Crafts Council
Phulkari chaddar, gesticktes Tuch
Indien, Punjab, 1. Hälfte 20. Jh.
Baumwolle; Stickereien mit Seide; 2019.420
Provenienz: 01.01.1971– 01.01.2015 Alice
Boner, Nachlass aus Davos, Chalet, Dach-
boden; 01.10.2015 – 01.10.2016 Lisette van
der Valk, Mieterin des Chalets in Davos
Geschenk Lisette van der Valk
Matani chandarvo, Tempeltuch
für eine Göttin (evtl. Chamunda)
Indien, Gujarat, Ahmedabad, 2. Hälfte 20. Jh.
Baumwollgewebe; Beizreservemusterung:
Holzblockdrücke und teilweise gemalt;
2019.421
Provenienz: 1979 – 2015 Alice Boner, Dach-
boden, Chalet, Davos; Nachlass A. Boner;
2015 – 2016 Lisette van der Valk, Mieterin
des Chalets in Davos
Geschenk Lisette van der Valk
Mannermantel
Indien, Kaschmir, 1. Hälfte 20. Jh.
Ocker farbiges Woll- und Seidengewebe
(Innenstoff); Stickereien mit Seide; 2019.422
Provenienz: 1979 – 2015 Alice Boner, Chalet
Davos, Dachboden; 2015 – 2016 Lisette van
der Valk, Mieterin des Chalets in Davos
Geschenk Lisette van der Valk
Frauenweste
Indien, 1. Hälfte 20. Jh.
Seidengewebe mit Goldfäden; 2019.424
Provenienz: 1979–2015 Nachlass A. Boner,
Chalet, Davos, Dachboden; 2015 – 2016
Lisette van der Valk, Mieterin des Chalets
in Davos
Geschenk Lisette van der Valk
78
Kinderhaube
Indien, Gujarat, Saurashtra, 1. Hälfte 20. Jh.
Seiden- und Baumwollgewebe (Innenstoff);
Stickereien mit Seide und Spiegelchen;
2019.425
Provenienz: 1979 – 2015 Nachlass Alice Boner,
Chalet, Davos, Dachboden; 2015 – 2016
Lisette van der Valk, Nachmieterin im Chalet
in Davos
Geschenk Lisette van der Valk
Mütze
Indien, 1. Hälfte 20. Jh.
Seidengewebe mit Stickereien mit Seide und
Golddraht; 2019.427
Provenienz: 1979 – 2015 Nachlass Alice Boner,
Chalet in Davos, Dachboden; 2015 – 2016
Lisette van der Valk, Mieterin im Chalet in
Davos
Geschenk Lisette van der Valk
Mütze
Indien, 1. Hälfte 20. Jh.
Baumwolle und Metallfäden; 2019.431
Provenienz: 1979 – 2015 Alice Boner, Chalet
in Davos, Dachboden; 2015 – 2016 Lisette van
der Valk, Mieterin im Boner-Chalet in Davos
Geschenk Lisette van der Valk
Serie von 9 Spiegeln (val kannati)
Indien, Kerala, Giessereien in Thrissur and
Kozhikode, 21. Jh.
Gelbguss; 2019.539, 2019.540, 2019.541,
2019.542, 2019.543, 2019.544, 2019.545,
2019.546, 2019.547
Provenienz: 2005 – 2015 Balan Nambiar,
Indien
Geschenk Balan Nambiar
Shiva Linga mit Nandi und Kobra
Indien, 1950 –1980
Gelbguss; 2019.553
Provenienz: 1980 – 2009 Heidi und Hans
Kaufmann, Wien; 2009 – 2019 Albert Lutz
Geschenk Albert Lutz
Südostasien
2 Dolche
Indonesien, Java,
Metalllegierung, Holz; 2019.413 und 2019.413
Provenienz: Familie Both, Rotterdam, erworben
in Indonesien; 1930–1955 Anna Emilie
Grieder- Both (1903 –), Zürich; um 1955 –1975
Mario Sala (1923 –1975), St. Moritz, Mitarbeiter
im Sportgeschäft Scheuing, Geschenk von
Anna Grieder, die seine langjährige Kundin
war; 1975 – 2019 Christian Barblan, Schwieger-
sohn von Mario Sala
Geschenk Christian Barblan
China
Buddha Shakyamuni
China, Ming- oder Qing-Dynastie, 16.–18. Jh.
Bronze, gegossen, punziert, vergoldet;
2019.1
Provenienz: Cécile Laubacher (1924 – 2018),
Brugg
Geschenk Cécile Laubacher
Guanyin, der Bodhisattva des Mitgefühls
als Bringer von Kindern
China, Qing-Dynastie, 17.–19. Jh.
Bronze, gegossen, punziert, mit Resten von
Bemalung; 2019.2
Provenienz: Cécile Laubacher (1924– 2018),
Brugg
Geschenk Cécile Laubacher
Japan
Ein Konvolut von 408 Surimono
Japan, Edo- bis Meiji-Zeit, 19. Jh.
Vielfarbendruck; 2019.5 bis 2019.411 und
2019.433 bis 2019.435
Provenienz: 1970er-Jahre – 2018 von Erich
Gross, Zürich, auf dem westlichen
Kunstmarkt erworben
Geschenk Gisela Müller und Erich Gross
Ägypten
Textil mit zwei Ornamentstreifen
Ägypten, 11. Jh. (?)
Wirkerei, monochrom. Kette und Eintrag:
Wolle; 2019.597
Provenienz: 1990er Jahre – 2019 Sylvie Felix,
Zürich, erworben im Zürcher Kunsthandel
Geschenk Sylvie Felix
Ornamentstreifen in Buntwirkerei
Ägypten, 8. Jh. (?)
Wirkerei, polychrom. Kette und Eintrag:
Wolle; 2019.598
Provenienz: 1950/60er – 1976 Max Hunziker
(1901–1976), Zürich; 1976 – 2019 Ursula Kunz,
Zürich
Geschenk Ursula Kunz
Madonna mit Kind
Ägypten, 6./7. Jh. (?)
Wirkerei, polychrom. Kette und Eintrag:
Wolle; 2019.599
Provenienz: 1950/60er –1976 Max Hunziker
(1901–1976), Zürich; 1976 – 2019 Ursula Kunz,
Zürich
Geschenk Ursula Kunz
79
Büste in Medaillon
Ägypten, 6. Jh.
Wirkerei, polychrom. Kette und Eintrag:
Wolle; 2019.600
Provenienz: 1950/60er – 1976 Max Hunziker
(1901–1976), Zürich; 1976 – 2019 Ursula Kunz,
Zürich
Geschenk Ursula Kunz
Ente in Medaillon
Ägypten, 6./7. Jh.
Wirkerei, polychrom. Kette und Eintrag:
Wolle; 2019.601
Provenienz: 1950/60er – 1976 Max Hunziker
(1901–1976), Zürich; 1976 – 2019 Ursula Kunz,
Zürich
Geschenk Ursula Kunz
Vogel (Rebhuhn) in Medaillon
Ägypten, 6./7. Jh.
Wirkerei, polychrom. Kette und Eintrag:
Wolle; 2019.602
Provenienz: 1950/60er – 1976 Max Hunziker
(1901–1976), Zürich; 1976 – 2019 Ursula Kunz,
Zürich
Geschenk Ursula Kunz
Vogel mit Band in Medaillon
Ägypten, 6./7. Jh.
Wirkerei, polychrom. Kette und Eintrag:
Wolle; 2019.603
Provenienz: 1950/60er – 1976 Max Hunziker
(1901–1976), Zürich; 1976 – 2019 Ursula Kunz,
Zürich
Geschenk Ursula Kunz
Zwei Tauben mit Vase
Ägypten, 6./7. Jh.
Wirkerei, polychrom. Kette und Eintrag:
Wolle; 2019.604
Provenienz: 1950/60er – 1976 Max Hunziker
(1901–1976), Zürich; 1976 – 2019 Ursula Kunz,
Zürich
Geschenk Ursula Kunz
Halsbesatz einer Tunika
Ägypten, 6./7. Jh.
Wirkerei, monochrom. Kette und Eintrag:
Wolle; 2019.605
Provenienz: 1950/60er – 1976 Max Hunziker
(1901–1976), Zürich; 1976 – 2019 Ursula Kunz,
Zürich
Geschenk Ursula Kunz
Ziereinsatz in Form eines Flechtband-
dekors
Ägypten, 11./12. Jh. (?)
Wirkerei, polychrom. Kette und Eintrag:
Wolle; 2019.606
Provenienz: 1950/60er – 1976 Max Hunziker
(1901–1976), Zürich; 1976 – 2019 Ursula Kunz,
Zürich
Geschenk Ursula Kunz
Ziereinsatz (beschnitten) mit Zentauer
und Kampfern
Ägypten, 5./6. Jh. (?)
Wirkerei, bichrom. Kette und Eintrag: Wolle;
2019.607
Provenienz: 1950/60er – 1976 Max Hunziker
(1901–1976), Zürich; 1976 – 2019 Ursula Kunz,
Zürich
Geschenk Ursula Kunz
Zierstreifen mit Figuren und quadratischer
Ziereinsatz
Ägypten, 10./11. Jh. (?)
Wirkerei, monochrom. Kette und Eintrag:
Wolle; 2019.608
Provenienz: 1950/60er – 1976 Max Hunziker
(1901–1976), Zürich; 1976 – 2019 Ursula Kunz,
Zürich
Geschenk Ursula Kunz
Ärmelstreifen einer Tunika (?)
Ägypten, 10./11. Jh. (?)
Wirkerei, monochrom. Kette und Eintrag:
Wolle; 2019.609
Provenienz: 1950/60er – 1976 Max Hunziker
(1901–1976), Zürich; 1976 – 2019 Ursula Kunz,
Zürich
Geschenk Ursula Kunz
Dekor in Form eines griechischen Kreuzes
mit vier Binnenkreuzen
Ägypten, 6./7. Jh. (?)
Wirkerei, polychrom. Kette und Eintrag: Wol-
le; 2019.610
Provenienz: 1950/60er – 1976 Max Hunziker
(1901–1976), Zürich; 1976 – 2019 Ursula Kunz,
Zürich
Geschenk Ursula Kunz
Kongo
Künstler der Biombo
Maske mit Schnabel und Federkrone,
munyinga
Demokratische Republik Kongo, vor 1938
Pflanzenfasern, Horn, Federn; 2019.426
Provenienz: 1938 Hans Himmelheber, in
situ erworben; Auktion Sotheby’s New York,
No. 284; 1987– 2019 Sammlung Barbara und
Eberhard Fischer
Geschenk Eberhard und Barbara Fischer
Künstler der Yaka
Maske mit fünfzackigem Aufsatz
Demokratische Republik Kongo, vor 1938
Holz, Pflanzenfasern, Farbpigmente; 2019.428
Provenienz: 1938 Hans Himmelheber, in situ
erworben; Auktion Sotheby’s New York,
No. 284; 1987– 2019 Sammlung Barbara und
Eberhard Fischer
Geschenk Eberhard und Barbara Fischer
80
Künstler der Yaka
Maske mit Kegel-Aufsatz
Demokratische Republik Kongo, vor 1938
Holz, Pflanzenfasern, Farbpigmente; 2019.429
Provenienz: 1938 Hans Himmelheber, in
situ erworben; Auktion Sotheby’s New York,
No. 284; 1987 Sammlung Barbara und
Eberhard Fischer
Geschenk Eberhard und Barbara Fischer
Katomi aus Kapuna in der Yaka-Region
Maske kambaanzya zum Schutz
Demokratische Republik Kongo, vor 1938
Pflanzenfasern, Farbpigmente; 2019.430
Provenienz: 20.06.1938 Hans Himmelheber,
in situ erworben; Auktion Sotheby’s
New York, No. 284; 1987– 2019 Sammlung
Barbara und Eberhard Fischer
Geschenk Eberhard und Barbara Fischer
Künstler der östlichen Pende-Region
Zierbeil für Künstler
Demokratische Republik Kongo, vor 1939
Holz, Metall; 2019.438
Provenienz: 1938/39–2003 Hans Himmelheber,
in situ erworben; 2003–2019 Susanne
Himmelheber
Ankauf mit Mitteln von Eberhard und Barbara
Fischer
Künstler der Kuba-Kete
Trinkhorn
Demokratische Republik Kongo, vor 1939
Rinderhorn; 2019.439
Provenienz: 1939–2003 Hans Himmelheber,
in situ erworben; 2003–2019 Susanne
Himmelheber
Ankauf mit Mitteln von Eberhard und Barbara
Fischer
Künstler und Ritualexperte der Bekalebue
Kraftfigur, nkishi
Demokratische Republik Kongo, vor 1939
Holz; 2019.440
Provenienz: 1939–2003 Hans Himmelheber,
in situ erworben; 2003–2019 Susanne
Himmelheber
Ankauf mit Mitteln von Eberhard und Barbara
Fischer
Amerika
Textilfragment mit Menschenfigur
Peru, nördliche/zentrale Küstenregion;
Chimú, 11.–15. Jh.
Leinwandbindiges Baumwollgewebe, evtl.
Kamelidenhaar; B. 49 cm, H. 66 cm; 2019.595
Geschenk Urs und Ruth Eberhard
Textilfragment mit Menschenfiguren
und Fransenborte
Peru, nördliche/zentrale Küstenregion;
Chimú, 11.–15. Jh.
Leinwandbindiges Gewebe, Kamelidenhaar;
B. 11 cm, H. 42 cm; 2019.596
Geschenk Urs und Ruth Eberhard
Textilfragment mit Vögeln
Peru, zentrale Küstenregion; Späte Zwischen-
periode, 11.–15. Jh.
Leinwandbindiges Gewebe, Kamelidenhaar;
L. 41 cm, B. 16 cm; 2019.611
Geschenk Angela Schader, aus dem Legat
ihrer Mutter Gira Annemarie Schader
Textilfragment mit zwei Menschenfiguren
und Wellenmuster
Peru, zentrale Küstenregion; späte Zwischen-
periode, 11.–15. Jh.
Leinwandbindiges Gewebe, Kamelidenhaar;
B. 9 cm, H. 31 cm; 2019.612
Geschenk Angela Schader, aus dem Legat
ihrer Mutter Gira Annemarie Schader
Textilfragment mit vier tiergestaltigen Wesen
Peru, zentrale Küstenregion; späte Zwischen-
periode, 11.–15. Jh.
Leinwandbindiges Gewebe, Kamelidenhaar;
L. 17 cm, B. 4 cm; 2019.613
Geschenk Angela Schader, aus dem Legat
ihrer Mutter Gira Annemarie Schader
Textilfragment mit Vögeln
Peru, zentrale Küstenregion; späte Zwischen-
periode, 11.–15. Jh.
Leinwandbindiges Gewebe, Kamelidenhaar;
B. 6 cm, H. 19 cm; 2019.614
Geschenk Angela Schader, aus dem Legat
ihrer Mutter Gira Annemarie Schader
Textilfragment mit Menschenfigur
und Wellenmuster
Peru, zentrale Küstenregion; späte Zwischen-
periode, 11.–15. Jh.
Leinwandbindiges Gewebe, Kamelidenhaar;
B. 9 cm, H. 18 cm; 2019.615
Geschenk Angela Schader, aus dem Legat
ihrer Mutter Gira Annemarie Schader
Textilfragment mit Vogel und Lappenfransen
Peru, zentrale Küstenregion; späte Zwischen-
periode, 11.–15. Jh.
Leinwandbindiges Gewebe, Kamelidenhaar;
B. 4,5 cm, H. 16 cm; 2019.616
Geschenk Angela Schader, aus dem Legat
ihrer Mutter Gira Annemarie Schader
Textilfragment mit vogelartigen Wesen
und Fransenborte
Peru, zentrale Küstenregion; späte Zwischen-
periode, 11.–15. Jh.
Leinwandbindiges Gewebe, Kamelidenhaar;
L. 22 cm, B. 9 cm; 2019.617
Geschenk Angela Schader, aus dem Legat
ihrer Mutter Gira Annemarie Schader
81
Steigbügelflasche mit Kriegerfigur
Peru, nördliche Küstenregion; Moche, 600 –700
Ton, bemalt, gebrannt; H. 23 cm, D. 14 cm;
2019.579
Legat Ulrich Frey
Steigbügelflasche mit szenischer Bemalung
Peru, nördliche Küstenregion; Moche, 600 –700
Ton, bemalt, gebrannt; H. 29,5 cm, D. 14 cm;
2019.580
Legat Ulrich Frey
Steigbügelflasche eines Vogels
Peru, nördliche Küstenregion; Moche, 400 – 500
Ton, bemalt, gebrannt; H. 18,5 cm, B. 10 cm,
T. 15 cm; 2019.581
Legat Ulrich Frey
Steigbügelflasche eines Meeresschnecken-
Horn-Spielers
Peru, nördliche Küstenregion; Moche, 500 – 700
Ton, bemalt, gebrannt; H. 21 cm, B. 13 cm,
T. 15,5 cm; 2019.582
Legat Ulrich Frey
Steigbügelflasche mit sog. Mondwesen
Peru, nördliche Küstenregion; Moche, 200 – 600
Ton, bemalt, gebrannt; H. 18 cm, D. 15 cm;
2019.583
Legat Ulrich Frey
Steigbügelflasche mit Ritzverzierung
Peru; Chavín, 900 – 550 v. Chr.
Ton, geritzt, gebrannt; H. 23 cm, D. 14 cm;
2019.584
Legat Ulrich Frey
Figurenkopf
Mexiko; Veracruz, 600 – 900
Ton, gebrannt; H. 17 cm, B. 13,5 cm, T. 8 cm;
2019.585
Legat Ulrich Frey
Doppelgefass mit Figurinenattache
Peru; Chimú-Stil, aber frühe Kolonialzeit,
1500 –1700
Ton, glasiert, gebrannt; H. 14 cm, B. 9 cm,
T. 17,5 cm; 2019.586
Legat Ulrich Frey
Steigbügelflasche mit Figurenattache
Peru; Chimú, 1300 –1500
Ton, gebrannt; H. 17 cm, D. 11 cm; 2019.587
Legat Ulrich Frey
Steigbügelflasche eines Vogels
Peru; Chimú, 1300 –1500
Ton, gebrannt; H. 17,5 cm, B. 11 cm, T. 18 cm;
2019.588
Legat Ulrich Frey
Steigbügelflasche eines Tieres
Peru; Chimú, 1300 –1500
Ton, gebrannt; H. 22 cm, B. 11 cm, T. 18 cm;
2019.589
Legat Ulrich Frey
Doppelgefass mit Figur und Architektur
Peru, nördliche Küstenregion; Moche,
100 v. Chr.–100 n. Chr.
Ton, bemalt, gebrannt; H. 14 cm, B. 9 cm,
T. 19,5 cm; 2019.590
Legat Ulrich Frey
Steigbügelflasche eines Kopfes
Peru, nördliche Küstenregion; Moche, 200 –700
Ton, bemalt, gebrannt; H. 26 cm, B. 16 cm,
T. 14 cm; 2019.591
Legat Ulrich Frey
Dreifussschale eines Vogels
Costa Rica, Datierung unklar
Ton, bemalt, gebrannt; H. 7,5 cm, B. 13,5 cm,
T. 14 cm; 2019.592
Legat Ulrich Frey
Steigbügelflasche eines Menschen
mit Tasche
Peru, nördliche Küstenregion; Moche, 400 –700
Ton, bemalt, gebrannt; H. 20 cm, B. 12 cm,
T. 18 cm; 2019.593
Legat Ulrich Frey
Steigbügelflasche eines Menschen
Peru, nördliche Küstenregion; Moche, 400 –700
Ton, bemalt, gebrannt; H. 22 cm, B. 12 cm,
T. 12 cm; 2019.594
Legat Ulrich Frey
Europa
Schal (europaische Imitation)
Europa, 19./20. Jh.
Wolle; 2019.619
Provenienz: 1926 –1935 Wahrscheinlich
Ankauf in der Türkei durch Henri Martin
(1879 –1959), Chargé d’affaires, ab 1928
Ministre plénipotentiaire; 1935 –1959 Henri
Martin; 1959 – 2018 Familienbesitz, zuletzt
Agnès Kaeser, Nichte von Henri Martin
Geschenk Agnès Kaeser
82
Ankäufe mit städtischen Mitteln
Iran
Federschachtel (qalamdân) mit Tintenfass
(Einsatz) und gehakelter Schutzhülle
Mohammad Sâdeq, 1781–1782
Papiermâché und Malerei unter Lack (Feder-
schachtel); Messing- und Weissblech, Filigré
(Messingdraht), Messingperlen, Türkis
(Tintenfass), Wolle, gehäkelt (Schutzhülle);
2019.432a-d
Provenienz: Antiquitätenhändler, Portobello
Road, London; 1990er – 2019 Masoud Etemadi
(Fetcham, Surrey, GB); Sotheby’s, London,
Arts of the Islamic World, L19220, Los 55
Ankauf mit Mitteln der Stadt Zürich
Indien
Jainistisches Pata
Indien, 1850 –1900
Pigmentmalerei auf Baumwolle; 2019.437
Provenienz: 1960 –1970 Mehra, Kunsthändler
im Red Fort, Delhi, Indien; 1970 –1993 Bodo
Schmitz, Sammler, Kronberg, Taunus;
1993 – 2019 Bettina und Winfried Wieland,
private Sammler in Deutschland, Grafenau;
Koller Zürich, 4. Juni 2019, Lot 466
Ankauf mit Mitteln der Stadt Zürich
Kannati Bimbam
Balan Nambiar
Indien, 2004
Stahl, geschweisst; 2019.535
Provenienz: 2004–2019 Sammlung Balan
Nambiar
Ankauf mit Mitteln der Stadt Zürich
Shakti Symbolized
Balan Nambiar
Indien, 2004
Stahl, geschweisst; 2019.536
Provenienz: 2004 – 2019 Sammlung Balan
Nambiar
Ankauf mit Mitteln der Stadt Zürich
Kannati Bimbam mit Prabhavali
Indien, Kerala, 2018
Messing; 2019.537
Provenienz: 1980 – 2019 Sammlung Balan
Nambiar
Ankauf mit Mitteln der Stadt Zürich
Gruppe von 8 Schattenspielfiguren
(Bisma, Kresna, Kunti, Udawa, Toggog,
Srikandi, Destarastra, Billung)
gefertigt nach den Entwürfen von Ki Enthus
Susmono
Indonesien, Java, 20. Jh.
Leder, Pigmente; 2019.554, 2019.555,
2019.556, 2019.557, 2019.558, 2019.559,
2019.560, 2019.0561
Ankauf mit Mitteln der Stadt Zürich
Pakistan
Untitled
Donia Qaiser
Pakistan, Lahore, 2018
Gouache auf Papier; 2019.0531
Provenienz: 2018 – 2019 Canvas Gallery,
Karachi
Ankauf mit Mitteln der Stadt Zürich
Untitled
Jahanzeb Akmal
Pakistan, Lahore, 2018
Gouache auf Papier; 2019.0532
Provenienz: 2018 – 2019 Canvas Gallery,
Karachi
Ankauf mit Mitteln der Stadt Zürich
Untitled
Mahzeb Baloch
Pakistan, Lahore, 2018
Gouache auf Papier; 2019.0533
Provenienz: 2018 – 2019 Canvas Gallery,
Karachi
Ankauf mit Mitteln der Stadt Zürich
Untitled
Maryam Baniasadi
Pakistan, Lahore, 2018
Gouache auf Papier; 2019.0534
Provenienz: 2018 – 2019 Canvas Gallery,
Karachi
Ankauf mit Mitteln der Stadt Zürich
Untitled
Shahid Malik
Pakistan, Lahore, 2018
Gouache auf Papier; 2019.0623
Provenienz: 2018 – 2019 Canvas Gallery,
Karachi
Ankauf mit Mitteln der Stadt Zürich
Untitled
Shamsuddin
Pakistan, Lahore, 2018
Gouache auf Papier; 2019.0624
Provenienz: 2018 – 2019 Canvas Gallery,
Karachi
Ankauf mit Mitteln der Stadt Zürich
Untitled
Syed Hussein Agha
Pakistan, Lahore, 2018
Gouache auf Papier; 2019.0625
Provenienz: 2018 – 2019 Canvas Gallery,
Karachi
Ankauf mit Mitteln der Stadt Zürich
ankäufe
83
Kongo
Künstler und Künstlerin der Kuba
Wickeltuch für Manner, mapel
Demokratische Republik Kongo, Anfang 20. Jh
Raffia; 2019.416
Provenienz: Galerie Carambol von Edith
Abegglen, Basel; ca. 1989 – 2019 Andrea
Bussiek und Peter Olpe
Ankauf mit Mitteln der Stadt Zürich
Künstler und Künstlerin der Kuba
Wickeltuch für Manner, mapel
Demokratische Republik Kongo, Anfang 20. Jh
Raffia; 2019.417
Provenienz: Susann Biedermann; 1998 – 2019
Sammlung Bernhard Gardi (bei Susann
Biedermann eingetauscht)
Ankauf mit Mitteln der Stadt Zürich
Japan
Zauberspiegel (makyo) mit Darstellung
des Amida Buddha
Yamamoto Gokin Seisakusho, Kyoto
Japan, 2018
Bronze; 2019.0552
Provenienz: Yamamoto Gokin Seisakusho Ltd.
6-6 Ebisubabacho, Shimogyo-ku,
Kyoto 600-8837
Japan
Ankauf mit Mitteln der Stadt Zürich
China
Schneelandschaft
Luo Ping (1733 –1799)
China, Qing-Dynastie, datiert 1780
Tusche auf Papier; 2019.0621
Provenienz: 1936/1937–1973 Fritz Wiegmann
(1902 –1973), arbeitete in diesen Jahren bei
Dubosc in Beijing; Jean-Pierre Dubosc,
Beijing; 1973/1999 – 2019 Detlev von Graeve,
Frankfurt, durch Erbschaft von Fritz Wiegmann
Ankauf mit Mitteln der Stadt Zürich
Landschaft in Miniaturformat
Dong Bangda (1699 –1769)
China, Qing-Dynastie, 18. Jh.
Tusche auf Seide; 2019.0622
Provenienz: 1936/1937–1973 Fritz Wiegmann
(1902 –1973), arbeitete in den Jahren 1936/1937
bei Dubosc in Beijing; Jean-Pierre Dubosc,
Beijing; 1973/1999 – 2019 Detlev von Graeve,
Frankfurt, durch Erbschaft von Fritz Wiegmann
Ankauf mit Mitteln der Stadt Zürich
Ankäufe mit Fremdmitteln
Iran
Kniende junge Frau
Valî Jân (Veli Can)
Iran und Türkei, Istanbul (Montage als
Albumblatt), 1570 –1580
Tinte, Pigmente und Gold auf Papier; 2019.436
Provenienz: Kunsthandel Istanbul; vor
1929 – um 1943 Armenag Bey Sakisian; um
1943 –1981 Maurice Bouvier (1901–1981);
um 1981– 2019 Nachfahren von Maurice
Bouvier (?); Artcurial, Paris, Archéologie
et arts d’Orient, vente 3916, Los 292
Ankauf mit Mitteln des Rietberg-Kreises
Indien
Goda Putra (von raga megha)
Folio aus der Guler-Ragamala-Serie von
ca. 1790
Meister der ersten Generation nach
Nainsukh, ev. Ranjha
Indien, Pahari-Gebiet, Guler, um 1790
Pigmentmalerei mit Gold auf Papier; 2019.0415
Provenienz: Alma Latifi Collection (1879 –1959);
2013 Sotheby’s London, 9 October, 2013,
lot 259; 2013 – 2019 Private Collection (USA);
Carlton Rochell, Asian Art Gallery, New York
Ankauf aus Legat von Gabriele Louise Aino
Schnetzer
Dhanasri Ragini
Folio aus der Berlin-Bundi-Ragamala-Serie
Indien, Bundi, 1670
Pigmentmalerei mit Gold auf Papier; 2019.0418
Provenienz: William K. Ehrenfeld collection,
San Francisco (1934 – 2005); Ludwig Habig-
horst (1935 –); Francesca Galloway, London
Ankauf aus Legat von Gabriele Louise Aino
Schnetzer
Krishna entwurzelt die arjuna-Baume
Folio aus dem Palam Bhagavata Purana
Indien, Delhi /Agra, 16. Jh.
Pigmentmalerei auf Papier; 2019.0441
Provenienz: Sammlung Eva und Konrad
Seitz, Wachtberg
Sammlung Eva und Konrad Seitz, Ankauf
mit Mitteln des Rietberg-Kreises
Krishna tritt im Vrindawald ein, die Gopis
vernehmen sein Flötenspiel in der Ferne
Folio aus dem Palam Bhagavata Purana
Indien, Delhi /Agra,
Pigmentmalerei auf Papier; 2019.0442
Provenienz: Sammlung Eva und Konrad
Seitz, Wachtberg
Sammlung Eva und Konrad Seitz, Ankauf
mit Mitteln des Rietberg-Kreises
Uddhava erteilt Ratschlage am Hof
und macht sich dann auf den Weg
nach Indraprastha
Folio aus dem Palam Bhagavata Purana
Indien, Delhi /Agra,
Pigmentmalerei auf Papier; 2019.0443
Provenienz: Sammlung Eva und Konrad
Seitz, Wachtberg
Sammlung Eva und Konrad Seitz, Ankauf
mit Mitteln des Rietberg-Kreises
84
Japan
No-Gewand vom Typ choken mit Dekor
von Trichterwinde und Bambuszaun auf
weissem Grund
Japan, Edo-Zeit, 2. Hälfte 18. bis Mitte 19. Jh.
Seide, Gaze-Webart mit zusätzlichen Schuss-
fäden aus Goldpapier-Streifen; 2019.562
Provenienz: 1750 –1870 verschiedene Daimyo-
Familien; 1870 – 2019 Sammlung Baron Fujita
Denzaburo (1841–1912); 2019 – Okt 2019
Takeshi Kimura, Tokyo
Ankauf aus Legat von Gabriele Louise Aino
Schnetzer
No-Gewand vom Typ choken mit Dekor
von Pinien, Wisteria und Bambusgras auf
purpurnem Grund
Japan, Edo-Zeit, 2. Hälfte 18. bis Mitte 19. Jh.
Seide, Gaze-Webart mit zusätzlichen Schuss-
fäden aus Goldpapier-Streifen; 2019.563
Provenienz: 1750 –1870 verschiedene Daimyo-
Familien; 1870– 2019 Sammlung Baron Fujita
Denzaburo (1841–1912); 2019–Okt 2019
Takeshi Kimura, Tokyo
Ankauf aus Legat von Gabriele Louise Aino
Schnetzer
No-Gewand vom Typ choken mit Dekor
von Fachern und Clematis-Ranken auf
grünem Grund
Japan, Edo-Zeit, 19. Jh.
Seide, Gaze-Webart mit zusätzlichen Schuss-
fäden aus Goldpapier-Streifen; 2019.564
Provenienz: 1750 –1870 verschiedene Daimyo-
Familien; 1870 – 2019 Sammlung Baron Fujita
Denzaburo (1841–1912); 2019 – Okt 2019
Takeshi Kimura, Tokyo
Ankauf aus Legat von Gabriele Louise Aino
Schnetzer
No-Gewand vom Typ choken mit Dekor
von Blumenkörben und Schmetterlingen
auf rotem Grund
Japan, Edo-Zeit, 18. Jh.
Seide, Gaze-Webart mit zusätzlichen Schuss-
fäden aus Goldpapier-Streifen; 2019.565
Provenienz: 1750–1870 verschiedene Daimyo -
Familien; 1870–2019 Sammlung Baron Fujita
Denzaburo (1841–1912); 2019 – Okt 2019
Takeshi Kimura, Tokyo
Ankauf aus Legat von Gabriele Louise Aino
Schnetzer
No-Gewand vom Typ maiginu mit Dekor
von Kranichen auf dunkelblauem Grund
Japan, Edo-Zeit, 2. Hälfte 18. bis Mitte 19. Jh.
Seide, Gaze-Webart mit zusätzlichen Schuss-
fäden aus Goldpapier-Streifen; 2019.566
Provenienz: 1750 –1870 verschiedene Daimyo -
Familien; 1870– 2019 Sammlung Baron Fujita
Denzaburo (1841–1912); 2019 – Okt 2019
Takeshi Kimura, Tokyo
Ankauf aus Legat von Gabriele Louise Aino
Schnetzer
No-Gewand vom Typ kariginu mit Dekor
von Paonien auf swastika-artigen Wappen-
zeichen
Japan, Edo-Zeit, 2. Hälfte 18. bis Mitte 19. Jh.
Seide, Satin-Webart mit zusätzlichen Schuss-
fäden aus Goldpapier-Streifen; 2019.567
Provenienz: 1750–1870 verschiedene Daimyo -
Familien; 1870– 2019 Sammlung Baron Fujita
Denzaburo (1841–1912); 2019 – Okt 2019
Takeshi Kimura, Tokyo
Ankauf aus Legat von Gabriele Louise Aino
Schnetzer
No-Gewand vom Typ kariginu mit Dekor
von geflochtenem Holzzaun über Wisteria
und Blumenstraussen
Japan, Edo-Zeit, 2. Hälfte 18. bis Mitte 19. Jh.
Seide, Satin-Webart mit zusätzlichen Schuss-
fäden aus Goldpapier-Streifen; 2019.568
Provenienz: 1750–1870 verschiedene Daimyo -
Familien; 1870– 2019 Sammlung Baron Fujita
Denzaburo (1841–1912); 2019 – Okt 2019
Takeshi Kimura, Tokyo
Ankauf aus Legat von Gabriele Louise Aino
Schnetzer
No-Gewand vom Typ kariginu mit Dekor
von Bambusblattern, die in Rhombenform
angeordnet sind
Japan, Edo-Zeit, 2. Hälfte 18. bis Mitte 19. Jh.
Seide, Gaze-Webart; 2019.569
Provenienz: 1750–1870 verschiedene Daimyo -
Familien; 1870– 2019 Sammlung Baron Fujita
Denzaburo (1841–1912); 2019 – Okt 2019
Takeshi Kimura, Tokyo
Ankauf aus Legat von Gabriele Louise Aino
Schnetzer
No-Gewand vom Typ happi (Jacke)
mit Dekor von Blumen, angeordnet
in Zickzack-Linien
Japan, Edo-Zeit, 2. Hälfte 18. bis Mitte 19. Jh.
Seide, Satin-Webart mit zusätzlichen Schuss-
fäden aus Goldpapier-Streifen; 2019.570
Provenienz: 1750–1870 verschiedene Daimyo -
Familien; 1870–2019 Sammlung Baron Fujita
Denzaburo (1841–1912); 2019 – Okt 2019
Takeshi Kimura, Tokyo
Ankauf aus Legat von Gabriele Louise Aino
Schnetzer
85
No-Gewand vom Typ sobatsugi (armellose
Jacke) mit Dekor von Drachen in Wolken
Japan, Edo-Zeit, 19. Jh.
Seide, Satin-Webart mit zusätzlichen Schuss-
fäden aus Goldpapier-Streifen; 2019.571
Provenienz: 1750–1870 verschiedene Daimyo -
Familien; 1870 – 2019 Sammlung Baron Fujita
Denzaburo (1841–1912); 2019 – Okt 2019
Takeshi Kimura, Tokyo
Ankauf aus Legat von Gabriele Louise Aino
Schnetzer
No-Gewand vom Typ karaori mit Dekor
von Pflaumenblütenzweigen auf rot-weiss
alternierenden Farbflachen
Japan, Edo-Zeit, 2. Hälfte 18. bis Mitte 19. Jh.
Seide, Köperbindung mit zusätzlichen Schuss-
fäden aus farbigen Seidenfäden; 2019.572
Provenienz: 1750–1870 verschiedene Daimyo -
Familien; 1870 – 2019 Sammlung Baron Fujita
Denzaburo (1841–1912); 2019 – Okt 2019
Takeshi Kimura, Tokyo
Ankauf aus Legat von Gabriele Louise Aino
Schnetzer
No-Gewand vom Typ atsuita mit Dekor von
Paulownia und Phoenixen auf rot-weiss-
braun alternierenden Farbflachen
Japan, Edo-Zeit, 2. Hälfte 18. bis Mitte 19. Jh.
Seide, Köperbindung mit zusätzlichen Schuss-
fäden aus farbigen Seidenfäden; 2019.573
Provenienz: 1750 –1870 verschiedene Daimyo -
Familien; 1870 – 2019 Sammlung Baron Fujita
Denzaburo (1841–1912); 2019 – Okt 2019
Takeshi Kimura, Tokyo
Ankauf mit Mitteln des Rietberg-Kreises
No-Gewand vom Typ nuihaku mit Dekor
von stilisierten Wolken
Japan, Edo-Zeit, 19. Jh.
Seide, Satin-Webart mit Stickerei aus Seiden-
fäden; 2019.574
Provenienz: 1750–1870 verschiedene Daimyo -
Familien; 1870 – 2019 Sammlung Baron Fujita
Denzaburo (1841–1912); 2019 – Okt 2019
Takeshi Kimura, Tokyo
Ankauf aus Legat von Gabriele Louise Aino
Schnetzer
No-Gewand vom Typ nuihaku mit Dekor
von Pampas-Gras und Schmetterlingen
über einem Holzgitter
Japan, Edo-Zeit, 19. Jh.
Seide, Satin-Webart mit Stickerei mit farbigen
Seidenfäden und Spuren von Goldblatt-
Applikationen; 2019.575
Provenienz: 1750–1870 verschiedene Daimyo -
Familien; 1870 – 2019 Sammlung Baron Fujita
Denzaburo (1841–1912); 2019 – Okt 2019 Ta-
keshi Kimura, Tokyo
Ankauf aus Legat von Gabriele Louise Aino
Schnetzer
No-Gewand vom Typ mizugoromo
(Reise-Mantel)
Japan, Meiji- bis Taishô-Zeit, spätes 19. bis
Anfang 20. Jh.
Seide, unregelmässige Grundbindung;
2019.576
Provenienz: 1750 –1870 verschiedene Daimyo-
Familien; 1870 – 2019 Sammlung Baron Fujita
Denzaburo (1841–1912); 2019 – Okt 2019
Takeshi Kimura, Tokyo
Ankauf aus Legat von Gabriele Louise Aino
Schnetzer
No-Gewand vom Typ hangiri mit Dekor
von chinesischen Löwen (karashishi)
Japan, Edo-Zeit, 19. Jh.
Seide, Satin-Webart mit zusätzlichen Schuss-
fäden aus Goldpapier-Streifen; 2019.577
Provenienz: 1750–1870 verschiedene Daimyo-
Familien; 1870 – 2019 Sammlung Baron Fujita
Denzaburo (1841–1912); 2019 – Okt 2019
Takeshi Kimura, Tokyo
Ankauf aus Legat von Gabriele Louise Aino
Schnetzer
No-Gewand vom Typ hangiri mit Dekor von
Drachen in Wolken
Japan, Edo-Zeit, 19. Jh.
Seide, Satin-Webart mit zusätzlichen Schuss-
fäden aus Goldpapier-Streifen; 2019.578
Provenienz: 1750–1870 verschiedene Daimyo-
Familien; 1870 – 2019 Sammlung Baron Fujita
Denzaburo (1841–1912); 2019 – Okt 2019
Takeshi Kimura, Tokyo
Ankauf aus Legat von Gabriele Louise Aino
Schnetzer
Kongo
Künstler der Chokwe
Weibliche Maske, pwo
Demokratische Republik Kongo, vor 1939
Holz, Farbpigmente, Pflanzenfasern, Eisen
(Ohrring links), Kupferlegierung (Ohrring
rechts); 2019.423
Provenienz: 1938/39 Hans Himmelheber,
in situ erworben; 1939/40 Georg Kegel und
Lore Kegel-Konietzko; Boris Kegel- Konietzko,
Hamburg
Ankauf mit Mitteln des Rietberg-Kreises
86
Anschaffungskommission
Das Museum Rietberg wird bei seinen An-
schaffungen von Kunstwerken unterstützt
von einer Kommission, die sich für das
Berichtsjahrs aus folgenden Fachleuten
zusammensetzt: Prof. Dr. Willibald Veit,
Prof. Dr. Franz Zelger, Dr. Eberhard Fischer
und Dr. Albert Lutz.
87
Im Jahr 2019 wurden aus den Sammlungs-
beständen des Museums Rietberg 45 Kunst-
werke an andere Institutionen ausgeliehen:
Rubin Museum of Art, New York
«The Second Buddha: The Lotus-born Guru»
Februar 2018 – Januar 2019
1 tibetische Bronze
Museo Nazionale Romano, Rom
«Primitivism in 20th century sculpture»
September 2018 – Februar 2019
3 Schweizer Masken, 1 malische Skulptur
Situation Kunst Bochum
«Qiu Shihua»
Oktober 2018 – Mai 2019
17 chinesische Werke
Museo Civico Archeologico, Bologna
«AFRICA – Stories and Glories of a Continent»
März 2019 – September 2019
2 afrikanische Skulpturen
Museo delle Culture (MUSEC), Lugano
«Primitivism in 20th century sculpture»
April 2019 – Juli 2019
4 Schweizer Masken, 1 afrikanische Skulptur
Historisches und Völkerkundemuseum
St. Gallen
«Mandala – Auf der Suche nach Erleuchtung»
Juni 2019 – Januar 2020
1 salvadorianisches Werk
Landesmuseum Zürich
«INDIENNES – Stoff für tausend Geschichten»
August 2019 – Januar 2020
8 indische Werke
Zentralbibliothek Zürich
«Kosmos in der Kammer»
August 2019 – Dezember 2019
1 indische Miniatur
Musée de l’Europe / Palexpo Genève
«Gods: A User’s Guide»
Oktober 2019 – Januar 2020
1 japanische, 1 afrikanische, 2 tibetische,
2 indische Skulpturen
Dauerleihgaben
Wereldmuseum Rotterdam:
1 japanische Skulptur
Zoo Zürich:
1 ghanaischer Ring
Antikenmuseum Basel und Sammlung
Ludwig:
6 Hauptwerke der Ägyptensammlung
Museum für Asiatische Kunst,
Staatliche Museen zu Berlin:
2 buddhistische chinesische Skulpturen
Stiftung Deutsches Hygiene-Museum,
Dresden:
1 Lehnstuhl der Chokwe-Werkstatt, Angola
Kunsthaus Zürich:
3 gotische Skulpturen,
1 Skulptur von Alexander Archipenko
leihgaben aus dem museum
88
NASCA. Buscando huellas en el desierto.Ausstellung in Madrid, Espacio Fundación Telefónica, von 22. Februar bis 19. Mai 2019.
Die Ausstellung, die das Museum Rietberg in enger Kooperation mit dem Museo de Arte de Lima und in Partnerschaft mit der Bundeskunsthalle in Bonn erarbeitete, ist im vorletzten Jahresbericht ausführlich diskutiert. Dass eine museale Produktion, die wissenschaftliche Arbeiten und Kooperationen mit der Herkunftsregion in ihrem Kern einschliesst, einen ausserordentlichen Publikumserfolg feiern darf, bestätigt die Ausrichtung des Museums Rietberg. Sämtliche Leihgaben stammten aus peruanischen Institutionen. Die Ausstellung vermittelte die wissenschaftlichen Erkenntnisse von Feldforschungsprojekten der Schweizerisch-Liechtensteinischen Stiftung für archäologische Forschungen im Ausland, des Archäologischen Insti-tuts der Universität Zürich und des Deutschen Archäologischen Instituts. Nasca war mit über 51‘000 Eintritten die am viertbesten besuchte Sonderschau unseres Museums. Auch in Lima und Bonn verzeichnete sie grosses Publikumsinteresse.
Anlässlich der internationalen zeitgenössischen Kunstmesse in Madrid (ARCOmadrid) konnten wir eine reduzier te Version der Nasca-Ausstellung dem Publikum zeigen, die mit 102‘104 gezählten Eintritten auf grosses Interesse stiess. / FuP
«ZeitRaume» in der Canvas Gallery in Karachi19.– 31. August 2019
Wie wäre es, am Abend der of fiziellen Eröffnung einer Ausstellung eine leere Galerie zu betreten? Was sich zuerst wie eine «Performance» anhört, war eigentlich die Protestgeste der Galeristin Sameera Raja, die Kuratorin der Canvas Gallery in Karachi. Nach der Ausstellung «ZeitRäume» im Museum Rietberg (siehe S. 27) reisten die Bilder zurück nach Pakistan, wo sie in der Canvas Gallery in Karachi gezeigt werden sollten. Jedoch blieben sie mehr als zwei Monate lang beim Zoll in Lahore hängen, so dass die Canvas Gallery die Werke nicht rechtzeitig für die Eröffnung erhalten konnte. Sameera Raja lud aber sämtliche Gäste an jenem Abend zur Vernissage ein. In leeren Räumen spazierten Kunstschaffende, Kunstliebhaber und Journalis ten. Vermutlich unterhielten sie sich auch über den von Sameera Raja verfassten Text. Die Galeristin verteilte nämlich eine Art Pamphlet mit dem Titel «Customs of the Customs» (Gebräuche des Zolls) gegen die übliche Arbeitsweise der Zollbehörden in Pakistan in Bezug auf die Kunstwelt. Ihr Mut wurde belohnt: Mehrere Journalisten berichteten über ihre Geste, und die Ehrengäste der Vernis-sage äusserten sich in aller Länge im Gästebuch über eine Vernissage in leeren Räumen. Die Bilder aber kamen doch zu spät, um ausgestellt zu werden. / VuR
ausstellungen auf reisen
89
Vortragsreihe «Stimmen der Weltarchaologie»In Kooperation mit dem Archäologischen Institut der Universität Zürich präsen-tierte das Museum Rietberg die Vielfalt der archäologischen Forschungswelt. Von März bis Mai waren hochkarätige Archäologinnen und Archäologen aus Kanada, Mexiko, Peru und China zu erleben. Beim Auftakt am 20. Februar beschäf-tigte sich Peter Fux, Archäologe und Kurator der Sammlung Altamerika, beim Vo r- trag «Über die wissenschaftsphilosophische Grundlage der komparativen Archaologie» mit den humanistischen Grundlagen der Altertumswissenschaften. Susan Rowley, Associate Professor und Kuratorin für Public Anthropology an der University of British Columbia in Vancouver, widmete sich am 6. März mit «Chan-ging Landscapes» der Archäologie rund um indigene Kulturen in British Colum-bia. «Archaeology as a profession in Peru: Historical and political contexts» lautete am 3. April das Thema von Christian Mesía, Direktor für Geisteswissen-schaften an der Universidad Científica del Sur in Lima, Peru. Mit «Ein Fenster in die Vergangenheit: Die Hieroglyphenschrift der Maya und ihre Entziffe-rung» brachte Christian Prager, Koordinator des Projekts «Textdatenbank und Wörterbuch des Klassischen Maya» an der Universität Bonn, den Anwesenden am 17. April die neusten Erkenntnisse auf diesem Gebiet näher. Franziska Fecher, wissenschaftli che Mitarbeiterin an Honduras-Projekten der Universitäten Zürich und Bonn und der Schweizerisch-Liechtensteinischen Stiftung für archäologische Forschungen im Ausland SLSA, gab am 15. Mai mit «Guadalupe, Honduras: Ar-ch aologische Ausgrabungen in einer prakolumbischen Siedlung an der Karibik-küste» Einblick in die laufende Forschung. Lukas Nickel, Professor für Asiatische Kunstgeschichte an der Universität Wien, setzte am 29. Mai mit «China und die Anfange der Seidenstrasse» den spannenden Schlusspunkt der Serie. / SuA
Zur Ausstellung «Farbe bekennen – Textile Eleganz in Teheran um 1900»Anlässlich der Veranstaltung «Le voile de la femme orientale, de l’Antiquité à nos jours» am 13. März führte Hana Chidiac, Leiterin der Sammlung Nordafrika und Naher Osten im Musée du Quai Branly in Paris, durch die jahrtausendalte Geschichte des Nahen Ostens. Im Zentrum stand die Entwicklung des Schleiers seit den ersten Erwähnungen im 3. Jahrtausend vor Christus bis in die heutige Zeit. Der Rietberg-Talk vom 27. März vermittelte zum Thema «Marktplatz global: Vom Wechsel spiel zwischen Geschaft und Kultur» Einblicke in die Mechanismen des globalen Textilhandels und die Wechselwirkungen zwischen Geschäft und Kultur: Wie haben sich Textil- und Modehäuser in den vergangenen 100 Jahren auf neue Bedürfnisse und Märkte eingestellt, Trends aufgenommen und Moden geschaf-
veranstaltungen
90
fen? Über dieses Wechselspiel diskutier te Talkmaster Rolf Probala mit Lea Haller, Historikerin und Redaktorin «NZZ Geschichte», Martin Leuthold, ehem. Art Director Jakob Schlaepfer AG und Gewinner Grand Prix Design BAK, Katja Rost, Professorin für Soziologie und Privatdozentin für Wirtschaft an der Univer-sität Zürich, sowie Axel Langer, Kurator Naher Osten am Museum Rietberg. / SuA
Zur Ausstellung «Nachster Halt Nirvana – Annaherungen an den Buddhismus»Die durch die Netflix-Serie «Chef’s Table» berühmt gewordene koreanische Zen-Nonne Jeong Kwan begeistert mit der jahrtausendalten Küchenphilosophie Foodies wie Küchenchefs auf der ganzen Welt. Am 17. Januar fand «Ein Abend mit Jeong Kwan und ihrer Tempelküche» statt, bei der die Köchin im intimen Kreis zu erleben war. Durch den Abend führten die vegane Küchenchefin und Aktivistin Lauren Wildbolz und Autorin Dr. Hoo Nam Seelmann, inklusive Ausstel-lungsbesuch mit den Kuratoren. Am 18. Januar dann lud das Haus Interessierte zur Veranstaltung «Auf einen Grüntee mit Zen-Buddhistin Jeong Kwan». Sie sprach unter Moderation von Dr. Hoo Nam Seelmann zu Zen-Buddhismus sowie zur Philosophie der koreanischen Tempelküche und bereitete den Gästen einen Grüntee zu. Wiederum begleiteten die Kuratoren den Ausstellungsbesuch. / SuA
Zur Sammlungsintervention «Die Frage der Provenienz – Einblicke in die Sammlungsgeschichte»Wie ist ein Kunstwerk in ein Museum gelangt? Dieser Frage, die auch Thema der Sammlungsintervention war, stellte sich Prof. Dr. Raphael Gross, Historiker und Präsident des Deutschen Historischen Museums DHM, in seinem Vortrag «Kolo-niale Objekte und historische Urteilskraft» am 17. März. Darin stellte er dar, wie sich sein Museum in der Auseinandersetzung um ein Werk aus kolonialem Kontext (Säule von Cape Cross) verhalten hat. Historische, ethische, politische und juris-tische Aspekte standen dabei im Fokus. Am 10. April gaben über 70 Institutionen – Museen, Bibliotheken und Archive – aus Deutschland, den Niederlanden, der Schweiz, Grossbritannien und Österreich anlässlich des 1. Tags der Provenienz-forschung einen Einblick in die Aufarbeitung der Herkunft ihrer Sammlungen und Objekte. So auch das Museum Rietberg: Esther Tisa Francini, seit über zehn Jahren Leiterin Provenienzforschung am Haus, berichtete beim Sammlungsrundgang «Die Frage der Provenienz» über ihren Forschungsalltag und offenbarte spannende Ein-sichten aus der Sammlungs geschichte des Hauses. / SuA
91
Zur Ausstellung «SPIEGEL – Der Mensch im Widerschein»Die Hauptausstellung des Jahres wurde von einem poetisch und ästhetisch geprägten Rahmenprogramm begleitet. Am 22. Mai war Schweizer Vorlesetag, das Museum Rietberg lud zu einer passenden Lesung ein. Wie Alice im Wunder-land traten die Gäste durch einen besonderen Spiegel in eine Phantasiewelt ein und liessen sich von Spiegelmärchen aus aller Welt verzaubern. Vorleserin war Christiane Ruzek, Kunstvermittlerin am Museum Rietberg. Die Compagnie Bodecker & Neander aus Berlin, begleitet von Stephan von Bothmer am Klavier, präsentierte an den Abenden vom 20. bis zum 22. Juni «Der Mann im Spiegel – Musiktheater mit Pantomime, Film und Schattenspiel», ein poetisches Musik-theater für Kinder und Erwachsene. Die eigens für die Ausstellung erdachte Pro- duktion verband Pantomime und Schattenspiel mit den Live-Klängen von Maurice Ravels «Miroirs» und Filmgeschichte von Méliès bis zu den Marx Brothers. – Die japanisch-schweizerische Modedesignerin Kazu Huggler hat, von ihrem textilen Kunstwerk in der SPIEGEL-Ausstellung inspiriert, Couture-Kreationen für die Sonnen-göttin Amaterasu und weitere Shinto-Gottheiten entwickelt. Diese präsentierte Kazu Huggler anlässlich des Fashion Talks «Von der Mythologie in die Mode» am 14. September live an Models, von der Idee bis zur Fertigung. / SuA
Zur Ausstellung «ZeitRaume – Zeitgenössische Miniaturmalerei aus Pakistan»16. Juni
Zur Finissage lud Dr. Caroline Widmer, Kuratorin für indische Malerei, zum Artist Talk mit Prof. Quddus Mirza, Ko-Kurator der Ausstellung und Vorsteher des Fine Arts Departments am National College of Arts in Lahore, Pakistan, und der Künst-lerin Sehrish Mustafaam. Dabei erörterten sie die Chancen und Potenziale von Zusammenarbeiten, wie sie im Rahmen dieser Ausstellung stattgefunden haben: eine Kooperation zwischen beiden Ländern, bei der junge Künstlerinnen und Künstler ihre von museumseigenen Werken inspirierten Arbeiten präsentieren. Als besondere Ehre ist die Anwesenheit des pakistanischen Botschafters zu nennen, der sich von der Idee, der Ausstellung und den Werken ausserordentlich begeistert zeigte. Am selben Abend wurde zudem auch die Begleitpublikation des Projektes vorgestellt, die als bleibende Erinnerung nicht nur die ausgestellten Werke präsentiert, sondern auch die Hintergründe und Umstände der Kooperation in gedruckter Form dokumentiert und bewahrt. Sie ist sowohl in den Museums-shops wie auch im Online-Shop des Museums erhältlich / SuA, WiC
92
Zur Ausstellung «Traumbild Ägypten – Frühe Fotografien von Pascal Sebah und Émile Béchard»In zwei Rahmenveranstaltungen haben Experten ihr Fachwissen mit Besuche-rinnen und Besuchern geteilt. Der Architekt und Experte für die Stadtgeschichte Kairos Thomas Meyer-Wieser verortete am 4. September in einer Art experimentellen Führung in Kairo aufgenommene Bilder im Stadtgrundriss und der Stadtgeschichte. Der Kunsthistoriker und Experte für Orientfotografie Felix Thürlemann lud am 6. Oktober zu einem Rundgang durch die Ausstellung ein und bezog die von Be-suchenden mitgebrachten historischen Souvenirfotografien aus Ägypten in das Gespräch mit ein. / GuN
Zur Ausstellung «Gitagovinda – Indiens grosse Liebesgeschichte»27. Oktober
Das indisch-kanadische Ensemble «Panwar Music and Dance» trat auf seiner Europa-Tournee exklusiv in der Park-Villa Rieter auf. Mit der Tanzperformance «Krishna – A Dance Drama» erzählten die international tätigen Künstlerinnen und Künstler vom hinduistischen Gott Krishna, seiner Jugend und seiner Liebe zum Hirtenmädchen Radha und liessen dabei die Geschichte durch den traditionell indischen Tanzstil «Kathak» aufleben. / SuA
Zur Ausstellung «Surimono – Gedichtblatter der Shijo-Schule»10. November
Teemeisterin Soyu Mukai lud zum ersten Mal und im kleinen Kreis von fünf Teil-nehmenden zur exklusiven japanischen Teezeremonie «Chaji», wörtlich die «Einladung zum Tee»: Diese im 16. Jahrhundert in Form und Inhalt vollendete Tradition gilt als höchstes Zeremoniell in der japanischen Teezubereitung, um gleichermassen eine kulturelle wie geistige Schulung zu geniessen. Bei der rund vierstündigen japanischen Teezeremonie stimmte Soyu Mukai die Gäste mit einem Begrüssungsgetränk ein. Das Legen der Kohle zur Aufbereitung des Teewassers wurde dann mit der symbolischen Reinigung von Raum und Seele abgeschlossen. Anschliessend nahmen die Teilnehmenden eine von der Teemeisterin frisch zu-bereitete, mehrgängige Kaiseki-Mahlzeit zu sich. Als ritueller Höhepunkt folgte die Zubereitung von konzentriertem Tee (Koicha), was im Genuss eines dünnen Tees (Usucha) seinen Abschluss fand. Chaji wird Soyu Mukai in losen Abständen erneut anbieten. / SuA
93
Zur Ausstellung «Fiktion Kongo – Kunstwelten zwischen Geschichte und Gegenwart»Am ersten Wochenende nach der Eröffnung der Ausstellung «Fiktion Kongo» fand ein Artist Talk mit vier kongolesischen Künstlerinnen und Künstlern statt. Ein kunstinteressiertes Publikum hörte den Ausführungen von Sammy Baloji, David Shongo, Michèle Magema und Sinzo Aanza zu ihren Werken in der Ausstellung zu. Auf Einladung des Museums hatten sich die Kunstschaffenden aus dem Kongo und der Diaspora mit dem Archiv von Hans Himmelheber auseinandergesetzt und eigens für die Ausstellung sehr spannende und zugleich diverse Arbeiten erstellt. Sammy Baloji, der zu den international bekanntesten Künstlern aus dem Kongo gehört, thematisierte in seiner komplexen Installation «The Slaughterhouse of Dreams or the First Human, Bende’s Error» die Dekontextualisierung von Objekten
94
in Museen. Um ihnen wieder eine Stimme zu geben, liess er vom kongolesischen Schriftsteller Fiston Mwanza Mujila ein Kasala neu dichten, ein Erinnerungsgedicht für Oral History bei den Luba. Der junge Medienkünstler David Shongo hingegen hatte in einer vom Museum Rietberg finanzierten Recidency für die Biennale in Lubumbashi eine Fotoserie und ein Video mit dem Titel «Blackout Poetry, Idea’s Genealogy» geschaffen. Hierfür kombinierte Shongo historische Fotografien von Hans Himmelhebers Reise 1938/39 mit futuristischen Elementen wie Virtual-Reality- Brillen oder Afronauten-Helmen. Obwohl Michèle Magema, eine der wenigen Frauen in der kongolesischen Kunstszene, ganz ähnliche Bildmotive von Hans Himmelheber auswählte wie Shongo, war ihre Arbeit «EVOLVE» sehr viel leiser und filigraner. Magema kreierte eine Serie von 26 kleinformatigen Bildern, indem sie einzelne Motive auf Himmelhebers Fotos mit feinen Tuschestrichen nachzeichnete. Diese stundenlange, repetitive Arbeit betont das Performative und Körperliche in Magemas künstlerischem Oeuvre. Beide Künstler – Magema wie Shongo – verwiesen einerseits auf die Kolonialgeschichte und bezogen sich andererseits auf ihre eigene persönliche Geschichte. Im Zentrum der Arbeit von Magema stand ihr Grossvater Malongo Isaac Magema, der zeitgleich zu Hans Himmelheber der höchste Steuereintreiber der belgischen Kolonialadministration war. Auch für Sinzo Aanza waren die Ambivalenzen und Widersprüchlichkeiten in der Kolonial-zeit der Ausgangspunkt für seine bild- und wortgewaltige Installation «The Lord is Dead, Long Life to the Lord». Als Reaktion auf eine Fotoserie von Himmelheber fragte sich der junge Künstler, was den Bewohner eines Songye-Dorfes dazu bewogen hatte, eine grosse Kraftfigur an Hans Himmelheber zu verkaufen. Mit seinen von Schifftauen umwickelten Figuren eines Priesters und eines Geschäfts-mannes verwies Sinzo Aanza auf die neuen Machthaber in der (post)kolonialen Geschichte des Kongo.
In diesem Jahr fand (ausserdem) der erste Termin der dreiteiligen Diskussions-Reihe «Look Think Discuss»: Fiktion Kongo im Dialog mit der Schweiz am 14. Dezember statt. Im Zentrum dieser ersten Begegnung stand die Installation Mvuatu-Mboka Na Biso – et la Suisse («Kleiderstil, unser Land und die Schweiz») und das dazugehörige Video von Fiona Bobo, welche sich um kongolesische Mode und Identität in der Schweiz sowie genauer um das Phänomen der sapeurs drehen. Nach einer allgemeinen Einleitung in die Ausstellung durch Michaela Oberhofer und dem gemeinsamen Betrachten des Dokumentarfilms zu den Schweizer sapeurs führte Laura Falletta das Gespräch mit den Gästen Fiona Bobo und Fabrice Mawete aus der schweizerisch-kongolesischen Diaspora.
95
Im Zentrum stand das Making-of der Installation und die Zusammenarbeit mit den sapeurs. Fabrice Mawete erzählte von seiner monatelangen Recherche in der kongolesischen Community und seiner zentralen Rolle als Vermittler zwischen den beteiligten Personen. Fiona Bobo fokussierte auf das künstlerische Vorgehen bei der Entstehung der Fotografien und dem Umgang mit den Protagonisten. Das Publikum zeigte sich sehr interessiert und beteiligte sich rege mit Kommentaren und Fragen an der Diskussion. Dabei entstand ein Gedankenaustausch rund um Themen wie Identität und Selbstdarstellung, Migration und das Zusammenleben in der Schweiz sowie um Mode allgemein und deren Stellenwert in den verschie-denen Kulturen. / ObM, FaL
4. Krauter- und Pflanzenmarkt10. Juni
Rund um die Villa Wesendonck und den «Smaragd» lockten am Pfingstmontag wiederum Marktstände mit einer grossen Auswahl an Kräutern, Pflanzen und Blumenstauden für Küche, Balkon und Garten, viele davon in Bioqualität. Inter-essierte besuchten zudem die Sonderausstellung «SPIEGEL – Der Mensch im Widerschein» im Rahmen der speziellen öffentlichen Führungen. Und die Offene Werkstatt empfing zum Bau eines Insektenhotels für die eigene Terrasse oder den Balkon. Street Food – von Glacé über Crêpes bis zum Burger – sowie das Museumscafé boten Köstlichkeiten für jeden Geschmack an. In Zusammenarbeit mit Bioterra. / SuA
Sommerfest im Rieterpark29./ 30. Juni
Musik und Literatur – sie gaben den Ton an am grossen Sommerfest, das nach 2016 wieder stattfand. Das Festprogramm war inspiriert von der SPIEGEL-Aus-stellung und vom 200-jährigen Geburtstag Gottfried Kellers. Es lockten Konzerte von klassischen und unkonventionellen Ensembles der ZHdK sowie Lesungen und Improvisationen aus Text und Musik mit den Schauspiel-Gästen Mona Petri, Hanspeter Müller-Drossaart und Patti Basler. Kuratorin des Wortprogramms war Hildegard Keller vom Literaturclub des Schweizer Fernsehens. Geboten wurden zudem Führungen durch die Ausstellungen und ein munteres Kinderprogramm – fünf spielerische Stationen zum Spiegel-Thema sowie eine Wasserrutsche auf dem Hügel hinter der Villa Schönberg oder Märchenlesungen vor dem Rebhäuschen im Park. Fürs leibliche Wohl sorgten hausgemachte Köstlichkeiten aus dem Café
96
sowie Street-Food-Stände mit Leckereien aus aller Welt. Zudem begeisterten Marktstände voller Trouvaillen die Festbesucherinnen und -besucher bei hoch-sommerlichem Wetter. In Zusammenarbeit mit der ZHdK, der Gottfried-Keller-Gesellschaft und dem Quartiertreff Enge. / SuA
Talk: The Gurlitt Art Trove – A Never Ending Story21. August
Das Gespräch, das von Swiss Friends of the Israel Museum in Jerusalem in Zu-sammenarbeit mit dem Kunstmuseum Bern, der Bundeskunsthalle Bonn und dem Museum Rietberg organisiert worden ist, drehte sich um die Gurlitt- Sammlung und die Frage der Restitution. Fünf internationale Gesprächspartner diskutierten über die verschiedenen Aspekte: Shlomit Steinberg, Hans Dichand Senior Curator of European Art am Israel Museum in Jerusalem und Mitglied der Gurlitt Task Force; Dr. Nina Zimmer, Direktorin des Kunstmuseums Bern – Zentrum Paul Klee; Dr. Stephanie Tasch, Dezernentin der Kulturstiftung der Länder und Mitglied der Gurlitt Task Force; Dr. Meike Hoffmann, wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Forschungsstelle «Entartete Kunst» und Koordinatorin der Mosse Art Research Initiative an der Freien Universität Berlin; Esther Tisa, Leiterin Provenienzforschung am Museum Rietberg. Moderiert hat den Talk Prof. Dr. Dirk Boll von Christie’s.
Lange Nacht der Zürcher Museen7. September
Dieses Jahr gab es an der Langen Nacht mit Talks, Tänzen und Touren für Gross und Klein viel zu entdecken. Die SPIEGEL-Ausstellung gab immer wieder den Ton an – so bei den indischen Tanzperformances in typischen Spiegel- Gewändern oder bei den Talks, bei denen Moderator Rolf Probala mit seinen Gästen das Spiegel- Thema ergründete: Balletttänzerin Aurore Lissitzky, Influencerin Zoë Pastelle, Astrophysiker Hans Martin Schmid, Modedesignerin Kazu Huggler, Museumsdirektor Albert Lutz und Schauspielerin Elisa Plüss. Weiter standen die Fotografie-Ausstellung zu Ägypten auf dem Programm, die japanischen Tee zere-monien, eine Offene Werkstatt für Spiegel-Buttons und Köstliches aus vielen Ländern, serviert im Café, im Sommerpavillon und ums Museum herum. / SuA
97
Vierte Tagung zu indischer Malerei am Museum Rietberg20.– 22. September 2019
Wie an den vorangegangenen Treffen bildete der öffentliche Vortrag von Prof. B.N. Goswamy den Auftakt. Dieser bedeutende indische Kunsthistoriker und lang jährige Freund des Museums Rietberg besprach ein Hauptwerk des Maisor Meisters von circa 1830. Er zeigte mutige Bildkompositionen von starker Farbig-keit und konnte das faszinierte Publikum überzeugen, dass in Indien auch zur Zeit des Umbruchs zur Moderne für lokale Fürsten erstaunlich lebendige Kunstwerke geschaffen wurden.
Bei der von Johannes Beltz, Eberhard Fischer und Caroline Widmer orga-ni sierten Tagung wurden drei Themen angesprochen: Zunächst die Bedeutung des Kleinen in der indischen Ästhetik, also der Miniaturisierung und des oft win-zigen, aber qualitätsbestimmenden Details, dann die stilistische Variationsbreite von Werken in einem regionalen «Zeitstil» und schliesslich aktuell brennende Fragen zu Kopien und Fälschungen.
Nachdem B.N. Goswamy Berichte aus der Mogulzeit von virtuoser Bema-lung kleinster Bildflächen (etwa der Darstellung eines Polospiels auf einem Reis-korn) zitiert hatte, stellte Eberhard Fischer Palmblatt-Folios des Haravali-Meisters in Odisha im 18. Jahrhundert vor, der bei einer Bildhöhe von nur 4 cm erstaunlich präzis Menschen aller Stände, Tiere und Landschaften, aber auch Emotionen und Stimmungen eingraviert und farbig gefasst hat. Die junge indische Kunst-
98
historikerin Sonika Soni zeigte Blätter einer Durga-Serie, die, vom Fürstenhof von Jaipur in Auftrag gegeben, von verschiedenen Malern ausgearbeitet wurden, die alle ihre Blätter signieren durften. Dies erlaubt, die individuellen stilistischen Eigenheiten der gleichzeitig in Jaipur wirkenden Meister zu erkennen. Usha Bhatia besprach ein heute verstreutes Manuskript aus einem Kloster im Panjab, das einem Staudamm weichen musste. V. Srinivasan aus Speyer zeigte auf, welche Möglichkeiten zur Definition von formalen Details die Formerkennung heutiger Computerprogramme leistet, will man beispielsweise verschiedene Künstler-hände unterscheiden. Dies führte gleich zum dritten Thema der Tagung: Kopie und Fälschung. Sonika Soni berichtete von ihrer Erfahrung bei der Konservierung indischer Bilder und schilderte verschiedene Techniken, mit denen Papier und Bildoberflächen einen «antiken Finish» erhalten. Die Präsentation von Prof. Milo Beach (der leider nicht anwesend sein konnte) zeigte auf, dass es in Indien Zeiten gab, in denen präzise Kopien sehr geschätzt waren, dass aber heute der indische Kunst markt von Fälschungen und manipulierten Bilder geradezu überflutet wird. Das ist unausweichlich der Fall, solange für die vielen, oft exzellent geschulten «Miniaturen maler» Rajasthans keine alternativen Erwerbsmöglichkeiten existieren. Ideal erschien deshalb das Projekt von Paul Abraham, der dem Maler Manish Soni ein mehrjähriges Kunstprojekt finanziert, bei dem der (hinduistische) Miniaturist nach den Erzählungen seines (christlichen) Patrons im Stil des (muslimischen) Hamzanama (16. Jahrhundert) das Leben Jesu für sein neu gegründetes Museum in Kerala malt. Dass man sich mit Bildern nicht nur gedanklich beschäftigen kann, zeigte abschliessend Neeta Premchand mit ihren aufklappbaren Bild-panoptiken.
Dieses Zusammenkommen indischer und Schweizer Sammler im Museum Rietberg hat zum Zweck, allseits die Sinne für die Besonderheit indischer Malerei zu schärfen und gemeinsam zu neuen Formen der Zusammenarbeit zu gelangen. So wurde abschliessend der Wunsch geäussert, bei der Erstellung von digitalen Databasen wie auch bei der filmischen Dokumentation von heutigen Malerwerk-stätten zusammenzuwirken.
Ohne die grosszügige Unterstützung dieses Treffens durch drei Vor-standsmitglieder der Rietberg-Gesellschaft (Catharina Dohrn, Dominik Keller und Eberhard Fischer) und die tatkräf tige Gastfreundschaft von Neeta und Barbara Fischer könnte ein solch hochkarätiges Symposium auf dem Rietberg nicht statt finden. / FiE
99
KonzerteDie langjährige Tradition indischer Konzerte ging am Museum Rietberg auch 2019 weiter. Der Auftakt erfolgte am 17. Februar mit Jayaram Ambedkar Jayanth, einem der populärsten Flötisten der südindischen karnatischen Musik, bekannt für seine kraftvolle Schlagtechnik, seine Spontanität und Präzision; begleitet wurde er von S. Varadarajan (Violine) und Neyveli Venkatesh (Perkussion, Mridangam). Am 7. April gehörte die Bühne dem melodiösen Vokalisten Jayateerth Mevundi und seiner einzigartigen Stimmfarbe; Santosh Ghante (Harmonium) und Shrirang Mirajkar (Tablas) begleiteten ihn dabei. Virtuosität und musikalische Vielfalt standen am 16. Juni im Zentrum: Abhishek Borkar bot eine einzigartige Mischung aus Sarod, Sitar, Sarangi und Gesangsstilen der hindustanischen Musik und trat in einen beherzten Dialog mit dem versierten Tabla-Meister Ramdas Palsule. Drei einzigartige Stile von herausragenden Musikern vereinten sich am 1. September zu einer lebendigen Performance: Als führender indischer Saxophonist fasziniert Jesse Bannister mit seinem Können sowohl die Welt des Jazz als auch der nordindischen klassischen Musik. Inspirierende Ergänzung fand sein Spiel durch Pratik Shrivastav, das preisgekrönte junge Sarod-Talent, und Pandit Subhen Chatterjee, einen der bekanntesten Tabla-Spieler Indiens. Als letzter Konzert-Höhepunkt des Jahres trat am 1. Dezember Dilshad Khan auf – Meistermusiker und Sarangi-Spieler der neunten Generation aus einer Reihe von Hofmusikern aus Rajasthan. Begleitet wurde der Klang des klassischen Streichinstruments vom poetisch-rhythmischen Tabla-Spiel des virtuosen indisch-französischen Perkussionisten Prabhu Edouard. Jedes der indischen Konzerte organisierte und begleitete auch 2019 Shrirang Mirajkar, ihm gebührt für sein ehrenamtliches Enga-gement ein herzlicher Dank.
Der Posaunist Michael Flury erhielt vom Jazzverein Moods eine begehrte Carte Blanche und präsentierte an den Abenden vom 1. bis zum 3. März «Chavín – Eine Synasthetische Uroper» am Museum Rietberg, die er zusammen mit Peter Fux (Text, Stimme) und Verena Regensburger (Regie) erarbeitete. Damit knüpfte Flury an seine Arbeit an, die er 2012 im Rahmen der Ausstellung «Chavín – Perus geheimnisvoller Anden-Tempel» realisiert hatte – im Zentrum stand auch 2019 die im Tempel ausgegrabene Meeresschnecken-Trompete «pututu». Mit ihrer Entdeckung trat Flury in einen ganz neuen, persönlichen künstlerischen Kosmos – zwischen archaischen Urklängen, Wachswalzen, Elektronik und der Frage, wie die Instrumente der schriftlosen Chavín-Kultur klangen. Was hat damals statt-gefunden? Und welche Geschichten hatte sie zu erzählen? Ein musikalischer Abend zum Teilen von Eindrücken, Erfahrungen und Erforschungen.
100
Traditionsgemäss war das Museum Rietberg auch dieses Jahr einer der Austragungsorte des Jazz-Festivals «unerhört!». Am 26. November präsentierte es gleich zwei wichtige Protagonisten des aktuellen Jazz: Auf das halbstündige Solo-Konzert des New Yorker Michael Formanek, der die Rolle des Bassisten neu definiert, folgte die französische Jazzsängerin Leïla Martial, die mit dem Vokal ensemble der Hochschule Luzern ein exklusiv für das «unerhört!»-Festival konzipiertes Repertoire an komponierter und improvisierter Vokalmusik erarbeitet hatte. / SuA
101
9. Januar
Aus der Sicht des Kurators
Führung mit Axel Langer anlässlich der
Ausstellung «Farbe bekennen»
16. Januar
Buchprasentation:
Des cloches et des hommes
Vortrag durch die Autorin Sylviane Messerli
und die Fotografin Hélène Tobler, Moderation:
Axel Langer
17. Januar
Ein Abend mit Jeong Kwan und ihrer
Tempelküche
Anlässlich der Ausstellung «Nächster Halt
Nirvana»
18. Januar
Auf einen Grüntee mit Zen-Buddhistin
Jeong Kwan
Anlässlich der Ausstellung «Nächster Halt
Nirvana»
19. Januar
Aus der Sicht der Kuratorin
Führung mit Esther Tisa anlässlich der
Sammlungsintervention «Die Frage der
Provenienz»
30. Januar
Introduction to the incense ceremony
‹Kodo ›
Mit Yoko Obata and Junko Maruyama
30. Januar
Aus der Sicht des Kurators
Führung mit Axel Langer anlässlich der
Ausstellung «Farbe bekennen»
10. Februar
Feierliche Teezeremonie zum Valentinstag
Mit Soyu Mukai, Teemeisterin
13. Februar
Aus der Sicht des Kurators
Führung mit Axel Langer anlässlich der
Ausstellung «Farbe bekennen»
17. Februar
Indisches Konzert
Mit Jayaram Ambedkar Jayanth
20. Februar
Medienkonferenz «ZeitRaume»
Anlässlich der Ausstellung «ZeitRäume»
20. Februar
Preview «ZeitRaume»
Mitglieder-Preview anlässlich der Ausstellung
«ZeitRäume»
20. Februar, 6. März, 3. und 17. April
sowie 15. und 29. Mai
Vortragsreihe «Stimmen der Welt-
archaologie»
Vorträge mit internationalen Gastrednern
1., 2. und 3. März
Konzert: «Chavín – Eine Synasthetische
Uroper»
Musikalischer Abend mit Michael Flury,
Musiker und Künstler, und Peter Fux,
Kurator, Wissenschaftler und Archäologe
6. März
Aus der Sicht des Kurators
Führung mit Axel Langer anlässlich der
Ausstellung «Farbe bekennen»
9. März
Aus der Sicht der Kuratorin
Führung mit Esther Tisa anlässlich der
Sammlungsintervention «Die Frage der
Provenienz»
13. März
Rietberg persönlich
Spezialführung anlässlich der Ausstellung
«Nächster Halt Nirvana»
13. März
Vortrag: Le voile de la femme orientale,
de l’Antiquité à nos jours
Vortrag von Hana Chidiac vom Musée
du Quai Branly anlässlich der Ausstellung
«Farbe bekennen»
17. März
Vortrag: Koloniale Objekte und historische
Urteilskraft
Vortrag von Prof. Raphael Gross vom
Deutschen Historischen Museum anlässlich
der Sammlungsintervention «Die Frage der
Provenienz»
20. März
Aus der Sicht des Kurators
Führung mit Axel Langer anlässlich der Aus-
stellung «Farbe bekennen»
22. März
Tagesausflug ins Tibet-Institut Rikon
Führung durch das Tibet-Institut Rikon mit
anschliessender Einführung in die Meditation
anlässlich der Ausstellung «Nächster Halt
Nirvana»
102
27. März
Rietberg-Talk: Marktplatz global –
Vom Wechselspiel zwischen Geschaft
und Kultur
Ein Gespräch anlässlich der Ausstellung
«Farbe bekennen» mit Lea Haller, Histori-
kerin, Redaktorin «NZZ Geschichte»; Martin
Leuthold, ehem. Art Director Jakob Schlaepfer
AG, Gewinner Grand Prix Design BAK; Katja
Rost, Professorin für Soziologie, Privatdozentin
für Wirtschaft, Universität Zürich; Axel Langer,
Kurator Naher Osten Rietberg Museum.
Moderation: Rolf Probala
7. April
Indisches Konzert
Mit Jayateerth Mevundi
10. April
Internationaler Tag der Provenienz-
forschung
Führung anlässlich der Sammlungs-
intervention «Die Frage der Provenienz»
8. Mai
Rietberg persönlich
Tandemführung zum Thema Afrika,
Provenienzen, Sammlungsgeschichte und
Kooperation mit den Kuratorinnen Esther
Tisa, Leiterin Provenienzforschung und
Afrika- Kuratorin Michaela Oberhofer
anlässlich der Sammlungsintervention
«Die Frage der Provenienz»
9. Mai
Aus der Sicht der Kuratorin
Führung mit Esther Tisa anlässlich der
Sammlungsintervention «Die Frage der
Provenienz»
16. Mai
Medienkonferenz «Spiegel»
Anlässlich der Ausstellung «Spiegel»
16. Mai
Vernissage «Spiegel»
Eröffnung der Ausstellung «Spiegel»
19. Mai
Internationaler Museumstag
Spezialführungen zum Thema
«Museen – Zukunft lebendiger Traditionen»
22. Mai
2. Schweizer Vorlesetag: «Spiegelmarchen»
Lesung mit Christiane Ruzek anlässlich der
Ausstellung «Spiegel»
24. Mai
62. Ordentliche Generalversammlung der
Rietberg-Gesellschaft
7. und 8. Juni
«Zurich Art Weekend»
Spezialführungen anlässlich des
«Zurich Art Weekend»
10. Juni
4. Krauter- und Pflanzenmarkt
Markt mit Kräutern und Pflanzen in
Zusammenarbeit mit Bioterra
12. Juni
Der Kurator erklart
Mitgliederveranstaltung anlässlich der
Ausstellung «Spiegel»
16. Juni
Indisches Konzert
Mit Abhishek Borkar und Ramdas Palsule
16. Juni
Finissage: Artist Talk «Space in Time»
Gespräch Dr. Caroline Widmer, Quddus
Mirza und Künstlerin Sehrish Mustafa
anlässlich der Ausstellung «ZeitRäume»
19. Juni
Medienkonferenz «Wunschtraum Ägypten»
Anlässlich der Ausstellung «Wunschtraum
Ägypten»
19. Juni
Preview «Wunschtraum Ägypten»
Mitglieder-Preview der Ausstellung
«Wunschtraum Ägypten»
19. Juni
Influencer Summit 2019
Spezialführung und Picknick im Park
mit Zürich Tourismus
20. Juni
International Day of Yoga
Yogastunde und Museumsbesuch mit
Malabika Chatterjee in Zusammenarbeit mit
der indischen Botschaft
20., 21. und 22. Juni
Musiktheater: «Der Mann im Spiegel»
Mit Compagnie Neander & von Bodecker
anlässlich der Ausstellung «Spiegel»
22. Juni bis 22. September
Sommerpavillon im Museum Rietberg
103
29. und 30. Juni
Sommerfest
Grosses, zweitägiges Fest mit Musik, Literatur
und Kunst im Rieterpark und Museum an-
lässlich der Ausstellung «Spiegel» und dem
200-jährigen Geburtstag von Gottfried Keller.
In Kooperation mit der ZHdK, der Gottfried-
Keller-Gesellschaft und dem Quartiertreff
Enge.
6. Juli
Tanabata-Teezeremonie
«Sternenfest» mit Soyu Mukai, Teemeisterin
21. August
Panel: «The Gurlitt Art Trove –
A Never Ending Story»
Gespräch organisiert durch Swiss Friends
of the Israel Museum in Jerusalem. In Ko-
operation mit dem Kunstmuseum Bern, der
Bundeskunsthalle Bonn, dem Israel Museum
in Jerusalem und dem Museum Rietberg
1. September
Indisches Konzert
mit Jesse Bannister, Pratik Shrivastav
und Pandit Subhen Chatterjee
4. September
Aus Sicht des Experten
Führung mit Thomas Meyer-Wieser zur
Stadtgeschichte Kairos anlässlich der
Ausstellung «Wunschtraum Ägypten»
7. September
20. Lange Nacht der Zürcher Museen
13. und 14. September
Vollmond-Teezeremonie
Mit Soyu Mukai, Teemeisterin
14. September
Europaische Tage des Denkmals 2019
Spezialführung zum Thema «Farben»
14. September
Fashion Talk: «Von der Mythologie in
die Mode – Amaterasu und die Shinto
Gottheiten»
Mit Kazu Huggler anlässlich der Ausstellung
«Spiegel»
20. September
Public lecture: «The Mysore Master’s
Masterpiece»
Vortrag mit Prof. B.N. Goswamy im Rahmen
der 4. Tagung zur Erforschung indischer
Malerei
20. und 22. September
4. Tagung zur Erforschung indischer Malerei
29. September
Open House Zürich 2019
Spezialführungen durch die Villa Schönberg
3.– 6. Oktober
Reise nach Paris und Versailles:
«Von Spiegeln und Garten»
Reise der Rietberg-Gesellschaft anlässlich
der Ausstellung «Spiegel»
6. Oktober
Aus Sicht des Experten
Führung mit Felix Thürlemann zur Orient-
fotogafie anlässlich der Ausstellung
«Wunschtraum Ägypten»
23. Oktober
Medienkonferenz «Gitagovinda» und
«Surimono»
Anlässlich der Ausstellungen «Gitagovinda»
und «Surimono»
23. Oktober
Vernissage «Gitagovinda» und «Surimono»
Eröffnung der Ausstellungen «Gitagovinda»
und «Surimono»
27. Oktober
Tanzperformance:
«Krishna – A Dance Drama»
Mit «Panwar Music and Dance» anlässlich
der Ausstellung «Gitagovinda»
10. November
Chaji – exklusive japanische Teezeremonie
Mit Soyu Mukai, Teemeisterin anlässlich
der Ausstellung «Surimono»
21. November
Medienkonferenz «Fiktion Kongo»
Anlässlich der Ausstellung «Fiktion Kongo»
21. November
Vernissage «Fiktion Kongo»
Eröffnung der Ausstellung «Fiktion Kongo»
23. November
Artist Talk / Rencontre avec les artistes:
«Fiction Congo»
Anlässlich der Ausstellung «Fiktion Kongo»
26. November
Jazzfestival unerhört!
Konzert mit Michael Formanek
und Leïla Martial
27. November
Der Kurator erklart
Mitgliederveranstaltung anlässlich
der Ausstellung «Fiktion Kongo»
104
28. November
«Zürich und das Museum Rietberg»
Gesprächsrunde aus Anlass der Pensionie-
rung von Albert Lutz
Nach 37 Jahren Tätigkeit am Museum
Rietberg und seit 1998 in der Funktion des
Direktors ging Albert Lutz Ende November
in Pension. An seinem letzten Arbeitstag lud
Talkmaster Rolf Probala im Rahmen einer
Mitgliederveranstaltung zum Gespräch ein.
Er erörterte in der Halle des Stadthauses die
unterschiedlichsten Facetten des Museums
Rietberg aus wechselnden Perspektiven.
Nebst Albert Lutz empfing er als Gesprächs-
gäste Corine Mauch, Stadtpräsidentin von
Zürich; Dr. Annette Bhagwati, die Nachfolgerin
von Albert Lutz als Direktorin des Museums
Rietberg; Dr. Eberhard Fischer, Präsident der
Rietberg-Gesellschaft; Prof. Dr. Silja Rüedi,
Prorektorin Pädagogische Hochschule Zürich;
Prof. Dr. Sarah Springman, Rektorin ETH
Zürich und Martin Sturzenegger, Direktor
Zürich Tourismus. Im Anschluss an den Talk
nutzten die anwesenden Mitglieder den Apéro
für einen angeregten Austausch. / SuA
1. Dezember
Indisches Konzert
mit Dilshad Khan und Prabhu Edouard
14. Dezember
Look, Think, Discuss: «Fiktion Kongo»
im Dialog mit der Schweiz
Anlässlich der Ausstellung «Fiktion Kongo»
105
Das Museum Rietberg empfing während des Jahres 105 Medienschaffende zu Medienkonferenzen und Medienreisen aus dem Ausland. Dazu organisierte das Museum 96 individuelle Medientermine für Interviews, Foto- und Filmaufnahmen sowie Ausstellungsrundgänge. 2019 erschienen 668 Medienberichte über das Museum Rietberg und seine Ausstellungen, davon 379 im Printbereich, 20 über Radio/TV und 269 auf Onlinemedien (die Zahlen decken aufgrund des Auftrags an den Medienbeobachtungsdienst ausschliesslich die Schweizer Medienland-schaft ab; zahlreiche Hinweise und Berichte aus benachbarten Ländern sowie aus internationalen Titeln ergänzen den Medienspiegel). Die grossen Ausstellungen des Jahres haben massgeblich zu diesen Resultaten beigetragen: Über «Spiegel» haben unter anderem die SRF Tagesschau (Hauptausgabe) oder die auflagenstar-ken Tageszeitungen Tages-Anzeiger und Neue Zürcher Zeitung berichtet, genauso beispielsweise The Art Newspaper (französische Ausgabe) oder die italienische Vogue. Auch «Fiktion Kongo» hat eine sehr erfreuliche mediale Aufmerksamkeit erfahren: Die Ausstellung war von den SRG-Sendern sowohl bei SRF als auch RSI in den Tagesschau-Hauptausgaben präsent, genauso im SRF Kulturplatz und auf Radio SRF 2 Kultur; Fernsehstationen im Ausland waren gleichermassen angetan, davon zeugen die Beiträge auf ARD Das Erste in der Sendung «titel, thesen, tempe-ramente» oder auf TV5MONDE. Auch Printmedien haben über «Fiktion Kongo»
berichtet, darunter die NZZ am Sonntag, Blick, Schaufenster – die Beilage der österreichischen Die Presse –, zwei belgische Tageszeitungen oder die deut-sche WELTKUNST (Titelstory).
Im Bereich der digitalen Kommunikation war 2019 ein Zuwachs an Face-book- Followern um 11% auf rund 12’200 Follower zu verzeichnen. Die höchste organische Reichweite (unbezahlte Verbreitung eines Beitrags) betrug auf Face-book beachtliche 7494 Personen (höchste bezahlte Reichweite: 56’826 Personen)*. Im Zentrum der Kommunikation standen ausstellungs- und veranstaltungsbezogene Inhalte, woraus 137 Posts auf Facebook, 28 auf Twitter und 78 auf Instagram resultierten. / SuA, DeL
* Aufgrund geänderter Messmethoden seitens Facebook ist eine direkte Vergleichbarkeit zum
Vorjahr nur beschränkt möglich.
medienarbeit und digitale kommunikation
106
Zahlreiche Besuchende aller Altersgruppen nahmen im vergangenen Jahr an den Vermittlungsaktivitäten am Museum teil: an Workshops für Schulklassen, Weiter-bildungen für Lehrpersonen, öffentlichen und privaten Führungen, der Teezere-monie, der sonntäglichen Offenen Werkstatt, Mach Mit! Kunst für die Kleinsten, Druck- und Holzschnittkursen oder an dem regelmässigen Angebot für Menschen mit Demenzerkrankung. Mit über 470 spezifischen Angeboten wurde ein viel-fältiges Publikum angesprochen und auf die unterschiedlichen Bedürfnisse vor, während und nach dem Museumsbesuch eingegangen.
Für die Konzeption und Entwicklung von neuen Angeboten ist es zentral, den Besuchenden in den Mittelpunkt zu stellen und sein Feedback in die tägliche Arbeit einfliessen zu lassen. Wie ernst wir die Rückmeldungen unserer Besuchen den nehmen, zeigt die erstmalig grossangelegte Evaluation der Ausstellung « Nächster Halt Nirvana» (13. Dezember 2019 – 31.März 2019), die im Rahmen des Projekts «Kunst sehen – Religion verstehen» durchgeführt wurde (siehe S. 16). Die Ergeb-nisse machen deutlich, wie wichtig es ist, beispielsweise der Wirkung einer Aus-stellung auf das Publikum nachzugehen und das Gelernte für zukünftige Projekte zu berücksichtigen. So sind wir etwa zu der Erkenntnis gekommen, dass ein viel-fältiges Publikum vor allem dann erreicht werden kann, wenn auch die Zusammen-setzung des Ausstellungsteams interdisziplinär ist: Damit sind Vielstimmigkeit und Vielfältigkeit in der Ansprache der Besuchenden von Anfang an gewährleistet.
Viele Parameter der Nirvana-Ausstellung waren, wie bereits im Jahresbe-richt 2018 erwähnt, neu für die Museumsmitarbeitenden und die internen Abläufe. Diesem Veränderungsprozess hohe Aufmerksamkeit zu schenken und das Pu-blikum in grundlegende Fragestellungen miteinzubeziehen, hat sich gelohnt. Das Museum wird als ein partizipativer dritter Ort, nach dem Soziologen Ray Oldenburg, von allen Generationen wahrgenommen. Gelegenheit, unsere Erfahrungen und Erkenntnisse mit einem internationalen Publikum zu teilen, bot sich im Rahmen des Projektes «Kunst sehen – Religion verstehen», welches bereits sechs Jahre erfolg-reich am Haus umgesetzt und in den letzten Jahren durch die Robert H.N. Ho Family Foundation und die Ernst Göhner Stiftung gefördert wird, in diesem Jahr gleich zweimal. Projektarbeit und Nirvana-Ausstellung wurden gemeinsam von Johannes Beltz und Anna Hagdorn bei dem Workshop «New Paradigms in Exhibition Planning, Audience Research, and Art Education», organisiert von der Robert H.N. Ho Family Foundation und dem Hong Kong Museum of Art, vorgestellt. Darüber hinaus prä-sentierte Anna Hagdorn das Projekt auch auf der ICOM-Konferenz 2019 in Kyoto.
Die Einführung des Lehrplans 21 gab im vergangenen Jahr Anlass, be-stehende Vermittlungsangebote zum Schulfach «Religionen, Kulturen, Ethik» zu überprüfen, an die neuen Anforderungen anzupassen und neue Formate zu kreieren.
kunstvermittlung
108
Im Lehrplan 21 werden vermehrt interdisziplinäre Themenbereiche angesprochen und auf Kompetenzförderung und -aufbau fokussiert. Für die Angebote am Museum bedeutet das, komplexere Zusammenhänge, die auch mit der Alltagswirklichkeit der Schülerinnen und Schüler verknüpft ist, zu berücksichtigen und sich an den Entwicklungsschritten und Lernprozessen zu orientieren. Alle Workshop- Angebote für das Schulfach «Religionen, Kulturen, Ethik», die unsere Sammlungsbereiche zu «Buddhismus und Hinduismus» thematisieren, wurden daraufhin überarbeitet.
Ganz im Sinne der Zugangsförderung und Barrierefreiheit ist das Museum Rietberg seit Beginn des Jahres 2019 Labelträger von «Kultur inklusiv» (www.kulturinklusiv.ch). Das über Pro Infirmis verliehene Label setzt sich in fünf Hand-lungsfeldern ein, mit dem Ziel, eine ganzheitliche und nachhaltige inklusive Haltung an einer Institution zu etablieren. In diesem Zusammenhang erfolgte zu-nächst eine Bedarfsanalyse des Ist-Standes am Museum Rietberg, die eine Reihe von Massnahmen mit sich bringt, um nachhaltig den Auftrag am Museum zu verankern. Das Museum soll als ein barrierefreier Ort für Menschen mit Beein-trächtigung zugänglich sein und einladend wirken. Daran wird das Museum in den nächsten drei Jahren arbeiten. Das bestehende Angebote für Menschen mit Demenz-Erkrankung in Kooperation mit dem Verein Treffpunkt Kultur und Demenz, das an 45 Freitagen im Jahr 2019 durchgeführt wurde, ist für die Labelträgerschaft ein wichtiger Impuls.
Ein grosser Dank geht an unsere langjährigen Kooperationspartner für die kontinuierliche und professionelle Zusammenarbeit sowie die grosszügigen Unter-stützungen von Förderern, Gönnerinnen und Gönnern und Stiftungen: GiM-Gene-rationen im Museum; mediamus – Schweizer Fachverband für Kulturvermittlung am Museum; Schulkultur/ Stadt Zürich; Schule und Kultur/Kanton Zürich; Verein Kulturvermittlung Zürich; The Robert H.N. Ho Family Foundation; Ernst Göhner Stiftung; Novartis; Rietberg-Gesellschaft. / SpC
109
Reise nach Paris«Von Spiegeln und Gärten», 3.– 6. Oktober 2019
Reiseleitung: Hans von Trotha (Gärten) und Beiträge von Gabriele und Albert Lutz (Museen)
Im Nachklang an die «Garten»-Ausstellung (2016), an der Hans von Trotha als Kurator mitgewirkt hatte, und aus Anlass der «Spiegel»-Ausstellung organisierte die Rietberg-Gesellschaft eine Wochenendreise nach Paris zum Thema «Gärten und Spiegel». Nach einem Spaziergang durch den Jardin des Tuileries gab es im Musée de l’Orangerie die weltberühmten Wasserspiegelungen in Monets Seerosen- Bildern zu bewundern.
Der Tag in Versailles begann mit einer Führung im Spiegelsaal des Schlosses und einer Geschichtslektion über den Friedensvertrag von Versailles (1919/1920). In einem ausgedehnten Spaziergang wurde danach der grandiose Schlosspark bewundert. Abgerundet wurde die Reise durch den Besuch des 1992 eröffneten Parc André Citroen in Paris sowie mit Führungen zu ausgewählten «Spiegel-Kunst-werken» im Musée d’Orsay und im Musée du Louvre. / LuA
reisen
110
Kooperation mit dem National Museum of Korea, SeoulRestaurierungsprojekt «Portrat des Zen-Meisters Chupadang»Im Rahmen des «Overseas Korean Galleries Support Program», das vom National Museum of Korea, Seoul, seit 2011 jährlich ausgeschrieben wird, konnte das Museum Rietberg im Jahre 2017 erfolgreich einen Antrag stellen, um das einzige koreanische Bild in der Sammlung fachgerecht in Korea restaurieren zu lassen. Dieses von der südkoreanischen Regierung finanzierte Programm ermöglicht ausländischen Museen mit einer koreanischen Sammlung unter anderem Ausstellungsräume für koreanische Kunst einzurichten, koreanische Kunstwerke zu publizieren oder erforschen und restaurieren zu lassen. Bei Restaurierungsprojekten verpflichtet sich die koreanische Seite, das technische Know-how und die Ressourcen zur Verfügung zu stellen, während die ausländische Partnerinstitution für die Trans-portkosten nach und von Korea verantwortlich zeichnet.
Da es im westlichen Ausland sehr wenige Fachleute gibt, die koreanische traditionelle Malerei konservieren und restaurieren können, ist dieses Programm für Museen von höchster Bedeutung.
Das «Porträt des Zen-Meisters Chupadang» (RKO 1) wurde 1956 mit städ-tischen Mitteln erworben und in der ersten Sammlungspräsentation des neu gegründeten Museums gezeigt.
Damals musste das mit Tusche und Farbpigmenten auf Seide gemalte Bildnis bereits aus der ursprünglichen traditionellen Montierung geschnitten und in europäischer Manier als gerahmtes Bild gezeigt worden sein. Wann es aus der
kooperationen
Presse-Präsentation, National Museum
of Korea, Seoul, 15. April 2019
Links: Dr. BAE Kidong, Director General
111
ständigen Sammlung entfernt und aus dem Rahmen genommen wurde, kann nicht mehr eruiert werden. Hingegen steht fest, dass es in den letzten Jahrzehnten nicht mehr ausgestellt wurde. Ohne Montierung und ohne feste Rückwand ist das Bild sehr fragil und konnte nur noch flach gelagert und transportiert werden.
Nach der Ankunft in Seoul im Januar 2017 wurde das Bild zunächst von einem Experten-Team bestehend aus Kunsthistorikern, Restauratoren und Kuratoren eingehend untersucht.
Dabei konnte nicht nur der ursprüngliche Zustand des Bildes rekonstruiert, sondern auch die richtige Datierung bestimmt werden. So wurde das Entste-hungsdatum vom 16. ins 19. Jahrhundert revidiert und das Porträt wieder als ein buddhistisches Hängerollenbild montiert.
Die Restaurierung dauerte zwei Jahre, doch die lange Wartezeit hat sich gelohnt. Im April 2019 ist der Grossmeister Chupadang im frischen Glanz wieder nach Zürich zurückgekehrt. Seit September ziert er erneut die ständige Samm-lung im 1. Untergeschoss des Smaragds. / TrK
Kooperation mit dem Centrum für Religionswissenschaftliche Studien der Ruhr-Universität BochumIm März 2019 trafen MitarbeiterInnen des Centrums für Religionswissenschaftliche Studien (CERES) der Ruhr-Universität Bochum und des Museums Rietberg zu einem zweitägigen Workshop zusammen. Gemeinsam gingen sie der Frage nach, wie sich «der» Buddhismus im musealen Kontext an verschiedene Zielgruppen vermitteln lässt.
Dieser fachliche Austausch zwischen Museumspraxis und Religionswis-senschaft wurde bereits 2017 vom Vermittlungsprojekt «Kunst sehen – Religion verstehen» anlässlich der geplanten Sonderausstellung «Nächster Halt Nirvana – Annäherungen an den Buddhismus» initiier t. Als gemeinsamer Beitrag zur Ausstel lung entstand das «Buddhismus ABC», das in der Ausstellung auflag und vertiefende Informationen rund um den Buddhismus bot.
Auch in Zukunft möchten beide Institutionen zusammenarbeiten. Das nächste Arbeitstreffen ist bereits für Mai 2020 geplant. / BeJ, HaA, SpC, PrA
112
Kooperation mit dem Alice Boner Institut in Varanasi, IndienDas ABI blickt auf ein sehr erfolgreiches 2019 zurück, und das Museum Rietberg ist stolz, dass wir an dieser positiven Entwicklung weiter mitwirken können. Die neu ins Leben gerufene Veranstaltungsreihe «Assi Evenings» fand im Berichtjahr 19-mal statt, mit Filmvorführungen, Konzerten und Yoga-Workshops mit Künst-lern, Studie reden und Wissenschaftlern aus der Schweiz, aus Portugal und Schweden.
Hervorzuheben sind sicher die Lesung aus «The Twice Born – Life and Death on the Ganges» mit dem bekannten Schriftsteller Aatish Taseer, der vor einigen Jahren selber im ABI tätig war. In seinem Buch geht es unter anderem um seine Zeit in Varanasi und natürlich auch um Alice Boner. Ein weiterer Höhe-punkt war sicher auch der Vortrag «Our Moon: Past, Present and Future» von Prof. Ben Moore von der ETH Zürich.
Ende September organisierte das ABI die «Long Nights of Literatures» (LNL), das erste Event dieser Art in Varanasi. Die jungen Autorinnen Judit Hidas, Dana Grigorcea and Aifric Mac Aodha präsentierten ihre Arbeit vor einem vollen Haus einem interessierten Publikum. Das war eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit den Botschaften Frankreichs, Ungarns, Irlands und der Schweiz sowie mit Green Barbet Company, der Banaras Hindu University and der Rajghat Besant School. Auch 2019 fand wieder der dreiwöchige Sanskrit-Kurs «Lived Sanskrit Cultures» statt.
Teilnehmende des «Lived Sanskrit Cultures»
zusammen mit Professoren aus Heidelberg
und Würzburg, Februar, 2019.
113
Leider hat sich trotz aller Bemühungen Kultur Stadt Zürich aus Varanasi zu rückgezogen. Es werden damit keine Residenzen mehr für Schweizer Künst-lerInnen und WissenschaftlerInnen in Varanasi angeboten.
Das Museum Rietberg ist bestrebt, zusammen mit der Boner Stiftung für Kunst und Kultur neue Partner zu finden, die diesen wichtigen Ort des interkul-tu rellen Lernens und der Begegnung langfristig und nachhaltig unterstützen möchten. / ViH, BeJ
Kooperation mit IndienSurimono in Indien Japanische Druckgrafik, Museumspartnerschaften und Schweizer Ausstellungsdesign31. Oktober 2019, Government Museum and Art Gallery, Chandigarh
Das Museum Rietberg Zürich und das staatliche Museum und die Kunstgalerie Chandigarh pflegten über viele Jahrzehnte hinweg enge Beziehungen. Diese waren das Ergebnis der langjährigen Freundschaft zwischen dem renommierten Wissenschaftler Prof. B.N. Goswamy, der an der Punjab University in Chandigarh
Martin Sollberger, Anoop Sharma (Secretary
of the Alice Boner Institute Varanasi),
Johannes Beltz, Megha Kulkarni (Curator of
the Government Museum and Art Gallery,
Chandigarh), Harsha Vinay (Director, Green
Barbet Private Ltd.), Khanh Trinh, Seema
Gera (Senior Curator, Government Museum
and Art Gallery, Chandigarh)
114
lehrte, und Dr. Eberhard Fischer, dem ehemaligen Direktor und Kurator für indische Kunst am Museum Rietberg in Zürich.
Mit grosser Leidenschaft für die indische Malerei initiierten beide Wissen-schaftler zahlreiche Publikationen und international renommierte Ausstellungen. Im Rahmen dieser Projekte gingen wichtige Miniaturen aus Chandigarh als Leih-gaben nach Zürich, wie zum Beispiel für die wegweisende Ausstellung «Pahari Masters» 1990. Fast zwei Jahrzehnte später, im Oktober 2019, konnten in der Ausstellung «Gitagovinda: Indiens grosse Liebesgeschichte» weitere ausser-gewöhnliche Miniaturen aus Chandigarh präsentiert werden.
Mit der geplanten Surimono-Ausstellung, die im Herbst 2020 im Government Museum in Chandigarh eröffnet werden soll, tritt diese laufende Partnerschaft nun in eine neue Ära ein. Nicht nur, dass das Museum Rietberg erstmals eine ganze Ausstellung mit japanischen Original-Holzschnitten in Chandigarh zeigt, es ist die erste Ausstellung dieser Art in Indien!
Am 24. Oktober 2019 reisten Dr. Johannes Beltz, stellvertretender Direk-tor und Leiter der Sammlungen, Dr. Khanh Trinh, Kuratorin für japanische Kunst und Martin Sollberger, Leiter Corporate Design und Ausstellungsachrichtekt, nach Chandigarh, um dort das Projekt «Surimono in India – A Curated Event on Japanese Printmaking, Museum Partner ships and Swiss Design» vorzustellen.
Das Besondere an diesem Projekt ist sicherlich, dass es sich nicht «nur» um eine Ausstellung handelt. Denn das Projekt beinhaltet ein Schulungsprogramm zum Thema Ausstellungsgestaltung. Parallel zum Ausstellungaufbau wird im Herbst 2020 eine 6-tägige Weiterbildung zum Thema Ausstellungsgestaltung von Martin Sollberger und der Grafikerin Mirijam Ziegler für eine ausgewählte Gruppe von Architek ten, Gestaltern, Ausstellungsmachern und Kuratoren angeboten.
In Zusammenarbeit mit: Green Barbet, Indien, Schweizer Botschaft in Neu Delhi, Japan Foundation, Neu Delhi, Government Museum and Art Gallery, Chandigarh, Alice Boner Institut Varanasi.
«Stone object preservation, conservation and restoration»Workshop vom 8./9. April 2019 in der Nationalbibliothek von Pakistan, Islamabad
Als unmittelbare Folge der spektakulären Leihgabe des monumentalen Buddhas aus dem Museum in Peshavar entstand der Wunsch nach einer Weiterbildung im Bereich Steinrestaurierung. In Zusammenarbeit mit den Kooperationspartnern, dem Departement of Archeology and Museums DOAM und der Direktion für Ent-
115
wicklung und Zusammenarbeit (Deza) konnte der Steinrestaurator Tobias Hotz einen Workshop in Islamabad durchführen.
In dem Workshop ging es zunächst um den Transport des Buddhas nach Zürich. Unter dem Titel «The Peshawar Buddha, a journey from Pakistan to Switzer-land» stellte Tobias Hotz die Herausforderungen, Lösungsansätze und Vorsichts-massnahmen vor. Ein wichtiger Aspekt war etwa das richtige Einschlaufen der Gurte sowie das Sichern gegen mögliches Rutschen. Tobias Hotz zeigte, dass es nicht zwingend die modernsten Hilfsmittel wie zum Beispiel die in der Schweiz vorhandenen hydraulischen Pressen braucht, sondern dass durchaus mit ein-facheren Hilfsmitteln wie einem Kettenzug gearbeitet werden kann, solange sein gutes Funktionieren gewährleistet ist. Ein Bankett für geladene Gäste in der Schweizer Botschaft mit einer nochmaligen Präsentation des sehr gelungenen Trailers zur Bergung des Buddhas rundete den ersten Tag ab.
Die Präsentationen am Folgetag mit Fallbeispielen galten weiteren Themen der Konservierung und Restaurierung von Kunst- und Kulturgut wie Transportschä-den, Reinigungsmethoden, Unterschiede bei Konservierung-Restaurierung- Renovierung, Leitsätze der Denkmalpflege in der Schweiz, Laborarbeit, bildhaue-rische und gusstechnische Reproduktionen und so weiter. Die Vorträge fanden bei den Teilnehmern grossen Anklang und stiessen auf positives Feedback. Die rund 30 Teilnehmer kamen hauptsächlich aus städtischen Museen des ganzen Landes. Alle Kursteilnehmer erhielten am Ende ein Zertifikat. / BeJ, HoT
116
10 Jahre Kooperationsprojekt mit KamerunDieses Jahr konnten wir das 10-jährige Jubiläum unserer Zusammenarbeit mit dem Palastmuseum in Fumban feiern. Nachdem das Kooperationsprojekt 2009 nach der Ausstellung «Kamerun – Kunst der Könige» noch unter der Leitung von Lorenz Homberger entstanden war, übernahm 2014 die neue Afrika-Kuratorin Michaela Oberhofer das Ruder. Seitdem werden gemeinsam mit den Mitarbeitenden des Palastmuseums regelmässig Treffen und Workshops zur Konservierung- Restaurierung durchgeführt. Im Juni/Juli 2019 fuhr erneut eine Delegation nach Fumban. Neben Michaela Oberhofer und Martin Ledergerber, dem neuen Restau-rator am Rietberg, kamen der Dozent und Restaurator Valentin Boissonnas, der bereits beim letzten Workshop dabei war, sowie vier Studierende der Haute- Ecole Arc aus Neuchâtel mit nach Kamerun. Zunächst wurde ein Workshop mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Palastmuseums durchgeführt, zu dem auch externe Teilnehmerinnen und Teilnehmer – zum Beispiel Mitarbeiter des Musée des Arts et Traditions, Studierende vom Institut des Beaux Arts oder Funktionäre der Verwaltung des Département du Noun – zugelassen waren. Das Interesse am Thema des Workshops war so gross, dass die 36-köpfige Gruppe für die praktischen Übungen aufgeteilt werden musste.
Seit unserem letzten Workshop 2017 hat sich die Situation in Fumban sehr verändert. Mittlerweile wurde fast die gesamte Sammlung vom alten Museums-gebäude im obersten Stock des Palastes in den neuen Museumsbau transferiert. Zwei Ausstellungsebenen waren mit den alten Vitrinen ausgestattet, und das Depot war teilweise eingerichtet. Während beim letzten Workshop die präventive Konservierung und der Umgang mit Objekten in einem living museum Thema waren, widmeten wir uns dieses Mal den konservatorisch-restauratorischen Anforderungen einzelner Materialgattungen von Leder, Federn, Glas oder Keramik zu Holz und Pflanzenfasern sowie Textilien und Metallen. Vormittags stand die Theorie mit Beiträgen der beiden Restauratoren und der vier Studierenden – Alice Gerber, Clara Le Bail, Nicolas Moret und Emeline Perret-Gentil – im Vordergrund, nachmittags wurden in der neuen Ausstellung die gemeinsam besprochenen Erkennt nisse in die Tat umgesetzt. Zusammen mit den Mitarbeiterinnen und Mit-arbeitern des Palastmuseums wurden einzelne Objekte restauriert, mit Inventar-nummern beschriftet, die Halterungen von Stücken optimiert und zahlreiche Vitrinen gesäubert und neu eingerichtet.
Im Gegensatz zu einem einseitigen Wissenstransfer ist die Idee unserer Kooperation, gemeinsam mit unseren Kooperationspartnern nach lokalen Mate-rialen und Techniken der Konservierung-Restaurierung zu suchen. Nicht Hightech- Lösungen oder unsere westlichen Museumsstandards sind gefragt, sondern vor
117
Ort umsetzbare und bezahlbare Strategien für den nachhaltigen Erhalt des Kultur-gutes in Kamerun. Dabei kann die Lösung von Problemen teilweise recht einfach beziehungsweise kostengünstig sein: Das bisherige Aufhängesystem für die fragilen Gewänder wurde zum Beispiel dahingehend verbessert, dass die Metallbügel, die das Textilgewebe stark beschädigten, mit Plastikrohen, die wir mit weichem Stoff umwickelten, verstärkt wurden. Die Plastikrohre wurden auf dem Markt für Baugewerbe verkauft – und von uns zweckentfremdet .
Neben der Konservierung-Restaurierung wurde während des Workshops auch die Präsentation von einzelnen Ausstellungsbereichen vor allem im ersten Stock optimiert. Dazu gehörte zum Beispiel, dass auf Kosten des Museums Riet-berg grosse Sockel für besonders wertvolle historische Stücke wie die Mandu Yenu in Auftrag gegeben wurden. Die Sockel werten die Objekte nicht nur ästhetisch auf, sondern helfen auch Wasserschäden oder Beschädigungen durch Besuche-rinnen und Besucher zu verhindern. Die behutsame Umgestaltung fand im Dialog mit den Mitarbeitenden des Museums statt, so dass die interne Logik und das Narrativ der Ausstellung berücksichtig wurden.
Eines der Highlights war, als der Perlmacher Ndam Maman sein Wissen und seine Erfahrungen auf dem Feld der Restaurierung von Perlobjekten an die Gruppe weitergab. Dabei waren sowohl seine Kenntnisse der alten Technik der Perlstickerei beeindruckend als auch sein Wissen über das Material und den
118
Handel von Glasperlen. Die Einblicke in sein Metier wurden noch bei einem Be-such seines Arbeits- und Wohnhauses vertieft. Da der Thron Mandu Yenu des letzten Sultans Njimoluh Seidou beim Transport ins neue Museum stark beschädigt worden war, erklärte sich das Museum Rietberg spontan bereit, die aufwendige Restaurierung des Throns durch Ndam Maman und sein fünfköpfiges Team zu finanzieren. Umso mehr freut es uns, dass nach wochenlanger Arbeit dieses wichtige Kulturzeugnis und einzigartige Kunstwerk wieder in altem Glanz erstrahlt. Die einzelnen Arbeitsschritte wurden dabei für das Archiv des Museums und damit für die Nachwelt dokumentiert.
Anlässlich des 10-jährigen Jubiläums fand zudem am 4. Juli 2019 im Insti-tut Français in Yaoundé ein von der Schweizer Botschaft finanziertes Symposium statt. Vor einem grossen Publikum an Fachleuten aus dem Bereich Museum und
119
Cultural Heritage gab es Vorträge zum Thema «Nouveaux modes de coopération muséale entre l’Afrique et l’Europe: Le cas du Cameroun et de la Suisse». Neben Valentin Boissonnas (ARC), Thomas Laely (VMZ), Michaela Oberhofer und Esther Tisa Francini (MRZ) sprachen auf Kameruner Seite der Archäologe Germain Loumpet sowie Nji Oumarou Nchare und Idrissou Njoya vom Palastmuseum. Moderator war der Vizedirektor des Nationalmuseums Ousman Mahamat. Die lebendigen Diskussionen hatten weniger das Thema Restitution zum Inhalt als vielmehr die lokale Historiographie, die Frage der Authentizität sowie die Unter-stützung von lokalen Museen beim Erhalt ihres Kulturerbes.
Nach dem Ende des of fiziellen Workshops blieben die vier Master- Studierenden noch weitere zwei Wochen in Fumban und führten die begonnene Arbeit gemeinsam mit dem Team des Palastmuseums fort. Das Ergebnis ist be-eindruckend: Bei über 350 Objekten wurden konservatorisch-restauratorische Massnahmen durchgeführt, wie etwa die Anbringung von Inventarnummern (315), die Säuberung (340), die Verbesserung der Halterung (28) oder die Restaurierung (33). Hinzu kommt die Einrichtung des Depots mit Schränken und Aufbewahrungs-systemen aus dem alten Palastmuseum. Wir möchten uns herzlich bei allen Stu-dierenden mit ihrem Betreuer Valentin Boissonnas für das grosse Engagement bedanken. Der enge Austausch mit unseren Kolleginnen und Kollegen in Kamerun war für uns alle sehr bereichernd und beflügelt uns auf der Suche nach Mitteln und Wegen für die Fortführung unseres Kooperationsprojektes. / ObM
120
Kooperation mit der Fondation Koble des Mandé Sud: eine Buchvernissage und Ordensverleihung in AbidjanAm 14. März 2019 fand in der Bibliothèque Nationale in Abidjan, Côte d’Ivoire, eine berührende Buchvernissage statt. Erstmals waren zwei wichtige Werke von Hans Himmelheber Die Dan von 1958 und Boti. Ein Maskenschnitzer der Guro von 1993 ins Französische übersetzt und damit der Leserschaft in der Côte d’Ivoire zugänglich gemacht worden. Vor versammelter Presse und vielen wichtigen VertreterInnen aus der Dan- und Guro-Region übergab Monsieur Kamara, Direktor der Fondation Koble des Mandé Sud, die beiden Bücher dem Ministre de la Culture et de la Francophonie, Monsieur Bandaman, und dem Schweizer Botschafter, Herrn Litscher. Ehrengast der Vernissage war jedoch der Künstler Saou bi Boti selbst, den die Familie Himmelheber/Fischer erstmals 1975 bei der Schnitzarbeit dokumentierte.
Dank dem Engagement von Eberhard Fischer und Mamadou Kamara und der Übersetzungsarbeit von Kanga Philibert und Pierre-Louis Blanchard können die zwei wichtigen Werke zum künstlerischen Schaffen und gemeinschaftlichen Leben in der Côte d’Ivoire nun endlich von den Nachfahren der ProtagonistInnen in den Büchern gelesen werden.
Mamadou Kamara, Thomas Litscher,
Anja Soldat und Tänzer des Ensembles
aus Tibéhita an der Vernissage, 19.03.2019,
Abidjan/Côte d’Ivoire.
121
Als Vertreterin des Museums Rietberg hielt Anja Soldat eine kurze Rede und dankte M. Kamara und der Fondation Koble für die gelungene Zusammen-arbeit bei der Übersetzung der beiden Himmelheber-Werke. Wie wichtig es ist, seine Forschungsergebnisse in den Herkunftsländern zugänglich zu machen, zeigte das grosse Interesse an der Buchvernissage. Neben JournalistInnen aus Radio und Fernsehen nahmen auch die Direktorin der Bibliothèque Nationale, Madame Adjiman, und die Direktorin des Musée des Civilisations, Madame Memel- Kassi, am Anlass teil.
Monsieur Boti war mit dem Maskentanzensemble aus seinem Heimatdorf Tibéhita nach Abidjan gereist, um der Zeremonie beizuwohnen. Der über 100- jährige Schnitzer war sichtlich gerührt, dass das Buch über seine künstlerische Tätigkeit nach so vielen Jahren nochmals offiziell präsentiert wurde. Aufgrund der grossen Ressonanz des Anlasses entschied sich der Kulturminister der Côte d’Ivoire, Monsieur Boti einen Orden zu verleihen, der ihn zu einer grosszügigen Rente be-rechtigt. Fast fünfundvierzig Jahre nach dem ersten Treffen mit Hans Himmelheber wurde der Künstler so für sein Lebenswerk geehrt. / Son
Saou bi Boti posiert mit dem Orden
für sein künstlerisches Lebenswerk,
19.03.2019, Abidjan/Côte d’Ivoire.
122
Schweizerisch-Liechtensteinische Stiftung für archäologische Forschungen im Ausland (SLSA)Die im Museum Rietberg domizilierte Stiftung unterstützt archäologische Projekte in Entwicklungs- und Schwellenländern. Finanziert wird sie durch eidgenössische Subventionen, Spenden, Mitgliederbeiträge und Erträge aus dem Stiftungskapital.
Zu den Zielen der Stiftung gehört die Erforschung und Bewahrung des kultu-rellen Erbes. Die archäologischen Projekte werden jeweils in engen Kooperationen zwischen Schweizer Archäologenteams und Projektpartnern in den Gastländern realisiert. Sie leisten damit auch einen Beitrag zur Entwicklungs zusammenarbeit im denkmalpflegerischen und wissenschaftlichen Bereich. Mit der Unterstützung durch die SLSA wurden 2019 Feldkampagnen in Honduras, Senegal, Ghana, Madagaskar, Ägypten, Albanien, Bulgarien und Bhutan realisiert.
Die SLSA publiziert ihre Aktivitäten ausführlich in einem eigenen Jahres-bericht. Auf der Website www.slsa.ch sind weitere Informationen zu finden. / ScDPräsident: Dr. Albert Lutz; Generalsekretär: Dr. Eberhard Fischer; Geschäftsführender Sekretär:
Daniel Schneiter.
«Amigos de Chavín» Konservierungs- und Restaurierungsarbeiten in Peru Der Freundeszirkel «Amigos de Chavín» konnte am 10. Juli 2014 im Museum Rietberg gegründet werden. Der Zirkel finanziert die Konservierung und Restaurierung der höchst bedeutsamen Steinskulpturen der Tempelanlage von Chavín de Huántar (ca. 1200 – 500 v. Chr.) im Hochland von Peru, die seit 1985 zum UNESCO-Welt-kulturerbe gehört. Der Freundeszirkel ermöglicht die nachhaltige Weiterführung des Projektengagements des Bundesamtes für Kultur und des Museums Rietberg. Der beliebige Jahresbeitrag ab 200 CHF kommt vollumfänglich den Konservie-rungsarbeiten vor Ort zugute. Gemeinsam mit dem bedeutenden peruanischen Archäologen Dr. Luis Guillermo Lumbreras und in Zusammenarbeit mit dem peruanischen Kulturministerium leitet Peter Fux, Kurator für die Kunst Amerikas, die Aktivitäten. Die fachliche Leitung hat der Winterthurer Konservator Gregor Frehner inne.
Nach den letztjährigen Pausen, bedingt durch die Schliessung und Neu-einrichtung des Nationalmuseums Chavín, aber auch durch weitere politische Faktoren wollen wir 2020 die Arbeiten wieder aufnehmen. Interessenten können sich direkt bei Peter Fux, Kurator für die Kunst Amerikas, melden. Der Zirkel trifft sich jährlich mindestens einmal, um die Arbeiten zu besprechen. Wir verbleiben mit verbindlichstem Dank an all unsere Mitglieder, die sich für den Erhalt von Weltkultur auf ganz persönliche und direkte Art einsetzen. / FuP
123
Forschungsprojekt «Hans Himmelheber – Kunst Afrikas und verflochtene Wissensproduktion»Das Forschungsprojekt zu Hans Himmelheber umfasst verschiedene Forschungs-stränge und Kooperationen. Die wichtigsten Ereignisse, Fragen und Ergebnisse aus dem letzten Jahr sollen hier aufgegriffen und in ihrer Bedeutung für das Projekt hervorgehoben werden.
FeldforschungMit ihrem dritten Aufenthalt in der Côte d’Ivoire von Januar bis Mai führte Anja Soldat ihre Feldforschung und Restudy in der Baule-Region weiter. Für ihre Dis-sertation stand dieses Mal die Dokumentation der heutigen Goldplattierer im Vordergrund. In Assabonou begleitete Anja Soldat während mehrerer Wochen acht Handwerker, die einen vom verstorbenen Künstler Alla Kouadio geschnitzten Fliegenwedel mit einem Schlangen- und Vogel-Motiv vergoldeten. Dieser neu entstandene Fliegenwedel wird nun vergleichbare Exemplare in der Himmelheber- Sammlung des Museums Rietberg ergänzen. Ebenso diskutierte Anja Soldat mit Dorfgemeinschaften und Dorfchefs über die Fotografien von Himmelheber. In
Anja Soldat mit Konan Noel (links) und
Mbra Kouadio Noel (Mitte), 2. April 2019
124
Einzelfällen konnten sogar die heute noch lebenden Verwandten der abgebilde-ten Personen identifiziert werden. Die Diskussion über diese Dokumente mit den Nachfahren bereichert die multiperspektivische Wissensproduktion, die das Projekt ausmacht.
WorkshopsIn Vorbereitung der Ausstellung «Fiktion Kongo» fanden in Zürich mehrere Work-shops der beiden Kuratorinnen und Projektmitarbeiterinnen, Nanina Guyer und Michaela Oberhofer, mit zeitgenössischen Künstlerinnen und Künstlern aus dem Kongo und der Diaspora statt. Dazu zählen Sinzo Aanza, Sammy Baloji, Hilary Balu, Fiona Bobo, Michèle Magema, Hardy Nimi sowie Yves Sambu. Die Kunst-schaffenden waren eingeladen worden, sich kritisch mit dem Archiv von Hans Himmelheber auseinanderzusetzen und die daraus entstandenen Werke in der Ausstellung zu präsentieren. Die intensiven Gespräche und Diskussionen berei-cherten die Forschung zum Archiv Hans Himmelheber und trugen massgeblich zur Schärfung des Konzepts der Ausstellung bei. Neben den künstlerischen Recher che-ergebnissen führten wir ausserdem lange Interviews mit den beteiligten Künst - ler innen und Künstlern, die in Form von multimedialen Projektionen als Oral History nicht nur für die Zeit der Ausstellung, sondern als Teil des immateriellen Archivs unseres Museums auch danach für die Öffentlichkeit zugänglich sind.
Am 5. April lud das Projektteam zudem auf Initiative von Gesine Krüger und Esther Tisa zur Diskussion über Archivwissen im Zusammenhang mit Provenienz-forschung ein. Im Zentrum standen die Fragen, wie mit einem im kolo nialen Zusam-menhang entstandenen Archiv von Objekten, Fotografien und Schriften umzugehen ist und wie solche komplexe Sammlungen erforscht, vermittelt und in Ausstellun-gen kuratiert werden können. Das Museum wird dabei als weit gefasster Gedächtnis- ort fürs Sammeln, Ausstellen, Forschen, Dokumentieren und Vermitteln begriffen. Provenienzforschung setzt Archivwissen voraus, geht jedoch darüber hinaus, und Letzteres reicht für Ersteres nicht aus. Die Diskussion mit rund 15 Künstle-rinnen, Kuratorinnen und Historikerinnen brachte spannende Reflexionsmomen-te für die weitere Forschung am Himmelheber-Projekt.
ErinnerungswerkstattIm März 2019 startete die erste Serie von Interviews im Rahmen einer Erinnerungs-werkstatt zu Hans Himmelheber. Sein Sohn Eberhard Fischer erzählte in fünf mehrstündigen Interviews über seinen Vater Hans Himmelheber, aber auch über seine Mutter, die gemeinsam mit ihrem Mann auf Forschung war und dabei eigene Themen wie die Rolle der Frauen untersuchte («Schwarze Schwester»). In den
125
Gesprächen wurde deutlich, dass die ganze Familie damals zum Gelingen der Forschung, des Sammelns und Verkaufens, des Dokumentierens und Publizierens beitrug. Das Wissen der Familie über das langjährige Wirken von Hans und Ulrike Himmelheber ist immens und so auch der Wert der Oral History für das Projekt. Bereits wurde auch Lorenz Homberger, langjähriger Afrika-Kurator am Museum Rietberg, über seine Erfahrungen mit Hans Himmelheber befragt. Weitere Inter-views mit den Kindern und Enkelkindern Himmelhebers werden folgen, ebenso mit noch verbliebenen Zeitzeugen.
ArchivrecherchenNicht nur die mündliche Überlieferung beschäftigte uns, sondern auch die Arbeit mit den Tagebüchern und dem Briefwechsel von Hans Himmelheber im Museums-archiv. Die Fülle an Einsichten zu den Forschungs- und Sammlungsreisen könnte umfassender nicht sein: Reiseerlebnisse, Ankaufssituationen, Austausch mit ande-ren WissenschaftlerInnen auf Konferenzen, Schreibprozesse und wirtschaftliche Sorgen tragen zu einem dichten Bild aus dem Forscherleben von Hans Himmel-heber bei. Mit den hauseigenen Akten haben sich sowohl Gesine Krüger, die insbesondere die Lehrtätigkeit Himmelhebers in den USA untersucht, als auch Esther Tisa auseinandergesetzt. Das Tagebuch Hans Himmelhebers von seiner Kongo-Reise 1938/39 war zudem die Basis dafür, die intensive Forschungs- und Sammelaktivität des Kunstethnologen während seines 13-monatigen Aufent halts im zentralen Kongo zu rekonstruieren. Hinzu die Analyse der 1500 im Kongo ent-standenen Fotografien. Diese neuen Forschungsergebnisse sind in die beiden wissenschaftlichen Artikel von Michaela Oberhofer und Nanina Guyer im Katalog der Ausstellung «Fiktion Kongo» eingeflossen.
Des Weiteren wurden Akten der französischen Kolonialregierung, die heute in den Archives Nationales d’Outre-Mer in Aix-en-Provence, konsultiert. Dabei wurde offensichtlich, wie eng die Beziehung zwischen Joseph-François Reste, dem damaligen Kolonialgouverneur, und Hans Himmelheber war. Reste war ein sehr kunstsinniger Beamter, der bereits an einem vorherigen Wirkungsort, in Abomey, eines der ersten Museen des kolonialen Afrikas eröffnete, wonach er dann ab 1934 Messe-Ausstellungen in Abidjan organisierte. Er förderte explizit die Kunstpro-duktion. Zwischen den beiden Männern muss eine wechselseitige Beeinflussung geherrscht haben. In der angespannten Situation am Vorabend des Zweiten Weltkrieges ermöglichte 1938 Joseph-François Reste – damals Generalgouverneur von Französisch-Äquatorialafrika – Hans Himmelheber mit einem Empfehlungs-schreiben an seinen belgischen Kollegen die Einreise in die Kolonie Belgisch-Kongo.
126
Die weitere Auswertung des Kolonialarchives im Nationalarchiv in Abidjan und der ivorischen Literatur zu Fragen der Kunstproduktion, des Sammelns, Ausstel-lens und des Marktes schärften den Blick für die lokale und globale Historio graphie zur Kunst Afrikas.
KooperationenWährend der Feldforschung von Anja Soldat fand in Abidjan die Präsentation von zwei Büchern aus der Feder von Hans Himmelheber statt, die bisher nur auf Deutsch existierten und erstmals seit ihrem Erscheinen (1958 bzw. 1993) ins Fran-zösische übersetzt wurden. Ermöglicht wurde dies dank Eberhard Fischer im Rahmen der Kooperation mit der Fondation Koble des Mandé (siehe S. 120). Die Bereitstellung von Texten in der Landessprache ermöglicht endlich die Rezeption der Arbeiten von Hans Himmelheber durch die Kunstgeschichte und Museums-politik der Côte d’Ivoire. Die Zugänglichkeit der Texte ist gerade auch für das weitere Forschungsvorhaben von Bedeutung, um die Zusammenarbeit mit den verschiedenen ivorischen Akteuren zu intensivieren.
Im Rahmen der Ausstellung «Fiktion Kongo» fand zudem eine Kooperation mit der Kunstbiennale in Lubumbashi statt. Die Kuratorin der Biennale Sandrine Colard trug zum Katalog ein eindrückliches Interview zur zeitgenössischen Kunst-
M. Tagro Gonleba mit Esther Tisa Francini
im Musée des Civilisations, 17. Oktober 2019
127
szene in der DR Kongo bei. Dabei machte die Kunsthistorikerin deutlich, dass sich im Zuge des archival turn immer mehr Künstlerinnen und Künstler mit kolonialen Archiven wie dem von Hans Himmelheber beschäftigen. So schuf der junge Künstler David Shongo die Fotoserie «Blackout Poetry, Idea’s Genealogy», die auf den Aufnahmen von Hans Himmelheber aus den 1930er-Jahren basiert. Mit einigen der kongolesischen Kunstschaffenden ist eine weitere Zusammenarbeit im Rahmen des Projektes geplant.
Schliesslich war ein weiterer Höhepunkt des Jahres das Zusammentreffen des Forschungsteams mit der Familie Himmelheber/Fischer anlässlich der Er-öffnung der Ausstellung «Fiktion Kongo». In der Ausstellung wurden am Beispiel der Kongo-Reise erste Forschungsergebnisse der drei miteinander verwobenen Erzählstränge des Archivs – Objekte, Fotografien und Texte – aufgezeigt. Die Miteinbezug der Gegenwartskunst ermögliche zudem einen zeitgenössischen Blick auf das Archiv und zeigte die vielfältigen, mitunter kontroversen Kontexte und Perspektiven auf. Es freut uns sehr, dass die Ausstellung auch von der Familie von Hans Himmelheber geschätzt wurde. Und so konnte an der Preview gemeinsam mit der Familie ein erster bedeutender Meilenstein des Himmelheber-Forschungs-projektes gefeiert werden. / TiE, ObM
128
Der Weg zu einer kooperativen Provenienzforschung am Beispiel der Kamerun-SammlungWährend sich die Provenienzforschung, im Rahmen der Sammlungsintervention, mit Fragen der Vermittlung befasst hat, ging es auch um weitere Abklärungen zu historischen Provenienzen in der Afrika-Sammlung. Vor dem Hintergrund der Diskussion um Erwerbungen in der Kolonialzeit ergeben sich unterschiedliche Fragen an die Herkunft der Werke. Im letzten Jahresbericht wurde die Sammlung aus dem Königtum Benin unter die Lupe genommen. Dieses Jahr rückte im Rahmen des Kooperationsprojektes mit dem Palastmuseum in Fumban die Provenienz-forschung zur Kamerun-Sammlung in den Vordergrund. Anlass hierfür war eine Konferenz, die anlässlich des 10-jährigen Jubiläums des Kooperationsprojektes zwischen dem Museum Rietberg und dem Palastmuseum in Fumban stattfand. Das Thema war die Museumskooperationen zwischen Europa und Afrika, im Spe-ziellen zwischen der Schweiz und Kamerun (vgl. S. 116). Dabei stand auch der Austausch zwischen den Archiven, Historikern und Museen im Zentrum, zumal eine in den westlichen Archiven durchgeführte Provenienzforschung an ihre Grenzen stösst. Die Überwindung dieser Barriere war deklariertes Ziel der Reise nach Kamerun. Eine umfassende Sicht auf die Objektbiografie und Handände-rungen von Werken schliesst eine multiperspektivische Herangehensweise ein, unter Einbezug von schriftlichen Quellen sowie der mündlichen Überlieferung in den Herkunftsländern.
Um Forschungsfelder zu definieren und die Erkenntnisse zu den Erwerbs-umständen vor Ort durchführen zu können, wurde die Sammlungsdokumentation aufgrund der hauseigenen Dokumentation aktualisiert und kategorisiert. Die 74 Werke mehrheitlich aus dem Kameruner Grasland wurden im 19. oder Anfang des 20. Jahrhunderts geschaffen. Die Sammlung kann in vier Erwerbsgruppen geglie-dert werden: Erstens in Erwerbungen in Kamerun selber, durch dem Museum nahe-stehende Personen, in der kolonialen (durch Elsy Leuzinger) und post kolonialen Zeit (durch Lorenz Homberger und Eberhard Fischer). Dabei wissen wir einer-seits, in welchem Dorf die Werke gekauft wurde, respektive wer der Händler war. Zweitens sind die diplo matischen Geschenke des Sultans von Fumban an den Missionar Martin Göhring aus der Zeit von 1906 bis 1910 zu erwähnen. Hierfür sind die Archive der Basler Mission, der Familie von Martin Göhring, das deutsche Reichs-kolonialamt und das Palastarchiv zu konsultieren. Eine dritte Kategorie ist der wissenschaftlichen Forschungs- und Sammlungstätigkeit zuzuordnen. Hierzu gehört auch die bedeutende Maske der Bamileke, die erstmals 1914 in einem Kamerun-Katalog beim Hamburger Ethnographica-Händler J.F.G. Umlauff publi-ziert wurde. Das Vorwort bei Umlauff ist sehr ausführlich und verweist auf ver-
provenienzforschung
129
schiedene Sammler und Expeditionen, die es weiter zu recherchieren gilt. Eine vierte Kategorie, und diese ist die grösste und am aufwändigsten zu erforschende, geht auf den westlichen Kunstmarkt zurück. Hier sind die Händler und Sammler Charles Ratton (Paris), Paul und Maria Wyss (Basel), Emil Storrer (Zürich) sowie Ulrich von Schröder (Zürich) zu nennen. Die namentlich bekannten Sammler und Sammlerinnen lauten in chronologischer Reihe der Sammeltätigkeit Nell Walden, Han Coray, Eduard von der Heydt sowie François Mottas. Der Weg der Provenienz-forschung ist nicht ohne die Kunsthändler- und Sammlerarchive zu gehen. Wenn es allerdings da kein Weiterkommen gibt, und dies ist aktuell der Fall, so kann von der anderen Seite her die Forschung angedacht werden. Der Verkauf, die Weg-gabe, der Tausch oder die Wegnahme von Werken soll auch von Kameruner Seite her erforscht werden, soweit es die Quellenlage in den Archiven sowie die Rekon-struktion durch Oral History vor Ort zulassen. So könnten wir die Objektbiografien von zwei Enden her zusammenführen.
Wenn wir nun von kooperativer Provenienzforschung sprechen, so gilt es, den Ursprung der Objekte mit in Betracht zu ziehen und mit Kuratoren und Künst-lerinnen aus den Herkunftsländern der Werke ins Gespräch zu kommen. Es geht nicht darum, die Rechtmässigkeit der in der Kolonialzeit erworbenen Werke per se infrage zu stellen, aber mögliche problematische Fallkonstellationen zu eruieren.
130
Abgesehen vom individuellen Weg von Kunstkonvoluten geht es auch um An- und Abwesenheiten von Werken. Wichtig ist zuerst, die Geschichte aufzuarbeiten und über die Berührungspunkte gemeinsam zu diskutieren. Dabei sollen Projekte von wechselseitigem Interesse entstehen.
In Kamerun haben wir es insbesondere mit drei Museumstypen und deren Sammlungsgeschichte zu tun: das Nationalmuseum mit seinen Dépendancen, Museen von Chieftancies und von Dorfgemeinschaften. Je weiter die Werke von ihrem Ursprungsort entfernt sind, desto mehr Wissen geht verloren – es sei denn, die Geschichte des Objektes wird dem Artefakt mit auf die Reise gegeben, aber dieses dokumentarische Bewusstsein kann nicht grundsätzlich vorausgesetzt werden. Dies ist schon bei innerkamerunischen Transfers der Fall und benötigt nicht erst eine transkontinentale Reise. Objekte wanderten schon immer, aber auch die Kunstproduzenten, oder aber Werke wurden ausgetauscht, und nicht erst in der Kolonialzeit.
Die bedeutenden ethischen Richtlinien von ICOM, erstmalig 1986 ver-abschiedet, definieren nicht präzise, was genau Raubkunst ist, geben jedoch klare Anweisungen für Rückgabe respektive Rückführung von Objekten in die Ursprungsländer. Dabei wird der wissenschaftliche, professionelle und humani-täre Dialog dem politischen vorgezogen. Selten wird gesagt, dass vor allem das geplünderte Kulturgut aus kriegerischen Auseinandersetzungen die oberste Priorität hat und zurückgegeben werden soll. Bei anderen Erwerbskontexten – wie hier ausgeführt – muss noch viel in die Forschung gesteckt werden. Sicher ist: Die Zukunft der Provenienzforschung liegt in der gemeinsam erarbeiteten Geschichte. So wie geteilte Geschichte dank Respekt und Transparenz möglich wird, wird es Lösungen geben für Provenienzfragen. / TiE
131
Das 2018 erschlossene Archiv von Hans Himmelheber hat Anfang 2019 nochmals einen bedeutenden Zuwachs erhalten. Eberhard Fischer übergab dem Museum mehrere Kisten an Material, die in die Fotosammlung in die Bibliothek und wie-derum ins Schriftenarchiv gingen. Dabei handelt es sich um so aufschlussreiche Dokumente wie Haushaltsbücher, Steuerbücher und Kommissionslisten, die be-sonders für Privatkunden, die Zusammenarbeit mit Galerien und für die Verkaufs-preise von Belang sind. Vorlesungsmanuskripte zu seiner Lehrtätigkeit in den USA, Korrespondenz mit Partnern, Vermittlerpersonen und Museen, wie auch wei-tere umfangreiche Familienkorrespondenz ergänzten die bisherigen Lücken. Damit können wir zahlreiche, bereits angelegte Dossiers erweitern und die gesamte Sammlung vervollständigen. Relevant sind diese Dokumente für alle Bereiche, aber insbesondere für diejenigen, die wegen des Kriegsverlustes dezimiert waren, so zum Beispiel die in diesem Archiv kaum doku mentierten Forschungsreisen vor dem Zweiten Weltkrieg. Der Nachlass von Hans Himmelheber verdichtet sich mit dieser Überlieferung also nochmals, und dies kommt schliesslich sowohl dem Museum als Gedächtnisort zugute als auch dem Forschungsteam des Himmel-heber-Projektes. Wir können damit das Wirken eines Kunstethnologen und Sammlers – gerade auch was die Erwerbskontexte in Afrika in der Kolonialzeit betrifft – sehr detailliert befragen, erforschen und vermitteln.
Ebenso freuen wir uns – dank der Vermittlung von Heidi Tacier – über den Zugang von fotografischem und schriftlichem Material von Elsy Leuzinger, der Direk torin des Museums von 1956 bis 1972 aus privaten Händen. Elsy Leuzinger, die keine Kinder hatte, vermachte ihre Tagebücher, Korrespondenz und Fotoalben sowie Sonderdrucke ihrer Nichte, Do Zeller (1939 – 2018). Ihr Mann, Andres Zeller, übergab diese nach dem Tod seiner Frau dem Museum. Die grössten teils privaten Dokumente, die aber auch über ihre so bedeutende Reise-, Forschungs- und Sammlungstätigkeit Aufschluss geben, ermöglichen nochmals einen breiteren Blick auf ihre absolute Pionierarbeit. Die Notizbücher sowie Reise tagebücher, Sonderdrucke und Briefe ergänzen das bisher von Elsy Leuzinger archivierte Material auf das Beste. Wir freuen uns sehr über diese Komplettierung unseres Archives von privater Seite und danken sehr für das Vertrauen. Das Wirken von Elsy Leuzinger ist für das Museum Rietberg zentral und wird entsprechend aufge-arbeitet werden: Sie hat die wissenschaftliche Grundlage für die Sammlungs-kataloge gelegt, durch ihre Verknüpfung von akademischer Lehre, durch um sichtige Ankäufe und Ausstellungen, Reisetätigkeit und Austausch innerhalb ihres wissen-schaftlichen Netzwerkes. Wir werden das Material der Öffentlichkeit zugänglich machen, und sicherlich wird Elsy Leuzingers Wirken einmal Gegenstand einer Ausstellung sein.
schriftenarchiv
132
Durch die Pensionierung von Albert Lutz hat das Archiv ebenso eine Erweiterung erfahren. Diese Akten betreffen direktoriale Belange, aber auch Samm-lungs- und Ausstellungsakten, baugeschichtliches und museumshistorisches Material, das es in der nächsten Zukunft zu sichten gilt. Ein Teil kann dem Stadt-archiv oder dem baugeschichtlichen Archiv der Stadt Zürich übergeben werden, da das Museum als städtische Dienstabteilung dem Stadtarchiv einerseits abgabepflichtig ist und wir andererseits nur eine beschränkte Archivierung bewirtschaften können – nämlich wie zu Beginn des Aufbaus des Archivs 2011 fest gehalten, das, was für die Sammlungsforschung speziell von Interesse ist. Ein Grossteil ist in elektronischer Form materialisiert, womit wir uns auch vermehrt mit der digitalen Archivierung, das heisst mit E-Recordsmanagement auseinander-setzen müssen. / TiE
Elsy Leuzinger, Reisetagebuch
133
Nachdem 2018 ein neues Lesezimmer mit zusätzlichen Regalflächen bezogen werden konnte, galt es nun, die Bestände im Untergeschoss der Bibliothek auf den frei gewordenen Tablaren neu einzuräumen. In mehreren Etappen verschoben wir über das Jahr verteilt einzelne Signaturenbereiche, um etwas Luft zwischen die geografisch und thematisch sortierten Abteilungen zu bekommen – ein Unter-fangen, das uns schon bald die Grenzen der bescheidenen Bibliothekserweiterung ein Jahr zuvor aufzeigte. Obwohl wir im Lesezimmer als auch im angrenzenden Büro des Vizedirektors 2019 nochmals zusätzliche Regale für die Bibliothek reali sie ren konnten, wurde schnell klar, dass es für den weiterhin wachsenden Platzbedarf der Bibliothek nachhaltigere Massnahmen braucht.
Im Herbst besichtigten wir ein Zivilschutzlager der Stadt Zürich im Sihlfeld, das zukünftig von verschiedenen Bereichen des Museums belegt werden wird. Geplant ist, dass die Bibliothek dort einen grossen Teil der vor Ort nicht benötigten Zeitschriftenliteratur unterbringen kann. Zusammen mit dem schon bestehenden Lager an der Rieterstrasse, das die Bibliothek aktuell für die Deponierung von Auktionskatalogen, Altbeständen, Dubletten und nicht bearbeiteten Schenkungen nutzt, ergibt sich mittelfristig die Möglichkeit, in den Haupträumlichkeiten der Bibliothek genügend Platz für weiteren Zuwachs zu schaffen. Und der Umfang vergrössert sich kontinuierlich: 2019 konnten verschiedene wichtige Schenkungen angenommen und teilweise integriert werden. So unter anderem die umfassende Bibliothek von Dr. Cornelia Mallebrein, einer mit dem Museum langjährig verbun-denen Indien-Kennerin, oder ein Bestand an China-Kunstliteratur aus dem Büro des Direktors des Hauses, Dr. Albert Lutz, der 2019 pensioniert worden ist. Da-neben bereicherten auch kleinere private Schenkungen dieses Jahr unsere Sammlungen; zudem ermöglichte uns eine Zuwendung des Metropolitan Center for Far Eastern Art Studies, Kyoto, bereits zum zweiten Mal, unsere Abteilung an Japan-Literatur um wichtige Referenzwerke zu erweitern. Der aktuelle Metadaten-bestand unserer Bibliothek in NEBIS beträgt nun rund 34’000 Titelsätze, dies entspricht einem Gesamtvolumen von rund 47’000 Einzelmedien.
In den vergangenen sieben Jahren haben wir konsequent alle früher einge-setzten Zeitschriftenschuber aus Plastik, die mit der Zeit brüchig geworden sind, durch kartonierte Archivschachteln für die Langzeitaufbewahrung ausgetauscht. Mit dem Einschachteln des letzten Jahrgangs der Zeitschrift Yamato bunka haben wir nun auch ein langfristiges Projekt zur Ausrüstung des Bibliotheksbestands mit säurefreiem, archivtauglichem Material zu einem guten Ende gebracht. / HuJ
bibliothek
134
Fiktion Kongo – Kunstwelten zwischen Geschichte und GegenwartNanina Guyer und Michaela Oberhofer (Hrsg.)Zürich: Scheidegger & Spiess 2019
Congo as Fiction, Art Worlds between Past and PresentNanina Guyer und Michaela Oberhofer (Hrsg.)Zürich: Scheidegger & Spiess 2019
Gitagovinda – Indiens grosse LiebesgeschichteCaroline WidmerStuttgart: Arnoldsche Art Publishers, 2019
Deutsche Ausgabe mit englischem Beiheft
Space in Time, Contemporary Miniature Paintings from PakistanJohannes Beltz, Quddus Mirza und Caroline WidmerZürich/ Karachi: Museum Rietberg, Canvas Gallery 2019
Artibus AsiaeDie seit 1925 erscheintende und seit 1991 unter der Herausgeberschaf t des Museums Rietberg stehende Fachzeitschrift Artibus Asiae, ist eines der renom-mier testen Journale für die Kunst und Archäologie Asiens. Im Berichtsjahr erschie-nen drei Journale (77.2 und 78, 1 und 2) mit Beiträgen u.a. von Nadhra Shahbaz Khan über die Spiegelsäle im Fort-Palast von Lahore, Terence McInerney über die Maler am Hof des Nawabs von Awadh im 18. Jht. oder von Huping Pang über Mikrounter suchungen zu chinesischer Malerei. Mit Laura Neapolitano konnte neu eine erfah rene Redakteurin für Manuskripte gewonnen werden. Als Chefredak teurin amtet nach wie vor Prof. Dr. Amy McNair (University of Kansas).
Während die Abonnementszahlen über die letzten Jahre relativ stabil ge-blieben sind, verzeichnet der Verlag steigende Nutzerzahlen auf der digitalen Plattform Journal Storage (JStor), auf der alle Titel des Verlags, die älter als fünf Jahre sind, zugänglich gemacht werden.
Herausgeber: Eberhard Fischer und Jorrit Britschgi; Abonnements und Finanzen: Barbara Hefti
Gestaltung und Satz: Claudie Rossi; Chefredaktion: Amy McNair; Redaktion: Laura Napolitano
publikationen
135
Auszug aus der Rede von Stadtpräsidentin Corine Mauch anlässlich der Verabschiedung von Albert Lutz durch das Präsidialdepartement der Stadt Zürich im Dezember 2019
Lieber Albert
Einundzwanzig Jahre im Direktorenamt, das ist eine lange Zeit. Nur der Vorgänger von Albert Lutz, Eberhard Fischer, hat auf eine noch längere Zeitspanne an den Schalthebeln im Museum Rietberg zurückschauen können.
Albert Lutz kann also aus seinen 21 Jahren am Rietberg viel erzählen: Zum Beispiel von zwei Stadtpräsidenten und von einer Stadtpräsidentin oder von der Verdoppelung der Besucherzahlen. Oder von den Dutzenden von Aus-stellungen, die Furore gemacht haben. Und, und, und. Ich könnte Albert Lutz also guten Gewissens und mit besten Gründen loben, preisen und rühmen – weil Albert Lutz wirklich grösste Anerkennung für seine Arbeit im Rietberg verdient.
Doch Albert Lutz ist ein im besten Sinne bescheidener Mensch und gänzlich frei von Eitelkeit. Ein «Lobhudel» wäre Albert nur peinlich. Und meine Rede soll auch kein mündlich vorgetragenes Abgangszeugnis sein. Das braucht Albert Lutz
personalia
136
a) nicht mehr – Du bist ja seit einigen Tagen pensioniert. Und Du hast b) auch keins nötig, weil alle wissen: Albert Lutz hat aus einem international sehr beachte ten Museum mit einer Sammlung von Rang ein international hoch ange sehenes und ausserordentlich erfolgreiches Museum gemacht.
Albert Lutz hat (…) einen wunderbaren Neubau realisieren, und es ist ihm gelungen, diesen zu einem grossen Teil privat finanzieren zu lassen. Unter Albert Lutz ist eine vorbildliche Provenienzforschung etabliert worden, und er ist in diesem Punkt vorangeschritten und hat diese heiklen Fragen nicht einfach ausgeblendet oder als Marginalie abgewickelt. Gerade dafür möchte ich Dir ganz herzlich danken.
Ich könnte jetzt noch einiges mehr aufzählen, doch lasse ich das sein und weiss, dass Albert Lutz das gerade recht ist …
Lieber Albert, Du hast das Museum Rietberg und die Stadt Zürich während der über 20 Jahren mit Deiner offenen und herzlichen Art bereichert und allen Rietberg-Mitarbeitenden ein Arbeiten in einem von Vertrauen, Wertschätzung und Kreativität geprägten Umfeld ermöglicht. Es ist wunderbar, dass diese gemein same Arbeit mit so vielen Erfolgen belohnt wurde. Ich danke Dir von Herzen für alles, was Du für unsere Stadt und für dieses Museum geleistet hast. Wir alle wissen: Es ist sehr, sehr viel gewesen!
Wir alle schätzen Albert in höchstem Masse. Wir haben die Zusammenarbeit mit Dir in angenehmster Erinnerung.
Ich wünsche Dir, lieber Albert, alles Gute für die Zukunft. Und ich weiss, dass sich diesem Wunsch meine Vorgänger gerne anschliessen. Und der ganze Stadtrat. Und Deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und Deine Nachfolgerin und die vielen Zehntausende, die Deine wunderbaren Ausstellungen gesehen und genossen haben. Danke, lieber Albert
Corinne Mauch
137
Janja PerišicJanja Perišic, das Herz unseres Reinigungsteams, war seit 1977 bei der Stadt Zürich tätig, zuerst in einem Altersheim, dann bei der Immobilienbewirtschaftung und seit 2001 bei uns im Museum. Somit war sie seit langem die Dienstälteste in unserem Haus. Ende September ging sie in Pension. Janja kam schon in jungen Jahren von Kroatien nach Zürich und hat hier ihre Familie gegründet. Mit der Er-öffnung des Erweiterungsbaus 2007 übernahm das Museum von der Immobilien-bewir tschaftung die Verantwortung über die Hauswartung, und das Museum konnte dadurch ein eigenes Team für die Reinigung aufbauen. Von Anfang an übernahm Janja im Team die Verantwortung für einen reibungslosen Ablauf der Arbeiten, die ja gerade im Umfeld eines Kunstmuseums sehr verantwortungsvoll sind. Vor der Eröffnung grosser Ausstellungen ist die Arbeitsbelastung des Teams immer besonders hoch – es gilt, die Räume und die Vitrinen sauber zu putzen, sowie das ganze Haus auf Hochglanz zu bringen. Janja war über all die Jahre eine positiv eingestellte, zuverlässige und stets hoch engagierte Mitarbeiterin. Wie ger-ne wir sie alle hatten, konnte sie am Abschiedsapéro erfahren, an dem beinahe alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anwesend waren. Sie hielt eine unvergessliche Ansprache, sie sprach von der «Rietberg-Familie» und dankte allen – ein schöner, emotionaler Abschied mit sehr viel Applaus für sie. Wir danken Janja für ihren unermüdlichen Einsatz für unser Museum und wünschen ihr eine glückliche und gesunde Zukunft, die sie auch teilweise wieder vermehrt in Kroatien verbringen möchte. / LuA
138
Annelis HuberMit Annelis Huber geht eine weitere langjährige, geschätzte Mitarbeiterin in Pension, die nicht nur bei uns im Haus, sondern darüber hinaus bei vielen unserer Besucherinnen und Besuchern bekannt und beliebt war. Seit 1997, zehn Jahre vor der Eröffnung des Erweiterungsbaus, war sie an der Kasse in der Villa Wesendonck, aber auch noch im Haus zum Kiel, unserer damaligen Dependance beim Kunst-haus, tätig. Dank ihrer stets freundlichen, aufmerksamen und zurückhaltenden Art und ihres Organisationstalents war sie dann auch die ideale Person bei der Neu-besetzung der Sekretariatsstelle für die Rietberg-Gesellschaft und den Rietberg-Kreis. Seit 2010 hat sie die Geschäfte unserer Freundesgesellschaften sorgsam und effizient geführt. Dabei wurde sie mit vielen Mitgliedern bekannt und war für sie eine geschätzte und zuverlässige Ansprechperson. Da sie vor ihrem Eintritt ins Museum in der Reisebranche tätig gewesen war, wirkte sie auch als ideale Organisatorin unserer Reisen, die wir den Mitgliedern der Rietberg-Gesellschaft anbieten. Dank ihres Engagements und ihrer Freude an dieser Arbeit blieb unser Angebot stets vielfältig und interessant – mit Kurzreisen aber auch mit grossen Reisen in entlegene Länder. Hans von Trotha, Co-Kurator der Ausstellung « Gärten der Welt» und beliebter und kenntnisreicher Reiseleiter bei unseren Gartenreisen, schätzte Annelis als die ideale Reisebegleiterin. Er nannte sie einmal die « Schäferin», weil sie stets um das Wohl aller Mitreisenden besorgt war und bei Wanderungen und Besichtigungen dafür sorgte, dass alle «Schäflein» schön zusammenblieben. Und noch etwas: Wenn immer unsere Besucherinnen und Besucher sich über den schönen Blumenschmuck beim Empfang, im Café, bei einem Konzert oder einer Vernissage gefreut haben, so war es stets Annelis, die sich um die Blumen, um ihre Bestellung und Auswahl gekümmert hat. Auch ihr danken wir von Herzen, und wir wünschen ihr eine gute neue, kreative und hoffentlich auch etwas geruh-samere Zeit. / LuA
139
Dr. jur. Susanne Elisabeth Hürlimann-Schmidheiny (1931– 2019)Susanne Hürlimann, die den grössten Teil ihres Lebens direkt angrenzend an den Rieterpark in ihrem Haus an der Brunaustrasse, zuerst mit ihrer Familie und dann allein, gewohnt hat, war unserem Museum über all die Jahre treu verbunden als Gönnerin sowie als gern und oft gesehene Besucherin. Sie stammte aus der da-mals in Holderbank-Wildegg ansässigen Unternehmerfamilie Schmidheiny war mit dem Bierbrauer Martin Hürlimann verheiratet und kümmerte sich in den letzten zwei Jahrzenten intensiv mit ihren Stiftungen um die Förderung von Jugendlichen. Sie gründete 2000 die Stiftung für hochbegabte Kinder, die heute von ihrem Sohn Philippe präsidiert wird, sowie 2007 die Stiftung Wegweiser, die sich für die gezielte Förderung von Heranwachsenden einsetzt und dabei insbesondere Sozial kom-petenz und Ethos für zukünftige Führungspersönlichkeiten fördert. Als Mitglied des Vorstands der Rietberg-Gesellschaft und als Gönnerin im Rietberg-Kreis war sie mit dem Geschehen im Museum stets vertraut. Sie engagierte sich als ehren-amtliche Mitarbeiterin des im Jahr 1996 anlässlich der Ausstellung «Mandat des Himmels» gegründeten Museumsshops, und sie war es auch, die zusammen mit anderen Mitgliedern des Vorstands der Rietberg-Gesellschaft mit einer grossen Initialspende das Neubauprojekt des Museums unterstützt und somit ermöglicht hat. Wir danken ihr für ihr grosses Engagement und ihr Wohlwollen und werden sie stets in guter Erinnerung behalten. / LuA
im andenken
140
Das Museum ist eine Dienstabteilung des Präsidialdepartements der Stadt Zürich und verfügt über insgesamt 44.9 Stellenprozente. Zusätzliche 5.9 Stellenprozente werden privat finanziert.
Direktion
Dr. Annette Bhagwati, ab 01.11.2019
Dr. Albert Lutz, Direktor, bis 30.11.2019
Dr. Johannes Beltz, stellvertretender Direktor
Verwaltung / Stabsstellen
Personal
Patrizia Zindel (Leitung)
Sabine Brenner
Finanzen
Michael Busse (Leitung)
Christine Hunziker
Abteilungen
Kuratorium und Kunstvermittlung
Dr. Johannes Beltz (Leitung)
Marketing und Kommunikation
Elena DelCarlo (Leitung)
Corporate Design und Facility Management
Martin Sollberger (Leitung)
Kuratorium und Kunstvermittlung
Dr. Johannes Beltz (Leitung)
Dr. Michaela Oberhofer (stv. Leitung)
Indien- und Südostasien-Sammlung
Dr. Johannes Beltz, Kurator
Dr. Caroline Widmer, Kuratorin indische Malerei
Rosine Vuille, Mutterschaftsvertretung ab
Oktober 2019, indische Malerei
Afrika- und Ozeanien-Sammlung
Dr. Michaela Oberhofer, Kuratorin
Amerika-Sammlung
und Leitung Sonderausstellungen
Dr. Peter Fux, Kurator
Sammlung Neuer Orient / Schweizer Masken
Dr. des. Axel Langer, Kurator
Sammlung der Kunst Chinas
und der Himalaya-Region
Alexandra von Przychowski, Kuratorin
Sammlung der Kunst Japans und Koreas
Dr. Khanh Trinh, Kuratorin
Provenienzforschung, Schrif tenarchiv
Esther Tisa Francini (Leitung)
Fotosammlung
Dr. Nanina Guyer, Kuratorin
Sammlungsdienste
Dr. Michaela Oberhofer (Leitung)
Registrarin
Andrea Kuprecht
Bibliothek
Josef Huber (Leitung)
Simon Hürlimann
Restaurierung und Konservierung
Martin Ledergerber
Textildepot
Nanny Boller
Verlag Artibus Asiae
Dr. Jorrit Britschgi (Leitung)
Barbara Hefti
Drittmittelprojekte
Dr. Kim Karlsson, Co-Kuratorin chin.
Landschaftsmalerei
Anna Hagdorn, MuseumDigital,
ab 1. September 2019
Dr. Daniel Horn («Spiegel»), bis 31. August 2019
Marius Kuhn («Spiegel»), bis 31. Mai 2019
Daniela Müller (SNF-Forschungsprojekt
Himmelheber)
Janina Offner (Workshops «Spiegel»),
13. Juli bis 30. September 2019
Esther Tisa Francini (SNF-Forschungsprojekt
Himmelheber)
Alice Küng (Workshops «Nächster Halt
Nirvana»), 15. Januar bis 31. März 2019
Abirami Raghupathy (Workshops «Nächster
Halt Nirvana»), 15. Januar bis 31. März 2019
Ebnomer Thaha (Workshops «Nächster Halt
Nirvana»), 15. Januar bis 31. März 2019
Nils Weber (Workshops «Nächster Halt
Nirvana»), 15. Januar bis 31. März 2019
mitarbeiterinnen und mitarbeiter
141
Kunstvermittlung
Caroline Spicker (Leitung)
Christiane Ruzek (stv. Leitung)
Robert Ashley
Maya Bührer
Vera Fischer Ambauen
Suy Ky Lim
Religion und Kultur
Anna Hagdorn (Leitung)
Linda Christinger, bis 30. Juni 2019
Karolina Lisowsky, ab 1. Juli 2019
Sarah Smolka, bis 31. Mai 2019
Angebot für Menschen mit Demenz-
erkrankung
Sylvia Seibold
Japanische Teezeremonien
Soyu Yumi Mukai
Museumsführungen
Caroline Spicker (Leitung)
Linda Christinger (Assistenz)
Damian Christinger
Eva Dietrich
Claudia Geiser
Gabriela Blumer Kamp
Dr. Chonja Lee
Daniel Schneiter
Sylvia Seibold
Anja Soldat
Penelope Tunstall
Christiane Voegeli
Monika Willi
Marketing und Kommunikation
Elena DelCarlo (Leitung)
Alain Suter (stv. Leitung)
Nicola Morgan, bis 31. Dezember 2019
Publikationskoordination
Mark Welzel
Events / Führungen
Caroline Delley
Veranstaltungsassistenz
Daniel André
Rietberg-Gesellschaft
Annelis Huber (Sekretariat und Finanzen),
bis 31. Dezember 2019
Café
Urban Högger (Leitung)
Gabriela Christen (stv. Leitung),
bis 31. Dezember 2019
Fabian Kaiser
Rebecca Luescher
Nico Lutziger
Daiana Mandato
Lea Pasinetti
Leroy Ramseier
Alexi Rapeau, 1. Mai bis 31. Dezember 2019
Deborah Schneider
Daniela Tau
Daniela Zgraggen
Corporate Design & Facility Management
Martin Sollberger (Leitung)
Ausstellungsarchitektur
Martin Sollberger
Visuelle Kommunikation
Jacqueline Schöb
Fotografie und Objektbeleuchtung
Rainer Wolfsberger
Multimedia
Masus Meier
Facility Management, Sicherheit, Technik
Silvan Bosshard (Leitung)
Sandra Gomez, Sicherheits- und Brand-
schutzbeauftragte (stv. Leitung)
Museumsshop
Régine Illi
Lager / Versand
Xuong Long Ly
142
Empfang, Sicherheit und Aufsicht
Peter B. Gröner (Leitung)
Sandra Gomez (stv. Leitung), ab 1. Mai 2019
Fani Buchholz
Randolph Egg
Noorjahan Haupt
Michael Hoffmann
Xi Hu
Manuela Hitz, ab 1. Dezember 2019
Annelis Huber, bis 31. Dezember 2019
Christina Hunziker
Laura Jones, ab 1. August 2019
Salomé Jost, bis 31. Juli 2019
Louis Louw, 13. Mai bis 16. August 2019
Valentin Magaro
Maka Mamporia
Olivia Pajarola
Davide Pellandini, bis 30. November 2019
Ramses Rapadas
Pema Ribi, ab 1. Mai 2019
Soraya Stindt
Ursula Tanner
Isabelle Torelli
Hauswart, Reinigung
Mesut Kara (Leitung)
Janja Perisic (Co-Leitung),
bis 30. September 2019
Gönül Akalin
Aljbine Bajrami
Cirila Blocher
Pashije Hamidi
Nicole Ilunga, bis 31. März 2019
Katarina Kara, bis 31. Oktober 2019
Arlinde Morina, ab 25. November 2019
Zejnije Sherifi
Dragana Stojanovic, ab 1. November 2019
Sohamy Trapaga, bis 30. Juni 2019
Oguz Turhan, ab 1. September 2019
Praktika
Tiziana Bucher (Visuelle Kommunikation),
bis 30. Juni 2019
Laura Falletta (Kuratorium), ab 1. Mai 2019
Mira Jossen (Kuratorium), ab 1. September 2019
Salomé Jost (Multimedia), bis 28. Febraur 2019
Helene Leuzinger (Visuelle Kommunikation),
ab 1. August 2019
Monique Schuler (Events), bis 31. Oktober 2019
Pascal Schlecht (Marketing und
Kommunikation), ab 1. August 2019
Nina Schweizer (Kuratorium), bis 30. Juni 2019
Sina-Catharina Voigt (Marketing und
Kommunikation), bis 31. Juli 2019
Rosine-Alice Vuille (Kuratorium), 1. April bis
30. September 2019
Cristian Zabalaga (Ausstellungsarchitektur),
bis 31. Mai 2019
Berufserfahrungsjahr
Valdrin Korbi, bis 31. Januar 2019
Rafael Pacheco Ramos, bis 31. August 2019
Umer Usman, ab 5. August 2019
Projekteinsätze
Nicole Fleischmann (Visuelle Kommunikation)
Stefan Pletschko (Facility Management)
Ehrenamtliche MitarbeiterInnen
Catherine de Reynier (Bibliothek)
Frauke Freitag (Shop)
Theres Marty (Shop)
Shrirang Mirajkar (Events / indische Konzerte)
143
Museumsexterne Publikationen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
Johannes Beltz
The «other» Indian art or why diversity
matters
in: Arts of Asia, September – October 2019,
S. 116-125.
Zwischen Assimilation und Abgrenzung:
Indiens (Dalit-Buddhisten)
in: Andreas B. Kilcher und Urs Lindner (Hrsg.),
Zwischen Anpassung und Subversion:
Sprache und Politik der Assimilation, Pader-
born: Wilhelm Fink / Brill 2019, S. 335 – 353.
Diffusé dans 135 pays, traduit en 36
langues : le Code de déontologie des
musées de l’ICOM, culture commune
des professionnels de musées
in: Juliette Raoul-Duval (Hrsg.), Musées et
droits culturels, Dijon: ICOM France 2019,
S. 73 – 77.
A cordes et à corps: Résonances
d’instruments de musique Santal, de
l’Inde à la Suisse et de la Suisse à l’Inde.
L’exemple de la collection Fosshag au
Museum Rietberg
zusammen mit Marie-Eve Celio-Scheurer
in: Diane Antille (Hrsg.), Retour à l’objet,
fin du musée disciplinaire ?, Bern: Peter Lang
2019, S. 77 –101.
Peter Fux
Archaologie Schweiz – weltweit. Potenzial
und Herausforderungen einer komparativen
Archaologie. Eine Studie mit wissen-
schaftstheoretischen Grundlagen und
empirischen Projektbeispielen mit Bhutan
und Peru.
Dissertation. Universität Zürich, philosophi-
sche Fakultät.
Archaologisches Projekt Guadalupe:
Bericht über die Feldkampagne 2018.
(Zusammen mit Markus Reindel und
Franziska Fecher)
Jahresbericht 2018 der Schweizerisch-Liech-
tensteinischen Stiftung für archäologische
Forschungen im Ausland (SLSA): S. 35 – 48.
The Archaeological Project Guadalupe:
Excavations in Honduras 2017 – 2018.
(Zusammen mit Franziska Fecher und
Markus Reindel)
Jahresbericht 2017/18 der Abteilung Prä-
historische Archäologie des Instituts für
Archäologie, Universität Zürich: S. 12 –13.
Anna Hagdorn
Mein Buddha, Dein Buddha? Geteiltes
Erbe als Denkfigur für die Kunstvermittlung
in: Katharina Christa Schüppel und Barbara
Welzel (Hrsg.): Kultur erben: Objekte, Wege,
Akteure. Berlin: Reimer Mann Verlag 2019,
S. 135 –149.
Understanding Religion through Art:
New Approaches to Art Education at the
Museum Rietberg
in: Arts of Asia, Vol. 49, No. 5 (Sept – Oct 2019):
S. 133–140.
Axel Langer
Safavid Revival in Persian Miniature
Painting. Renewal, Imitation and Source
of Inspiration
in: Francine Giese, Mercedes Volait, Ariane
Varela Brage (Hrsg.), À l’orientale: Collecting,
Displaying and Appropriating Islamic Art
and Architecture in the 19th and Early 20th
Centuries, Arts and Archaeology of the
Islamic World, Bd. 14, Leiden und Boston:
Brill, 2019, S. 15 – 27.
Emil Alpiger (1841–1905): Das abenteuerliche
Leben eines Teppich-Kaufmanns
in: Werdenberger Jahrbuch 2019:
Kommuni kation, Schwellbrunn: FormatOst,
2019, S. 174 –185.
Tales Told by Persian Textiles: Emil Alpiger’s
Collection of Qajar Costumes, Rugs and
Embroideries at the Museum Rietberg
in: Arts of Asia, The Museum Rietberg:
History, Collection and Activities, September –
October 2019, S. 126 –132.
Michaela Oberhofer
Artikel (zusammen mit Anja Soldat):
Ein Koffer voller Kunst? Ein Geschenk
zwischen Diplomatie und Kunstgeschichte
in: Edenheiser, Iris und Larissa Förster
(Hrsg.): Museumethnologie. Eine Einführung.
Theorien, Debatten, Praktiken. Berlin: Dietrich
Reimer, 2019, S. 28 – 29.
144
Alexandra von Przychowski
Arts of Asia: The Asian Arts & Antiques
Magazine, Bd. 49, 5, Ausgabe Sep.–Okt.
Sonderausgabe zum Museum Rietberg mit
Beiträgen von Alexandra von Przychowski,
Kim Karlsson, Esther Tisa Francini, Caroline
Widmer, Johannes Beltz, Axel Langer, Anna
Hagdorn.
Esther Tisa Francini
Itineraries of Art: Provenance Research
into the Collection of Chinese Art of the
Museum Rietberg
in: The Museum Rietberg. History, Collection
and Activities, Arts of Asia, September –
October 2019, S. 98 –105.
Rosine-Alice Vuille
Gedichtübersetzung in Baschera, Marco,
De Marchi, Pietro, and Zanetti, Sandro.
Zwischen Den Sprachen – Entre Les
Langues: Mehrsprachigkeit, Übersetzung,
Öffnung Der Sprachen – Plurilinguisme,
Traduction, Ouverture Des Langues.
Bielefeld: Aisthesis Verlag 2019, S. 39, 41.
Caroline Widmer
Immersing in the World of Radha and
Krishna: Visual Storytelling in the Context
of Religious Practice,
in: Dirk Johannsen, Anja Kirsch and Jens
Kreinath (eds.): Narrative Cultures and the
Aesthetics of Religion (Supplements to Method
and Theory in the Study of Religion), Brill,
Leiden, forthcoming 2019.
Indian Painting at the Museum Rietberg:
Collecting, Studying, Exhibiting and
Enchanting,
in: Arts of Asia. The Museum Rietberg.
History, Collection and Activities (Septem-
ber – October 2019), S. 107 –115.
Gitagovinda – India’s Great Love Story, in:
Swisspuja Patrika, 2019, p. NN.
145
Vorträge von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Museums
Johannes Beltz
Buddhismus in Indien
Vortrag im Rahmen der Ringvorlesung
«Der Buddha», Volkshochschule Zürich,
10. Januar 2019
Diffusé dans 135 pays, traduit en 36
langues : le Code de déontologie des
musées de l’ICOM, culture commune
des professionnels de musées
Vortrag an der ICOM-Tagung «Musées
et droits culturels», ICOM France, Rennes,
8. Februar 2019
Social equality or exclusion? Buddhist
modernisms in India
Vortrag im Rahmen der Tagung «The
Multi plicity of Asian Buddhist Modernities»,
University of California, Berkeley,
15. Februar 2019
Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit –
Dr. B.R. Ambedkars Konversion zum
Buddhismus als Kritik an der indischen
Kastengesellschaft
Vortrag am Lehrstuhl für Fundamentaltheo-
logie, Katholisch-Theologische Fakultät,
Universität Augsburg, 13. Juni 2019
The Museum Rietberg – History,
Collections and International Cooperation
Government Museum and Art Gallery
Chandigarh,
31. Oktoberr 2019
«Kunst verpflichtet»: Strategien und Praxis
des Museum Rietberg
Vortrag am ICOM-Herbst Seminar zum
Thema «Das Museum im kolonialen Kontext»,
ICOM Österreich, Weltmuseum Wien,
6. Dezember 2019
Peter Fux
Positivismus oder Idealismus? Gedanken
über die wissenschaftsphilosophischen
Grundlagen der Altertumswissenschaften
Eröffnungsvorlesung der Vortragsreihe
«Stimmen der Weltarchäologie» im Frühlings-
semester am Institut für Archäologie der Uni-
versität Zürich. 20. Februar 2019, Universität
Zürich.
Archaeological Objects are more than just
items
Vortrag im Rahmen des Digital Brainstorming
«New life for destroyed cultural assets with
Virtual Reality». Migros-Kulturprozent.
26. Juni 2019, KOSMOS, Zürich
Nanina Guyer
Ritual and Photography
Bridging Visual Histories: Sculpture and
Photography in the Arts of Africa, Annual
Conference College Art Association of
America, New York, 13. Februar 2019
Anna Hagdorn
Buddhismus in Tibet und der Mongolei
3. Teil der Ringvorlesung «Der Buddha»,
Volkshochschule Zürich, 24. Januar 2019
Das Vermittlungsprojekt «Kunst sehen –
Religion verstehen»
Projektpräsentation (per Skype) im Rahmen
der «Materialwerkstatt Wissenstransfers»
am Centrum für Religionswissenschaftliche
Studien (CERES), Ruhr-Universität Bochum,
22. Mai 2019
Next Stop Nirvana – Art Education
on the Move
Vortrag im Rahmen der ICOM-Tagung «Mu-
seums as Cultural Hubs: The Future of Tradi-
tion», Kyoto, 4. September 2019
Michaela Oberhofer
Histoire croisée des collections muséales
entre recherche historique et coopération
actuelle
Begrüssung sowie Vortrag mit Esther Tisa
Francini an der von der Schweizer Botschaft
finanzierten Konferenz «Nouveaux modes de
coopération muséale entre l’Afrique et l’Euro-
pe. Le cas du Cameroun et de la Suisse» am
4. Juli 2019 in Yaoundé
Curating the Archiv am Beispiel der
Ausstellung Fiktion Kongo
Vortrag am Archivworkshop des SNF-Projek-
tes « Hans Himmelheber – Kunst Afrikas und
verflochtene Wissensproduktion » am 5. April
2019 im Museum Rietberg
Von der Herkunft der Objekte zur Koope-
ration: Warum eine Rote Liste?
Vortrag zur Präsentation «Rote Listen
Jemen & Westafrika – Notfall Mali»
von ICOM am 11. Juli 2019 im Museum
Rietberg
146
Alexandra von Przychowski
Ein Bild – viele Botschaften
Vortrag am Symposium «Landschaft. Bild.
Religion.
Chinesische Landschaftsmalerei aus
Religions- und Kunstwissenschafticher Per-
spektive», Tagung Ruhruniversität.Bochum,
20./21. Februar 2019
Die Fülle der Leere – Die Kunst
des Zen-Buddhismus
Vortrag am Haus der Religionen, Bern,
11. Mai 2019
Raum im Wandel Chinesische Perspektiven
Podiumsgespräch der Uni Zürich,
14. September 2019
Das Qi fliesst aus der Pinselspitze –
Chinesische Landschaftsmalerei und
Maltheorie
Referat am Symposium «Transversal –
Landschaft neu denken» am Bündner
Kunstmuseum, 8./9. November 2019
Martin Sollberger
Exhibition Design for Museums
Government Museum and Art Gallery Chan-
digarh, 31. Oktober 2019
Esther Tisa Francini
Itinerarien von aussereuropaischen Kunst-
werken. Die Chancen einer kooperativen
und multiperspektivischen Provenienz-
forschung
Übung im Rahmen des CAS «Werk-
zuschreibung und Provenienzrecherche
interdisziplinär», Hochschule der Künste
Bern, Berner Fachhochschule, 28. Mai 2019
Werke und ihre Geschichte. Die Zukunft
der Provenienzforschung.
Plenarvortrag mit Nikola Doll
Die Relevanz der Provenienz. Aktuelle
Dimensionen der Provenienzforschung
in Theorie und Praxis
Panelleitung mit Nikola Doll und Floria
Segieth-Wülfert
Jahrestagung der Vereinigung der Kunsthisto-
rikerinnen und Kunsthistoriker der Schweiz,
6.– 8. Juni 2019, an der Università della
Svizzera italiana, Accademie di architettura,
Mendrisio
Histoire croisée des collections muséales
entre recherche historique et coopération
actuelle
Vortrag mit Michaela Oberhofer
Konferenz «Nouveaux modes de coopération
muséale entre l’Afrique et l’Europe: le cas du
Cameroun et de la Suisse», organisiert von
der Schweizer Botschaft in Kamerun,
4. Juli 2019
Provenienzfragen am Museum Rietberg.
Sammlungsgeschichte und Kooperations-
projekte mit den Herkunftslandern der
Kunstwerke
Vortrag an der 11. Tagung von infoclio.ch
gewidmet dem Thema «Provenienz und
Geschichtswissenschaft», Bern, PROGR,
Zentrum für Kulturproduktion,
8. November 2019
Khanh Trinh
Korin’s legacy: Yamamoto Taro
and Heisei Rinpa
Vortrag im Rahmen der Sonderausstellung
«Trésors de Kyoto – Trois siècles de création
Rinpa», Musée Cernuschi, Paris,
24. Januar 2019
Surimono – Die Kunst des eleganten
Glückwunschs in Japan
Volkshochschule Zürich, 21. und
26. Oktober 2019
Surimono – Felicitous poetry prints
Government Museum and Art Gallery
Chandigarh, 31. Oktober 2019
Rosine-Alice Vuille
Haider, an Indian Hamlet. Narrating
Contemporary Conflicts Through Classical
Theatre.
Tagung: CBC 2019: Translation in Pre-modern
Asia. Turin, 1.– 3. Oktober 2019, Università
degli Studi di Torino
Caroline Widmer
Vom leeren Thron zum Buddha-Bild
Vortrag in der Reihe «(K)ein Bild»,
Haus der Religionen, Bern, 2. Mai 2019
Response to: Pardis Eskandaripour about
Categorization of Islamic Objects in Museums.
Tagung REDIM (Dynamiken religiöser Dinge
im Museum), 16.–17. Mai 2019, Frankfurt a.M.
147
Externe Lehraufträge
Johannes Beltz
Vorlesung, Grundkurs «Einführung in den
Hinduismus», Universität Zürich, Religions-
wissenschaftliches Seminar, Frühjahrs-
semester 2019
Peter Fux
Ringvorlesung: «Stimmen der Weltarchäo-
logie», Institut für Archäologie der Universität
Zürich, Frühjahrssemester 2019
Museumsübung: «Kosmovisionen der Gesell-
schaften der Nordwestküste Nordamerikas»,
Institut für Archäologie der Universität Zürich,
Frühjahrssemester 2019
Grundlagenmodul: «Grundlagen interdiszipli-
nären Arbeitens», Institut für Archäologie der
Universität Zürich, Frühjahrssemester 2019
Caroline Widmer
Grundkurs «Einführung in den Buddhismus»,
Religionswissenschaftliches Seminar, Uni-
versität Zürich, Frühjahrssemester 2019
Johannes Beltz und Caroline Widmer
Grundkurs «Einführung in den Hinduismus
und den Buddhismus», Religionswissen-
schaftliches Seminar, Universität Zürich, für
Studierende der Pädagogischen Hochschule
Zürich, Frühjahrssemester 2019
Grundkurs «Hinduismus und Buddhismus»,
für Quereinsteiger der Pädagogischen
Hochschule Zürich, Frühjahrssemester 2019
Lehrveranstaltung SIK
Bereits 2018 kam das Schweizerische Institut
für Kunstwissenschaft (SIK) mit der Frage
auf uns zu, ob das Museum bereit wäre, zwei
ganztägige Workshops im Rahmen ihres
Lehrgangs (Certificate of Advanced Studies,
CAS) «Angewandte Kunstwissenschaft: Ma-
terial und Technik» zu bestreiten. Nachdem
die Lehrveranstaltungen im Frühsommer
2018 (15. und 22. Juni) auf reges Interesse
gestossen waren, erklärten sich die Kura-
torInnen des Museums Rietberg bereit, die
Lektionen auch 2019 anzubieten.
Das zweitägige Programm (14. und 21. Juni)
bot den TeilnehmerInnen jeweils einen histo-
rischen Überblick, der mit der Betrachtung
einzelner Kunstwerke der museumseigenen
Sammlung verbunden war, wobei der Um-
gang ebenfalls berücksichtigt wurde.
Dabei wurden folgende Themen erörtert:
chinesische Malerei, japanische Farbholz-
schnitte und persische und indische
Buchmalerei einerseits und chinesische
Ritualbronzen, indische Metallkunst sowie
die Schrift und Kunst der Maya andererseits.
Ergänzt wurden die Lektionen durch ein
Modul zur Provenienzforschung.
Bei genügenden Anmeldungen auf Seiten des
SIK wird das Museum voraussichtlich auch
im Jahr 2020 wieder mit von der Partie sein.
149
Die 62.Generalversammlung der Rietberg-Gesellschaft fand am 24. Mai 2019,die 74. ausserordentliche Vorstandssitzung am 22. August 2019,
die 75. Vorstandssitzung am 27. November 2019 statt.
Mitglieder 2019
Korrespondierende Mitglieder 1Mitglieder auf Lebenszeit 218
Fördermitglieder 88
Einzelmitglieder 2175
Paarmitglieder 1017
Junioren-Mitglieder 128
Kreismitglieder 67
Total 4711
VorstandDr. Eberhard Fischer, PräsidentRegula Brunner-VontobelCatharina DohrnDr. Martin EscherChristian Gut, QuästorAnnemarie HombergerDominik KellerDr. Albert Lutz, AktuarDr. Daniel VasellaMartin VollenwyderBruno WidmerDr. Daniel ZuelligDr. Robert E. Züllig
EhrenmitgliederEduard von der Heydt (1882–1964)Johannes Itten (1888 –1967)Ernst Gamper (1890 –1982)Dr. Martin Hürlimann (1897–1982)Dr. Georgette Boner (1903 –1998)Charles A. Drenowatz (1908 –1979)Prof. Dr. Wilhelm Keller (1909 –1987)Balthasar Reinhart (1916–2005)Berti Aschmann (1917– 2005)Prof. Dr. Elsy Leuzinger (1910 –2010)Dr. Pierre Uldry (Ehrenpräsident) (1914–2010)
Korrespondierendes MitgliedProf. Dr. B.N. Goswamy, Chandigarh
SekretariatAnnelis Huber / Pema Ribi
rietberg-gesellschaft
150
§1 Name und Zweck
Die Gesellschaft für das Museum Rietberg,
kurz «Rietberg-Gesellschaft» genannt, ist ein
Verein gemäss Art. 60ff. des ZGB, mit Sitz in
Zürich. Sie bezweckt, einen weiteren Kreis
von Kunstfreunden am Museum Rietberg der
Stadt Zürich zu interessieren und es seiner
Bestimmung gemäss zu fördern.
§2 Mitgliedschaft
a) Die Aufnahme als Mitglied erfolgt durch
den Vorstand
b) Es bestehen die folgenden Mitglieder-
kategorien:
1. Ehrenmitglieder
2. Einzelmitglieder
3. Fördermitglieder
4. Mitglieder auf Lebenszeit
5. Paarmitglieder
6. Korrespondierende Mitglieder
7. Junioren-Mitglieder
§3 Organe
Die Organe der Gesellschaft sind:
a) die Generalversammlung
b) der Vorstand
c) die Rechnungsrevisoren
§4 Generalversammlung
a) Die ordentliche Generalversammlung
findet alljährlich oder nach Beschluss der
Generalversammlung alle zwei Jahre statt
und wird durch den Vorstand einberufen.
b) Sie wählt den Vorstand, der aus wenigs-
tens drei Mitgliedern bestehen soll, und
zwei Rechnungsrevisoren oder an deren
Stelle eine Treuhandgesellschaft für eine
Amtsdauer von vier Jahren.
c) Die Generalversammlung nimmt den Jah-
resbericht und die Jahresrechnung ab,
welche letztere jeweils auf den 31. Dezember
abzuschliessen ist.
d) Die Generalversammlung bestimmt
die Höhe der Jahresbeiträge und der ein-
maligen Zahlung der Mitglieder auf Lebens -
zeit.
§5 Vorstand
Der Vorstand konstituiert sich selbst. Er kann
einen Sekretär bestellen, der nicht Mitglied
des Vorstandes sein muss. Der Vorstand ver-
tritt die Gesellschaft nach aussen und be-
stimmt die Unterschriftsberechtigungen. Er
führt die Geschäfte der Gesellschaft.
§6 Auflösung der Gesellschaft
Im Falle einer Auflösung der Gesellschaft wird
ihr Vermögen der Direktion des Museums
Rietberg zur Verfügung gestellt zum Zwecke
des Ankaufs neuer Ausstellungsobjekte.
Vorstehende Statuten wurden in der konsti-
tuieren den Versammlung vom 19. November
1952 angenommen. Die Änderung in §2,
Absatz b) 5 wurde in der Versammlung vom
23. August 1985 angenommen.
statuten
Erfolgsrechnungvom 1 .1 .– 31 .12 . in CHF
Ertrag 2019 2018 Aufwand 2019 2018
Mitgliederbeiträge 353’240 316’753 Veranstaltungen, Reisen 9’922 9’869
Spendenerträge 0 0 Sekretariat, Informatikkosten für
Zinsen und Wertschriftenertrag 216 216 Mitgliederverwaltung /Buchhaltung 43’324 43’372
Ertrag aus Reisen / Veranstaltungen 2’400 13’290 Portogebühren Versand 24’652 20’488
Diverse Ausgaben 13’059 8’580
Beiträge an das Museum Rietberg 257’606 417’624
Total Ertrag 355’856 330’259 Total Aufwand 348’563 499’932
Jahresergebnis 7’293 - 169’673
Bilanzper 31 .12 . in CHF
Aktiven 2019 2018 Passiven 2019 2018
Bank 489’045 591’991 Kreditoren 35’254 19’870
Verrechnungssteuer 79 3 Mitgliederbeiträge Folgejahr 280’112 289’290
Debitoren 1’430 2’840 Verbindlichkeiten ggü. Museum Rietberg 0 100’000
Fondskapital Freundeskreis Alice Boner 10’335 28’529
Fondskapital Amigos De Chavin 22’738 22’325
Total Fremdkapital 348’440 460’013
Eigenkapital 142’114 134’820
Total Aktiven 490’554 594’834 Total Passiven 490’554 594’834
Kommentar zur Rechnung
Das Museum Rietberg erhielt 2019 aus dem Vermögen der Rietberg-Gesellschaft einen Unterstützungsbetrag von CHF 300’000. Für die Finanzierung
der Sekretariatsstelle wurden CHF 42’394 verwendet. CHF 257’606 werden als Pauschalspende verbucht. Diese Mittel wurden folgendermassen
eingesetzt: Unterstützung sämtlicher Veranstaltungen (wie Konzerte, Vorträge, Lange Nacht); Vernissagen und Mitglieder-Anlässe; Beitrag für öffent-
liche Führungen; allgemeiner Beitrag an das Museum (Eintrittsentschädigung); Beitrag für Druck- und Produktionskosten des Jahresberichts; Beiträge
für Kooperationsprojekte; Beiträge für Praktikumsstellen. Des Weiteren hat die Rietberg-Gesellschaft die Publikation des Buches «Das Museum
Rietberg und Elsy Leuzinger» mit CHF 10’000 unterstützt.
Der Unterhalt des Alice Boner Hauses in Varanasi wird seit 2015 vollständig über den Fonds «Freundeskreis Alice Boner» getragen. Mit dem Fonds-
kapital der «Amigos De Chavín» werden Konservierungsarbeiten in der Tempelanlage Chavín de Huántar in Peru finanziert.
jahresrechnung 2019 RIETBERG- GESELLSCHAFT ZÜRICH