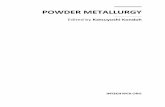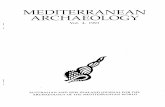Adams, S. Iron in a time of change: brooch distribution and production in Middle Iron Age Britain.
Iron Age metallurgy in Siegerland
Transcript of Iron Age metallurgy in Siegerland
INH
ALT
Arc
häol
ogie
in W
estf
alen
- Lip
pe 2
011
Säugetiere aus einer Verkarstung des devoni-schen Massenkalkes im Hönnetal bei Balve
Wadersloh – ein bedeutender Fundplatz der spätmittelpaläolithischen Keilmessergruppen
Neue Erkenntnisse zur Besiedlung Westfalens am Ende des späten Jungpaläolithikums
Frühe Hirschjäger am Hellweg bei Werl-Büderich
Menschenreste und Besiedlungsspuren – Meso- und Neolithikum aus der Blätterhöhle
Die befestigte linearbandkeramische Zentral-siedlung von Borgentreich-Großeneder
Neue Hinweise zum Frühneolithikum – die linearbandkeramische Siedlung von Werl
Eine ungewöhnliche neolithische Steinaxt-klinge aus der Hellwegzone bei Werl
Lange gesucht und wieder gefunden – das Großsteingrab I von Beckum-Dalmer
Die Toten in den Galeriegräbern von Erwitte-Schmerlecke – erste Erkenntnisse
Von Kollektiv- zu Einzelbestattungen – die Kreisgräben von Erwitte-Schmerlecke
Das mittelbronzezeitliche Halbstegbeil von Lintel-Schledebrück
Eines der reichsten bronzezeitlichen Gräber Westfalens: das Brandgrab in Barkhausen
Klaus-Peter Lanser
Manfred Schlösser
Jörg Holzkämper, Andreas Maier
Michael Baales, Martin Heinen
Jörg Orschiedt, Birgit Gehlen,
Werner Schön, Flora Gröning
Hans-Otto Pollmann
Franz Kempken,Katja Oehmen
Michael Baales
Judith Heinen, Kerstin Schierhold,
Bernhard Stapel
Susan Klingner, Kerstin Schierhold,
Michael Baales, Ralf Gleser,
Michael Schultz
Eva Cichy, Kerstin Schierhold
Johannes Werner Glaw
Hannelore Kröger
17
20
25
28
32
36
40
45
47
50
52
56
60
Leitartikel
Ausgrabungen und Funde
In dubio pro reo? Das archäologische Jahr 2011 in Westfalen-Lippe
Michael M. Rind 7
INH
ALT
Arc
häol
ogie
in W
estf
alen
- Lip
pe 2
011
Ein ungewöhnlicher Grabbefund in Westerkappeln
Neues aus dem Höllenloch bei Brilon-Rösenbeck
Neue 14C-Daten zu alten Funden aus Olfen
Die späteisenzeitliche Lanzenspitze aus Olfen-Kökelsum – ein Bauopfer?
Wettringen-Bilk – ein früheisenzeitliches Gefäßdepot aus dem nördlichen Münsterland
Eine eisenzeitliche Siedlung am »Wietheimer Weg« in Geseke
Eisenzeitliche Stege in die Emscher – die Grabung Castrop-Rauxel-Ickern 2011
Olfen-Sülsen – ein neues Römerlager aus der Zeit der Drususfeldzüge
Prospektionen im augusteischen Marschlager Haltern-»In der Borg« (Ostlager)
Archäologische Forschung in der Siedlung Aspethera in Paderborn
Mit Blick auf die Seseke – Reste eines frühmit-telalterlichen Gräberfeldes in Bergkamen
Karolingische Funde aus zwei Wüstungen bei Bad Lippspringe
Serie und Einzelstück – spätkarolingische und ottonische Metallobjekte aus Westfalen
Ein neuer Hinweis auf den mittelalterlichen Königshof in Lennestadt-Elspe
Der Erzbischof im Brandschutt: Eine Schachfigur von der Falkenburg
Bischofsstäbe aus Münster? Ein ungewöhnlicher mittelalterlicher Geweih-Nodus
»Fuchsspitze« und »Burgstätte« in Datteln-Markfeld
Eine Grundstücksentwicklung im 12.–14. Jahrhundert im Paderborner Schildern
Neufunde auf der Flur Borgstätte in Hamm-Heessen – ein Teil der Burg Nienbrügge?
Jürgen Gaffrey
Eva Cichy
Jürgen Gaffrey
Alexandra Stiehl
Andrea Stapel, Bernhard Stapel
Kai Bulka
Jürgen Pape, Angelika Speckmann
Bettina Tremmel
Bettina Tremmel
Sven Spiong
Eva Cichy, Martha Aeissen
Sven Spiong
Christoph Grünewald
Eva Cichy, Elena Kolbe
Hans-Werner Peine, Elke Treude
Bernd Thier
Baoquan Song, Georg Eggenstein
Sven Spiong
Eva Cichy
63
67
70
74
76
80
82
86
89
92
96
99
102
104
106
111
114
117
121
INH
ALT
Arc
häol
ogie
in W
estf
alen
- Lip
pe 2
011
Wohlfeiler Tand? Ein mittelalterlicher Glasring aus Dortmund, Kuckelke 10
Gefäßkeramik des 14. Jahrhunderts aus Höxter
Ein Brand im ehemaligen Kloster Kentrop in Hamm als Glücksfall für die Archäologie
Die Hüffert – eine Siedlung vor den Toren der Stadt Warburg
Am Rande der Domburg – Ausgrabung am Geologisch-Paläontologischen Museum
Wasserbaukunst an der Werse – Ausgrabungen an der Havichhorster Mühle bei Handorf
Leben in der Stadt: Archäologie zwischen Ems- und Münsterstraße in Rheine
Wasserbauliche Zufallsfunde der frühen Neuzeit aus Geseke und Arnsberg
Landsknechte in Porta Westfalica-Barkhausen
Ein Schatzfund des späten 17. Jahrhunderts aus Coesfeld-Lette
Endlich gefunden: die Mikwe der jüdischen Gemeinde Warburg
Feldbefestigungen des Zweiten Weltkriegs beim Hof Kapune in Arnsberg
Der Splittergraben Uferstraße 4 in Höxter aus dem Zweiten Weltkrieg
Ein langer Schnitt in die Vergangenheit – Ausgrabungen in Werl-Büderich
Eine fast verpasste Chance – zur Verlegung einer Gasleitung zwischen Werl und Welver
Menschliche Skelettreste aus der Weißen Kuhle bei Marsberg
Erdwerk und Glockengussgrube – die Ausgra-bungen an der Höggenstraße 28 in Soest
Montanarchäologie am und im Bastenberg bei Bestwig-Ramsbeck
Gerard Jentgens, Regina Machhaus
Andreas König
Wolfram Essling-Wintzer, Cornelia Kneppe
Andrea Bulla, Franz-Josef Dubbi
Agnieszka Marschalkowski
Ulrich Holtfester
Wolfram Essling-Wintzer, Cornelia Kneppe
Michael Baales, Eva Cichy,
Reinhard Köhne
Werner Best
Peter Ilisch
Hans-Werner Peine, Franz-Josef Dubbi
Manuel Zeiler, Torsten Kapteiner
Johannes Müller-Kissing
Martin Heinen
Franz Kempken
Linda Gomolakova, Jörg Orschiedt,
Eva Cichy
Frederik Heinze
Martin Straßburger
124
128
131
135
139
142
145
149
153
156
159
163
166
170
175
179
182
185
INH
ALT
Arc
häol
ogie
in W
estf
alen
- Lip
pe 2
011
Das spätpaläolithische Fundgebiet Rietberg und die allerødzeitliche Landschaft
Holozäner Landschaftswandel an der Emscher bei Castrop-Rauxel-Ickern
Ein Blick zurück – Neues von der Fischfauna der Emscher
Luftbildarchäologie in Westfalen – methodische Erfahrung im Jahr 2011
Prospektionen und Siedlungsarchäologie in Westfalen 2011
Digitale Geländemodelle – eine Methode zur Lokalisierung von archäologischen Fundstellen
Ergebnisse des Airborne Laserscanning am Nordrand der Warburger Börde
Eisenzeitliche Montanregion Siegerland: Forschungen und Präsentationen 2011
Die Amphoren aus den römischen Militäranlagen in Haltern
Ortswüstungen in den Hochlagen des Rothaargebirges
Hochmittelalterliche Rodungssiedlungen auf der Bulderner Kleiplatte des Westmünsterlandes
Auf beiden Seiten der Emscher – Adelssitze im Stadtgebiet von Gelsenkirchen
Voxel versus STL – die Aussagekraft von 3-D-Scans archäologischer Objekte
Die Rekonstruktion einer mittelbronzezeit- lichen Schwertscheide aus Porta Westfalica
Methoden und Projekte
Jutta Meurers-Balke, Andreas Maier, Arie J. Kalis
Jutta Meurers-Balke, Till Kasielke
Margret Bunzel-Drüke, Lothar Schöllmann
Baoquan Song
Wolfgang Ebel-Zepezauer, Michael M. Rind, Klaus Röttger, Thomas Stöllner, Beate Sikorski, Baoquan Song
Ingo Pfeffer
Rudolf Bergmann, Hans-Werner Peine, Hans-Otto Pollmann, Martin Schaich
Manuel Zeiler, Thomas Stöllner
Bettina Tremmel, Horacio González Cesteros, Torsten Mattern, Patrick Monsieur
Rudolf Bergmann, Maja Thede
Rudolf Bergmann
Cornelia Kneppe
Andreas Weisgerber
Eugen Müsch
191
196
200
203
208
212
217
221
225
227
233
236
241
244
INH
ALT
Arc
häol
ogie
in W
estf
alen
- Lip
pe 2
011
Schätze des Mittelalters – Schmuck aus dem Staatlichen Archäologischen Museum Warschau
Die Landesausstellung »Fundgeschichten. Neueste Entdeckungen von Archäologen in NRW«
Fundgeschichten en Blog – das museumspäda-gogische Modellprojekt ArchäoLOGIN
Kulturstrolche erobern die Kaiserpfalz
Sommerferien mit Asterix – Aktion, Ausstellung oder Event?
Ausstellungen
Martin Kroker
Kai Jansen, Susanne Jülich
Michael Lagers
Renate Wiechers
Renate Wiechers
251
254
257
261
264
Autorenverzeichnis
Neuerscheinungen
Ansprechpartner, Adressen
270
273
280
Arc
häol
ogie
in W
estf
alen
- Lip
pe 2
011
me
TH
od
eN
uN
d P
ro
jek
Te
221
Eisenzeitliche Montanregion Siegerland: Forschungen und Präsentationen 2011Kreis Siegen-Wittgenstein, Regierungsbezirk ArnsbergEi
senz
eit
Manuel Zeiler, Thomas Stöllner
Im Rahmen eines Kooperationsprojektes wird seit 2002 die jüngereisenzeitliche (latènezeit-liche) Montanlandschaft Siegerland erforscht. Ziel ist die Rekonstruktion sowohl der Pro-duktionskette vom Erz zum Fertigprodukt als auch der Entwicklung des prähistorischen Wirt-schaftsraumes. Neben dem Archäologischen In-stitut der Ruhr-Universität Bochum (RUB) arbeiten die Fachbereiche Montanarchäologie sowie Archäometallurgie des Deutschen Berg-bau-Museums Bochum (DBM) und die LWL-Archäologie für Westfalen, Außenstelle Olpe, an diesem Themenkomplex. Seit 2007 fördert die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) das Vorhaben. 2011 konzentrierten sich die Projektarbeiten auf Prospektionen im west-lichen Arbeitsgebiet. Darüber hinaus wurden zwei museale Vorhaben im Siegerland bzw. in Herne abgeschlossen.
Begehungen im Frühjahr 2011 haben sich gezielt mit montanarchäologischen Fundstellen im Projektgebiet westlich von Siegen beschäf-tigt. Auf einer exponierten Bergkuppe nördlich von Siegen-Oberschelden hatte das Planfest-stellungsverfahren zur Erschließung des Indus-trie- und Gewerbeparkes Seelbach eine archäo-logische Grunderfassung zur Folge: Sie wurde
unter der Leitung von Beate Sikorski von dem Projektteam durchgeführt (Abb. 1). Entdeckt wurden neue montanarchäologische Fundstel-len verschiedener Epochen vor allem an den Quelltopfbereichen der Seifen (Abb. 2).
Darüber hinaus wurden bei weiteren Pros-pektionen prominente und alt gegrabene Fund- stellen der eisenzeitlichen Montanlandschaft erneut begangen oder wieder aufgespürt. Es handelt sich um die ausgedehnten Verhüt-tungsfundstellen an der Engsbach (Siegen- Achenbach), an der Minnerbach (Siegen-Win-chenbach) und an der Leimbach (Wilnsdorf-Obersdorf). Die Überprägung dieser Orte ist insbesondere durch Infrastrukturmaßnahmen seit den 1960er-Jahren sehr massiv. Trotzdem sind alle Produktionsstandorte noch großflä-chig erhalten und bieten weiterhin großes For-schungspotenzial, da sie nur teilweise gegra-ben oder nicht auf moderne Fragestellungen hin untersucht wurden. Beispielsweise spülte die Minnerbach mittlerweile nicht ausgegra-bene Bereiche einer Schlackenhalde frei. Dabei wurde eine Schicht von verbackenen, metall-urgischen Resten erster Schmiede- bzw. Lup-penreinigungsprozesse freigelegt (sogenannte Schlackenbreccie). So kann neben dem 2003 bis
Abb. 1 Teilbereich des Plangebiets Industrie- und Gewerbepark Seelbach, Blick nach Süden (Foto: DBM, RUB/I. Luther).
me
TH
od
eN
uN
d P
ro
jek
Te
Arc
häol
ogie
in W
estf
alen
- Lip
pe 2
011
222
2005 ausgegrabenen Verhüttungsplatz Trülles- seifen (Siegen-Oberschelden) und dem seit 2009 gegrabenen Schmelzplatz Gerhardsseifen (Siegen-Niederschelden) nun eine weitere Fundstelle mit diesen charakteristischen Ab-fallprodukten aufgeführt werden (Abb. 3). Auch in der älteren Forschung wurden sie gelegent-lich beschrieben. Schlackenbreccien sind vor-nehmlich mit Luppenreinigungsprozessen, dem sogenannten Ausheizen, zu verbinden; es deu-tet sich an, dass diese zumindest an einem Teil der Verhüttungsplätze direkt vor Ort durch-geführt wurden. Damit verdichtet sich zuneh-mend das Bild einer gleichartig organisierten Montanlandschaft Siegerland. Denn neben den Ausheizprozessen sind auch die Rennöfen bau-
gleich und die Organisationsstrukturen der Werkplätze einheitlich.
Beim derzeitigen Stand der Forschung lässt sich die Herausbildung der Montanland-schaft vor allem ab dem 3. Jahrhundert v. Chr. fassen und zeigt von Beginn an diese Einheit-lichkeit. Die Zahl der Fundstellen lässt bereits früh ein massives Ausgreifen in den Raum er-kennen. Ob zu einem späteren Zeitpunkt (Lt D, 1. Jahrhundert v. Chr.) eine Differenzierung der Tätigkeitsbereiche des Produktionsgebietes stattfand, ist noch nicht eindeutig. Auffallend ist immerhin derzeit das Fehlen von Verhüt-tungsstellen im östlichen Siegerland. Dage-gen sind Schmiedefundstellen dort besonders zahlreich. Bemerkenswert ist der Zeitpunkt
Abb. 2 Entdeckte Fund-stellen (rote Punkte), mon-
tanarchäologische Ver- dachtsflächen (gelb ein-
gekreist) und Höhenweg-trassen (rot gestrichelte Linie) der Begehung des Plangebiets des Indust-rie- und Gewerbeparks
Seelbach (blau gestrichelte Linie) (Kartengrundlage:
DGM 1 NRW; Grafik: DBM, RUB/M. Zeiler).
Arc
häol
ogie
in W
estf
alen
- Lip
pe 2
011
me
TH
od
eN
uN
d P
ro
jek
Te
223
des Entstehens und des Niedergangs der Mon-tanlandschaft. Parallel zur Herausbildung von Siedlungen mit zentralörtlicher Funktion in der Westhessischen Senke und am Südrand des Westerwaldes, lässt sich eine umfangrei-che Stahlproduktion in deren Hinterland be-legen. Auch der Niedergang der Montanland-schaft dürfte mit dem Ende dieser Zentren und damit der Hauptnachfrage nach Eisen und Stahl zu verbinden sein. Es deuten sich somit besonders strukturelle Zusammenhänge als de-terminierende Kriterien des latènezeitlichen Wirtschaftsraums an.
Die Forschungsergebnisse konnten in zwei Projekten einer breiten Öffentlichkeit prä-sentiert werden. So wurde der Heimatverein Achenbach bei der Erstellung eines maßstabsge-treuen Rennofenmodells wissenschaftlich bera- ten. Dieses steht nun nahe einer der wichtigs-ten Fundstellen der eisenzeitlichen Montan-landschaft Siegerland am Engsbachtal. Von hier sind zahlreiche große, birnenförmige Renn-öfen bekannt. Ihre gute Erhaltung hatte einst erstmals eine Rekonstruktion dieser für das Siegerland spezifischen Ofenart möglich ge-macht. Ein Exemplar wurde en bloc geborgen und steht heute im Siegerlandmuseum. Dieses diente primär als Vorlage für das aktuelle Mo-
dell aus wetterbeständigem Material, welches unter der Leitung von Bernd Heinzerling er-stellt und mit einer Informationstafel ausge-stattet wurde. Im Gegensatz zu den bisherigen Nachbauten in der Region ist das Achenba-cher Exemplar den latènezeitlichen Originalen gemäß in den Hang gebaut (Abb. 4). Eine Über-dachung, wie sie häufig auf Grabungen nach-gewiesen wurde, konnte allerdings aus Sicher-heits- und Feuerschutzgründen nicht realisiert werden. Der Ofen ist Teil des im Juni 2011 ein-geweihten Historischen Rundwegs Achenbach, der Natur und Kultur der Region touristisch erschließt.
In Zusammenarbeit mit dem LWL-Mu-seum für Archäologie in Herne wurde seit 2009 neben der Erstellung eines Rennofen-modells auch die Darstellung der prähistori-schen Arbeitsvorgänge während der Verhüt-tung in einem Film realisiert. Beides wurde als die Ausstellungseinheit Siegerland in der archäologischen Ausstellung »Fundgeschich-ten« des Landes NRW gezeigt und wird nach der Landesausstellung seinen Platz in der Dauerausstellung des Deutschen Bergbau-Museums (DBM) finden. Das Modell konn-te in den Werkstätten des DBM unter der Lei-tung von Berthold Brunke und Heinz Schaber
Abb. 3 Schlacken-breccien an Fundplätzen im Siegerland. A– B: Trüllesseifen (B1: Ofenstandort; B2: Schlackenbreccien dem dem Ofen vorgelager-ten Graben); C: Gerhards- seifen; D– E: Minnerbach-tal (D, gestrichelte Linie: Breccie im Bachprofil;E: laterale Ansicht eines Breccienfragments) (Fotos: DBM, RUB/J. Gar-ner, C. Wirth, M. Zeiler).
me
TH
od
eN
uN
d P
ro
jek
Te
Arc
häol
ogie
in W
estf
alen
- Lip
pe 2
011
224
hergestellt werden. Als Vorlage dienten hier vor allem jüngere archäologische Untersu-chungen der Bodendenkmalpflege bzw. des Siegerlandprojektes am Trüllesseifen und an der Wartestraße (Siegen-Niederschelden). Die Besonderheit an diesem Modell ist die Über-dachung, die sogenannte Gichtbühne, über die der Ofen beschickt wurde. Aus Platzgründen war es nicht möglich, eine vollständige eisen-zeitliche Werkstatt mit Röst- und Pochbereich sowie Ausheizplatz museal nachzubilden. Au-ßerdem sind die komplexen Arbeitsschritte während der Verhüttung nicht einfach vermit-telbar. Deswegen wurde auf dem Gelände des Historischen Haubergs Offdilln e. V. unter der Leitung von Heinz Hadem 2009 ein Ver-hüttungsexperiment durchgeführt und unter der Leitung von Matthias Pfetzing (Matoliv CrossMediaAgentur) gefilmt. Der Ofen auf dem Gelände des Freilichtmuseums ist zwar nicht baugleich mit denen der Eisenzeit im Sie-gerland, weist aber ähnliche Abmessungen auf. Das Experiment in Offdiln hat versucht, die bis-lang nachgewiesenen, eisenzeitlichen Arbeits-schritte nachzuvollziehen. Deswegen konnten in dem Film die Ofenreise des Experiments so-wie alle weiteren prähistorischen Tätigkeiten, vom Rösten bis zur Öffnung des abgekühlten Rennofens, veranschaulicht und zudem der enorme Brennmittelverbrauch thematisiert werden.
SummarySurveying of the Iron Age mining landscape of Siegerland, which had been ongoing since 2002, continued in 2011. The overall view af-forded by this type of approach allowed us to discuss the possible existence of standard or-ganisational structures since the beginnings of the productive landscape in the 3rd century BC. Preliminary results from the study were presented to a wide audience with true-to-scale replicas of kilns and the screening of a film showing a smelting experiment.
SamenvattingDe sinds 2002 plaatsvindende prospectie van het mijnlandschap uit de ijzertijd in het Sie-gerland, werd in 2011 voortgezet. Een nade-re beschouwing van alle vindplaatsen samen roept discussie op over uniforme organisatie-structuren vanaf het begin van het productie-landschap in de 3e eeuw v. Chr. Door het op schaal nabouwen van de ovenmodellen en een gefilmd experiment van het smelten van me-taal konden de tussentijdse resultaten aan een breed publiek gepresenteerd worden.
LiteraturThomas Stöllner u. a., Latènezeitliche Eisenwirtschaft im Siegerland: Interdisziplinäre Forschungen zur Wirt-schaftsarchäologie. Vorbericht zu den Forschungen der Jahre 2002–2007. Metalla 16/2 (Bochum 2009). – Jennifer Gar-ner, Der latènezeitliche Verhüttungsplatz in Siegen-Nieder-schelden »Wartestraße«. Metalla 17.1/2 (Bochum 2010). – Siegerländer Heimat- und Geschichtsverein (Hrsg.), Frühes Eisen im Mittelgebirgsraum. Sonderheft Siegerland 87/2, 2010. – Thomas Stöllner/Manuel Zeiler, Zur ei-senzeitlichen Eisengewinnung und neuzeitlichen Haubergs-wirtschaft im Siegerland. Archäologie in Westfalen-Lippe 2010, 2011, 63–65.
Abb. 4 Rennofenmodell Siegen-Achenbach an der
Engsbach (Foto: DBM, RUB/M. Zeiler).