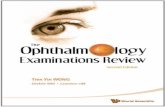Imaging examinations of the patellofemoral joint
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of Imaging examinations of the patellofemoral joint
Orthopäde 2008 · 37:818–834DOI 10.1007/s00132-008-1288-3Online publiziert: 25. Juli 2008© Springer Medizin Verlag 2008
J. Kramer1 · G. Scheurecker1 · A. Scheurecker1 · A. Stöger1 · H. Huber1 · S. Hofmann2
1 Institut für CT & MRT Diagnostik am Schillerpark, Linz2 Allgemeines und Orthopädisches LKH - Stolzalpe
Bildgebende Unter-suchungen des Patellofemoralgelenks
Leitthema
Beschwerden im ventralen Abschnitt des Kniegelenks lassen sich rela-tiv häufig beobachten und sind zu-meist auf ein patellofemorales Fehl-gleiten, posttraumatische Läsionen oder auf chronische Überlastungen am Sehnen- und Bandapparat zu-rückzuführen [1, 2]. Während aku-te Knorpelschäden an Patella und Trochlea zumeist als Folge eines di-rekten Traumas auftreten, sind de-generative Veränderungen des hyali-nen Knorpels hingegen in der über-wiegenden Mehrzahl auf ein patho-logisches Fehlgleiten der Patella zu-rückzuführen. Gerade bei Jugend-lichen und jungen Erwachsenen soll-te daher bei Auftreten von Knorpel-schäden ohne entsprechendes Trau-ma eine biomechanische Abklärung des patellofemoralen Gelenks ins Au-ge gefasst werden.
Schäden an Weichteilstrukturen sind ent-weder direkte Folge eines Traumas oder stellen sekundäre Veränderungen ei-ner chronischen Überlastung dar. Bei der bildgebenden Analyse des „vorderen Knieschmerzes“ sollte daher auf die Eva-luierung hinsichtlich anatomischer Vari-anten des patellofemoralen Gelenks und der Alterationen im Bereich der Weich-teilstrukturen des Streckapparats beson-deren Wert gelegt werden [3, 4].
Radiologische Methoden
Das Röntgenbild (a.-p., lateral) stellt nach wie vor die Basis in der radiologischen
Abklärung von Kniegelenkveränderungen dar und ist heute insbesondere unter Zu-hilfenahme von Spezialaufnahmen (z. B. tangentiale Serien des patellofemoralen Gelenks unter bestimmten Winkeln) im diagnostischen Procedere nicht wegzu-denken. Bei Veränderungen der Weich-teilstrukturen der patellofemoralen Re-gion kommt der Ultraschallmethode ei-ne nicht unwesentliche Bedeutung zu. Sie weist insbesondere bei der Evaluie-rung von Läsionen an der Quadrizeps-sehne bzw. Patellasehne eine hohe Sensi-tivität und Spezifität auf. Die Computer-tomographie (CT) wird heute als Stan-dard für die Bestimmung der Tibiatuber-kel-Trochleagrove- (TT-TG-)Distanz ein-gesetzt und hat zur Feststellung möglicher Fehlrotationen des Beins eine zentrale Be-deutung [5]. In eher seltenen Fällen wird auf die Möglichkeit der Multislice-CT-Ar-thrographie zur Beurteilung des Gelenk-knorpels zugegriffen. Bei der gesamt-haften Abschätzung von pathologischen
Veränderungen an Patella, Trochlea, Mus-keln, Sehnen und Retinacula ist heute je-doch die MRT nicht mehr wegzudenken und sicherlich die Methode der Wahl.
EDie MRT stellt die Methode der Wahl dar.
Patella
Die Patella ist ein großes, im Wesentlichen dreieckig konfiguriertes Sesambein, wel-ches in die Sehnen des Extensormecha-nismus eingebettet ist. Gewöhnlicherwei-se entwickelt sich die Patella aus einem einzigen Knochenkern. Nicht selten wer-den allerdings auch (beginnend etwa um das 3. Lebensjahr) sekundäre Ossifikati-onszentren beobachtet. Ist die Verschmel-zung dieser Knochenkerne unvollständig, so spricht man von einer geteilten Patella (Patella bi-, tri-, multipartita). Eine derar-tige Diagnose ist allerdings erst nach Ab-
Abb. 1 7 Axiales Bild (fettunterdrückte T2-betonte Sequenz). Es zeigt sich eine Patella bipartita. Im Teilungs-
bereich ist der Knorpel durchgehend intakt
818 | Der Orthopäde 9 · 2008
schluss des Wachstums mit Sicherheit zu stellen, da diese Ossifikationen manchmal für einen längeren Zeitraum isoliert blei-ben können und erst verzögert bzw. nach-träglich verschmelzen. Dieser Umstand kann zu diagnostischen Schwierigkeiten nach traumatischen Ereignissen führen. Es ist dann besonderes Augenmerk auf die
Teilungsränder zu richten. Diese sind bei einer Patella partita geglättet und weisen hingegen bei Frakturen in den allermeis-ten Fällen Kanten und Spitzen auf.
Bei einer Patella bipartita ist der kleinere Knochenkern zumeist kraniolateral loka-lisiert []. Lange Zeit wurden multiple Os-sifikationszentren (das am häufigsten an-
getroffene ist die sog. Patella bipartita) als Normvarianten angesehen und man hat ihnen keine wesentliche klinische Signifi-kanz zugebilligt. Mit der Einführung der MRT hat sich hierbei allerdings eine Än-derung ergeben, zumal die MRT die ein-zelnen Gewebekomponenten im Teilungs-bereich (Knorpel, Knochen und fibröses
Abb. 2 8 a,b Unmittelbar benachbarte IR-Bilder, c koronales fettunterdrücktes PD-Bild: Es zeigt sich im Teilungsbereich (a, b) eine Knorpelfissur. c Dreiteilung der Patella (I, II, III)
Abb. 3 9 a T1-betontes sa-gittales SE-Bild, b koro-nales fettunterdrücktes PD-Bild: Es gelangen Frak-turen im Bereich der Patel-la zur Darstellung, welche aufgrund des schrägen Ver-laufs im Nativröntgen nicht mit entsprechender Sicher-heit festgestellt werden konnten
Abb. 4 9 a T1-betontes sa-gittales SE-Bild, b fettun-terdrücktes PD-Bild in sa-gittaler Ebene: Im Bereich der Patella ist ein Knochen-marködem (T1-betont hy-po- und T2-gewichtet hy-perintens) erkennbar. Dar-über hinaus findet sich prä-patellar ein subkutanes Ödem. Diagnose: Kontusi-onsgeschehen
820 | Der Orthopäde 9 · 2008
Leitthema
Gewebe) exakt darzustellen vermag und darüber hinaus auch pathologische Ver-änderungen im Teilungsbereich erkennen lässt. Denn nicht selten zeigen sich näm-lich im Teilungsbereich reaktive Kno-chenmarkveränderungen (in der MRT als sog. „ödematöse Knochenmarkare-ale“ unmittelbar im Anschluss an den Teilungsbereich zu erkennen, .Abb. 1, 2). Diese Knochenmarködeme sind ein Hinweis auf eine Instabilität mit Überlas-tung der benachbarten Knochenstruktu-ren. Darüber hinaus sind damit auch ein-deutig ein diskontinuierlicher Knorpel- überzug bzw. Fissuren oder auch Knorpel-unterbrechungen im Teilungsbereich dia-gnostisch festzuhalten.
Beim Erwachsenen ist die Patella selbst der schwächste Part des Extensormecha-nismus. Patellafissuren bzw. Frakturen lassen sich nicht selten nach direkter Ge-walteinwirkung beobachten. Wenn-gleich bei traumatischen Läsionen im Be-reich der Patella das Nativröntgen an ers-ter Stelle zu setzen ist, so entgehen doch manchmal Frakturen im Bereich der Pa-tella der nativradiologischen Detektion. Man spricht dann von sog. okkulten Frak-turen (.Abb. 3). Deshalb sollte bei Ver-dacht auf eine Patellaläsion bei anhalten-den oder relativ charakteristischen Symp-tomen und negativem Röntgenbild eine MRT zur weiteren Abklärung in Betracht gezogen werden, zumal diese Methode nicht nur Frakturen und Fissuren ein-deutig erkennen lässt, sondern auch Mi-krofrakturen und Knochenkontusionen, die mit keiner anderen radiologischen Methode diagnostiziert werden kön-nen, in hervorragender Weise darstellt. Es kommt nämlich im Rahmen der Kon-tusion zu Frakturen von Trabekeln und Einblutungen sowie Austritt von Flüs-sigkeit. Dies stellt sich in Summe sodann als sog. Knochenmarködem dar, welches zwar unspezifisch ist, zusammen mit der Anamnese allerdings eindeutig als Kontu-sion („bone bruise“) identifiziert werden kann (.Abb. 4)[7, 8].
EEin subchondrales Ödem in der Patella weist auf eine Instabilität, Überlastung der Knochenstrukturen oder einen unterbrochenen Knorpelüberzug hin.
Zusammenfassung · Abstract
Orthopäde 2008 · 37:818–834 DOI 10.1007/s00132-008-1288-3© Springer Medizin Verlag 2008
J. Kramer · G. Scheurecker · A. Scheurecker · A. Stöger · H. Huber · S. Hofmann
Bildgebende Untersuchungen des Patellofemoralgelenks
ZusammenfassungDie Ursachen für Läsionen im Bereich des Fe-moropatellargelenks sind mannigfaltig. Ne-ben traumatischen Ereignissen und chro-nischen Überlastungen sind insbesondere Abnützungen im Rahmen eines Fehlgleitens oder auch entzündliche Erkrankungen zu er-wähnen. Denn nicht selten kommt es da-durch zu frühzeitigen Arthrosen. Eine exakte klinische Abklärung ist bei allen Patienten mit vorderem Knieschmerz und mit Verdacht auf pathologische Kniegelenkveränderungen un-bedingt zu fordern. Zusammen mit der ent-sprechend klinischen Information und Ergeb-nissen radiologischer Untersuchungen lässt sich eine genaue Diagnose erstellen.
Im Rahmen der radiologischen Abklärung des anterioren Knieschmerzes und nach post-traumatischen Ereignissen kommt sicherlich der Magnetresonanztomographie (MRT) ei-ne sehr hohe Wertigkeit zu. Sie erlaubt ei-
ne direkte Darstellung der in Frage kommen-den pathologischen oder verletzten Struk-turen und hilft so, ein suffizientes therapeu-tisches Prozedere zu planen. Darüber hinaus kommt der MRT bei klinischem Verdacht auf eine Läsion oder Verletzung eine nicht unwe-sentliche Bedeutung zu. Sollte sich die Ver-dachtsdiagnose bei unauffälligem MRT-Be-fund nicht bestätigen, kann von einer weit-reichenden Behandlung und insbesondere chirurgischen Eingriffen Abstand genommen werden kann. In diesem Beitrag werden die wichtigsten bildgebenden Verfahren zur Eva-luierung der patellofemoralen Region kurz vorgestellt und insbesondere die Wertigkeit der MRT beschrieben.
SchlüsselwörterPatellofemoralgelenk · Diagnostik · Röntgen · CT · MRT
Imaging examinations of the patellofemoral joint
AbstractLesions in the patellofemoral region can be caused by trauma, chronic overloading, and especially regarding cartilage alterations by normal aging or pathologic processes. Very commonly these lesions lead to early arthro-sis. An accurate clinical evaluation in all these patients is recommended. The combination of clinical information and radiological ex-aminations should end up with an exact di-agnosis.
As part of the radiological evaluation of complaints of the patellofemoral region MR
imaging is of special value since this method allows direct visualization of all intra- and ex-tra-articular structures and their alterations, ultimately aiding in planning sufficient thera-py. Moreover, is it possible to exclude pathol-ogy by MR imaging, which helps to prevent useless treatment and surgical procedures.
KeywordsPatellofemoral joint · Diagnostics · Radiology · CT · MRI
821Der Orthopäde 9 · 2008 |
Patellarer Gelenkknorpel
Im Nativröntgen (a.-p., seitlich und insbe-sondere Tangentialaufnahmen) war man auf indirekte Zeichen wie Osteophyten, Gelenkspaltverschmälerung oder ver-stärkte subchondrale Sklerosierung an-
gewiesen, um pathologische Verände-rungen am Knorpel zu erfassen. Deshalb kam früher auch der Beurteilung der Pa-tellaformen ein besonderer Stellenwert zu, da eine mehr oder weniger von der Norm abweichende Ausformung (Typ I–III nach Wiberg) mit einer erhöhten Prädispositi-
on zu Chondromalazie, Chondropathie und Arthrose einherzugehen schien [9]. Nach heutigem Wissensstand sind jedoch die Kontaktflächen und der Patellalauf die entscheidenden Faktoren für die Entste-hung einer Arthrose [2].
Abb. 5 9 Sagittale Schicht-ebene: a T1-betonte SE-Se-quenz, b IR-Sequenz: An der lateralen Patellafacet-te und ventral am lateralen Femurkondylus zeigt sich ein ausgeprägter Knorpel-schaden. Zudem gelan-gen Zeichen erhöhter sub-chondraler Sklerosierungen sowie kleine Geröllzyst-chen und ödematöse Kno-chenmarkveränderungen (Pfeile) zur Darstellung. Dia-gnose: ausgeprägte, gering aktivierte Femoropatellar-gelenkarthrose
Abb. 6 9 Axiales T1-betontes fettunterdrücktes 3D-GE-Bild, nach intraar-tikulärer Kontrastmittel- (KM-)Applikation (MR-Arthrographie). An der la-teralen Patellafacette nahe dem First zeigt sich ein wenige Millimeter im Durchmesser haltendes Areal, welches im Vergleich zum übrigen Knor-pel auffälligen KM-Enhancement (diffusionsbedingt) aufweist. Der Knorpel ist allerdings noch normal dick und zeigt eine glatte Oberfläche. Diagnose: Knorpelläsion Grad I
Abb. 7 9 Sagittales IR-Bild (a), axiales PD-Bild mit Fett-unterdrückung (b). Am Pa-tellafirst mit Ausdehnung zur medialen und lateralen Facette finden sich zarte Knorpeloberflächenirregu-laritäten (Pfeile). Diagno-se: Chondromalacia patel-lae Grad II
822 | Der Orthopäde 9 · 2008
Leitthema
Neben dem Nativröntgenbild hat man sich mit arthrographischen Techniken (konventionelle Kniearthrographie, CT-Arthrographie) beholfen. Da diesen Me-thoden allerdings doch eine gewisse In-vasivität zu eigen ist, hat man sie groß-teils wiederum verlassen. Lediglich mit der Dünnschicht-CT-Technik und darauf basierenden multiplanaren Rekonstruk-tionstechniken hat neuerdings die Multi-slice-CT-Arthrographie eine gewisse Re-naissance erfahren.
Die Methode der 1. Wahl ist allerdings heutzutage die MRT. Mit ihr lassen sich die Kontaktflächen, Patellalauf und Knor-pelveränderungen direkt darstellen [10]. Zusätzlich erlaubt die MRT auch eine rela-tiv exakte Beurteilung des hyalinen Knor-pels hinsichtlich Dicke und Oberflächen-beschaffenheit und kann in beschränktem Ausmaß auch Aussagen über die Binnen-
Abb. 8 8 Fettunterdrückte PD-Bilder in axialer Schichtung. a An der lateralen Patellafacette ist eine tief greifende Knorpel-fissur (Pfeil) erkennbar. b Anderer Patient: Am Patellafirst an der lateralen Facette ist der Knorpel ausgedünnt und weist be-trächtliche Oberflächenunebenheiten (Fissuren bzw. Ausfransungen) auf. Diagnose: Chondromalacia patellae Grad III
Abb. 9 9 Sagittales IR-Bild (a), axiales PD-Bild mit Fett-unterdrückung (b): Im Fe-moropatellargelenkbereich gelangt sowohl patella- als auch femurseitig (late-rale Patellafacette und First bzw. lateraler Femurkon-dylus ventral) ein Knorpel-schaden (Ellipse) zur Dar-stellung, welcher bis an die subchondrale Grenzlamelle heranreicht, sodass hier der Knochen freiliegt. Diagno-se: Femoropatellargelen-karthrose Grad IV
Abb. 10 9 Sagittales IR-Bild, Patient nach Zustand eines trauma-tischen Ereignisses. Es zeigt sich zentral an der Patella ein rela-tiv großer Knorpelaus-bruch (Pfeil)
824 | Der Orthopäde 9 · 2008
Leitthema
struktur des Knorpels machen. Darüber hinaus lässt sich mittels MRT auch das subchondrale Knochenlager als Funkti-onseinheit mit dem Knorpel in hervor-ragender Weise darstellen. Dadurch wer-den z. B. bei einer aktivierten Femoro-patellargelenkarthrose nicht nur die ent-sprechenden Veränderungen am Knor-pel selbst, sondern auch die reaktiven Knochenmarkveränderungen, die mögli-
cherweise Ursache für die akute Schmerz-symptomatik sind, eindeutig erfassbar (.Abb. 5).
Man hat in der MRT in Anlehnung an die arthroskopische Klassifikation diverse Einteilungen der Knorpelschäden getrof-fen, wobei zumeist folgende Anwendung findet [11, 12, 13, 14, 15]:FGrad I: Der Knorpel weist eine nor-
male Dicke auf und zeigt eine glatte
Oberfläche. Allerdings finden sich Si-gnalalterationen innerhalb des Knor-pels (.Abb. 6).
FGrad II: Es zeigen sich Knorpelfis-suren, welche allerdings relativ auf die Oberfläche beschränkt sind. Es kann hier teilweise auch eine diffuse Knor-peldickeminderung beobachtet wer-den (.Abb. 7).
Abb. 11 7 Sagittales T1-gewichtetes SE-Bild (a), sa-
gittale IR-Bilder (b, c), axi-ales fettunterdrücktes PD-
Bild (d): a,b Am lateralen Femurkondylus zeigt sich
ein ausgeprägtes sub-chondrales Knochenmark-ödem. c Der Pfeil weist auf eine Knorpelabhebung im
kaudomedialen Aspekt der Patella mit angrenzendem Ödem (Kontusionsgesche-
hen im Rahmen der statt-gehabten Patellaluxation) hin. d Zu erkennen ist der
Knorpelschaden sowie ein beträchtlicher Gelenker-
guss mit Schichtungsphä-nomen (Stern)
Abb. 12 7 Axiale fettunter-drückte PD-Bilder: a durch-
gehendes jedoch z. T. auf-fällig signalalteriertes me-
diales Retinaculum (Pfei-le) sowie einen Knorpelde-fekt. b Mediales Retinacu-
lum (Pfeil) ist komplett rup-turiert. Diagnose: Zustand
nach Patellaluxation mit Zerrung des medialen Re-tinaculums (a). b Anderer
Patient – Zustand nach Pa-tellaluxation mit Ruptur
des medialen Retinaculums und ausgeprägtem Gelenk-
erguss
825Der Orthopäde 9 · 2008 |
FGrad III: Fissuren bzw. Knorpelde-fekte reichen bis knapp an die sub-chondrale Grenzlamelle heran bzw. bei alten degenerativen Prozessen ist der Knorpel relativ stark ausgedünnt (.Abb. 8).
FGrad IV: Es fehlt der Knorpel zumin-dest teilweise gänzlich, sodass die subchondrale Grenzlamelle frei zu liegen kommt. Im Falle einer derar-tigen Femoropatellargelenkarthro-se kommt Knochen an Knochen zu liegen (.Abb. 9). Darüber hinaus finden sich verstärkte subchondrale Sklerosezeichen bzw. ödematöse Ver-änderungen. Histologisch lassen sich in diesem Stadium neben Granulati-onsgewebeformationen auch kleine nekrotische Anteile nachweisen [1].
In der heutigen Zeit gilt es nicht nur dege-nerative Knorpelveränderungen mit groß-er Sicherheit und Genauigkeit zu erfas-sen, sondern insbesondere traumatische Knorpel-Knochen-Schäden exakt darzu-stellen (flake fracture), da insbesondere in den letzten Jahren die therapeutischen Möglichkeiten der Refixation oder Repa-ratur eine enorme Verbesserung erfahren haben [17] (.Abb. 10).
Retinaculum
Die Patellaretinacula gehören zu den Komponenten des passiven Stabilisati-onssystems der Patella. Sie teilen sich in eine oberflächliche und eine tiefe Schicht. Das dünne, schräg verlaufende oberfläch-liche Retinaculum verbindet die Patella und das Lig. patellae medial mit der Seh-
ne des M. sartorius und der tiefen Faszie des Beins. Lateral geht sie in die Fascia la-ta über [18, 19]. Die tiefe Schicht läuft von der Patella zum medialen bzw. lateralen Epikondylus und den vorderen Aspekt der Menisken.
Die Retinacula stellen sich auf MRT-Bildern als schmale hypointense Struktu-ren dar, welche vom medialen bzw. late-ralen Patellarand bis hin zum medialen und lateralen Seitenband verfolgbar sind. Die biomechanisch entscheidende Struk-tur stellt dabei das mediale patellofemora-le Ligament (MPFL) dar. In der MRT lässt sich das MPFL von seinem Ursprung am medialen Patellarand bis zum Ansatz am medialen Femurkondylus darstellen. Da-bei ist die Abgrenzung vom oberflächlich gelegenen Retinaculum manchmal nicht einfach. Nach Verletzungen oder Luxa-
Abb. 13 8 a Sagittales T1-betontes SE-Bild, b sagittales TIRM-Bild, c axiales fettunterdrücktes PD-Bild: Patient mit Zustand nach Patellaluxation mit ausgeprägten Knochenkontusionsarealen am lateralen Femurkondylus. c Epikondylus sowie Fraktur bzw. knöchernem Ausriss des medialen Retinaculums (Pfeil)
Abb. 14 9 Sagittale Bilder: a T1-gewichtetes SE-Bild, b IR-Bild. Die Quadrizepsseh-ne (Pfeile) ist deutlich auf-getrieben und signalalte-riert (Flüssigkeitseinlage-rungen). Diagnose: ausge-prägte mukoide Verände-rungen bzw. Partialruptur der Quadrizepssehne, Ge-lenkerguss
826 | Der Orthopäde 9 · 2008
Leitthema
tionen können mit der MRT die betrof-fenen Strukturen hervorragen zur Dar-stellung gebracht werden [20].
Patellaluxation
Zur Erfassung des knöchernen Gleitlagers am Femur eignet sich nach wie vor die Tangentialaufnahme in einem ersten dia-gnostischen Schritt, wobei der Sulkuswin-kel der entscheidende Parameter für eine Trochleahypoplasie darstellt [21]. Die Ein-teilung der Patellahypoplasie erfolgt im streng seitlichen Röntgenbild in 4 Typen
[4, 5]. Mit MRT kann heute die Morpho-logie einfach den verschiedenen Trochlea-typen zugeteilt werden. Dabei zeigt sich bis etwa 0° Beugung zwischen lateralem und medialem Femurkondylus eine deut-liche Einsenkung, die mit zunehmendem Dysplasiegrad verflacht und letztendlich bei schweren Formen der Dysplasie gänz-lich aufgehoben oder sogar leicht konvex geformt sein kann – also Veränderungen, welche eine zunehmende Gefahr für Pa-telladislokationen darstellen [10].
Bei der patellaren Instabilität handelt es sich um ein multifaktorielles Problem,
bei dem 4 Hauptfaktoren (Trochleadys-plasie, Patella alta, pathologischer TT-TG-Abstand und Patella-Tilt) von 4 Neben-faktoren (interne Rotation des Femurs, externe Rotation der Tibia, Genu recur-vatum und Genu valgum) unterschieden werden können [4, 22]. Meist kommt es zu einer lateralen Subluxation oder Luxation [23, 24]. Oft wird dies von Patienten, da es sich häufig um ein transientes Geschehen handelt, nicht in vollem Umfang wahrge-nommen. Bei traumatischen Luxationen kann die Ursache für ein derartiges Ereig-nis eine Verdrehung im Kniegelenk sein, wobei der Femur bei fixiertem Fuß nach innen rotiert wird [25, 2]. Nicht selten al-lerdings wird die Luxation durch ein di-rektes Trauma verursacht.
Eine transiente, laterale Patellaluxation ist aufgrund der unspezifischen Sympto-matik klinisch schwer zu diagnostizie-ren. Sie kann allerdings mittels MRT auf-grund der pathognomonischen Weich-teil- und Knochenveränderungen rela-tiv leicht erfasst werden [27, 28, 29, 30, 31, 32, 33] (.Abb. 11, 12, 13). In typischer Weise kommt es dabei zu charakteristi-schen Knochenkontusionen am lateralen Femurepikondylus und an der medialen Patellafacette [20]. Darüber hinaus las-sen sich zumeist eine Verletzung an den Retinaculumstrukturen, dem MPFL und nicht selten auch pathologische Verände-rungen am patellaren Gelenkknorpel fest-stellen.
Abb. 15 9 Sagittale Bilder: a T1-gewichtetes SE-Bild, b IR-Bild (Pfeile patellana-he Ruptur der Quadrizeps-sehne)
Abb. 16 8 Sagittale Bilder: T1-gewichtetes SE-Bild (a), IR-Bild (b). Das Lig. patellae zeigt ausgeprägte Signalalterationen, wobei lediglich noch der vordere Anteil ein normal hypointenses Signalverhalten aufweist. Diagnose: ausgeprägte Ligamentose des Lig. patellae
828 | Der Orthopäde 9 · 2008
Leitthema
Quadrizepssehnen
Zur Quadrizepssehne, welche am oberen Pol der Patella inseriert, vereinigen sich distal 4 Muskeln: der relativ oberfläch-lich gelegene M. rectus femoris, der tief-er gelegene M. vastus intermedius sowie die Sehnen des M. vastus medialis und la-teralis. Der oberflächliche Anteil der Qua-drizepssehne ist extraartikulär, der hintere tiefe Sehnenanteil ist mit Synovia überzo-gen und liegt somit teilweise intraartiku-lär. Biomechanisch sind die Quadrizeps-sehne und die Patella ein integraler Teil des aktiven und passiven Extensormecha-nismus des Kniegelenks [34, 35]. Während
der Quadrizepsmuskel als aktiver Stabili-sator des Patellofemoralgelenks anzuse-hen ist, sind der Sehnenapparat sowie die Patellasehne, mediales und laterales patel-lofemorales Ligament inklusive menisko-patellare Ligamenta den passiven Stabili-sierungselementen zuzuordnen.
Die häufigste Verletzung des Extensor-apparats stellt die Patellafraktur dar. Aber schon an zweiter Stelle kommen Verlet-zungen an der Quadrizepssehne. Verlet-zungen der Quadrizepssehne werden zu-meist unmittelbar an ihrem Ansatz am oberen Pol der Patella angetroffen [3, 37, 38]. Quadrizepssehnenrupturen können partial oder komplett sein (.Abb. 14,
15). Während bei vollständigen Rupturen eine funktionelle Diskontinuität vor-liegt, kann bei Partialrissen (insbesonde-re wenn das Retinaculum noch intakt ist) teilweise eine aktive Extension gegeben sein. Bei einem derartigen Läsionsmuster wird nicht selten eine frühzeitige suffizi-ente Therapie verabsäumt. Man sollte al-so nicht zögern, bei entsprechendem kli-nischem Verdacht einer Quadrizepsseh-nenläsion eine adäquate Bildgebung zur exakten Abklärung heranzuziehen.
Sowohl mit Ultraschall als auch mit der MRT lässt sich die Sehne im Normal-zustand darstellen. Bei Verletzungen ist mittels dieser Methoden eine präzise An-
Abb. 17 7 Sagittales T1-betontes Bild (a), IR-Bild
(b): Das Lig. patellae ist auf-getrieben und signalalte-riert. Im mittleren Drittel ist zentral auch eine klei-
ne spindelförmige Flüssig-keitsansammlung (Pfeil) er-kennbar. Diagnose: ausge-
prägte Ligamentose mit in-traligamentöser Partialrup-
tur des Lig. patellae
Abb. 18 7 Sagittales T1-betontes SE-Bild (a), sagit-
tales IR-Bild (b): Das Lig. pa-tellae ist unmittelbar im
Anschluss an die Patella be-trächtlich verdickt und si-gnalalteriert. Geringfügig
sind auch die Weichteil-strukturen präpatellar bzw. der Hoffa-Fettkörper in das
Geschehen miteinbezogen. Diagnose: Patellaspitzen-
syndrom
829Der Orthopäde 9 · 2008 |
gabe hinsichtlich Lokalisation, Ausmaß und Grad der Verletzung möglich. Insbe-sondere die MRT zeigt in eindrucksvol-ler Weise die Sehnenstrukturen, seien sie normal oder teilweise oder komplett rup-turiert, wobei auch die Sehnenstümpfe in den allermeisten Fällen von Flüssigkeit umgeben dargestellt sind und evtl. Mus-kel- bzw. Sehnenretraktionen auf dem Bild festgehalten werden [39, 40, 41, 42].
Lig. patellae (Patellasehne)
Die Patellasehne verbindet die Patella mit der Tibia. Sie ist im Wesentlichen eine Fortsetzung von Sehnenfasern des M. rec-tus femoris, entspringt am unteren Pol der
Patella und reicht bis zum Ansatz an der Tuberositas tibiae. In seltenen Fällen kön-nen auch Fasern der Quadrizepssehne über die Patella hinweg verlaufen und sich mit dem Lig. patellae vereinigen.
Rupturen der Patellasehne sind bei ge-sunden Individuen ein äußerst seltenes Ereignis [43, 44, 45]. Kommt es zu einer Ruptur der Patellasehne, so ist diese zu-meist am unteren Patellapol lokalisiert. Ei-ne Patellasehnenruptur ist überwiegend auf einen insuffizienten Heilungsprozess nach Mikrotraumen zurückzuführen. Ähnlich wie bei anderen Sehnen kann es auch bei der Patellasehne im Rahmen systemischer Erkrankungen (z. B. Lupus erythemathodes) oder nach langfristigen
Kortikosteroideinnahmen zu entspre-chenden Alterationen im Sehnengewebe und damit verbundener Schwächung der Sehnenstrukturen kommen, welche letzt-endlich bei Überbeanspruchungen zur Ruptur führen mögen.
Das normale Lig. patellae imponiert auf allen Sequenzen MR-tomographisch hypointens. Im Rahmen einer Schädigung kommt es zum Signalanstieg und eben bei Rupturen zur Konturunterbrechung und entsprechenden Flüssigkeitseinlage-rungen. Zumeist handelt es sich bei einem Patellasehnenriss um das Endstadium ei-ner Tendinosis patellae (.Abb. 16, 17). Sie ist somit der kumulative Effekt repe-titiver Mikrotraumen, einhergehend mit
Abb. 19 9 Sagittale Bil-der: T1-betontes SE-Bild (a), IR-Bild (b). Im Ursprungs-bereich ist die Patellaseh-ne aufgetrieben und mas-siv signalalteriert, wobei le-diglich noch im Randbe-reich normale hypointen-se Faserzüge zur Darstel-lung kommen. Im Bereich der angrenzenden Patella ein ausgeprägtes Knochen-marködem (Pfeil) erkenn-bar. Diagnose: massives Pa-tellaspitzensyndrom mit knöcherner Mitbeteiligung
Abb. 20 9 Sagittale Bil-der: T1-betontes SE-Bild (a), IR-Bild (b). Das Lig. patel-lae ist unmittelbar am An-satz an der Tuberositas ti-bia signalalteriert. Ein Kno-chenmarködem im Ansatz-bereich des Ligaments ist erkennbar. Die Epiphysen-fugen sind noch nicht knö-chern durchgebaut. Dia-gnose: rezenter Morbus Os-good-Schlatter
830 | Der Orthopäde 9 · 2008
Leitthema
Minimaleinrissen, bei welchen eine ent-sprechende Ausheilung nicht zustande kam [4, 47, 48].
EQuadrizeps- und Patellasehne lassen sich sowohl mit Ultraschall als auch mit der MRT darstellen.
Patellaspitzensyndrom („jumper’s knee“)
Teilweise wurden schmerzhafte Verände-rungen an der Patellaspitze im Ursprung der Patellasehne als Tendinitis bezeichnet. Es handelt sich hierbei allerdings um eine Fehlinterpretation, zumal keinerlei Ent-zündungszeichen in diesem Bereich his-tologisch vorzufinden sind. Fakt ist, dass es sich hierbei um eine chronische Über-lastung mit kleinsten Sehnenrissen sowie reaktiven Veränderungen im Rahmen des
Heilungsprozesses handelt (Insertionsten-dinose), welche durchaus auch die Patella-spitze miteinbeziehen können [49, 50].
Eine Patellatendinose lässt sich relativ häufig bei Athleten beobachten, die vor-wiegend Sportarten betreiben, die mit ex-zessivem Laufen und Springen einherge-hen [51]. Es kommt dabei zu einer deut-lichen Verdickung der Patellasehne im Ursprungsbereich, charakterisiert durch Signalalterationen in der MRT bzw. deut-licher Auftreibung (.Abb. 18, 19). Im Sonogramm findet man entsprechend echoarme Sehnenareale, mukoide Verän-derungen bzw. vermehrt Flüssigkeitsein-lagerungen.
EBeim Patellaspitzensyndrom handelt es sich um überlastungs-bedingte kleinste Sehnenrisse.
Sinding-Larsen-Johansson-Syndrom
Im Gegensatz zum Patellaspitzensyndrom wird das Sinding-Larsen-Johansson-Syn-drom bei Jugendlichen bzw. Heranwach-senden angetroffen. Charakteristisch ist ein Schmerz über dem kaudalen Patel-lapol, wobei sich radiologisch manch-mal kleine ossäre Fragmente darstellen. Es dürfte sich hierbei um die Folge eines Traktionsphänomens handeln [52]. MR-tomographisch zeigt sich typischerweise eine Fragmentation am unteren Patella-pol sowie bei akutem Geschehen Signal-alterationen im Bereich der abgehenden Patellasehne.
Abb. 21 9 a Schemazeich-nung mod. nach Insal u. Salvatti. b–d Sagittale T1-betonte SE-Sequenz mit verschieden hoch stehen-der Patella (schwarze Bal-ken): b normal, c tief ste-hende Patella, d hochste-hende Patella
832 | Der Orthopäde 9 · 2008
Leitthema
Morbus Osgood-Schlatter
Ähnlich wie bei den Veränderungen am Sehnenursprung lassen sich auch im Be-reich der Tuberositas tibiae Irregularitäten und ödematöse Veränderungen beobach-ten. Sind derartige Alterationen beim Er-wachsenen äußerst ungewöhnlich, so kön-nen chronische Irritationen beim Heran-wachsenden (speziell bei Individuen, die entsprechenden athletischen Aktivitäten nachgehen) beobachtet werden. Am MR-Bild kommt es dabei zu Signalalterationen und morphologischen Veränderungen in-nerhalb des distalen Sehnenabschnittes in Verbindung mit zarten ossären Verände-rungen im Bereich der Tuberositas tibiae, ähnlich dem Patellaspitzensyndrom [53] (.Abb. 20).
Impingement
Bei Kniebeugung zwischen 20 und 70° be-trägt das Verhältnis Länge des Lig. patel-lae (Patellaspitze bis Ansatz an Tuberositas tibiae) zum kraniokaudalen Durchmesser der Patella zwischen 0,8 und 1,2. Ist dieses Verhältnis >1,2 spricht man von Patella al-ta bzw. ist es <0,8, bezeichnet man es Pa-tella profunda (baja) (.Abb. 21) [5, 54]. Eine isolierte Patella baja kann die maxi-male Flexion einschränken, während ei-ne Patella alta eine Prädisposition für eine patellofemorale Instabilität darstellt.
Manchmal lassen sich Signalalterati-onen im Bereich des kraniolateralen As-pekts des Hoffa-Fettkörpers in der MRT beobachten. Ödematöse Veränderungen in diesem Bereich weisen auf ein patholo-
gischs Geschehen hin, das wahrscheinlich in vielen Fällen durch eine relativ hoch stehende Patella verursacht wird und so-mit durchaus den Ausdruck „infrapatel-lares Fettkörperimpingement“ rechtferti-gt (.Abb. 22) [55, 5].
Dynamische Untersuchung am patellaren Gleitlager
In den letzten Jahren hat man zuneh-mend Augenmerk auf die dynamische Si-tuation der Patella im Rahmen der Knie-gelenkbewegung (Beugung/Streckung) gelegt, da ein pathologisches Gleitmuster der Patella unweigerlich früher oder spä-ter aufgrund der Fehlbeanspruchung zu Abnützungserscheinungen führt. Neben der klinischen Abklärung musste man bis vor nicht allzu langer Zeit mit der Beob-achtung dieses Vorgangs in der Röntgen-durchleuchtung vorlieb nehmen. Neu-erdings ist es, zunehmend aufgrund der technischen Entwicklung der MR-Anla-gen (offene Systeme bzw. relativ große Pa-tientenröhren), auch möglich, zumindest in einem gewissen Umfang dynamische Untersuchungen am Kniegelenk durchzu-führen [57, 58]. Dies hat den Vorteil, dass nicht nur die Lokalisation der knöcher-nen Patella im Bezug zum Femur darge-stellt werden kann, sondern auch die üb-rigen umgebenden Weichteilstrukturen in die Abklärung miteinbezogen und beur-teilt werden können.
EDynamische MRT-Untersuchungen sind in offenen Systemen möglich und werden in Zukunft einen verbesserten Einblick in den patellofemoralen Gleitvorgang vermitteln.
In Zukunft sollten dynamische MR-Un-tersuchungen entscheidende Einblicke in die Pathobiomechanik des patellofemo-ralen Fehlgleitens freigeben und damit neue therapeutische Möglichkeiten er-öffnen. Es handelt sich hierbei allerdings um eine Technik, die noch einiger tech-nischer Verbesserungen bedarf, von der aber künftig eine hohe Wertigkeit hin-sichtlich therapeutischer Konsequenz zu erwarten ist.
Fazit für die Praxis
Die verschiedenen radiologischen Unter-suchungen ergänzen die exakte klinische Untersuchung und ermöglichen meis-tens eine genaue Diagnosestellung. Der MRT kommt dabei eine sehr hohe Wer-tigkeit zu. Zudem ist sie bei der Thera-piewahl (konservativ/operativ) mitent-scheidend.
KorrespondenzadresseProf. Dr. J. KramerInstitut für CT & MRT Diagnostik am SchillerparkRainerstraße 6-8, A-4020 LinzÖ[email protected]
Interessenskonflikt. Der korrespondierende Autor gibt an, dass kein Interessenkonflikt besteht.
Abb. 22 8 a Sagittale T1-betonte Aufnahmen, b sagittale IR-Sequenz, c axiales fettunterdrücktes PD-Bild: a,b Relativ hoch stehende Patella mit ödematösen Veränderungen im Hoffa-Fettkörper kraniolateral (Pfeile). c Auf dem axialen Bild weist der Pfeil auf den ödematös alterierten Hoffa-Fettkörper hin. Diagnose: Impingementsymptomatik in Folge einer hoch stehenden Patella
833Der Orthopäde 9 · 2008 |
Literatur
1. Calmbach WL, Hutchens M (2003) Evaluation of patients presenting with knee pain, Part II. Diffe-rential diagnosis. Am Fam Phys 68(5): 917–922
2. Mihalkov W, Fishkin Z, Krackow K (2006) Patellofe-moral overstuff and ist relationship to flexion af-ter total knee arthroplasty. Clin Orthop Relat Res 451(10): 295
3. Egund N, Ryd L (2002) Patellar and quadriceps me-chanism: Imaging of the knee. Springer, Berlin Hei-delberg New York, pp 217–245
4. DejourD, Le CoultreB (2007) Osteotomies in Patel-lo-Femoral Instabilities. Sports Med Arthrosc Rev 15(1): 39–46
5. Pietsch M, Hofmann S (2006) Wertigkeit derradi-ologischen Bildgebung beim Kniegelenk für den Orthipäden. Radiologe 46: 55–64
6. Mellado JM, Salvadó E, Ramos A et al. (2001) Dor-sal defect on a multi-partite patella: imaging fin-dings. Eur Radiol 11: 1136–1139
7. Yao L, Lee J (1988) Occult intraosseous fracture: detection with MR imaging. Radiology 167: 749–751
8. Mink JH, Deutsch AL (1989) Occult cartilage and bone injuries of the knee: detection, classification, and assessment with MR imaging. Radiology 170: 823–829
9. Dihlmann W (1987) Knie und Tibiofibulargelenk. In: Gelenk-Wirbelverbindungen. Klinische Radiolo-gie einschließlich Computertomographie-Diagno-se, Differentialdiagnose. Thieme, Stuttgart NewY-ork
10. YamadaY, Toritsuka Y, Yoshikawa H et al. (2007) Morphological analysis of the femoral trochlea in patients with recurrent dislocation of the ptella using threedimensional computer models. J Bone Joint Surg Br 89: 746–751
11. Endo Y, Schweitzer ME, Bordalo-Rodrigues M et al. (2007) MRI quantitative morphologic analysis of patellofemoral region: lack of correlation with chondromalacia patellae at surgery. Am J Radiol 189: 1165–1168
12. Vande Berg BC, Lecouvet FE, Maldague B, Malg-hem J (2004) MR appearance of cartilage defects of the knee: preliminary results of a spiral CT ar-thrography-guided analysis. Eur Radiol 14(2): 208–214
13. Recht MP, Piraino DW, Paletta GA (1996) Accuracy of fat-suppressed three-dimensional spoiled gra-dient-echo FLASH MR imaging in the detection of patellofemoral articular cartilage abnormalities. Radiology 198: 209–212
14. Kramer J, Recht MP, Imhof H et al. (1992) Contrast MR arthrogrphy in assessment of cartilage lesions. JCAT 16: 254–260
15. Recht MP, Kramer J, Marcelis S et al. (1993) Abnor-malities of articular cartilage in the knee: Analysis of available MR techniques. Radiology 187: 473–478
16. Zanetti M, Bruder E, Romero J, Hodler J (2000) Bo-ne marrow edema pattern in osteoarthritic knees: correlation between MR imaging and histologic findings. Radiology 215: 835–840
17. Trattnig S, Ba-Ssalamah A, Pinker K et al. (2005) Matrix-based autologous chondrocyte implantati-on for cartilage repair: non-invasive monitoring by high-resolution magnetic resonance imaging. Mag Reson Imag 23: 779–787
18. Warren LF, Marshall JL (1979) The supporting structures and layers on the medial side of the knee: an anatomical analysis. J Bone Joint Surg Am 61: 56–62
19. Conlan T, Garth WPJ, Lemons JE (1993) Evaluation of the medial soft tissue restraints of the extensor mechanism of the knee. J Bone Joint Surg Am 75: 682–693
20. Elias DA, WhiteL, FithianDC (2002) Acute lateral pa-tellar dislocation at MR imaging: Injury patterns of medial patellar soft-tissue retraints and osteo-chondral injuries of the inferiomedial patella. Radi-ology 225: 736–743
21. Smith TO, Davies L, O‚Driscoll ML, Donell ST (2008) An evaluation of the clinical test and outcome measures usedtoassess patellar instability. Knee (Epub)
22. Davies AP, Costa ML, Shepstone L et al. (2000) The sulcus angle and malalignment of the extensor mechanism of the knee. J Bone Joint Surg Br 82(8): 1162–1166
23. Atkin DM, Fithian DC, Marangi KS et al. (2000) Cha-racteristics of patients with primary acute late-ral patellar dislocation and their recovery within the first six months of injury. Am J Sports Med 28: 472–479
24. Spritzer CE, Courneya DL, Burk DL et al. (1997) Me-dial retinacular complex injury in acute patellar dislocation: MR findings and surgical implications. AJR 168: 117–122
25. Cash JD, Hughston JC (1988) Treatment of acute patellar dislocation. Am J Surg Med 16: 244–249
26. Hawkins RJ, Bell RH, Anisette G (1986) Acute patel-lar dislocations. Am J Sports Med 14(2): 117–120
27. Lance E, Deutsch AL, Mink JH (1993) Prior lateral patellar dislocation: MR imaging findings. Radiolo-gy 189: 905–907
28. Hammerle CP, Jacob RP (1980) Chondral and os-teochondral fractures after luxation of the patella and their treatment. Arch Orthop Trauma Surg 97: 207
29. Virolainen H, Visuri T, Kuusela T (1993) Acute dislo-cation of the patella: MR findings. Radiology 189: 243–246
30. Kirsch MD, Fitzgerald SW, Friedman H, Rogers LF (1993) Transient patellar dislocation: diagnosis with MR imaging. AJR 161: 109–113
31. Quinn SF, Brown T, Demlow T (1993) MR imaging of patellar retinacular ligament injuries. J Magn Re-son Imag 3: 843–847
32. Nakanishi K, Inoue M, Harada K et al. (1992) Sublu-xation of the patella: evaluation of patellar articu-lar cartilage with MR imaging. Br J Radiol 65: 662–667
33. Vainionpaa S, Laasonen E, Patiala H et al. (1986) Acute dislocation of the patella: clinical, radio-graphic, and operative findings in 64 consecutive cases. Acta Orthop Scand 57: 331–333
34. Heegaard J, Leyvraz PF, Curnier A et al. (1995) The biomechanics of the human patella during passive knee flexion. J Biomech 28: 1265–1279
35. Huberti HH, Hayes WC, Stone JL, Shybut GT (1984) Force ratios in the quadriceps tendon and liga-mentum patellae. J Orthop Res 2: 49–54
36. Evans EJ, Benjamin M, Pemberton DJ (1991) Vari-ations in the amount of calcified tissue at the at-tachments of the quadriceps tendon and patellar ligament in man. J Anat 174: 145–151
37. Siwek CW, Rao JP (1981) Ruptures of the extensor mechanism of the knee joint. J Bone Joint Surg Am 63: 932–937
38. Scuderi C (1958) Ruptures of the quadriceps ten-don. Am J Surg 95: 626–635
39. Mink JH, Reicher MA, Crues JV III, Deutsch AL (1992) MRI of the knee, 2nd ed. Raven Press, New York, pp 189–236
40. Schweitzer ME, Mitchell DG, Ehrlich SM (1993) The patellar tendon: thickening, internal signal buck-ling, and other MR variants. Skeletal Radiol 22: 411–416
41. Resnick D, Kang HS (1997) Knee: plate 16-9. In: Resnick D, Kang HS (eds) Internal derangements of joints: emphasis on MR imaging. Saunders, Phila-delphia, pp 555–785
42. Sonin AH (1994) Magnetic resonance imaging of the extensor mechanism. MRI Clin North Am 2: 401
43. Kelly DW, Carter VS, Jobe FW, Kerlan RK (1984) Pa-tellar and quadriceps tendon ruptures: jumper‘s knee. Am J Sports Med 12: 375–380
44. Kricun R, Kricun ME, Arangio GA, et al. (1980) Pa-tellar tendon rupture with underlying systemic di-sease. AJR 135: 803–807
45. McMaster PE (1933) Tendon and muscle ruptures: clinical and experimental studies on the causess and location of subcutaneous ruptures. J Bone Joint Surg Am 15: 705–721
46. Davies SG, Baudouin CJ, King JB, Perry JD (1991) Ultrasound, computed tomography, and magnetic resonance imaging in patellar tendinitis. Clin Radi-ol 43: 52–56
47. Kujala UM, Osterman K, Aalto T et al. (1990) L‘incongruenza patellofemorale e‘spesso bilate-rale. J Sports Traumatol Rel Res 12(1): 25–31
48. Scranton PE, Farrar EL (1992)Mucoid degenerati-on of the patellar ligament in athletes. J Bone Joint Surg Am 74: 435–437
49. Motamedi K, Seeger LL, Hame SL (2005) Imaging of postoperative knee extensor mechanism. Europ J Radiol 54: 199–205
50. Hollinshead WH, Rosse C (1985) Textbook of anatomy, 4th edn. Harper & Row, Philadelphia, pp 434–435
51. Colosimo AJ, Bassett FH (1990) Jumper‘s knee: dia-gnosis and treatment. Orthop Rev 19: 139–149
52. Resnick D (2003) Soft tissues. In:Diagnosis in bo-ne and joint disorders, 4th edn. Saunders, Philadel-phia
53. Hirano A, Fukubayashi T, Ishii T, Ochiai A (2002) Magnetic resonance imaging of Osgood Schlatter disease: the course of the disease. Skeletal Radiol 31: 334–342
54. Insall J. Salvati E (1971) Patella position in normal knee joint. Radiology 101: 101–104
55. Hoffa A (1904) Influence of adipose tissue with re-gard to the pathology of the knee joint. JAMA 43: 795–796
56. Saddik D, McNally EG, Richardson M (2004) MRI of Hoffa‘s fat pad. Skeletal Radiol 33: 433–444
57. O‚Donnell P, Johnstone C, Watson M et al. (2005) Evaluation of patellar tracking in symptomatic and asymptomatic individuals by magnetic resonance imaging. Skeletal Radiol 34: 130–135
58. McNally EG, Osterle SJ, Pal C et al. (2000) Assess-ment of patellar maltracking using combined sta-tic and dynamic MRI. Eur Radiol 10: 1051–1055
834 | Der Orthopäde 9 · 2008
Leitthema