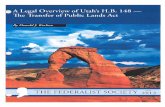Holzkirchen des 18. Jahrhunderts im Glatzer Raum, in: architectura 29 (1999) 121–148
Transcript of Holzkirchen des 18. Jahrhunderts im Glatzer Raum, in: architectura 29 (1999) 121–148
Hinweis:
Die Arbeit von C. Hof ist erschienen als Band 9 der
Reihe >Materialien zu Bauforschung und Baugeschich
te< des Instituts für Baugeschichte der Universität
Karlsruhe:
Catharine Hof, Holzkirchen in Schlesien.
Untersuchungen an Holzkonstruktionen des 16. bis
18. Jahrhunderts in der Woiwodschaft Waldenburg
(488 Seiten, ca. 520 Abb., polnische Zusammenfas
sung) Karlsruhe 1999.
I. >Ein Wald von Holz< jeweils in den Dachwerken der Holzkirchen in Spätenwalde (Zalesie) 1718 und Wölfelsgrund (Mi�dzyg6rze) 1742. Sich wandelnde Formempfinden nahm durch prinzipiell ähnlich konzipierte Dachwerke Gestalt an. Nach den Bauuntersuchungen wurden aber unterschiedliche Überlegungen zu Abbundvorgang und Richttechnik deutlich, die am Modell nachvollzogen werden können.
Cathar ine Hof
Holzkirchen des t8.Jahrhunderts im Glatzer Raum
Vier Beispiele sonderbar individuellen, kleinräumigen Bauens und deren Entwicklungsschritte m der auf gemeinsame Ursprünge zurückzuführenden Dachkonstruktionsweise
Von Bauten, deren Baugestalt und Konstruktion im Vergleich miteinander ihre Entstehung in einem Raum kultureller Überschneidungen zum Ausdruck bringen,
soll hier berichtet werden (Abb. I). Schlesien und das Glatzer Land besitzen als Durch
gangs- bzw. Grenzländer jeweils eine bewegte Geschichte, bestimmt durch die wechselnden böhmischen, polnischen, österreichischen und preußischen Landesherren! (Abb. 2). Im Zeitalter von Reformation und Gegenreformation sowie der mit der Glaubens-
I Das Glatzer Land war 1459 zur Grafschaft erhoben worden, die dann an die unterschiedlichsten Landesherren verpfändet werden sollte, wodurch die eigene geschichtliche Entwicklung geprägt wurde. Das Gebiet der ehemaligen Grafschaft Glatz deckt sich nach der Reform der polnischen Verwaltungsbezirke, die am LL1999 in Kraft getreten ist, mit dem neuen Landkreis Klodzko (Glatz) in der Woiwodschaft Dolnosl,!skie (Niederschlesien). Nach der zuvor geltenden Einteilung von 1975 war das Glatzer Gebiet Teil der Woiwodschaft Walbrzych (Waldenburg). Zur Geschichte des Glatzer Landes seien genannt: Arno Herzig, Reformatorische Bewegungen und Konfessionalisierung. Die habsburgische Rekatholisierungspolitik in
1 2 1
spaltung verbundenen territorialen Streitigkeiten wurden der Bevölkerung nahezu drei Jahrhunderte lang religiöse und politische Um- bzw. Neuorientierungen oder Anstrengungen um ein Festhalten an einer bestehenden Überzeugung abverlangt. Gemeinsam noch standen Niederschlesier und Grafschafter als deutsche Katholiken in den Hussitenkriegen ( 1 426-1437) den böhmischen Taboriten gegenüber. Hundert Jahre später identifizierten allerdings beide offenbar nicht mehr ihr Deutschtum mit dem katholischen Glauben, denn die Lehren Luthers fanden jetzt, im zweiten Viertel des 1 6. Jahrhunderts, großen Zuspruch bei den Menschen2• Die Parallelen der Gangart endeten jedoch im Zuge des stetig wachsenden Druckes der Rekatholisierungspolitik Österreichs mit der Hochphase der Auseinandersetzungen im Dreißigjährigen Krieg ( 1 6 1 8-48). Während die reformierten Schlesier zäh an ihrem Glauben festhielten und dafür große Repressionen auf sich nahmen, gaben die Grafschafter dem sie gewiß viel direkter umklammernden Druck der Truppen Ferdinands 11. nach und wechselten, nach weniger als hundert Jahren protestantischen Bekenntnisses, innerhalb kurzer Zeit und nahezu geschlossen wieder zum katholischen Glauben zurück. So entstanden ab dieser Zeit nur noch katholische Gotteshäuser, wie z. B. die vier Holzkirchen von Steinbach (heute Kamiericzyk) 1 7 10, Spätenwalde (Zalesie) 1 7 1 8, Neuweistritz (Nowa Bystrzyca) 1 726, und genau zum Ende der habsburgischen Zeit noch diejenige in Wölfelsgrund (Mi�dzyg6rze) 1740-423.
1 22
2. Ausschnitt aus Matthäus Merians Karte Silesia (1650); Im rechten Drittel am oberen Rand liegt Breslau (» Breslaw«); Links unten ist der Gebirgszug der westlichen Sudeten (»Risenberg«) dargestellt; Unterbrochen wird dieser von der Hochebene des Glatzer Kessels. »Goltz« bezeichnet die Stadt Glatz
Von deren Konstruktion soll hier im weiteren berichtet werden.
Konstruktionslandschaften im Holzkirchenbau
Die vier genannten niederschlesischen Holzkirchen wurden alle in Blockkonstruktion errichtet. Dies mag zunächst verwunden, da der Blockbau als typisch für Oberschlesien gilt, in Niederschlesien hingegen wurde bekanntermaßen wenn mit Holz, dann in Fachwerk-
der Grafschaft Glatz, Hamburg I996 (Hamburger Veröffentlichungen zur Geschichte Mittel- und Osteuropas; I); Dieter Pohl (Hrsg.)/Joseph Kögler, Die Chroniken der Grafschaft Glatz, Bd. 2, Modautal, I993 (Geschichtsquellen der Grafschaft Glatz; N.F. 21 A); Franz Strecke (Hrsg.), Stadt Habelschwerdt und Umgebung aus der Zeit IOOO bis Herbst I945, Lüdenscheid 2I993·
2 Wie ein »so rechtgläubiges, auf das Papsttum gegen den Ketzerkönig [gemeint ist Georg von Kunstadt auf Podiebrad] eingeschworenes Schlesien mit Luthers Auftreten so abtrünnig werden konnte«, beschreibt Petry ( I987), 43. In der Grafschaft Glatz konnten sich erst um die Mitte des I 6. Jahrhunderts Luthers Lehren gegenüber denen Kaspar von Schwenkfelds und denen der Täufer durchsetzen.
3 Im Ersten Schlesischen Krieg (I740-42) annektierte Preußen auch die Grafschaft Glatz. Friedrich 11. gewährte den Protestanten die Religionsfreiheit, so daß in Niederschlesien unzählige einfache Bethäuser errichtet wurden, um den Bedarf zu decken. In der ehemaligen Grafschaft Glatz ist die Bautätigkeit der wenigen noch vorhandenen bzw. der wiederkehrenden Protestanten viel geringer und zeitlich verzögert. Zu nennen wären etwa die Evangelische Kirche in Habelschwerdt (I825), oder diejenige in Bad Reinerz ( I 845).
11 1111 7r�;��'� K · 0 -
11
� 11
� 11 f::.�� [Uü ,.
. �\;r' . § Blod;bauwcisc �( ;-.1....
?/} L( [IIJ Fachwc:t:bauwcisc + "v o keine Kircben in HoIzbauwcisc aacbweisbar '-,
. Blo::kbau"-e:se
Stande:-bohlen �a:.J \\·e�se
0 rachwerkbau"·eis�
1--"11 I I ! I I I I I I I 10 0 5C :ca km
!
3. Zonierungskarte der Konstruktionsweisen im Holzkirchenbau in Schlesien und seinen angrenzenden Regionen; M 1: 3 000 000
konstruktion gebaut; das gilt auch für die Gebirgsregionen des Riesengebirges. Die bisherige Forschung versäumte allerdings eine nähere Untersuchung des Übergangsbereichs beider Konstruktionsarten. Weder der genaue Verlauf, noch die Ausdehnung der Region mit Überschneidungen in der Baukultur konnten dargestellt werden, da auch keine zusammenhängende Inventarisierung der Kirchen in Holzbauweise vorlag4• Die hier nun gezeigte Karte zur Verbreitung der Konstruktionsweisen im Holzkirchenbau (Abb. 3) verdeutlicht, daß der südliche Teil der ehemaligen Grafschaft Glatz zum reinen Blockbaugebiet gehört. In den nördlichen Landesteilen des Glatzer Beckens kamen neben Blockbauten auch Fachwerkkonstruktionen vor. Diese Zone, in der beide Konstruktionsarten nebeneinander nachgewiesen sind, zieht sich als breites
Band über das östliche Niederschlesien und weiter nach Norden über weite Gebiete Großpolen-Posens5•
4 Eine von der Autorin verfasste wissenschaftliche Arbeit hat sich der Klärung dieser Frage angenommen. Auf der Grundlage eines erstmals erstellten Kataloges, der nahezu 1500 Holzkirchen in Schlesien und in seinen benachbarten Regionen umfaßt, konnte eine Karte der Konstruktionsweisen im Holzkirchenbau erstellt werden. In jener Arbeit werden die Hintergründe, die auf das Bauen Einfluß haben, beleuchtet und die baulichen Besonderheiten der Holzkirchen innerhalb der Übergangsregion, insbesondere die Bildung von Mischkonstruktionen, dargelegt.
5 Der >weiße Fleck< auf der Karte des Holzkirchenbestandes, links der Oder zwischen Katzbach und Glatzer Neiße, in seinem Kern die Kreise Grottkau (Grodk6w) und Strehlen (Strzelin), in dem keine Holzkirchen vorkommen, findet seine Erklärung darin, daß hier die Waldflächen schon seit langem sehr stark zurückgegangen waren, so daß nur der Massivbau nachzuweisen ist.
1 23
a) b) d)
4. Die Baukärpertypen (ohne Anbauten und Dachreiter) der vier Holzkirchen im Glatzer Raum: a) Spätenwalde (Zalesie) 1718, b) Steinbach (Kamiericzyk) 1710, c) Neuweistritz (Nowa Bystrzyca) IJ26, d) Wälfelsgrund (Mi�dzyg6rze) 1742 (Darstellung unmaßstäblich)
Die ausschließliche Anwendung der Blockbauweise im südlichen Glatzer Raum ist bedingt durch die naturgeographischen Einflüsse der Sudeten und die eher bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen in dieser Region. Die Ausformung der Bauweise gibt, wie noch gezeigt werden wird, in manchen Aspekten Zeugnis für die historisch engen Bindungen zur ländlichen böhmischen Baukultur.
Holzkirchen in der Glatzer Region
Die vier Blockholzkirchen, die räumlich höchstens 28 km voneinander entfernt stehen und in einem zeitlichen Rahmen von nur 30 Jahren, also theoretisch einer Generation, entstanden, fallen durch ihre extreme Unterschiedlichkeit der Baukörperformen auf (Abb. 4). Obwohl noch bis in das 1 8. Jahrhundert hinein im ländlichen Bauen des Glatzer Landes die Blockbauweise die übliche Konstruktionsart darstellte, war sie für den Kirchenbau in dieser Zeit keineswegs mehr gebräuchlich, sondern bereits zur Ausnahme geworden. Wenngleich bautechnisch anspruchsvoll und sorgfältig ausgeführt, stellen diese Blockbauten doch hinsichtlich der Baukörperform und der Konstruktionsmerkmale eigenwillige Einzellösungen dar, welche in den Details einer kleinräumigen Handwerkstradition folgen. Jeweils eigenständige Handwerker schufen diese Bauwerke, indem sie sich individuelle Vorbilder suchten und deren Bauformen und Konstruktionsweisen den lokalen Bedingungen anpaßten. Insgesamt
1 24
fällt das Fehlen einer handwerklichen Schule für den Bereich des Holzkirchenbaus in dieser Zeit auf.
Zur differenzierteren Darstellung dieser individuellen Eigenarten, aber auch zur Aufdeckung von Spuren dennoch vorhandener gemeinsamer konstruktiver Vorbilder, sollen die vier Bauwerke zunächst kurz vorgestellt werden.
Die Holzkirche in Steinbach
Die älteste der vier, die Kirche St. Nikolaus (Sw. Mikolaja), im ehemaligen Steinbach, dem heutigen Kamiericzyk, nahe der böhmischen Grenze, wurde 17 10 als schlichte katholische Begräbniskapelle auf dem bereits bestehenden Friedhof errichtet (Abb. 5)6. Noch heute erreicht man die Kirche in Steinbach nur über einen steil ansteigenden Feldweg. Sie ist mit ihrer Längsachse parallel zur Hangkante ausgerichtet und ihr Chor ist nach Nordosten orientiert.
6 Erst im Jahre 1734 (Signatur an der Südempore: A. F. V. 1734) wurde sie von dem Maler Anton Ferdinand V. aus Prag ausgemalt. Im gleichen Jahr erhielt sie eine Glocke, die bis 1851 existierte. Um die Mitte des 1 8. Jahrhunderts wurden aus dem nahegelegenen tschechischen Dorf Wichstadt (Mladkov) der Altar und die Kanzel erworben. Nach Haase erfolgte im Jahre 1868 ein Umbau, nämlich das Anfügen eines »rechten Seitenchores«. Im Jahre 1934 wurde die Holzkirche, kurz vor dem »gänzlichen Verfall«, umfassend instandgesetzt. G. Haase, Das neuerstandene Holzkirchlein in Steinbach, in: Die Grafschaft Glatz. Illustrierte Zeitschrift des Glatzer Gebirgsvereins, Glatz 6 ( 1935), 88f.
5. Holzkirche in Steinbach (Kamierfczyk), 1994
Der Gemeinderaum und der Chor sind zusammengefaßt in einem Einheitsraum mit polygonalem Abschluß des Chores (Abb. 6). Mit ihrem nicht eingezogenen Chor und dem über den gesamten Hauptbaukörper gezogenen Dach besitzt die Holzkirche in Steinbach eine recht einfache Baukörperform. Die Breite dieses Raumes beträgt 7.3 5 m, seine größte Länge 13,4 m. Die dem Bauwerk zugrunde liegende historische Maßeinheit ist die böhmische Elle (ca. 0,59 m)7: Das lichte Längenmaß des gesamten Kirchenbaus beträgt 22 Ellen, wovon 17 auf die geraden Langwände des Versammlungsraumes entfallen und 5 Ellen die Chortiefe bilden. Die lichte Breite der Kirche beträgt 12,5 Ellen.
I
Die drei Seiten des gebrochen Chores sind von uneinheitlicher Länge und ihre Winkel entsprechen nicht denen eines regelmäßigen Vielecks.
Die durchschnittliche Wandbalkendimension beträgt 1 8 x 27 cm, was relativ gering ist, und als Eckverbindung wurde ein einfacher Schwalbenschwanz verwendet, der auch an den älteren Bauteilen der Holzkirche in Wölfelsgrund beobachtet wurde.
Der Kirchenraum ist an drei Seiten von Emporen umgeben. Auf den Emporen finden bis zu 64 Kirchgänger einen Platz, insgesamt bietet die Holzkirche in Steinbach ca. 1 45 Sitzplätze8•
Die Sakristei befindet sich an der Südostseite, also an der rechten Langwand des Kirchenraumes. Sie wurde 1 934 vergrößert, aber ihre ursprüngliche Gestalt läßt sich noch heute an den Spuren am Bauwerk, an der Blockwand und im Dachbereich, ablesen. Bei dem
7 Genau 0,5927 m. Nachgewiesen in Böhmen für die Jahre 1268 und I764. Wilhelm Rottleuthner, Alte lokale und nichtmetrische Gewichte und Maße und ihre Größe nach metrischem System, Innsbruck I 98 5. 24. Die Breslauer Elle (im Jahre I 705 vorgeschrieben in ganz Schlesien, nicht jedoch in der Grafschaft Glatz) und diejenige, die in Österreich-Schlesien von I705-I750 Gültigkeit besaßen, sind mit ihrer gleichen Länge von nur 0,5 76 I m zu kurz.
8 Hossfeld gibt für Dorfkirchen eine übliche Sitzplatzbreite von 0,5 m an. o. Hossfeld, Stadt- und Landkirchen. Berlin 4 I9 I5, 24·
, ::
L _______ ---------- -------------'�I 'II
6. Grundriß der Holzkirche in Stein bach (Kamierfczyk), M 1:200 1 i
125
�,m � " 20 10 0 10
7. Sakristei der Holzkirche in Steinbach (Kamiericzyk), Axonometrie des Anschlusses der alten Blockwand an die neue Ständerkonstruktion
I <J!a
i I
1 26
Umbau wurden die alte Südost- und Nordostwand gegen eine verbretterte Ständerkonstruktion ausgetauscht (Abb. 7).
Die Decke der Kirche ist flach und neigt sich zum Chor hin um 10 cm (Abb. 8). Der Fußboden dagegen fällt vom Eingang des Turmes bis zum Chorende kontinuierlich um 50 cm. Die unterlassene Nivellierung des Baugrundes ist eine besondere Eigenart dieses Bauwerkes. Die Decke im Gemeinderaumbereich ist zu beiden Seiten des Längsunterzuges durch Leisten in jeweils sieben mal vier Felder aufgeteilt und ornamental vegetabil bemalt.
Das Kirchendach, in Form eines Satteldaches mit einem dreiseitigen Walm über dem polygonalem Chorschluß, besitzt eine Neigung von pO (Abb. 9). Es sind keinerlei Abbundzeichen an den Hölzern der Dachkonstruktion vorhanden. Innerhalb des Dachwerkes ist deutlich abzulesen, daß früher ein Dachreiter existiert hat. Seine acht Stiele standen eingezapft auf einem
. ..l
8. Längsschnitt der Holzkirche in Steinbach (Kamiericzyk), M 1 : 2 00
'I'
i I
9. Querschnitt der Holzkirche in Steinbach (Kamiericzyk), M 1:200
Schwellenrost, der noch vorhanden ist (Abb. 1 0). Die kurzen Hölzer des Rostes spannen in keiner Richtung von Außenwand zu Außenwand durch, wie das bei anderen Dachreiterkonstruktionen der Umgebung beobachtet werden konnte.
JO. Axonometrie des Dachwerkes Holzkirche in Steinbach (Kamiericzyk), M J:200
Von den acht Gebinden des einfachen Kehlbalkendaches sind zwei zu Voll gebinden aus gezimmert. Dennoch kann man nicht von einer Binderkonstruktion des Daches sprechen, da die Vollgebinde nicht dazu herangezogen werden, Lasten von den sechs Leergebinden zu übernehmen. Nur die beiden Vollgebinde besitzen Dachbalken, in welche die Sparren eingezapft sind. In der Mitte dieser beiden Dachbalken befinden sich Säulen, die jeweils bis hinauf in den Firstpunkt reichen. Dort werden diese Spitzsäulen von beiden Sparren nichtbündig überblattet und alle drei Hölzer werden durch einen Holznagel gesichert.
Die Sparren der Leergebinde besitzen keine Dachbalken, sondern stehen auf einer Schwelle nur mittels Fersenversatz und Holznagelsicherung auf (Abb. II) .
Die von der eigentlichen Dachkonstruktion unabhängigen, den Kirchenraum nach oben abschließenden Deckenbalken sind mit den oberen beiden Wandbalken verschränkt und verhindern als Ankerbalken das seitliche Ausweichen der Langwände infolge von Sparrenschub. Diese Dachschwellenkonstruktion mit der unterschiedlichen Zahl an Deckenbalken und Dachgespärren ist im nachmittelalterlichen Kirchenbau sehr ungewöhnlich. Dachbalkenlosen Dachkonstruktionen
1 27
sind ursprünglich Bestandteil deckenloser Bauten mit offenem Dachstuhl, bei denen das Umkippen der Wände durch Ankerbalken verhindert wurde. Ostendorf beschreibt das dachbalkenlose Dachwerk als urtümlich germanisches Dach9. Loewe zeigt, daß es die gängige Art der Ausbildung bei den kleineren ländlichen Wohnhäusern Schlesiens war 10. Der Sinn der engeren Deckenbalkenlage im Wohnbau ist darin zu sehen, daß der Dachboden als Lager genutzt wurde und damit höhere Lasten aushalten mußte als die leichten schindelgedeckten Dächer, auf denen aufgrund ihrer Neigung auch keine allzu zu großen Schneernassen Halt finden konnten. Offenbar glaubte man in Steinbach, daß die enger liegenden Deckenbalken auch einen Dachreiter würden tragen können, was sich jedoch wohl schon bald als Trugschluß erweisen sollte.
Die Längsaussteifung des Dachwerkes leistet hauptsächlich ein Mittelwandverband I I. Dieser steht nicht auf den beiden Dachbalken der Vollgebinde sondern auf den Deckenbalken auf. Eine Ausbildung des Mittelwandverbandes, dessen Spitzsäulen gleich einer Hängesäule am Firstpunkt an die Sparren geblattet sind, wogegen der Verband ansonsten aber nur als
I I. Axonometrie des Sparrenfußpunktes mit der Dachschwelle bei der Holzkirche in Steinbach (Kamiericzy k)
1 28
stehend verstanden werden kann, wird von der Verfasserin als Spitzsäulenverband bezeichnetI2•
Von allen hier vorgestellten Holzkirchen ist die Konstruktion des Baus in Steinbach mit ihrem dachbalkenlosen Dachwerk am stärksten dem ländlichen Wohnbau entlehnt. Auch an anderen baulichen Besonderheiten, wie den unregelmäßigen Geometrien von Chorschluß und ehemaligem Dachreiter, wird deutlich, daß die Erbauer der Holzkirche in Steinbach wenig vetraut waren mit einer solchen Bauaufgabe.
Die Holzkirche in Spätenwalde
Die Holzkirche St. Anna (Sw. Anny) in Spätenwalde (Zalesie) wurde 1 7 1 7 als katholische Begräbniskapelle errichtet (Abb. 12) . Der Friedhof, auf dem die Holzkirche steht, ist älter und wurde den Berichten zufolge bereits zu reformatorischer Zeit angelegtI3 •
Das Dorf Spätenwalde liegt ca. 7 km nordwestlich der ehemaligen Kreishauptstadt Habelschwerdt (Bystrzyca Ktodzka). Dem steil ansteigenden Gelände paßt sich die Holzkirche an, die dadurch mit ihrem Chor nach Südsüdosten orientiert ist.
Die Kirche ist als Einraumkirche über rechteckigem Grundriß von der einfachst möglichen Bauform (Abb. 1 3)' Versammlungs raum und Chor sind in einem Kubus untergebracht, jedoch innen durch eine bogenförmig ausgeschnittene Trennwand räumlich vonein-
9 Friedrich Ostendorf, Die Geschichte des Dachwerks, Leipzig, Berlin I908, 6. Ludwig Loewe, Schlesische Holzbauten, Düsseldorf I969, 8.
I I Das Walmdreieck und die nachträglich eingebrachten Windrispen haben, bedingt durch die wenig kraftschlüssigen Verbindungen nur eine untergeordnete längsaussteifende Wirkung.
11 Hierbei wird der Begriff des Stuhles vermieden, da eine Unterstützung der Kehlbalken bei fehlender Überkämmung mit dem Rähm offenbar nicht der Hauptzweck des Längsverbandes ist, sondern vielmehr die Längsaussteifung des Daches.
13 ]oseph Kögler, Historische Nachrichten von der Pfarrkirche des hl. Erzengels Michael in der Königlich Preußischen Immediat-Stadt Habelschwerdt wie auch von allen übrigen Kirchen und Kapellen (nach Aufzeichnungen von I804) in: Vierteljahreszeitschrift für Geschichte und Heimatkunde der Grafschaft Glatz, Habelschwerdt I (I88I/82), I05 .
[2. Holzkirche in Spätenwalde (Zalesie), [993
ander abgesetzt (Abb. 1 4)14. In der Verlängerung des Chores liegt die Sakristei. An der gegenüberliegenden Querwand befindet sich, durch eine Vorhalle geschützt, die einzige Tür zur Kirche. Der Versammlungsraum besitzt eine Querempore, die eine Orgel trägt. Auf den in engen Reihen aufgestellten Sitzbänken des Gemeinderaumes haben 96 Besucher Platz, dazu 34 auf der Empore. Mit 130 Plätzen bietet die Kirche in Spätenwalde die geringste Anzahl an Sitzmöglichkeiten der hier untersuchten Kirchenbauten 15. An den baulichen Veränderungen, welche in dieser
Abhandlung nicht im einzelnen erläutert werden sol-
len, ist zu erkennen, daß die Orgel erst nachträglich eingebaut worden ist. Von Berichten und historischen Aufnahmen in Form von Fotografien und Plänen wissen wir, daß auch die Vorhalle Änderungen unterlag und daß eine Kammer ehemals außen an der rechten Langwand angebaut war.
Die lichten Grundrißmaße der Gesamtfläche von Versammlungsraum und Chor betragen ca. 13,42 X 7,45 m. Die Maßeinheit, das der Holzkirche in Spätenwalde zugrunde gelegt wurde, beträgt ca. 0,6 m und ist vor allem am Schema des Bildprogrammes der Decke, aber auch an den Bodenplatten ablesbar. Es kann gewiß angenommen werden, daß es, wie bei der Holzkirche in Stein bach, auf der böhmischen Elle mit etwas mehr als 0,59 m beruhtl6. Die Wandbalken sind im Mittel 22 cm breit und
weisen eine Höhe von ca. 28 cm auf. Die Balken der Chorscheidewand sind dagegen etwas schwächer dimensioniert und haben eine durchschnittliche Breite von 20 cm. Der Eckverband wird aus einer Kombina-
14 Der bogenfärmige Ausschnitt der Chorscheidewand entspricht einem akkuraten Halbkreis mit einem Radius von 2,82 m.
15 In der Kirche in Wälfelsgrund finden 270 Kirchgänger einen Sitzplatz, also mehr als doppelt so viele. Die Sitzplatzbreite wird mit 0,5 m berechnet. S. Anm. 8.
16 Vgl. Anm. 7.
� � ________ _____________________ L __ __ _____ _ ___ _ ____________ ______ I
[3. Grundriß der Holzkirche in Spätenwalde (Zalesie), M [:2 00 I i
."
1 29
14. Querschnitt der Holzkirche in Spätenwalde (Zalesie), M 1: 2 00
tion von einem Hakeneckblatt und einem Eckkamm gebildet (Abb. 1 5)'
Die flache Decke ist im Versammlungsraum und Chor gleich hoch, und ein Längsunterzug unterstützt die Deckenbalken (Abb. 1 6). Durch Leisten wird die Deckenfläche in gleichmäßige quadratische Felder geteilt, deren Lage in den wenigsten Fällen der Lage der Deckenbalken entspricht. Aufeinanderfolgende Szenen der Bibel bilden die Motive des Bildprogrammes der bemalten Decke.
Auf ihrer Innenseite sind die Wände mit einem Kalkanstrich überzogen. Die Kalkschlemme trägt nicht so
1 30
15. Holzkirche in Späten walde (Zalesie), Axonometrie des Eckverbandes
stark auf wie ein Putz, so daß die Wandbalken durch Unebenheiten und Risse erkennbar bleiben. Die Wandbalken besitzen auf ihren Innenseiten noch einen relativ großen Anteil an Waldkantenl7. Dadurch entstehen breite, tiefe Fugen in den Blockwänden entlang den Balkenlagen, und in kurzem Abstand von 1 0-15 cm sind an den abgerundeten Kanten jedes Balkens kleine Hartholznägel eingeschlagen. Sie bieten der Kalkschlemme, die zugleich Fugendichtung ist, Haltl8.
Die Holzkirche besitzt ein Walmdach mit zwei sehr steilen Walmabschlüssen. Die Neigung des Daches beträgt an den Sattelflächen 54°. Ein sehr hoher, schlanker, achtseitiger Dachreiter bekrönt das Dach, dessen oberen Abschluß ein kegelartiger Helm bildet.
Im konstruktiven Sinne handelt es sich um ein doppeltes Kehlbalkendach, also um ein Sparrendach. In dem Dachwerk sind keine Abbundzeichen vorhanden, was bei der doch sehr komplexen Konstruktion verwundert (Abb. I) .
[7 Wie die Balken auf der Außenseite ausgebildet wurden, konnte wegen der Verschalung nicht festgestellt werden.
[8 Deutschmann berichtet von Holzkeilen als Putzträger und als Träger der Lehmfugendichtung an den Wandaußenseiten. Diese Dichtungstechnik sei von Nordböhmen bis in den Spreewald verfolgbar. Eberhard Deutschmann, Lausitzer Holzbaukunst unter besonderer Würdigung des sorbischen Anteils, Bautzen 1959,74.
16. Längsschnitt der Holzkirche in Spätenwalde (Zalesie), M 1 : 2 00
Mit wenigen Worten sollen im folgenden nur die Hauptkomponenten der Dachkonstruktion umrissen werden:
Die Dachkonstruktion besteht aus einem Bindersystem mit vier Leer-, vier Voll- und vier Turmgebinden, die eine eigene Form der Vollgebinde darstellen. Zwei Walmgespärre bilden zu beiden Seiten den Abschluß des Dachwerkes. Außerhalb der Turmgebinde wechseln Voll- und Leergebinde einander stets ab. An den Fußpunkten sind die Sparren in ihrer Position oberhalb der Langwände ohne Holznagelsicherung in die Dachbalken gezapft (Abb. 17).
Die Vollgebinde des Dachwerkes (Abb. 18) besitzen als wesentliches Element Hängesäulen in den Mittelachsen. Am Firstpunkt sind die Sparren, wie im Dachwerk der Holzkirche in Steinbach, zu beiden Seiten
17. Axonometrie des Sparrenfußpunktes mit der Dachschwelle bei der Holzkirche in Spätenwalde (Zalesie)
13 1
18. Querschnitt durch das Dachwerk der Holzkirche in Spätenwalde (Zalesie), M 1:200
19. Dachreiter- Turmquerbinder der Holzkirche in Spätenwalde (Zalesie)
20. Mittelwandverband (Hängesäulenverband) der Holzkirche in Spätenwalde (Zalesie)
132
angeblattet, und alle drei Hölzer sind mit einem Holznagel verbunden. Außer den Bügen besitzen die Vollbinder noch drei weitere Strebenpaare: Zwei setzen an der mittleren Hängesäule an und verlaufen unterschiedlich steil nach unten außen. Das dritte Strebenpaar ist umgekehrt geneigt. In den Vollgebinden überlagern sich demnach mehrere Tragwerkprinzipien. Es soll hier ein besonderes Augenmerk dem dritten Strebenpaar, dem von der Hängesäule zu den Sparren ansteigenden, zukommen. Seine Wirkungsweise ist nicht eindeutig bestimmbar. Einerseits hängen die Streben als auf Zug belastete Bänder die mittlere Hängesäule sowohl an die Sparren, wie auch an das obere Strebenpaar und den Kehlbalken. Eine solche zusätzliche Aufhängung der mittleren Säule ist dann erforderlich, wenn diese nicht ausschließlich am Holznagel im First hängen soll. Allerdings ist für ein Hängeband der Winkel sehr flach gewählt und außerdem ist der Punkt der Aufhängung am Sparren, in Feldmitte zwischen den Kehlbalkenunterstützungen, ungünstig. Besser wäre er in der Nähe des Kehlbalkenanschlusses angebracht, da hier der Kehlbalken die Durchbiegung der Sparren verhindern würde. So ist andererseits an eine Deutung als Druckstreben zu denken, nämlich als Zwischenunterstützung der Sparren in Feldmitte zwischen den Kehlbalken. Die leichte Eindeckung des Daches mit Holzschindeln, und die infolge der Steilheit des Daches geringe Schneebelastung, läßt diese Interpretation wiederum als übertriebene Vorsicht erscheinen.
Die Turmvollgebinde im Bereich des Dachreiters gehören in gleichem Maß zur Dach- wie zur Turmkonstruktion (Abb. 19), was eine besondere Eigenart diese Dachkonstruktion ist.
Für das doch noch relativ kleine Dachwerk ist die große Zahl von sieben Längsverbänden zu unterscheiden, die drei verschiedenen Funktionen zuzuordnen sind. Es handelt sich dabei um zwei seitliche Stuhlwände, einen Mittelwandverband und vier Turmlängsbinder. In den Kreuzungspunkten der Längs- und Querbinder befinden sich die mit beiden Ebenen verstrebten Stuhl- und Mittelwandverbandssäulen, so daß die Gesamtheit der Hölzer ein räumliches Fachwerkgitter bilden. Von den sieben längsgerichteten Zimmereinheiten soll nur eine genauer betrachtet werden: Der Aufbau des Mittelwandverbandes zeigt deutlich, daß dieser
auch Teil der Dachreiterkonstruktion ist. Im Bereich des Dachreiters sind die Stützen enger gestellt und nach oben über die Firstlinie hinaus geführt - auch hier also haben wir wieder die Vernetzung von Längs-und Querträgern zu einem räumlich wirkenden Fachwerkgitter (Abb. 20). Dieser Längsverband ist, nach der oben dargelegten Analyse der Hängesäulen als Teil der querspannenden Vollgebinde, in seinen Details so ausgebildet, daß seine Last von den Erbauern als an die Sparren der Vollgebinde gehängt verstanden worden sein muß.
Der Mittelwandverband des Dachwerkes der Holzkirche in Spätenwalde kommt damit dem bekannten Prinzip mittelalterlicher Dachwerke des deutschen Ostens recht nahe19. Der Hängesäulenverband allgemein dient hauptsächlich der Längsaussteifung eines Daches. Um die Dachbalken nicht zusätzlich durch das enorme Eigengewicht des Längsverbandes zu belasten, ist dieser an die Sparren gehängt. Die Kehlbalken- und mehr noch die Dachbalkenunterstützung ist beim Hängesäulenverband zwar meistens in Ansätzen gegeben, aber von untergeordneter Bedeutung.
Bei der Holzkirche in Spätenwalde ist insgesamt, anders als in Steinbach, ein großer Kontrast zwischen der schlichten Form des Blockbaus auf der einen Seite und dem Dachwerk mit einer sehr komplexen Konstruktion auf der anderen Seite feststellbar. Die Spätenwalder Kirche zeigt einige Parallelen zu den schlichten Holzkirchenbauten der böhmischen Utraquisten (Hussiten)20, was vor allem die einfache Baukörperform, das Vorhandensein eines Dachreiters und die Fugenabdichtung mit Kalkmörtel betrifft.
Die Holzkirche in Neuweistritz
Die katholische Kirche Maria Himmelfahrt (Wniebowzi�cia NP Marii) in Neuweistritz (N owa Bystrzyca) wurde 1726 erbaut (Abb. 2 1 ), also nur neun Jahre nach jener im nur drei Kilometer entfernten Spätenwalde2l. Dennoch könnten die beiden Bauwerke, wie im folgenden deutlich werden wird, kaum unterschiedlicher sem.
Die Holzkirche in Neuweistritz steht parallel zum
Hang und ist nach Nordosten ausgerichtet. An ihren nur wenig langrechteckigen Gemeinderaum schließt sich ein leicht eingezogener, fast quadratischer Chor an
2 I. Holzkirche in Neuweistritz (Nowa Bystrzyca), 1996
(Abb. 22). Chor und Versammlungs raum liegen unter einem Dach mit durchlaufendem First und nahezu gleicher Traufhöhe. In Verlängerung der Kirchenachse befindet sich hinter dem Chor die Sakristei, und am anderen Bauwerkende ist dem Versammlungsraum eine Eingangshalle vorgelagert.
Von den hier vorgestellten Kirchenbauten ist die Holzkirche in Neuweistritz die größte. Von den 255 Sitzmöglichkeiten der Kirche befinden sich 6 1 auf der Empore und 24 im Obergeschoß der Vorhalle22• Das lichte Längenmaß, gemessen von der Eingangswand des Gemeinderaumes bis zur Chorschlußwand, beträgt 17,52 m. Hiervon entfallen auf den Gemeinderaum
19 Dargestellt bei Josef Bronner, Zur konstruktiven Entwicklung der Dachstühle auf Breslauer Kirchen und Monumentalbauten. Breslau, TH, Diss., I 93 I, und bei Fritz Heyn, Die Danziger Dachkonstruktionen. Ihre konstruktive und historische Entwicklung, Danzig, T H, Diss., I9I3. Nur wenige Holzkirchen sind im benachbarten Böhmen erhalten geblieben, so etwa diejenige in Slavonov (deutsch: Slawoniow). Der Kirche in Spätenwalde muß vor allem die ehemalige Holzkirche in Zalesni Lhota u Jilemnice (deutsch Huttendorf bei Starkenbach) sehr ähnlich gewesen sem.
21 Sie besaß als einzige der vier hier beschriebenen Holzkirchen einen Vorgängerbau. Dieser wurde I63I, also während des Dreißigjährigen Krieges, aber noch kurz vor den massiveren Kampf- und Plünderungszügen kaiserlicher und schwedischer Truppen durch die Grafschaft Glatz, erbaut. Kögler a. a. 0., I06. Die Sitzplatzbreite wird mit 0,5 m in Rechnung gestellt, vgl. Anm. 8.
1 3 3
10,55 m, auf den Chorbereich 6,72 m und auf die Projektion der Chorscheidewand 0,25 m. Der Versammlungsraum der Kirche ist 8 ,94 m, der Chor etwa 6,3° m breit. Das entspricht recht genau einem Verhältnis von sieben zu fünf. Weitergehende maßliche Beziehungen in der Grundrißdisposition sind, anders als bei den drei anderen Holzkirchen, nicht feststellbar.
Recht mächtige Wandbalken mit Abmessungen von 22 X 3 2 cm sind mittels Hakeneckblatt oder Eckkamm zur Blockwand verzimmert23 •
Die Form des Chorbogens entspricht einem Ellipsenausschnitt (Abb. 23). Ein Zementputz überzieht heute die flache Decke ebenso wie die Wände im Inneren. Die nicht unterteilte, in früheren Zeiten bemalte24 Deckenfläche ist heute weiß angelegt und in der Raummitte ist ein schlichtes Kreuz dargestellt.
Die Kirche besitzt eine Querempore, auf der eine Orgel steht. Die Orgel wurde nachträglich eingebaut, wofür die Empore umgebaut werden mußte. Die Konstruktion der Empore ist durch den Orgeleinbau völlig überlastet und stark deformiert. Die Kirchenbänke auf der Empore stehen sehr gedrängt und steigen tribünenartig zur Eingangswand hin an (Abb. 24).
Die Holzkirche hat ein Walmdach, dessen First, wie erwähnt, über Gemeinderaum und Chor in einer Höhe
durch läuft. Da die Überstände der Dachbalken über dem Chor und über dem Versammlungsraum jeweils fast gleich sind, ergibt sich im Chorbereich eine etwas steilere Dachneigung von 57° gegenüber 5 1° beim Dach des Versammlungsraumes (Abb. 25). Ein sehr wuchtiger achtseitiger Dachreiter mit Zwiebelhaube und Laterne ragt aus dem Schiffdach. Auf den Hölzern des Daches über dem Versamm
lungsraum wurden, anders als in den Dachwerken der Holzkirchen in Steinbach und Spätenwalde, Abbundzeichen in Form von Ruten und Stichen beobachtet.
Das konstruktive Grundkonzept ist das eines Sparrendaches in der Ausformung als einfaches Kehlbalkendach. Neben den Leergebinden gibt es noch unterschiedlich stark ausgezimmerte Binder des Daches und der Dachreiterkonstruktion. Da das Dachwerk deutlich in die Bereiche über dem Versammlungsraum bzw. dem Chor geteilt ist, werden hier nun diese getrennt betrachtet:
23 Vgl. die Eckverbände der Holzkirchen in Spätenwalde (Zalesie) und Wölfelsgrund (Mi�dzyg6rze). Während bei der Kirche in Neuweistritz der Haken an der Hirnholzseite nach unten weist, ist es bei den anderen beiden Holzkirchen umgekehrt.
24 So beschrieben bei Kögler a. a. 0., 106.
-+1 I .L 22. Grundriß der Holzkirche in Neuweistritz (Nowa Bystrzyca), M 1 :200
1 34
Das Dachwerk über dem Chor besitzt ein Vollgebinde und drei Leergebinde. In der Mitte des Vollbinders steht eine Stütze, die Teil einer nur sich über den Chorbereich erstreckenden, mittleren Stuhlwand ist. Das längsverlaufende Rähmholz liegt direkt unterhalb der Kehlbalken, die, was ganz außergewöhnlich bei den hier behandelten Dachwerken ist, mit langen Holznägeln an diesem befestigt sind.
Das Dachwerk über dem Versammlungsraum besitzt neun Gebinde, die sich in drei Gruppen einteilen lassen: neben drei Leergebinden und zwei Vollgebinden sind vier Turmgebinde vorhanden, die wiederum anders ausgezimmert sind als die beiden normalen Vollgebinde. Es gibt keinen gleichmäßigen Rhythmus im Bindersystem.
2 3. Querschnitt der Holzkirche in Neuweistritz (Nowa Bystrzyca), M 1:2 00
=-!
�<-----�-----�-----�------�o-- .-----�._---�-ii Ir I1 :\ �
, '" j"'1
24. Längsschnitt der Holzkirche in Neuweistritz (Nowa Bystrzyca), M 1:2 00
Al
j, ""i
.J..:
-+-t++t+ti ---+--+-+-+---+--+-+-+.1
2 5 . Querschnitt des Dachwerkes der Holzkirche in Neuweistritz (Nowa Bystrzyca), M 1:2 00
Die Vollgebinde bilden die beiden Abschlußgebinde des Schiffdachwerkes. In diesen beiden Ebenen stehen seitlich jeweils zwei Stuhlstützen auf Längsschwellen. Den Stuhlstützen sind Längsrähme aufgezapft, auf denen die Kehlbalken ruhen, welche zwar stumpf auf den Rähmhölzern aufliegen, jedoch durch seitlich eingeschlagene und noch weit vorstehende Holznägel in ihrer Position gesichert sind.
Das Dachwerk der Holzkirche in Neuweistritz besitzt keinen sich über die gesamte Dachlänge erstrekkenden Mittelwandverband, wie er in den anderen hier beschriebenen Dachkonstruktionen anzutreffen ist: Über dem Chorbereich ist die erwähnte mittlere Stuhlwand vorhanden, während über dem Gemeinderaum zwei seitliche Stuhlwände (die zugleich die äußeren Längsbinder der Dachreiterkonstruktion darstellen) und zwei innere Längsbinder des Dachreiters stehen25. Die Stuhlwände dienen der Längsaussteifung des Tur-
mes und des Dachwerkes und nicht in erster Linie der Kehlbalkenunterstützung, da diese, bedingt durch ihre hohe Lage, recht kurz sind. Ungewöhnlich in diesem Dachwerk ist die Holznagelsicherung der Kehlbalken an den Stuhlrähmen, was der Wirksamkeit der Längsaussteifung zugute kommt. Im Dachbereich über dem Gemeinderaum werden sie zwar nur seitlich durch die vorstehenden Nägel gehalten, aber im Bereich des Chordachwerkes sind die Kehlbalken regelrecht festgenagelt.
Bei einem Vergleich der beiden sich sowohl räumlich, wie zeitlich sehr nahestehenden Dachwerke der Holzkirchen von Spätenwalde und Neuweistritz überrascht ihre Verschiedenheit. Angesichts des Aufwandes, der in dem erstgenannten Kirchenbau betrieben worden ist, um mit hängenden Konstruktionsgliedern einen Großteil der Last möglichst direkt auf die Außenwände zu leiten und die Dachbalken dadurch zu entlasten, ist es erstaunlich, mit welcher Unbekümmertheit im Dachwerk von Neuweistritz die Lasten des wuchtigen Turmes (der als einziger Turm der hier betrachteten Dachwerke zwei Stützenkränze besitzt) fast ausschließlich auf die Dachbalken gestellt wurden, welche nicht einmal einen Längsunterzug zur Unterstützung erhielten. Daß dies auf Dauer für die Dachbalken eine zu hohe Belastung darstellte, zeigt das Hängewerk, das zu deren Entlastung eingesetzt werden mußte6.
Die Holzkirche in Neuweistritz hat im Laufe der Zeit keine gravierenden baulichen Veränderungen erfahren. Einiges weist aber darauf hin, daß ursprünglich mit ihr ein Massivbau imitiert werden sollte. So besitzt die nichtverschalte Sakristei noch Reste einer außen flächig aufgebrachten Tünche. Ältere Innenaufnahmen zeigen im Chorbereich ein aufgemaltes Steinquaderfugenbild und naiv gemalte, stark stilisierte ionische Säulen in den Ecken, die ein ebenfalls gemaltes Architravband tragen27.
25 Das die Dachbalken aufhängende doppelte Hängewerk nahe der Mittelachse wurde nachträglich eingebaut.
26 Die Kirchendecke von Neuweistritz besitzt nicht einmal einen Unterzug, wie die anderen hier behandelten Bauten, und damit überspannen ihre Dachbalken als Einfeldträger die gesamte Raumbreite von 9, I 6 m.
27 Jörg Marx, Grafschaft Glatzer Kirchen in Bild und Wort, Leimen/Heidelberg I967, Abb. auf S.57.
Die Holzkirche in Wölfelsgrund
Die katholische Holzkirche St. Josef (Sw. J6zefa) in Wölfelsgrund (Mi�dzyg6rze), wurde in den Jahren 1749-1742 errichtet (Abb. 26). Sie entstand also in der Schlußzeit der österreichi
schen Herrschaft und ist die jüngste noch bestehende Holzkirche in diesem Raum. Ein Dokument aus dem Jahre 1742, das im Zuge einer Neueindeckung des Daches im Jahre 1 924 im Knauf der Dachreiterspitze entdeckt worden war, gibt einige Aufschlüsse über die Errichtung der Kirche28• Vor allem nennt das Dokument als die »Baumeister« der Kapelle den Freirichter Franz Teuber, der das Grundstück geschenkt hatte, sowie Friedrich Keitig aus Wölfelsdorf (Wilkan6w) und Heinrich Ludwig aus dem benachbarten Plomnitz (Plawnica) Der Herkunftsort Friedrich Keitigs ist bei der Betrachtung der Holzkirche in Wölfelsgrund, wie im Abschluß noch zu zeigen sein wird, von besonderem Interesse.
Der Ort Wölfelsgrund liegt ca. 1 2 km südöstlich der ehemaligen Kreishauptstadt Habelschwerdt (Bystrzyca Ktodzka). Das Dorf befindet sich von Wald umgeben in einem Hochtal zwischen dem Glatzer Schneeberg (Snieinik Ktodzki) und Maria Schnee (Maria Snieia). Die Kirche steht auf dem von einer Mauer umgebenen Friedhof und ist mit seinem Chor nach Nordnordost ausgerichtet.
Der Bau überrascht beim ersten Anblick durch seine langgestreckte Form. Sein Gemeinderaum ist fast genau doppelt so lang wie breit, und die an der Eingangsseite angebaute Vorhalle vergrößert diese Längenausdehnung noch (Abb. 27). Die recht große Kirche bietet heute 275 Gläubigen einen Sitzplatz, wovon sich 54 auf den Emporen befinden29• Die lichte Raumlänge bis zur Chorscheidewand des langgestreckten Versammlungsraumes beträgt 1 5,75 m. Bei einer Breite von 7,9 m ergeben diese Maße recht genau das Verhältnis zwei zu eins. Der jeweilige Anteil von Chor und Versamm
lungsraum an der Gesamtlänge beträgt 5,3 8 m bzw. 1 0, 1 2 m. Ähnlich wie bei der Kirche in Spätenwalde ist auch in Wölfelsgrund die böhmische Elle30 mit etwas über 0,59 m als Maßeinheit feststellbar. Werden die Maße am Bau durch diese Größe dividiert, so ergibt sich folgendes: Die Gesamtlänge des ursprünglichen
26. Holzkirche in Wölfelsgrund (Mi�dzyg6rze) 1995
Kirchenbaus, d.h. der Bereich des flachgedeckten Versammlungsraumes, beträgt 2 8 Ellen. Davon entfallen 1 8 Ellen als Außenmaß für die Länge des Gemeinderaumes und 1 0 Ellen von der Chorraumseite der Chorscheidewand bis zur Außenseite der Chorabschlußwand. Der Radius des das Chorpolygon umschreibenden Kreises beträgt 3 Ellen. Die Gesamtbreite der Kirche beträgt 1 4 Ellen. Hiervon entfallen 6 Ellen auf die lichte Chorbreite und jeweils 4 Ellen auf die seitlich anschließenden Wände des Versammlungsraumes. Die Holzkirche in Wölfelsgrund ist baulich stark ver
ändert worden, was im folgenden nur in den wesentlichen Teilen aufgezeigt werden soll.
Der Versammlungsraum ist deutlich wahrnehmbar in zwei Teile gegliedert: zum einen in den kürzeren Abschnitt des Bereiches der Orgelempore mit einer Tonnendeckung, bei dem es sich um eine jüngere Bauerweiterung handelt, und zum anderen in den Bereich
28 Charlotte von Radecke, Wölfelsgrund in alter und neuer Zeit, Habelschwerdt 1926,20-24 und 25-28. Sie gibt beide Dokumente im originalen Wortlaut und in voller Länge wieder.
29 Zugrunde gelegt ist eine Sitzplatzbreite von 0,5 m, wie für Dorfkirchen üblich. S. Anm. 8.
3° S. Anm. 7.
1 37
4t1-1 ri I:
2J. Grundriß der Holzkirche in Wälfelsgrund (Mi�dzyg6rze), M 1 :200
28. Längsschnitt (links der Chor - rechts die Vorhalle) der Holzkirche in Wälfelsgrund (Mi�dzyg6rze), M 1 :200
1 3 8
des Versammlungs raumes mit emer flachen Decke (Abb. 28). Zwischen beiden Teilen des Gemeinderaumes gibt es eine deutliche Zäsur in der Konstruktion, die am deutlichsten im Dachwerk, jedoch auch im Kirchenraum lesbar ist. So stehen am Übergang der beiden Abschnitte mächtige Ständer innerhalb der Wand, in deren Nuten die Schrotholzbalken eingespundet sind. Lange Eisenlaschen verbinden die Schrotholzbalken zu beiden Seiten des Wandständers. Der Vef"sammlungsraum ist also nach der Konstruktionsmethode der Ständerbohlenbauweise verlängert worden3 I • Am Übergang zwischen gewölbtem Emporenraum und dem flachgedeckten Versammlungsraum spannt ein mächtiger Querunterzug (Abb. 29), der als verzahnter Doppelbalken ausgeführt ist32• Der Unter-
I "
29. Querschnitt durch den jüngeren Bereich des Orgelemporenanbaus, M 1:2 00
zug ruht seitlich auf den Wandständern der Schiffverlängerung auf. Im Querschnitt ist abzulesen, daß der Orgelemporenboden horizontal verläuft, der gezahnte Verbundbalken darüber jedoch erheblich, nämlich um 20 cm, nach Norden abfällt. Die Emporenstützen sind deshalb auch verschieden lang. An dieser Anpassung eines Konstruktionselementes an einen verformten Kontext läßt sich ableiten, daß die Stützen erst nachträglich in den Bau, der sich in unterschiedlicher Weise gesetzt hatte, eingebracht wurden.
Im Bereich der flachen Decke des Versammlungsraumes liegen die Dachbalken frei. Mit ihnen verkämmt und im Gemeinderaum noch sichtbar ist ein Längsüberzug. Die Deckendielung ist im Fischgrätmuster auf die Dachbalken aufgebracht.
Als einzige der noch erhaltenen Holzkirchen im Glatzer Raum besitzt der Bau in Wölfelsgrund einen eingezogenen Chor mit polygonal gebrochenem Schluß. An seiner linken Chorseite befindet sich ein Raum, der heute als Kammer genutzt wird, in früherer Zeit aber wohl zum Kirchenraum hin als Nische für einen Seitenaltar geöffnet war. Gegenüber, an der rechten Chorseite, liegt die zweigeschossige Sakristei, deren Gestalt heute nicht mehr die ursprüngliche ist:
3 I Bauerweiterungen nach der Konstuktionsmethode der Ständerbohlenbauweise sind eher ungewöhnlich. Oft werden Anbauten, oder auch Erweiterungen, als verbretterte Ständerbauten ausgeführt, so etwa die Sakristeivergrößerung in Steinbach. Da eine Wandverlängerung in Blockbauweise an den Anschlußpunkten nicht konstruktionsgerecht zu bewerkstelligen ist, wurden die Ständer eingefügt. Ständer innerhalb einer Blockkonstruktion stellen eine erhebliche Störung des Gefüges dar, da das Schwindmaß von Holz längs zur Faser viel geringer ist als quer zu ihr. Aus diesem Grund fallen die Wände des Emporenbereiches von den Ständern weg zu den Ecken hin deutlich ab.
}2 Die Methode der Balkenverstärkung durch schubfeste Aufdopplung ist alt und war auch bereits zur Erbauungszeit der Kirche bekannt. Beschrieben wurde sie z. B. im Jahre 1 726 bei Jacop Leupold, Theatrum Pontificiale oder Schau-Platz der Brücken und Brücken-Baues, Leipzig 1 726, 70- 7 1 . Jedoch werden solche Konstruktionen kaum zur Bautechnik ländlichen Bauens in der Mitte des 1 8. Jahrhunderts gehört haben, so daß anzunehmen ist, daß der Anbau doch um einiges jünger ist. Durch die unterstützenden Säulen unterhalb des Balkens stellt der Verbundbalken statisch einen Dreifeldträger dar, bei dem das mittlere Feld eine Spannweite von nur 4,65 m aufweist, um dem großen Lastanfall aus dem Dachbereich zu begegnen.
1 39
Sie wurde nach der gleichen Methode wie bei der Verlängerung des Versammlungsraumes vergrößert und zusätzlich aufgestockt.
Die Breite der Wandbalken beträgt 2 I cm und ihre Höhe variiert von 22 bis 3 2 cm. Der Eckverband der älteren Bauteile ist ein schwalbenschwanzförmiges Eckblatt; dagegen bildet ein Hakeneckblatt die Eckverbindung der beschriebenen Anbauten (Abb. 3 0).
Die Kirche besitzt ein Satteldach mit Walm über dem Chorpolygon. Der ursprüngliche steile Walm im Bereich des heutigen gezahnten Querträgers wurde durch ein Leergebinde ersetzt, welches den Übergang zum neueren Dachabschnitt bildet (Abb. I ) . Der First des Schiffdaches läuft auch hier über dem Chorbereich in gleicher Höhe weiter. Bei ebenfalls gleicher Traufhöhe der beiden Bauteile ist das Dach über dem stark eingezogenen Chor also wieder wesentlich steiler. Die Dachneigung über dem Gemeinderaum beträgt 46° (Abb. 3 I) . Das eigentliche Chordach tritt heute auf der Gebäudesüdseite, wegen des vom Chordach abgeschleppten Daches der aufgestockten Sakristei, nicht mehr in Erscheinung. Die Dachneigung über der linken Hälfte des Chores beträgt 66° (Abb. 3 2). Etwa aus der Mitte der langen Firstlinie, jedoch ein wenig zum Chor hin versetzt, ragt ein ho her achtseitiger, zwiebelbekrönter Dachreiter.
Abbundzeichen wurden nur im jüngeren Dachbereich über der Tonne der Orgelempore festgestellt.
�= � " '" 10 10
3 0. Holzkirche in Wölfelsgrund (Mi�dzyg6rze), Axonometrie des Eckverbandes
1 4°
3 I. Querschnitt durch den älteren Bereich des Gemeinderaumes der Holzkirche in Wölfelsgrund (Mi�dzyg6rze), M 1 :2 00
Von den verschiedenen Dachabschnitten, die zu den erwähnten unterschiedlichen Bauphasen gehören, soll an dieser Stelle nur das ältere Hauptdach angesprochen werden. Die Gebinde weisen die Dachkonstruktion als doppeltes Kehlbalkendachwerk aus. Sie sind verschieden stark aus gezimmert, wobei sechs Leergebinde, davon drei im Chordachbereich, fünf Vollgebinde, davon eins im Chordachbereich, und zwei Turmgebinde der Dachreiterkonstruktion zu unterscheiden sind. Auf die Dachbalkenenden sind Längshölzer aufge
kämmt, die den Sparren des Dachwerkes als Schwellen dienen. Die Sparren stehen, wie bei der ersten beschriebenen Holzkirche in Steinbach, mit einem Fersenversatz auf den Schwellen auf und werden durch kräftige Holznägel gehalten. Die Gebinde des Schiffdaches besitzen keine Aufschieblinge, was ungewöhnlich bei Sparrendachkonstruktionen ist. Die Überdeckung der Dachbalkenköpfe wird lediglich durch ein kräftiges Traufholz erreicht.
Die Vollgebinde besitzen in der Mittelachse jeweils eine Spitzsäule. Am oberen Ende ist diese, anders als in den Dachwerken der Holzkirchen in Steinbach und Spätenwalde, nur von einer Seite her, von dort dann aber in voller Sparrenstärke abgearbeitet. Das seitlich
32. Querschnitt durch das Chordachwerk und das davon abgeschleppte Dach über der umgebauten Sakristei der Holzkirche in Wölfelsgrund (Mie,dzygorze), M 1 .·200
stehengebliebene Schwert ist mit dem Sparrenpaar bündig verblattet und mit einem Holznagel gesichert. Ein Paar lange Streben bildet zusammen mit dem dazugehörigen Dachbalken für diese Säulen ein zusätzliches einfaches Hängewerk aus.
Ungewöhnlich an den Dachreiterquerbindern ist, daß zwar die beiden inneren zugleich Teil der Dachkonstruktion sind, daß aber die äußeren beiden (Abb. 3 3) nur zur Turmkonstruktion gehören und unmittelbar neben zwei regulären Dachwerkbindern stehen. Eine Verquickung von Dachreiter- und Dachwerkhölzern, wie in Spätenwalde und Neuweistritz, ist hier nicht so extrem gegeben, im Gegenteil, offenbar wurden die jeweiligen Tragwerkkomponenten absichtlich getrennt.
Außer einem Mittelwandverband (Abb. 34), an dessen Schwelle die Dachbalken angehängt sind, gibt es noch vier weitere in Längsrichtung verlaufende Zimmereinheiten des Daches, welche Teil der Dachreiterkonstruktion sind. Der Mittelwandverband dagegen ist deutlich von der Dachreiterkonstruktion abgesetzt.
Die Dachbalken liegen zum Kirchenraum hin offen und besitzen keinen Unterzug, sondern sind allein an einem Überzug, der Schwelle des Mittelwandverbandes, aufgehängt. Diese Dachbalkenabhängung und die Absprengung der Spitzsäule durch das zusätzliche Hängewerk läßt die eindeutige Bestimmung des Mittelwandverbandes im Bereich über dem Versamm-
lungsraum als Hängesäulenverband zu. Die Ausbildung des Mittelwandverbandes als Hängesäulenverband besteht allerdings nur im Schiffdachwerk. Im Chordachwerk ist die Hängefunktion des Mittelwandverbandes nicht gegeben. Die Chordachbalken mit ihrer geringen Spannweite bedürfen ja auch keiner Zwischenunterstützung. Der Längsverband spannt von Spitzsäule zu Spitzsäule über fünf Gebindefelder recht weit, so daß sich, selbst bei als wirksam angenommener Aufhängung der Spitzsäulen, der Längsverband durchbiegen wird und damit die Dachbalken belastet.
So dient im Bereich des Chordachwerkes der Mittelwandverband, wie derjenige im Dachwerk der Holzkirche in Steinbach, als Spitzsäulenverband vornehm-
33. Die äußeren beiden Dachreiterquerbinder des Dachwerkes der Holzkirche in Wö/felsgrund (Mi�dzygorze)
3 4. Mittelwandverband der Holzkirche in Wölfelsgrund (Mi�dzygorze); dieser besteht aus zwei Abschnitten: über dem Gemeinderaum als Hängesäulenverband und über dem Chorebereich als Spitzsäulenverband.
3 5 . Axonometrien der heutigen Baugestalt und der Rekonstruktion der ursprünglichen Bau/arm der Holzkirche in Wöl/elsgrund (Mie.dzyg6rze)
lich der Längsaussteifung des Dachwerkes. Der Mittelwandverband in Wölfelsgrund ist der einzige der hier behandelten Mittelwandverbände, dessen Wirkungsweise innerhalb seines Verlaufes von stehend zu hängend wechselt.
Eine Besonderheit dieses Dachwerkes ist es, wie der Schwellenrost des Dachreiters ohne Kontakt zu den Dachbalken ausgeführt wurde, indem seine Hölzer frei über den Kirchenraum spannen und mit geringen Abstand über den Dachbalken >schweben<,
Den Dachreiter, wie im Dachwerk der Holzkirche in Spätenwalde, allein auf Längsschwellen aufzubauen, verbot sich wegen der geringen Trägerhöhe des Auflagers am Chorbogen, und mehr noch, weil die Längsschwellen in freier Überspannung des Gemeinderaumes zu stark auf Biegung belastet wären. Der zusätzliche Holzbedarf, durch die Binderdopplung an den Übergangsstellen des Dachwerkes zum Turm, besteht lediglich in zwei langen Strebenpaaren, die bei einer >Verschmelzung< der Binder hätten vermieden werden können. Der gewonnene Vorteil, nämlich das Fernhalten der Dachreiterlast von den Dachbalken, wiegt jedoch weit mehr als der Nachteil des zusätzlichen Materialverbrauches.
V öllig unverständlich in diesem ansonsten so reiflich durchdachten Dachwerk bleibt der Einsatz einer Sparrenschwelle. Sie wird lediglich im Chordachbereich
ihrem Sinn entsprechend genutzt, da hier die Gebinde und Dachbalken ungebunden gestellt sind. Durch einen gegenüber den Deckenbalken weiteren Gebindeabstand konnte ein Leergebinde eingespart werden. Im Dachwerk über dem Versammlungsraum ist die Sparrenschwelle jedoch unsinnig, zumal die Sparren durch die Abhängung der Spitzsäulen zusätzliche Schubkräfte auf ihre Auflager ausüben.
Die oben angestellten Beobachtungen lassen eine Rekonstruktion der ursprünglichen Erscheinungsform der Holzkirche zu (Abb. 35)' Durch die Urkunde der Fertigstellung aus dem Jahr 1 742 war zu erfahren, daß Friedrich Keitig aus Wölfelsdorf und Heinrich Ludwig aus dem benachbarten Plomnitz die Holzkirche in Wölfelsgrund errichtet haben. Offenbar diente die Kirche im Heimatort des einen >Baumeisters<, nämlich die in Wölfelsdorf, dem heutigen Wilkan6w, als Vorbild für die neu zu errichtende Holzkirche. Diese war im Jahre 1 5 1 6 als Massivbau errichtet und 1 70 I umgebaut worden (Abb. 3 6). Die Kirche in Wölfelsdorf besitzt heute einen massiven, vierseitigen, turmartigen Dachreiter über der Westfront. Früher jedoch hatte sie, wie in einem alten Stich aus dem Jahre 17 3 8 zu erkennen ist, einen achtseitigen Dachreiter etwa auf der Mitte des Schiffdaches (Abb. 37), wodurch die Ähnlichkeit mit der Holzkirche in Wölfelsgrund verstärkt wird.
3 6. Kirche in Wilkan6w, dem ehemaligen Wölfelsdorf
Auch die Übereinstimmungen In der Fassadenbehandlung der Massivkirche und derjenigen der Holzkirche in Wölfelsgrund ist sehr augenfällig: so sind bei jener vor allem die liegend ovalen Fensterformen wiederzuentdecken.
Vergleichende Betrachtung der Dachwerke
Die untersuchten Kirchendachwerke mit Neigungen über dem Gemeinderaum von 46° bis 54° sind alle als Sparrendächer, und zwar als einfache (Steinbach und Neuweistritz) oder zweifache (Spätenwalde und Wölfelsgrund) Kehlbalkendachwerke ausgeführt. Ihre weitere Auszimmerung ist in hohem Maße unterschiedlich komplex, so daß im folgenden für die zusammenfassende Betrachtung die auftretenden Hauptbauglieder getrennt behandelt werden, um dann ihr zusammenwirken zu beleuchten.
Gespärre- und Binderkonstruktionen
Bei den Holzkirchen des Glatzer Raumes sind die Sparrenfüße in zwei Fällen ohne Holznagelsicherung in die Dachbalken gezapft, nämlich in Spätenwalde und Neuweistritz. Es ist dies eine für ein Sparrendach gebräuchliche schubfeste Verbindungsart, die jedoch keinen Schutz bietet bei Widsog, der für die leichten, schindelgedeckten Dächer eine besondere Gefahr darstellt. Um hier nicht völlig auf eine zugfeste Veranke-
37- Kirche in WölJelsdorf, Bauzustand 17] 8
rung zu verzichten, wurden an beiden Enden geblattete Fußstiele bzw. -bänder zwischen Sparren und Dachbalken angebracht.
Die beiden anderen Dachwerke besitzen Sparrenschwellen, auf denen die Sparren nur mittels Fersenversatz und Holznagelsicherung aufgestellt sind. Während diese Lösung bei dem vom ländlichen Hausbau abgeleiteten dachbalkenlosen Dachwerk der Holzkirche in Steinbach nicht weiter verwundert, ist diese urtümliche Ausbildung im jüngsten und in hohem Grade durchdachten Kirchendachwerk in Wölfelsgrund rätselhaft. Angenommen werden können nur formale Beweggründe: Offenbar war der sonst für Sparrendächer übliche Knick am Dachfuß unerwünscht, und der aufgeklaute Sparren eine Möglichkeit, die Aufschieblinge zu vermeiden.
Die Streben innerhalb der Hauptgebinde der verschiedenen Dachwerke erfüllen als Druck- bzw. als Zugglieder verschiedene Funktionen. Sie dienen der Queraussteifung der Binder und als zugbelastete Bänder bzw. als druckbelastete Sprengstreben der Aufhängung der Konstruktion.
Die Strebenanordnung im Dachwerk der Holzkirche in Spätenwalde ist offenkundig auf Vorbilder des mittelalterlichen monumentalen Kirchenbaus zurückzuführen. Wenn solche Auf teilungs regeln auf Rahmenformen übertragen wurden, deren Größe und Proportionen sich gegenüber den ursprünglich zur Regel gehörenden Formen verändert hatten, etwa auf die flachere Dach-
neigungen der Dachwerke des Barock gegenüber jenen der Gotik, so resultierten daraus Verstrebungsfiguren, die ihre konstruktive Wirkung verloren haben. Unter Berücksichtigung dieses Aspektes sind die steigenden Streben des Vollbinders der Holzkirche in Spätenwalde sicherlich den Hängebändern der mittelalterlichen Dachwerke nachempfunden, allerdings ohne daß die Bedeutung der Dachneigung begriffen worden wäre.
Im Falle der Holzkirche von Wölfelsgrund wurde jedoch die statisch-konstruktive Wirkungsweise der Hängebänder und vor allem auch die Abhängigkeit ihrer Effektivität von der Neigung der Sparren und der Bänder selbst erkannt. Sie wurden, da das Dach hier eine recht flache Neigung besitzt und dadurch die Zugbelastung im Anschlußpunkt extrem groß werden würde, durch Druckstreben ersetzt.
Die Art der Strebenanordnung an den Säulen der Querbinder ist auch von Bedeutung bei der Beurteilung der längsverlaufenden Mittelwandverbände.
Mittelwandverbände
In allen hier untersuchten Dachwerken ist, zumindest in Abschnitten, ein fachwerkartiger Verband in der Dachmittelebene vorhanden. Diesen zu beschreiben und dann entsprechend seiner konstruktiven Wirkungsweise eindeutig mit einem Begriff aus der gängigen Dachwerkterminologie zu belegen, ist nicht möglich. Daraus ergab sich die Notwendigkeit, eine den Befunden gerecht werdende Einteilung der Mittelwandverbände vorzunehmen. Prinzipskizzen der verschiedenen Mittelwandverbände verdeutlichen in einem Schaubild (Abb. 3 8), wie die Einflüsse aus den Dachwerken des ländlichen Wohnbaus und den Dachwerken des monumentalen Kirchenbaus offenbar zusammengeflossen sind.
Der Mittelstuhlverband
Der Mittelwandverband des Chordachwerkes in Neuweistritz stellt einen einfach stehenden Stuhl dar. Bei diesem Dachwerk wird deutlich, daß das in den anderen Dachwerken ungenutzte Potential der Längsaussteifung aller Gebinde erkannt wurde, da hier die Kehlbalken mit kräftigen Holznägeln in ihrer Position auf
144
dem Rähmholz des Stuhles gesichert sind. Damit wird eine Verschiebung verhindert, und die Kehlbalken können bei Druckbelastung auch nicht seitlich ausknicken.
Der Hängesäulenverband
In zwei der hier untersuchten Dachwerke gibt es Fachwerkbinder in den Mittelebenen, welche den Hängekonstruktionen, wie sie vor allem Josef Bronner und Fritz Heyn33 für die mittelalterlichen Dachwerke Breslaus und Danzigs dokumentiert haben, recht nahe kommen. Es sind dies die Mittelwandverbände in den Dachwerken in Spätenwalde und Wölfelsgrund. An die Schwelle des letzteren sind auch die Dachbalken der Leergebinde gehängt. In Spätenwalde hängen nur die Dachbalken der Vollgebinde am Längsverband. Hauptziel hier war es wohl, den schweren Längsverband allein aufzuhängen und damit die Dachbalken zu entlasten.
Die Spitzsäulen der hier betrachteten beiden Hängesäulenverbände sind am Firstpunkt mit einem schwertartigen Blatt aufgehängt. Diese Ausführung ist im monumentalen Kirchenbau weniger häufig dokumentiert worden als der wirksamere Versatz, jedoch ist er von Heyn bei der Barbarakirche in Danzig beobachtet und gezeichnet worden34. Im Dachwerk der Holzkirche in Spätenwalde sollten offenbar die zu den Sparren verlaufenden Bänder eine weitere, die Spitzsäulen aufhängende Funktion übernehmen. Im Kirchendachwerk in Wölfelsgrund wird in Querrichtung mittels weit nach außen reichender Druckstreben ein Hängewerk ausgebildet.
Durch die fehlende Verkämmung der Kehlbalken mit den Riegeln der Hängeverbände wird bei diesen beiden Beispielen die Möglichkeit der Längsaussteifung nicht optimal ausgenutzt.
Der Spitzsäulenverband
Neben den eindeutig stehenden bzw. hängenden Konstruktionen finden sich Längsverbände in den in dieser Arbeit untersuchten Kirchendachwerken, deren Wirkungsweise nicht klar ablesbar ist. Der Mittelwand-
33 Siehe Anm. 19. 34 Heyn a. a. O., Tafel 5.
freitragend I stehend
Dachwerk ohne Längsverband I
Reiterverband2
doppelt stehender Stuhe Mittelstuhlverband4
(
/ /
J 8. Übersicht der Längsverbände; Anmerkungen dazu:
/
Längsverbände
hängend
Hängesäulenverband5
/ /
Hochsäulenverband6
Spitzsäulenverband 7
I Dachwerk ohne Längsverband nach Hermann Phleps, Ost-, und westgermanische Baukultur unter besonderer Würdigung der ländlichen Baukunst Siebenbürgens, Berlin 193., 2 I, Abb. I lg. 2 Reiterverband nach Alfred Fiedler/jochen Helbig, Das Bauernhaus in Sachsen, Berlin 1967, 73, Abb. 50. Vgl. auch »freitragendes fachwerkartiges Längstragwerk mit Hängesäulen«, nach Susanne Kraft, Statisch-konstruktive Untersuchung gezimmerter Dachtragwerke in Pirna, in: Erhalten historisch bedeutsamer Bauwerke, Berlin 1997 Oahrbuch des Sonderforschungsbereiches 3 15, 1995), 181-187- 3 Doppelt stehender Stuhl nach Eberhard Deutschmann, Lausitzer Holzbaukunst unter besonderer Würdigung des sorbischen Anteils, Bautzen 1959, 166-167, Ta[ 4 u. 5. 4 Mittelstuhlverband nach Hans Schwab, Die Dachformen des Bauernhauses in Deutschland und in der Schweiz, ihre Entstehung und Entwicklung, Diss., TH, Berlin 1914, 19, Abb.2. 5 Hängesäulenverband nach josef Bronner, Zur Konstruktiven Entwicklung der Dachstühle auf Breslauer Kirchen und Monumentalbauten, Diss., TH, Breslau 193 I, Ta[ I I. 6 Hochsäulenverband nach Heinrich Franke, Ostgermanische Holzbaukultur und ihre Bedeutung für das deutsche Siedlungswerk, Breslau 1936, 43, Abb. 41 . 7 Spitzsäulenverband nach den in dieser Arbeit dokumentierten Dachwerken. Vgl. auch »fachwerkartiges Längstragwerk mit Spitzsäulen«, nach Kraft, a. O.
1 45
39. Tragwerkkomponeneten der Dachwerke der Holzkirchen in Spätenwalde (Zalesie) (links) und in Wölfelsgrund (Mie.dzyg6rze) (rechts)
verband des Dachwerkes der Kirche in Stein bach und derjenige des Chordachwerkes in Wölfelsgrund sind Mischkonstruktionen aus Hängesäulenverband und stehendem Mittelstuhlverband, die von der Verfasserin als Spitzsäulenverbände bezeichnet werden. Die Spitzsäulen der Kirchendachwerke in Steinbach und Wölfelsgrund sind am Firstpunkt durch ihre holznagelgesicherte Verblattung mit den Sparren »abgehängt«,
aber weder Hängebänder zu den Sparren noch Hängewerkstreben zu den Dachbalkenenden sorgen für eine wirklich wirksame Aufhängung der Säulen. Sie sind zudem recht weit voneinander entfernt angeordnet, so daß der Fachwerkbinder aufgrund seiner Durchbiegung auf jeden Fall auf den Dachbalken ruht.
Da die Unterstützung der Kehlbalken in diesen Spitzsäulenverbänden nur eine untergeordnete Rolle spielt, was sich an ihrer fehlenden Verkämmung mit dem Längsrähm zeigt, hierin jedoch eine wesentliche Funktion einer Stuhlkonstruktion besteht, wird für diese Verbände der Begriff des Stuhles vermieden.
Integration der Dachreiterkonstruktion in das Hauptdachwerk
Die Dachreiter der Kirchen in Steinbach, Spätenwalde, Neuweistritz und Wölfelsgrund sind achtseitig, stehen mit zwei Seitenflächen senkrecht zum First und besitzen, bzw. besaßen, durch den gesamten Dachwerkquerschnitt aufsteigende Stützen. Dennoch gleicht keine Grundkonzeption genau einer anderen.
1 46
In den Dachwerken der Holzkirchen in Spätenwalde, Neuweistritz und Wölfelsgrund stehen die Stützen des Dachturmes innerhalb von Längsbindern auf langen, von Querwand zu Querwand reichenden Schwellen. In Steinbach, wo dies nicht der Fall ist, sondern wo ein Schwellrost aus relativ kurzen Hölzern auf wenigen Deckenbalken liegt, mußte der Dachreiter abgetragen werden, da er eine zu große Belastung der Deckenbalken darstellte.
Zu beobachten ist, daß die Hauptkonstruktionsglieder: Gebinde, Mittelstuhlwand und Turmkonstruktion, unterschiedlich stark verschmelzen (Abb. 39). Die Dachwerke in Spätenwalde und Wölfelsgrund bilden in Bezug auf den Grad der Verflechtung der Konstruktionselemente von Dach und Turm die beiden extremen Pole (Abb. 40). Bei der Holzkirche in Spätenwalde sind die Konstruktionshölzer der beiden Bauteile sehr stark miteinander verflochten: Die Stützen des Mittelwandverbandes, der in diesem Bau als Hängesäulenverband ausgeführt wurde, sind zugleich Stützen des Turmes. Alle vier Turmquerbinder sind zugleich Vollgebinde des Dachwerkes. Diese Verflechtung bringt eine starke Verunklärung des Systems der Lastabtragung mittels stehender und hängender Tragwerkglieder mit sich. Damit entzieht sich die Konstruktion unserem Verständnis für statisch bestimmte Systeme, das entstandene räumliche Fachwerkgitter ist aber offenbar von großer Stabilität. Die Ausbildung eines räumlichen Gitterwerkes, mit seinen gewollten Knotenpunkten zwischen Quer- und Längsverbänden, ist in diesem
Dachwerk am weitesten vorangetrieben. Der extrem große Holzaufwand des Dachwerkes erschwerte natürlich den Abbundvorgang. Zum Anreißen ihrer Verbindungen müssen gerade die Spitzsäulen mehrfach, nämlich im Zusammenhang mit den Hölzern der Längs- und der Querbinder, ausgelegt werden. Im Zuge des Richtens ergaben sich dadurch auch ungewollte aber auch unvorhersehbare Kollisionen der Streben mit anderen Hölzern, so daß viele Konstruktionsglieder abgebeilt oder gar durchgesägt werden mußten.
Die in Spätenwalde vorzufindende Verquickung von Dachwerk- und Dachreiterkonstruktion wurde in Neuweistritz auf besondere Art noch weiter getrieben, wahrscheinlich mit dem Ziel, Holz einzusparen: Nicht nur die Querverbände gehören gleichzeitig zum Dachwerk und zum Turm, mehr noch: die Dachreiterlängsverbände sind mit den Stuhlwänden >verschmolzen<, die bei dem Dachwerk der Holzkirche in Spätenwalde als getrennte Längsverbände zusammen mit einem Mittelwandverband bestehen (Abb. 3 9)' Als Folge dieser Rationalisierung stehen nun jedoch die beiden Stuhlwände ungünstig eng zusammen und belasten die Dachbalken zu weit in der Feldmitte. Außerdem sind dadurch die Kehlbalken für eine sinnvoll angebrachte Unterstützung der Sparren zu hoch gelegen, und ihre Unterstützung durch den Stuhlrähm ist überflüssig.
Die Erbauer der Holzkirche in Wölfelsgrund müssen die jeweiligen Vorteile einer hängenden bzw. einer stehenden Konstruktion und gleichzeitig die Nachteile der übermäßigen Verflechtung der Tragwerkkomponenten erkannt haben, denn innerhalb dieses Dachwerkes sind die Konstruktionsanteile von Dach und Turm weitgehend getrennt ausgebildet worden. Hier stehen die Vollgebinde des Dachwerkes neben den Turmquerbindern, und der als Hängesäulenverband ausgebildete Mittelwandverband über dem Versammlungsraum hat keine gemeinsamen Hölzer mit der stehenden Turmkonstruktion. Diese wurde sogar, um die Dachbalken nicht zu belasten, auf einen Schwellenrost gestellt, der frei über den Dachbalken von Umfassungswand zu Umfassungswand gespannt ist. Der Verzicht auf ein räumliches Gittertragwerk bedeutete jedoch auch ein Verlust an statischen Re-
serven, und so mußten die einzelnen Binder konsequent den an sie gestellten Anforderungen entsprechend konzipiert werden, was durch die Ausbildung eines tatsächlich funktionsfähigen Hängewerkes geschah.
Schlußgedanken
Die Walmausbildung, die stehenden Stuhlwände, seien sie in der Dachmittelebene oder seitlich aufgestellt, sowie die Sparrenschwellen sind Anleihen aus dem ländlichen Wohnbau, während die hängenden Mittelwandverbände zunächst nur in den mittelalterlichen Kirchendachwerken zu finden sind.
Friedrich Herzberg aus Breslau macht, kurz nachdem die letzte Holzkirche in Wölfelsgrund entstanden war, in einigen nacheinander erschienenen Veröffentlichungen Vorschläge dazu, wie seiner Meinung nach die bis dahin »üblichen Dächer zu verbessern« seien und faßt diese im Jahre 1774 in einem Buch zusammen35. Er macht sich vor allem Gedanken über Alternativen zu stehenden oder liegenden Stuhlkonstruktionen, mit dem Ziel, den Holzaufwand zu minimieren. Nur mit wenigen Bemerkungen spricht er die ihm bekannten Dachwerke mit Hängekonstruktionen an:
»Die, nach ächtem gothischen Geschmack erbauete Kirchen oder Thürme scheinen insbesondre diese Dachwerke [gemeint sind solche mit Hängesäulenverband], als bewährte Zeugnisse des barbarischen Zeitalters der Baukunst, der Bewunderung neuerer Baumeister aufbewahrt zu haben. Denn es ist ausgemacht, daß ein jeder Kunstverwandter beym Anblicke der innern Verbindung eines solchen Daches, Bewunderung über die Ausschweifungen der Kunst, einen kleinen Wald von Bauholz, den Grundgesetzen der Natur zuwieder, in freyer Luft aufzuhängen, empfinden müsse.«36 Herzberg führt weiter aus, daß diese Dachwerkart, als »bewunderte kostbare Kunst weniger zur Nachahmung reize« und keinen Raum finden könne innerhalb einer Arbeit, die sich mit der Ökonomie der Konstruktion beschäftige.
35 Friedrich Herzberg, Vorschläge zur Verbesserung der bisher üblichen Dächer, Breslau 1 774.
36 Ebd., 44-4 5 , §30.
b) c)
40. Prinzipskizzen der Querbinder, M I : 2 00 a) Spätenwalde (Zalesie), 1718: Stehendes und Hängendes verknüpft: Der >hängende< Mittelwandverband ist im Bereich des Dachreiters
Teil der Dachreiterkonstruktion (die Spitzsäulen sind im engeren Abstand aufgestellt und über die Firstlinie hinaus höher geführt). Sparren
und Streben verknüpfen den Mittelwandverband mit den stehenden Längsbindern der Dachreiterkonstruktion und den seitlich stehenden
Stuhlwänden des übrigen Dachwerkes zu einem räumlichen Gittertragwerk.
b) Neuweistritz (Nowa Bystrzyca), 1726: Stehendes zusammengefaßt: Starke Verflechtung der Komponenten von Dachreiterkonstruktion
und übrigem Dachwerk (seitlich stehende Stuhlwände sind zugleich Längsbinder der Dachreiterkonstruktion) und Verzicht auf einen
Mittelwandverband; Dadurch konnte zwar der Holzaufwand reduziert werden, aber die Dachbalken werden stark belastet, und die Kehl
balken liegen ungünstig hoch.
c) Wölfelsgrund (Mü:dzyg6rze) 1742: Stehendes oder Hängendes getrennt ausgebildet: Hängender Mittelwandverband und dazugehörige
Querbinder sind getrennt von den stehenden Dachreiterbindern.
Die Dachwerke der Holzkirchen in Spätenwalde und Wölfelsgrund zeigen, wie die Zimmerleute des 1 8. Jahrhunderts im Glatzer Raum mit den konstruktiven Vorbildern, die sie hatten, experimentierten, um diese den zeitgemäßen formalen Anforderungen, vornehmlich der einer erwünschten flacheren Dachneigung, anzupassen. Der Weg zur Erkenntnis, daß ein Dachwerk mit mittlerem Hängesäulenverband, oder in der Modifikation als Spitzsäulenverband, gerade hierfür kaum geeignet ist, zog sich also sehr lange hin.
Deutlich zeigt sich allerdings, daß es bei den untersuchten Holzkonstruktionen nicht vorrangiges Ziel der Zimmerleute gewesen ist, Holz einzusparen. Damit ging es auch nicht um eine Suche nach neuen, effizienteren Tragwerksystemen, sondern allenfalls darum, das Bekannte in Hinblick auf eine Vereinfachung der Richttechnik zu verbessern. So werden
Abbildungsnachweis:
Herzbergs geringschätzig gemeinten Worte zur Dachkonstruktion mit Hängesäulenverband als »Wald von Bauholz« und als zu »bewundernde kostbare Kunst«, damit jedoch abzulehnende, unsinnige Konstruktion, relativiert. Diese Dachwerke geben in den Details der Knotenpunktausbildungen doch Zeugnis von einer hohen Zimmermannskunst. Und wenn man bedenkt, daß es keine Vorlagen in Form von Plänen gab, sondern der Zimmermann nur durch eigene Anschauung anderer Dachwerke das Prinzip erfassen mußte, verweist dies auf ein gutes räumliches Vorstellungsvermögen und ein ausgeprägtes analytisches Denken. Daß er das Vorgefundene dann nach eigenem Gutdünken mehr oder weniger abgewandelt hat zeigt auch, daß er den Vorbildern nicht kritiklos gegenüberstand und sein eigenes Können in seinem Werk einbringen wollte.
2 Matthäus Merian, Topographia Bohemiae, Moraviae et Silesiae, Kassel und Basel 1960, Repr. d. Ausg. Frankfurt 1 65 0, Taf. n. 1 1 6. - 36 Jörg Marx, Grafschafter Kirchen in heutiger Zeit, Leimen/Heidelberg 1978, 32I. - 37 Aloys Bernatzky (Hrsg.), Landeskunde der Grafschaft Glatz, Leimen, 1988, 82 nach Vorlage in: Franz August Pompejus (Hrsg.), Album der Grafschaft Glatz oder Abbildungen der Städte, Kirchen, Klöster, Schlösser und Burgen derselben vor mehr als 1 5 0 Jahren, Glatz 1 862. - Die Dachwerk-CAD-Modelle: Stefan Blum, Sascha Hendl, Kat ja Melan und Catharine Hof (Insitut für Baugeschichte, Karlsruhe). -Bauaufnahmezeichnungen: Polnische und deutsche Architekturstudenten unter Anleitung von Rafal Czerner, Jacek Kosciuk (Breslau/Wrodaw) und Bettina Häfner, Catharine Hof (Karlsruhe). - Alle übrigen: Catharine Hof.
1 48