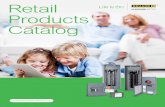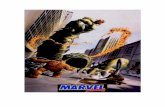Hardware - Classic Computing
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Hardware - Classic Computing
Verein zum Erhalt klassischer Computer e.V. www.classiccomputing.de
Apple II Soundkarten
Wie der Applepolyphon wurdeSoftware entwickeln
Amiga CProgrammierung
IDE, TTRAM, USB
Neue AtariHardwareAmiga 500 als PCXT
KCS Power PCBoard
Interview
Atari HardwareEntwicklerWissen
Logikanalysator35 Jahre LISA
UNABHÄNGIG ∙ GEMEINÜTZIG ∙ KOSTENLOSAusgabe 4 | 2018
Hardware
Erweiterungen
Selbstbau
Neue Projekte
OnlineAusgabe
33
Hier ist sie also – die lange erwartete vierteAusgabe von „LOAD“, dem Magazin des
Vereins zum Erhalt klassischer Computer e.V. Alswir im Jahr 2012 die erste Ausgabe vorstellten, warwohl keinem im Verein klar, wie groß die Aufgabeist, die wir uns da gestellt hatten. Wir wollten einjährlich erscheinendes Magazin herausgeben, daseinen Vergleich mit anderen RetrocomputerMagazinen nicht scheuen sollte. Dazu braucht es so einiges: Themen, Artikel, ein flottes Layout,Verständnis der Anforderungen von Druckereien,eine Logistik zur Verteilung, Werbung im Heft zurFinanzierung des Heftes – und vor allem Menschen,die das alles beibringen und machen. Und es bedeutet viel Zeit und viel Arbeit. Der zeitliche Abstand, mit dem dann 2014 die zweite Ausgabeerschienen ist, hat das deutlich gezeigt.
Die dritte Ausgabe erschien dann nur als OnlineAusgabe, um den Aufwand in Grenzen zu halten.Der Erfolg dieser Ausgabe hat uns überrascht – inden ersten Monaten hatten wir über 3.500 Downloads. Und das, obwohl es recht wenig Werbung inden Foren für die LOAD#3 gab. Das hat uns bestärkt, weiterhin eine PrintAusgabe zu erstellen.Die Vorzeichen haben sich allerdings geändert: DasMagazin wird nun vollständig durch die Mitgliedsbeiträge getragen. Das steht im Einklang mit denVereinszielen – denn wie könnte die Wahrung undDokumentation des Wissens um klassische Computer besser erreicht werden als durch ein Magazin,das auch in Bibliotheken verfügbar ist?
Auch der Focus der LOAD ist ein anderer: Wirwollen hauptsächlich die Projekte und die in derFreizeit erbrachten Leistungen unserer Mitgliederdokumentieren. Und da gibt es eine Menge interessanter Dinge: Restauraton defekter Geräte, Reparatur von Bauteilen, Selbstbau von Rechnern undauch komplette Neuentwicklungen von Zusatzhardware. Daher ist auch "Hardware" das übergreifende Thema dieser Ausgabe.
Mit dem neuen Focus ist aber auch klar: Die LOADist nur so gut wie die Artikel, die in die Redaktionkommen! Daher der Aufruf an alle Mitglieder undalle, die es werden wollen: Schreibt über die Projekte, die ihr vorantreibt. Wir helfen auch gern dabei. Dann wird auch die LOAD#5 wieder ein tollesHeft.
Nun viel Spaß beim Lesen!
README.TXT Inhalt
3 Readme.txt
3 Inhalt
4 Retro Termine 2018 / 2019
6 Kurz berichtet
37 Agenda VR3 der erste Linux PDA
54 Kleine Rechenhilfen
8 IDE und RAM für Atari TT
10 USB Interface für Atari
12 Interview mit den AtariEntwicklern
16 PC Board für Amiga 500
22 Wie der Apple II polyphon wurde
31 WLAN für klassische Computer
32 Das CCC Modem Datenklo
34 Minimales Z80 System
38 Wiederbelebung eines AIM65
40 Neue Akkus für den Epson HX20
42 Iomega ZIP Drive als Festplatte
26 Spieleklassiker Stellar 7
28 Amiga C Programme entwickeln
53 Zahlenmemory für Apple ][
44 Messen mit dem Oszilloskop
48 35 Jahre Apple LISA
52 Little Man Computer
55 CP/M Quick Reference Card
5 Unsere Veranstaltungen
57 Neues aus dem VzEkC e.V.
58 Das Computermuseum Visselhövede
60 Der Verein über sich
61 Mitgliedsantrag
62 Impressum
62 Vorschau auf LOAD#5
Editorial und Inhalt
Tippfaul?
Einfach einmal auf
http://www.classiccomputing.de/load4
gehen und alle Links zu den Artikeln
durchklicken. Die Liste wird fortlaufend
ergänzt.
Hardware
Software
Wissen
Vereinsleben
Kurzberichet
44
Hier wird es rund gehen—RetrocomputerTreffen 2018 / 2019
Service
April 2018
RetroAktiv Kaiserslautern
Freitag, 27. April 2018, 18:00 23:00
RudolfBreitscheidStraße 65, 67655 Kaiserslautern
Mai 2018
8. Amiga Treffen Ost
Samstag, den 12.05.2018 von 8:30 Uhr
bis Open End
http://www.a1k.org/forum/
showthread.php?t=61614
OCM Arcadebereich
Samstag, 12. Mai 2018, 14:00 19:00
Oldenburger Computermuseum | Bahnhofsplatz 10,26122 Oldenburg
3. Retrobörse Saar
Samstag, 19.05.2018
Aula der Universität Saarbrückenhttp://www.retroboersesaar.de/
HomeCon 49
Samstag, 26. Mai 2018, 10:00 20:00
Taubengasse 3, 63457 Hanau
Juni 2018
20. RetroDaddel Day & 4.
Ruhrgebietsstammtisch in Essen
Samstag 09.06.2018
Unperfekthaus, FriedrichEbertStr. 18, 45127Essen
7. Alternatives Computer Meeting
Wolfsburg
15. bis 17. Juni 2018
Dorfgemeinschaftshaus Flechtorf | AlteBraunschweiger Str. 21, 38165 Lehrehttp://amigalanparty.de/meeting.html
HainCon #2
Samstag, 23. Juni 2018, 09:00 22:00
Wörther Str. 1A, 64750 Lützelbach
RetroAktiv Kaiserslautern
Freitag, 29. Juni 2018, 18:00 23:00
RudolfBreitscheidStraße 65, 67655 Kaiserslautern
Juli 2018
OCM Arcadebereich
Samstag, 14. Juli 2018, 14:00 19:00
Oldenburger Computermuseum | Bahnhofsplatz 10,26122 Oldenburg
RetroAktiv Kaiserslautern
Freitag, 27. Juli 2018, 18:00 23:00
RudolfBreitscheidStraße 65, 67655 Kaiserslautern
August 2018
7. LuheCon
Samstag, 4. August 2018 Sonntag, 5.
August 2018
Schloßpl. 11, 21423 Winsen (Luhe)
RETROLUTION!2018
Samstag 11.08.2018, ab 10:00 Uhr und
Sonntag 12.08.2018, ab 10:00 Uhr
Kulturhalle Steinheim | Ludwigstraße 67, 63456Hanau (Steinheim)
OCM Arcadebereich
Samstag, 11. August 2018, 14:00 19:00
Oldenburger Computermuseum | Bahnhofsplatz 10,26122 Oldenburg
Retro Computer Treff #19
Samstag, 25.08.2018
Freizeitheim Döhren, An der Wollebahn 1, 30519Hannover
RetroAktiv Kaiserslautern
Freitag, 31. August 2018, 18:00 23:00
RudolfBreitscheidStraße 65, 67655 Kaiserslautern
September 2018
OCM Arcadebereich
Samstag, 8. September 2018, 14:00
19:00
Oldenburger Computermuseum | Bahnhofsplatz 10,26122 Oldenburg
Classic Computing 2018Sa. 22.09.2018 09:00 – 18:00und So. 23.09.2018 11:00 – 17:00Mehrzeckhalle Degmarn | Plattenstr. 27,74229 ÖdheimDegmarnhttp://www.classiccomputing.de/veranstaltungen/cc2018/
HainCon #3
Samstag, 29. September 2018, 09:00
22:00
Wörther Str. 1A, 64750 Lützelbach
Oktober 2018
OCM Arcadebereich
Samstag, 13. Oktober 2018, 14:00 19:00
Oldenburger Computermuseum | Bahnhofsplatz 10,26122 Oldenburg
RetroAktiv Kaiserslautern
Freitag, 26. Oktober 2018, 18:00 23:00
RudolfBreitscheidStraße 65, 67655 Kaiserslautern
November 2018
OCM Arcadebereich
Samstag, 10. November 2018, 14:00
19:00
Oldenburger Computermuseum | Bahnhofsplatz 10,26122 Oldenburg
HomeCon 51
Samstag, 17. November 2018, 10:00
20:00
Taubengasse 3, 63457 Hanauhttp://forum.homecon.org
Dezember 2018
8. LuheCon
Samstag, 1. Dezember 2018
Schloßpl. 11, 21423 Winsen (Luhe)
OCM Arcadebereich
Samstag, 8. Dezember 2018, 14:00
19:00
Oldenburger Computermuseum | Bahnhofsplatz 10,26122 Oldenburg
RetroAktiv Kaiserslautern
Freitag, 28. Dezember 2018, 18:00
23:00
RudolfBreitscheidStraße 65, 67655 Kaiserslautern
Januar 2019
OCM Arcadebereich
Samstag, 12. Januar 2019, 14:00 19:00
Oldenburger Computermuseum | Bahnhofsplatz 10,26122 Oldenburg
RetroAktiv Kaiserslautern
Freitag, 25. Januar 2019, 18:00 23:00
RudolfBreitscheidStraße 65, 67655 Kaiserslautern
Februar 2019
OCM Arcadebereich
Samstag, 9. Februar 2019, 14:00 19:00
Oldenburger Computermuseum | Bahnhofsplatz 10,26122 Oldenburg
RetroAktiv Kaiserslautern
Freitag, 22. Februar 2019, 18:00 23:00
RudolfBreitscheidStraße 65, 67655 Kaiserslautern
März 2019
OCM Arcadebereich
Samstag, 9. März 2019, 14:00 19:00
Oldenburger Computermuseum | Bahnhofsplatz 10,26122 Oldenburg
RetroAktiv Kaiserslautern
Freitag, 29. März 2019, 18:00 23:00
RudolfBreitscheidStraße 65, 67655 Kaiserslautern
April 2019
RetroAktiv Kaiserslautern
Freitag, 27. April 2018, 18:00 23:00
RudolfBreitscheidStraße 65, 67655 KaiserslauternOldenburger Computermuseum |
Bahnhofsplatz 10, 26122 Oldenburg
RetroAktiv Kaiserslautern
Freitag, 25. Januar 2019, 18:00 23:00
RudolfBreitscheidStraße 65, 67655 Kaiserslautern
55
Das Vereinsleben im Verein zum Erhalt klassischer Computer e.V. findetnicht nur virtuell in den Foren statt.Wir treffen uns regional und überregional – mal auf großen Veranstaltungen und mal im überschaubarenRahmen. Und das waren so einige inden letzten Monaten.
Der Retro Computer Treff Niedersachsen findet dreimal
jährlich
in Hannover statt. Dort finden sichFreunde alter Computer zusammen,um zu spielen, sich auszutauschenund gemeinsam Spass zu haben.
Das Alternative Computermeetingin Wolfsburg hat seine Schwerpunktauf dem Commodore Amiga. Es findet immer im Mai statt.
Der Waiblinger Usertreffen imMärz versammelt RetrocomputerFreunde aus dem Stuttgarter
Raum.
Der Süden der Republik ist auch einVeranstaltungsort für uns, in BadSäckingen findet in loser Folgenämlich die Säcks statt.
Auch in der Kölner Bucht gibt esRetrocomputerTreffen, oft sind fürein Wochenende die Mitglieder dortzusammen.
Und natürlich die Classic Computing, unsere jährliche Hauptveranstaltung– sie findet jedes Jahr ineinem anderen Ort statt. 2017 war esBerlin gemeinsam mit dem VCFB,2018 ist es Ödheim nahe Heilbronn.
Hier ein paar Bilder von unserenjüngsten Treffen.
Retro Computer TreffNiedersachsen RCT#16
Juli 2017: "Säcks" in Bad Säckingen
Hier ist es rund gegangen— Treffen 2017
Vereinsleben
Vintage Computer Festival Berlin, 07. / 08. Oktober 2017
Stuttgart, 06. / 07. Januar 2018: CRT"18.1
66
Kurz berichtet
Apple II: MultitaskingBetriebssystem für Apple //eA2osX ist ein MultitaskingKernelfür enhanced Apple //e Systeme mit128 kByte Arbeitsspeicher und65c02 CPU. Das System benötigtkeine weitere Hardware. A2osX istdas Ergebnis 4jähriger Programmierarbeit von Remy Gilbert.
Da der Apple //e kein VBL Signalals Interrupt liefert, ist kein preemptives Multitasking möglich.Vielmehr müssen alle Programmeregelmässig die Kontrolle an denKernel zurückgeben (kooperativesMultitasking wie z.B. bei MS Windows 2.x und 3.x). Erst mit einemMouse Interface steht bei Apple //Modellen (Zusatzhardware beim//e, serienmässig beim //c und IIgsvorhanden) eine entsprechende InterruptQuelle zur Verfügung. Dannarbeitet der Kernel auch preemptivder Kernel 0.9.1 hat im September2017 diesen Modus gelernt.
Der Kernel residiert oberhalb vonProDOS und stellt verschiedeneDienste bereit. Ein Memory Manager reloziert 65c02 Code. DerEvent Manager stellt einen TCP/IPStack bereit und bedient verschiedene Ports. Der Task Manager verwaltet die verschiedenen Prozesse.Der Device Manager bedient dieverschiedenen Geräte und kenntzuladbare Gerätetreiber. Gegenwärtig sind Treiber für die Konsole,die Super Serial Card, ParallelInterfaces, das Mouse Interface undUthernet 1 und 2 Interfaces undLanCeGS Ethernetkarten vorhanden.
Auch bietet der Kernel eine direkteUnterstützung für virtuelle ADTProDrives über die Super Serial Cardund einen AppleTalk Support fürProDOS. Außerdem sind Hintergrundprozesse (Daemons) fürTCP/IP inklusive DHCP ClientSupport vorhanden. An einemTELNET und einem HTTP Daemon wird gearbeitet.
Das Userland wird durch einen LoginDaemon und eine KommandozeilenShell bedient. Die Shell kennt übliche UNIX Kommandos wie CD,PWD und DATE. Weitere Kommandos wie LS, PS, MD, RM, CP oderPING und IPCONFIG werden durcheigene Binaries bereitgestellt. (gb)
Links
https://github.com/burniouf/A2osX
Atari ST: Frogger erschienenScott Clifford hat eine Atari ST Version des Klassikers Frogger erstellt.Frogger wurde 1981 von Sega produziert und war sowohl in Spielhallen als auch auf der SpielekonsoleAtari 2600 sehr beliebt. Später wurden Versionen auch für andere 8BitSysteme und Spielekonsolen herausgebracht. (gb)
Links
http://www.atarimania.com/gameataristfrogger_30782.html
Amiga: MUI 5.0 für AmigaOS4/PPC erschienenDas MUI für AmigaOS Entwicklerteam gibt die Veröffentlichung derVersion 5.02017R4 des Magic UserInterface für AmigaOS4/PPC undAmigaOS3/m68k bekannt. Wie in allen bisherigen Versionen ist ein Keyfile zur Nutzung aller Funktionenerforderlich; Keyfiles von MUI 3.8können uneingeschränkt verwendetwerden. MUI5 ist für AmigaOS3/m68k und leistungsstärkereSysteme mit schneller CPU undGrafikkarte gedacht. Es werden auchFarbpaletten mit gemappten 265 Farben unterstützt. MUI4 und MUI5verwendet jedoch vorrangig TrueColor Bilder und Effekte, die jedochnicht auf gemappten Farbpalettendargestellt werden können. (hh)
Links:
http://download.muidev.de
Amiga: MUIbase Version4.0 veröffentlichtMUIbase (Magic Data Base mit Benutzeroberfläche) ist eine relationale,programmierbare Datenbank mitgrafischer Benutzeroberfläche fürWindows, Mac, Linux und Amiga.MUIbase ist OpenSource Softwareund wird unter den Bedingungen derGNU General Public License (GPL)verteilt. MUIbase ist für fortgeschrittene DesktopAnwender, dieDaten in einer komfortablen undleistungsfähige Weise verwaltenmöchten. MUIbase kann jede Artvon Daten, z.B. Adressen, CDs, Filme, Fotosammlung, Stammbaum,Erträge und Aufwendungen und vieles mehr verwalten. Die Stärke derMUIbase liegt in seiner klaren undleistungsstarken grafischen Benutzeroberfläche und den Programmiermöglichkeiten. MUIbase kann Datenauf verschiedene Weise verarbeiten.Automatische Berechnungen der Benutzereingaben, Generierung vonReports, Import und Export vonDaten, usw. So kann MUIbase dieBerechnung des Gesamtbetrags derEinkünfte, die Gesamtlaufzeit einerCD berechnen oder auch Serienbriefe automatisch erstellen und ausdrucken. (hh)
Links:
http://aminet.net/package/biz/dbase/MUIbase4.0
Amiga: HDRec frei verfügbarHDRec ist ein mächtiges MIDI Audio Sequencer Programm für AmigaOS. Es kombiniert komfortableMIDI Nutzung mit Audio Editierfunktionen. Es nutzt das AHI Systemfür Audio und das CAMD Systemfür die MIDI Ein und Ausgabe.HDRec ist durch ein PluginSystemerweiterbar, es existieren zahlreichePlugins für Editieren, Synthesizerund Visualisierung. Es untersütztaiff, wav, maud, raw, cdda, 8svx,mp3, mod und mid Dateiformate.Das Programm ist nun unter den Bedingungen der GNU General PublicLicense (GPL) erhältlich. (hh/gb)
77
Kurz berichtet
Links:
https://sourceforge.net/projects/hdrec/
http://www.hdrec.de/HDRec/index.php?site=downloads
Amiga: Scandoubler fürA1200 und A4000DDer Scandoubler ScanPlus AGA istfür den Anschluss an VGAMonitoregedacht. Unterstützt werden die nativen AmigaAuflösungen PAL, NTSC, DblPAL, DblNTSC, Euro 36/72,Super 72 und Multiscan. Zum Lieferumfang gehört eine Blende für dieAussparung auf der Rückseite einesA1200Gehäuses. Die Platine wirdauf die Alice oder LisaChips aufgesetzt. Die Karte ist vom französischen Händler Amedia Computer für99,92 EUR lieferbar. (hh)
Links:
https://www.amediacomputer.com/en/accueil/272scanplusagaforamiga12004000d.html
http://amigaprj.blogspot.de/2017/04/scanplusagaupdate.html
Amiga: Individual Computers legt Buddha IDEneu aufJens Schönfeld von Individual Computers teilt mit, dass aufgrund derhohen Nachfrage der Buddha IDEController neu aufgelegt wird. Dervor 20 Jahre erstmalig erhältlicheController erfreut sich immer nochgroßer Beliebheit. Die Neuauflagemit technischen Neuerungen undstark erweitertem Softwarepaket istmittlerweile lieferbar. (gb/hh)
Links:
https://icomp.de/shopicomp/de/newsreader/items/buddhaidekehrtzurueck.html
C64: Sams JourneyDas Entwicklerstudio Knights ofBytes hat mit Sams Journey ein neues Spiel für den C64 veröffentlicht.Es macht einen gelungenen Eindurckund kommt mit guter Musik. Die
Spielidee ist mit Giana Sisters vergleichbar. Es gibt verschiedene Gimmicks, die sich einsammeln lassenund die Eigenschaften der Spielfigurverbessern. So erwirbt man die Fähigkeit, an Wänden hochzuklettern,zu fliegen, besser zu werfen oder zuspringen oder Gegner mit demSchwert zu erschlagen. Es gibt dabeikeine Zeitbeschränkung. Das Spielwird in einer Box für 45, EUR aufDiskette oder für 55, EUR als Cartridge (PAL) verkauft. (gb)
Links:
https://www.knightsofbytes.games/samsjourney
Acorn: RiscOS Versionvon DoomRComp Interactive hat eine neueEdition der bekannten RiscOS Version von Doom veröffentlicht. Sie basiert auf den originalen UltimateDoom und Doom 2 Produkten undden offiziellen Erweiterungen. Ebenfalls enthalten ist die Acorn Versionvon Wolfenstein 3D, die auch aufmodernen Systemen wie ARMX6(mit Aemulor) getestet wurde. Besondere Verbesserungen des neuenReleases betreffen die Musikunterma lung. Es sind mehrere verschiedene Soundtrack Optionen verfügbar.Dazu gehört auch ein neuer, optionaler Soundtrack in hoher Qualität, derdas ursprüngliche MIDI Playback ersetzt. Die Version unterstützt einweites Feld an Addon "pwads" undist Multiplayer/ Netzwerkfähig.Doom ist voll kompatibel mit Titanium und anderen Systemen, die einRGB/BGR Colour Swapping benötigen. Damit werden alle RiscOSPlattformen wie RiscPC, VirtualAcorn, Iyonix, Raspberry Pi, ARMinioder ARMX6 oder TiMachine bedient. Die Software ist für 14,99 UKPounds erhältlich. (gb)
Links:
http://www.plingstore.org.uk/
Atari: HDDriver 10.11 erschienenUwe Seimet hat am 04. Februar 2017
die Version 10.11 seines Festplattentreibers HDDriver herausgegeben. Neu gegenüber der Vorversionist der neue Menüpunkt "Bootsektor prüfen" in den HDUTILS. Dieser überprüft, ob eine Partitionkompatibel mit dem gerade laufenden Betriebssystem und den aktuellen XHDILimits ist. Partitionenmit anderen als den aktuell eingestellten Limits erfordern möglicherweise eine neuere Version vonTOS oder Software wie BigDOS,um nutzbar zu sein. HHDriver istzum Lizenzpreis von 43, EURbeim Hersteller erhältlich. (gb)
Links
https://hddriver.seimet.net
Apple //: AppleIISDAnfang des Jahres hat Florian Reitzdie erste Kleinserie seines Projekts"AppleIISD" aufgelegt. Es handeltsich dabei um eine Speicherlösungfür enhanced IIe und IIgs, die SDKarten verwendet. Die AppleIISDKarte ist nicht die erste Speicherlösung auf SDKartenbasis. Im Gegensatz zu anderen Projekten sindhier alle Sourcen und das Layoutder Platine auf Github veröffentlicht. Die Apple Images werden mitCiderpress unter Microsoft "Windows" auf die SDKarte kopiert.Dabei vereinzelt auftretende Fehlerliessen sich auf Inkompatibilitätenzwischen den verwendeten Cardreadern und der USB Schnittstellezurückführen. Nicht jeder Cardreader läuft sowohl an USB2 undUSB3 Ports, Die Software für"AppleIISD" entsteht mit CC65 inVisual Studio und wird nochweiterentwickelt. So sollen dannunter GSOS auch vier oder sechsProDOS Partitionen erkannt werden. (gb)
Links:
https://github.com/freitz85/AppleIISd
http://bluemeanieretro.blogspot.de
88
Hardware
IDE Interface und TTRAM für Atari TT
Donner und Sturm am Fujiyama
Der Atari TT030 (für
"Thirtytwo/Thirtytwo")
wurde ursprünglich für
den professionellen Einsatz kon
zipiert. Der 1990 auf den Markt
gekommene Rechner ist mit ei
nem Motorola 68030 Prozessor
mit 32 MHz Prozessortakt aus
gestattet.
Beim Arbeitsspeicher wurde füreine möglichst hohe Kompatibilitätzur Atari ST Serie eine Zweiteilunggewählt: Das STRAM liegt innerhalb der ersten 16 MB des Adressraumes und verhält sich wie beimST. Der TT wurde mit 2 MD STRAM on board ausgeliefert. Hingegen steht das TTRAM, auch alsFastRAM bezeichnet, nur derCPU zur Verfügung. Meist wurdendie Atari TT mit 4 MB TTRAMausgeliefert, entsprechende Boardsermöglichen eine Erweiterung bis256 MB.
Als Massenspeicher kommt andersals in Atari MegaST undMegaSTE Modellen eine NarrowSCSI Festplatte am internen 50poligen SCSI Anschluss zum Einsatz. Die sonst verwendeten ASCIPlatten lassen sich extern anschließen.
Wenngleich sowohl die Konzeption des TTRAM als auch der Massenspeicherlösung bei derMarkteinführung sehr modern erschienen, bereitet sie heute durchaus Sorgen. Zum einen sindpassende TTRAM Speicherkartenrar gesäht und entsprechend schwerzu beschaffen. Andererseits werden50polige SCSI Platten schon langenicht mehr produziert. Es wird alsoimmer schwerer, bei Defekteneinen entsprechenden Ersatz aufzutreiben. Es gibt zwar Lösungen,die SDKarten und CompactFlashKarten an den SCSI Anschlussbringen. Preisgünstig sind diese je
doch nicht und die Verwendungbleibt auf genau diesen einen Einsatzzweck begrenzt.
Das IDE InterfaceThunderDiese Ausgangslage hatten die vierEntwickler Holger Zimmermann,Ingo Uhlemann, Matthias Gaczenskyund Christian Zietz aus dem AtariHome.DE Forum vor Augen, als sie
sich zusammenfanden, um eine bessere Lösung für Massenspeicher undRAM am TT zu entwickeln. Die Ideewurde 2016 beim Retro ComputerTreff RCT#11 in Hannover geboren.Herausgekommen ist dabei ein einzigartiges Interface names"Thunder". "Thunder" ist ein IDEInterface zum Anschluss von Festplatten, CDROMLaufwerken oderauch IDEbasierten SD oder CFKartenadaptern. Die "Thunder" wirdauf den TTRAM Sockel aufgesteckt.Außerdem sind zwei Signalleitungenzum Motherboard anzubringen. Istdiese Hürde erst einmal genommen,können bis zu 2 ParallelIDE Geräteim Master/Slave Betrieb angeschlos
sen werden. Der TTRAM Sockelwird durch die "Thunder" nicht blockiert, sondern ist durchgeschleift.Dadurch können vorhandene TTRAM Karten oder die "Storm"Kartebetrieben werden doch dazu spätermehr.
Die "Thunder"Karte ist eine vollständige Neuentwicklung, basierendauf einem programmierbaren Logikbaustein (CPLD von Xilinx). Siewird im SMD Reflowverfahren
handgefertigt. Um eine möglichstbreite Kompatibilität zur AtariSoftware zu erhalten, kennt die Karte dreiüber Jumper einstellbare Betriebsmodi: Einen FalconKompatibilitätsmodus, einen ByteSwap Modus undeinen SmartSwapModus. Letzterebedienen die Erfordernis, beschriebene Massenspeicher zwischen LittleEndian und Big Endian Architekturen austauschen zu können.
Neben der Hardware ist zum Betriebder "Thunder" ein passender Treibererforderlich. Mit HDDriver von UweSeimet steht ein solcher zur Verfügung. Ab der Version 10 dieser Software lässt sich dieser auch in das
Das Thunder IDE Interface für Atari TT
99
Hardware
Storm sorgt für mehrRAMWie eingangs beschrieben, ist nebendem Bedarf an zeitgemäßen Massenspeicherlösungen besonders die Beschaffung einer passenden TTRAMKarte die größte Sorge vieler AtariTT Besitzer. Dies wussten auch dieEntwickler und haben mit der"Storm" TTRAM Karte für Abhilfegesorgt. Auch die "Storm"Karte basiert auf dem Xilinx CPLD Logikbaustein und wird ähnlich gefertigt.Sie ist also kein Nachbau der bekannten MagnumTTKarte, sonderneine unabhängige Neuentwicklung.Die Karte wird einfach auf den TTRAM Steckplatz des Motherboardsoder einer bereits eingebauten"Thunder"Karte gesteckt. Der aufgesteckte RAM Speicher wird ohneweitere Arbeiten an der Hardwareund ohne Treiber erkannt. Als RAMSpeicher kommen PS/2 RAM Module in gleicher oder verschiedenerGröße zum Einsatz (16/32/64/128MB Module). Es kann sich um Fastpage oder um EDO (extended dataout) Module handeln, für die dieKarte zwei Steckplätze bietet.
Die TTRAM Karte Storm nutzt sowohl FastPageals auch EDO PS/2 SIMMs
TTRAM laden, wodurch dieÜbertragungsgeschwindigkeit sichdeutlich steigern läßt. Mit einerCFKarte wurden DatentransferGeschwindigkeiten von 5750kByte/s gemessen. Um von einerIDE Festplatte booten zu können,ist eine weitere Anpassung nötig.Normalerweise ist das Betriebssystem des Atari nämlich dazunicht in der Lage. Es wird daherein TOS 3.06 mit dem IDE Patchbenötigt. Das Entwicklertean stellrein gepatches TOS 3.06 ROM bereit, das mehrere Patches enthält:"IDEBoot" ermöglicht das Bootendirekt vom IDEGerät, "RAM SizeFit" zeigt die Größe des FastRAMauch über 100 MB korrekt an,"WinX 2.3n"verbessert dieFensterverwaltung, "SHBuf" vergrößert den Pufferspeicher,"BPatch" verbessert die Floppyverwaltung und "New TOS Logound Dialog" visualisiert das gepatchte TOS.
Da es sich um Handfertigungenhandelt, die zwar aus gedrucktenPlatinen (PCB) bestehen, aber manuell bestückt werden, sind dieKarten nicht unbegrenzt ab Lagerverfügbar. Die ersten Exemplareim Jahr 2017 waren schnell vergriffen, eine erste Serie in 2018 istin Vorbereitung. Es lohnt sich also,bei Interesse regelmäßig auf AtariHome.DE vorbei zuschauen. DieKarten werden zum Preis von je80, EUR angeboten. (gb)
Links
http://wiki.newtosworld.de/index.php?title="Storm"
http://wiki.newtosworld.de/index.php?title=Thunder_IDE_Interface
Jumpereinstellungen der Thunder
1010
Hardware
USB Interfaces für Atari TT und Atari MegaSTE
Endlich zeitgemäß
Atari 16/32Bit Computer
sind von Haus aus
kommunikative Geräte.
Sie verfügen mit seriellen und
parallelen Schnittstellen über
standardisierte Anschlüsse für
Peripheriegeräte und verfügen
über MIDI und ROM Ports.
Doch es ist mit diesen über drei
Jahrzehnte alten Schnittstellen
nur mit Mühen möglich, aktuelle
Geräte am Atari zum Laufen zu
bringen. Drucker, Scanner, Mas
senspeicher und andere Geräte
verwenden heute überwiegend
den "Universal Serial Bus", sei es
in der ursprünglichen 1.1 Version
oder den neueren 2.0 oder 3.1
Spezifikationen. Und dieser Port
fehlt natürlich den Geräten.
USB Ports für AtariDen Atari 16/32Bit Modellen zueinem USB Port zu verhelfen, haben sich mehrere Projekte auf dieFahnen geschrieben. In gewisserWeise sind auch Floppyemulatorenwie die beliebte LowCost Lösungder chinesischen Firma GOTEK eine USB Implementierung für denAtari. Aufgrund der andersartigenAusrichtung und fehlenden Universalität soll dieses Gerät hier nichtweiter Beachtung finden. Dies giltauch für die verschiedenen Projekte,die den Anschluss von USB Mäusenund USB Tastaturen an den Atari STim Focus haben. Auch für das CosmosEX Subsystem von Jookiebleibt außen vor– hier lassen sichUSB Massenspeicher als emulierteFestplatten am ACSI Port einbinden.
Echte USB Adapter stellen lediglichdie USB Schnittstelle selbst bereit.Sie sind universell für viele USBGeräte verwendbar wenn passendeTreiber bereitstehen!
Die Lightning VME Karte bringt USB Ports für Atari TT030 undMegaSTE. Hier ist die Karte von der Ober und von der Unterseite zusehen. Sie wird zwischen VME Board und Motherboard gesteckt.
Unicorn USBAlan Hurrihane hat mit dem UnicornUSB Adapter für den ACSI (DMA)Port eine einfach anzusteckende Lösung entwickelt. Der im länglichenSteckergehäuse daherkommendeAdapter wird von außen auf einenACSI Port aufgesteckt. Er bietetzwei USB TypA Buchsen. Der externe ACSI Port wird durchgeschleift, Peripheriegeräte bleibenalso weiterhin nutzbar. Die für TOSund MiNT verfügbaren Treiben unterstützen Massenspeichergeräte(Festplatten, CDROMLaufwerke,USB Sticks), USB Mäuse und USBNetzwerkadapter, sofern diese aufdem ASIX 88772 Chip basieren(z.B. DLink DUBE100 Rev B.1).Der Adapter ist für 50. £ beim Entwickler bestellbar.
NetUSBeeAuch die NetUSBee von EntwicklerLyndon Amsdon liefert neben einerEthernet auch eine USBSchnittstelle. Sie wird an den ROMPortAtari angesteckt. Allerdings ist dieTreiberunterstützung recht dürftig
USBMäuse funktionieren, solangesie das PS/2 Protokoll unterstützen.Ein Treiber für USBSticks ist bisher nicht erschienen. Die EthernetFunktion wird durch Sting (TOS),MiNTNet (MiNT) und MagiCNet(MagiC) hingegen gut unterstützt.Prinzipbedingt ist besonders dasSchreiben auf die Schnittstelle nichtsonderlich schnell. Die NetUSBeeist für 59, € bei Lotharek's Lair bestellbar.
Lightning VMESowohl der Anschluss an den ACSIPort als auch die Lösung über denROM Port missbraucht streng genommen eine eigentlich für andereZwecke gedachte Schnittstelle.Diese Anschlussarten sind aus derNot heraus geboren, die aus demFehlen eines echten Erweiterungsbusses im Atari entsteht. Allerdingshaben späte AtariModelle hier dazugelernt: Sowohl der Atari TT alsauch der Atari MegaSTE verfügenmit dem VME Bus (Versa ModuleEurocard Bus) über einen Slot fürErweiterungskarten. Der für Motorola 68000 Systeme von einem
1111
Hardware
Konsortium um die UnternehmenMotorola und Philips entworfeneBus verfügt über einen 16BitDatenbus und 24Bit Adressbus.Beim Mega STE ist die Spezifikation VMEBus Rev. C.1 implementiert. Der VME Bus steht beibeiden Systemen nicht im Rampenlicht– hauptsächlich findet erAnwendung für eine überschaubare Anzahl an Grafikkarten. Nochseltener sind Ethernetinterfacesoder Karten für Mess und Regeltechnik.
Das Entwicklerteam der Thunderund Stormerweiterungskarten (siehe Artikel im gleichen Heft) ist angetreten, dem VME Bus einegrößere Daseinsberechtigung zugeben. Mit der VME Buskarte"Lightning VME" bringen die fleißigen Konstrukteure eine USBSchnittstellenkarte für den MegaSTE und den TT030 an den Start.
Die Karte hat zwei USB 1.1 Ports.Eine Erweiterung mit einem USBHub ist möglich, sofern dieser dasUSB 1.1 Protokoll unterstützt.Aufgrund der Abwärtskompatibilität der USB Spezifikationen ist esaber auch möglich, USB 2.0 oder3.0 Geräte mit der "LightningVME" zu betreiben. Die Karte istals Aufsteckplatine für die VMEBackplane konzipiert und wird
zwischen Flachbandkabel und Platineaufgesteckt. So bleibt der VMESteckplatz weiterhin benutzbar.
Ein großes Thema bei der Entwicklung war die Interoperabilität der"Lightning VME" mit üblichenGrafikkarten. Erfolgreich getestetwurden unter anderem das Zusammenspiel mit einer Nova ET4000(1024*768*256 Farben) im MegaSTE unter TOS 2.06, MiNT und MagiC. Allerdings muss der GAL aufder Nova getauscht werden. Die Nova beansprucht nämlich den gesamten VME Adressraum für sich undverhindert so die Verwendung anderer VME Karten. Christian Zietz hatim AtariHome.DE Forum ein kleines Testprogramm veröffentlicht. Esprüft mögliche Adresskonflikte beiVME Bus Karten. Erste Ergebnisselassen auf die problemlose Verwendung von TKR CrazyDotsKarten(mit HiColorModul und 15 BitFarbtiefe ) und der Matrix MatGraphTC 1208 hoffen. Auch eine MatrixTC1006 im Atari TT030 produziertkeine Konflikte. Ohne Modifikationen funktioniert auch eine ECLGrafikkarte. Neben Grafikkartenwurde auch eine RIEBL Netzwerkkarte im TT030 erfolgreich getestet.
USB Stick und Maus am Atari MegaSTE unter MagiC
TreiberDie Karte allein genügt natürlichnoch nicht für eine erfolgreicheNutzung von USB Geräten hierbestimmen die verfügbaren Treibermaßgeblich, was funktioniert undwas nicht. Die Karte läuft sowohlunter TOS als auch unter MiNTund MagiC. Der grundlegendeMiNT/ USB4TOSUSBStackwurde von Christian Zietz für dieVerwendung der "Lightning VME"Karte modifiziert. Er unterstütztMassenspeicher wie USB Sticks,Festplatten, CDROMLaufwerke,USB Mäuse und einige USBTastaturen sind verwendbar. Aberauch ein DLink Ethernetadapterwird bereits erkannt. ErsteVersuche mit einem USBFloppylaufwerk im März 2018verliefen ebenfalls erfolgreich.
Die Übertragungsgeschwindigkeitwird entscheidend von der verwendeten CPU bestimmt. Die Hauptarbeit beim Datentransfer leistet derTreiber und der kann nur so schnellarbeiten, wie die CPU das erlaubt.Dennoch ist die erreichte Geschwindigkeit beeindruckend: Sieliegt bei Zugriffen auf einen USBStick bei 320 kBit/s im MegaSTEund 600 kBit/s im TT030. ZumVergleich: Die USB 2.0 Schnittstelle der Firebee bewegt sich imTest bei 920 kBit/s.
Die "Lightning VME" ist direkt beiden Entwicklern erhältlich. DerPreis liegt bei 80, EUR. (gb)
Links
http://www.atarikit.co.uk/unicorn/unicorn.html
http://www.lotharek.pl/product.php?pid=73
ttps://forum.atarihome.de/index.php?topic=14000.0
1212
und Storm. Um es einmal ganzdeutlich zu sagen: ohne die beidenRCT damals wären wir nicht dort,wie wir jetzt stehen.
LOAD: Wie seit ihr auf die Idee
gekommen, ein neues IDE Inter
face für den TT030 zu entwickeln?
Es gibt doch bereits IDE Lösun
gen?
Holger: Die Anregung dazukam von Frank Lukas, schon vor
einigen Jahren. Er sagte, es gäbemittlerweile IDEInterfaces für alleAtaris, nur der TT sei außen vor.Ginge das nicht? Jetzt sehen wir:Doch, es geht! Es hat nur etwasgedauert.
Matthias: Bis Anfang 2016war mir nicht einmal ansatzweisebekannt, dass es eine IDE Lösungfür den TT gibt. Umso erstaunterwar ich, als ich von Holger davonhörte und war Feuer und Flamme.Ich habe viel mit SCSI Geräten amAtari probiert, aber diese zu beschaffen, wird immer schwieriger.Bei IDE Geräten sieht das zumGlück noch anders aus und auchder Austausch mit anderen Systemen ist so wesentlich einfacher.Ein weiter wichtiger Grund war für
Interview
Die Thunder Storm und Lightning VME Entwickler im Gespräch
„Gutes zu verbessern, das ist unser Ziel“
Das LOAD Magazin hatte
die Gelegenheit, mit den
Entwicklern der Atari
Karten Thunder, Storm und
LightningVME ein Interview zu
führen.
LOAD: Das ThunderstormTeam
besteht aus vier aktiven Entwick
lern und zwei BetaTestern. Wie
habt ihr euch zusammengefunden?
Christian: Ich bin erst seitder Lightning VME dabei. Ichwurde von den Thunder/StormEntwicklern (Holger, Ingo, Matthias) gefragt, ob ich bei der Arbeit ander Lightning VME mithelfenwollte. Konkret ging es darum, dieAnpassung der Treiber vorzunehmen. Man musste also sowohlKenntnisse in der Programmiersprache C als auch Verständnis vonHardware und deren Debugginghaben. Ich hatte vorher schon kleinere eigene Soft und Hardwareprojekte für den Atari ST realisiertund fand die Lightning VME einespannende Herausforderung.
Holger: Auf einer vorläufigen Teilnehmerliste für den RetroComputer Treff NiedersachenRCT#11 in Hannover Döhren Anfang 2016 (Anmerkung: eine Veranstaltung des VzEkC e.V) hattesich Matthias angemeldet. Der Name war mir aus dem Forum geläufig, er war bei AtariHardwareziemlich aktiv. Da habe ich mir gesagt, dann gehe ich auch mal dahin. Das ist ja auch keine Weltreisefür mich. Dort sind wir ins Gespräch gekommen, und der Resthat sich ergeben.
Ingo: Matthias und ich kennen uns schon seit ein paar Jahrenund haben schon viel zusammenerlebt. Nachdem sich Matthias undHolger in Hannover das erste Malgetroffen haben, berichtete er vondem Treffen und worüber gespro
chen und gefachsimpelt worden war.Da mich Hardware und Hardwaredesign schon länger beschäftigenund ich auch schon einige Sachenfür die Ataris aufgelegt habe, habeich mich dem Team angeschlossen.
Matthias: Ich hatte mich miteinem späteren Betatester auf demRCT#11 verabredet. Holger, den wirbis dahin nicht persönlich kannten,stieß dazu und entwickelte sich imGespräch die Idee, eine hochinte
grierte Version der IDE Erweiterungzu verwirklichen. Holger hatte zudiesem Zeitpunkt bereits das Grundkonzept in diskreter Bauweise verwirklicht, wovon es aber nur eineHandvoll Karten gab. Ich konnte ihnüberzeugen, dass das Interesse daransicherlich deutlich höher sein wird,wenn dies publik gemacht würde.Glücklicherweise ließ sich Holgerüberreden und war bereit, seinKnowHow zur Verfügung zu stellen, wenn er Unterstützung beimTesten und Aufbau bekäme. Ausdieser Idee heraus bildete sich dasTeam dann beim RCT #12, bei demIngo dazu stieß. Etwas später kamdann die Idee der FastRAMKartedazu und als beides spruchreif war,erfolgte die Namensgebung Thunder
Das erste Zusammentreffen zwischen Holger (2. von links) undMatthias (rechts) auf dem RCT#11
1313
mich: Ein leiser Rechner, wenigerStromverbrauch sowie Platz unterder dann ja leeren "Brotdose".
LOAD: Was waren die besonderen
Knackpunkte bei der Entwicklung
der "Thunder"?
Holger: Wie konnte man dieim TT anschließen, ohne andereErweiterungen zu behindern? DieLösung mit einem VGSteckverbinder mit langen Pins war schnellgefunden, aber Kontaktproblememit den ersten Mustern trieben unszur Verzweiflung. Gerettet habenuns schließlich vergoldete Steckverbinder. Und es gab die unvermeidlichen Überraschungen mitden verschiedenen MainboardRevisionen. So hat uns einmal einunsauberes /ASSignal aufgehalten. Das hat Atari wohl auch selbstbemerkt: In späteren Revisionen istdieses Signal besser terminiert.
Ingo: Aus meiner Sicht wares die Anpassung des TOS, damites von IDE Booten kann. Das wirdvon Tos 3.06 im TT nicht unterstützt, anders als bei TOS 2.06 imMegaSTE. Gerade hier hatten wirgrößere Schwierigkeiten, beispielsweise nachdem MiNT hochgefahren war: Wenn dann einReset ausgeführt wurde, konntenicht mehr von IDE gebootet werden. Auch die Performanceoptimierung war eines der Dinge, diewir sehr hoch priorisiert haben.Von der anfänglichen Geschwindigkeit von 3,5 MBit/s sind wir bei5,86 MBit/s gelandet.
LOAD: Die "Thunder" erwartet
ParallelATA Devices, die mittler
weile so gut wie ausgestorben sind.
Wieso verwendet die "Thunder"
keine SATA Schnittstelle?
Holger: Die Karte solltekompatibel zu den vorhanden Interfaces sein, und zwar zu allenbekannten: dem Falcon als AtariStandard, denen von ppera mit"verdrehten" DatenbusLeitungenund dem SmartSwap, wie er vonHDDDriver unterstützt wird. Fürkleines Geld gibt es außerdemAdapter von PATA auf SATA,
Interview
CFKarten oder SDKarten das sollte reichen.
Matthias: Und es war durchaus auch eine Kostenfrage. Aber auchangesichts der Handanfertigung wurde Wert auf eine möglichst einfacheUmsetzung gelegt. So ist es dann jaauch gelungen, alles auf nur einenChip zu packen. Für eine SATASchnittstelle wäre mehr erforderlichgewesen.
LOAD: Habt ihr schon einmal an ei
ne "Thunder" Variante für Atari 16
Bit Systeme nachgedacht?
Holger: Nein. Ich denke, dagibt es schon genügend Lösungen.Uns reizt mehr, zu entwickeln, was esnoch nicht gibt oder wo noch deutliches Verbesserungspotenzial besteht.
LOAD: Kommen wir zur "Storm". Ihr
betont, dass es sich nicht um einen
Magnum TT Nachbau handelt. Wo
liegen die Unterschiede?
Holger: Die Storm basierttechnisch auf der FRAK, der FastRAMKarte zur PAK68/3. So unterstützt die Magnum z.B. keinen BurstModus, die Storm hingegen wahlweise "FastPageMode" (FPM) oder"Extended Data Out" (EDO).
Ingo: Die Magnum ist einegute Karte, aber wir haben uns zumZiel gesetzt, es mit der Storm besserals bei allen bereits existierendenKarten zu machen. Dafür waren vieleDiskussionen notwendig! So sah dasursprüngliche Layout der Storm eineautomatische Erkennung der Speichermodulgrößen vor. Aber die PS/2Module sind seitens der Hersteller oftnicht korrekt codiert, daher gab es zuviele Probleme. Aus diesem Grundhaben wir uns für eine Umsetzungper Jumpersetting entschieden.
LOAD: Wie vertragen sich
"Thunder" und "Storm" mit übertak
teten Rechnern?
Ingo: Thunder und auch Stormlaufen einwandfrei in einem mit20Mhz getakteten TT (Bus 20Mhz,CPU 40Mhz). Der Performancegewinn liegt bei rund 24%. So läuftin meinem TT, der mit 20/40Mhz getaktet ist, die Storm rund 65%
schneller als eine originale AtariFastRAMKarte mit 16/32mhz.
LOAD: Mit der "Lightning VME"
gewinnt der VME Bus des MegaS
TE und des TT030 deutlich an Be
deutung. Was hat euch bewogen,
diese Schnittstelle auszuwählen
und nicht beispielsweise eine
weitere Lösung für den ROM Port
zu bauen?
Holger: Wir wollten denmaximalen Speed aus dem gegebenen Konzept herausholen, undda ist der ROM Port nicht ideal.Insbesondere gilt das für Schreibzugriffe, die dort nur mit Tricksmöglich sind. Aktuelle ICs hättenwir auch gerne genommen, aberdazu müsste man dann einen vollständig neuen Treiber programmieren, und da will irgendwieniemand so richtig dran. Schließlich ist natürlich eine interne Lösung viel schicker und derROMPort bleibt frei für andereDinge.
Ingo: Angefangen hat es damit, das ich eine NetUSBee undeinen CPLD als Adressdecoder direkt mit dem VME Bus verkabelthabe und den bereits existierendenTreiber von der EtherNAT (FalconCT60 Erweiterung) angepasst habe. Nach ersten Tests konnte ichmit dem USB Chip kommunizieren und kleine Datenpakete austauschen. Also haben wir unshingesetzt und eine PrototypenPlatine gefertigt, welche auchschnell zum Einsatz kam. Da diessehr gut funktionierte und wirdurch Optimierungen der Firmware und des Treibers recht gute Ergebnisse erzielten, stand derROMPort gar nicht mehr zur Debatte.
Matthias: Hier ist es wiemit der Thunder und der Storm. Essollte eine möglichst einfach zuinstallierende, interne Lösung her.Das ist uns vortrefflich gelungen.Beide Rechner können um zweiUSB 1.1 Port erweitert werden,ohne dass irgend eine der vorhandenen Schnittstellen dafür belegt
1414
wird. Ich finde die Lösung immernoch genial, denn so wird der Atarium eine weitere, gängige Schnittstelle erweitert. Und das Ganzepasst auch ins originale Gehäuse.
LOAD: Wie viel Entwicklungsar
beit steckt in den Anpassungen der
Treiber für die USB Schnittstelle?
Welche Treiber und Softwarekom
ponenten habt ihr angepasst oder
neu entwickelt?
Christian: Wir konnten aufdem existierenden USBStack vonFreeMiNT aufsetzen, der teilweiseauch für Plain TOS portiert wurde.Das ist großes Glück, denn hinterden Kulissen ist USB ein unheimlich komplexes Protokoll. Bei USBmuss schon sehr viel passieren, damit ein angestecktes Gerät überhaupt erkannt wird, geschweigedenn danach auch etwas Sinnvollestut. Aus dem USBStack konntenwir die Gerätetreiber für Mäuse,USBSticks und bestimmte USBEthernetAdapter als Grundlageübernehmen. Allerdings hat sichherausgestellt, dass diese Treibernoch einiges Optimierungspotential haben. Wir haben auch daranÄnderungen vorgenommen, um diePerformance dieser Geräte an derLightning VME zu erhöhen. Fürdie Lightning VME selbst setzenwir auf denselben USBChip wiedie NetUSBee. Auch hier warendeutliche Verbesserungen amQuelltext des Treibers nötig, sowohl hinsichtlich der Leistungsfähigkeit als auch der Lauffähigkeitunter Plain TOS. Dafür kann ichnun sagen, dass wir mit der Lightning VME nahezu das Maximuman Geschwindigkeit herausholen,die dieser Chip zu bieten hat.
Holger: Mein Beitrag ist darelativ gering zum einen war esder Vorschlag, den Datenbus imVergleich zur NetUSBee "verdreht"anzuschließen, zum zweiten eineAssemblerroutine zum "Datenschaufeln" zu programmieren.Beides soll den größtmöglichenSpeed herauszukitzeln. Allerdingswar der Effekt etwas geringer als
Interview
erwartet, Christian konnte da in derSoftware ganz andere Bremsen lösen.Jetzt erweist sich tatsächlich USB 1.1als Flaschenhals.
Matthias: Der Beitrag von Ingo und mir lag in mehreren DutzendTests der Karte im TT030 undMegaSTE unter verschiedenen Betriebssystemen und Varianten. Späterdann testeten wir die inzwischenlauffähigen Kombinationen zwischen"Lightning VME" und den Rechnernmit diversen Grafikkarten für denVME Bus.
LOAD: Ihr habt in den letzten 1½
Jahren mit den Thunder, Storm und
LightningKarten gleich drei kom
plette Neuentwicklungen in die Ata
riwelt eingebracht. Wie schafft ihr
das so schnell? Wie viel Zeit ist in die
Entwicklung geflossen?
Christian: Wie meine Mitstreiter entwickele auch ich für dieLightning VME rein in meiner Freizeit. Ich bin jetzt seit August 2017dabei, je nach freier Zeit mal mehrund mal weniger stark involviert. Ichhabe die Stunden nie zusammengezählt, aber in besonders intensivenPhasen wie vor der ersten öffentlichen Demo der Lightning VME aufdem "Oberfränkischen AtariMeeting" habe ich viele Abende am Stückdamit verbracht.
Holger: Die Zeit habe ichnicht gezählt. Von Vorteil ist, dassEntwicklung, Test und Fertigungauf mehrere Schultern verteiltsind. Das geht dann nicht nurschneller, sondern hilft einem auchüber Phasen hinweg, wenn nichtsso richtig laufen will.
Ingo: Da wir alle Familiehaben und einem Job nachgehen,ist es nicht immer einfach, allesunter einen Hut zu bekommen, oftsind es hier mal eine Stunde damal zwei Stunden, aber generellhaben wir die Stunden, die an Entwicklung rein geflossen sind,nicht gezählt. Man muss auchnoch bedenken, dass auch Aufwand für Erlernen von Technikenoder Wissen aufgebracht werdenmusste. So haben mich diese Projekte näher an die ThematikGAL/VHDL gebracht.
Matthias: Die Anfertigungder Hardware wird von mir in derFreizeit vorgenommen. Diese ist,neben Beruf und Familie, durchausknapp bemessen. Aber es ist immer wieder schön, wenn ein Plangelingt und man das Ergebnissieht. Meist ist es übrigens Holger,der bereits das nächste Ass im Ärmel hat. Wir dürfen da alle gespannt sein.
LOAD: Wie sind eure Entwicklun
gen in der Szene aufgenommen
worden?
Ingo: Das Feedback, waswir erhalten haben, war durchwegpositiv. Natürlich gab es auchKritiken, wobei einige davon auchals Verbesserungsvorschläge füreventuell zukünftige Neuauflagengenutzt werden können.
Matthias: Das stimmt. DasFeedback war und ist recht gut.Andernfalls würden wir wahrscheinlich auch kaum weitermachen. Eine Vorschläge von Usernsind tatsächlich in späteren Revisionen aufgenommen worden.
LOAD: Wie groß schätzt ihr den
Markt für diese Entwicklungen
weltweit ein?
Die "Thunder" Karte eingebaut imAtari TT030
1515
Ingo: Wenn man sich dieGruppen in den sozialen Medienanschaut, dann ist der Markt nichtso groß wie für den ST oder Falcon, aber für ein reines Hobbyprojekt schon ausreichend.
Matthias: Erstaunlich findeich, dass gut die Hälfte der Nachfragen aus aller Welt hereinkommt. So befinden sich ThunderstormKarten inzwischen in nahezu jedem Land in Europa, vonSpanien bis Finnland, Großbritannien bis Griechenland. Einige sindauch in die USA gegangen, auchSingapur und Australien sind dabei. Ich vermute, dass es bei derLightning sogar noch eine größereNachfrage gibt.
LOAD: Wie ist es um die Verfüg
barkeit der Karten bestellt? Habt
ihr erwogen, größere Chargen als
Auftragsfertigungen herstellen zu
lassen?
Matthias: Aufgrund des besonderen Designs von Thunderund Storm wird man um eineHandfertigung nicht herum kommen. Diese stellt inzwischen keinProblem dar, denn die Teile undPlatinen sind gut beschaffbar. Eskostet nur Zeit. Zudem erfolgt einGroßteil der Fertigung im ReflowVerfahren, wozu ich mir extraeinen passenden Ofen modifizierthabe. Andererseits ist der Marktleider nicht so groß, dass sich eineindustrielle Herstellung lohnenwürde. Diese würde die Kostendeutlich ansteigen lassen. Es istund bleibt eben ein Hobbyprojekt.So werden Anfragen gesammeltund quasi im Dutzend abgearbeitet.
LOAD: Was habt ihr für die
Zukunft in der Planung?
Holger: Wir fragen uns: Wasgibt es noch nicht? Wo könnte mannoch mehr Speed holen? Waskönnte sonst noch verbessert werden? Da gibt es schon Ideen imUmfeld der CPU und der Videodarstellung.
Ingo: Es gibt viele Ideen,und und es wurden auch bereits zu
Das Interviewwurde per EMaildurchgeführt. Die Fragen für dieLOAD stellte Georg Basse.
Interview
einigen Machbarkeitstests angestellt.Aber da möchte ich noch nicht soviel verraten.
LOAD: Sagt doch bitte zumSchluss noch ein paar Worte übereuch und eure Affinität zu AtariRechnern!
Christian: Ein gebrauchterAtari 1040STF war einst mein erstereigener Rechner; mein erstes größeres Hardwareprojekt damit war dessen Aufrüstung auf 4 MB RAM inden 1990er Jahren. Nachdem derAtari aus Platzgründen lange Zeitsicher verstaut aufbewahrt war, hatteich vor ca. 2,5 Jahren endlich wiederdie Möglichkeit ihn bei mir aufzubauen. Ich habe relativ schnell wieder den Spaß entdeckt, daran zubasteln und dafür zu entwickeln undhabe diverse kleinere Projekte auchim Internet veröffentlicht, wo sie aufResonanz gestoßen sind. Abseits vonder AtariWelt bin ich als Entwicklerfür Fahrerassistenzsysteme bei einemAutomobilzulieferer beschäftigt. Interessanterweise arbeite ich dort auchan der Schnittstelle zwischen Hardware und LowLevelSoftware; Fähigkeiten, die mir auch bei derLightningVMEEntwicklung nützlich sind.
Holger: Mein erster Computerwar ein Sinclair ZX81, für den ichschon damals etliche HWErweiterungen gebastelt hatte. Später, so um1987 habe ich mir einen gebrauchten520ST gekauft, 1MB RAM, externesDoppelFloppyLaufwerk, SM124.Und es hat nicht lange gedauert, bisich auch dort anfing, ihn zu erweitern. Als Lohn für die Wiederbelebung eines ST, der bei einermissglückten RAMAufrüstung verstorben war, bekam ich von einemMotorolaMitarbeiter einige 68020ergeschenkt. Das war dann der Startschuss zur Entwicklung derPAK68/3. Aber das ist eine andereGeschichte.
Ingo: Mein erster Computerwar ein Atari 130XE, den mein Vatergekauft hat. Damals war ein Computer und dann dazu noch ein "West"Computer in der ehemaligen DDR(1985) etwas besonderes und es gabnur ganz wenige. Mein erstes Pro
gramm habe ich mit 8 Jahren geschrieben und dazu die Hardwaregelötet. Ich nutzte dazu den JoystickPort und schloss da 8 LED´san, die ich mit einem Basicprogramm zu einem Lauflicht blinkenlies. Seit dem hat mich das ThemaAtari nur zeitweise losgelassen.Gegen 1993 rüstete ich damalsmeinen Mega ST auf, zu den Aufrüstungen gehörten 4 MByteRAM, TOS 2.06, SCSI Festplattenüber einen AdScsi Adapter undspäter dann noch eine ET4000Grafikkarte über ein Selbstbauprojekt. Dieser MegaST hat leidereinen Blitzeinschlag in die Stromleitungen nicht überlebt.
Matthias: Mein Computererstkontakt war damals Ende der1980er Jahre im Ferienlager miteinem KC85, auf dem ein Pacmanartiges "Hase und Wolf"Spiel lief einfach cool! Dankmeiner Eltern bin ich unmittelbarnach der Wende zu meinem erstenComputer gekommen, einem Atari1040STE. Ich kam damals auf diePenne, ich sollte oder wollte einenComputer haben. Meine Elternlegten mir dazu einen Otto Katalog vor. Es hieß: C64, Amiga 500oder Atari ST. Meine Wahl habeich nie bereut. Den 1040STE habeich im Laufe der Zeit erweitert,auch um eine interne IDE Schnittstelle. Ich besitze den nach wievor lauffähigen Rechner übrigensnoch heute. Über kleine Problemean einem Falcon ist der Kontakt zuIngo schon vor inzwischen 12Jahren entstanden. Beruflich habeich mit Computern nur insoweit zutun, als sie mein tägliches, leiderunverzichtbares Schreib undKommunikationsmittel sind. Anders als die 3 Mitstreiter habe ichberuflich nichts mit Hard oderSoftwareentwicklung zu tun. (gb)
1616
Hardware
Ein PC Board für den Amiga 500
Der Parasit in der Trapdoor
Die AmigaSerie von
Commodore besteht aus
Rechnern mit bahnbre
chenden Eigenschaften. Sie war
Mitte der 1980er Jahre ihrer Zeit
weit voraus. Dies war aber auch
die Zeit, in der sich der IBM
Personal Computer am Markt
etablierte. Und eines sind die
AmigaRechner nicht: IBM
kompatibel! Diese Eigenschaft
lässt sich bei vielen Amigas aber
einfach nachrüsten.
Für den Amiga 1000 gibt es das Sidecar A1060 von Commodore. Fürdie BigBoxAmigas, also denA2000, A3000(T) und A4000(T)existieren die Bridgeboards vonCommodore und Vortex. Sie sindeine wunderbare Lösung, um seinem Amiga ein zweites Standbeinzu verschaffen und Softwarekompatibilität zur PCSeite herzustellen. Für die meistverkaufteFreundin aus der AmigaSerie, denA500, gab es vom Hersteller selbstallerdings keine Lösung. In dieseLücke sprangen andere Anbieter.
Warum sich Commodore diesesGeschäft entgehen ließ, ist nichtbekannt. Mit der niederländischenFirma Kolff Computer Supplies,kurz KCS, wurde diese dieseLücke sehr erfolgreich geschlossen. KCS hat eine Art Mehrzweckwaffe für den A500 entwickelt.Diese Lösung stellt kein Bridgeboard dar, sie schlägt keine Brückezwischen der ZorroWelt des Amigas auf der einen und der ISAWeltdes PCs auf der anderen Seite.Vielmehr wird dem A500 ein kleiner Parasit in seinen Trapdoor eingepflanzt, der bei Bedarf dieHerrschaft über seinen Wirt übernimmt und dessen Ressourcen verwendet.
Dieses KCS Power PC Board, dasnicht mit einer PowerPC Prozes
sorkarte für den Amiga verwechseltwerden darf, verdrängt somit dieSpeichererweiterung aus der Trapdoor. Und genau dort zeigt die Karteihren Mehrwert: Die Power PCBoards stellen auch eine entsprechende Speichererweiterung für denWirtsAmiga bereit und verhaltensich auf den ersten Blick auch genauso.
Original verpackt von KCS
Die Originalverpackung der unterschiedlichen KCSBoardVersionenunterscheidet sich kaum. Hier weichen nur die Abbildung des Boardsauf der Verpackung voneinander abund es findet sich ein dezenter Hin
weis auf die tatsächlich enthalteneVersion. In unserem Beispiel bezieht sich der Hinweis auf dieTurboVersion auf die beiliegendeSoftware in der Version 4.5, dieauch 68020 und 68030 CPUs imAmiga unterstützt. Dieser Versionlag im Übrigen auch noch eineMSDOS Lizenz bei, wie man unschwer am Etikett erkennen kann.Je nach Ausstattung wurde sogareine vollwertige MSDOS 4.01Lizenz beigelegt.
Als Software lag bei Auslieferungdie entsprechende KCSSoftwarefür den Amiga als auch für denPCTeil bei. KCS hat zu Beginnsogar eigene Shutter verwendet,
1717
Hardware
bis später Disketten von der Stangebenutzt wurden. Zuletzt wurdeauch die Diskette mit den MSDOSTools eingespart. Späterwanderten die MSDOSDiskettenin die OVP des KCS Power PCBoards und oft genug war keineMSDOS Lizenz dabei– das warwohl billiger für den Käufer. Dadie einzelnen Versionen desBoards sich nicht ihrer Einstellungunterscheiden und am Board selbstnahezu keine Einstellungen vorzunehmen sind, bezieht sich dasHandbuch über weite Strecken immer auf die mitgelieferte SoftwareVersion.
Technik der KCS Karten
Nachdem wir uns das Drumherumangesehen haben, kommen wir nunzu den technischen Details desPower PC Boards. Da ist zunächstder Prozessor. Auf allen Boards arbeitet eine NEC V30 CPU, frühermit 8 MHz und später mit 10 MHz,also eine vollwertige 8086kompatible CPU. Die Verwendung einerFPU ist nicht vorgesehen. Die eigentliche Geschwindigkeit desProzessors hängt interessanterweise von der eingesetzten KCSSoftware ab. Aber mit einem SystemIndex (SI) Vergleichsfaktor (gemessen mit Norton SI 4.5) zwischen 3,7 und 4,8 braucht sich dasKCS Power PC Board nicht hinterden XTBrückenkarten von Commodore verstecken. Diese liegenzwischen 1,0 und 1,8, werden alsonicht nur eingeholt, sondern umLängen überholt. Selbst den Vergleich mit 286er Emulatoren wiedie Vortex ATOnce Classic oderA2286 oder braucht das KCSBoard nicht fürchten. Eine ATOnceClassic schafft einen Vergleichsfaktor von 4,4 (Norton SI 4.5) undeine A2286 kommt auf 7,7.
Das KCS Power PC Board hat keineigenes BIOS PROM. Das BIOSwird durch die Systemsoftware andie entsprechende Stelle im Speicher des Boards geschrieben. Somit ist die BIOSVersion auch vonder verwendeten Systemsoftwareabhängig.
Es befindet sich 1 MB Arbeitsspeicher auf der Steckkarte, der je nachBasissystem im AmigaModus leichtunterschiedlich verwendet wird.Wird der PCTeil aktiviert, dann giltfür alle Versionen:
____ 704 kB freies RAM im MGA/CGAModus
____ 640 kB freies RAM im EGA/VGAModus
____ 200 kB ExtraSpeicher für eineresetfeste RAMDisk unter MSDOS
Im Gegensatz zu anderen Speichererweiterungen des A500 lässt sichdas KCSBoard im Originalzustandnicht abschalten. Es gibt aber auf derPlatine insgesamt vier Anschlusslöcher, die nicht verwendet werden.An die beiden Äußeren (die beidenmit dem Transistor in der Nachbarschaft) lässt sich mit einem passenden Stecker ein Ein/Ausschaltermontieren. Somit muss bei alterSoftware das Board nicht ausgebautwerden, sollte alte Software Kompatibilitätsproblemen zeigen.
Kein Multitasking
Wie bereits erwähnt, kapert derkleine Parasit bei Aktivierung demAmiga vollständig. Es ist kein Multitasking mit der AmigaSeite möglich. Das KCS Power PC Boardübernimmt die Herrschaft über dieRessourcen des Amiga wie Mausund Tastatur, Schnittstellen, Laufwerke und RAM. Für die PCUm
gebung werden eine Soundblasteroder AdlibKarte durch den Amigaemuliert und je nach verwendeterKCSSoftware ein Grafikstandardwie MDA, CGA, EGA, VGA oderMCGA bereitgestellt. Viele Festplattencontroller des Amiga werdenunterstützt, aber bei weitem nichtalle. So sind folgende Festplattencontroller bzw. ROMVersionennicht nutzbar: SCSIController vonCommodore oder GVP mit GURUROM (omniscsi.device), AlfaPower Plus (SIMMVersion) ProtarA500HD und ACA500/ACA500Plus. Aber selbst wenn man einenunterstützten Controller in seinemAmiga verbaut hat, ist das KCSBoard etwas zickig. Große Festplatten mag das Board der Erfahrung nach gar nicht gerne, selbstmit 256 MB Platten hat es oft nichtfunktioniert. Mit diversen DOMs,Festplatten ab 1 GB oder auch CFKarten mit 256 MB oder mehr wares im Test nicht möglich, eine mitFDISK angelegte MSDOSPartition auf den vorgenannten Medienzu formatieren.
Unterschiedliche HardwareVersionen
Bei der Version des KCS Power PCBoards für den normalen A500werden 512 kB des Power PCBoards als SlowRAM eingebunden, bei entsprechendem Umbau des A500Boards auch alszusätzlicher ChipRAM. Die freien512 kB des KCSBoards lassen
KCS PC Power Board Revision V1 für A500 (P2541)
1818
Hardware
sich als RAMDisk verwenden.Wie viele andere TrapdoorSpeichererweiterungen auch, bringtdiese Version eine Echtzeituhr inden Amiga. Ein KCS Power PCBoard für den A500 läuft jedochnicht in einem A500+. Dieserstartet mit eingebautem Boardnicht, der Bildschirm ist grün odergelb und die PowerLED blinkt.Das gleiche Verhalten zeigt auchein auf 2 MB ChipRAM umgebauter A500 Rev. 8A.1, ein nichtveränderter A500 dieser Revisionfunktioniert anstandslos.
KCS Power PC Board fürA500 und A500+
Es sind zwei BoardRevisionenfür den ursprünglichen AmigaA500 in den Handel gelangt. DieRevision "v1" (PCBBeschriftungP2541) verwendet durchgehendeinen NEC V30 mit 8 MHz. Allerdings sind in der "v2" (PCBBeschriftung P2542) nicht nurdie 10 MHzVariante dieser CPUverbaut worden, wie öfters behauptet wird. Die frühen Exemplare dieser Revision verwendenebenfalls die 8 MHzVariante. Esexistiert sogar eine Übergangsversion der v2, bei der das PCB aufder Vorderseite mit P2541 beschriftet, auf der Rückseite abereindeutig P2542 zu erkennen ist.Die Taktangabe auf der CPU istohnehin unwichtig, denn die Taktung der V30 hängt von der verwendeten Software ab. Die 4.5erSoftware taktet alle Boards gleichermassen mit 10,7 MHz!
Im Zusammenhang mit den Revisionen der A500Version ist auchoft zu lesen, dass die frühe P2541keine Festplatten unterstützenwürde. Das stimmt jedoch nicht:Die Festplattenunterstützunghängt einzig und alleine von derverwendeten KCSSystemsoftware ab. Es ist kein Problem, mit derersten BoardRevision und derSoftware v4.5 z. B. eine Partitionauf einem SupraDrive 500XP als
Festplatte einzurichten.
Eine weitere Version des KCSBoards ist das KCS Power PC BoardPlus. Dieses ist für den Amiga 500+gedacht und der komplette Speicherdes Boards (1 MB) wird als zusätzliches ChipRAM eingebunden. Somithat der A500+ dann ganze 2 MBChipRAM zur Verfügung. Da derAmiga selbst eine RTC onboard mitbringt, ist sie auf dem KCSBoardauch nicht vorhanden. Das KCSPower PC Plus ist deutlich selteneranzutreffen, als die normale Variante. Und Vorsicht, ein KCS Power PCBoard Plus für den A500+ läuft nichtin einem A500. Es wird zwar imA500 eine 512 kB Speichererweiterung erkannt, der PCTeil jedochnicht. Leider funktioniert das Plusauch nicht in einem auf 2 MB ChipRAM umgebauten A500 Rev. 8A.1,mehr als einen grünen Bildschirmund einem hektischen Blinken derPowerLED wird man nicht erkennen.
KCS Power PC Board für denZorro II
Die Lösung für die BigBoxAmigasist technisch durch Adapterplatinegelöst, an die das KCSBoard angesteckt wird. Von dieser Adapterplatine existieren zumindest dieRevisionen 1.1 und 1.2. Die frühere1.1 hat einen TTL IC weniger undauch insgesamt weniger diskreteBauteile verbaut. Was diese Änderungen bewirken sollten, ist schwernachvollziehbar. Möglicherweisewurde das TimingVerhalten in eini
gen ZorroAmigas positiv beeinflusst. Die Geschwindigkeitbleibt gleich, nur ist es nicht möglich, ISASteckkarten wie z.B.Grafikkarten oder Festplattenkontroller zu verwenden. Es fehlterkennbar die Verbindung vomZorroBus des Amiga zum ISABus eines PCs. Die Karten sindwie bereits eingangs erwähnt keineBridgeboards.
Bis einschließlich der Version 3.5der KCSSoftware kann mit demProgramm KCSCONFIGMEM derSpeicher des KCS Power PCBoards als FastRAM genutzt werden, sofern noch Platz innerhalbder 8 MB im Zorro II Bereich freiist. Andernfalls kann der Speicherdes Boards nicht verwendet werden. Ab der Version 4.5 ergab sichhierbei eine Änderung. Ist derZorro II Bereich bereits mit 8 MBdurch Speicherkarten gefüllt, sokann das Programm KCSCONFIGMEM noch 512 kB als Extra
Speicher einbinden. Die Uhr aufdem KCS Board kann nicht verwendet werden, da die großenAmigas bereits selbst über eineentsprechende Uhr verfügen.
Es werden keine Turbokarten mit68040 oder 68060 CPU unterstützt. Nur die SoftwareVersionenab 5.0 bieten eine StartdateiA4000_40, wobei diese ein KCSDual High Density Laufwerkzwingend voraussetzen.
KCS Power PC Board für den
KCS PC Power Board für den Zorro II mit P2542 Boardund ZorroAdapterplatine
1919
Hardware
A600
Für den beengten Einsatzort in derA600 Trapdoor ging KCS einenähnlichen Weg wie für die großenAmigas. Mit Hilfe einer Adapterlösung lässt sich das KCS Board, daswegen seiner Größe außerhalb ineiner Kunststoffbox untergebrachtist, als Speichererweiterung für denA600 anschließen. Somit hat derA600 dann 2 MB ChipRAM zurVerfügung. Allerdings hat derkleinste Amiga keine Echtzeituhr.Aus diesem Grund hat KCS dieRevision P2544 (PlusVariante)mit einer solchen versehen. DerAdapter lässt sich ohne Zerlegendes A600 nur mit etwas "Nachdruck" am Anschluss aufstecken,denn der Platz oben in Richtungder Tastatur ist durch die Gestaltung des Adapters nahezuvollständig ausgenutzt. Das Boardfunktioniert auch mit Turbokartenim A600.
Die Software
Das Board ist von seiner technischen Umsetzung bereits am Anfang extrem durchdacht undausgereift– das ist bemerkenswert.Alle im Laufe der Zeit durch neueKCSSystemsoftware hinzugekommenen Möglichkeiten wie Unterstützung von vielenFestplattencontrollern, EGA undVGAModi für die Grafikausgabeund Adlib bzw. Soundblasteremulation für den guten Ton, wurdenrein in der Steuersoftware für dasBoard implementiert. Das verdient
großen Respekt. Die nächsten Seitenstellen die wichtigsten Softwareversionen vor. Es lässt sich erkennen,wie das KCS Power PC Board überdie Jahre an Features gewonnen hat.
Fazit
Das KCS Power PC Board machtden Amiga 500, aber auch die BigBox Modelle und den A600 weitgehend PCkompatibel. Dabei musssich die Geschwindigkeit nicht hinter anderen Lösungen für den Amigaund auch nicht vor echten IBM PCSystemen aus der gleichen Zeit verstecken. Fehlt der Lösung auch dieBridgeboardFunktion und erlaubtsie daher nicht den Einsatz von ISAZusatzkarten im Amiga, so ist siedoch eine vielseitige Erweiterung.
Es lohnt sich also, bei entsprechenden Angeboten zuzugreifenund seinem Amiga neue Welten zueröffnen. (bg)
Links
http://amiga.resource.cx/expde/powerpc
KCS PC Power Board für den Amiga 600. Links das Anschlussboard für den Expansionslot, rechts die Karte (P2544) Über den Autor
Herwig Solf ist ein computerbegeisterter Realschullehreraus Niederbayern und seitNovember 2013Mitglied imVzEkC e.V. Seine Leidenschaftgilt den PCs als Parasiten in anderenWirtssystemen, also denHardwarePCEmulatoren inAmiga und Atari Computern.
2020
Hardware
Version 1.0Die frühen Versionen der Systemsoftware laufennur unter Kickstart 1.2 und 1.3 und es finden sichnoch einige Bugs. Die Version 1.0 unterstützt keineFestplatten. Unterstützte Grafikmodi sind MGA(Monochrome Graphics Adapter) mit 720 x 348Bildpunkten in 2 Farben und CGA (Color GraphicsAdapter) mit 640 x 200 in 2 Farben oder 320 x 200in 4 Farben jeweils aus einer Palette von 16 Farben.
Version 1.20Das Scrolling ist bei den frühen 1.X und 2.XVersionen der Software im Textmodus auf einemTestamiga invertiert, es scrollt also von unten nachoben. In die PCPreferences dieser frühenVersionen kommt man mit gedrückter linkerMaustaste beim Booten von der KCSSystemdiskette. Es gibt noch keinen TurboModusund das Board ist von der Geschwindigkeit eingutes Stück langsamer als die späteren Versionen.Mit Norton SI 4.5 schafft diese Softwareversionlediglich einen Vergleichswert von 3,3 zum IBMXT. Das lässt auf einen Takt des NEC V30 mit ca.7,5 MHz schliessen. Als zusätzlicher Grafikmoduswird CGAmit 8 Farben unterstützt.
Version 2.xDas Handbuch der Version 2.00BETA ist nur einFaltblatt. In dieser Version gibt es einen TurboButton, der die Geschwindigkeit des Boardszwischen ca. 8,5 MHz und 11 MHz umschaltet. DerTurbo macht sich auch tatsächlich in denMesswerten bemerkbar. Ohne Turbo liegt das KCSbei einem Vergleichswert von 3,7 (Norton SI 4.5).Somit ist das Board mit der 2.00ßSoftware auchohne TurboModus bereits schneller als in der v1.20.Bei aktiviertem Turbo klettert der Wert auf satte 4,8.Der TurboModus wurde von KCS im Übrigen nichtgarantiert. Das Problem sollen allerdings einigeAmigas gewesen sein und nicht die 8 MHzVersionder NEC V30 CPU. Die Version kennt alszusätzlichen Grafikmodus nun auch CGA mit 16Farben. Des Weiteren ist eine Unterstützung derCommodore A590 Festplatte und FastRAM zurBeschleunigung der Bildschirmausgabe und desDiskettenzugriffs implementiert. Weitere Versionenhaben die Unterstützung der Festplattencontrollermassiv ausgeweitet. Sie booten z. B. mit demPhoenix BIOS v2.52, wobei zusätzliche Extensionsv2.83 geladen werden. In der Version 2.95 wurdedann der EGAGrafikmodus der kommendenSoftwareVersionen getestet.
Power PC MenüUm während der Laufzeit einige Grundeinstellungender PCEmulation zu ändern, kann man mit RAmiga+Help das Power PC Menü öffnen. Dort lassen sichdann mit Hilfe der Funktionstasten folgende Änderungen für den aktuellen Betrieb abändern:
F1: Umschalten der Belegung der beiden emuliertenCOMPorts (Serieller Port oder Maus)F2: Zuweisen der Laufwerksbuchstaben für das interne und evtl. vorhandene externe DiskettenlaufwerkF3: ohne Funktion
F4: Schneller oder StandardMONO EGA/VGAModusF5: Anzahl der Farben im EGA/VGAHires Modus (4, 8 oder 16)F6: Schreibschutz für die Festplatte (also für die KCSPartition)F7: Ein oder Ausschalten des StatusdisplaysF8: Anzeige der Uhr (Datum und Uhrzeit)F9: Festlegen der Pufferung für dasDiskettenlaufwerkF10: Reset des PCTeils
2121
Hardware
Versionen 3.00 und 3.05Im Power_PCVerzeichnis auf der KCSDiskettebefinden sich nun drei ausführbare Dateien.STANDARD ist für einen A500/A2000, der nurüber das KCSBoard als Speichererweiterungverfügt, EXTRA_MEM ist für ein System mitzusätzlichem FastRAM und 68020_30 fürbeschleunigte A500/2000 und natürlich demA3000. Die Versionen 3.0 und 3.05 unterscheidensich in allen Dateien und bei der 3.05 ist aucheine zweite StandardKonfiguration vorhanden.Alle Konfigurationsdateien ebenso wie HDsetupund PCPreferences werden mit Icon in derWorkbench angezeigt. Der Button für den TurboModus für das Board ist noch vorhanden,allerdings ohne Funktion. Mit der Versionkommen die zusätzlichen Grafikmodi EGA(Enhanced Graphics Adapter) mit maximal 640 x350 Bildpunkten und bis zu 16 Farben aus einerPalette von 64 und VGA (Video Graphics Array)mit maximal 640 x 480 Bildpunkten und bis zu 16Farben aus einer Palette von 4096 hinzu.Außerdem werden 68020 und 68030 CPUs, derA500+ und A2000/3000, das Kickstart 2.0 undhöher unterstützt. FastRAM kann nun auch auchals EMSSpeicher nach dem LIMStandardverwendet werden und die Geschwindigkeit derseriellen Schnittstelle wurde auf bis zu 19 200Baud erhöht.
Versionen 4.5xAuch die v4.5 lässt sich einfach über Programme inder Amiga Workbench konfigurieren, allerdings sinddie einzelnen Konfigurationsdateien STANDARD,EXTRA_MEM und 68020_30 nicht mehr auf derWorkbench sichtbar. Beim Installationsvorgang wirddie als passend erkannte Datei als Power PC Boardauf die Festplatte installiert. Besondere Dateien fürden A2000 wie in der v3.50 gibt es nicht mehr. Esgibt unterschiedliche Versionden der v4.5 Disketten.Die einzelnen Programme PCPREFERENCES,HDSETUP, STANDARD, EXTRA_MEM und68020_30 unterscheiden sich geringfügig in derGröße. Feststellen kann man diese unterschiedlichenVersionen auf jeden Fall mit dem HDsetupProgramm. Dieses gibt es als v4.5 und als v4.51,wobei bei letzterem einige zusätzlicheFestplattencontroller unterstützt werden. Alszusätzliche Grafikmodi sind MDA (MonochromeDisplay Adapter) mit Text in 2 Farben, Tandy 1000bzw. PC Jr. mit 160 x 200, 320 x 200 oder 640 x 200in 16 Farben aus einer Palette von 16 und MCGA(Multi Color Graphics Array) mit 320 x 200Bildpunkten in 32 Farben aus einer Palette von 4096hinzugekommen. Die Version unterstützt den A600,emuliert Soundblaster oder Adlib und steigert dieGeschwindigkeit der seriellen Schnittstelle auf bis zu38 400 Baud.
Versionen 5.xDie drei Versionen v5.0, v5.1 und v5.2 benötigenzwingend das KCS Dual High Density Drive, damitsie sich starten lassen. Auf der v5.2Diskette ist auchdie aktuellste Variante der 68020_30, EXTRA_MEMund STANDARD Startdatei, datiert mit dem02.11.1994, vorhanden. Die 5er Versionen sind dieeinzigen, die eine Unterstützung von 68040er CPUs,z. B. im A4000, ermöglichen.
Die Software zumKCS Power PCBoardHier stellen wir Ihnen die wichtigsten Versionen
der KCS Software vor. Sie bestimmt maßgeblich,
was mit der BoardHardware alles möglich ist.
2222
Apple Soundkarten
Wie der Apple II polyphon wurde
Vor 40 Jahren wurde der
Apple II vorgestellt. Als
„ready to run“ System
für Jedermann konzipiert, lagen
seine Stärken vor allem in der
guten Erweiterbarkeit. Kein
Wunder also, dass schon bald
zum Bild auch der Ton kam.
Der Apple II war einer der erstenHeimcomputer, der neben derFarbdarstellung auch Töne produzieren konnte. Die Methodik warjedoch ähnlich wie der Apple IIselbst relativ einfach implementiert. Über ein Register konnte einFlipFlop geschaltet werden, welches ein Knacken im Lautsprechererzeugte. Mit etwas Geschick gelang es, mittels des Zählen von Zyklen auch einfache Musik zuerzeugen. Diese Musik war jedochden Videospielgeräten der Zeit weitunterlegen, da nur eine Notegleichzeitig gespielt werden konnte.
Dies änderte sich 1978, als die Firma ALF Products die „AppleMusic II“ auf den Markt brachte(der Name wurde auf Wunschvon Apple in MC16 umgeändert). ALF hattebereits vor 1978 mehrere Musikkarten fürder S100 Bus (Altair,ISMAI usw) auf denMarkt gebracht. Der großeUnterschied zwischen dem AppleII und den S100Geräten war, dassim Apple II wesentlich wenigerPlatz für die Erweiterungskartenvorhanden war. Somit musste dieMC16 sehr viel kleiner sein als diebisherigen ALFProdukte. Die Erfahrung mit den S100Produkten(AD8, QCPG) hatte gezeigt, dassminimal 3 Stimmen nötig waren,um eine typische Melodie ohnegroße Verluste abbilden zu können.Mit relativ wenig Komponentenließ sich somit eine 3stimmige
Musikkarte bauen. Zunächst kostetedie MC16 um 180, US$ und wurdenach relativ kurzer Zeit von TexasInstruments als Vorbild für denSN76489 Chip verwendet. TI fügteeinen Rauschgenerator hinzu, reduzierte den Dynamikumfang und dieLaustärkeregelung von 8 Bit auf 4Bit . Dieser Chip ermöglichte es ALFim Jahr 1980, die MC1 mit 9 Stimmen auf den Markt zu bringen. Dadiese Karte wiederum wenigerKomponenten als
die MC16 enthielt, konnte sie trotzder dreifachen Anzahl von Stimmengünstiger angeboten werden. In Jahr1979 war das Unternehmen Mountain Computer mit dem Musik System auf der Bildfläche erschienen.Diese Soundkarte war sehr eng mitden ALF AD8 Systemen verwandt,da es sich um einen echten digitalenpolyphonen Synthesizer handelte.Das MCMS bot mit 32kHz Abtastrate und 8bit Auflösung gleich 8 unabhängige Stimmen, die auf zwei
Hardware
Kanälen gespielt wurden (16 Oszillatoren). Damit war echter StereoKlang mit 8 Stimmen möglich.Da jede Stimme 256 Byte anSpeicher benötigte, mussten fürdie 16 Oszillatoren mehrere KBytean Speicher bereit gestellt werden.Zudem musste der Speicher vonden Computer aus beschreibbarsein. Um die Karte günstig zu halten, entschied man sich bei Mountain Computer dazu, auf das RAMdes Apple II zuzugreifen. Jeder 2.Takt des Apple II musste nunmehr
für das MCMS bereitgestellt werdenum Töne zu erzeugen. (16 x 32 KHz =512 KHz) Zudemmusste noch dieHüllkurve vomComputer berechnetund in Echtzeit ander Karte gesetztwerden. All diesführte dazu, dass derApple II gerade sogenug Kapazitätenhatte, um Musik miteiner simplen Visualisierung abzuspielen. Mit wenigenAnpassungen liesssich das MCMS aberauch für Live Performances zusammen
mit einem Keyboard (AlphaSyntauri, SoundChaser) nutzen.
Alle frühen Soundkarten bis 1982für den Apple II hatten eines gemeinsam: Sie waren nicht fürSpiele geeignet. Das MCMS verbrauchte zu viele Ressourcen unddie ALFKarten hatten keinen Interrupt und wurden daher über dasZählen von Zyklen programmiert.
Erst 1983 hat die Firma SweetSystems Micro dies mit demMockingboard geändert. Der zurAnsteuerung verwendete 6522VIA bot InterruptTimer und der
2323
ALF MC16 (1978)
1x 8254 Timer
3x AM6070 DAC (8bit)
1782Khz Basistakt
Erlaubt 3 Stimmen mit sehr geringer Abweichung und8bit Lautstärkeregelung. Die DACs benutzen einenLogarithmus nach dem uLAW Verfahren underlauben somit eine hohe Dynamik. Die Karte kannkeinen Interrupt auslösen.
Hardware
Mountain Computer Music System(1979)
Echter digitaler Synthesizer mit 16 Stimmen bzw. 8Stimmen in Stereo. 8 Bit Lautstärke, 8 Bit Hüllkurveund 8 Bit Wellenform mit 256 Byte Länge. Die 3 DACssind so verschaltet, dass die jeweiligenReferenzspannungen die Ausgansspannung des anderenDACs sind, also DAC1 an DAC2 an DAC3. Die Kartenutzt den Apple II Hauptspeicher für das Auslesen derWellenform (DMA) und verbraucht dafür jeden 2. Takt(ca. 512khz). Das Ergebnis ist eine 32khz Abtastrate bei16 unabhängigen Oszillatoren. Die Karte benötigtnahezu alle verfügbaren Ressourcen des Rechners.
Über den Autor
Jonas ist begeisterter Computersammler und hat sich aufAppleSysteme spezialisiert.Besonders interessieren ihnneue und alte Hardwareerweiterungen für Apple ][ Systeme.
AY38913 war einfach und günstig zu beschaffen. Zudem wurdeein Paket mit Bibliotheken zur Erkennung und Nutzung der Kartefür Spiele mitgeliefert. Obwohl dasMockingboard technisch nicht mitden verfügbaren Lösungen mithalten konnte, war es der Softwaresupport, der den Durchbruch imSpielesektor ermöglichte. Leiderwar die Zeit des Apple II fast vorbei und als 1984 erste Spiele mitMockinboardUnterstützung geliefert wurden, gab es bereits denC64 und den Macintosh.Außerdem hatte der neu eingeführte und schnell zum Verkaufsrenner
avancierte Apple IIc keine Slots, umein Mockingboard zu verwenden.Mit Einführung des Apple IIgs gabes keinen Bedarf mehr an individuellen Musikkarten, da der Apple IIgsvon Haus aus 32stimmige Polyphonie mit 64Kb eigenem SoundRAM ermöglichte.
Übrigens: Den Vergleich zum PCbraucht der Apple II nicht zu scheuen. Die ADLibKarte kam dort erst1987 auf den Markt und der Soundblaster im Jahre 1989. (j)
2424
Decillionix DX1 (19801989)
Eine Stimme 8 Bit In/Output mit 0,78 bis 30 kHz perDMA aus dem Apple II RAM (24k erlauben zwischen0,8 bis 10 sek. "Spielzeit"). Oftmals wurde diese Karteals AudioDigitizer für das MCMS benutzt, um neueWellenformen aufzunehmen.
Generic single DAC (19771979)
Ein einzelner 8bitDAC, der direkt vom Bus aus beschrieben wird.
Beispiele: S.A.M., MMI DAC, usw.
Mockinboard (1983)
• 12x AY38913
• 02x Votrax Speech Chip
• 1 Mhz Basistakt
Die Karte gab es in mehreren Varianten, von denen dasMockinboard A das bekannteste ist. Die Karte bietet 6Stimmen (3 Rechts, 3 Links), sowie 2 Rauschgeneratoren und bis zu 2 Synthesizer Stimmen. Die Karte besitzt zwei dynamisch konfigurierbare Interrupts, waseine einfachere Programmierbarkeit erlaubt.
Mimetics GeneSys (1983/1984)
Gleiche Leistungsmerkmale wie das MCMS aber keinDMA. Die Karte besitzt ihr eigenes 8k RAM. Zusätzlich ist ein KeyboardInterface (AlphaSyntauri) auf derKarte verfügbar.
Passport MX5 (1983)
Gleiche Leistungsmerkmale wie das MCMS mit gleicher Anbindung des Apple II RAM (DMA). Die Kartebesitzt zudem ein KeyboardInterface (SoundChaser)und einen Drum SyncAnschluss.
ALF MC1 (1981)
• 3x SN76489
• D2Mhz vom Q3Signal des Apple II Bus
Die Karte besitzt insgesamt 9 Stimmen + 3 Rauschgeneratoren. Die Stimmen sind als 3x rechts, 3x Linksund 3x Mitte angeordnet. Es ist kein Interrupt Generator vorhanden. Sie kam als ALF AMII auf den Marktund wurde auf Druck von Apple sehr schnell in ALFMC1 (music card 1) umbenannt.
Hardware
2525EinNachbau
desMoc
kinboard
ist bei Reactive M
icrofür c
a. 70,
EURerhä
ltlich.
How to buy...Auch in Deutschland waren Soundkarten fürden Apple II bald erhältlich. Diese Seite zeigtAuszüge aus den Pandasoft Katalogen 1986und 1987 mit den Angeboten einiger derbeschriebenen Karten (gb).
2626
„The earth is mine! Everything is mine!
Now punish the earthlings for thier
foolisch resistance“. Mit knarrender
Stimme verkündet so der arcturischen Tyrann Gir
Draxon aus dem Lautsprecher des Amiga das En
de eines Spiels mit „Stellar 7“.
Stellar 7 ist klassisches Ballerspiel, bei dem der Spieler aus seinem Cockpit heraus einen über einSchlachtfeld steuert. Das Feld ist voll mit Hindernisobjekten und feindlichem Kriegsgerät. Was sich bewegt, muss abgeschossen werden keine besondersoriginelle Spielidee, dennoch immer wieder fesselnd.Der eigene Panzer „Raven“ verfügt über eine doppelläufige Kanone, einen Radarschirm zur Beobachtungdes Schlachtfelds, Protonenschilde, Tarnvorrichtung,Raketenbooster und Sprungfähigkeit. Aber auch dieGegner sind nicht von schlechten Eltern: Einfache
Lasertanks, Hovercrafts, schwere Panzer, Sandgleiter, aber auch feststehende Laserkanonen und Minenjagen dem Spieler hinterher. Das Spiel besteht ausmehreren Leveln, die –je nach Plattform– von einemWächter geschützt werden. Der erscheint, sobaldman eine gewisse Anzahl an Punkten durch dasAbschiessen der Gegner gesammelt hat. Ist derWächter besiegt, erscheint eine „Warplink“, einsechszackiger Drehkörper, der den Spieler bei Kollision in den nächsten Level transportiert. Im letzten Level wartet Gir Draxon für eine finaleSchlacht. Stellar 7 erschien 1983 zunächst für denApple ][. Der Programmierer Deman Slyth vertriebdas Spiel über die Firma Dynamics, die später vonSierra übernommen wurde. Anregung war das Arcadespiel „Battlezone“, mit dem Atari seit November 1980 in den Spielhallen vertreten war. Kern derSpielentwicklung war ein aus heutiger Sicht einfa
ches 3D Vektorgrafikpaket mit dem Namen „ThreeSpace“. Es sorgte auf dem Apple ][ für Furore, weilderartige Darstellungen bis dahin nahezu unbekanntwaren. Dennoch wurden nur etwa 8.000 Exemplaredes Spiels verkauft. Der Grund: Sehr schnell war derKopierschutz der Diskette geknackt und die illegalenKopien untergruben das Geschäft von Dynamics. Aufdiesem Weg hatte Stellar 7 aber großen Erfolg esgab Anfang der 1980er Jahre kaum einen Apple IIBenutzer, der Stellar 7 nicht spielte. Atarisoft lieferteseinerseits eine Version von Battlezone für den Apple][ aus, die aber hinsichtlich der Darstellung und demBildaufbau deutlich hinter Stellar 7 zurückblieb.
Die Vektorgrafik ist auch aus heutiger Sicht nochdurchaus ansehnlich. Das Bild wird flüssig aufgebautund ruckelt nur dann merklich, wenn viele Objekteparallel verändert werden müssen. Die Objekte vergrößern und verkleinern sich mit änderndem Abstandzum Spieler und sind von allen Seiten zu betrachten.Auf dem Apple ][ ist prinzipbedingt der Sound weniger begeisternd. Eine Unterstützung für polyphoneSoundkarten fehlt.
Software
Spieleklassiker
Stellar 7 — Ballern auf vielen Plattformen
2727
Software
Im Jahr 1984 erschien Stellar 7 bei Penguin Softwareauch für den Commodore C64. Diese Version ist einenahezu identische Portierung der Apple II Fassung undteilt mit dieser auch den schlechten Sound. Besser wurde der Ton erst 1990 mit einem Rewrite des Programmsfür Apple Macintosh, Commodore Amiga und PCDOS.Die AmigaVersion lässt denn auch die Stimme gir Draxons erschallen, während die MacintoshVersion stummbleibt.
Stellar 7 ist für die verschiedenen Plattformen von denüblichen DownloadSeiten erhältlich und kann auch inOnlineEmulatoren gespielt werden. (gb)
Die Level
Sol: Die Landschaft bietet mit ihrem Netz aus Würfelobjekten genügend Schutz vor Feinden. Diese umfassen Sandgleiter, Skimmer und Hovercrafts. DerWächter kann durch Dauerfeuer bei ständiger Rückwärtsfahrt zerstört werden.
Antares: Hier erwarten den Spieler erstmalig Laserbatterien, Minen und Prowler Panzer. Der Wächter lässtbei Vorwärtsfahrt mit Dauerfeuer zerstören aber bevor die Spinneneier schlüpfen.
Rigel: Hier gibt es einen Treibstofftank, mit dem sichSchilde und Antrieb wieder aufladen lassen. Auf Rigel gibt es Laserpanzer, Pulsare und Stinger. DerWächter wird mit der gleichen Taktik wie im SolLevel zerstört.
Deneb: Die schützenden Objekte auf Deneb sind nichtmehr unzerstörbar. Hier treten erstmalig AssaultPanzer und Kanonenbatterien auf. Der Wächter lässtsich wie auf Sol zerstören, ist aber stärker, daherwird die „Gelbe Kanone“ benötigt.
Sirius: Hier umkreisen Flugwaffen den Spieler, die beimRückwärtskreiseln abzuschiessen sind. Bei Betretendes Levels greifen drei Seeker den Spieler an. DerWächter muss von der Seite angegriffen werden, umnicht in die Schusslinie seiner Kanone zu geraten.
Regulus: Hier existiert ein weiterer Treibstofftank. DieFeinde verwenden Panzer mit Tarnvorrichtung. DerWächter ist mit dem auf Antares identisch, richtetaber mehr Schaden an.
Arcturus: Hier findet die alles entscheidene Schlacht mitGir Draxon statt. Ein Zusammenprall ist zu vermeiden, weil dieser über ein Protonenschild verfügt.
Tastenbelegung
Taste I: Tarnvorrichtung, wirkt für eine kurze Zeit
Taste E: Protonenschild, schützt vor feindlichem Beschuss und zerstört alle feindlichen Fahrzeuge beiBerührung.
Taste S: Die „Gelbe Kanone“ mit stärkerer Schusskraftals die reguläre Bewaffnung
Taste J: Lässt den Raven über Hindernisse oder anderePanzer springen
Taste B: Verlegen von Landminen
Taste C: Detektor für getarnte feindliche Panzer
Taste T: Raketenbooster, kurzzeitige starke Beschleunigung
2828
Wenn der vorhandene Amiga entweder
keine ausreichenden Ressourcen für die
erforderlichen Werkzeuge hat oder kein
echter Amiga zur Verfügung steht, bleibt der Aus
weg über einen AmigaEmulator auf dem heimi
schen IntelPC. In der folgenden SchrittfürSchritt
Anleitung richten wir darum mit WinUAE einen
bekannten und frei verfügbaren Emulator ein. Die
ser erhält dann die erforderlichen Entwicklungs
werkzeuge.
Um eigene AmigaProgramme in C zu entwickeln, benötigt man neben einem Texteditor vor allem einen CCompiler. Dieser erstellt aus einem C Programm(Source Code) ein ablauffähiges Binary. CCompilerund andere Entwicklungswerkzeuge finden sich kostenlos zum legalen Download auf den einschlägigenServern im Internet.
Download und Installation
Schritt 1 : Als erstes besorgen wir uns einen CCompiler. Ein Compiler ist ein Programm, das den von unsgetippten Quellcode (in unserem Fall den C Quellcode) in Maschinensprache (also in ein ausführbaresProgramm) übersetzt. Wir nehmen dazu den wirklichguten DICE CCompiler. Diesen bekommen wir imAminet:
Schritt 2: Wir richten ein Unterverzeichnis ‚dev’ aufFestplatte ein und entpacken obiges lha Archiv (z.Bmit WinRAR) dort hinein. Das entstehende Verzeichnisfür Dice.. nennen wir nur in ‚dice’ um.
Schritt 3: WinUAE suchen wir uns im Netz , laden esherunter und installieren es.
Amiga C Programme entwickeln
WinUAE als C Entwicklungsumgebung
Software
Setup starten
Komponenten auswählen
Installationsort festlegen
2929
Software
WinUAE konfigurieren
Schritt 4: Der Emulator benötigt ein OriginalKickstartROM, also den Teil des AmigaBetriebssystems,das als ROM in den AmigaSystemen fest verbaut ist.WinUAE enthält ein ROM Image, den Pfad zumKickstartROM Image müssen wir entsprechend einstellen:
Schritt 5: Neben dem KickstartROM ist eine grafischeOberfläche erforderlich, die sog. Workbench. EinigeVersionen stehen als Diskettenimages zum Downloadbereit. Für WinUAE muss ein WorkBench DiskettenImage als df0: eingebunden werden . Auf diese, WorkbenchDiskettenimage sollte der Editor ‚ED’ enthaltensein.
Schritt 6: Nun muss das Verzeichnis bekanntgegebenwerden, in dem sich 'dice' befindet (in diesem Beispielalso 'dev'). WinUAE erlaubt es, ein WindowsVerzeichnis als dh0: (Festplatte) einzubinden (Read/Write=Markieren, um Schreibzugriff zu erhalten).
Setup abschliessen
Kickstart ROM festlegen
Workbench Diskimage Pfad festlegen
Windows Verzeichnis als Festplatte einbinden
3030
Software
Wieder in der Shell geben wir ein:
dcc 3.1 hallo.c o hallo <Enter>
Wenn wir keinen Tippfehler gemacht haben, dann gibtes keine Meldung, es erscheint wieder die Eingabeaufforderung und wir können uns mit dir <Enter> davonüberzeugen, das der Compiler unseren Quelltext in einausführbares Programm übersetzt hat.
Wir sollten in dem Verzeichnis also einmal die von unsgeschriebene Datei hallo.c sehen und zusätzlich dievom Compiler erzeugt Datei hallo .
Probieren wir unser Programm doch einfach mal aus.Wir geben in der Shell ein:
hallo <Enter>
Wenn jetzt in der Shell der Text “Hallo Welt !” erscheint dann haben wir es geschafft, wir haben unsererstes AmigaProgramm geschrieben!
(ps)
Links
http://www.aminet.net/dev/c/dice3.16.lha
http://www.winuae.de/
Über den Autor
Peter Sieg ist seit 2006Wiedereinsteiger im RetroComputing Hobby. Er ist Autor der Bücher"CommodoreHardwareRetrocomputing" und"SimulationEmulation Exotic Flavor"
7: Anschließend müssen einmalig einige Änderungenin der Datei ShellStartup gemacht werden, welcheman in dem Verzeichnis S auf der WorkbenchDiskettefindet. Dazu müssen wir zuerst eine Shell (Kommandozeile) öffnen.
Mit ‚dir’ kann man sich alle Dateien anzeigen lassen..In Verzeichnis wechseln mit ‚cd <Verzeichnis>’. Zurück mit ‚cd /’. Mit ‚type <Datei> kann man sichText/ASCIIDateien am Bildschirm anzeigen lassen.
Jetzt also ‚cd s’ und dann ‚ed shellstartup’. Dann diefolgenden Einträge hinzufügen:
(ED: <esc>x<enter> speichert den Text; q=Ende ohneSpeichern; StrgB löscht Zeile)
assign dcc: dh0:dice
assign DLIB: dcc:dlib
assign dinclude: dcc:include
assign libs: dcc:libs
path DCC:abin/ ADD
path DCC:editors/dme/ ADD
Hello World?
Schritt 8: Zur Eingabe eines einfachen Beispielprogramms gehen wir zur ‚Festplatte’ (Verzeichnis ‚dev’)mit: ‚cd dh0:’.
Mit dem ED Editor geben wir dann folgendes Programm als Datei 'hallo.c' ein:
#include <stdio.h>
int main()
printf(“Hallo Welt !”);
return 0;
3131
Im AtariHomeForum (siehe Links) fiel die An
leitung von Christian Zietz für ein WLAN Mo
dul für den Atari ST auf.
Dort wurde als Primärfunktion das Holen und Setzender Uhr mittels NTP und HTTP beschrieben. DieLösung besteht aus einem MiniSystem (ESP8266) undist dank des sehr einfachen Aufbaus nicht schwernachzubauen. Zu beziehen sind die Komponente preisgünstig über OnlineVersandhäuser, meist stammen sievon Herstellern aus China. Leider sind die Wartezeitfür Bestellungen aus China etwas lästig. Man benötigtdrei Hardware Komponenten:
•ESP01Modul
• 3.3V Stromversorgung
• TTL (3,3V) nach RS232 Wandler
Das ESP01 muss noch mit der speziellen Firmwaregeflasht werden (siehe Links). Die Firmware lässt sichauch mit dem NodeMCUflasher aufspielen. Zum Aufspielen von Firmware muss zum Start des ModulsGPIO0 auf GND gelegt werden, entsprechende Anleitungen für den esp01 gibt es genügend im Internet.Anschließend sind die drei Hardwarekomponentenmiteinander zu verbinden (siehe Links) . Als erstes erfolgte dann ein Aufbau mit einer Lochrasterplatine undentsprechender Verdrahtung. Danach wurde ein einfaches Platinenlayout erstellt. Der fertige Aufbau mitPlatine ist in den Bildern zu sehen.
Layout + Dateien (Eagle) sind ebenfalls im AtariHome Forum zu finden. Die nötige Software für den AtariST hat Christian Zietz auf seiner Seite ebenfalls zumDownload zur Verfügung gestellt. Da die Firmware mit9600 8N1 kommuniziert und die API beschrieben ist,kann man sie mit entsprechend erstellter Software natürlich auch für andere Systeme nutzen. Dies gilt ent
sprechend auch für die originale AT Firmware, NodeMCU und ggfs. weitere Firmware (z.B. esplisp). (ps)
Links
https://www.chzsoft.de/site/hardware/diversekleinigkeitenfurdenatarist/
https://forum.atarihome.de/index.php?topic=12698.20
WLAN für klassische Computer
WLAN Modul für Atari ST
Hardware
Über den Autor
Peter Sieg ist seit 2006Wiedereinsteiger im RetroComputing Hobby. Er ist Autor der Bücher"CommodoreHardwareRetrocomputing" und"SimulationEmulation Exotic Flavor"
3232
Eine Zeitlang war der
SelbstbauAkustikkopp
ler des Chaos Computer
Clubs, liebevoll das "Datenklo"
genannt, eine kostengünstige
Möglichkeit für Datenfernüber
tragung. Der Nachbau macht
auch heute noch Spaß.
Wer erinnert sich noch an die Zeit,als das Telefonnetz in der BRDnoch analog war und von der Postbetrieben wurde? Zu dieser Zeitwar DFÜ ein schwieriges und teures Unterfangen. An das Telefonnetz durften nur Geräte mitFTZZulassung (später ZZFZulassung) angeschlossen werden.Diese Geräte waren extrem teuer.
1984 griff der Chaos ComputerClub zur Selbsthilfe. Es wurde einModem entwickelt, das für dengeübten Bastler gut nachzubauenund für damalige Verhältnisse unschlagbar günstig war. Das Modem konnte sowohl direkt an dieTelefonleitung angeschlossen, alsauch als Akustikkoppler betriebenwerden. Das Modem mit den erforderlichen Schaltungen für beideBetriebsarten sowie den RS232Pegelwandlern wurde auf einerEuropakarte untergebracht. In derDatenschleuder, der Zeitschrift desCCC, wurde die Schaltung nebstErläuterungen, Bauanleitung, Platinenlayout und Datenblatt desverwendeten ModemChips veröffentlicht.
Den Namen 'Datenklo' erhielt dasModem von den Gummiverbindern, die für den AkustikkopplerBetrieb auf den Telefonhörer gesteckt wurden. Die Verbinderstammten nämlich aus dem Sanitärbereich und waren für die Verbindung von Spülrohr undWCTopf gedacht. Auf die Telefonhörer der damaligen PostTelefone passten sie aber auch perfekt.
Selbst gebaut
Das CCC Modem Datenklo
Hardware
Für den Nachbau hat sich der Autorzum ersten Mal an das Ätzen vonPlatinen gewagt – mit der freundlichen Unterstützung des Vereinsmitglieds for(;;). Das hat erfreulich gutgeklappt. Die Beschaffung der Bauteile war kein großes Problem. Bisauf den verwendeten ModemChipund die Gummiverbinder für denAkustikkoppler sind alle erforderlichen Teile noch neu im Handel erhältlich. Der ModemChip ist beieBay noch gut zu bekommen, dagibt es offenbar noch an vielen Stellen Restbestände. Die Gummiverbinder fanden sich noch im eigenenLager – die lagen da schon, als derAutor 1985 seine Lehre anfing. Bereits damals wurden sie nicht mehrverwendet, die Ausführung war zuder Zeit schon veraltet.
Das Datenklo benötigt vier Spannungen: +5V, 5V, +12V und 12V.Das Netzteil dafür ist denkbareinfach aufgebaut. Die Schaltung istan den Vorschlag vom CCC angelehnt, konnte aber noch weitervereinfacht werden. +12 und 12Vwerden nur für die RS232 Treiberverwendet. Laut Datenblatt dürfendie Spannungen im Bereich von +/7,5V 15V liegen (+/9V nominal).In der Wühlkiste fand sich ein kleiner Trafo, der 2 x 9V~ im Leerlaufliefert der wurde vor vielen Jahrenaus irgendeinem Kleingerät ausgeschlachtet. Mit Gleichrichter und Elkos (2 x 1000µF) stellen sichLeerlaufspannungen von +/ 12,5Vein.
Also wurden kurzentschlossen die+12V/12V Versorgung an diese ungeregelten Spannungen angeschlossen. Dazu noch einen 7805 undeinen 7905 Regler und jeweils einen100nF Kondensator an den Ausgang– fertig ist das EinfachstNetzteil.Der 7805 hat noch einen kleinenKühlkörper bekommen, der 7905benötigt keinen; auf der 5V Leitungfließen nur wenige mA. Im Betrieb
stellen sich nun für die RS232Treiber Spannungen um +9V und10,7V ein, das liegt alles im Rahmen. Zur Warnung: Beim Bau vonNetzteilen müssen die aktuellenSicherheitsbestimmungen beachtetwerden! Im Zweifel sollten lieberfertige Netzteile verwendet werden. Eigenbauten sollte ein Fachmann prüfen.
Das fertige Gerät wurde erst imLoopbackBetrieb getestet, sowohlmit dem Akustikkoppler, als auchmit der Schaltung für den Direktanschluss. Mit Direktanschluss liefalles prima ohne irgendwelcheÜbertragungsfehler.
Beim Akustikkoppler sah dasschon etwas anders aus. Im LoopbackBetrieb werden einfach beideGummimuffen aufeinandergesetzt,um eine direkte Tonübertragung zuerreichen. Sowohl Lautstärke alsauch Mikrofonempfindlichkeitsind mit Potentiometern einzustellen. Das gestaltete sich im erstenAnlauf schwierig, es kamen zuerstnur falsche Zeichen. Abhilfebrachte es, den den Hohlraum zwischen den Gummimuscheln mit einem Tuch zu stopfen. Dannfunktionierte das Ganze mit 300Baud erfreulich zuverlässig, auchbei unterschiedlichen Einstellungen für Lautstärke und Mikrofonempfindlichkeit.
Bei 1200 Baud sah es dann schonwieder anders aus, es kamen wieder nur falsche Zeichen. Erst einedeutliche Erhöhung der Lautstärkeund die Einregulierung der Mikrofonempfindlichkeit auf einen passenden Wert brachte einefehlerfreie Übertragung. Bei 300Baud ist der Akustikkoppler offenbar praxistauglich, bei 1200 Baudist für eine stabile Verbindungwohl der Direktanschluss erforderlich.
3333
Hardware
Bisher gelang ein erfolgreicher Verbindungsaufbaumit einem kommerziellen Modem nur im V.21 OrginateModus (300 Baud). Da auch der Verbindungsaufbau zwischen zwei Datenklos scheiterte,hat der Autor den Verdacht, dass der AnswerModebei den verwendeten Modemchips nicht richtigfunktioniert.
Für den hier vorgestellten Aufbau wurde das Platinenlayout leicht geändert, weil der verwendete Trafo (TelefonÜbertrager) andere Maße hat als der imOriginal vorgesehene. Außerdem ist ein unbenutzterBereich der Platine mit einer Massefläche belegt.Da die Angaben im Schaltplan und im Bestückungsplan teilweise sehr schlecht zu lesen waren, wurden dort die handschriftlichenBeschriftungen ersetzt. Für einem Nachbau ist esempfehlenswert, das Platinenlayout nochmals zuverändern, da die ZDioden D2 und D3 zu nah amÜbertrager liegen.
Die veränderten Pläne stehen als ZIP Datei (sieheLink) bereit. Diese Datei enthält die OriginalBauanleitung, die geänderten Dateien und das Datenblatt des verwendeten Modem Chip. Der für dasgeänderte Platinenlayout verwandte Trafo ist bei Fa.Reichelt unter der Bestellnummer NFU 11 erhältlich. (cd)
Über den Autor
Christian Dirks ist seit 2011 Vereinsmitglied undbeschäftigt sich vor allemmit der Reparatur vonCommodore 8bit Computern und deren Peripherie
Der fertige Testaufbau des CCC Modems
Schematische Darstellung des Aufbaus
aus: CCC DatenschleuderLinks:
http://www.classiccomputing.de/cccdatenklo
3434
Hardware
Selbst gebaut
Minimales Z80 System
Eine besonders reizvolle
Aufgabe ist es, einen Ein
platinencomputer (EPC)
komplett selbst zu bauen. Das
hier vorgestellte System verwen
det einen Z80 Prozessor und ist
wenig aufwändig im Nachbau.
Es gibt einiges dazu im Netz zuentdecken. Von Arduino/esp8266Emulatoren von 8bit CPU‘s, eineCPU mit Propeller/AVR als I/OInfrastrukturen bis hin zu ‚wirklichen‘ EPC‘s bestehend aus CPU,Ram, Rom. Ziel des Autors war einEPC ohne moderne Hilfchips, ohne Video, Tastatur und Monitorprogram.
Hier wird folgende Startkonfiguration verwendet:
____Z80 CPU
____4093 Oszillator
____Rom = 27C256 32k Eprom
____Ram = 62256 32k SRam
Rom / Ramselektion
Mit A15 kann direkt selektiertwerden, ob Rom (A15=0) oderRam (A15=1) angesprochen werden soll. Zur Selektion wird/MREQ + A15 über 74HCT32 undeinem Inverter aus 4093 folgendermassen verschaltet:
Um nicht unnötige Leitungen vonZ80 zu Rom und Ram extra legen zumüssen, wurden beim RAM von altem Cache RAM in schmaler Bauform ausgegangen. So liess sich dasRAM innerhalb des ROMSockelspacken und die korrespondierendenLeitungen (D0 D7; A0 A13) direkt über eine Lötbrücke verbinden.Lediglich A14, /OE, /CE, /WE, VPPmüssen getrennt bleiben und separatangesteuert werden.
OutputDer Output wird über einen 8fachTristate Latch 74HCT374 gesteuert.über /IORQ und /WR. D0D6 über560 Ohm Widerstände an einer 7Segment LED Anzeige mit gemeinsamer Anode. /OE des 74LS374 sind
fest auf GND. Selektsignal anCP/CLK Pin 11 gezogen.
AufbauDer erste Testaufbau erfolgte aufeiner Lochrasterplatine. Für eineDemonstration der Funktionsfähigkeit der Schaltung reicht das.Für den Nachbau ist das aber nichtempfehlenswert. Deshalb wurdeim Anschluss an den Testaufbaueine gedruckte Platine (PCB) dazuentworfen. Als 7Segmentanzeigedient eine Kingbright: SA3611GWA grün und SA3611SRWArot (gemeinsame Anode). Die Bauform ist etwas zu schmal, dahermüssen die Pin's etwas nach außengebogen werden. Die EinzelLED'szeigen mit der Anode zum Platinenrand. (ps)
Links
https://github.com/petersieg
Über den Autor
Peter Sieg ist seit 2006Wiedereinsteiger im RetroComputing Hobby. Er ist Autor derBücher "CommodoreHardwareRetrocomputing" und"SimulationEmulation ExoticFlavor"
3535
Hardware
Ramtest mit Zaehler (1x Ramtest 8000h ffffh ca. 1,x min):
1/ 0 : cpu z802/ 0 : org 03/ 0 : 01 36 00 init: ld bc,led0 ;bc points to ledn4/ 3 : 16 0B ld d,10 ;count runs 09 loop5/ 5 : 0A ld a,(bc)6/ 6 : ; ld a,(led0) ;11000000b7/ 6 : D3 00 out (0),a8/ 8 : start:9/ 8 : 21 00 F0 ld hl,08000h ;mem start10/ B : ramtst:11/ B : 3E 55 ld a,55h12/ D : 77 ld (hl),a13/ E : 7E ld a,(hl)14/ F : FE 55 cp 55h15/ 11 : C2 35 00 jp nz,fail16/ 14 : 3E AA ld a,0aah17/ 16 : 77 ld (hl),a18/ 17 : 7E ld a,(hl)19/ 18 : FE AA cp 0aah20/ 1A : C2 35 00 jp nz,fail21/ 1D :22/ 1D : 23 inc hl ;mem end ffffh > 023/ 1E : 7C ld a,h24/ 1F : FE 00 cp 025/ 21 : C2 0B 00 jp nz,ramtst26/ 24 : 7D ld a,l27/ 25 : FE 00 cp 028/ 27 : C2 0B 00 jp nz,ramtst29/ 2A :30/ 2A : 15 dec d31/ 2B : CA 00 00 jp z,init32/ 2E : 03 inc bc ;bc points no next led code33/ 2F : 0A ld a,(bc)34/ 30 : D3 00 out (0),a35/ 32 : C3 08 00 jp start36/ 35 :37/ 35 : 76 fail: halt38/ 36 :39/ 36 :40/ 36 : C0 led0: defb 11000000b ;0: c0h a, b, c, d, e, f41/ 37 : F9 led1: defb 11111001b ;1: f9h b, c42/ 38 : A4 led2: defb 10100100b ;2: a4h a, b, d, e, g43/ 39 : B0 led3: defb 10110000b ;3: b0h a, b, c, d, g44/ 3A : 99 led4: defb 10011001b ;4: 99h b, c, f, g45/ 3B : 92 led5: defb 10010010b ;5: 92h a, c, d, f, g46/ 3C : 82 led6: defb 10000010b ;6: 82h a, c, d, e, f, g47/ 3D : F8 led7: defb 11111000b ;7: f8h a, b, c48/ 3E : 80 led8: defb 10000000b ;8: 80h a,b,c,d, e, f, g49/ 3F : 90 led9: defb 10010000b ;9: 90h a, b, c, d, f, g50/ 40 :51/ 40 : end
I/OTestprogramm:
1/ 0 : CPU Z802/ 0 : org 03/ 0 :4/ 0 : start:5/ 0 : DB 00 in a,(0)6/ 2 : D3 00 out (0),a7/ 4 : C3 00 00 jp start8/ 7 :9/ 7 : end
3636
Hardware
Selbst gebaut — Minimales Z80 System
Hier die Unterseite mit der Verdrahtung vonSpannungen, Takt und RAM/ ROMSelect.
Nun kommen die Datenleitungen D0 – D7und die Adressleitungen dazu.
Das ist die Oberseite mit den bis dahinverdrahteten Bauteilen.
Hier sind bereits Output Port und 7SegmentAnzeige hinzugefügt.
Dieser Drahtverhau macht klar: Einegedruckte Platine ist eindeutig die bessereIdee.
Geschafft: Das fertige MiniZ80 System mit 32kROM, 32k RAM und 8bit Output und 8bit Input
3737
Kurz vorgestellt
Mein liebstes Sammlerstück
Agenda VR3 —der erste LinuxPDA
Im Juli 2001 kam mit dem Agen
da VR3 der erste serienmäßig
mit Linux ausgelieferte Hand
held auf den Markt. Das Gerät wur
de vom Hersteller vollmundig als
"ultimate mindtool" bezeichnet.
Weniger als zwei Jahre danach war
es aber wieder in der Versenkung
verschwunden.
Die Hardware des Agenda VR3 wurdevon der Kessel Electronics Ltd. ausHong Kong hergestellt. Die Holdingdieses Unternehmens hatte auchdie Agenda Computing, Inc. inden USA und die AgendaComputing DeutschlandGmbH gegründet und mit demVertrieb betraut. Ende 2001wurde die Agenda Computing,Inc. geschlossen. Die Weiterentwicklung der AgendaSoftware lief noch eine Weiledurch die deutsche AgendaComputing GmbH in Berlin,2002 schloss auch dieses Unternehmen.
Der Agenda VR3 besitzt einemit 66 MHz getaktete MIPSCPU (NEC VR4181), 16 MBFlashRAM und 8 MB akkugepuffertes RAM. Als Ein/Ausgabeeinheit wird einLCD Touchscreen Display mit16 Graustufen benutzt. Den Kontaktzur Außenwelt stellt eine serielleHochgeschwindigkeitsschnittstelle mit1,6 MHz Takt her, die über ein spezielles Synchronisationskabel auch mit einem normalen RS232Interfaceverbunden werden kann. Auch einModem zum Anschluss an dieseSchnittstelle und ein EthernetAdapterwar erhältlich. Abgelegte Adressen undTelefonnummern können auch per Infrarotschnittstelle an Mobiltelefoneoder andere Organizer gesendet werden.
Als Betriebssystem dient Agenda Linux, das mit einem weitestgehend unveränderten LinuxKernel 2.4 arbeitet.Es hat seine Wurzeln im Linux VRProjekt, das Linux für NEC VRbasierte Windows CE Handhelds angepasst hat.
Der Kernel (ca. 2 MB) liegt ebenso wiedas RootDateisystem (ca. 9 MB) imFlashRAM und bootet in das akkugepufferter RAM, das Wurzelverzeichniswird dabei readonly gemountet. DerEin/Ausschalter bzw. der Stiftsensorversetzen dann das geladene Betriebssystem via APM in den SleepModus.Ein Teil des regulären RAM wird alsRAMDisk genutzt, auf der die Verzeichnisse /tmp und /var liegen, das übrige wird als Arbeitsspeicher für
laufende Programme genutzt. Etwa3,5 MB desFlashRAM'swird währenddes Bootens
als nonvolatileDisk nach/flash gemountet. Die
ser Bereich dient zur Ablage vonBenutzerdaten (/home/default) undKonfigurationen (/etc). VRLinux beinhaltet elementare UNIXProgramme undDaemons wie inetd, telnetd, rsyncd, einFramebuffer X11Server, rxvt als XTerminal, die BourneAgain Shell undKompaktversionen der üblichenKommandozeilenTools. In erster Liniesolle der VR3 als "SchreibtischVerlängerungsgerät" dienen und die auf demDesktop gesammelte Adressbeständeund Termindaten auch unterwegs verfügbar machen. Für die Verbndung zwischen Desktoprechner und Handheldbenutzt der Agenda VR3 das Synchronisationskabel und unter Linux eine VRSync genannte Software. VRSync kannden VR3 Terminkalender, das Adressbuch und die ToDo Liste mit denGNOME Pendants GnomeCal, Gnome
Card oder auch dem KOrganizer desKDEProjekts abgleichen. Viel darfman von den Programmen nicht verlangen, als Adressbuch und Kalendertaugen sie aber allemal; auch die TaschenrechnerAnwendung ist durchausbrauchbar. Außerdem gibt es ein paarSpiele.
Der VR3 baut über das serielle Kabeleine PPPVerbindung mit demDesktop auf, hat also einen vollwertigen Netzzugang. Das Display des VR3wird über einen angepassten X11Server angesteuert. Dies gelingt nicht nurmit den eingebauten Programme. Mankann durchaus über die PPPVerbindung eine X11Applikation ihre Datenan diesen Prozess senden lassen undsich so ein Desktopprogram auf demDisplay des VR3 zeigen lassen.
Zum Surfen im Internet gibt es keinengrafischen Browser, mit "links" findetsich aber ein nur 1 MB großer cursesbasierter WWWClient für die Textkonsole. In Anbetracht der geringen
Bildschirmgröße ist dies eher einVorteil. Die Bedienung dieses übrigensframefähigen Programms erleichtertein Menü, das nachDrücken des ESCFeldes des SoftKeyboards am oberenBildrand erscheint.
Interessant wird dasGerät auch durch das
EthernetAddon, das die AgendaComputing Deutschland GmbH zusammen mit OptiCompo Electronicsentwickelte. Es wird an die serielleHighspeedSchnittstelle des AgendaVR3 angesteckt und hat eine eigeneStromversorgung durch zwei AAABatterien. Den Zugang zum Ethernetschafft eine RJ45 Buchse. In der Praxis kam diese Schnittstelle kaum anÜbertragungsgeschwindigkeiten von80 kByte/s heran, was in der magerenRechenleistung des VR3 liegt.
Trotz aller Schwächen macht der kleine MIPS Rechner auch heute nochSpaß. Das Konzept an sich ist gut erhätte nur einen Hersteller mit etwaslängerem Atem verdient gehabt. Mitbesserer Software auch für denDesktop wäre wohl ein größererMarkterfolg zustande gekommen. (gb)
3838
Reparatur
Selbst restauriert
Wiederbelebung eines AIM65
Mitte der 1970er Jahre waren Computer
für Hobbyisten und Heimanwender eher
selten. Zumeist handelte es sich um Ein
platinenComputer, die eher als Lern und weniger
als Anwendersysteme konzipiert waren. Auch
mussten diese Systeme oft selbst zusammengebaut
oder wenigstens komplettiert werden.
Ein bekannter und sehr erfolgreicher EinplatinenComputer war der Commodore KIM1, ein anderersicher der Apple I des jungen Gespanns Steve Wozniakund Steve Jobs. Ein weiterer, oft vergessener Vertreterdieser Gattung war der Rockwell AIM65, ein Nachfolger des KIM1.
Der AIM65 war für Lehrzwecke, als Steuerungsrechner und für Hobbyanwender gedacht. Er kam Ende1978 auf den Markt. Der Name AIM65 ist die Abkürzung für "Advanced Interactive Microcomputer", während die Zahl "65" auf den verwendeten MOS 6502Prozessor hinweist. Ein Nachbau des AIM65 wurdevon Siemens als PC100 vertrieben und gern für Steuerungszwecke benuztz.
Die übliche Grundausstattung des AIM65 ist rechtumfangreich:
___20stelliges LED Display (16Segment Anzeige)
___eingebauter 20 Zeichen Thermodrucker
___14Kb RAM
___Monitor für Maschinensprache
___2 ROM Sockel für Erweiterungen wie Assembler,BASIC Interpreter usw. (2516, 2532 oder 2716Eproms)
___maximal 8 RAM Bausteine (2114) für den Maximalausbau von 4 kByte Speicher. Mindestens müssen zwei 2114 verbaut sein (1 kByte Speicher)
___KIM1 kompatible "EXPANSION" und "APPLICATION" Schnittstelle. Diese dienen demAnschluss von Druckern, Datenrecordern oderzusätzlichen Schnittstellen und Erweiterungskarten
___Audioein/ ausgang zum Speichern von Programmen auf Audiokassetten
Der Computer benötigt fünf unterschiedliche Spannungen für die Stromversorgung. Die "+5V" und"GND" Eingänge versorgen den Rechner selbst, der"+24V" Eingang den Thermodrucker und die "+12V"und "12V" Eingänge einen etwaigen Fernschreiber(TTY).
AIM65 Systeme sind nicht gerade häufig anzutreffenund auch nicht immer gut erhalten. Daher folgen hier einige Erfahrungen und Tipps für die Rekonstruktion einesAIM65 gegeben werden. Ausgangspukt ist ein recht lädierter AIM65: der Platine fehlt die Tastatur, die Anzeige und der Drucker.
Der AIM65 vor der Restauration
Für die Erstinbetriebnahme sollte der Rechner zunächstüber die TTY Schnittstelle betrieben werden. Im Handbuch für den Siemens PC100 ist eine serielle Schnittstelle mit 20mA zum Anschluss eines Fernschreibersbeschrieben. Es muss kein echter Fernschreiber sein –ein PC mit einen USBV24TTL Wandler kann ebensoverwendet werden und eine Übertragungsgeschwindigkeit von 1.200 Bit/s ist machbar.
Das fehlende Display musste ebenfalls ersetzt werden.Die 20 Anzeigen sind in 5 Modulen à 4 Stellen angeordnet, die über eine 6520 PIA angesteuert werden. Die orginalen Module Siemens DL1416 sind schwer zubeschaffen und meist recht teuer. Die Module DL3416sind hingegen deutlich preiswerter und entsprechen in
Das fertige Display
3939
Reparatur
der Leistung den DL1416. Sie sind etwas größer, wodurch die Lesbarkeit verbessert wird. Allerdings erfordern diese Module eine individuelle Platine zumAufstecken auf den AIM65, die selbst entworfen undgeätzt bzw. in Auftrag gegeben und anschließend bestückt werden muss.
Der Ersatz der Tastatur ist ein deutlich schwierigeresUnterfangen. Dies liegt vor allem am Tastaturlayout.Die QWERTY Anordnung ist unspektakulär, aber dieSonderzeichen auf den Zifferntasten sind anders alsüblich belegt. Hier gibt es natürlich länderspezifischeVariationen, das alte Layout des AIM65 gibt es heutenicht mehr. Das Zeichen über der Ziffer (also mitShiftTaste) entspricht immer einem ASCIICode, derum den Subtrahenten 16 (0x0F) kleiner ist als der ASCIICode der Ziffer.
Das Tastaturlayout des AIM65
Ein Beispiel: Die ASCIICodes des Ausrufezeichensist 0x21, das der Zahl 1 ist 0x31, dementsprechendliegt das Ausrufezeichen über der Zahl 1. Bei den anderen Tasten ist es genauso. Glücklicherweise haben
auch andere Homecomputer eine derartige Belegung, beispielsweise der EACA Video Genie. DieseKeyboards bestehen aus einer einfachen Tastaturmatrix, die aber von der des AIM65 abweicht. Dahermüssen die Tasten aus der Matrix ausgelötet werden.Hier leistet eine qualitativ hochwertige Entlötstationgroße Hife.
Für die neue Tastenverdrahtung musste nun eine eigene Platine entwickelt werden. Dazu waren dieTasten mit der Schieblehre zu vermessen und imLayoutprogramm ein entsprechendes Bauteil zu definieren. Damit gelingt die Erstellung des Schaltplanrecht schnell und auch das Layout geht gut von derHand. Die fertige Tastatur lässt sich durchaus sehenhier hat eine Profilackiererei das Halteblech entsprechend gepimpt. (fs/gb)
Der fertig restaurierte AIM65
Über den Restaurator
Florian Stassen kam über die PflichtAG in der9.Klasse an die "Informatik". Die Sammlerei hatihn 2007 überkommen, als er die alten (Taschen)Rechner wiederhabenwollte.
4040
Reparatur
Selbst repariert
Neue Akkus für den Epson HX20
Alte, tragbare Rechner verfügen oft über Ak
kus zur Stromversorgung unterwegs. Will
man seinen Oldtimer auch heute noch
mobil nutzen, führt an einem Tausch der Akkus
kein Weg vorbei.
Der HX20 ist ein Wegbereiter wirklich tragbarer Computer – er war der erste serienreife Laptop der Welt.Das Gerät kam im Jahr 1982 auf den Markt und kostetein Deutschland um die 2100. DM. Er verfügt über einMicrokassettenLaufwerk als Massenspeicher, eineneingebauten 1Nadeldrucker (ja, wirklich eine Nadel)und grafikfähiges Display mit 4 Zeilen a 20 Zeichenoder 120 x 32 Pixel. Das Gerät ist erstklassig verarbeitet und kennt viele Details wie den getrennt schaltbarenDrucker oder das BASIC mit Befehlen zur Nutzungdes Bandlaufwerks. Es ist mit Akkus für den mobilenBetrieb versehen.
Bei einem 1982 ausgelieferten Gerät ist es nicht verwunderlich, dass die Akkus heute nicht mehr funktionieren. Glücklicherweise ist der Austausch gegenhandelsübliche Akkus in Eigenarbeit zu bewerkstelligen. Im Epson HX20 sind NickelCadmium Zellen(NiCd) verbaut und zwar als sogenannte SUBC Zellen(D=21mm, L=42mm). Auf dem Schild an der Unterseite des Rechners findet sich die Angabe der Ladezeitund des Ladestroms, nämlich 8 Stunden bei 200mA.Die NiCd Zellen hatten eine die Originalkapazität von1100 mAh. Passende Zellen zu finden ist keine großeSache, SUBC ist nach wie vor eine gängige Bauform,und die meisten davon sind auch direkt mit Lötfahnenausgestattet. Hier sollen NiCd Zellen mit 2400mAhverwendet werden. Die erforderliche Ladezeit liegtdann bei Ladung mit 200mA bei etwa 14 Stunden. Diefolgende SchrittfürSchritt Anleitung zeigt den Umbauder Akkus. Dies ist die Ausgagssituation – das alte AkkuPack und die neuen Zellen:
Zunächst entfernen wir die Folie vom AkkuPack undlegen die Anschlüsse frei. Die Anschlüsse sind oft sowie hier durch die AkkuLauge beschädigt:
Zum Glück brauchen wir davon nur die abgelötete Anschlussleitung mit Stecker:
Die Lötfahnen der neuen Zellen werden erst einmal verzinnt. Dann klappt auch später das Zusammenlöten. Wirverwenden dafür Lötzinn mit Kolophonium als Flussmittel. Der Vorteil: Kolophonium hat eine korrosionshemmende Wirkung und kann hinterher an denLötstellen verbleiben. Andere Flussmittel wie Lötfettsind korrosionsfördernd und sollten daher nach dem Löten entfernt werden. Das wäre aber zwischen zwei aufeinander gelöteten Lötfahnen recht schwierig.
Die Lötfahne am Pluspol einer Zelle wird so umgebogen, dass sie auf die Fahne am Minuspol der nächstenZelle passt:
4141
Reparatur
Würde dies umgekehrt geschehen, bestände bei einerBeschädigung der Zellenummantlung die Gefahr einesKontakts der zusammengelöteten Fahnen mit dem Gehäuse der Zelle. Da das Gehäuse der Zelle den Minuspol darstellt, wäre die Zelle dann kurzgeschlossen. Beieiner voll geladenen Zelle ist ein Kurzschluss nichtungefährlich. An der Oberseite der umgebogenen Fahne wird auch noch eine kleine Stelle verzinnt, damitbeim anschließenden Löten auch der Wärmeübergangvom Lötkolben zur Fahne klappt.
Wenn man die Zellen möglichst ohne Versatz aneinander hält, müssen die Fahnen mit leichter Vorspannungaufeinander liegen:
Der im Bild sichtbare Abstand zwischen den Fahnenergibt sich durch das beim Verzinnen aufgebrachteLötzinn. Jetzt muss der Lötkolben nur noch oben aufdie zuletzt verzinnte Stelle gehalten werden. Wenn dasZinn zwischen den Fahnen verläuft und die Fahnenflach aufeinander liegen, ergibt sich eine recht großeverlötete Fläche. Diese ist mechanisch sehr stabil undkann auch hohe Ströme vertragen. Zwar ist das in unserem Anwendungsfall nicht erforderlich, kann abernicht schaden, falls der Akku einmal an einem externen Schnellader geladen wird.
So sehen alle vier Zellen zusammen gelötet aus:
Der ursprüngliche Plan war es, das Paket in der Mitteumzubiegen, um die gewünschte 2x2 Anordnung zu bekommen. Leider passt es so nicht in das Batteriefach desHX20. Wenn zwei Zellen darin nebeneinander liegen,ist das Fach in der Breite bereits ausgefüllt. Platz für dieneben den Zellen liegenden Lötfahnen ist da leidernicht.
Also wurde das Päckchen wieder in der Mitte auseinander gelötet und die Zellen entsprechend zusammengelegt. Nun wurden noch die Anschlussleitungangelötet, beide Hälften des AkkuPack verbunden unddie Kontakte mit Schrumpfschlauch isoliert:
So passen die Zellen so gerade eben in das Fach – wederin der Länge noch in der Breite bleibt Platz. Das fertigeAkkuPack sitzt passgenau im Gerät und lässt sich problemlos laden. (cd)
Über den Autor
Christian Dirks ist seit 2011 Vereinsmitglied undbeschäftigt sich vor allemmit der Reparatur vonCommodore 8bit Computern und deren Peripherie.
4242
WürfelMacs erweitern
Iomega ZIP Drive als Festplatte
Reparatur
Am 22. Januar 1984 wurde
mit der spektakulären
Einführung des ersten
Macintosh Computers für die
Massen eine neue Innovation ge
feiert: die Steuerung des Betriebs
systems mit einem neuartigen
Zeigegerät – der Maus. Intuitiv,
sicher und einfacher sollte die Be
dienung sein als je zuvor und
zukunftsweisend für alle kom
menden Generationen.
Aufgrund der neuen Möglichkeiten,die der Macintosh versprach, entwickelten sich in kürzester Zeit vieleneue Programme, Software undSpiele für das Macintosh Betriebssystem, das zunächst nur "System"genannt wurde. Schnell stieß manmit den damaligen Hardwarekonfigurationen von maximal 128KBRAM an die Grenzen des Notwendigen. Im Jahr 1985 brachte Appledeshalb das erweiterte ModellMacintosh 512K auf den Markt,welches 512 KB Arbeitsspeicher besaß. Der neue Mac kurbelte den Hype geringfügig an, aber noch dieHöhe der Zeit nicht erreicht.
Macintosh PlusErst im Januar 1986 und damit genau zwei Jahre nach Erstvorstellungdes UrMacintosh erschien mit demMacintosh Plus ein Modell mit damals sagenhaften 1 MB RAM unddem modernen 800 KB Diskettenlaufwerk. Er war die Antwort aufdie beiden größten Wünsche an dasVorgängermodell Macintosh 512k –mehr Leistung und Speicherplatz.Den täglichen Ansprüche im Arbeits bzw. Bürobetrieb wurde derMacintosh 512k und erst recht derVorläufer Macintosh 128K nämlichganz und gar nicht gerecht. Der MacPlus ist der längsten unterstützte undgebaute Rechner der Macintosh Linie und der wohl erfolgreichste allerWürfel überhaupt.
Er wurde auch am meisten verkauft.Erst im Oktober 1990 wurde dieserseitens Apple endgültig eingestellt.
Der Riesensprung zur 1 MBMarke,die Aufrüstoption auf 4MB und die800KB Diskettenmedien und besonders die neu eingeführte SCSISchnittstelle für externe Geräe waren die Eigenschaften, die diesenComputer über Jahre hinweg denMarkt beherrschen ließ und auchnoch heute den Sammlern einJauchzen entlockt. Denn der Macintosh Plus ist so, wie ein Macintoshvon Anfang an hätte sein sollen –schnell, stark und für damalige Verhältnisse äußerst stabil und solide.Dennoch ist er ein sehr leichter undleiser Arbeitscomputer für das Büro,die Schule und die Universität, aberauch für die einfachen Familien Zuhause.
Keine FestplatteDas einzige Manko des Mac Plus istbis zum heutigen Tage das Fehleneiner internen Festplatte. Alle nachfolgenden Macintosh Computer hatten diese entweder direkt von Hausaus dabei oder konnten optional miteiner Platte nachgerüstet werden.War dies früher in erster Linie eineGeldfrage, so ist eine Nachrüstungoder der Ersatz einer defekten Platteeine Frage der Verfügbarkeit. Diehierzu benötigten Narrow SCSIFestplatten sind mittlerweile nämlich rar geworden. Zudem verträgtder Mac nicht jede beliebige Platte.
Eine Alternative zur Platte ist alsogefragt. Sie findet sich in Form eines SCSI ZIP Drive des HerstellersIOMEGA.
Die Installation ist nicht ohneTücken. Zunächst gilt es, die benötigten Komponenten zu beschaffen.Wir brauchen neben dem Macintoshmit Maus und Tastatur ein externesSCSI ZIPLaufwerk, am besten einIOMEGA ZIP100. Die SCSI Termination muss aktiv sein und dasLaufwerk muss auf SCSI ID 5 eingestellt werden. Außerdem werdendie Installationsdisketten vonMacintosh System 6.x und am besten die Version 6.0.7 gebraucht. Zusätzlich erforderlich sind dieIOMEGA Treiberdisk v4.2, mehrereleere ZIP100 Disketten und mehrere leere 3.5“ 800K Disketten (720kB Disks und keine HD Disks). Umbei Laune zu bleiben, sollten aucheine große Tasse Kaffee und etwasGebäck zur Versüßung der Wartezeitbereitstehen.
Die Vorgehensweise an sich ist relativ simpel und wer schon mal einenMacintosh Computer – egal obWürfel oder Desktop bzw. StandMacintosh – installiert hat, kennt dieGrundschritte einer Installation.
Schritt 1: Anschluss aller Peripherie und Laufwerke
Als erstes schließt man alle notwendigen Laufwerke wie externe Diskettenlaufwerke und das SCSIZIPLaufwerk an den Rechner an. Auchdas SCSILaufwerk solte schon mitStrom versorgt werden.
Schritt 2: Start des Mac undder Installation des Systems
Wir legen die Systemdiskette insLaufwerk und schalten den Rechnerein.
Nach kompletten Start des Plus finden wir und auf dem Schreibtisch
Macintosh PlusFoto: Alexander Schaelss (Wikipedia)
4343
(Desktop) wieder. Dort navigierenwir mit der Maus auf das Diskettenlaufwerk und starten das Programm„System Aktualisieren“. Nach kurzem Moment sollte das SetupFenster „System aktualisierenSkript“ erscheinen. Wir klicken aufOK und den Button „Auswerfen“.Nun muss eine leere bzw. formatierte 800K Diskette eingelegt werden.Sollte die Diskette nicht leer seinoder aufgrund eines vorherigen Formats nicht erkannt werden, erscheintein entsprechendes Fenster. Dortwählen wir als Format „Zweiseitig“aus, damit wir die vollen 800KB Kapazität nutzen können. Als Namevergeben wir "Startdiskette". Initialisieren bedeutet im Macintosh System das Formatieren der Diskette,was alle Daten auf der Diskette unwiederbringlichlöscht. Nach erfolgreicherInitialisierung und Prüfungder Diskette erscheint einÜbersichtsfenster zur Installation. Mit Klick auf„Installieren“ wird einminimales Grundsystemauf diese Diskette startfähig kopiert.Während des Installationsprozesseswerden im Wechsel die „Startdiskette“ und die jeweiligen System bzw.Installationsdisketten verlangt. NachAbschluss wählen wir „Beenden“,um den Installation auf dem Datenträger abzuschließen.
Die Installation eines minimalenSystems auf einer einzelnen Disketteist notwendig, um den wichtigen IOMEGA ZIP Treiber ins Setup zu injizieren. Erst damit erkennt dasSystem ZIPDrive und Medium –von Haus aus geht das nicht. Auf einer Minimalinstallation auf Diskettehaben wir genug Speicherplatz übrig, um den Treiber zu integrieren.Wenn das System dann von dieserDiskette startet, wird der ZIPTreibergeladen und erkennt unser externesZIPLaufwerk mit ZIPDiskette.
Schritt 3: ZIPTreiber einbauen
Nach erfolgreichen Start von derfrisch erstellten Systemdiskette wer
fen wir diese über die Menüsteuerung wieder aus und legen dieIOMEGA Treiber Diskette ins Laufwerk. Auf Diskette befindet sich dieDatei „IOMEGA Driver“. DieseDatei schieben wir einfach per Drag& Drop direkt auf das Symbol„Startdiskette“ auf dem Desktop. DieDatei wird in den RAMPuffer geladen und dann wird nach der Startdiskette verlangt. Nach erfolgtemDiskettenwechsel sollte die Datei direkt im Hauptverzeichnis der Startdiskette liegen. Dort muss diesewieder mit der Maus in das Unterverzeichnis „Systemordner“ geschoben werden. Sobald dies erledigt ist,starten wirden
Macintosh neu. Schon beim Systemstart sollte ein neues kleines Symbolam linken unteren Bildschirmranderkennbar sein. Dies bedeutet ein erfolgreiches Laden des ZIPTreibers.
Schritt 4: Installation auf demZIP Laufwerk
Wenn der ZIPTreiber erfolgreichgeladen wurde, sollte beim Einlegeneiner ZIPDiskette mit fremdenDateisystem eine Meldung erscheinen und der Macintosh sollte das Initialisieren anbieten. Dieses Angebotnehmen wir an und benennen dieZIP Disk mit „MAC ZIP HDD“. Wieschon zuvor bei der „Startdiskette“sollte nach erfolgreicher Erstellungdas Symbol einer ZIPDiskette mitentsprechender Benennung auf demDesktop erscheinen. Jetzt kann dieInstallation der eigentlichen „ZIPFestplatte“ beginnen. Dazu sind wieder die System & Installationsdisketten erforderlich. Der Vorgangläuft wie im Schritt 2 beschriebenab. Allerdings kann nun eine Vollin
stallation samt aller zugehörigenElemente durchgeführt werden.Schon bei Start des Programms„System Aktualisieren“ wird imNormalfall die eingelegte ZIPDiskette als größtes Speichermediumerkannt und eine vollständige Installation der Macintosh Systemsoftwarefür den Macintosh Plus angeboten.
Nach Abschluss der Installation legen wir wieder die „Startdiskette“ins Laufwerk und kopieren den „IOMEGA Driver“ wieder via Drag &Drop in den Systemordner auf der„MAC ZIP HDD“.
Nun schalten wir den Macintoshaus, nehmenalle Diskettenund gebeneinzig dieMAC ZIPHDD wiederins ZIPLaufwerk. Nach demEinschalten sollteder Mac sein Sys
tem vom ZIP Laufwerk laden und wir können und ansagenhaften 100MB Speicherplatzauf dem ZIP Medium freuen. Mitdieser Methode können wir beliebigviele ZIP Systemdisketten erstellenund diese mit Spielen oder Anwendungen füllen. (mn)
Links:
https://youtu.be/tplQWxFD3xU
Reparatur
Über den Autor
Marcus Nothhelfer ist seit 2011Vereinsmitglied und beschäftigtsich am liebstenmit AppleKlassikern der vor 90er Jahre.Seine Steckenpferde sind dabeidie Apple Lisa, der Apple /// undfrühe Apple Systememit 68kArchitektur.
4444
Wissen
Messen an digitalen Schaltungen mit dem Logikanalysator — Teil 1
Wer viel misst
Viele interessante Schaltun
gen sind mit übersichtli
chem Aufwand nachge
baut– den richtigen Umgang mit
dem Lötkolben vorausgesetzt.
Doch nicht immer funktioniert
das fertige Gerät dann so, wie es
soll. Um Fehlerursachen in digita
len Schaltungen zu suchen oder
unerwarteten Ergebnissen bei der
Programmierung auf den Grund
zu kommen, sind sinnvolle Mess
methoden und Messgeräte erfor
derlich.
In solchen Problemfällenstehen mehrere Geräte zurVerfügung. Das Multimeter sei an dieser Stelle nurder Vollständigkeit halbererwähnt. Es kann nur statische Zustände messen.Sein Einsatz ist sinnvoll,um die korrekte Spannungsversorgung in derSchaltung zu bestimmenoder Unterbrechungensowie Kurzschlüsse inSignalwegen festzustellen.
Das Oszilloskop
Das Oszilloskop ist geeignet, dieQualität von analogen Signalen aufden Signalwegen zu messen. AntikeGeräte sind hier ausgeklammert, wirbetrachten hier nur digitalen Speicheroszilloskope (DSO). Diese Geräte messen auf Messkanälen denSpannungsverlauf über die Zeit,speichern ihn und stelllen diesengrafisch dar. Zum Start einer Messung wird ein bestimmter Zustandder überwachten Leitung festgelegt(Triggerbedingung). Ist dieser Zustand erreicht, wird zur Erfassung inregelmäßigen Zeitabständen derSpannungswert über einen A/DWandler in einen diskreten Wertkonvertiert und als digitaler Wertabgespeichert. Auf dem Display
können diese Daten ausgewertet und– bei der Erfassung mehrerer Kanäle – auch verglichen werden. ImHobbybereich sind Oszilloskope mitzwei Kanälen üblich.
Der Logikanalysator
Mit dem Logikanalysator könnendie Logikzustände auf mehreren Signalwegen parallel festgestellt werden. Im Gegensatz zum DSOwerden bei der Erfassung aber keinedigitalisierten Analogwerte gespei
chert, sondern nur der logische Wert(True oder False, also 1 oder 0), derdurch einen vorzugebendenSchwellwert (Threshold) definiertist.
Im einfachsten Fall, dem TimingMode, werden die Spannungswerteauf den beobachteten Leitungen ineinem festen Zeitraster (Abtastrateoder Sample Rate) an einen Komparator übergeben, der die Spannung mit einem festgelegtenSchwellwert (Threshold) vergleichtund Unter bzw. Überschreitungdieser Schwelle als Logikwert 0oder 1 interpretiert. Diese Logikwerte werden gespeichert, bis derSpeicher voll ist. Im State Modewird ein externer Takt aus derSchaltung als Steuerung der Abtastung verwendet. Dadurch istgewährleistet, dass die relevantenStatusänderungen sicher erfasst
werden, ohne unnötig viele Datenzu erfassen. Bei einigen TektronixLogikanalysatoren wird mit konstanter Abtastrate gemessen, abernur die Pegeländerungen inklusiveder Zeitstempel gespeichert. Dieswird als Transitional Mode bezeichnet. In allen Fällen kann zum Startder Messung über alle beobachtetenSignale eine komplexe Bedingungals Trigger definiert werden.
Die gespeicherten Daten können inForm von Wertetabellen, Rechteck
kurven oder Datendiagrammen angezeigt undausgewertet werden.Der Schwerpunkt beimLogikanalysator ist dieAnalyse des zeitlichenVerlaufs der Logikpegelzwischen mehreren Leitungen. Dabei mussman allerdings berücksichtigen, dass dieseDaten nicht die realenSpannungswerte, sondern nur die Interpreta
tion als Logikpegel wiedergeben.
Grundsätzliche Messprinzipien
Aus dieser Einführung wird klar,dass die Messmethoden bei DSOund Logikanalysator sehr ähnlichsind. Die Abtastrate oder Abtastfrequenz (Samplerate) ist die Frequenz, mit der die Spannungswerteauf den überwachten Leitungen erfasst und an den A/D Wandler beimDSO bzw. Komparator beim Logikanalysator weitergegeben werden. Alle Geräte haben eine größteAbtastfrequenz, diese ist ein wichtiges Qualitätsmerkmal des jeweiligen Gerätes. Je größer sie ist, destogenauer können Spannungsänderungen dargestellt werden und destoteurer ist in der Regel das Gerät.Die korrekte Wahl der Abtastrate istentscheidend für die Qualität der
Tektronix 465 Oszilloskop (aus de.wikipedia.org, User Elborgo)
4545
Wissen
Messung. Ist die Abtastrate zu niedrig, wird die analoge Kurvenform(DSO) nicht korrekt dargestellt oderes werden nicht alle Änderungender Logikpegel erfasst (Logikanalysator). Ist die Abtastrate zu hochgewählt wird der Messwertspeicherzu schnell vollgeschrieben und nurein kurzer Zeitraum aufgezeichnet.Die korrekte Wahl der Abtastratewird später genauer beleuchtet,wenn es um die praktische Messungmit DSO und Logikanalysator geht.
Da sowohl das DSO als auch derLogikanalysator die Messdaten ineinem digitalen Speicher ablegen,ist dessen Größe von entscheidender Bedeutung für den maximal zuerfassenden Messzeitraum. Bei einem Logikanalysator mit 1 kByteSpeicher pro Messkanal kann beieiner Abtastrate von 1Mhz nur eineMillisekunde Datenverkehr aufgezeichnet werden.
Der Start der Messung erfolgt überdie vordefinierte Triggerbedingung,denn in der Regel kennt man einenerwarteten Wert, bei dem die Messung gestartet werden soll. DieserSchwellwert kann eine Spannung(DSO) sein, ein Wechsel des Logikpegels (Logikanalysator), die Richtung der Spannungsänderung
(aufsteigende oder absteigendeFlanke) oder eine Kombination derLogikzustände auf verschiedenenLeitungen. Diese Triggerbedingungkann auch auf einer anderen Leitung als der zu messenden ausgewertet werden. Wenn alsobeispielsweise auf der Leitung X eine ansteigende Flanke detektiertwird, kann die Erfassung der Datenauf den Leitungen A0…A7 (Logikanalysator) starten.
Ohne eine passende Triggerbedingung ist eine sinnvolle Messung nurschwer möglich. Man muss die erwarteten Vorgänge in der Schaltungsehr genau kennen, um dieMesswerte korrekteund zeitsynchron erfassen zu können. Bei vielen modernen Geräten kann dieDatenerfassung nach dem Startkontinuierlich in einen Ringpufferlaufen, bis die Triggerbedingung erfüllt ist. Danach werden die Dateninklusive des Inhalts des Puffers gespeichert. Auf diese Weise erfasstman auch Zustände die beim Erreichen der Triggerbedingung in derVergangenheit lagen. Hier sprichtman von PreTrigger.
DSO und Logikanalysator teilensich das Problem, bei einer an den
Messzweck angepassten Abtastrateschnelle Störspitzen evtl. nicht zuerfassen. Deshalb besitzen höherwertige Geräte eine zusätzliche analoge StörimpulsErkennung(GlitchDetection), die parallel zurdigitalen Messung läuft.
Praktische Messung mit demLogikanalysator
Um Frustration zu vermeiden, ist eswichtig, sich intensiv mit den Möglichkeiten des Logikanalysators auseinander zu setzen. Messungen unddie Interpretation der Ergebnissesind wesentlich aufwendiger alsbeim DSO. Die Einstellungen zu allen Messungen sollten an einemfehlerfreien Gerät getestet werden.Nur mit viel Erfahrung erhält manaussagekräftige Messwerte – es giltauch hier: Wer viel misst, misst vielMist.
Als Beispiel wird nun eine Messungan einem 8 Bit ParallelIEEE488 Interface Bus (auch IEC625, HPIB,GPIB) besprochen. Dieser Buswird bei den CBM Rechnernverwendet, um Diskettenlaufwerke,Drucker und anderen Gerätenanzubinden. Viele Messgeräte besitzen ebenfalls eine solche Schnittstelle. Zum Einsatz kommt inunserem Beispiel ein Logikanalysator Zeroplus LAPC 16128. DieDatenübertragung soll ab dem ersten Schnittstellenbefehl erfasstwerden.
Zur Vorbereitung der Messung mitdem Logikanalysator sollte die Signalqualität auf allen Leitungen miteinem DSO überprüft werden. Flankensteilheit, Pegel und Störungenkönnen nur so gesehen werden. DerLogikanalysator würde die Dateneventuell irreführend interpretieren.Gemäß der Messergebnisse desDSO können Abtastrate, Schwellwert und Filtereinstellungen amLogikanalysator angepasst werden.
Anschließend gilt es, zu analysieren, welche Signalleitungen der zuüberwachenden Schaltung relevantsind, was eine sinnvolle Triggerbe
Logikanalysator und petSD verbunden und bereit zur Messung
4646
Wissen
dingung ist und welche Taktfrequenzen erwartet werden.
__IEEE488 Leitungen: 8 Datenleitungen D0…D7; 3 HandshakeLeitungen NRFD, DAV, NDAC;3 Steuerleitungen EOI, ATN,IFC. Also insgesamt 14 Kanäle.
__ IEEE488 Handshake: EinSchnittstellenbefehl wird mitATN=1 und EOI=0 eingeleitet
__ IEEE488 Datenrate: Da es sich
um einen asynchronen Bus handelt, existiert keine konstanteDatenrate.
Die maximale Datenfrequenz liegtbei 1Mhz, wird aber nur bei wenigen, modernen Gerätekombinationen erreicht. Das langsamste Gerätbestimmt die Geschwindigkeit. Hiermuss man die Datenrate im konkreten Fall mit dem DSO feststellen.Die Signalleitungen werden denKanälen des Logikanalysators zugewiesen und zur besseren Über
sicht mit Namen versehen. AlsTriggerbedingung wird eine absteigende Flanke auf der SteuerleitungAttention (ATN) gesetzt. Die achtDatenleitungen werden als BUS(HPIBData) auf den KanälenA0…A7 definiert. Damit werdenspäter nicht nur die Zustände aufden einzelnen Leitungen, sondernauch das 8bit Datenwort angezeigt(siehe Abbildung). Es ist auch möglich, ein Datenwort z.B. $A7 oderDatenbereich $01…$1F auf demBus als Trigger zu definieren.
Messung und Auswertung
Zur Messung wurde der Logikanalysator Zeroplus C16128 mit demIEEE488 Bus auf einem petSD Diskettenemulator verbunden. Als Buscontroller dient ein CBM 8296. DerLogikanalysator wurde konfiguriertund mit dem petSD verbunden. Danach wurde die Messung auf demLogikanalysator gestartet. Auf demCBM 8296 wird ‚catalog‘ zum Abruf des Inhaltsverzeichnisses eingegeben. Der Logikanalysator wartetbis die Triggerbedingung (Beginnder ersten Befehlssequenz absteigende Flanke auf ATN) erfüllt ist(senkrechte Linie markiert mit roten‚T‘) und zeichnet dann mit einerSamplerate von konstant 200 kHzdie 14 Signalleitungen auf, bis derSpeicher von 128 kb voll ist. Da einPreTigger Bereich von 10% eingestellt ist, werden auch circa 13kB
Triggerbedingung einstellen
Das Ergebnis der Messung
4747
Wissen
Daten abgespeichert, die vor Erfüllung der Triggerbedingung aufgezeichnet wurden.
Die Messung zeigt deutlich, dassdie erste Befehlssequenz (ATN=0)aus den Zeichen $C0 $D7 $0F besteht, gefolgt von einem Datenwort$DB. Der Logikanalysator hilft ander Stelle nicht weiter, diese Sequenz zu interpretieren. Man mussdie Befehlssequenz mit Hilfe einesIEEE488 Manuals/Tutorials dekodieren. Dazu ist auch zu berücksichtigen, dass der IEEE488 Bus mit
inverser Logik arbeitet, das heißtLow entspricht True und High entspricht False.
Die Befehlssequenz ist also $3F(Untalk), $28 (Listener Address 8),$F0 (Secondary Address 0). Dasheißt, alle Talker auf dem BUS werden deaktiviert und die petSD mitder Adresse 8 wird als Listener mitder Sekundäradresse 0 aktiviert.Man kann auch das exakte Zusammenspiel der drei HandshakeLeitungen NRFD, NDAC und DAVgut beobachten.
Protokollanalysatoren
Wie man an dieser Stelle sieht, kanndie Auswertung einer Messung mitdem Logikanalysator beliebig kompliziert werden. Einige moderneLogikanalysatoren, wie der Zeroplus C16128, bieten als Hilfe beider Interpretation von Signalprotokollen Softwareplugins an, die sogenannten Protokollanalysatoren.Diese können Busprotokolle wiez.B. i2C, RS232, USB, oder auchIEEE488 interpretieren. In derAbbildung kann man die IEEE488Busbefehle wie IFC (Interface Clear), MTA (My Talker Address 0)und so weiter direkt in der Paketund der Diagrammansicht sehen.(jk)
Auswahl eines LogikanalysatorEine umfassende Kaufberatung ist an dieser Stelle ausPlatzgründen nicht möglich. Trotzdem sollen einigeKriterien die Auswahl erleichtern:
Zunächst: LA sind teuer. Wer mit geringem Budgeteinsteigen will, sollte sich nach einem gebrauchten, älteren Komplettgerät umsehen oder den Open Workbench Logic Sniffer ausprobieren. Beim letzterenmuss man aber bereit sein, Aufwand in das Gerät selber zu stecken. Ein Zeroplus LAPC 16032 z.B. ist fürden schnellen Start eventuell besser geeignet, das Gerät ist noch preiswert und verfügt über eine sehr guteSoftware.
Auch früher teure ‚all in one‘ Geräte wie z.B. Tektronix 1230 oder Hewlett Packard HP 1662C werdenmanchmal gut erhalten, zu erträglichen Preisen angeboten. Diese Geräte sind in der Regel den preiswertenneuen Logikanalysator überlegen. Es fehlt allerdingsdie Flexibilität der PC basierten Software.
Bei Geräten, die als Auswerte und Anzeigeeinheiteinen PC nutzen, ist die Software zur Darstellung undAuswertung der Messdaten mindestens so wichtig,wie die Hardware des Logikanalysators. Man solltesich die Software vor dem Kauf ansehen und dieBrauchbarkeit beurteilen, besonders wenn es für dieseSoftware keine Alternative gibt. Es gibt aber guteOpen Source Software für ein breites Spektrum vonLogikanalysatoren (siehe Link). Unter Umständen istdie Liste der dort unterstützten Geräte ein Kaufkriterium.
Die Geräteparameter Kanalanzahl, Speichertiefe undAbtastrate müssen zu Problemstellung passen. Wennhauptsächlich serielle Interfaces überprüft werden sollen, kommt man mit 8 Kanälen aus. Will man an 8BitMikroprozessorschaltungen messen, sind oft schon 16Kanäle zu wenig.
Links
http://www.sigrok.org
Mit einem Protokollanalysator werden die Messergebnisse ausgewertet
Über den Autor
Jürgen Krieg hat 1978 seinenersten Computer gekauft, einenPET 2001. Ein Studium dertechnischen Informatik und dasBasteln an alten 8Bit Gerätenwaren die Folge. Seit 2014 ist erfolgerichtig Mitglied im VzEkC e.V.
4848
Wissen
35 Jahre Apple LISA
Orchideen für Miss Lisa
Die Apple LISA war der erste, in nennens
werten Stückzahlen verfügbare Computer
mit einer grafischen Benutzeroberfläche.
Die LISA erschien im Jahr 1983 also vor 35 Jah
ren. Zeit also für eine kritische Würdigung.
Als die LISA am 19. Januar 1983 vorgestellt wurde,sah die Computerwelt anders aus als heute. GrafischeOberflächen waren weit vom Massenmarkt entfernt.Zwar hatte Xerox Anfang der 1970er Jahre in seinerDenkschmiede Palo Alto Research Center (PARC) mitdem Xerox Alto eine Maschine mit einer grafischenBenutzeroberfläche entwickelt. Davon wurden jedochnur etwa 2.000 Geräte gebaut, die nicht an den öffentlichen Markt verkauft wurden. Das 1981 vorgestellteNachfolgemodell Xerox Star 8010 war erfolgreicher.Er verkaufte sich in den 1980er Jahren etwa 25.000mal zu einem Preis von 17.000 US$. Doch davonwar auf dem Massenmarkt wenig zu sehen. Die normalen Personal Computer und Homecomputer warenzeichenorientiert, sei es eines der Commodore CBMGeräte, der IBM PC oder einer der vielen Homecomputer von Atari 800 über Commodore C64 zum Sinclair Spectrum.
EntwicklungApple Computers, Inc. hatte die Entwicklung der LISAim Jahr 1978 begonnen. Durch eine Kooperation mitXerox erhielt Apple Einblick in die Entwicklungen imXerox PARC. Steve Jobs als damaliger CEO von Applehatte die Entwicklung einer neuen Generation vonComputern mit einer 16Bit CPU beauftragt. Der 1979von Ken Rothmueller (Hardware) und Bill Atkinson(Software) vorgestellte Prototyp fand aber wenig Anklang bei Jobs. Rothmueller verlor dadurch seinen Jobbei Apple. Steve Jobs drängte darauf, die Erkenntnisseaus Xerox PARC in die LISA zu bringen: DieBildschirmdarstellung in Schwarz auf Weiss, die Icons,Fenstertechnik und vor allem die Mausbedienung wurden adaptiert. 1980 übernahm Apple 15 Mitarbeitervon Xerox, um das Projekt voranzubringen. Trotzdemmusste das Projekt immer wieder Fehlschläge verkraften, nicht zuletzt wegen Problemen mit den verwendeten 5¼Zoll Twiggy Drives. Außerdem erwuchs derLISA Konkurrenz aus dem eigenen Hause. Steve Jobs,1981 aus dem LISA Projekt herausgelobt, engagiertesich in dem von Jeff Raskin initiierten McIntoshProjekt. Ein gutes Jahr nach der LISA erblickte dann dasErgebnis dieses Projekts, der Macintosh, das Licht derWelt – doch das ist eine andere Geschichte.
InnenansichtenDie Technik der LISA ist für ein Gerät aus den frühen1980er Jahren durchaus ansehnlich: Es verwendet denMotorola 68000 Prozessor, verfügt über eine MMUund ist mit 5,09 MHz getaktet. Der 16BitDatenbusund der 24BitAdressbus haben Zugriff auf einen serienmäßigen Arbeitsspeicher von 512 kByte, der sich aufeiner austauschbaren Platine befindet. Es sind zweiPlatinen einsteckbar, Apple lieferte auch 1 MB Modelleaus. Modifikationen der CPU/MMUPlatine ermöglichten später auch einen Speicherausbau auf 4 MBoder 8 MB RAM. Als Massenspeicher kamen in der ursprünglichen Lisa zwei 5¼ZollDiskettenlaufwerkemit jeweils 871 kByte Platz zum Einsatz. Über eineparallele Schnittstelle konnte die bereits vom Apple ///bekannte Festplatte Apple ProFile mit 6 oder 10 MBSpeicherplatz angeschlossen werden. Das 1984 vorgestellte Modell LISA 2 ersetzte die 5¼ZollLaufwerkedurch ein 400 kByte 3,5ZollLaufwerk. Dafür bietetdie LISA 2 bereits eine interne 10MBFestplatte. EineApple ProFile ist bei diesem Modell nicht mehr anschließbar. Mit dem Erscheinen des Apple Macintoshwurde die LISA 2 mit einigen Modifikationen einezeitlang als Macintosh XL vermarktet. Der Bildschirmzeigt eine Schwarz/Weiss Darstellung ohne Graustufenmit 720x384 Pixeln. Zum Vergleich: Der IBM PCbrachte es zur gleichen Zeit auf bestenfalls 640x200Pixel.
Apple LISA mit zwei Profile Festplatten
4949
Wissen
Kommerziell ein FlopDer kommerzielle Erfolg der LISA blieb aber aus. Apple hat 150 Mio. US$ in die Entwicklung investiert,aber nur etwa 100.000 Geräte verkaufen können. Dieslag nicht nur am hohen Preis von etwa 10.000 US$, inDeutschland gut und gerne 30.000, DM. Vielmehr warzwar das Bedienkonzept allen am Markt etabliertenComputern überlegen, aber nicht die Anwendungsprogramme selbst. LisaWrite beispielsweise erscheint neben etablierten Textverarbeitungen wie WordStar eherals Gimmick denn als ernst zunehmendes Werkzeug.Außerdem fehlte der LISA damals schlicht der Marktpersönliche Computer waren Anfang der 1980er Jahreimmer noch computeraffinen Anwendern vorbehalten.Diese hatten wenig Probleme, mit Controlcodes undSteuerzeichen auf dem Bildschirm klar zukommen.Dem narrensicher zu bedienenden Rechner fehlten alsoschlicht die Narren, der Anwenderorientierung die"NurAnwender". Mit dem 1984 erschienenen Macintosh merkte Apple das ein zweites Mal. Allerdingsschaffte es der Konzern hier schneller, ein passendesMarktsegment zu definieren: Das Desktop Publishing(DTP). Erst damit begann der wirtschaftliche Erfolgdes Macintosh, wenngleich einige Jahre später als vonSteve Jobs in seiner legendäre MacintoshPräsentation1984 verkündet. Der Erfolg des Mac war gleichzeitigder Niedergang der LISA. 1985 wurde die LISA abgekündigt, 1989 verschrottete der Konzern die letztenLagerbestände von 2.700 Geräten irgendwo auf einerMüllkippe in Utah.
PionierleistungTrotz dieses Misserfolgs verdient die LISA als erste,für eine breite Anwenderschar verfügbare Inkarnationeines neuen Bedienkonzepts heute große Achtung.Heute sind grafische Benutzeroberflächen auf beinaheallen Computern zu finden und wurden auch auf vieleklassische Computersysteme portiert. Es lohnt sich daher, einen Blick auf das LISA Office System (LISAOS) zu werden. Hier zeigen sich Elemente heutigergrafischer Oberflächen schließlich noch beinahe in ihrer Urform. Übrigens war mit dem Erscheinen desMacintosh auf der LISA 2 mittels MacWorksXL auchder Einsatz der Macintosh System Software (Finder)möglich. Genügend RAM vorausgesetzt, kann eine LISA 2 so maximal System 7.5.5 nutzen. Apple hat Ende2017 angekündigt, in 2018 den Quellcode von LISAOS freizugeben.
Reise durch die OberflächeFür Einblicke in LISA OS benötigt man nicht unbedingt ein eigenes System vielmehr steht mit dem LisaEmulator Project von Ray Arachelian ein leistungsfähiger und liebevoll gestalteter Emulator zur Verfügung.LisaEm ist für Macintosh unter MacOS X (Intel und
PowerPC), für Windows 32Bit Systeme und für denRaspberry Pi als Binärpaket verfügbar. Als Toolkit fürdie Oberflächengestaltung wird WxWindows benutzt.So ist eine Zeitreise möglich und man kann die GUI derLISA live erleben.
Die Oberfläche der LISA lässt sich nach den persönlichen Bedürfnissen einstellen. Sie bietet auch einigeGadgets wie einen Taschenrechner und eine Uhr.
Ein Blick auf den LISA OS Desktop
Die Arbeit mit der LISA ist dokumentenzentriert. Dernormale Arbeitsablauf besteht nicht darin, ein Programm zu öffnen, Inhalte zu erzeugen, dann einen Dateinamen zu vergeben und zu speichern. Vielmehrerzeugt der Benutzer durch einen Doppelklick auf eine"Paper" Datei eine neue Datei eines bestimmten Typs.Ein Doppelklick auf die Datei startet das dazugehörigeProgramm und öffnet die Datei. Zur Installation neuerProgramme genügt es, irgendwo auf der Festplatteeinen Platz zur Ablage auszusuchen. Die "Paper" Dateiist immer mit dem dazugehörigen Programm verbunden. Die Verbindung bleibt auch beim Verschiebender Programmdateien an andere Orte erhalten.
Ein Paper vom Stapel nehmen
Dieses Konzept ist übrigens in der WorkplaceShell vonOS/2 ebenfalls umgesetzt. Heutigen Oberflächen fehlt
5050
dieser Mechanismus. LISA OS unterstützt zudem eineinfaches Multitasking. Es lassen sich mehrere Programme nebeneinander öffnen und benutzen. Dies giltfür alle Anwendungen und nicht nur für Desktop Gadgets, wie dies beim Macintosh bis zum MultiFinder inSystem 6 der Fall war. Hier war also LISA OS demMacintosh um einige Jahre voraus.
Anwendungen wie die Textverarbeitung LisaWritesind aus heutiger Sicht spartanisch und konnten auch1983 nicht mit Textverarbeitungen wie WordStar oderauch AppleWorks auf dem Apple //e mithalten. DieBedienung mit Maus, Pulldown Menüs und einemWYSIWYG Konzept waren aber für die Masse derAnwender völlig neu.
Die Textverarbeitung LisaWrite
Jede LISA besitzt eine Seriennummer im ROM, dievon LISA OS ausgelesen werden kann. Beim Kopierenvon Programmen von den OriginalProgrammdisketten auf eine Festplatte der LISA werden die Diskettenmit dieser Seriennummer markiert. Dadurch lassensich einmal benutzte Disketten nicht mehr auf eineranderen LISA benutzen– ein einfacher Kopierschutz.
Dateien erhalten einen Kopierschutz
Die LISA taugt auch durchaus als serielles Terminalund damit als Anbindung an Mainframes oder Minicomputer der 1980er Jahre. Durch die Terminalemulation von MacTerminal wird die LISA zum wohl
teuersten Weg, seriell auf einen solchen Rechner zuzugreifen.
Wer also einmal an den den Ursprung grafischer Benutzeroberflächen zurückkehren möchte, kann mit dem LisaEm viele interessante Stunden erleben. Einige LISAssind auch öffentlich zu bewundern, so im OldenburgerComputermuseum oder im Heinz Nixdorf Forum Paderborn. Und wer weiß vielleicht wird auch auf derClassic Computing eine LISA zu sehen sein.
Die LISA Terminalemulation
Der Titel dieses kleinen Berichts ist übrigens eine Anspielung auf den Artikel "No Orchids for Miss Lisa"von Ulrich Stiehl im "Peeker" Heft 07/1985. Dort spekuliert der Autor über die Gründe der mangelnden Akzeptanz der LISA und kehrt die Vorteile des Apple IIhervor. Allerdings wird das Potenzial des neuen Bedienkonzeptes nicht erkannt.
Heute ist die GUI nicht mehr wegzudenken. Die LISAwar der Wegbereiter dieser Technik. Wer also dieGelegenheit hat, eine LISA live zu erleben, sollte sienutzen. (gb)
Links:
http://lisa.sunder.net
https://de.wikipedia.org/wiki/Apple_Lisa
http://blog.hnf.de/applelisaausdertiefegeholt
Wissen
5151
Wissen
Werbeanzeige für die Lisa
Das Innenleben der LISA ist modular aufgebaut. Links ist derBlick in das geöffnete Gehäusezu sehen. Nach Lösen der Befestigungen lässt sich der Träger mitdem CPU Board, dem SchnittstellenBoard und den beidenSpeichermodulen einfach herausziehen (Bild unten). Rechtsauf der hinteren Platine ist derMotorola 68000 Prozessor zu sehen.
5252
CPU Simulation
Little Man Computer
Moderne Prozessoren arbeiten mit sehr
komplexen Instruktionen, parallelisieren
die Abarbeitung von Programmen, füh
ren Befehle spekulativ durch und kennen viele Me
chanismen zur Unterstützung von Multitasking und
virtueller Speicherverwaltung. Einfach zu verste
hen sind sie gewiss nicht. Wer einmal nachvollzie
hen möchte, wie ein Prozessor arbeitet, kann dies
besser mit einer vereinfachten Simulation tun.
Eine solche Simulation ist der "Little Man Computer"LMC. LMC ist eine abstrakte, stark vereinfachendeSimulation der Grundzüge eines Computers. Er sollauch Laien ermöglichen, die Arbeitsweise eines Computers nachzuvollziehen. LMC wurde im Jahr 1965von Stuart Madnick entwickelt.
Es existieren verschiedene Implementierungen desLMC. Einige sind online zu benutzen, andere könnenals JavaProgramme auf dem eigenen Rechner ablaufen. Unten sind ein paar Links zum Download vonLMC Programmen angegeben, weitere lassen sichsicher schnell mit der Suchmaschine des Vertrauensentdecken.
Was macht den LMC nun so interessant? Zunächst–der LMC besitzt nur sehr eingeschränkte Ressourcen.Der Arbeitsspeicher verfügt nur über 100 Speicherstellen (00 – 99). Ähnlich reduziert ist der Befelsumfang:Der LMC kennt nur 11 Befehle.
Dennoch lässt sich damit eine ganze Menge anfangen.Zusammen mit Sprungmarken (Labeln) sieht eineinfaches Assemblerlisting und übersetztes Programm
in einem Javescript Simulator dann so aus wie im Bildunten. Eine sehr schöne Simulation ist auch dies vonTim Street (siehe Links). Dort ist auch ein LMC Programm verfügbar, das zwei Zahlen addieren, subtrahieren, und dividieren kann, die Wurzel einer Zahl ziehenund weitere Operationen ausführen kann! Aufgrund derEinfachheit lassen sich Simulatoren leicht in C oder anderen Sprachen erstellen. (ps)
Links
https://peterhigginson.co.uk/LMC
http://superdecade.blogspot.co.uk/2016/10/themostimpressivelittlemancomputer.html
http://www.d.umn.edu/~gshute/cs3011/LMC.html
Befehlssatz des LMC
Wissen
5353
Software
Zum Abtippen
Apple ZahlenmemoryDas Programm "Zahlenmemory" ist ein kleines Spiel,das dem Prinzip von "Senso" nachempfunden ist: Einezufällige Ziffer wird angezeigt und dazu wird ein kurzer Ton gespielt, wobei die Tonhöhe von der angezeigten Zahl abhängt. Danach wird der Bildschirm gelöschtund man muss die angezeigte Zahl eingeben. Nun zeigtder Computer zwei Zahlen: Die erste Ziffer ist gleich,die zweite ist neu. Jetzt muss der Spieler diese zweiZahlen eingeben. So geht es weiter, bis der Spielereinen Fehler macht. In diesem Fall zeigt der Computerdie korrekte Folge an und das Spiel startet neu.
Die Umsetzung für den Apple ][ hat eine Besonderheit:Applesoft BASIC kennt keinen Befehl, um Töne auszugeben, sondern kann nur einen "Beep" erzeugen. Umdie Töne an die verschiedenen Ziffern anzupassen,nutzt das Programm eine kleine Routine in Maschinensprache. Die Routine wird von BASIC aus inden Speicher des Apple an Adresse 768 (oder in Hex$300) geschrieben, ein Speicherbereich, der vom BASIC nicht verwendet wird.
ProgrammdetailsZeile 15: Hier wird ein Array mit 50 Positionen definiert, in welchem die Zahlenfolge gespeichert wird.
Zeile 20: Schreibt das Maschinenspracheprogramm inden Speicher
Zeile 3060: Es wird eine Zahl zufällig erzeugt und indas Array geschrieben und dann zur Ausgabe gesprungen.
Zeilen 65150: Prüfung, ob die Zahl richtig war: Wennja, wird die nächste Zahl erzeugt, wenn nein, startet dasProgramm neu.
Zeile 500580: Hier erfolgt die Ausgabe der Zahlenreihe mit Tönen. Dazu wird der Wert MEM(H) umgerechnet und in die Speicherstelle 774 (Hex: $306)geschrieben.
Die AssemblerRoutineDie wichtigste Zeile beginnt bei $302: hier wird eineinzelnes Knacken im Lautsprecher des Apple erzeugt.Die Zeilen darum herum sind zwei ineinander verschachtelte Schleifen. Die Schleife des YRegisterssorgt dafür, das der Ton lange zu hören ist, die XSchleife bestimmt die Tonhöhe. Und hier kommt dieSpeicherstelle $306 ins Spiel. Sie enthält den Startwertfür die XSchleife. (je)
10 REM ZAHLENMEMORY
15 DIM MEM(50)
20 GOSUB 900
25 I=0
30 Z=INT ( RND (1) * 9 )
40 I=I+1
50 MEM(I)=Z
60 GOSUB 500: REM AUSGABE
65 FOR H=1 TO I
70 GET A
74 POKE 774,20 + MEM(H) * 10
76 CALL 768
80 IF A=MEM (H) THEN GOTO 130
86 PRINT A;">";
90 PRINT "FALSCH!"
100 PRINT "DIE KORREKTE FOLGE IST:"
105 FOR H = 1 TO I
110 PRINT MEM(H);" ";
113 NEXT
115 INPUT A$
120 RUN
130 PRINT A;" ";
140 NEXT
150 GOTO 30
500 REM AUSGABE
505 HOME
510 FOR H = 1 TO I
520 PRINT MEM(H);" ";
522 POKE 774,20 + MEM(H) *10
524 CALL 768
530 NEXT
540 PRINT
550 FOR H = 1 TO 1000
560 NEXT
570 HOME
580 RETURN
900 FOR I=768 TO 781
910 READ CODE
920 POKE I,CODE
930 NEXT
940 RETURN
1000 DATA
160,0,173,48,192,162,32,232,208,253,200,16,24
5,96
Assemblerlisting (nicht abtippen, Hexdump ist
in Zeile 1000)
0300 A0 00 LDY #$00
0302 AD 30 C0 LDA $C030
0305 A2 28 LDX #$28
0307 E8 INX
0308 D0 FD BNE $0307
030A C8 INY
030B 10 F5 BPL $0302
030D 60 RTS
Über den Autor
Jochen Emmes ist DiplomPhysiker und seit 1995hauptberuflich als Anwendungsentwickler undSystemadministrator angestellt.
5454
Kurz vorgestellt
Mein liebstes Sammlerstück
Kleine Rechenhilfen
Taschenrechner gibt es schon seit Ende der
1960er Jahre und haben sich seit dem sehr
schnell verbreitet. Im Bereich der klassi
schen Computer gibt es für diese Geräte einen
großen Liebhaberkreis.
Sehr bekannt wurden in den 70er Jahren die programmierbaren Taschenrechner von HP und Texas Instruments. Solche Rechner konnten schon kleineProgramme auf Magnetstreifen oder Microcassettenspeichern.
Funktionen, die heutzutage bei einen Taschenrechnerder Standard sind, sucht man auf den Modellen derfrühen Jahre meist vergeblich. Damals gab es oft nurdie vier Grundrechenarten die Dinger wurden in denUSA immer „fourbanger“ genannt. Aber gerade dasmacht diese Geräte interessant. Da der Übergang vomTaschenrechner zum PocketComputer fließend ist, istauch die Vielfalt riesig. Für Sammler solcher Rechnergibt es eine sehr große Auswahl an Herstellern undModellen. Besonders gut gefallen mir persönlich dieTaschenrechner mit Digitron Displays (Vakuum Fluoreszenzanzeige).
Besonders erfreulich ist es, wenn bei dem alten Taschenrechner noch die Anleitung und eventuell dasoriginal Etui dabei ist. Zudem macht es auch Spaß, mitden Geräten zu rechnen. Es muss ja nicht immer das
Smartphone sein, das man für schnelle Berechnungennutzt. Wer mehr über Taschenrechner und Rechenmaschinen wissen möchte, der kann sich auf der Seite vonFritz Gallwitz umfangreich über Hersteller, Modelleund Technik informieren. (bb)
Links
http://www.schlepptops.de
SHARP Rechner aus der ELReihe aus der ELReiheder 1980er Jahre.
TriumphAdler mit DigitronDisplay
Tandy Radio ShackRechner
Olympia CD76S
Über den Autor
Björn Benner ist 1. stv. Vorsitzender desVzEkC e.V. und begeisterter Sammler.
5555
CP/M Quick Reference Card
Allgemeines zu CP/M
Diskettenwechsel
Nach jedem Diskettenwechsel ist mit CtrlC einWarmstart erforderlich. Ohne Warmstart ist dieDiskette schreibgeschützt.
Residente CP/M Befehle
DIR
Inhaltsverzeichnis einer Diskette ausgeben.Beispiele:
Alle Inhalte von Laufwerk A:
DIR A:
Alle COM Files auf Laufwerk A:
DIR A:*.COM
ERA
Löscht die angegebene Datei. Beispiele:
Alle Dateien auf A: löschen:
ERA A:*.*
Dateien A.TXT und B.TXT löschen:
ERA A.TXT B.TXT
REN
Umbenennen einer Datei. Beispiel:
FOO.COM in BAR.COM umbenennen:
REN B:FOO.COM = B:BAR.COM
TYPE
Inhalt eine ASCII Datei ausgeben. Beispiel:
Datei BOB.TXT ausgeben:
TYPE BOB.TXT
SAVE
Speichert den Inhalt des Arbeitsspeichers in einerDatei ab. Beispiel:
5 Blöcke mit je 256 Byte ab Adresse 0x100 in derDatei DUMP.DAT speichern:
SAVE 5 DUMP.DAT
Die Anzahl ist als Dezimalzahl anzugeben.
STAT
Überprüfung oder Veränderung vonSystemeigenschaften. Beispiele:
freien Speicherplatz und Schreibzustand der Diskin Laufwerk B:
STAT B:
Übersicht der Benutzerbereiche:
STAT USR:
Zuordnung der logischen Kanäle zu Geräten aus:
STAT DEV:
Einen logischen Kanal mit einem Gerät verbinden:
STAT kanal: = gerät
Kanäle sind
CON: Konsole (also Tastatur und
Bildschirm)
LST: Drucker
PUN: Lochstreifenstanzer
RDR: Lochstreifenleser)
Erlaubte Geräte sind
CON: => TTY: CRT: BAT: UC1:
LST: => TTY: CRT: LPT: UL1:
PUN: => TTY: PTP: UP1: UP2:
RDR: => TTY: PTR: UR1: UR2
Speicherplatz, Sektoren usw. der Laufwerkeanzeigen:
STAT DSK:
Größe der Dateien FOO.TXT und BAR.TXTanzeigen:
STAT FOO.TXT BAR.TXT
Datei FOO.TXT schreibschützen:
STAT FOO.TXT $R/O
Schreibschutz von Datei FOO.TXT aufheben:
STAT FOO.TXT $R/W
Datei ALICE.COM als Systemdatei verstecken:
STAT ALICE.COM $SYS
Systemdatei ALICE.COM wieder sichtbarmachen:
STAT ALICE.COM
PIP
PIP steht für Peripheral Interchange Program.Es dient zum Kopieren und Drucken. PIP ohneParameter eröffnet einen Prompt, an demAktionen direkt und nacheinander aufgerufenwerden können.
Kopieren aller Dateien von Laufwerk A: aufLaufwerk B:
PIP B: = A:
Alle COM Dateien von B: nach A: kopieren:
PIP A: = B:*.COM
Datei FOO.TXT auf dem logischen Kanal LST:ausgeben:
PIP LST: = FOO.TXT
(noch PIP)
Liste weiterer Optionen für PIP, jeweils amEnde des Aufrufs, z.B. PIP LST: = FOO.TXT[N2]
[B] Block mode transfermit XON/XOFF
5656
[E] Echo, alle gelesenen Zeichen auf demBildschirm ausgeben (nur für ASCIIDateiensinnvoll)
[H] Hex Modus
[N] Zeilennummerierung.
[N2]dto. mit führenden Nullen und TAB.
[O] Object file transfer, CtrlZ (Dateiende) wirdignoriert
[Pn] Seitenvorschub nach n Zeilen
[R] Systemdateien lesen
[V] Verify, Kopie wird auf korrekteÜbertragung geprüft (nur Disk)
[W] Read only einer Datei ignorieren
SUBMIT
Stapeldateien verarbeiten, ein Kommando proZeile. Extension muss .SUB sein, z.B. BOB.SUB
SUBMIT BOB.SUB
Kommentarzeilen beginnen mit einem Zeichen«».,: — ?*[]
Aufrufparameter beginnen mit Dollarzeichen undsind nummeriert, also $1 $2 usw.
Variable = $1..
Fehlermeldungen
Die ausführbare Datei ALICE.COM wurde nichtgefunden:
ALICE?
Eine angebene Datei ist nicht vorhanden:
NO FILE
Ein beim Kopieren angebener Zielname ist schonvorhanden:
FILE EXISTS
Die Diskette ist voll:
NO SPACE
Im Laufwerk A: liegt keine Diskette oder dasLaufwerk existiert nicht:
Bdos Err on A:
Die Zieldatei in Laufwerk A: ist schreibgeschützt:
Bdos Err on A: FILE R/O
Die Diskette in Laufwerk B: ist defekt:
Bdos Err on B: BAD SECTOR
Die Diskette in Laufwerk B: ist schreibgeschütztoder der Warmstart mit CtrlC beimDiskettenwechsel wurde vergessen:
Bdos Err on B: R/O
ED
Texteditor, Aufruf z.B. mit ED FOO.TXT.
Kommandos:
E ED beenden und speichern
O ED abbrechen, mit Originaldatei weiter
Q ED verlassen, ohne zu speichern
I Text einfügen, Ende mit CtrlZ
Is String s am Pointer einfügen
H Editieren beenden und Pointer anDateianfang
nA n Zeilen an den Buffer anhängen
nW Schreibe die obersten n Zeilen in dieAusgabedatei
nX Schreibe die nächsten N Zeilen in eine DateiX$$$$$$$.LIB
Rfn Datei fn.LIB in Buffer einlesen
B Pointer an Dateianfang
B Pointer an Dateiende
nC Pointer n Zeichen voran
nL Verschiebe Pointer um n Zeilen
n n Zeilen voran
– eine Zeile zurück
nP nächste n Seiten anzeichen (23Zeilen/Seite)
nD n Zeichen ab Pointer löschen
nK Lösche n Zeilen ab Pointer
nFs finde das n. Auftreten des Strings s
nSx^Zy Ersetze den String x durch y an dennächsten n Fundstellen
nT Gebe n Zeilen aus
U Tausche Klein gegen Grußbuchstaben beinächster Eingabe
V Zeilennummern erzeugen
nMxFühre Kommandostring n nmal aus
n:x n Zeilen vor und Kommando x ausführen
n::mx Zu Zeile n springen undKommando x von aktueller Zeile bis Zeile mausführen
Seite heraustrennen, Zick/Zack falten und
neben den CP/M Rechner legen
5757
Vereinsleben
Liebe Leser des LOAD Magazins,
liebe Vereinsmitglieder des VzEkC e.V.
Ein Ehrenamt ist eine Aufgabe, die der Gemeins
chaft und Gesellschaft zugute kommt und freiwi
llig
übernommen wird. DieseAufgabe wird in der Fre
izeit unentgeltlich und über einen längeren Zeitra
um
wahrgenommen. Viele Menschen üben ihre ehren
amtliche Tätgkeit in gemeinnützigen Vereinen au
s.
Mittlerweile ist jeder dritte Bundesbürger Mitglie
d in einem eingetragenenVerein. Im Jahr 2017 wa
ren
fast 15 Mio. Menschenin Deutschland mehr al
s nur Mitglieder, sondern haben ehrenamtlich
eine
Funktion ausgeübt und unzählige Stunden an frei
williger Arbeit erbracht.Das zeigt, wieviel Bedeu
tung
in Deutschland das ehrenamtliche Engagement
für die Gesellschaft besitzt. Ehrenämter verge
ben
Sportvereine, soziale Einrichtungen, kirchliche Or
ganisationen und eben auch kleine, besondere The
men
vertretende Vereine wie unserer eingetragener Vere
in, der Verein zum Erhaltklassischer Computer e.V
.
Ehrenamtliche Tätigkeitlebt vom Engagement einzelner M
enschen, die aus einemstarken Interesse
heraus handeln. Diese Arbeit ist freiwillig sie w
ird nicht bezahlt und wird neben dem Beruf und
den
familiären Verpflichtungen erbracht. Sie kann nic
ht eingefordert werden.Sie bemisst ihren Wert n
icht
nicht wie eine gekaufte Dienstleistung in erster Lin
ie am Ergebnis, sondernam Tun an sich. Gerade
das
macht sie besonders wertvoll und besonders hierfü
r verdient sie Dank und Anerkennung.
Daher ist es an dieser Stelle an der Zeit, einmal
allen Vereinsmitgliedernzu danken, die in so vie
len
freiwilligen Stunden im vergangenen Jahr für unse
ren Verein tätig waren. Wir haben im Jahr 2017 vi
ele
Veranstaltungen durchgeführt, um unseren Verein u
nd unser Hobby der Öffentlichkeit vorzustellen un
d es
gemeinsam auszuüben. Ich denke hier an Tradition
sveranstaltungen wie dasWaiblinger Usertreffen, d
as
2017 zum 13. Mal stattfand, aber auch an junge Treffen wi
e die Treffen im Kölner Raum (Brühl), in
Wolfsburg, in Hannover,in Augsburg und viele w
eitere. Auch die Präsenzauf Messen darf hier nic
ht
vergessen werden – sowohl auf der Stuttgarter M
esse "Modell + Technik"als auch auf der Gamesc
om
waren wir vertreten. Und natürlich darf unser jä
hrliches, großes Vereinstreffen und der ursprüngl
iche
Grund zur Vereinsgründung nicht unerwähnt bleib
en: Die "Classic Computing", die 2017 zusammen
mit
dem Vintage Computer Festival Berlin stattfand. H
ier haben die Vereinsmitglieder nicht nur wertvo
lle
Beiträge zu einer kuratierten Ausstellung geliefer
t und über 2.000 Besuchern interessante Projekte
im
RetrocomputingBereichvorgestellt. Auch bei d
er Logistik der Gesamtveranstaltung haben uns
ere
Mitglieder tatkräftig geholfen. Möglich wird das
durch die hohe Kompetenz unserer Mitglieder –
ich
denke da insbesonderean unsere ausgebildeten Elektromeister, die jede
s Jahr für eine sichere
Stromversorgung der Exponate auf der Classic Com
puting sorgen.
Aber nicht nur die Veranstaltungen allein mache
n unsere Aktivität aus. Vielmehr sind wir durch
das
Forum ( https://forum.classiccomputing.org ) und
unsere Webseite ( http://www.classiccomputing.de
)
ständig präsent und aus aller Welt erreichbar. Viel Zeit verbringe
n unsere Mitglieder hiermit
Diskussionen und gebenHilfestellungen zu allen m
öglichen Themen rund umklassische Computer. Auc
h
hierfür sei ausdrücklichgedankt. Und auch die t
echnische Pflege dieserPräsenz kostet viel Zeit
, die
ebenfalls ehrenamtlich erbracht wird. Und zu gu
ter Letzt: Das Heft, dasSie hier in Händen halte
n, ist
selbst das Ergebnis vielerStunden freiwilliger Arbe
it.
Für das laufende Jahr und die kommenden Jahre
werden die Aufgaben nicht weniger und ich bin m
ir
sicher, dass auch weiterhin viele engangierte Mitglie
der diesen Verein tragenwerden. Ich freue mich
darauf, dies miterlebenzu können, auch wenn
dann ein Anderer als Vorsitzender die Geschicke
des
Vereins lenken wird.
Ihr Roman Seewer
(1. Vorsitzender VzEkC e.V.)
Einmal Danke sagen...
5858
Vereinsleben
Classic Computing in der Heide
Das Computermuseum Visselhövede
Um in einem Eindruck von
der Vielfalt der Compu
terwelt zu bekommen,
muss man nicht nach München
oder Paderborn reisen. Compu
termuseen finden sich auch in
anderen Städten– und manchmal
auch an Orten, an denen man es
nicht vermuten würde.
Die Lüneburger Heide ist eineLandschaft im Norden Deutschlands, die vor Jahrtausenden durchRodung und Bewirtschaftung entstanden ist. Sie zieht sich aus demDreieck der Autobahnen A1, A7und A27 in Richtung Osten bis zurStadt Lüneburg südwestlich vonHamburg. Die Lüneburger Heideist als Freizeit und Urlaubsparadies bekannt. Wer nun meint, hiergäbe es nur Schafe und DieterBohlen und für Freunde klassischerComputer nichts zu entdecken, derirrt sich. Am Westrand dieses Gebiets liegt der Ort Visselhövede.
Ein Abstecher dahin lohnt sich, dennin der ehemaligen Zündholzfabrikfindet sich ein beeindruckendesComputermuseum.
Der seit 2012 bestehende Verein"Forum für ComputerGeschichte"mit Sitz in Rothenburg betreibt dieses Museum seit 2013. Ziel des Vereins ist es, durch Unterhaltung einesMuseums und Ausstellungen dieWissenschaft und Forschung, Bildung und Erziehung sowie Kunstund Kultur zu fördern. Hierzu habendie Mitglieder eine große Sammlungan Homecomputern, mittlererDatentechnik und Großrechnern zusammengetragen. Anders als in anderen Museen liegt der Schwerpunktdieser Sammlung auf Systemen ausdem Rechenzentrumseinsatz.
Das Rechenzentrum
Um diese in einem passenden Rahmen präsentieren zu können, wurdeein Raum als Rechenzentrum eingerichtet. Hinter dem Leitstand sind
betriebsbereite Systeme aufgebaut. Auf der linken Seite findensich viele HPUX Maschinen,rechts davon stehen Unisys eActionServer in den Racks, außerdem HP XP256, Solbourne, IBMRS6000, SGI Challenge XL undSUN Sparc Server 490.
In einem weiteren Raum ist eineIBM AS/400 Anlage aufgebaut.Das Gerät diente bei seinem Vorbesitzer lange Zeit als Anschauungsobjekt. Nach der Übernahmedieses System durch den Vereinstellte sich zunächst heraus, dasseine Festplatte ausgefallen warund der Rechner nicht mehr bootet. Im Frühjahr 2016 gelang danneine erste „Inbetriebnahme“durch einen AS/400 Experten. Daes sich bei diesen Maschinen um
5959
Vereinsleben
Produktionsmittel handelt, sind Betrieb und Wartung streng hierarchisch organisiert und unterliegenstrikten Lizenzbestimmungen. Daserleichtert die Wiederherstellungeines solchen Objektes nicht. Mittlerweile läuft die Maschine wiederund kann im Betrieb bewundertwerden. Ausdrucke sind mit einemTwinaxDrucker vom Typ IBM4224 möglich. Die Datensicherungder AS/400 erfolgt mittels einigerSLR5 Tapes mit einem Streamer.
Ebenfalls vertreten sind mehrereDEC Systeme wie VAXStationsund Microvax Rechner.
Homecomputer und mehr
In weiteren Räumen präsentiert dasMuseum verschiedene Homecomputer wie Commodore C64 undAmiga, AtariSysteme und AppleIIModelle, aber auch weniger bekannte Modelle wie Rechner vonTriumpf Adler. Viele Rechner sindeinsatzbereit und können "handson" benutzt werden.
Die Ausstellung macht in der 8BitArä aber nicht halt. In anderenRäumen sind viele IBM PCSysteme und Kompatible zu sehen. Hier
kann man insbesondere verschiedeneCompaqModelle bewundern. AuchApple MacintoshSysteme sind zusehen, angefangen von den erstenWürfelMacs über PerformaModellebis hin zu iMacs aus verschiedenenGenerationen.
Besonders beeindruckend ist eineRegalwand im Eingangsbereich,zeigt sie doch auf Laptops undNotebooks unterschiedlichsterHersteller die geschichtliche Entwicklung von Microsoft Windowsvon den frühen Versionen bisheute.
Besucher sind willkommen
Der Verein richtet die Räume zurZeit noch ein. Bei den Exponatenstehen noch viele Restaurationenan. Aus diesem Grunde könnennoch keine festen Öffnungszeitenangeboten werden. Aber die Mitglieder treffen sich jeden Samstag im Museum ab 14:00 Uhr imMuseum Visselhövede, CellerStraße 1. Sie lassen gern Besucherüber die Schulter schauen.
Links
www.computermuseumvisselhoevede.de
Ein Blick in das Rechenzentrum. Das Sillicon Graphics Modell hatlange im Deutschen Elekronensynchrotron in Hamburg bei der Suchenach Elementarteilchen geholfen.
Laptops zeigen die Geschichte der PC Betriebssysteme
6060
Service
Der Verein über sich
Vereinsmeierei ist ja nicht so jedermanns Sache.Aber der Verein zum Erhalt klassischer Computerhebt sich auch hier ganz positiv von der Masse ab –und beimAufgabengebiet ja sowieso.
Wir vereinen im VzEkC e.V. viele Hunderte klassische ComputerSysteme. Darunter die allseits bekannten Homecomputer der 80er, wie denCommodore C64, den Atari 800 XL oder denSchneider CPC. Aber auch ausgefallenere Modellesind bei uns zu finden – und nicht nur Homecomputer.
Bürorechner aller möglicher Hersteller, ausgeklügelte Konzepte für tragbare Rechner und natürlichfür die Kurzweiligkeit auch die Spielekonsolen der70er, 80er und 90er finden bei uns ein Zuhause.
Der Verein wurde übrigens schon 2003 gegründetund ist seit 2007 als gemeinnützig eingetragen. DieMitgliedschaft im Verein ist ziemlich günstig.Schon einmal deshalb, weil wir keine Aufnahmegebühr für Neumitglieder verlangen.
Für gerade einmal 3 Euro im Monat kann man ordentliches Vereinsmitglied sein und hat dann vieleVorteile. So kann man bei der ClassicComputingVeranstaltung kostenfrei teilnehmen, erhält vergünstigten Eintritt auf einigen Messen und Ausstellungen, hat erweitere Zugriffsrechte imVereinsforum, kann an der vereinsinternen Auktionfür Hardware teilnehmen und vieles mehr.
Auf ins Forum!
Im Vereinsforum diskutieren wir über dies und das,helfen bei RechnerProblemen und haben eine guteZeit!
Die aktuelle Vereinssatzung findet man direkt aufunserer Homepage unter
http://www.classiccomputing.de/derverein/
Und den Aufnahmeantrag findest du auf der nächsten Seite. Wir freuen uns auf dich!
6161
Aufnahmeantragzur Mitgliedschaft im Verein zum Erhalt klassischer Computer e.V.
Persönliche AngabenBitte ankreuzen, welche Daten im geschützten Vereinsbereich anderen Vereinsmitgliedern angezeigt werden dürfen.
Nachname __________________________________________________________Vorname __________________________________________________________Straße, Nr. __________________________________________________________PLZ, Ort __________________________________________________________Telefon Festnetz __________________________________________________________Telefon Mobil __________________________________________________________Geburtsdatum ____ . ____ . ________Emailadresse __________________________________________________________Bild
Nickname im Vereinsforum __________________________________________________________Lieblingscomputer __________________________________________________________
Ich möchte Mitglied im Verein zum Erhalt klassischer Computer e.V. werden
Als ordentliches Mitglied (Beitragssatz 3, € pro Monat)Als ordentliches Mitglied mit reduziertem Beitragssatz (Beitragssatz 2, € pro Monat)Schüler(in), Student(in, Auszubildene(r), Behinderte(r), Rentner(in), Kopie des entsprechenden Nachweises liegt bei
Als Fördermitglied zum Beitragssatz von _____ € pro Monat(ohne Stimmrecht in der Mitgliederversammlung) (Beitragssatz ab 1, € pro Mnat, nur ganze Zahlen)
Die Satzung des Vereins habe ich gelesen und anerkannt.
Der Mitgliedsbeitrag wird per Lastschrift jährlich am 01. Mai von meinem Konto abgebucht. Fällt dieser nicht aufeinen Bankarbeitstag, erfolgt der Einzug am unmittelbar darauf folgenden Bankarbeitstag. Kosten, die dem Vereindurch Rücklastschriften entstehen, ersetze ich in vollem Umfang.Unsere GläubigerID lautet DE26ZZZ00000029862. Die Mandatsreferenznummer ist die neueVereinsmitgliedsnummer und kann im Benutzerprofil im Forum nachgesehen werden.
IBAN ____________________________________________________________________BIC ____________________________________________________________________Kontoinhaber ____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________Ort, Datum, Unterschrift (Bei Minderjährigen Unterschrift eines Erziehungsberechtigten)
Service
Verein zum Erhalt klassischer Computer e.V.
c/o Roman Seewer (1. Vorsitzender)Achslenstrasse 39016 St. Gallen (Schweiz)
info@classiccomputing.deFax: +41 (0) 71 280 00 18
6262
Impressum
Herausgeber
Verein zum Erhalt klassischer Computer e.V.c/o Roman Seewer (1. Vorsitzender)Achslenstrasse 3CH9016 St. GallenTelefon: +41 712801251
ISSN für die Printausgabe: 21943567ISSN für die PDFAusgabe: 21943575
Redaktionsleitung
Georg Basse (V.i.S.d.P.)Telefon: +49 5723 9865 700redaktion@loadmagazin.de
Redaktion
Georg Basse, Peter Sieg
Autoren dieser Ausgabe
Georg Basse (gb), Björn Benner (bb), Christian Dirks (cd), Helmut Haake(hh), Jochen Emmes (je), Roman Seewer (rs), Peter Sieg (ps), Herwig Solf(hs), Jonas (js), Marcus Nothelfer (mn), Jürgen Krieg (jk)
CoverFoto
Georg Basse
Grafik | Gestaltung | Druck
Gestaltung:Verein zum Erhalt klassischer Computer e.V.Druck: Flyeralarm.de, 1.Auflage 2018 (1.000) [1509]
Wichtige Hinweise
Wir freuen uns über eingesandte Beiträge, behalten uns aber Veröffentlichungen, Kürzungen und Änderungen vor. Für unverlangt eingesandtesBild und Textmaterial können wir keine Haftung übernehmen. Namentlichgekennzeichnete Artikel geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktionwieder. Die Beiträge der namentlich genannten Autoren und der Redaktionstehen nach Veröffentlichung im Heft unter einer CreativeCommonsLizenz(CCBYNCSA) und dürfen für nichtkommerzielle Zwecke und unter Namensnennung des Autors verwendet und für abgeleitete Werke unter dergleichen Lizenz benutzt werden. Autoren können ihre Artikel bis zumRedaktionsschluss zurückziehen, wodurch alle Rechte an den Autorzurückfallen. Nach Redaktionsschluss ist dies nicht mehr mögich. Autorenakzeptieren mit ihrer Einsendung diese ehrenhaften Bedingungen. Logos,Warenzeichen und Produktabbildungen werden redaktionell ohne Nennung des Eigentümers benutzt. Das Fehlen einer Kennzeichnung impliziertnicht die freie Verwendbarkeit dieser Elemente. Trotz sorgfältiger Prüfungist es uns nicht gelungen, alle Rechteinhaber zweifelsfrei zu identifizierenund anzuschreiben. Bitte wenden Sie sich gegebenenfalls an die Redaktion.
Preis
Das Magazin LOAD wird in gedruckter und elektronischer Formgrundsätzlich kostenlos abgegeben. Um einem Mißbrauch der gedrucktenAuflage vorzubeugen, kann die ausgebende Stelle eine Schutzgebühr inHöhe von 3, EUR erheben.
Vorschau
Nach der LOAD istvor der LOAD —Das bringt LOAD#5
Titelthema EmulationNicht alle historisch interessanten klassischen Computer sind noch verfügbar. Gerade frühe Systemesind auf dem Gebrauchtmarkt nur noch für hohePreise erhältlich. Einige Systeme sind sogar völligverschwunden und nur noch in Museen zu finden–meist auch noch defekt. Die Emulation dieser Systeme hilft, ihre Technik zumindest teilweise der Nachwelt zu erhalten.
HardwareEmulatoren
Wir stellen spezielle Hardware vor, die der Nachbildung eines oder mehrerer klassischer Computerdient. Auch die Grundlagen kommen nicht zu kurz.
SoftwareEmulatoren
Viele klassische Computer werden durch spezifischeSoftware nachgebildet. Wie man diese installiert undbetreibt und wo die Grenzen dieser Lösungen liegen,untersuchen wir in Schwerpunktartikeln.
Virtual Box und QEMU
Allgemeine, verbreitete Desktop Virtualisierungslösungen erweisen sich als vielseitig verwendbar. Wirstellen Lösungen jenseits von VMWare vor und zeigen ihren Nutzen für den Betrieb alter Betriebssysteme auf.
Außerdem:Neuigkeiten, Terminkalender, Rückschau auf Veranstaltungen, Interviews, Hard und Softwareberichte,Spielevorstellungen und, und, und!
Sind das auch Ihre Lieblingsthemen? Dann her
mit den Artikeln! redaktion@loadmagazin.de
LOAD#5 erscheint im April 2019