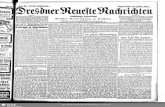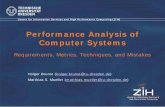Gesamtplanung – Raumor - TU Dresden
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
5 -
download
0
Transcript of Gesamtplanung – Raumor - TU Dresden
Raumplanung
Grundbegriffe
Raumplanung dient dem Interessenausgleich bei der Bodennutzung. Unterscheide: Gesamtplanung – Raumordnung
Fachplanung
§ 1 Abs. 4 BauGB Bauleitpläne sind den Zielen der Raumplanung anzupassen
Unscharfe Inhalte; Abwägungsmaterial, hoher Abstraktionsgrad
Konkret: Landesentwicklungsplan 2013 – www.revosax.sachsen.deExkurs: RevosaxExkurs: PläneExkurs. Text der Einleitung"Buch mit sieben Siegeln" (Stuer)
Abgrenzung zur FachplanungBestimmte fachlicher Gesichtspunkt – etwa Verkehrsanlagen, Deponien, Windkraft, Bildung, medizinische VersorgungAbgrenzung zum BodenrechtBauplanungsrecht- Art. 74 Abs. 1 Nr. 18 GG kommunale Bauleitplanung
Verschiedene Stufen der Planung:Raumordnung Bund – Land – Regionalplanung – kommunale Bauleitplanung
Definition Raumordnung:
Zusammenfassende, überörtliche und überfachliche Or dnung des Raums aufgrund von vorgegebenen oder erst zu entwic kelnden LeitvorstellungenBVerfGE 3, 407, 425 – Baugutachten
GeschichteStädtebaulicher Ansatz ab Beginn 20. JahrhundertBallungsgebiete kommunale ZusammenarbeitNS-Zeit: statt Landesplanung Raumordnung – nach dem Krieg daher MisskreditKommunales Interesse an überörtlicher Planung (Wasser, Abwasser, Verkehr, Bauleitplanung, Energie)Ab 1960 PlanungseuphorieRezession 1966/67: Überwindung durch staatliche PlanungEnergiekrise 1973: Ernüchterung, wieder mehr freiheitlicher Ansatz, Spannungsverhältnis zur Verpflichtung des Staates zur Daseinsvorsorge, SozialstaatsprinzipEuroparechtliche Einflüsse: Umweltbelange EG-RL Umweltverträglichkeitsprüfungen UVPGNovellierungen 1998 und 2008: einheitliches Raumordnungsverfahren
1
Gesetzliche GrundlagenRaumordnungsgesetz ROG Bund 2008Landesplanungsgesetze – Sachsen SächsLPlG 2010Kompetenzrechtliche Probleme – Förderalismusreform 2006 – Art. 74 Abs. 1 Nr. 31 GGLetztlich alles unklar; wohl hat der Bund weiterhin ROG-Kompetenz für den Gesamtstaat
Abgrenzung der Regelungsbereiche Bund – Länder§ 28 ROG Geltung des ROG für die Länder – die Länder haben einen weiten Gestaltungsspielraum
Vorschriften – Geltungsbereich des ROGLesen § 1 Abs. 1 Satz 1 ROG§ 1 Abs. 4 ROG nicht nur das Land!§ 1 Abs. 2 ROG: nachhaltige Entwicklung – gleichwertige
Lebensverhältnisse – Sozialstaatsprinzip
Grundsätze der Raumordnung
Def. in § 3 Abs. 1 Nr. 3 ROGergeben sich aus § 2 Abs. 2 ROG -> lesen!eine verbindliche Festlegung hat hier noch nicht stattgefunden, eine
abschließendeAbwägung auch nichtd.h. abwägungsrelevant, Ermessen! -> vgl. § 4 Abs. 1 Satz 1 ROG: dort sind
sie zu berücksichtigendie Aufzählung in § 2 Abs. 2 ROG ist nicht abschließendhohe Praxisrelevanz: § 2 Abs. 2 Nr. 2 Satz 4 ROG: Siedlungsverdichtung(Blick aus dem Flugzeug)Zentrale Orte werden durch die Landesplanung festgesetzt § 8 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 b ROG
Die Grundsätze der Raumordnung können auch für Priv ate Bedeutung erlangen: § 4 Abs. 1 S. 2 ROG -> Berücksichtigungspflicht
Hauptsächlich aber in Planfeststellungsverfahren relevant
Ziele der Raumplanung § 3 Abs. 1 Nr. 2 ROGWeitreichende Bindungswirkung § 4 Abs. 1 Satz 1ROGAbgrenzung der "Ziele" von den "Grundsätzen" ist im Einzelfall schwierig.Ziele -> abschließende Abwägung – LetztentscheidungGrundsätze -> abwägungsrelevant
Im Verhältnis zur Bauleitplanung sind die Ziele der Raumordnung der Abwägung vorgelagert. Deshalb müssen sie bestimmt genug sein. Sie müssen konkrete raumordnerische Entscheidungen sein. Sie können nicht weggewogen werden. BVerwGE 115, 17 Rn 9
2
Soll oder In-der-Regel Vorschriften erfüllen diese Anforderungen nicht
Sonstige Erfordernisse der Raumplanung§ 3 Abs. 1 Nr. 1 ROG: umstriiten ist § 3 Abs. 1 Nr. 4 ROG: jedenfalls reicht die Absicht, einen Plan aufzustellen nicht aus. Vgl. Baulietplanung
Was gibt es für Raumordnungspläne?Bundesraumordnung § 17 ROGRaumordnungsprogramm für die großräumige Entwicklung des Bundesgebiets (BT-Drs. 7/3584) -> keine Rechtsnormqualität
§ 17 ROG:• zur Konkretisierung von Grundsätzen Abs. 1• für länderübergreifende Standortkonzepte Abs. 2• für die deutsche ausschließliche Wirtschaftszone Abs. 3
deutsche ausschließliche Wirtschaftszone Art. 55/57 UN-Seerechtsabkommen
die Pläne nach Abs. 2 und 3 ergehen als RVO – siehe Wortlaut
Wenig Verbindlichkeit, mehr Relevanz hat die Zusammenarbeit und Abstimmung der zuständigen Akteure der Landesplanung
Regelungen zur Landes- und Regionalplanung
§ 1 Abs. 1 Satz 1, § 8 Abs. 1 Satz 1 ROG: die Länder haben die HauptzuständigkeitLandesweite Regionalpläne und RaumordnungspläneFlächendeckende Aufstellung von RegionalplänenInhalte sind in § 7 Abs. 1 ROG geregelt: Bestimmter Planungsraum – zur Entwicklung, Ordnung und Sicherung des Raums§ 8 Abs. 2 Satz 1 ROG: raumordnungsrechtliche Entwicklungsgebot§ 8 Abs. 3 ROG: gemeinsame Planungspflicht der Länder; aber freiwillig§ 8 Abs. 4 ROG: Möglichkeit der regionalen Flächennutzungspläne
§§ 9 ff ROG: VerfahrensvorschriftenDiese werden durch die UVP-Richtlinie stark vorgeprägt. § 9 Abs. 1 ROG
§ 12 ROG -> vgl. § 214 BauGB Verfahrensfehler und ihre Wirkung§ 12 Abs. 5 ROG Rügepflicht
Instrumente zur Sicherung und Verwirklichung der Ra umordnungNeben dem Raumordnungsplan ist nach § 1 ROG weiter relevant:
• • • • Raumordnerische Zusammenarbeit
§ 13 Abs. 1 ROG:
3
§ 26 ROG: Zusammenarbeit von Bund und Ländern, Ministerkonferenz für Raumordnung - MKRO
• • • • Abstimmung raumbedeutsamer Planungen und Maßnahmen§ 3 Abs. 1 Nr. 6 ROG: DefinitionAuch Maßnahmen PrivaterRaumordnungsverfahren nach § 15 ROG:Das Verfahren wird von Amts wegen eingeleitet. welche Planungen und Maßnahmen erfasst werden, ist in § 1 RoV katalogartig geregelt. Verfahren in § 15 ROG geregelt. Beteiligung anderer Stellen Abs. 3.Die Ergebnisse der Raumordnungsverfahren sind sonstige Erfordernisse der Raumordnung nach 3 3 Abs. 4 ROG -> Rechtswirkung aus § 4 ROG, für Abwägungs-, Ermessensentscheidungen und generell relevantRechtscharakter ist umstritten; keine Rechtsqualität, kein VA – BVerwG NVwZ-RR 1996, 67
• • • • Untersagung von Planungen und Maßnahmen§ 14 ROG Befugnisse der RaumordnungsbehördeRechtsbehelfe haben keine aufschiebende Wirkung Fragen! Abs. 3Wer kann überhaupt dagegen vorgehen? Behörden nicht!
• • • • Raumordnungsberichte und BeiräteAn Bundestag - § 25 Abs. 2 ROGAn LT - landesrechtlichen Regelungen; in Sachsen
§ 17 Abs. 1 Satz 2 SächsLPlG in jeder Legislaturperiode
• • • • Raumordnungskataster, Mitteilungen-, Auskunfts- und sonstige Pflichten§ 25 Abs. 1 ROG für Bund: Informationssystem§ 18 SächsLPlG für Land Auskunftspflichten§ 17 Abs. 2 SächsLPlG Raumordnungskataster (Verzeichnis)Alle raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen nach der Anlage zum SächsLPlG
Möglichkeiten des RechtsschutzesDie Raumordnung ist wegen der weitreichenden Bindungswirkungen fürGemeinden - Bürger/Personen des PrivatrechtsHohe Bedeutung.
Was ist mit Rechtsschutz?
RVO, kein VA, auch kein Rechtsschutz gegen etwaige Genehmigungen.
Ausschließlich über Normenkontrolle möglich1 § 47 VwGO. Voraussetzung § 47 Abs. Abs. 1 Nr. 2 VwGO ins Sachsen erfüllt: § 24 Abs. 1 SächsJG Antragsbefugnis § 47 Abs. 2 VwGOFür Gemeinden: wenn sie vom Raumordnungsplan betroffen sind und die Regelungen für sie verbindlich geltenPrivatpersonen schwieriger, lange wurde das verneint. Heute zeichnet sich ab, dass bei einer unmittelbaren Rechtswirkung auf die Privaten diese auch
4
klagen können müssenUnabhängig davon inzidente Kontrolle
Feststellungsklage nach § 43 VwGO
Rechtsweg zu den Verfassungsgerichten; sächsische Gemeinden VerfGH Subsidiarität § 91 Satz 1 BVerfGG
Europarechtliche Bezüge1970 Europäische Raumordnungsministerkonferenz des Europarats (CEMAT)
1993 Bericht Europa 2000
1999 Europäische Raumentwicklungskonzept 1999 EUREK – unverbindlich, Selbstverpflichtung, Agenda
2007 Territoriale Agenda der EU (TAEU)
Fachkompetenzen der EU wirken einAgrar, Struktur, Umwelt, Verkehr
2009 Lissabon: Art. 3 Abs. 3 EUV fördert den wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalt
2011 TAEU 2020
Aber wenig verbindlich
Arten von Plänen:
Haushaltsplan Bund, Länder, Gemeinden
Raumordnungspläne Gesamtpläne
Fachpläne FernstraßenG LuftVG KrW-AbfG Windenergie
Bedarfsplan Bundesfernstraßen
Pläne im umweltrechtlichen Bereich Landschaftspläne; Luftreinhaltepläne
Bedarfspläne im sozialen Bereich Krankenhausfinanzierungsgesetz
Pläne im Bildungs- und Hochschulbereich z. B. Struktur- Entwicklungspläne für Hochschulen
Pläne, die nur eine Person betreffen z. B. Eingliederung eines behinderten
5
SGB XII, Vollzugsplan Strafgefangener StVollZG
Dienstpläne behördenintern – VwV
Bedeutung:
SozialstaatsprinzipKnappheit von RessourcenInteressengegensätzeBewältigung von Problemen
Schwerpunkt staatlicher Planung liegt in Gesetzgebung und Regierung
Normenpyramide -> wo gehört das hin?Die Vielfalt der staatlichen Pläne schließt eine einheitliche Zuordnung aus!
Bindungswirkung?
Indikative PläneImperative PläneInfluenzierende Pläne
Rechtsnatur -> sehr unterschiedlichHaushaltsplan Bund/Länder – GesetzHaushaltsplan Gemeinde - SatzungB-Pläne – Satzung § 10 BauGBPlanfeststellungsbeschluss – VA – in Fachgesetzen angeordnet!Regionalpläne – unterschiedlich, z. T. G, Sachsen: RVO
Fehlt eine gesetzliche Einordnung, dann muss man im Einzelfall prüfen
Plangewährleistung:Anspruch auf Planfortbestand? Beibehaltung, also keine Änderung oder AufhebungAndere Frage: Anspruch auf Planerlass; grds. nein -> vgl. § 1 III 2 BauGBEin allgemeiner Planfortbestandsanspruch existiert nichtSonst zu unterscheiden: Rechtsform des PlanesGesetz - RüWiVA – WiderrufSonst planerische gestaltungsfreiheit
Anspruch auf Planbefolgung:
Rechtsverbindlich? für wen?
Anspruch auf Übergangsregelungen und Anpassungshilf en
Allgemeiner Anspruch auch hier nicht
Anspruch auf Entschädigung
6
Grds. nicht!
Bauleitplanung
Grundlagen
• • • • Funktion des Baurechts
InteressenausgleichBaufreiheit des Grundstückeigentümers Art. 14 Abs. 1 GGInteresse der Allgemeinheit an sinnvoller NutzungErholungszwecke, Verkehrsanlagen, Wasser- und LandschaftsschutzgebieteViele Gemeinsamkeiten mit anderem Planungsrecht
• • • • Geschichte
PrOVGE 9, 353 = DVBl. 1985, 216: Kreuzbergurteil 14.6.1882Bauverbote und –beschränkungen in der Umgebung des Siegerdenkmals in Kreuzberg. Zweck Freihaltung der Sicht. PrOVG fand, es gebe hierfür keine EGL; PolG reicht nicht
Exkurs: Ermächtigungsgrundlage
Im Anschluss dann Erlass von Baugesetzen
3. Arten von Planung
Reaktionsplanung -> Gefahren beseitigen, auf Missstände zu regieren, Ende 19. Jahrhundert
Auffangplanung -> Richtlinien zur Entwicklung, also eher zukunftsorientiert, seit Anfang 20. Jahrhundert
Angebotsplanung -> Planung beschränkt sich auf die Bereitstellung einer Struktur, die dann auch von den Bauherrn angenommen werden muss
Entwicklungsplanung -> Gebote der Planverwirklichung und städtebauliche Gebote
Informelle Planung vgl. § 1 Abs. 6 Nr. 11BauGBProblem: formalisierte Prozesse laufen leer
• • • • Rechtsgrundlagen
7
Gutachten des BVerfG (E 3,407) zur Abgrenzung der Gesetzgebungskompetenzen:
Bundesrecht:Städtebauliche Planung §§ 1 – 44, 136 – 191 BauGBBaulandumlegung §§ 45 – 79 BauGBBodenbewertung §§ 192 – 199 BauGBBodenverkehrsrecht §§ 19 – 28 BauGBErschließungsrecht §§ 123 – 135 BauGB
Landesrecht:Bauordnungsrecht – Baupolizei
• BauGB, BauNVO
Abgrenzung: Bauplanungsrecht – Einfügen in die Umgebung, Konkretisierung der Sozialbindung des Eigentums Art. 14 Abs. 1 Satz 2 GGBauordnungsrecht Gefahrenabwehr
Kommunale Selbstverwaltungsgarantie Art. 28 Abs. 2 GG
Den Gemeinden muß das Recht gewährleistet sein, alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung zu regeln. Auch die Gemeindeverbände haben im Rahmen ihres gesetzlichen Aufgabenbereiches nach Maßgabe der Gesetze das Recht der Selbstverwaltung. Die Gewährleistung der Selbstverwaltung umfaßt auch die Grundlagen der finanziellen Eigenverantwortung; zu diesen Grundlagen gehört eine den Gemeinden mit Hebesatzrecht zustehende wirtschaftskraftbezogene Steuerquelle.
Dazu gehört auch die Planungshoheit, jedenfalls sie die bauliche Nutzung von Grund und Boden betrifft. zusätzlich interkommunales Abstimmungsgebot, § 2 Abs. 2 Satz 1 BauGB (s. u.).
Eigentum Art. 14 GG -> Baufreiheit
1) Das Eigentum und das Erbrecht werden gewährleistet. Inhalt und Schranken werden durch die Gesetze bestimmt.(2) Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen.(3) Eine Enteignung ist nur zum Wohle der Allgemeinheit zulässig. Sie darf nur durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes erfolgen, das Art und Ausmaß der Entschädigung regelt. Die Entschädigung ist unter gerechter Abwägung der Interessen der Allgemeinheit und der Beteiligten zu bestimmen. Wegen der Höhe der Entschädigung steht im Streitfalle der Rechtsweg vor den ordentlichen Gerichten offen.
Nassauskiesungsbeschluss BVerfG 15.7.1981 E 55, 300:
Die Befugnisse eines Eigentümers ergeben sich aus der Zusammenschau
8
der die Eigentümerstellung regelnden gesetzlichen Vorschriften. Habe der Eigentümer danach eine bestimmte Befugnis nicht, ergebe sie sich auch nicht aus dem Grundrecht.
Inhalts- und SchrankenbestimmungPrivatnützigkeit des Eigentums – SozialgebotVerhältnismäßigkeit
Exkurs: Verhältnismäßigkeitsgrundsatz
Verfassungsrechtlicher Schutz der Umwelt § 1 Abs. 5 BauGB
Verkehrslärm, Natur und BodenStaatszielbestimmung in Art. 20a GG:
Der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung durch die Gesetzgebung und nach Maßgabe von Gesetz und Recht durch die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung.
Europarechtlicher Rahmen keine RegelungskompetenzDennoch FFH RichtlinieLuftqualitäts RLUVP RLÖffentlichkeitsbeteiligungs RL
• • • • Allgemeines zur Bauleitplanung
Funktion der BauleitplanungKernstück des modernen Städtebaurechts§ 1 Abs. 5 BauGB -> Grundsatz der Planmäßigkeit im BaurechtZuständig sind die Gemeinden § 1 Abs. 2, Abs. 3 und § 2 Abs. 1 BauGB§ 1 Abs. 1 BauGB -> die Bauleitpläne müssen in objektiver Beziehung zur städtebaulichen Ordnung stehen, sie dürfen nicht (nur) sonstigen Interessen, insbes. privaten Interessen dienen
VGH BW VBlBW 1995, 241 : Nach § 1 Abs. 3 BauGB haben die Gemeinden die Bauleitpläne aufzustellen, sobald und soweit es für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich ist. Maßstab der Erforderlichkeit ist die erkennbare planerische Konzeption der Gemeinde. Als solche bezeichnet die Antragsgegnerin in der Bebauungsplanbegründung das Ziel, in extrem locker bebauten Gebieten zusätzliche Baumöglichkeiten zu schaffen, um so den Anteil an neu zu erschließenden Außenbereichsflächen zu reduzieren. Daß der angefochtene Bebauungsplan diesem Ziel dient, ist nicht zu bezweifeln. Als nicht erforderlich im Sinn des § 1 Abs. 3 BauGB wäre der Plan daher allenfalls dann anzusehen, wenn es der Antragsgegnerin tatsächlich nicht um
9
die Erreichung dieses Ziels, sondern allein um die Befriedigung privater Interessen ginge. Dafür ist indessen nichts zu erkennen. Allein der Umstand, daß die Antragsgegnerin das Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplans deshalb eingeleitet hat, weil einige Grundstückseigentümer den Wunsch nach einer besseren baulichen Ausnutzbarkeit ihrer Grundstücke geäußert hatten, rechtfertigt nicht die Annahme, es handle sich um eine bloße "Gefälligkeitsplanung". Auch die von den Antragstellern ferner ins Feld geführte "überaus lange Verfahrensdauer" läßt nicht hierauf schließen. Sie belegt vielmehr im Gegenteil, daß die Antragsgegnerin nicht einfach die geäußerten Bauwünsche übernommen und sich bei ihrer Planung nicht nur von ihnen hat leiten lassen.
Unbedenklich ist es also, wenn private Bauwünsche den Anstoß für die Planung geben.
Das BauGB sieht grundsätzlich ein zweistufiges Verfahren vor:
Flächennutzungsplan § 1 Abs. 2 BauGB: vorbereitender Bauleitplan - § 5 BauGBBebauungsplan § 1 Abs. 2 BauGB: verbindlicher Bauleitplan – §§ 8, 9 BauGB
Einen Flächennutzungsplan für die ganze Gemeinde, grundsätzliche PlanungViele B-Pläne für die Gemeinde, Detailplanung für bestimmten Bereich
• • • • Abhängigkeit des B-Plans vom FNP
B-Plan wird als Satzung erlassen, § 10 BauGBFNP Rechtsnatur umstritten - § 7 BauGB wirkt nur gegenüber Behörden
Ausnahme: § 35 Abs. 3 BauGBHoheitliche Maßnahme eigener Art
FNP erstreckt sich über das gesamte Gemeindegebiet, § 5 BauGB -> grobmaschige Planung
Auf dieser Grundlage ist/sind nach § 8 Abs. 2 Satz 1 BauGB dann der/die B-Pläne aufzustellen. Der B-Plan ist aus dem FNP zu entwicklen darf ihn also in seinen Grundentscheidungen nicht verändern.
Unbedeutende Änderungen der >Grenzen des bebauten Gebietes gegenüber dem Außenbereich verstoßen nicht gegen § 8 Abs. 2 BauGB
Der FNP kann bereits konkrete Gebiete nach der BauNVO festsetzen. Dann bleibt für den B-Plan nicht mehr viel. Wenn der b-Plan dann davon abweicht, ist er nichtig.
Verstoß ist nach § 214 Abs. 2 Nr. 2 BauGB unbeachtlich, wenn der B-Plan die sich aus dem wirksamen FNP ergebende geordnete städtebauliche Entwicklung nicht beeinträchtigt. Nur bei quantitativ und qualitativ
10
unbedeutenden Abweichungen möglich! Zirkelschluß : Unbedeutende Abweichung wird schon kein Verstoß gegen das Entwicklungsgebot darstellen.
• • • • Ausnahmen von der Abhängigkeit
• Parallelverfahren § 8 Abs. 3 BauGB – lesen! § 214 Abs. 2 Nr. 4 BauGB• Selbständiger B-Plan § 8 Abs. 2 Satz 2 BauGB – lesen! kleine Gemeinden oder ganz kleines Plangebiet• Vorzeitiger B-Plan § 8 Abs. 4 BauGB – lesen!
§ 8 Abs. 4 BauGB findet auch dann Anwendung, wenn der FNP nichtig ist. § 214 Abs. 2 Nr. 3 BauGB .
Einbeziehung weiterer Behörden (s. u.)
§ 4 BauGB Beteiligung anderer Behörden, also Fachplanung Straßenplanung, natur- und Landschaftsschutz, Wasserschutz, Bahnanlagen, Abfallbeseitigung, Ausbau von Gewässern
Grundsätzlich besteht ein Vorrang des Fachplanungsrechts, § 38 BauGB. Die Fachplanungsbehörde ist dann an die Festsetzungen eines FNP gebunden, wenn sie ihnen nicht widersprochen hat. Bei geänderter Sachlage kann ein Widerspruch auch noch nachträglich erfolgen. Ein Widerspruch ist dann entbehrlich, wenn die Gemeinde selbst nicht mehr an den Festsetzungen festhält.
Fall:Die Gemeinde beantragt, einen aufgelassenen Steinbruch als Naturschutzgebiet auszuweisen. Im FNP ist das Gebiet als Gewerbegebiet ausgewiesen.
Exkurs: BauNVO
Gebot der konkreten Planung
Der B-Plan muss konkrete Vorgaben über die zulässige Bebauung und sonstige Nutzung der Grundstücke enthalten.
Exkurs: Normen - Verwaltungsakte
Gebot der positiven Planung
11
Der Bebauungsplan muss Festsetzungen enthalten, die positiv bestimmen, welche bauliche oder sonstige Nutzung zulässig ist.
Eine rein negative Planung kann nicht der städtebaulichen Ordnung dienen, weil dann ein "planloser" Zustand entsteht.
Kein grds. Verbot der Negativplanung (s. u.). Man kann somit durch konkrete Festsetzungen andere Vorhaben vermeiden, wenn damit städtebauliche Entwicklungen geschützt werden sollen. Nur wenn die Planung ausschließlich der Verhinderung dient, ist das rechtswidrig.
Bestimmtheitsgebot
Inhaltlich so bestimmt sein, dass die Betroffenen wissen, welchen Beschränkungen ihr Grundstück unterworfen oder welchen Belastungen es ausgesetzt sein wird (Immisionen)
Es muss allerdings nicht alles geregelt werden, was geregelt werden kann –planerische Zurückhaltung und Konfliktbewältigung
Grenze: Zumutbarkeit
Planungshoheit der Gemeinde
§ 1 Abs. 3 BauGB. primäre politische Entscheidungen, die der Gemeinderat zu fällen hat
Kernbereich nach Art. 28 Abs. 1 GG: Selbstverwaltung der Gemeinde
§ 205 BauGB: Planungsverband
Erforderlichkeit der Bauleitplanung, § 1 Abs. 3 Bau GBWortlaut § 1 Abs. 3 BauGBFolgen:*Das Aufstellen der Bauleitpläne ist nicht in das Ermessen der Gemeinde gestellt*unbestimmter Rechtsbegriff, volle gerichtliche Kontrolle; allerdings spielen hier viele prognostische Elemente eine Rolle: Bedarf an Wohnungen, Gewerbeflächen, Verkehrswege etc.*planerische Konzeption als solche ist nicht überprüfbar
Exkurs: Ermessen und unbestimmter Rechtsbegriff
Def.: Es reicht aus, wenn es vernünftigerweise geboten ist, die bauliche Entwicklung durch eine vorherige Planung zu ordnen (BVerwG, NVwZ 1989, 664). Das BauGB geht grds. von einer vorherigen Planung aus. Daher nur dann nicht erforderlich, wenn die Planung auf keiner planerischen Konzeption
12
beruht und daher überflüssig ist.
Kein Verbot der Negativplanung – allerdings Grenze wenn ausschließlich verhindert werden soll, ohne etwas Positives zu verfolgen. SächsOVG, SächsVBl. 200, 193:
Nach der zitierten Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts gibt es auch kein Verbot der Negativplanung; der Gemeinde steht es frei, gerade anlässlich eines bestimmten Vorhabens eine Bauleitplanung zu betreiben, um dessen planungsrechtliche Genehmigungsfähigkeit zu verhindern. Unzulässig ist es allerdings, wenn sich die Plankonzeption in dieser Verhinderungswirkung erschöpft und nicht darüber hinaus ein positives Planungsziel erkennen lässt.
Gebot der Lastenverteilung : entstehende Belastungen sollen möglichst gleichmäßig verteilt werden. Privates Gelände darf für öffentliche zwecke nur herangezogen werden, wenn keine Fläche in öffentlicher Hand dafür zur Verfügung steht.
Gebot der Konfliktbereinigung: § 1 Abs. 3 BauGB und Abwägungsgebot:Es sollen in der Planung diejenigen Festsetzungen erfolgen, die zur Bewältigung der vorhandenen oder neu entstehenden städtebaulichen Konflikte notwendig sind.Es darf also kein Problem ausgeklammert werden. Allerdings: Es muss auch nicht alles bereits gelöst werden, sondern kann auch dem nachfolgenden Genehmigungsverfahren überlassen bleiben.
BVerwGE 109, 246:Die Gemeinde darf keinen Bebauungsplan aufstellen, der aus Rechtsgründen nicht vollzugsfähig ist, z.B. weil für seine Verwirklichung erforderliche Genehmigungen wegen Verletzung zwingenden Rechts, hier wegen Nichteinhaltung der für Sportanlagen geltenden immissionsschutzrechtlichen Anforderungen, nicht erteilt werden dürften. Ein solcher Bebauungsplan wäre wegen Verstoßes gegen das in § 1 Abs. 3 BauGB enthaltene Gebot der Erforderlichkeit der Planung nichtig (stRspr, vgl. z.B. BVerwG, Beschluß vom 25. August 1997 - BVerwG 4 NB 12.97 - DÖV 1998, 71 = NVwZ-RR 1998, 162 = Buchholz 406.11 § 6 BauGB Nr. 7). Allerdings kann von einer Vollzugsunfähigkeit eines Bebauungsplans nur ausgegangen werden, wenn dessen Realisierung zwangsläufig an rechtlichen Hindernissen scheitern müßte. Dies ist zu verneinen, wenn z.B. durch Auflagen im Baugenehmigungsverfahren oder durch angemessene Beschränkungen des Sportbetriebs Hindernisse überwindbar sind
Im Ergebnis führt das dazu, dass eine Planung = ein Bebauungsplan nur dann wegen unterbliebener Konfliktlösung unwirksam ist, wenn eine nachträgliche Problemlösung ausgeschlossen ist, etwa die
13
Immissionsbelastung durch eine Straße oder eine bauliche Anlage so hoch sein wird, dass sie auch durch Schallschutzmaßnahmen nicht mehr auf ein zumutbares Maß reduziert werden kann.
• • • • Gesetzliche Schranken der Bauleitplanung
BVerwGE 45, 309 geht davon aus, dass mehr Bindung als Freiheit besteht.
Zwingende Vorgaben – etwa Ziele der Landesplanung § 1 Abs. 4 BauGBOptimierungsgebote – etwa Trennung von Wohn- und Gewerbegebieten
• Ziele der Raumordnung § 1 Abs. 4 BauGBVgl. den ersten Tag unserer Veranstaltung
• Interkommunale Rücksichtnahme § 2 Abs. 2 BauGBMaterielle AbstimmungspflichtFormelle Abstimmungspflicht ist in § 4 BauGB geregeltEs reicht hier aus, dass unmittelbare Beeinträchtigungen gewichtiger Art in Betracht kommen.
• Fachplanerische VorgabenDie Gemeinde kann sich über Fachplanungen (Straßenbau, Wasserschutz, Naturschutz etc. nicht einfach hinwegsetzen. Aber inwieweit das gilt, ist problematisch.Nach § 7 BauGB sind die Fachplaner an den Flächennutzungsplan gebunden, sofern sie ihm nicht widersprochen haben.
• Naturschutzrecht § 1a BauGB, §§ 8, 8a BNatSchG
• • • • Die Abwägung
BVerwGE 34, 301BVerwGE 48, 56
§ 1 Abs. 7 BauGB -> lesen!
Es gibt also keinen prinzipiellen Vorrang der priva ten oder der öffentlichen Interessen!
Drittschützende Wirkung!
Zentrales Gebot der Bauleitplanung - > planerische Gestaltungsfreiheit der Gemeinden
Es sind so vielgestaltige Lösungen möglich, dass keine konditionierte Entscheidung sachgerecht ist
14
Finale Strukturierung eines Entscheidungsprozesses, bei dem das Ergebnis nicht determiniert ist. Komplexer Willensbildungsprozess
Wohnt der Planung inne und ist Gebot der Verhältnismäßigkeit und des Rechtstaatsprinzips
§ 1 Abs. 7 BauGB verhalten sich nicht zu den Inhalte n der Abwägung§ 214 BauGB auch nicht
Rspr. und Lit.:
• • • • Abwägung muss stattfinden• • • • Es muss eingestellt werden, was nach Lage der Dinge eingestellt werden muss• • • • Die Bedeutung der Belange darf nicht verkannt werde n• • • • Keine Fehlgewichtung, also muss der Ausgleich so vo rgenommen werden, das die objektive Gewichtung der eingestell ten Belange nicht verfehlt
Abwägungsbereitschaft offen sein für alle in Frage kommenden Planungsvarianten
Zeitliche Verzögerung ist kein ArgumentPlanung darf nicht von vorneherein fixiert sein auf ein bestimmtes Ergebnis
BVerwGE 45, 309: die Freiheit von jeglichen ) Bindungen ist lebensfremd, gerade bei großen Projekten (neue Stadteile oder Industrieansiedlungen
Es darf aber keine überflüssige Vorfestlegung erfol gen
Die Vorabfestlegung muss
• • • • Sachlich gerechtfertigt sein• • • • Planerische Zuständigkeitsordnung muss gewahrt werd en• • • • Die vorgezogene Entscheidung darf inhaltlich nicht zu beanstanden sein
Eine verbindliche Vorfestlegung (Vertrag!) ist inde s ausgeschlossen - § 2 Abs. 3 BauGB
Ausnahme: vorhabenbezogen B-Plan § 12 Abs. 2 BauGB -> später mehr
Zusammenstellen des Abwägungsmaterials
Alle öffentlichen und privaten Belange müssen eingestellt werden
15
Lage der Dinge
Dürfen nicht objektiv geringwertig oder nicht schutzwürdig seinAbwägungsrelevant beachtlich erkennbar sind
Trennungsgebot, § 50 BImSchG
Bauplanungsrechtliches RücksichtnahmegebotAllgemeines Wohngebiet neben Industriegebiet
AbstandGliederungEventuell Besondere Vorkehrungen Bsp. Lärmschutzwälle
Gebot der LastenverteilungGleichmäßig auf alle Grundstückseigentümer
Gebot der Konfliktbewältigung
Spannungsverhältnis zu planerischer Zurückhaltung
• • • • Gerichtliche Prüfung der Abwägung
§ 1 Abs. 7 BauGB
Exkurs: gerichtliche Prüfung von VerwaltungsentscheidungenGewaltenteilung – Art. 20 Abs. 2 Satz 2 GGArt. 19 Abs. 4 GG – RechtschutzgarantieMaßstäbe – SpannungsverhältnisRichterliche ZurückhaltungRealität
Abwägungsausfall eine sachgerechte Abwägung findet nicht statt
Abwägungsdefizit es wird nicht in die Abwägung eingestellt, was hätte eingestellt werden müssen
Abwägungsdisproportionalität wenn die Bedeutung der betroffenen privaten Belange verkannt oder wenn der Ausgleich in einer Weise vorgenommen wird, die zur objektiven Gewichtung außer Verhältnis steht
Fehlerfolge: § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB Abwägungsvorgang –Abwägungsergebnis
Abwägungsvorgang: Zusammenstellen des AbwägungsmaterialsAbwägungsergebnis: kann die Planung schlechterdings nicht getroffen werden
16
BVerwG NJW 1982, 591 einschränkende Auslegung wegen Art. 19 Abs. 4 GG gebotenOffensichtlich heißt sofort erkennbar und objektiv eindeutig
Kausalität ist schon dann gegeben, wenn nicht ausgeschlossen werden kann, dass eine andere Entscheidung hätte getroffen werden können.
§ 215 Abs. 1 Nr. 2 BauGB Frist von einem Jahr!
Rüge wirkt gegenüber jedermann
• • • • Verfahren der Bauleitplanung
Einstieg:
Traditionell weist das Verwaltungsrecht dem Verfahren dienende Funktion zu. Wesentlich ist die Richtigkeit der Entscheidung, also das Ergebnis. Das Verfahren wird vielfach darauf reduziert, zu dieser inhaltlichen Richtigkeit beizutragen.
Konsequent dann § 214 Abs. 1 Nr. 2 BauGB. -> Lesen!Unbeachtliche FehlerBeachtliche Fehler, die im ergänzenden Verfahren behoben werden können
Europarechtlich spielt das Verfahren eine immer größere, eigenständige Rolle.Das Verwaltungsverfahren dient hier nicht der Ermittlung des richtigen Ergebnisses -> i. S. d. einzig richtigen Ergebnisses, sondern nähert sich einem Verhandlungsprozess mit einer gewissen Bandbreite möglicher Entscheidungen an.Einfach gewendet: Wenn das Verfahren richtig läuft, wird auch das so gefundene Ergebnis zutreffen. - > Eigenwert des Verfahrens
Verfahrensgrundnorm: § 2 Abs. 3 BauGB -> Lesen!Konkretisierung in § 4a Abs. 1 BauGB Zweck die relevanten Informationen zu verschaffenAußerdem Präklusion – durch frühzeitige Geltendmachung der Belange wird Rechtswahrung angestrebtDie Wahrung von Rechten und Belangen erfordert Kenntnis – PublizitätÖffentlichkeit – ohne Einschränkung – führt zur KontrolleZiel Akzeptanz und Legitimation
Diskussion: Klappt das?
Gesetzliche Grundlagen: allgemein §§ 2 bis 4b BauGBSpezielle §§ 6 und 10 BauGB
Einleitung über UVP
17
Umwelt(verträglichkeits)prüfung
Das Bauleitverfahren steht erheblich unter europarechtlichem Einfluss. Plan-UP-Richtlinie
Diese Richtlinie überträgt das Konzept der Umweltprüfung auf das Planungsrecht. bereits hier werden die relevanten Messen gesungen.
Ausnahmen in § 13 BauGB
Ablauf der Umweltprüfung
Anwendungsbereich: u. a. Pläne Bodennutzung
Schritte in § 13a BauGB – Anlage 2 BauGB
• Schritt: Vorprüfung des Einzelfalls (Screening)• Schritt: Einbeziehung der mgl. betroffenen Behörde
Umweltprüfung Art. 2 lit.b UP-Richtlinie"die Ausarbeitung eines Umweltberichts, die Durchführung von Konsultationen, die berücksichtigung des Umweltberichts und der ergebnisse der Konsultationen bei der Entscheidung und Unterrichtung über die Entscheidung"
Umweltbericht § 2 Abs. 4 BauGB lesen!
§ 2a BauGB : der Umweltbericht wird Teil der Begründung des B-Plans
Kern der Umweltprüfung liegt in der Beteiligung
• der Behörden• der Öffentlichkeit
das war schon immer so im deutschen Bauplanungsrecht
Ablauf des Bauleitverfahrens
Aufstellungsbeschluss § 2 Abs. 1 Satz 1 BauGB – lesen!
Aufstellungsbeschluss§ 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB; Verfahrensvorschriften im BauGb inkomplett. Das richtet sich dann nach Landesrecht, Kommunalrecht, SächsGemO .
Ein Verstoß gegen § 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB ist nach § 214 BauGB
18
unbeachtlich BVerwG NVwZ 1998, 916 – juris Rn 23f:
Das Bundesrecht (BBauG/BauGB) enthält keine in sich abgeschlossene und vollständige Regelung der formellen Voraussetzungen für gültige Bauleitpläne. Bundesrechtlich vorgegeben ist zwar, daß es sich bei der Bauleitplanung um eine Aufgabe der Gemeinde handelt (§ 2 Abs. 1 Satz 1 BBauG/BauGB). Bundesrechtlich geregelt sind auch einzelne Schritte im Verfahren der Bauleitplanung wie z.B. die Bürgerbeteiligung, die Beteiligten der Träger öffentlicher Belange oder die Beschlußfassung über den Bebauungsplan. Für einzelne dieser Verfahrensschritte enthält das Bundesrecht ferner weitere Anforderungen, etwa die Regelungen über die Auslegung des Planentwurfs und deren Dauer und die öffentliche Bekanntmachung über Ort und Dauer der Auslegung (§ 2 a Abs. 6 BBauG/§ 3 Abs. 2 BauGB). Im übrigen aber, nämlich soweit das Bundesrecht keine Regelung trifft, bestimmt sich das bei der Aufstellung von Bauleitplänen einzuhaltende Verfahren nach Landesrecht (Urteil des Senats vom 7. Mai 1971 - BVerwG 4 C 18.70 - <DVBl. 1971, 757>; Beschluß vom 18. Juni 1982 - BVerwG 4 N 6.79 - <ZfBR 1982, 220 = DVBl. 1982, 1095>; Beschluß vom 3. Oktober 1984 - BVerwG 4 N 1 und 2.84 - DVBl. 1985, 387, 388>; in diesem Sinne auch schon der 1. Senat des Bundesverwaltungsgerichts im Urteil vom 18. August 1964 - BVerwG 1 C 63.62 - <BVerwGE 19, 164, 165 f.> zum BBauG 1960), Die bundesrechtliche Regelung der Bauleitplanung - sei es ausdrücklich, sei es sinngemäß - setzt dem Landesrecht insoweit nur einen Rahmen, der nicht überschritten werden darf (Urteil vom 7. Mai 1971, a.a.O.). Dementsprechend regelt beispielsweise allein das Landesrecht, nämlich die jeweilige Gemeindeordnung in Verbindung mit dem Ortsrecht, die Zuständigkeit der Gemeindeorgane für die Bauleitplanung oder für einzelne Verfahrensabschnitte (BVerwG, Beschluß vom 3. Oktober 1984, a.a.O.). Diese im Grundsätzlichen allgemein anerkannte Rechtslage hat sich durch das Inkrafttreten des Baugesetzbuchs nicht verändert. Im Gegenteil ist es eines der Ziele dieses Gesetzes, die bundesrechtlichen Verfahrensvorschriften unter Wahrung rechtsstaatlicher Mindestanforderungen auf das unbedingt Notwendige zu beschränken.
Das Bundesbaugesetz und das Baugesetzbuch gehen allerdings davon aus, daß das Verfahren zur Aufstellung eines Bebauungsplans durch einen Aufstellungsbeschluß eingeleitet wird. § 2 Abs. 1 Satz 2 BBauG/BauGB bestimmt, daß der Beschluß, einen Bauleitplan aufzustellen, ortsüblich bekanntzumachen ist. Das Vorliegen eines ordnungsgemäßen Planaufstellungsbeschlusses ist aber nach Bundesrecht keine Wirksamkeitsvoraussetzung für den späteren Bebauungsplan.
Zu § 214 BauGB: -> juris Rn 33
Für die Abwägung ist allein die Sach- und Rechtslage im Zeitpunkt der Beschlußfassung über die Bauleitplanung maßgebend (§ 155 b Abs. 2 Satz 1 BBauG 1979/§ 214 Abs. 3 Satz 1 BauGB). Unzulässige Einwirkungen auf die Planung sind aus diesem Grunde bundesrechtlich nur beachtlich, wenn sie zu einer relevanten Verletzung des Abwägungsgebotes führen.
19
Frühzeitige Beteiligung
Wieder Beteiligung der • Behörden - § 4 Abs. 1 BauGB• Öffentlichkeit § 3 Abs. 1 BauGB
Nur geringe formelle Anforderungen, auch Zeitpunkt ist flexibel, kann auch schon vor dem Aufstellungsbeschluss beginnen.
Spannungsverhältnis zur Öffentlichkeitsbeteiligung
Die Öffentlichkeit Art. 3 Abs. 1 BauGB – lesen!
Unterrichtung über wesentliche Inhalte und >Gelegen heit zur Äußerung und Erörterung
Ausgestaltung im Ermessen der Gemeinde, es muss geeignet seinÄußerung kann mündlich oder schriftlich erfolögenEs bietet sich die Durchführung eines Erörterungstermins an.
Die Behörden - § 4 Abs. 1 BauGB – lesen!
Träger öffentlicher Belange sind Behörden- funktionaler Behördenbegriff
Hier sollen die relevanten Informationen beschafft werden – auch bei Öffentlichkeit
Aufgabenbereich der Behörde relevant; manchmal schwierig. Es empfiehlt sich die Behörden zu informieren. Sie können dann selbst entscheiden, ob sie betroffen sind.
Förmliche Beteiligung – nächste StufeÖffentlichkeit - § 3 Abs. 2 BauGB
Behörden - § 4 Abs. 2 BauGb
Jetzt gibt es ein vom Gesetz vorgegebenes striktes Schema!
Rechtsstaatlicher Mindeststandard
Allerdings muss jetzt schon eine gewisse Verfestigung der Planung vorliegen, da sonst keine Beteiligung möglich wäre – formal beschlussfähiger Entwurf mit Begründung § 2a Abs. 1 BauGB Hier jetzt § 214 Abs. 1 Nr. 2 BauGB relevant, der hier Fehler als beachtlich einstuft
Förmliche Öffentlichkeitsbeteiligung:
• • • • Öffentliche Auslegung § 3 Abs. 2 Satz 1 BauGB
20
VGH BW VBlBW 1999, 178 – juris Rn. 19 Die Handhabung der öffentlichen Auslegung durch die Antragsgegnerin wird diesen Anforderungen nicht gerecht. Nach den dazu von ihrem Bürgermeister in der mündlichen Verhandlung abgegebenen Erklärungen wurde die Auslegung im vorliegenden Fall - dem auch sonst üblichen Verfahren entsprechend - so durchgeführt, daß die Unterlagen auf einem niedrigen Aktenschrank ("Sideboard") im Zimmer der zuständigen Mitarbeiterin zur Einsicht bereit lagen. Wie der Senat bei einer Besichtigung dieses Zimmers festgestellt hat, befindet sich der Schrank hinter dem Stuhl der Mitarbeiterin und ist daher für Dritte nicht frei zugänglich. Zudem ist nicht erkenntlich, daß hier die Planunterlagen "ausgelegt" sind. Ein an der Planung Interessierter war daher gezwungen, sich mit seinem Anliegen zuerst an die Mitarbeiterin zu wenden, nach den Unterlagen zu fragen und diese um deren Aushändigung zu bitten. Den an eine Auslegung zu stellenden Anforderungen ist damit auch unter Berücksichtigung des Umstands, daß es insbesondere für kleinere Gemeinden schwierig sein kann, einen separaten Raum oder einen bestimmten Teil eines Raums für die Auslegung zur Verfügung zu stellen, nicht genügt.
• Ortsübliche Bekanntmachung (Landes- und Ortsrecht) erforderlich ist Ort und Dauer benannt werden und Angabe, welche umweltbezogenen Informationen vorliegen• • • • Anstoßwirkung der Bekanntmachung• • • • Genaue Bezeichnung des Plangebietes• • • • Hinweis auf Möglichkeit einer Stellungnahme während der Auslegungsfrist• • • • § 3 Abs. 2 Satz 2 2.HS BauGB: Hinweis auf Präklusio n; formelle und materielle § 47 Abs. 2a VwGO; entscheidend ist, das s darauf hingewiesen wird• • • • Auslegung für einen Monat• • • • Unterlagen sind: Entwurf B-Plan; Begründung, weiter relevante Stellungnahmen von Behörden, Verbänden, Privater
Präklusionsregelung des § 4a Abs.6 BauGB – lesen!Nur geringe Bedeutung, weil auf Rechtmäßigkeit des B-Plans zurückgegriffen wirdWenn etwas in der Abwägung zu beachten wäre, auch ohne Stellungnahme, dann läge auch ohne Stellungnahme ein Abwägungsmangel vor.Wichtig ist ohnehin, dass die Beschleunigung des Verfahrens nicht zu inhaltlich unrichtigen Ergebnissen führen darf! EuGH
21
Förmliche Beteiligung der Behörden
Jetzt mit Übersendung des Plans und der anderen auszulegenden Unterlagen
Die Behörden können jetzt prüfen, inwieweit ihre Stellungnahmen im nicht förmlichen Verfahren berücksichtigt wurden
Auch hier gilt die Präklusion des § 4a Abs. 6 BauGB
Planänderung während des Verfahrens
Die eingehenden Stellungnahmen der Öffentlichkeit und der Behörden können zu Planänderungen führen. Wenn diese Änderungen neue Planbetroffenheiten verursachen, muss erneut beteiligt werden.
F§ 4a Abs. 3 Satz 1 BauGB _ lesen!
Endlosschleife? Verfahrenserleichterungen in § 4a Abs. 3 BauGB
Entscheidungsphase und Beschluss
Wenig Vorschriften im BauGB, nur § 3 Abs. 2 Satz 4 BauGB
Und § 10 BauGB Satzung
Ausfertigung
Der Plan muss vom Bürgermeister ausgefertigt werden, d.h. Er muss mit Namen und Amtsbezeichnung und Datum unterschrieben werden. Nach dem Satzungsbeschluss, aber vor der Veröffentlichung - § 4 Abs. 3 Satz 1 GemO, Rechtstaatsprinzip
Sinn: Mit der Ausfertigung wird die Authentizität des B-Plans, also die Übereinstimmung des ausgefertigten Textes mit dem beschlossenen Text beurkundet; damit steht fest, was Inhalt des B-Plans ist.
Genehmigung
§ 6 Abs. 1 BauGB i. V. m. § 10 Abs. 2 BauGB; FNP und B-Plan
Rechtsaufsicht - § 6 Abs. 2 BauGB -> also in Planungshoheit nicht eingeschränkt
Bekanntmachung
richtet sich nach Landesrecht
22
Vereinfachtes Verfahren § 13 BauGB
Änderung oder Ergänzung eines B-Plans§ 34 BauGB Gebiete
Erhebliche verfahrensmäßige Erleichterungen – selbst herausfinden
Beschleunigtes Verfahren - § 13a BauGB
Verzicht auf Umweltprüfung
Inhalt der Bauleitpläne
• • • • Flächennutzungsplan:
Das wird in § 5 BauGB geregelt. Lesen!
Der FNP ist das grobe Raster, aus denen die B-Pläne entwickelt werden.Enthält keine Festsetzungen oder Ausweisungen (B-Plan), sondern Darstellungen. Keine Rechtsnorm.
• • • • Bebauungsplan
Der Inhalt wird in § 9 BauGB geregelt. Lesen!Vgl.mit § 5 BauGB
Art der baulichen Nutzung
→ BauNVO § 2 bis 9 – Typenzwang (keine anderen Arten von Baugebieten möglich)
Ausnahme: Sondergebiete § 10/11 BauNVO
Aufbau der Vorschriften immer gleich:#
Abs. 1 Definition der Eigenart der BaugebieteAbs. 2 Vorhaben die regelmäßig zulässig sindAbs. 3 Ausnahmen - § 31 BauGB
§ 1 Abs. 3 BauNCVO bestimmt, dass mit der Festsetzung eines Gebietstyps diese Nutzungen zulässig sind; die Gemeinde kann aber nach § 1 Abs. 4 bis 6 BauNVO das modifizierenRückausnahme: der Gebietstyp darf nicht verändert w erden.
23
Die Abweichung muß außerdem aus städtebaulichen Gründen erfolgt sein, sich also im Rahmen von § 1 Abs. 6 BauGB Abwägung ergeben
Regelungsinstitute § 1 Abs. 7 BauNVO vertikale Gliederung! Bsp. Kerngebiet - EG Läden, OG Wohnungen§ 1 Abs. 8 BauNVO horizontale Gliederung, nach Gebietsabschnitten
Maß der baulichen Nutzung§ 16 bis 21a BauNVO
Grundflächenzahl § 19 BauNVOGeschossflächenzahl § 20 Abs. 2 BauNVOGebäudehöhe § 16 Abs. 2 Nr. 4, § 18 BauNVO Traufhöhe Schnittpunkt Außenwand und DachFirsthöhe Gesamthöhe
Bauweise und überbaubare Grundstücksfläche
§§ 22, 23 BauNVOOffene Bauweise – BauwichGeschlossene Bauweise – Erstreckung bis zur Grenze
Sonstiges§ 9 BauGB Gemeinbedarf, Verkehrsflächen Versorgungsflächen, Grünflächen....
Bauplanungsrechtliche Zulässigkeit von Vorhaben
Grundlagen § 29 bis 38 BauGB
Verbidnung zwischen Bauleitplanng und >Vorhabenaber auch Regelung für den Fall, dass es keine Pläne gibt
beplanter Innenbereich § 30 BauGBnicht beplanter Innenbereich § 34 BauGBAußenbereich § 35 BauGB
Überschneidungen § 30 Abs. 3 BauGB
Feinabstimmung in • § 31 VbauGB Ausnahmen und Befreiungen• § 33 BauGB Vorhaben in der Phase der Planaufstellung• § 36 BauGB Beteiligung der Gemeiden
24
• § 38 BauGB Kollision mit Fachplanung
Baugenehmigungsverfahrendie Durchsetzung der planerischen Entscheidung findet hier statt, in dem die einzelnen Vorhaben und ihre Vereinbarkeit mit dem Recht geprüft werden
§ 29 BauGB: Anwendungsbereich der § 30 ff BauGB
Begriff des Vorhabens: Errichtung, Änderung und Nutzungsänderung,aber auch Aufschüttungen, Abgrabungen, Ausschachtungen, Ablagerungen., Lagerstätten
→ für bestehende Anlagen zunächst ohne Relevanz; bereits entstandene fejhlentwicklungen können so nicht repariert werden (einfachrechtlicher Bestandsschutz)
bauliche Anlage: Merkmal des Bauens, also des Schaf fens einer Anlage; außerdem bodenrechtliche Relevanz. Ausnahmen in § 38 BauGB
Vorhaben im Geltungsbereich eines B-Plans
§ 30 BauGB: beplanter Innenbereichqualifizierter und einfacher B-Plan
Qualifizierter B-Plan regelt abschließend die Zulässigkeit von Vorhaben. Zulässig ist, was den Festsetzungen nicht widerspricht.
Weitere Voraussetzung: Sicherung der Erschließung (Funktionsfähigkeit, Dauerhaftigkeit)Straßen- und Wegenetz, Abwasser, Wasser und Elektrizität
Insbesondere: § 15 BauNVO
Gebot der Rücksichtnahme , planerische Festsetzungen können nicht jeden Nutzungskonflikt im vorhinein antizipieren und ausschließenim Einzelfall könenn daher an sich zulässige Anlöag en unzulässig sein, wenn von ihnenn unzumutbare, bodenrechtlich erhebl iche Belästigunegn oder Störungen ausgehen oder sie selb st solchen Störungen ausgesetzt wären
Vorhabenbezogener B-Plan
25
§ 30 Abs. 2 BauGB
Einfacher B-Plan
§ 30 Abs. 3 BauGB nur soweit seine Festsetzungen reichen → § 34 BauGB
Ausnahmen und Befreiungen
§ 31 BauGB: Möglichkeit der Abweichung im Einzelfall
Ausnahmen , muss im B-Plan ausdrücklich vorgesehen sein, planimmanentes Institutist schon in §§ 2 bis 9 BauNVO vorgesehen -> Lesen!Entspricht damit der planerischen EntscheidungGrenze: Ausnahme darf nicht zur Regel werdenErmessen der Zulassungsbehörde, § 36 BauiB beachten!Befreiungen, planexterne Einrichtung, Herstellung von Einzelfallgerechtigkeit, Bewältigung von Sondersituationen, Verhältnismäßigkeit
Einklang mit Grundzügen der Planung, → Rückgriff auf konkrete Planungssituation; je tiefer die Befreiung geht, um so mehr ist die Planung berührt; je mehr Befreiungen erteilt werden, um so mehr spricht dafür das die Planung angepasst werden muss (B-Plan bedeutungslos?)Befreiung muss mit öffentlichen Belangen vereinbar seinnachbarliche Belange müssen berücksichtigt werden
Außerdem muss einert der Gründe des § 31 Abs. 2 BauGB erfüllt sein:Allgemeinwohl, städtebauliche Vertretbarkeit, nicht beabsichtigte Härte
Im Aufstellung befindlicher Plan
§ 33 BauGB: schon im Vorfeld eines in Aufstellung befindlichen PlansProblem: Bindung im Vorfeld der Gültigkeit einer Normdaher muss schon eine Verfestigung eingetreten seinGenehmigungsfähigkeit: formelle Planreife – matwerielle Planreife
Vorhaben im unbeplanten Innenbereich
§ 34 BauGB; Bauliche Nutzung ist im Innenbereich gewünscht und soll nicht von Planung abhängig sein „Planersatz“erhebliche praktische Bedeutung - 1998 wurden 30% der Baugenehmigungen auf dieer Grundlage erteilt
Voraussetzungen Nicht beplanter Innenbereich, im Zusammenhang bebauter Ortsteil, gfs. plus einfacher B-Plan
26
Das Vorhaben muss sich einfügen in die Eigenart der näheren Umgebung. § 34 Abs. 2 BauGB –> BauNVO faktisches Baugebiet. Das ist vorrangig zu prüfen.
Der Innenbereich ist ein im Zusammenhang bebauter Ortsteil. Es muss ein Bebauungszusammenhang bestehen. - tatsächlich aufeinanderfolgende Bebauung. Es wird nur die prägende Bebauung beachtet. Optish wahrnehmbare Gebäude mit gewissem Gewicht. Die gebäude müssen dem ständigen Aufenthalt von Menschen dienen.
Problem: große Freiflächen, Baulücken, AußenbereichsinselGibt es den Eindruck der Geschlossenheit? Zusammengehörigkeit und ist das Vorhabensgrundstück ion diesem Bereich?Maßgeblich ist die Verkehrsauffassung. Umfassende Bewertung ders Einzelfalls.In Ortsrandlagen muss ermittelt werden, wo konkret der Bebauunsgzusammenhang aufhört.
Ortsteil: jeder Bebauungskomplex, der nach der Zahl der vorhandenen Gebäude ein gewisses Gewicht besitzt und Ausdruck einer organischen Siedliungsstruktur ist.
Gemeinde kann Satzungen erlassen, § 34 Abs. 4 BauGB
Zulässigkeitsvoraussetzungen nach § 34 BauGB
§ 34 Abs.1 BauGB: • Prägung durch die nähere Umgebung, Auswirkung auf die nähere Umgebung, Beeinflusst die Umgebung das Vorhaben?• Eigenart der baulichen Nutzung,• fügt es sich ein? Bleibt es in dem rahmen der Umgebung? • Erschließung muss gesichert sein
Art. 34 Abs. 2 BauGB: spezieller als Abs. 1, Prüfung ob ein gebiet nach der BauNVO vorliegt, dann so wird dort vorgesehen
Vorhaben im Außenbereich
§ 35 BauGBDer Außenbereich wird negativ abgegrenzt. Er liegt weder im beplanten noch im unbeplanten Innenbereich. Der Außenbereich soll grundsätzlich nicht bebaut werden. Ausnahme: privilegierte Vorhaben. Land-, Forstwirtschaft, Erholung.
Abs. 1 enthält privilegierte Vorhaben.
27
Abs. 2 Zulässigkeit sonstiger Vorhaben, stark begrenzt.Abs. 3 enthält Kriterien für die Zulassung.Abs. 4 Bestandssschutz
Privilegierte Vorhaben§ 35 Abs. 1 BauGB das sind zum einen Nutzungen, die im Außenbereich nicht stören – Bsp. Forstwirtschaftoder an bestimmte Flächen im Außenbereich gebunden sindoder nur dort sein können – Bsp. Kernenergie
Wegen der Spannungen, die die Vorhaben im Innenbereich auslösen würden, werden sie im Außenbereich verwirklcicht. Aber auch dort ist eine strenge Planung notwendig.
Privilegierungstatbestände in § 35 Abs. 1 BauGB – Lesen!
Es dürfen keine öffentlichen Belange entgegenstehen, § 35 Abs. 2 BauGB. Hier ist eine nachvollziehbare Abwägung erforderlich.
Nach Abs. 2 gibt es auch sonstige Vorhaben, die im Außenbereich verwirklicht werden können. Strengere Vorasusetzungen. Eine Beeinträchtigung liegt immer dann vor, wenn der Belang durch das Vorhaben negativ berührt wird. Auch hier ist dann eine Abwägung nötig. Für die Realisierung müssen überwiegende Belange vorliegen – gesetzgeberische Entscheidung grds. für Freihalten.
Öffentliche Belange in § 35 Abs. 3 BauGB benannt. Keine abschleißende Liste.
Aus § 35 Abs. 3 Nr. 1 BauGB ergibt sich, dass auch im Außenbereich geplant werden kann.
Der fehlerhafte Bebauungsplan
Verfahrensfehler nach § 214 BauGB
Im Unterschied zu anderen Rechtsnormen führt nicht jeder fehler zur Nichtigkeit. Es gibt auch einen rechtswidrigen, aber dennoch wirksamen B-Plan. Im Einzelnen: § 214 BauGB.Pflicht zur Rüge, Ablauf der Frist
Kommunalrechtliche Fehler
Das verfahren im gemenderat wird durch die gemeindeordnung gereglet –SächsGemO. Auch hier führen fehler nicht zwingend zur Ncihtigkeuit - § 4 SächsGemO.
Materiell-rechtliche Fehler
Auch hier enthält § 214 Abs. 2 und 3 BauGB Vorschriften.
28