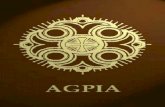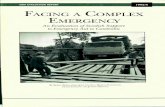Facing the 'sacred Coptic text': the pre-Coptic Egyptians as lexicographers
Transcript of Facing the 'sacred Coptic text': the pre-Coptic Egyptians as lexicographers
Das Ägyptische und die Sprachen ..., AOAT 3 10, S. 509-52 1
Der Einfluß des Griechischen auf das Ägyptische in ptolemäisch-römischer Zeit
Frank Feder, Berlin
Wohl keine Sprache, auch keine semitische Sprache, hatte einen so nachhaltigen Einfluß auf das Ägyptische wie das Griechische in der spätesten Phase der Sprachentwicklung des Ägyptischen, die man gemeinhin mit den Begriffen Demotisch und Koptisch beschreibt, womit sowohl das Schriftsystem als auch die Sprache gemeint sind. Das ist jedoch nicht ganz korrekt, denn ein in demotischer Schrift abgefaßter Text konnte ebenso dazu verwendet werden, „klassisches" Ägyptisch (~ittelä~yptisch)' wiederzugeben, wie auch ein mit grie- chischen Buchstaben geschriebener Text, der für die nicht im Griechi- schen vorhandenen Phoneme demotische einsetzt, also nach landläufi- ger Definition in koptischer oder altkoptischer Schrift gehalten ist.2 Ja auch ein in Hieroglyphen oder Hieratisch geschriebener Text kann in „demotischer" Sprache verfaßt sein.3 Die Dominanz des Griechischen in Politik und Wirtschaft, schließlich im Rechtswesen Ägyptens unter den ptolemäischen und römisch- byzantinischen Herrschern und die mit ihm transportierte und ent- wickelte hellenistische Kultur haben das Ägyptische bis weit in die arabische Zeit mit wachsender Intensität geprägt. So sehr, daß das alte Ägypten die radikalste Veränderung in seiner Geschichte erlebte, in- dem es seine über 3000 Jahre tradierte Religion und sein Schriftsy- stem (die Hieroglyphen und ihre kursiven Abwandlungen Hieratisch und Demotisch) scheinbar ohne jede Erinnerung zu Gunsten des Chri- stentums und einer auf dem griechischen Alphabet basierenden Al- phabetschrift mit 7 Phonemen aus der demotischen Schrift für immer
' Vgl. Smith, Version, 115-149; Smith, Catalogue. Vgl. Osing, Papyrus BM 10808. ' Vgl. Shisha-Halevy, Papyrus Vandier; Quack, Monumental-Demotisch, 107- 121.
510 Frank Feder
aufgab. Das so entstandene, sogenannte Koptische konnte die zuvor immer vorhandene Diskrepanz zwischen dem Schriftsystem und der gesprochenen Sprache im Wesentlichen aufheben. Das Griechische hat neben dem Koptischen sogar bis heute als Liturgiesprache der christlichen arabischsprachigen Bevölkerung Ägyptens überlebt - d.h. es hat selbst das Aussterben der alten ägyptischen Sprache überdauert.
1. Der Prolog - Griechen und Griechisch vor Alexander Wenn auch Ägypten noch kein Hauptziel griechischer Koloniegrün- dung zu Zeiten der sogenannten ,Großen Griechischen Kolonisation' im 8. und 7. Jh. V. Chr. gewesen ist, so müssen dennoch verstärkte Kontakte mit Griechen und Griechisch für Ägypten unvermeidbar gewesen sein. Die erfolgreiche Besiedlung der Ägypten sehr nahe gelegenen Kyrenaika in jener Zeit und die politische Bedeutung, die diese Kolonie in Folge gewann, mag Indiz genug dafür sein. Die 26. Dynastie stellt in jeder Hinsicht eine Landmarke für die Prä- senz von Griechen in Ägypten dar. Sie etabliert feste Beziehungen zu den griechischen Staaten und griechische Kaufleute und Söldner set- zen sich zunächst im Delta fest. Unvermeidlicherweise mußte, wer Handel im östlichen Mittelmeer treiben wollte und wer die Politik und die Machtverhältnisse im Vorderen Orient mitbestimmen wollte, sich mit den Griechen auf die eine oder andere Weise engagieren. Und die 26. Dynastie hatte diese Ambitionen. Psamrnetich I. (664-610) kann sich auf ionische und karische Söldner des Königs Gyges von Lydien bei der endgültigen Einigung Ägyptens stützen. Unter diesem Herr- scher wird die milesische Kolonie Naukratis ihren Anfang genommen haben. Necho 11. (610-595) versucht, sich in die große Politik einzu- mischen und die Vernichtung des Assyrerreiches aufzuhalten. Er läßt eine Flotte aus Dreiruderem nach griechischem Vorbild ausrüsten. Seine nicht zum geringen Teil aus griechischen Söldnern bestehenden Truppen erringen für kurze Zeit noch einmal die Oberhoheit über Pa- lästina, Phönizien und Syrien bis zu Euphrat. Am Ende kann Necho 11. nur noch Ägypten gegen Nebukadnezar von Babylon halten. Der Feldzug Psammetichs 11. (595-589) gegen Napata, den die Generale Amasis und Potasimto mit einem Heere von Söldnern führen, ist wohl Verursacher des Graffitos von Abu Simbel, das als erste Schreibung eines ägyptischen Namens mit griechischen Buchstaben - eben Ho-
Der Einjiuß des Griechischen auf das Ägyptische 5 1 1
zaoipzo - von Ägyptologen gefeiert wurde.4 Seine Datierung in das Jahr 589 V. Chr. ist wohl beeindruckend, allerdings ist der Ort seiner Anbringung und seine Isoliertheit für die Geschichte von Griechisch in Ägypten belanglos - und man spreche mir bitte nicht von der ,,Ur- geschichte" der koptischen Schrift. Unter Apries (589-570) wissen wir schon von einer aufständischen griechischen Militärkolonie auf Ele- phantine, die von der in aramäischen Papyri gut bezeugten jüdischen Garnison ersetzt wurde. Mit Amasis (570-526), dem schon genannten General, erreichen die Beziehungen zu Griechenland und der Einfluß der Griechen in Ägypten, trotz verschiedener Widerstände, einen er- sten Höhepunkt. Auch den griechischen Söldnern verdankt er wohl seine Erhebung zum Herrscher gegen den amtierenden Apries und gegen jede ägyptische Tradition, eine Vorwegnahme der Verfahrens- weise zur Zeit der römischen „Soldatenkaiser" des 2. Jh. Amasis gibt Naukratis einen festen Status und die Privilegien einer Polis, er stiftet griechischen Tempeln (Lindos, Samos) und ist Polykrates von Samos freundschaftlich verbunden. So haben wir allen Grund, anzunehmen, daß Griechisch seit dem spä- ten 7. und dem 6. Jh. V. Chr. in Ägypten nicht nur gehört, sondern auch gesprochen und verstanden wurde. Da uns nur schriftliche Do- kumente darüber Auskunft geben können, dürfen wir froh sein, die Berichte der griechischen Historiker und Reisenden, Herodot, Thuky- dides und Diodor zur Verfügung zu haben. Jedoch berichten sie, wohl oft aus zweiter Hand, über eine nicht erlebte Vergangenheit. Die ägyptischen Quellen dieser Zeit, dem Traditionalismus und der Onen- tierung auf als groß empfundene, aber längst dahingegangene Epo- chen verpflichtet, lassen uns im Stich. Der unaufhaltsame Aufstieg des Perserreiches erreicht 525 V. Chr. Ägypten. Die persische Administration führt das in Ägypten sicher auch schon zuvor hier und da im Lande geläufige Aramäische in der höheren Verwaltung des Landes ein. Im Wesentlichen stützt man sich aber seit Dareios I. (521-486) auf die etablierte ägyptische Verwal- tung. Es ist schwer zu sagen, ob Griechen und Griechisch in dieser Zeit zurückgedrängt wurden, wenn dann nicht für lange Zeit. Die grie- chischen Siege bei Marathon (490) und Salamis (480) und die Ver- nichtung der persischen Flotte bei Mykale in der Nähe von Milet (479) ermutigten Ägypten zu mehrfachen Erhebungen. Die bedeu- tendste unter Inaros - sein Andenken lebt in der demotischen Literatur
Vgl. Quaegebeur, Ecriture, 129.
512 Frank Feder
später weiter - wurde 459-454 durch ein Athenisches Expeditions- Corps unterstützt. Der Frieden Athens mit dem Großkönig (449 V. Chr.) beruhigte die Lage für einige Zeit. In dieser Zeit war es, als He- rodot Ägypten bereiste. Da er des Ägyptischen nicht mächtig war, aber die Ägypter, wie er immer wieder in seinem zweiten Buche be- tont, ihm vieles von dem, was er niederschrieb, erzählt hatten, müssen Ägypter mit ihm in Griechisch gesprochen haben. Mag sein, daß eini- ge davon in Ägypten ansässige Griechen waren. Das ändert nichts an der Tatsache, daß in Ägypten Griechisch gesprochen und verstanden wurde. Die Befreiung von der persischen Herrschaft soll einem Amyrtaios 404 V. Chr., wohl zunächst nur im Delta, gelungen sein. Wohl erst 401, als Artaxerxes 11. alle verfügbaren Truppen zum Kampfe gegen die 13000 griechischen Söldner seines Bruders Kyros nach Mesopo- tamien abziehen mußte, konnte der Rest des Landes nach und nach zurückgewonnen werden. Persien waren durch inneren Zwist und den Krieg gegen Sparta die Hände gebunden. Ein König der 29. Dynastie, Achoris, wehrt einen weitem persischen Angriff (385-383) mit Hilfe eines griechischen Söldnerheeres erfolgreich ab. Für die Bezahlung der Söldner soll er die ersten ägyptischen Münzen haben prägen las- sen. Die 30. Dynastie (380-342) führt Ägypten zu einem letzten pha- raonischen Höhepunkt. Dennoch ist das einzige griechische Wort, das sich in demotischen Urkunden vor Alexander findet (schon 364 V. ~hr.)' , ozazip, also Geld, aus dieser Zeit. Man brauchte Geld, griechisches Geld, zum Handel mit den Griechen und zur Bezahlung der Söldner.
2. Ägypten unter griechisch-ptolemäischer Herrschaft
Alexanders Statthalter und vor allem sein ehemaliger General Ptole- maios I. (306-283182) und dessen erste Nachfolger als Könige von Ägypten führen in Ägypten eine gut organisierte, straffe Verwaltung ein. Griechisch wird für den hohen und mittleren Verwaltungsdienst obligatorisch. Wollte ein Ägypter dorthin aufsteigen, mußte er Grie- chisch beherrschen. Die Korrespondenz mit diesen Ebenen des Staates hatte in Griechisch zu erfolgen. Dies, die aktive Mittelmeerpolitik der Ptolemäer und die Ansiedlung zahlreicher Griechen in Ägypten, nicht nur Militärkolonisten, erfaßte nun mehr und mehr das tägliche Leben
Vgl. Clarysse, Creek Loan-words, 13.
Der EinjluJ des Griechischen auf das Äavptische 513
auch der einfachen ägyptischen Bevölkerung. Es ist im Laufe der Zeit wohl unumgänglich geworden, wenigstens zu einer einfachen Ver- ständigung in Griechisch in der Lage zu sein. Noch durften die Ägyp- ter ihre Rechtsverhältnisse im Prinzip nach ägyptischem Recht regeln und in ägyptischer Sprache niederlegen.6 Nur die unteren Verwal- tungsebenen, wohl vor allem auf dem Lande, blieben in ihrer über- kommenden Struktur bestehen. Wichtige Zentren auch der wirtschaft- lichen Organisation des Landes blieben die ägyptischen Tempel und die elitäre Priesterschaft. Sie waren die direkten Mittler zwischen der griechischen königlichen Administration und den Ägyptern. Sie hatten zudem für die oft bedrückende Fiskalpolitik der königlichen Verwal- tung Unterstützung zu gewähren. Dafür gewährte der König ihnen auch steuerliche Privilegien. Aber auch als Träger des religiösen Le- bens Ägyptens war eine gewogene Priesterschaft eine Stütze der pto- lemäischen Macht. Die Priester, oder zumindest einige von ihnen, mußten folglich Griechisch recht gut beherrschen. Und die Überset- zung des griechischen Textes der sogenannten griechisch-ägyptischen ~~nodaldekrete' ins Ägyptische (Hieroglyphisch und Demotisch) wird wohl von kundigen Priestern geleistet worden sein. An dieser Stelle sollte der Priester Manetho von Sebennytos genannt werden, dessen A i y w z ~ a ~ c i , eine Geschichte Ägyptens in griechischer Sprache, je- doch leider nicht direkt und nicht vollständig überliefert sind. Dieses Werk wurde wohl im Auftrage Ptolemaios I. oder 11. für das Museion von Alexandria geschrieben. Es ist sehr wahrscheinlich, daß auch andere solcher Auftragswerke bzw. Übersetzungen ägyptischer Werke in griechischer Sprache einen Teil der Bibliothek einnahmen. Trotz dieser unübersehbaren Präsenz des Griechischen in nahezu allen Lebensbereichen erhalten wir keinen adäquaten Eindruck davon in den demotischen Texten, hier vor allem natürlich den Urkunden, die ja am ehesten erwarten lassen, daß die Obligation der Administration zum Griechischen hier ihre Spuren in Form von Lehnwörtern hinter- lassen hatte. „The general impression is given that the demotic voca- bula y was remarkably free of greek influence", mußte Willy Clarysse in seiner Studie zu den griechischen Lehnwörtern im ~emotischen' feststellen. Überdies beschränkt sich der nicht sehr umfangreiche Lehnwortschatz in der Regel auf Substantive aus dem ausgesprochen
Vgl. Hoffmann, Ämpten, 69 ff. ' Vgl. Hoffmann, ÄDpten, 153 ff. Clarysse, Creek Loan-words, 12.
514 Frank Feder
offiziellen Griechisch. In erster Linie Beinamen und Titel der ptole- mäischen Könige wie Zoz7ip, E l jdzop oder TpU+ov. Dann, schon relativ früh belegbar, die makedonischen Monatsnamen in offiziellen Dokumenten wie z.B. ' ~ x ~ h h a i o q (Kanopusdela-et 237 V. Chr.) oder ' A p ~ p i o ~ o q (Raphiadekret, 217 v.Chr.). Ableitungen von griechi- schen Eigennamen kommen natürlich auch vor. Überdies wird es schon im 3.Jh. v.Chr. immer schwieriger, anhand von griechischen Namen die ethnische Zugehörigkeit ihrer Träger zu bestimmen. Im- mer mehr Ägypter übernehmen griechische Namen, sei es auch nur als ~ e i n a m e . ~ Wie zu erwarten sind offizielle Titel der ptolemäischen Verwaltung besonders prominent vertreten, gleich neben einer ganzen Reihe ter- mini technici aus der Administration, der Armee und speziell dem Finanzwesen. So erscheinen schon im 3. Jh. V. Chr. die Titel bzw. Amtsbezeichnungen aOho@poq (Priestertitel), kxtp~hqz~jq (Finanz- beamter), fiy~pOv (militärischer Rang), p~oOo@poq (Söldner), npdiczop (eine Art Steuereintreiber), otzohoyoq (Chef der Getreide- speicher) und besonders häufig oi~ou6poc (Finanzbeamter verschie- dener Ressorts). Seit dem 2. Jh. V. Chr. trifft man verstärkt auf den Titel des Oberhauptes eines Nomos, den ozpzqyoc, ursprünglich ein rein militärischer Rang. Unter den besonders verbreiteten Fachbegriffen sind Gavetov (staatl. Vorschuß an Bauern, seit dem 2. Jh. V. Chr.), 6iaypaQ7i (Zahlungs- anweisung, Gutschrift, seit dem 2. Jh. V. Chr.), o6pßohov (Quittung, seit dem 2. Jh. V. Chr.) und vor allem o6vcactq (staatl. Einkommen von Beamten und ~riestern)." Wie wir sehen, handelt es sich hier um den Kern der höheren Verwaltungsebene. Diese Begriffe können nicht ohne Weiteres als Zeichen für eine reiche Entlehnung griechischen Wortschatzes gelten, da sie wohl kaum Auskunft über den alltäglichen Sprachgebrauch der Ägypter geben. Natürlich kommen weitere Begriffe dieser Art im Laufe der Zeit hinzu und auch das eine oder andere eher alltägliche Wort verirrt sich - erst ab dem 2. Jh. V. Chr. - in demotische Texte, wie z.B. ~ o i z o v (Schlaf- zimmer), nivac (Schreibtafel) oder ozabtov (Längenmaß). Die Ursa- che dessen dürfte die Abneigung demotischer Schreiberschulen, ins- besondere der Tempel, gegen die Alltagssprache, hier ,,bewährter"
Vgl. Hoffmann, ÄQpten, 50. 'O Zu den Einzelheiten vgl. Clarysse, Greek Loan-words, 21-33. Clarysse, Greek
Loan-words, 32-33 fuhrt auch die nicht geringe Zahl von 22 Wörtern auf, bei denen nicht geklärt werden konnte, ob und um welche griechischen Wörter es sich handelt.
Der EinJluP des Griechischen auf das Ägyptische 515
ägyptischer Tradition folgend, gewesen sein. Es gibt eine sich verstär- kende Tendenz zur Übersetzung der griechischen Wörter anstelle der Umschreibung im Demotischen selbst bei den Kulttiteln der ptolemäi- schen (und später römischen) Herrscher, so nti &m statt swtr (Soter), oder hi (der „Messende6') anstelle von otzohoyoc, und sogar ptoeo- gpoc wird umständlich mit rmc' iw=f ip hbs wiedergegeben." Daß die demotische Dokumentation den wahren Einfluß des Griechischen verschleiert, erweisen die Briefe der Militärkolonie Pathyris, in denen weit mehr griechische Lehnwörter auftauchen.12 Insofern trifft die Bemerkung von J. Ray zu, daß die demotischen Texte mit fortschrei- tender Hellenisierung des Landes ja eigentlich nicht wirklich Gqpo- Z L K ~ , die Alltagssprache des Landes wiedergab, sondern eher die ~a0ape6ouoa , die um diesen Anteil ,gereinigte6 Schrift-Sprache, denn selbst demotische Briefe gehorchen scheinbar dieser puristischen stilart.13 Demotische Urkunden erhielten bei ihrer Registrierung ein griechi- sches Datumsvermerk, wie das Beispiel dreier Urkunden aus dem Archiv eines Kaufmanns aus Memphis Hr-m-hi zeigen.14 Und es nicht unwahrscheinlich, daß der Schreiber der demotischen Urkunde auch das griechische Datumsvermerk anfügte: 2 ~ o u c 0 ~ 6 ß t ~0 &vay&ypa(.nzat) Ev T@ ['A]vou(ßteiot) G t ' H p a ~ h e i h u , was dem 14. Februar 108 V. Chr. entspricht. Der Ort der Registrierung war wohl das Anubieion von Saqqara. Ein erstaunliches Zeugnis für die ptolemäische Zeit ist ein Graffito aus dem Tempel Sethos I. in ~ b ~ d o s " , das einen kurzen mit griechischen Buchstaben geschriebenen Text in ägyptischer Sprache enthält. Es erwähnt einen ägyptischen Gegenkönig Hurgonaphor (Hr-wn-nfv), der als Pharao bezeichnet wird. Dieser gehört in die Zeit der oberägypti- schen Aufstände um 200 V. Chr. In diesem Kontext wäre von Interes- se, wer dieses Graffito schrieb, ein Ägypter, wie man wohl annehmen muß, oder ein Grieche? Jedenfalls fand sich im Tempel auch ein grie- chisches Graffito, das eine Belagerung von Abydos erwähnt.16
Clarysse, Greek Loan-words, 12-1 3. IZ Clarysse, Greek Loan-words, 13-14. l 3 Ray, Demotic, 259. l4 Vgl. Pestrnann, Recueil I, Nr. 4-6 mit Anm. 61 zu Nr. 4. l 5 Vgl. Pestmann, Recueil I, Nr.ll; Lacau, Graflito; Clarysse, Notes, 243-253.
Vgl. Pestmann, Recueil 11, 1 1 1 .
516 Frank Feder
3. Ägypten in römischer Zeit (bis zum 4. Jh.)
Die römische Verwaltung führt das römische Recht und ein speziell in Ägypten geltendes Provinzialrecht ein. Griechisch blieb natürlich die Amtssprache und bis auf die Präfekten und die Militärverwaltung benutzte kaum jemand Latein. Obwohl man das bisher in Ägypten übliche Nebeneinander von griechischem bzw. königlichem Recht und ägyptischem Recht zunächst in Kraft ließ, wurde das Rechtswesen immer mehr nach römischer Vorstellung umgestaltet. Urkunden mußten in speziellen Büros geschrieben werden und wurden mit einer Inhaltsangabe in Griechisch chronologisch in Alexandria archiviert. Beweiskraft hatte nur der griechische Text einer Urkunde, auch wenn diese zweisprachig ausgefertigt war." Das demotische Urkundenwe- Sen neigte sich seinem Ende zu. Der hauptsächliche Gebrauch des Demotischen in der öffentlichen Verwaltung beschränkte sich auf Steuerquittungsostraka, die noch in der ersten Hälfte des 1. Jh. zahl- reich auftreten. Sie stabilisieren sich auf niedrigem Niveau, um dann um 235 völlig zu verschwinden." Nach Augustus sind eigentlich de- motische dokumentarische Papyri nur noch aus Tebtynis und Sokno- paiou Nesos im Fayyum bekannt.I9 Steuerrechtlich wurde die Bevölkerung schließlich in privilegiertere Polisbürger (Alexandria, Ptolemais, Naukratis und Antinoupolis) und Aiyd.rcztot eingeteilt, wobei die sprachlich-ethnische Zugehörigkeit der Bevölkerung eigentlich keine Rolle mehr spielte. Eine wirkliche rechtliche Gleichstellung aller Bevölkerungsgruppen stellte auch die Verleihung des Bürgerrechts an alle Freien des Imperiums durch die Constitutio Antoniniana (21 1/12) nicht her. Wenn ein Ägypter Karrie- re machen wollte, mußte er auch weiterhin Griechisch beherrschen. Das Land mit seiner lang vorher angelegten Potenz zur Bilingualität entwickelt diese nun auch in seinen schriftlichen Dokumenten quasi vor unseren Augen. Auch einfache Dokumente können in Griechisch geschrieben sein und erhielten nur eine kurze demotische Subskripti- on, Mumienetiquetten werden zweisprachig.20 Es ist vielleicht etwas zugespitzt, wenn Bagnall meint, „... aper about A.D. 50 there was for most Egyptians only one means of recording things in writing: ~ r e e k . " ~ ' Dennoch stimmt die Tendenz. Im Ganzen, verglichen mit
I' Vgl. Hoffmann, Ägypten, 69-70, 89. I * Vgl. Bagnall, Egypt, 236-237. l9 Vgl. Bagnall, Egypt, 237. *' Vgl. Pestmann, Recueil I, Nr. 13 U. 14 sowie 15-23.
Bagnall, Egypt, 237.
Der Einjluß des Griechischen auf das Ägyptische 517
den produktivsten Phasen demotischen Schrifttums in der Ptolemäer- zeit und noch im 1. Jh., reduziert sich die Zahl demotischer Doku- mente seit dem Ende des 2. Jh. zu einer verschwindend geringen An-
Verschwindet Demotisch auch zusehends aus dem öffentlichen Ge- brauch, so finden es sein Refugium in den Tempeln, in denen die Weitergabe der alten ägyptischen Schriften noch gepflegt wird. Die Blüte der literarischen Texte in Demotisch liegt gerade im 1. und 2. Jh. Diese enthalten, ganz ~ a k p e h u o a , natürlich keine griechischen Lehnwörter. Doch deren Schreiber sind wenige und werden weniger. Dennoch benötigten auch sie zur Abwicklung ihrer wirtschafilichen und rechtlichen Angelegenheiten Griechischkenntnisse. Hierüber kann uns das mehr und mehr ins Licht tretende Archiv des Lebenshauses (?) des Tempels von Tebtynis (1 .-2. Jh.) Auskunft geben.23 Während die hieroglyphischen, hieratischen und die auch die Masse des Materi- als ausmachenden demotischen Papyri Kompendia priesterlicher Ge- lehrsamkeit und Literaturpflege überliefern, scheint der alltägliche wirtschaftliche Schriftverkehr der Priester - Abrechnungen, Steuerre- gister des Tempels, amtliche Schreiben, Privatverträge der Priester (Pacht, Verkauf, Geld-Darlehen) - in Griechisch abgewickelt worden zu sein. Aber auch wissenschaftliche Handbücher in Griechisch (me- dizinische Rezepte, Pflanzenkunde und astrologische Texte) wurden von den Priestern benutzt. Last but not least fand sich auch ein Papy- rus mit einem Auszug aus Homers Illias (3,225-30). Auch in der Aus- bildung der Schreiber in den Tempeln gehörte bald wohl Griechisch zum Standardrepertoire. Die in jeder Hinsicht instruktiven Ostraka aus dem Tempel von Narmuthis (Medinet Maadi), die zum größten Teil Schultexte enthielten, zeigen nun auch in demotischen Texten den reichen Anteil griechischer Lehnwörter und eine Sprache, die man am ehesten durch das Koptische verstehen kann.24 Beispielsweise stehen im OMM 1156 (2. ~ h . ) ~ ' die Lehnwörter potpoloyo~ und ~povo- ~ & z o p . Diese führen uns eindeutig zu den magisch-astrologischen Texten, wohl eines der letzten Wirkungsfelder des Demotischen au- ßerhalb der Tempel.
22 Vgl. die Graphik bei Hoffmann, Ägypten, 26. 23 Vgl. Tait, Papyri, 93-1 1 1 ; Osing, Hieratische Papyri, 20. 24 Vgl. Ray, Demotic, 257-258. 25 Vgl. Hoffmann, Ägypten, 45-47.
5 18 Frank Feder
Gerade das magisch-astrologische Metier ist aber der Gegenstand der sogenannten ,,altkoptischen ~ e x t e " ~ ~ , die vom 1 .-4.15. Jh. datieren. Sie sind jedoch mit griechischen Buchstaben geschrieben und für die ägyptischen Phoneme treten demotische Grapheme ein. Doch geben sie weder einheitlich die aktuelle (koptische) Sprachstufe wieder (2.B. Pap. BM 10080 einen Text in ,,klassischer Sprache") noch verwenden sie ein einheitliches und standardisiertes Alphabet wie das Koptische. Bezeichnend für ihren Charakter ist das Fehlen jeglicher griechischer Lehnwörter. In ihrem Falle sollte man folglich nicht von koptischen Texten sprechen, da sie den zuweilen zeitgleichen koptischen Texten größtenteils weder sprachlich noch wirklich vom Schriftsystem her entsprechen. Auch wenn diese Texte sicherlich nicht die besten Zeu- gen für die Übernahme des griechischen Alphabetes zur Wiedergabe der zeitgenössischen ägyptischen Sprache sind, so sind sie dennoch ein Beleg für das zunehmende Bemühen darum. Ein Faktum sollte man in diesem Zusammenhang herausheben. Die, wie ich glaube, wohl gänzlich aus dem Bereich der priesterlichen Wissenschaft stammende Glossierung demotischer, aber auch hierati- scher Texte (z.B. Tebtynis) mit in griechischen Buchstaben + demoti- sche Zusatzzeichen geschriebenen Randbemerkungen, die offensicht- lich die Lautung fixieren sollten, sind in gewissem Maße Vorarbeiten für die ersten Auseinandersetzungen der ägyptischen Christen mit griechischen Bibeltexten. So sind die „altkoptischen" Glossen des demotischen magischen Papyrus ~ondon-~eiden~ ' praktisch zeitgleich (3. Jh.) mit den koptischen Glossen in den griechischen Bibelhand- schrifien von Hosea und ~ m o s . ~ ~ Somit stehen auch die bisher bekannt gewordenen, soweit man sehen kann sehr qualitätvollen griechischen Übersetzungen ägyptisch- demotischer Literaturwerke in einem neuen Lichte. Ich möchte hier nur die griechische Version des sog. ,Mythos vom Sonnenauge' des Pap. BM 274 (3. Jh.), schon wegen des Umfangs des erhaltenen Tex- tes, als Exempel hera~sheben.~~ Nach ersten Anfangen im 3. Jh. tritt uns das Koptische mit aller Macht nun im 4. Jh. in den zahlreichen
26 Vgl. hierzu: Quaegebeur, Ecriture, 125- 136 und Satzinger, Texte, 137- 146. '' Gri ffith/Thompson, Magical Papyrus.
Bell/Thompson, Glossary, 241 -246. Vgl. auch Nagel, Bilinguen, 23 1-257. 29 West, Tefnut, 161-183. Weitere Übersetzungen liegen z.B. im Pap. Oxy. 1380
(1. Jh. Isislitanei), 1381 (vso. zu 1380; Leben des Imhotep/Imouthes) vor; vgl. ansonsten Thissen, Gräco-ägyptische Literafur. Jüngst fand Kim Ryholt auch ein Fragment einer demotischen Version vom „Traum des Nektanebos" - eine Geschichte, die bisher nur griechisch bekannt war (Ryholt, Demofic Version).
Der Einjluß des Griechischen auf das Ägyptische 519
Bibelübersetzungen aus dem Griechischen vor Augen. Die Qualität und die Menge der Bibelübersetzungen, die praktisch ex nihilo er- scheinen, setzen geübte Übersetzer mit einer gewissen Tradition vor- aus. Der Übertritt zum Christentum, der im 3. Jh. immer weiter um sich griff, schloß wohl auch den einen oder anderen gelehrten Priester ein, der natürlich Griechisch bestens beherrschte und sich im Überset- zen auch literarischer Werke geübt hatte. Unter diesen gab es wohl schon eine lange Tradition von Übersetzern, man denke nur an Ma- netho. Das machte natürlich die Lage der in den Tempeln verbliebe- nen ,,Traditionalisten" noch prekärer - trotzig ,,demotiertea man dem Untergang entgegen. Vielleicht haben wir mit dem bekannten Chairemon aus dem 1. Jh., der an Neros Hof Furore gemacht haben soll, ein solches frühes Ex- emplar eines vollständig zweisprachigen Ägypters vor uns, den Peter Willem van der Horst Egyptian Priest und Stoic Philosopher nannte.30 Solche gelehrten Ägypter hielt es wohl kaum in der Geborgenheit und Weltabgeschiedenheit der Tempel. Für diejenigen, die lieber in Refu- gia wirkten, gab es ja dann, als heidnische Tempel verboten waren, zahlreiche Klöster und die ganze Wüste, um in sich zu gehen und sich ganz den Schriften hingeben zu können. Abschließend sei mit den Worten Bagnalls eine, wie ich finde, tref- fende Beschreibung des Platzes, den das Griechische am Übergang zur koptischen Epoche einnahm, gegeben: ,,In short, in the time of Diokletian und Constantine as for many years before, literacy required knowing Greek und, for anyone who spoke Egyptian, implied bilingualism."31
'O Van der Horst, Chaeremon. 3 1 Bagnall, Egypt, 241.
Frank Feder
Bibliographie
Bagnall, R. S., Egypt in Late Antiquity, Princeton 1993. Beckerath, J. von, Chronologie des pharaonischen Ägyptens, MÄS 46 (1 997). Bell, H. 1.1 Thompson, H., A Coptic Glossary to Hosea und Amos, JEA 11 (1925),
24 1-246. Bresciani, E., Pernigotti S., Betrb M. C., Ostraca demotici da Narmuti I. (Quaderni di
Medinet Madi I). Pisa 1983. Clarysse, W., The Eponymous Priests of Ptolemaic Egypt, Leiden 1983 (Papyrologica
Lugduno-Batava 24). Clarysse, W., Greek Loan-words in Demotic, in: Aspects of Demotic Lexicographie
(ed. S.P. Vleeming). Studia Demotica 1 (1987), 9-33. Clarysse, W., Notes de prosopographie thkbaine, CdE 53 (1 978), 226-253 Gallo, P., Ostraca demotici e hieratlci dall' archivo bilingue di Narmouthis 11, Pisa
1997. Graeco-Coptica, Griechen und Kopten im byzantinischen Äavpten, hg. von P. Nagel,
Wissenschaftliche Beiträge der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg 1984148.
Griffith, F. LI./ Thompson, H., The Demotic Magical Papyrus of London und Leiden 1-111, London 1904,1905, Oxford 1921.
Hoffmann, F., Ägypten - Kultur und Lebenswelt in griechisch-römischer Zeit. Eine Darstellung nach den demotischen Quellen. Studienbücher Geschichte und Kultur der Alten Welt, Berlin 2000.
Hölbl, G., Geschichte des Ptolemäerreiches, Darmstadt 1994. Hornung, E., Grundzüge der ägyptischen Geschichte, Darmstadt 1978. Kienitz, F. K., Die politische Geschichte Ägyptens vom 7. zum 4. Jahrhundert vor der
Zeitwende, Berlin 1953. Lacau, P., Un graflto kgyptien d'Abydos kcrit en lettres grecques, Btpap 2 (1933-34),
229-46. Nagel, P., Griechisch-Koptische Bilinguen des Alten Testamentes, in: Graeco-Coptica,
23 1-257. Osing, J., Der spätägyptische Papyrus BM 10808, ÄA 33 (1976). Osing, J., Hieratische Papyri aus Tebtunis, The Carlsberg Papyri 2 (CNI Publ. 17),
Copenhagen 1998 Pestmann, P. W. avec la collaboration de J. Quaegebeur et R. L. Vos, Recueil de
Textes Dkmotiques etBilingues I-III, Leiden 1 977. Preaux, CI., Les Grecs en Egypte d'apres les archives de Zknon, Bruxelles 1947. Quack, J. F., Das Monumental-Demotische, in: Per aspera ad astra (Festschrift Schen-
kel), Kassel 1995, 107-121. Quaegebeur, J., De la Prihistoire de I '~cri ture Copte, OLP 13 (1 982), 125-136. Ray, J. D., How demotic is Demotic?, EVO 17 (1 994), 25 1-264. Ryholt, K., A Demotic Version of Nectanebos' Dream (P. Carlsberg 562), ZPE 122
(1998), 197-200. Satzinger, H., Die altkoptischen Texte als Zeugnis der Beziehungen zwischen Ägyp-
tern und Griechen, in: Graeco-Coptica, 137-146. Shisha-Halevy, A., Papyrus Vandier Recto, an early Demotic literary text?, JAOS
109 (1989). S. 421-435 , ,, Smith, M., A new Version of a Well-Known Egyptian Hymn, Enchoria 7 (1977), 11 5-
149. Smith, M., Catalogue of Demotic Papyri in the British Museum 111: The Mortuary
Texts of Papyrus BM 10507, London 1987. Tait, W. J., Papyri from Tebtunis in Egyptian an Greek, London 1977.
Der Einfluß des Griechischen auf das Ägyptische 52 1
Thissen, H.-J., Art. Gräco-ägyptische Literatur, in LÄ 11,873-878. van der Horst, P. W., Chaeremon - Egyptian Priest und Stoic Philosopher, Leiden
1984 Verhoogt, A. M. F. W. und Vleeming, S. P. eds., The Two Faces ofCraeco-Roman
Egypt. Greek und Demotic und Creek-Demotic Texts und Studies presented to P. W. Pestman, Leiden/Boston/Köln 1998 (Papyrologica Lugduno-Batava 30).
West, St., The Greek Version of the Legend of Tefnut, JEA 55 ( 1 969), 161 - 183.
















![Recent Progress in Coptic Codicology and Paleography (1988–1992) [1993]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6330791d5d634a4a44079ad1/recent-progress-in-coptic-codicology-and-paleography-19881992-1993.jpg)