Die Sicherung der ethnischen Ordnung: das Wandbild eines eigenartigen nubischen Streitwagens im Grab...
-
Upload
kalkriese-varusschlacht -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Die Sicherung der ethnischen Ordnung: das Wandbild eines eigenartigen nubischen Streitwagens im Grab...
© Koninklijke Brill NV, Leiden, 2013 DOI: 10.1163/18741665-12340006
Journal of Egyptian History 6 (2013) 131–151 brill.com/jeh
Die Sicherung der ethnischen Ordnung: Das Wandbild eines eigenartigen nubischen Streitwagens im Grab
des Huy, Vizekönig von Kusch (Neues Reich)*
Preservation of the Ethnic Order: A Painting of a Curious Nubian Chariot in the Tomb of Huy,
Viceroy of Kush (New Kingdom)
Stefan BurmeisterMuseum und Park Kalkriese
ZusammenfassungIn dem Grab des Huy (TT 40) befindet sich eine Bildszene, die bislang zwar viel beachtet und kommentiert, jedoch nicht eingehend analysiert wurde. Im Gefolge von Hekanefer, des Fürsten von Miam, befindet sich ein Streitwagen, der von einer Frau gefahren und von Ochsen gezogen wird. Beides widerspricht dem in Ägypten üblichen Gebrauch dieses elitären Fahrzeugs. Es wird der Frage nachgegangen, ob es sich hierbei um die reale Darstellung einer nubischen Streitwagen-nutzung oder um eine propagandistisch verzerrte Fremdvölkerdarstellung handelt. Diese Szene wird aus verschiedenen Blickwinkeln untersucht: 1) der Streitwagentechnologie; 2) der Perspek-tive des ägyptischen Grabherrn Huy; 3) der Perspektive des nubischen Fürsten Hekanefer. Eine detaillierte Analyse der Bildszene zeigt, dass sie höchstwahrscheinlich einen realen Aufzug abbil-det; hierbei handelt es sich jedoch eindeutig um eine absichtsvolle Inszenierung von ägyptischer Seite, mit dem Ziel eine verkehrte Welt darzustellen und die ethnische Ordnung, die durch die ägyptisierte Oberschicht der Nubier ins Wanken gerät, aus ägyptischer Sicht wiederherzustellen.
AbstractIn the tomb of Huy (TT 40) is a mural which received much attention and was often commented, but however was not yet analyzed in detail. Amongst the retinue of Hekanefer, prince of Miam, is
* Den Hinweis auf diese Streitwagenszene bei Lepsius verdanke ich Eva Rosenstock (Berlin). Sie gab damit den Anlass, mich intensiver mit der Darstellung zu beschäftigen. Ebenfalls zu gro-ßem Dank verpflichtet bin ich Martin Fitzenreiter (Münster und Bonn), der mich vor allzu gro-ßen Fehlern bei der Interpretation ägyptischer Bildwerke bewahrte. Wichtige Impulse bei der Bewertung der Schirrung und Zäumung verdanke ich Ute Dietz (Frankfurt/Main). André J. Veldmeijer (Leiden), Katalin Kóthay (Budapest) und Melanie Augstein (Leipzig) danke ich für die Versorgung mit Literatur, den beiden anonymen Gutachtern für wertvolle Hinweise und Inspirationen.
132 S. Burmeister / Journal of Egyptian History 6 (2013) 131–151
a chariot, driven by a woman and drawn by a team of oxen. Both contradict the common use of this elite vehicle in Egypt. It is debated, if we here see a real depiction of Nubian chariot use or if it represents a propagandistically distorted depiction of a foreign people. The scene is analyzed from different angles: 1) chariot technology; 2) the perspective of the Egyptian viceroy of Kush Huy; 3) the perspective of the Nubian prince Hekanefer. A detailed analysis of the mural shows, that most likely it represents a real parade. What we see is an intentional production to portray world upside down and from the Egyptian point of view to re-establish the ethnic order which begin to sway due to the egyptized Nubian elite.
KeywordsAuf Deutsch: Propaganda; Fremdvölkerdarstellung; Barbarentopos; Neues Reich; Kusch; Huy; Hekanefer; Streitwagen
In English: Propaganda; depictions of foreigners; Barbarian topos; New Kingdom; Kush; Huy; Hekanefer; chariot
* * * *
Aus der Regierungszeit des Tutenchamun (1347–1338 v. Chr.) stammt das reich verzierte Grab des Amenhotep, genannt Huy. Dieses ist aufgrund einer viel beachteten Darstellung eines Streitwagens (Abb. 1) hier von besonderem Inter-esse. Der Wagen sticht in mehrfacher Hinsicht aus den ägyptischen Darstel-lungen von Streitwagen heraus. Seine wesentlichen Merkmale sind: 1) dass er von einer Frau gefahren wird; 2) dass das Zugtiergespann aus zwei Ochsen besteht. Das Gespann ist Teil einer nubischen Delegation, die unter Führung des nubischen Prinzen Hekanefer dem Huy huldigt und diesem Tribute über-bringt. Die Szene gehört zu den klassischen Tributszenen, wie sie vielfach in der ägyptischen Grabmalerei dargestellt sind.1
Das Grab von Huy wurde u. a. mit dieser Szene bereits von Lepsius auf sei-ner ersten Ägyptenreise (1842–1845) aufgenommen und von Erich Weiden-bach kopiert;2 eine Beschreibung posthum veröffentlicht.3 Eine umfassende Vorlage des Grabbefundes und der einzelnen Bildszenen und Inschriften erfolgte später durch Nina de Garis Davies und Alan H. Gardiner.4 Die Bildauf-nahme durch de Garis Davies ist gegenüber den kolorierten Zeichnungen von Weidenbach deutlich akkurater und detaillierter;5 sie bilden hier auch die
1 Hallmann, Tributszenen des Neuen Reiches.2 LD Plates VI, Abt. 3, Bl. 117.3 LD Text III, 301–06.4 Davies und Gardiner, Tomb of Huy.5 Siehe Davies und Gardiner, Tomb of Huy, 22.—Einige der Grabmalereien wurden photogra-
phisch dokumentiert (Wreszinski, Atlas zur Altaegyptischen Kulturgeschichte 1, Taf. 158–165); auch die Streitwagenszene zeigt hier bereits einige Abweichungen gegenüber Lepsius (siehe Wreszinski, Atlas zur Altaegyptischen Kulturgeschichte 1, Taf. 160 mit Begleittext).
S. Burmeister / Journal of Egyptian History 6 (2013) 131–151 133
Abb. 1 Wandbild im Grab des Huy. Aus LD Plates VI, Abt. 3, Bl. 117.
Referenz für die weitere Diskussion. In seiner Beschreibung der Streitwagen-szene kommentiert Gardiner, dass sie wohl die eigenartigste und pittoreskeste Einzeldarstellung in der gesamten Nekropole von Theben ist.6 Der karikie-rende Charakter und das Burleske der Szene ist seitdem mehrfach betont wor-den.7 Eine eingehende Analyse, die uns das Dargestellte näher bringt, ist jedoch nicht erfolgt.
Ich möchte im Folgenden näher auf die Streitwagenszene eingehen und der Frage nachgehen, ob hier das reale Abbild eines nubischen Fahrzeugs darge-stellt wird oder sie nicht doch eher—wie der erste Augenschein nahelegt—eine propagandistisch verzerrte Fremdvölkerdarstellung repräsentiert, in der die Nubier als kulturelle Barbaren dargestellt werden. Die weitere Betrachtung erfolgt aus drei Perspektiven: 1) der Streitwagentechnologie und -nutzung; 2) der Person des Huy und 3) der Person des Hekanefer.
6 Davies und Gardiner, Tomb of Huy, 24.7 Z. B. Drenkhahn, Darstellung von Negern in Ägypten, 149 f.; Wilkinson, Egyptian Wall Pain-
tings, 45.
134 S. Burmeister / Journal of Egyptian History 6 (2013) 131–151
Der Streitwagen
Bei dem dargestellten Wagen handelt es sich um einen klassischen ägypti-schen Streitwagen (Abb. 2)—einen Wagentyp, der von Mary Littauer und Joost Crouwel als „true chariot“ angesprochen wurde.8 Ikonographie und technische Merkmale, wie etwa die Konstruktionen von Rad und Wagenkasten, weisen die Darstellung als Amarna-zeitlich aus.9 Insofern handelt es sich um einen in der Regierungszeit des Tutenchamun zeittypischen Streitwagen. Die farbige Darstellung des Wagens ist wie nur wenige andere zeitgenössische Bildwerke in zahlreichen technischen Details auffallend explizit und korrekt.
Das sechsspeichige Rad ist in seinen konstruktiven Details dargestellt. Deut-lich zu erkennen ist eine Ummantelung der Speichenenden und die Umfas-sung der Felge; dadurch erhält die Einfassung der Speichen in den Radkranz eine höhere Stabilität. Möglicherweise handelt es sich hierbei um eine Leder-wicklung. Littauer und Crouwel vermuteten eine ähnliche Konstruktion bei
8 Littauer und Crouwel, „Origin of the true chariot“.9 Vgl. Hofmann, Fuhrwesen und Pferdehaltung, 164 ff.
Abb. 2 Der Streitwagen im Gefolge des nubischen Prinzen Hekanefer. Ausschnitt nach Davies und Gardiner, Tomb of Huy, Taf. 28.
S. Burmeister / Journal of Egyptian History 6 (2013) 131–151 135
einem der überlieferten Streitwagen aus dem Grab des Tutenchamun, konn-ten die Annahme aufgrund des Goldüberzugs der Radteile jedoch nicht verifizieren.10 Decker spricht von zangenartigen Fortsätzen der Speichen, die den Radkranz umgreifen.11 Die Felge selbst besteht aus drei ungleich langen Segmenten, deren—sicherlich schräg auslaufende, sich überlappende—Enden umwickelt sind. Auch hier ist an eine Lederumwicklung zu denken, wie sie von den erhaltenen Streitwagen bekannt ist.12 An der Lauffläche der Felge befindet sich ein umlaufend rotes Band, das seine Entsprechung an dem Streit-wagen aus dem Grab von Juja und Tuja findet.13 Das wahrscheinlich nass auf-gebrachte Lederband schützt die Lauffläche des Rades vor Verschleiß und schont die Lederwicklungen der Speichen und Felgensegmente.
Der Wagenkasten des Streitwagens hat seitlich eine halbhohe Verkleidung. Die gesamte Seite der Fahrerkanzel ist mit einer Lederbespannung bezogen; die durch die Verkleidung ausgesparte Öffnung zeichnet sich im Dekor der Lederbespannung ab. Am Einstieg der Fahrkanzel ist eine kleine runde Aus-sparung in der Bespannung freigelassen, die als Handhabe den Einstieg in die Kanzel erleichtert haben wird. Die Lederbespannung ist im Bereich der Seiten-verkleidung mit einem feinen Liniendekor versehen. Eine solche Lederbespan-nung ist durch archäologische Funde kaum belegt; neben einem neu entdeckten Altfund14 konnte bislang nur am Wagen aus dem Grab von Juja und Tuja eine solche Verkleidung nachgewiesen werden.15 Am Wagenkasten hängt entspre-chend der üblichen ikonographischen Konvention eine Waffentasche,16 jedoch ohne Waffen.
Auch die Anschirrung des Zugtiergespanns ist detailliert dargestellt. Die Tiere laufen unter einem Joch, das in seiner Form den bekannten Jochen ande-rer Streitwagendarstellungen bzw. den überlieferten Sachzeugnissen ent-spricht. Abweichend wird hier jedoch die Zugkraft nicht über die Jochgabeln auf das Joch und die Deichsel übertragen, sondern über eine etwa zweihand-breite Auflage. Dessen Position vor dem Joch sowie die Befestigung des Brust- und Bauchgurts legen nahe, dass sie die Funktion der ansonsten gebräuchlichen Jochgabeln erfüllt. Zahlreiche Streitwagenabbildungen sind gerade in diesem Bereich undeutlich ausgeführt. Nicht immer ist zu erkennen, wie das Joch auf den Zugtieren saß; einzelne Abbildungen lassen durchaus an eine ähnliche
10 Littauer und Crouwel, Chariots and related equipment from the tomb of Tutˁankhamūn, 77.11 Decker, „Bemerkungen zur Konstruktion des ägyptischen Rades in der 18. Dynastie“, 484.12 Littauer und Crouwel, Chariots and related equipment from the tomb of Tutˁankhamūn, 77.13 Davis, Tomb of Iouiya and Touiyou, 35.14 Marchant, „Ancient Egyptian chariot trappings rediscovered“.15 Davis, Tomb of Iouiya and Touiyou, 35. Zu Leder für Bau und Nutzung des Streitwagens siehe
Veldmeijer, Amarna’s Leatherwork; Veldmeijer und Ikram, „Lederwaren in el-Amarna“, 135 f.16 Hofmann, Fuhrwesen und Pferdehaltung, 180.
136 S. Burmeister / Journal of Egyptian History 6 (2013) 131–151
Auflage denken,17 wie wir sie hier im Grab des Huy sehen. Möglicherweise ergibt sich die Notwendigkeit der zur Jochgabel abweichenden breiteren Auf-lage aus dem Einsatz von Rindern als Zugtiergespann. Die Jochgabeln sind bei den Pferden notwendig, da deren höherer Hals und die Bewegungen im Lauf ein Verrutschen des Joches hinter den Vortrieb gebenden Widerrist erleich-tern. Die durch die Arme der Gabeln erreichte Lagefixierung des Joches ist bei Rindern nicht notwendig, da sowohl deren niedriger Hals als auch deren Bewe-gungen nicht zu einer Lageveränderung des Joches führen. Um das Wund-scheuern die Tierhälse zu verhindern, befindet sich auch hier eine Unterlage.
Der Wagenlenker steuert die beiden Zugtiere über vier Zügel. Die Zäumung besteht aus einem Kopfgestell mit Genickriemen, zweibändigem Backenrie-men und einem umlaufenden Nasenriemen. Es fehlt ein Kehlriemen; ob ebenso ein Stirnriemen fehlt, ist aufgrund der Beschädigung des Bildes in die-sem Bereich nicht zu erkennen. Der Genickriemen ist zwischen Hörnern und Ohren geführt und nicht wie sonst bei Pferden üblich hinter den Ohren. Die Zügel laufen zu einer am Nasenriemen befestigten Scheibe. Hierbei muss es sich nicht zwingend um einen Trensenknebel handeln,18 obwohl seine Lage dies andeutet. Möglicherweise tragen die Zugtiere auch einen Kappzaum, also einen gebisslosen Zaum ohne Mundstück. Das dargestellte Kopfgestell ist jedoch typisch für eine Trensenzäumung; bei Rindern ist es hingegen gänzlich ungewöhnlich.
Die Darstellung eines Rindergespanns in einer Pferdeschirrung ist einzigar-tig; wenn Rinderschirrungen dargestellt sind, dann tragen die Tiere ein Stirnjoch.19 Die Skurrilität des Gespanns wird dadurch unterstrichen, dass ein Wagenlenker zwar die Zügel in den Händen hält, ein weiterer Führer zusätz-lich neben den Tieren geht und sie an den Hörner kontrolliert. Der Wagenlen-ker zieht die Zügel deutlich an und scheint die Tiere in ihrem Lauf bremsen zu wollen. In gleicher Absicht ist das Eingreifen des Führers zu deuten.20 Dem-nach hätte der Wagenlenker keine volle Kontrolle über die Zugtiere; was auf
17 Z. B. Hofmann, Fuhrwesen und Pferdehaltung, Taf. 55; LD Plates VI, Abt. 3, Bl. 10.18 Siehe Dietz, „Zäumungen—Material und Funktion“, 58.19 Z. B. LD Plates VI, Abt. 3, Bl. 10.20 Die Beschreibung Hallmanns (Tributszenen des Neuen Reiches, 104) eines Jungen, der die
Rinder festhält und streichelt, dürfte am Kern dieser Szene vorbeigehen. Jeder der Teilnehmer der Delegation ist in Körperhaltung und Aktion auf Huy ausgerichtet. Insofern weicht diese Per-son am Kopf der Tiere in ihrer Handlungsausrichtung deutlich von allen anderen in dem Aufzug ab. Es ist jedoch vom gesamten Bildaufbau her nicht anzunehmen, dass diese Person ein szeni-sches Eigenleben führt und in ihrer Aktion nicht auf Huy fokussiert ist. Wenn man annimmt, dass der Führer die Bremsbemühung des Wagenlenkers unterstützt, erhält auch er seine Funktion innerhalb des Aufzugs, indem er das Zugtiergespann unter Kontrolle hält. Das erklärt, warum seine unmittelbare Aufmerksamkeit nicht bei Huy, sondern den Tieren ist.
S. Burmeister / Journal of Egyptian History 6 (2013) 131–151 137
eine mangelhafte Ausbildung der Tiere für den Einsatz im Wagengespann schließen ließe.
Bei dem dargestellten Fahrzeug handelt es sich ohne Zweifel um einen realen und einsatzfähigen Streitwagen, wie er in der Regierungszeit des Tuten-chamun gebräuchlich war. Der Maler scheint mit den konstruktiven Details eines solchen Wagens und der Schirrungstechnik vertraut gewesen zu sein bzw. hatte ein entsprechendes Anschauungsobjekt vor Augen. Einige der beobachteten Abweichungen in der Schirrung mögen als Anpassung an die Anatomie der Rinder zu sehen sein. Insofern wäre dann auch dieser unge-wöhnliche Aufzug als reale Darstellung zu werten.
In zwei Aspekten weicht die Darstellung jedoch grundlegend von dem gän-gigen Bildkanon ägyptischer Streitwagendarstellungen ab: Wie bereits oben kurz angeführt ist das Besondere dieses Aufzuges, dass der Streitwagen von einer Frau gefahren wird und dass ein Ochsengespann den Wagen zieht. Frauen als Streitwagenfahrerinnen sind ungewöhnlich, dennoch durchaus vereinzelt bildlich und textlich dargestellt. Die meisten Belege stammen aus der Regierungszeit des Echnaton sowie des Tutenchamun; der Kontext der Darstellungen ist jeweils ziviler Natur; Frauen werden sowohl in Begleitung eines Wagenlenkers gezeigt als auch als eigenständige Wagenlenkerin.21 Ein Ostrakon aus der 20. Dynastie weicht von diesem Bildschema ab: Es zeigt eine Frau im Kampf mit einem Mann; beide fahren im Streitwagen frontal aufein-ander zu, sie beschießen sich mit Pfeil und Bogen. Anne Minault-Gout betont ausdrücklich den satirischen Charakter dieser Darstellung und zieht eine Paral lele zu einem Bild, auf dem ein Pharao ein Fischernetz flickt.22 Der Streit-wagen war augenscheinlich kein ausschließliches Attribut der männlichen Elite und so schließt sich die Streitwagenszene im Grab des Huy hinsichtlich der weiblichen Besatzung zwanglos an zeitgenössische Darstellungen an. Die Seltenheit von Wagen fahrenden Frauen und der häufige Konnex von Wagen-fahrerinnen mit dem Königshaus verweist dennoch auf das Außergewöhnliche dieser Darstellung. Das genannte Ostrakon zeigt die Gratwanderung zur „ verkehrten Welt“.
Für die Darstellung eines von Rindern gezogenen Streitwagens gibt es mei-nes Wissens keine ägyptische Parallele. Wenn Streitwagen in Bewegung gezeigt werden, dann—folgt man dem Bewegungsbild der Pferde—meist in schneller Fahrt. Geschwindigkeit war ein Attribut des Streitwagens. Erst die Verwen-dung von Pferden als Zugtiere, die direkte Kontrolle der Tiere durch die
21 Siehe Köpp, „Weibliche Mobilität im Alten Ägypten“, 39 f.; Köpp, „Nofretete auf dem Streit-wagen“.
22 Minault-Gout, Carnets de pierre, 88 f., Abb. 63.
138 S. Burmeister / Journal of Egyptian History 6 (2013) 131–151
Gebisszäumung23 sowie die leichte Bauweise des Fahrzeuges ermöglichten bis dahin unbekannte Geschwindigkeiten von bis zu 40 km/h. Geschwindigkeit wird in der zeitgenössischen ägyptischen Epigraphik und Ikonographie inszeniert und ideologisch überhöht. Mit Verweis auf eine Inschrift an der Sphinx-Stele von Thutmosis IV. spricht Wolfgang Decker von einem Geschwin-digkeitsrausch: Schneller als der Wind zogen die Pferde den Pharao auf seinem Streitwagen.24 Die halsbrecherische, rasende Fahrt ist fester Bestandteil der elitären Statusinszenierung. Ochsen als Zuggespann zerstören Funktionalität und Sinn des auf Geschwindigkeit ausgelegten Fahrzeuges. Insofern muss die nubische Prinzessin auf dem von Rindern gezogenen Streitwagen als Karikatur einer zeitgenössischen Herrschaftsrepräsentation zu verstehen sein.
Der Grabherr Huy
Das Grab des Huy ist eines der Privatgräber in der Nekropole Theben-West in Qurnet Murrai; in der Nekropolenzählung firmiert es unter TT 40. Das bereits vor der ersten dokumentierten Öffnung ausgeraubte Grab ist durch die zwi-schenzeitliche Nutzung als Stall stark in Mitleidenschaft gezogen. Die einst reichen Wandmalereien sind inzwischen in großen Teilen zerstört. Das Grab besteht aus der eigentlichen Grabkammer und einer vorgelagerten Querhalle. Aus dieser stammen die szenischen Wandmalereien. Huy ist in zahlreichen Szenen in seiner Amtsführung dargestellt, so dass wir hier einen guten Ein-blick in seine Stellung und Aufgaben erhalten.25 In einer Szene wird seine Amtseinsetzung als Vizekönig von Kusch durch den Pharao dargestellt. Hier erfahren wir auch, dass sich sein Verwaltungsgebiet, die Provinz Nubien, von Nechen (Hierakonpolis) bis südlich des Vierten Katarakts ausdehnte.26 Huys privilegierte Stellung am Hofe des Pharao wird durch seinen Titel „Wedelträ-ger zur Rechten des Königs“ ausgedrückt. Eine Belobigungsszene zeigt die Ehr-erbietung Huys für Tutenchamun.
Den größten Raum nehmen die Tributszenen ein, in denen Huy von so genannten Fremdvölkern Gaben empfängt, diese stellvertretend für den
23 Der Einsatz von Trensen ist keine zwingende Voraussetzung für den Einsatz eines Pferde-gespanns, auch die gebisslosen Kappzäume erlauben die Kontrolle gut trainierter Tiere. Für den Streitwagen des Thutmosis IV. nehmen Carter und Newberry (The tomb of Thoutmôsis IV, 26) die Nutzung eines solchen Zaumes an. Dass Trensen jedoch eine rigidere Kontrolle der Tiere ermöglichen, ist unstrittig (siehe Brownrigg und Dietz, „Schirrung und Zäumung des Streitwagenpferdes“).
24 Decker, Sport und Spiel im Alten Ägypten, 59 f.25 Davies und Gardiner, Tomb of Huy, 10–30; PM I.12, 75–78.26 Siehe Davies und Gardiner, Tomb of Huy, 10 f.
S. Burmeister / Journal of Egyptian History 6 (2013) 131–151 139
Pharao annimmt, inspiziert und registriert.27 Der hier behandelte Streitwagen ist Teil einer solchen Tributszene, in der eine Delegation nubischer Fürsten mit Gefolge dem Huy huldigt und ihm landestypische Gaben für den König überbringt. Generell stellt sich die Frage, ob die Tributszenen idealtypische Darstellungen der institutionalisierten Tributpflicht sind oder nicht doch eher reale historische Ereignisse widerspiegeln. Für die hier konkret besprochene Szene nimmt Cyril Aldred einen konkreten historischen Anlass an.28 Die namentliche Nennung des Hekanefer, der als historische Person überliefert ist, sowie die Teilnahme weiterer nubischer Fürsten an dem Aufzug sprechen nicht dafür, dass die Szene als idealisierte Darstellung einer der jährlich wie-derkehrenden Tributlieferungen zu verstehen ist. Er spricht sich für einen kon-kreten Anlass aus, etwa eine Krönung oder ein Krönungsjubiläum. Dies wird durch eine weitere Auffälligkeit im Grab des Huy gestützt. Gegenüber den nubischen Tributszenen befinden sich an der anderen Raumseite parallele Szenen, in denen Huy Tribute von Syrern entgegen nimmt. In seiner Funktion als Vizekönig von Kusch war er eigentlich nicht in der Position, Tribute aus dem Norden zu empfangen. Während Davies u. Gardiner zwar zurückweisen, dass diese Szene rein fiktiv ist,29 können sie jedoch auch keine schlüssige Erklärung für deren Inhalt liefern. Hallmann dagegen vermutet hier Huys Wunsch „nach einer noch repräsentativeren Szene und der damit verbunde-nen Demonstration seiner hohen Stellung“.30 Der im Großen und Ganzen dokumentarische Charakter der Bildszenen des Grabes lässt jedoch wenig Spielraum für solche ambitionierten Machtanmaßungen und Funktionsusur-pationen. Schlüssiger scheint dagegen zu sein, dass im Sinne der Deutung von Aldred die syrische Delegation als politische Abordnung eines Nachbarstaates zu dem gleichen konkreten Anlass kam wie Hekanefer und hier seine Aufwar-tung machte.
Die Bildszenen, die Huy in seiner Amtsführung zeigen, befinden sich alle in der Querhalle, also jenem Bereich, der auch nach der Grabniederlegung zugänglich war. Diese Halle diente dem Kult und der repräsentativen Selbst-thematisierung. Im Gegensatz zu dem Pharao, der kein thematisierungsbe-dürftiges Selbst hatte, nutzten die hohen Beamten den zugänglichen Raum als Projektionsfläche für ihr Selbst, ihre persönliche Geschichte, die eine Erwer-bungsgeschichte des Amtes war.31 Die Sichtbarkeit dieser verewigten Lebens-geschichte impliziert gleichfalls, dass sie betrachtet und von Zeitgenossen
27 Siehe Hallmann, Tributszenen des Neuen Reiches, 100–09.28 Aldred, „The foreign gifts offered to Pharaoh“, 115.29 Davies und Gardiner, Tomb of Huy, 28.30 Hallmann, Tributszenen des Neuen Reiches, 109.31 Assmann, „Sepulkrale Selbstthematisierung im Alten Ägypten“, 214.
140 S. Burmeister / Journal of Egyptian History 6 (2013) 131–151
auch kritisch betrachtet werden konnte. Die Darstellung dürfte deshalb zumin-dest in den offiziellen Teilen nicht zu weit von der—überprüfbaren—Realität abweichen.
Wenden wir uns erneut der Streitwagenszene zu. Bevor Huy Vizekönig von Kusch wurde, hatte er eine gehobene Offizierslaufbahn in der Streitwagenab-teilung des Königs durchlaufen. Er führte den Titel eines Feldmarschalls. Huy begründete eine kurze Dynastie der Vizekönige von Kusch. Auch seine Söhne durchliefen eine gehobene militärische Laufbahn in Ägypten: Sein Sohn Tjur[. . .] war Erster Königlicher Stalloberst und vermutlich auch Erster Offizier der Streitwagentruppen; Paser, der auch Huy in seinem Amt als Vizekönig beerbte, hielt einen hohen militärischen Rang inne, der in der Infanterie oder Marine anzusiedeln ist.32 Die Söhne sind beide in Bildszenen der Grabkammer des Huy präsent.33 Der Enkel Huys Amenemope war vor seinem Amtsantritt als Vizekönig ebenfalls Erster Königlicher Stalloberst und Erster Streitwagen-kämpfer seiner Majestät.34
Huy und seine Familie, sicherlich auch ihr unmittelbares Umfeld, waren bestens mit Streitwagen vertraut. Sie waren trainiert in Nutzung und Gebrauch dieser Fahrzeuge—sicherlich besser als viele der ägyptischen Beamten, für die dieser ein standesgemäßes Statussymbol und Repräsentationsfahrzeug war. Hierdurch erhält die Streitwagenszene eine besondere Note. Sie schafft eine spannungsreiche Beziehung zu Huy und seinem persönlichen Streitwagen- Hintergrund. Für den gesellschaftlichen Stand der nubischen Prinzessin ist der Streitwagen ein standesgemäßes Fahrzeug. Dennoch wird der Aufzug zur Komödie: Vor allem durch die Verbindung aus klassischem Streitwagen und einem Ochsengespann als Zugtiere sowie einem Wagenlenker, der offensicht-lich sein Fahrzeug nicht unter Kontrolle hat, erhält der ganze Aufzug ein komi-sches Moment. In der Gegenüberstellung von Huy und dem nubischen Streitwagen kristallisiert sich der Kontrast von richtig und falsch, von kultureller Kompetenz versus Ignoranz, von richtiger Welt und verkehrter Welt.
Der Nubier Hekanefer
Das oberste Bildregister zeigt die nubische Delegation mit dem Streitwagen. Sie wird von Hekanefer angeführt, der Huy in Proskynese aufwartet. Die Iden-tität des Mannes wird inschriftlich als „Hekanefer, Großer von Miam“ ausge-wiesen. Hinter ihm knien zwei weitere Männer, die als „Die Großen von
32 Gnirs, Militär und Gesellschaft, 135.33 Davies und Gardiner, Tomb of Huy, 11, 15.34 Gnirs, Militär und Gesellschaft, 74, 135.
S. Burmeister / Journal of Egyptian History 6 (2013) 131–151 141
Wawat“ bezeichnet werden. Es folgen eine Frau und vier Männer, eine Bei-schrift identifiziert sie als „Die Kinder des Großen jedes Fremdlandes“; dahin-ter zwei Gabenträger, die ausweislich einer Inschrift Gold bringen, und dann kommt der Streitwagen. Der Zug schließt mit fünf gefesselten Männern und einer Frau mit drei Kindern.
In den beiden folgenden Registern sieht man parallele Szenen, in denen jeweils eine Delegation eine Vielzahl unterschiedlicher Gaben bringt. Laut Inschrift machen in beiden Szenen die „Großen von Kusch“ Huy ihre Aufwar-tung und liefern landestypische Gaben ab. Diese beiden Register weichen in etlichen Details von der obersten Szene mit Hekanefer ab. Die Personen im ersten Register sind deutlich größer abgebildet als jene der anderen beiden. In der Person des Hekanefer haben wir auch eine namentliche Nennung, die anderen „Großen“ bleiben anonym. Auffällig ist die jeweilige personelle Zusammensetzung der Delegationen. Rund die Hälfte der Personen im Gefolge des Hekanefer gehört zur Oberschicht, nur zwei Personen bringen Gaben—und hierbei handelt es sich ausschließlich um Gold. Bei den Abordnungen aus Kusch stehen dagegen die Gaben deutlich im Vordergrund; jede der Gruppen wird durch drei „Große“ angeführt; die restlichen Personen überbringen ein breites Spektrum an landestypischen Gaben. Die Großen von Kusch überbrin-gen nicht nur ihren Gruß an den König, sie bitten auch um den Atem (ṯꜢw) bzw. Lebenshauch (ṯ῾w n ῾nḫṯ῾w). Für Hekanefer und die Großen von Wawat ist nichts dergleichen bezeugt. Mit ihrem Leopardenfellumhang heben sich diese zudem von den Fürsten aus Kusch durch eine stärkere Ethnisierung in der Tracht ab. Sowohl Hekanefer35 als auch einer der Fürsten von Kusch im dritten Register bezeugen ihre Ehrerbietung gegenüber Huy in Proskynese. In einem kleinen Detail mag man auch hier einen Unterschied erkennen: Trotz seiner niedrigen Kopfhaltung blickt Hekanefer Huy direkt an, während der Mann aus Kusch seinen Blick in einer weitgehenderen Unterwerfungsgeste komplett senkt und auf seine Hände blickt. Durch den gesamten Bildaufbau der drei Register erhält die von Hekanefer angeführte Delegation aus Unternu-bien (Wawat) eine deutliche Aufwertung gegenüber den beiden Abordnungen aus Obernubien (Kusch).
Wie bereits angeführt, sind die drei Fürsten aus Unternubien in ihrer Tracht deutlich als Nubier ausgewiesen: Ihre Gewänder, Umhänge aus Leopardenfell, Federn im Haar und große goldene Ohrringe erzeugen ebenso wie ihre Frisu-ren und Physiognomie einen deutlichen Kontrast zu den Ägyptern in den
35 Die Identität des Mannes in Proskynese als Hekanefer ist nicht eindeutig; die namentliche Nennung und die bildlich herausgehobene Position des vorderen Mannes in Proskynese machen diesen Bezug jedoch plausibel.
142 S. Burmeister / Journal of Egyptian History 6 (2013) 131–151
diversen Bildszenen. Auch die beiden Gabenträger sowie die Personen hinter dem Streitwagen sind ikonographisch als Nubier dargestellt.
Anders dagegen die „Kinder der Großen“ sowie die Frau im Streitwagen: Sie sind in ägyptischem Stil gekleidet und tragen entsprechende Frisuren.36 Es war durchaus üblich, die Kinder der Eliten unterworfener Völker zur Ausbildung an die königliche Residenz zu schicken. Hekanefer selbst hat wahrscheinlich eine Ausbildung am Hofe des Pharaos erhalten37 und auch für die „Kinder der Großen“ aus Unternubien ist dies zu erwarten; zumal der Vizekönig von Kusch—also Huy—seinen Amtssitz in Unternubien zunächst in Miam (Aniba), später dann in Faras hatte. Vor allem Hekanefer wird sich mit seiner Familie sicherlich im Umfeld der ägyptischen Administration aufgehalten haben und in die Gunst der politischen Beziehungen Huys gekommen sein. Die Ausbil-dung der Elite unterworfener Völker ist ein durch alle Zeiten gebräuchliches Verfahren, sich das Wohlverhalten der unterworfenen Völker zu sichern. Aus Sicht Ägyptens ist dies eine Maßnahme der Herrschaftssicherung in Unternu-bien. Zum einen haben die Kinder quasi Geiselstatus und erzwingen die Fried-fertigkeit der unterworfenen Oberschicht, zum anderen bildet man die zukünftige Elite im eigenen Sinne aus und sozialisiert sie in der ägypti-schen Kultur und den ihnen zukünftig zugewiesenen Aufgaben. Die Elite der unterworfenen Völker hingegen erhalten darüber eine Bestandsgarantie ihrer Privilegien und Führungsrolle innerhalb ihrer eigenen Gesellschaft. Aufgrund der besonderen Bedeutung, die den Kindern in diesem politischen Bezie-hungsgeflecht zukommt, ist es aus ägyptischer Sicht durchaus schlüssig, sie hier als Ägypter darzustellen. Für die Delegation aus dem obernubischen Kusch ist bemerkenswerterweise ähnliches nicht dargestellt.38
Auch der Wagenlenker und der Gespannführer sind als Ägypter dargestellt, wenngleich sie deutlich einfacher gekleidet sind. Die drei Fürsten sind größer dargestellt als der Rest des Zuges; deutlich kleiner als die anderen Personen sind die drei zum Streitwagen gehörenden Personen. Bei der Frau mag es
36 Siehe z. B. Kemp, Ancient Egypt, 37.—Auch der Umstand, dass die Nubierin auf dem Streit-wagen steht, ist ein ägyptisches Attribut. Einer der anonymen Gutachter wies darauf hin, dass wenn in zivilem Kontext Fremde mit einem Streitwagen dargestellt werden, dann handelt es sich um Angehörige von Fremdvölkern, die Streitwagen als Gaben überbringen. Sie stehen neben dem Wagen, keinesfalls fahren sie ihn; die Wagen sind in diesen Fällen auch niemals mit vorge-spannten Zugtieren dargestellt.
37 Simpson, Heka-Nefer and the Dynastic Material from Toshka and Arminna, 26.38 Es ist in der Diskussion, inwieweit Obernubien in dieser Zeit überhaupt unter ägyptischer
Kontrolle stand (siehe z. B. Morkot, „Nubia in the New Kingdom: The Limits of Egyptian Con-trol“). Martin Fitzenreiter wies mich darauf hin, dass Ägypten wahrscheinlich dort keine Integra-tionsstrategie verfolgte wie vergleichsweise in Unternubien.
S. Burmeister / Journal of Egyptian History 6 (2013) 131–151 143
technisch bedingt sein: Sie steht erhöht im Streitwagen und ihr Sonnenschirm39 schließt auf gleicher Höhe ab wie die Federn der Nubier, so dass das zur Verfü-gung stehende Bildfeld für sie deutlich kleiner ist. Für das Wagenpersonal gibt es hingegen keinen technischen Grund. Sie wirken wie junge Heranwach-sende. Ähnlich klein sind auch die Rinder des Zuggespanns. Insgesamt wirken Zugtiere und Wagenführer jenseits ihrer Dysfunktionalität wie Fremdkörper in dem Aufzug.
Soweit der ikonographische Rahmen und die ägyptische Perspektive, wen-den wir uns nun der anderen Seite zu: Hekanefer und der nubischen Kultur jenseits der ägyptischen Bildvorlage. Die Frage von Selbstdarstellung und Fremddarstellung lässt sich in der Person des Hekanefer sehr gut ausleuchten. Auch seine Grabanlage ist überliefert und archäologisch untersucht.40 Sein Grab ist eines von drei aus dem Sandstein gehauenen Felsengräbern des Neuen Reiches in Toshka-Ost. Der Grundaufbau entspricht der Grabanlage des Huy. Die Felsreliefs sind qualitativ sehr hochwertig und entsprechen ebenfalls zeit-genössischen Darstellungen aus Theben. Einige der Objekte, die der Plünde-rung der Grabkammer entkommen sind, werden aufgrund ihrer Qualität als thebanischen Ursprungs anzusehen sein. Im Eingangsbereich der Anlage ist auch der Grabherr Hekanefer selbst dargestellt wie er Osiris anbetet. Die Grab-kammer ist in ihrer Anlage und ihrem Dekor ebenso ägyptisch wie der abgebil-dete Hekanefer. Der Titel „Fürst“ (wr) weist ihn jedoch weniger als ägyptischen Beamten, denn als lokalen Herrscher der unterworfenen Nubier aus.41 Die iko-nographische Repräsentation in beiden Grabanlagen könnte kaum kontrast-reicher sein: Huy sah ihn als Nubier, doch Hekanefer selbst präsentierte sich selbstbewusst als Ägypter.
Wenden wir uns erneut dem Streitwagen zu. Der dargestellte persönliche Hintergrund von Hekanefer macht es wenig glaubhaft, dass er oder jemand aus seinem Gefolge nicht um den richtigen Gebrauch des Streitwagens wusste. Kaum vorstellbar ist ebenfalls, dass ein Mangel an Pferden zu der
39 Bei Lepsius ist der Sonnenschirm mit einer Haltestange dargestellt; die späteren Aufnah-men von Wreszinski, Atlas zur Altaegyptischen Kulturgeschichte 1, Taf. 160 und Davies und Gardi-ner, Tomb of Huy, Taf. 28 zeigen diese jedoch nicht. Dort ruht der Schirm scheinbar auf dem Modius, der bei Lepsius bereits etwas eigenwillig Kronenartiges hatte. Wilkinson (Egyptian Wall Paintings, 45) sieht diese Darstellung, in der der Sonnenschirm zum Teil des Kopfputzes gewor-den ist, als Beleg für die inszenierte Provinzialität der Nubierin. Die fünf strahlenförmigen Fort-sätze des Modius‘ scheinen mir eher Halteverstrebungen des Sonnenschirms zu sein, dessen Haltestange durch den Körper der Frau verdeckt wird. Damit hätte sie einen Modius auf, wie ihn auch die anderen „Kinder der Großen“ tragen; der Sonnenschirm hingegen wäre am Wagen befe-stigt. Die leichte Asymmetrie des Sonnenschirms ist jedoch nicht zu übersehen.
40 Simpson, Heka-Nefer and the Dynastic Material from Toshka and Arminna.41 Fitzenreiter, „Identität als Bekenntnis und Anspruch“, 177.
144 S. Burmeister / Journal of Egyptian History 6 (2013) 131–151
ungewöhnlichen Wahl des Zugtiergespanns geführt hatte. Seit dem Aufkom-men des Pferdes in Ägypten ist es auch in Nubien belegt; eine aktuelle Zusam-menstellung der realen Pferdebelege zeigt, dass die Mehrheit der Funde aus Nubien stammt.42 In einer weiteren Bildszene im Grab des Huy bringen Schiffe Gaben aus Nubien, darunter zahlreiche Pferde—sowie schwarzweiß gefleckte Rinder.43 Die große Bedeutung von Pferden zumindest für spätere nubische Herrscher wird auf der Stele des Piye aus der zweiten Hälfte des 8. Jahrhun-derts v. Chr. deutlich.44 Auch aus einer anderen geographischen Region erhal-ten wir möglicherweise einen Hinweis auf Pferdehaltung und -zucht in Nubien: In assyrischen Texten werden vielfach Pferde aus Kusch (KUS ku-sa-a-a) erwähnt. Auch wenn nicht immer davon auszugehen ist, dass diese Tiere aus Nubien stammen, muss die gentile bzw. regionale Bezeichnung doch als Hin-weis auf eine Pferdezucht in Nubien gesehen werden. Die Kusch-Pferde wer-den als Zugtiere gelistet.45 Bedenken, dass in diesem Naturraum eine Pferdehaltung aufgrund der durch die Tsetsefliege übertragenen Schlafkrank-heit (Afrikanische Trypanosomiasis) nicht möglich ist, sind gegenstandslos. Erhellend ist die Studie Robin Laws zur präkolonialen Pferdenutzung in Westafrika.46 Trotz der regional hohen Verlustraten durch die Krankheit hatte das Pferd vor allem im militärischen Einsatz über Jahrhunderte eine besondere Bedeutung in den dortigen Kulturen. Der Grund für den Niedergang der Pferdenutzung hatte keine endemischen, sondern politische Gründe, indem die europäischen Kolonialmächte die lokalen Kriege eindämmten und damit die wesentliche Funktion der Tiere aufhoben. Die berittenen Dschand-schawid-Milizen, die in den letzten Jahren im Darfur-Konflikt (Westsudan) als Aggressor auftraten, zeigen die volle Einsatzfähigkeit des Pferdes in diesem geographischen Großraum.
Pferdemangel kann folglich nicht der Grund für den Streitwagen mit Och-sengespann im Gefolge des Hekanefer sein. Doch wie sieht es mit dem Streit-wagen selbst aus? Die Belege für die nubische Streitwagennutzung sind rar,
42 Raulwing und Clutton-Brock, “The Buhen Horse”.43 Siehe Davies und Gardiner, Tomb of Huy, 26 f., Taf. 30 f.; LD Plates VI, Abt. 3, Bl. 116; Hallmann,
Tributszenen des Neuen Reiches, 102.—Die Beischrift informiert darüber, dass mit dem Transport die Gaben aus dem Süden eintreffen. Wie einer der anonymen Gutachter zu Recht betont, ist es jedoch nicht gesichert, ob die Pferde zum Konvolut der Gaben gehören oder nicht doch zu Huys persönlicher Streitwagenausstattung. Letztere Vermutung wird möglicherweise durch den Umstand gestützt, dass sich die beiden Schiffe, auf denen sich die Pferde befinden, durch ihre aufwändigere Machart und Größe deutlich von den anderen Booten im Konvoi unterscheiden.
44 Welsby, The Kingdom of Kush, 90; Fitzenreiter, „Piye Son of Ra, Loving Horses, Detesting Fish“, 264 f., siehe auch 265 Anm. 18.
45 Postgate, Taxation and conscription in the Assyrian Empire, 11–13.46 Law, The horse in West African history.
S. Burmeister / Journal of Egyptian History 6 (2013) 131–151 145
doch deutlich genug, um den Nachweis zu liefern, dass die Nubier sehr wohl im Gebrauch des klassischen Streitwagens mit Pferdegespann geübt waren. In dem Grab des Djehuty-Hetep sieht man den Grabherrn im Streitwagen in schneller Fahrt auf der Jagd.47 Diese Bildszene fügt sich zwanglos in den klassi-schen Kanon der ägyptischen Streitwagendarstellungen ein. Auch Djehuty-hetep war ein nubischer Herrscher, der rund 100 Jahre vor Huy im Amt war, und auch sein Grab ist vollkommen ägyptisiert. Säve-Söderbergh stellt fest, dass eine Unterscheidung zwischen ägyptischen Beamten und lokalen Herr-schern unterworfener Völker nicht zu treffen ist.48
Andere Darstellungen nubischer Fahrzeuge sind aus dem Neuen Reich mei-nes Wissens nicht überliefert.49
Fazit
Kehren wir zu der Eingangsfrage zurück: Stellt die Streitwagenszene in dem Grab des Huy ein reales Abbild nubischer Wagennutzung dar oder ist sie als inszenierte Verzerrung einer Fremdvölkerdarstellung zu verstehen? Masson u. Rosenstock sehen in dem Bild einen Beleg dafür, dass Rinder durchaus als Zug-tiere vor einem Streitwagen eingesetzt wurden—zumindest wenn dieser als elitäres Repräsentationsfahrzeug genutzt wurde.50 Damit hätten wir hier einen einzigartigen Beleg für die nubische Verwendung des klassischen Streitwa-gens, die von gänzlich anderem Charakter gewesen wäre als wir sie bislang aus den benachbarten Regionen im zweiten Jahrtausend v. Chr. kennen. Die Heraus forderung von Geschwindigkeit und Geschicklichkeit—und die damit einhergehende soziale Absetzung und Bewunderung—wäre hier nicht die dem Wagengebrauch zugrundeliegende Idee; wir sähen hier eine kulturelle Umwidmung, die ein mit hohem Prestige aufgeladenes Fahrzeug adaptiert und einer gänzlich anderen Idee von Wagenfahrt zuführt: hier stände das
47 Säve-Söderbergh, “The Paintings in the Tomb of Djehuty-hetep at Debeira”, 32 Abb. 5.48 Säve-Söderbergh, “The Paintings in the Tomb of Djehuty-hetep at Debeira”, 44.—Strittig ist,
inwieweit Streitwagen selbst in Nubien gefertigt wurden und als Gaben nach Ägypten kamen. Aus einem nicht näher zuzuweisenden Grab aus der Zeit der Hatschepsut stammt eine Bildszene mit zwei Streitwagen und der Beischrift, dass einer der Wagen aus shendet-Holz aus Kusch komme (Säve-Söderbergh, Four eighteenth dynasty tombs, 4); wobei unklar bleibt, ob nur das Holz oder der ganze Wagen aus Nubien stammt. Davies und Gardiner (Tomb of Huy, 22) erwägen die Lieferung von nubischen Streitwagen an Huy; Caminos (The shrines and rock-inscriptions of Qasr Ibrim, 68 f. mit Anm. 3) ist demgegenüber skeptisch und betont die Einzigartigkeit dieser Beleg-stelle.
49 Zu jüngeren Darstellungen aus der Zeit des napatanischen und meroitischen Reiches von Kusch siehe Welsby, The Kingdom of Kush, 171.
50 Masson und Rosenstock, „Das Rind in Vorgeschichte und traditioneller Landwirtschaft“, 99.
146 S. Burmeister / Journal of Egyptian History 6 (2013) 131–151
Repräsentieren bei getragener Fahrt im Vordergrund, das den Wagenfahrer zwar selbst nicht fordert, ihn aber gemächlich an einer Zuschauermenge vor-bei defilieren ließe.
Nach eingehender Betrachtung bezweifele ich das. Der Streitwagen in der besprochenen Bildszene steht in dem Kontext nubischer Elitenrepräsentation. Es ist in jedem Falle davon auszugehen, dass sich die nubische Oberschicht an ägyptischen Vorbildern orientierte, besonders wenn es darum ging, ihre geho-bene Stellung darzustellen. Es ist ebenso davon auszugehen, dass sie sowohl das Wissen um die ägyptische Nutzungsweise des Streitwagens hatte als auch die Mittel, ihn in dieser Weise zu verwenden. Von daher wird der einzigartige Aufzug eines Streitwagens mit Rindergespann nicht dem normalen Gebrauch der nubischen Oberschicht entsprochen haben: Sicherlich sehen wir hier keine für die Nubier typische Situation.
Dennoch spricht einiges dafür, dass der Aufzug so wie abgebildet stattge-funden haben könnte, es sich folglich nicht zwangsläufig um ein idealtypisches Bild handelt. Die technischen Details des Wagens sowie der Schirrung und Zäumung sind bis in kleinste Details korrekt dargestellt. Der Maler hatte offen-sichtliche gute Kenntnis der Streitwagentechnologie bzw. eine entsprechende Bildvorlage. Ein Missverständnis des Malers wird nicht Grund für die unge-wöhnliche Darstellung gewesen sein. Gerade in den Aktionen des Wagenlen-kers sowie des Gespannführers erkennen wir das Außeralltägliche und Groteske dieser Situation. Beide versuchen das Gespann zu kontrollieren; der Wagenlenker ist offensichtlich nicht alleine dazu in der Lage—was im regulä-ren Streitwageneinsatz jedoch seine Aufgabe wäre. Man gewinnt den Eindruck, dass für den konkreten Anlass dieser Aufzug zusammengestellt wurde und beide Ochsen, die augenscheinlich untrainiert sind, in Pferdeart angeschirrt und gezäumt wurden. Eine Routine bestand in dieser Nutzung offensichtlich nicht. Es bedarf schon eines besonderen erzählerischen Geschicks, diese Szene frei zu erfinden bzw. zu ergänzen.
Der Sinn des Bildes erschließt sich nicht aus der nubischen Perspektive, son-dern liegt in der Gestaltung des Aufzugs durch die ägyptische Seite. Der Aufzug wie auch die Grabmalereien wurden für ein ägyptisches Publikum inszeniert. Es ist nicht davon auszugehen, dass der durchschnittliche Betrachter einen vertrauten Umgang mit Nubiern hatte; insofern hatte der Zeremonienmeister relativ freie Hand in der Gestaltung und Kleiderordnung der nubischen Dele-gationen. Die gesamte Tributszene lebt von dem Kontrast zwischen Ägyptern und Nubiern. Die Darstellung der Nubier lässt keinen Zweifel an ihrer Anders-artigkeit. Aus ägyptischer Sicht wird hier eine visuelle Trennungslinie zwi-schen den Gruppen gezogen, die auch die jeweilige Funktion definiert: Gabenbringer oder -empfänger. Die deutliche Ethnisierung der Nubier steht in
S. Burmeister / Journal of Egyptian History 6 (2013) 131–151 147
krassem Gegensatz zu dem Selbstbild, das die nubische Oberschicht von sich selbst zeichnete. Über den Grad der Freiwilligkeit der Unterordnung in die ägyptische Inszenierung sind wir nicht informiert; in jedem Falle symbolisiert die Art des Aufzuges seitens der Nubier eine politische Stellungnahme und ein Bekenntnis zu dem Verhältnis zwischen Ägyptern und Nubiern. Die Nubier bekommen ihre Rolle als unterworfenes Volk zugewiesen, ihr Bekenntnis zu der ägyptischen Kultur wird streitig gemacht.
Doch gerade die Darstellung des Gefolges von Hekanefer zeigt auch Brüche. Die politischen Führer der Delegation sowie die Gabenbringer sind für den Ägypter äußerlich als Nubier zu identifizieren; doch in den „Kindern der Gro-ßen“ treten kulturelle Grenzgänger auf, die die klare Rollenzuschreibung zwi-schen Ägyptern und Nubiern zu durchbrechen scheinen. Sie sind zumindest in ihrer Kleidung und Frisur als Ägypter dargestellt. Das hat seine Berechtigung, denn wie bereits angeführt, dürften für den Betrachter die nubischen Führer und Gabenbringer kein vertrauter Anblick gewesen sein. Anders jedoch die Kinder der nubischen Elite, die ihre Ausbildung in Ägypten erhielten; ihnen wird man sicherlich des Öfteren begegnet sein. Für die Glaubwürdigkeit der Szene ist es deshalb angezeigt, die Kinder so darzustellen, wie man sie gewohnt war zu sehen: als Ägypter. Der Streitwagen in ihrem Gefolge, der ja nicht von einem der Fürsten, sondern einem der „Kinder“ gefahren wird, ist ein geschick-tes Stilmittel, die ethnische Ordnung aus ägyptischer Sicht wieder herzustel-len. Die Frau im Streitwagen und das Ochsengespann zeigen die verkehrte Welt und lassen das ägyptische Erscheinungsbild der Nubier als komische Maskerade und Ausdruck ihrer kulturellen Inkompetenz erscheinen.
Pascal Vernus hat in mehreren Beiträgen die Anekdote als rhetorisches wie bildnerisches Stilmittel dargestellt, mit dem Mächtige ihre besondere Position pointieren.51 Er spricht von einer „stratégie d’appogiature“ und bezieht sich hierbei auf ein musikalisches Stilmittel—im Deutschen als Vorhalt bezeich-net—mit harmoniefremden Noten ein dissonantes Intervall und damit eine harmonische Spannung zu erzeugen. Auch bei Fremdvölkerdarstellungen wird dieses Mittel eingesetzt, um die herausragende Stellung der Mächtigen und ihres Weltbildes zu betonen.52 Der in ägyptischen Augen sicherlich wider-sinnige Einsatz eines Ochsengespanns kann im Sinne Vernus’ ebenso als szeni-sche „stratégie d’appogiature“ verstanden werden wie die Darstellung der beiden Personen, die mit der Kontrolle des Zuggespanns sichtlich überfordert
51 Folgende Ausführungen profitierten stark von den Kommentaren der anonymen Gutach-ter, für die ich an dieser Stelle nochmals danke.
52 Siehe Vernus, „Comment l’élite se donne à voir dans le programme décoratif“ und „Stratégie d’épure et stratégie d’appogiature“, bes. 113.
148 S. Burmeister / Journal of Egyptian History 6 (2013) 131–151
sind. Hierin wird die Darstellung zur Karikatur einer Streitwagenfahrt. Die vie-len technischen Details, die beeindruckend akkurat wiedergegeben sind, kön-nen im Sinne Roland Barthes’ einen Wirklichkeitseffekt erzeugen, der die Plausibilität einer fiktiven Darstellung erhöhen soll.53 Die hier interessierende Frage, ob die szenische Darstellung als Teil einer idealtypischen Fremdvölker-darstellung zu werten ist oder als Darstellung eines realen Aufzuges, ist kaum zu beantworten, da eine Unterscheidung zwischen realer Darstellung und Idealbildnis in der ägyptischen Kunst generell nicht trennscharf zu ziehen ist. Wie Dimitri Laboury betont, sind reale mit idealisierten Darstellungen kon-taminiert, beide Dimensionen sind in unterschiedlichen Anteilen immer präsent.54
Ich möchte hier eine weitere Ebene einziehen. In der Darstellung des Gespannführers am Kopf der Tiere sehe ich eine Schlüsselszene für die Inter-pretation des Bildes. Wie bereits oben ausgeführt, ist jeder der Teilnehmer der Delegation in Körperhaltung und Aktion auf Huy ausgerichtet. Allein der Gespannführer weicht von diesem Schema ab, indem er seine ganze Aufmerk-samkeit auf die Zugtiere richtet. Dies wird im praktischen Vollzug seiner Auf-gabe begründet sein; entscheidend ist jedoch, dass er sich damit der Ehrerbietung für Huy entzieht. Es ist fraglich, ob die darin zum Ausdruck kom-mende Respektlosigkeit gegenüber dem Grabherren szenisch gewollt ist und etwa im Sinne Vernus’ zu deuten ist. Möglicherweise ist die kritische Frage von realer versus idealisierter Darstellung nicht auf das Bild selbst, sondern den dargestellten Aufzug als solchen zu richten. Mir scheinen die vielen techni-schen Details und insbesondere die Aktion des Gespannführers schlüssige Indizien einer realen Abbildung zu sein. Die Maskerade fand demnach nicht in erster Linie auf der Ebene des Bildes statt, sondern in realiter. Was hier als ide-altypische Fremdvölkerdarstellung abgebildet ist, kann auch als detailgetreue Darstellung eines real inszenierten Aufzuges verstanden werden. In diesem Falle wäre nicht das Bild auf die Frage real versus idealisiert abzuklopfen, son-dern das dargestellte Ereignis, das so, wie auf dem Bild zu sehen, zwar stattge-funden hat, jedoch an sich ein Schauspiel für das ägyptische Publikum war, um das idealtypische Klischee der gängigen Fremdvölkerdarstellungen zu propa-gieren. Es ist jedoch offensichtlich, dass eine klare Entscheidung, ob die Aus-formulierung des Fremdvölkertopos allein auf der Bildebene erfolgte oder bereits zuvor in einer dargestellten ›Wirklichkeit‹ inszeniert wurde, letztlich nicht zu treffen sein wird.
53 Barthes, „Der Wirklichkeitseffekt“.54 Laboury, „Portrait versus Ideal Image“, 2.
S. Burmeister / Journal of Egyptian History 6 (2013) 131–151 149
Der Streitwagen war in der Bildszene ein geschickt platzierter Bestandteil, um die junge nubische Elite, die bereits ägyptisch assimiliert gewesen zu sein scheint, zu re-ethnifizieren. Die durchlässigen Schranken der ägyptischen Gesellschaft ermöglichten einerseits die Integration von Angehörigen fremder Volksgruppen, erschwerten jedoch auch die Grenzziehung zwischen dem „Ägyptischen“ und dem „Fremden“.55 Die üblichen Fremdvölkerdarstellungen mit den spezifischen Trachten waren ein Mittel der Segregation. Bei der assi-milierten Elite am königlichen Hof bediente man sich einer Variante: eine in der Streitwagenszene zum Ausdruck gebrachte—zu belächelnde—unzuläng-liche kulturelle Kompetenz der nur scheinbar ägyptisierten Nubier. Die Szene spiegelt die ägyptische Weltordnung wider, keinesfalls gibt sie einen Einblick in die nubische Kultur.
Abkürzungen
LD Plates R. Lepsius. Denkmäler aus Aegypten und Aethiopien. Nach den Zeichnungen der von Seiner Majestät dem Könige von Preussen Friedrich Wilhelm IV nach diesen Ländern gesendeten und in den Jahren 1842–1845 ausgeführten wissenschaftlichen Expedition. Pla-tes, Bd. VI, Abt. 3: Denkmäler des neuen Reichs, Bl. XCI–CLXXII. Berlin: Nicolai, 1849–1852.
LD Text R. Lepsius. Denkmäler aus Aegypten und Aethiopien. Text, Bd. 3: Theben. Hrsg. von E. Naville. Leipzig: Hinrichs’sche Buchhand-lung, 1900.
MGAEU Mitteilungen der Berliner Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte
MittSAG Der Antike Sudan. Mitteilungen der Sudanarchaeologischen Gesell-schaft zu Berlin
PM I.12 B. Porter und R.L.B. Moss. Topographical bibliography of ancient Egyptian hieroglyphic texts, reliefs, and paintings 1. The Theban necropolis 1. Private tombs. Oxford: Clarendon, 19602.
Literatur
Aldred, C. „The foreign gifts offered to Pharaoh.“ JEA 56 (1970): 105–116.Assmann, J. „Sepulkrale Selbstthematisierung im Alten Ägypten.“ In Selbstthematisierung und
Selbstzeugnis: Bekenntnis und Geständnis, Hrsg. A. Hahn und V. Knapp, 208–232. Frankfurt/Main: Suhrkamp, 1987.
55 Siehe Kemp, Ancient Egypt, 26 ff.
150 S. Burmeister / Journal of Egyptian History 6 (2013) 131–151
Barthes, R. „Der Wirklichkeitseffekt.“ In Das Rauschen der Sprache. Kritische Essays 4. R. Barthes, 164–172. Frankfurt/Main: Suhrkamp, 2006. [Erstveröffentlichung: „L’effet de réel.“ Communica-tions 11 (1968): 84–89.]
Brownrigg, G. und U.L. Dietz. „Schirrung und Zäumung des Streitwagenpferdes: Funktion und Rekonstruktion.“ In Rad und Wagen—Der Ursprung einer Innovation. Wagen im Vorderen Ori-ent und Europa, Hrsg. M. Fansa und S. Burmeister, 481–490. Archäologische Mitteilungen aus Nordwestdeutschland, Beiheft 40. Mainz: Zabern, 2004.
Carter, H. und P.E. Newberry. The tomb of Thoutmôsis IV. Catalogue général des antiquités égyp-tiennes du Musée du Caire, No. 46001–46529. Westminster: Constable, 1904.
Caminos, R.A. The shrines and rock-inscriptions of Qasr Ibrim. ASE 32. London: Egypt Exploration Society, 1968.
Davies, N. und A.H. Gardiner. The Tomb of Huy. Viceroy of Nubia in the Reign of Tutˁankhamūn (No. 40). TTS 4. London: Egypt Exploration Society, 1926.
Davis, T.M. The tomb of Iouiya and Touiyou. The finding of the tomb. London: Constable, 1907.Decker, W. „Bemerkungen zur Konstruktion des ägyptischen Rades in der 18. Dynastie.“ SAK 11
(1984): 475–488.———. Sport und Spiel im Alten Ägypten. München: Beck, 1987.Dietz, U.L. „Zäumungen—Material und Funktion.“ In Bronzen im Spannungsfeld zwischen prakti-
scher Nutzung und symbolischer Bedeutung, Hrsg. U.L. Dietz und A. Jockenhövel, 55–69. Prähi-storische Bronzefunde Abt. 20, 13. Stuttgart: Steiner, 2011.
Drenkhahn, R. Darstellung von Negern in Ägypten. Hamburg: Dissertation Universität Hamburg, 1967.
Fitzenreiter, M. „Identität als Bekenntnis und Anspruch—Notizen zum Grab des Pennut (Teil IV).“ MittSAG 15 (2004): 169–193.
———. „Piye Son of Ra, Loving Horses, Detesting Fish.“ In La pioche et la plume. Autour du Sou-dan, du Liban et de la Jordanie, Hommages archéologiques à Patrice Lenoble, Hrsg. V. Rondot, F. Alpi, und F. Villeneuve, 261–268. Paris: Presses de l’Université Paris-Sorbonne, 2011.
Gnirs, A.M. Militär und Gesellschaft. Ein Beitrag zur Sozialgeschichte des Neuen Reiches. SAGA 17. Heidelberg: Heidelberger Orientverlag, 1996.
Hallmann, S. Die Tributszenen des Neuen Reiches. ÄAT 66. Wiesbaden: Harrassowitz, 2006.Hofmann, U. Fuhrwesen und Pferdehaltung im Alten Ägypten. Bonn: Dissertation Universität
Bonn, 1989.Kemp, B.J. Ancient Egypt. Anatomy of a Civilization. London: Routledge, 20062.Köpp, H. „Nofretete auf dem Streitwagen.“ Kemet 19, 3 (2010): 34–35.———. „Weibliche Mobilität im Alten Ägypten: Frauen in Sänften und auf Streitwagen.“ In Mis-
cellanea in honorem Wolfhart Westendorf, Hrsg. C. Peust, 34–44. Göttinger Miszellen, Beiheft 3. Göttingen: Universität Göttingen, Seminar für Ägyptologie und Koptologie, 2008.
Laboury, D. „Portrait versus Ideal Image.“ In UCLA Encyclopedia of Egyptology, Los Angeles, Hrsg. W. Wendrich, accessed 2012. http://www.escholarship.org/uc/item/9370v0rz. UCLA: UCLA Encyclopedia of Egyptology, Department of Near Eastern Languages and Cultures, 2010.
Law, R. The horse in West African history. The role of the horse in the societies of pre-colonial West Africa. Oxford: Oxford University Press, 1980.
Littauer, M.A. und J. Crouwel. Chariots and related equipment from the tomb of Tutˁankhamūn. Tutˁankhamūn’s Tomb Series 8. Oxford: Griffith Institute, 1985.
———. „The origin of the true chariot.“ Antiquity 70 (1996): 934–939.Marchant, J. „Ancient Egyptian chariot trappings rediscovered. Forgotten drawers in Egyptian
museum yield ‘astonishing’ leather finds.“ http://www.nature.com/news/ancient-egyptian-cha-riot-trappings-rediscovered-1.9388 [abgerufen am 23.11.2011].
Masson, A. und E. Rosenstock. „Das Rind in Vorgeschichte und traditioneller Landwirtschaft: archäologische und technologisch-ergologische Aspekte.“ MGAEU 32 (2011): 81–106.
S. Burmeister / Journal of Egyptian History 6 (2013) 131–151 151
Minault-Gout, A. Carnets de pierre. L’art des ostraca dans l’Égypte ancienne. Paris: Édition Hazan, 2002.
Morkot, R.G. „Nubia in the New Kingdom: The Limits of Egyptian Control.“ In Egypt and Africa. Nubia from prehistory to Islam, Hrsg. W.V. Davies, 294–301. London: British Museum Press, 1991.
Postgate, J.N. Taxation and conscription in the Assyrian Empire. Rom: Biblical Institute Press, 1974.
Raulwing, P. und J. Clutton-Brock. „The Buhen Horse: Fifty Years after Its Discovery (1958–2008).“ JEgH 2.1–2 (2009): 1–106.
Säve-Söderbergh, T. Four eighteenth dynasty tombs. PTT 1. Oxford: Oxford University Press, 1957.———. „The Paintings in the Tomb of Djehuty-hetep at Debeira.“ Kush 8 (1960): 25–44.Simpson, W.K. Heka-Nefer and the Dynastic Material from Toshka and Arminna. Publications of
the Pennsylvannia-Yale Expedition to Egypt 1. New Haven und Philadelphia: Peabody Museum of Natural History of Yale University und University Museum of the University of Pennsylvania, 1963.
Veldmeijer, A.J. Amarna’s Leatherwork, 1. Preliminary analysis and catalogue. Leiden: Sidestone Press, 2011.
Veldmeijer, A.J. und S. Ikram. „Lederwaren in el-Amarna.“ In Im Licht von Amarna. 100 Jahre Fund der Nofretete, Hrsg. F. Seyfried, 136–141. Berlin: Michael Imhof Verlag, 2012.
Vernus, P. „Comment l‘élite se donne à voir dans le programme décoratif de ses chapelles funé-raires. Stratégie d‘épure, stratégie d‘appogiature et le frémissement du littéraire.“ In Élites et pouvoir en Égypte ancienne, Hrsg. J.C. Moreno García, 67–115. Cahiers de recherches de l’Institut de Papyrologie et d’Égyptologie de Lille 28. Lille: Université Charles-de-Gaulle, 2010.
———. „Stratégie d’épure et stratégie d’appogiature dans les productions dites ‚artistiques‘ à l’usage des dominants. Le papyrus dit ‚érotique‘ de Turin et la mise à distance des dominés.“ In Art and Society. Ancient and Modern Contexts of Egyptian Art, Hrsg. K.A. Kóthay, 109–121. Buda-pest: Museum of Fine Arts, 2012.
Welsby, D.A. The Kingdom of Kush. The Napatan and Meroitic Empires. London: British Museum Press, 1996.
Wilkinson, C.K. Egyptian Wall Paintings. The Metropolitan Museum of Art’s Collection of Facsi-miles. Catalogue compiled by M. Hill. New York: Metropolitan Museum of Art, 1983.
Wreszinski, W. Atlas zur Altaegyptischen Kulturgeschichte 1. Leipzig: Hinrichs’sche Buchhand-lung, 1923.






























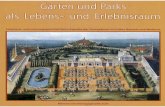








![Toruńska ustawa aptekarska z 1623 roku [Thorner Apotheker-Ordnung aus dem Jahre 1623]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/631a56e8d43f4e1763046709/torunska-ustawa-aptekarska-z-1623-roku-thorner-apotheker-ordnung-aus-dem-jahre.jpg)


