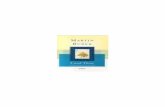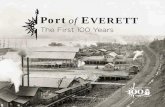Buber-Rosenzweig in Amerika: Die Bibelübersetzung von Everett Fox
Transcript of Buber-Rosenzweig in Amerika: Die Bibelübersetzung von Everett Fox
Altes Testament und Moderne
begründet von
Hans-Peter Müller (f), Michael Welker und Erich Zenger (f)
herausgegeben in Verbindung mit Andreas Schule und Bernd Janowski
ab Band 24 herausgegeben von
Prof. Dr. M ichaela Bauks (Koblenz)
Prof. Dr. Ulrich Berges (Bonn)
Prof. Dr. Daniel Krochmalnik (Heidelberg)
Prof. Dr. Manfred Oeming (Heidelberg)
Band 25
L1T
Daniel Krochmalnik, Hans-Joachim Werner (Hg.)
50 Jahre Martin Buber BibelInternationales Symposium
der Hochschule für Jüdische Studien Heidelberg und der Martin Buber-Gesellschaft
L1T
Buber-Rosenzweig in AmerikaDie Bibelübersetzung von Everett Fox
Ran HaCohen (Tel Aviv)
Im Jahr 1968 erschien in den USA die erste Nummer des seinerzeit äußerst po- pulären Whole Earth Catalog, der zum Kauf angebotene Bücher, Landkarten, Gartengeräte und allerlei andere Artikel der amerikanischen Gegenkultur der Sixties auflistete: Alles, was die do-it-yourself Anhänger der sechziger Jahre brauchten bzw. glaubten zu brauchen, um die Macht ihrer Feinde - nämlich - “govemment, big business, formal education, church״ auszuhöhlen. Die Pub- likation - one of the bibles of my generation“ wird Steve Jobs die Publikation״ vier Jahrzehnte später nennen - steht ikonisch für die kulturelle Atmosphäre der 1960er Jahre: für Misstrauen gegen herkömmliche und etablierte Rituale, für kritischen, schöpferischen Individualismus, für Rückkehr zur Intimität der klei- nen Gemeinschaft.
Auch bei der jüdischen Minderheit in den USA blieb der Zeitgeist der counter- culture nicht unbeachtet: Eine Art jüdische Entsprechung fand sie in der sog. Chavurah-(oder Havurah, pl. Havurot)Bewegung.1 Die typische Havura war eine bewusst klein gehaltene Gruppe, die höchstens einige Dutzend Mitglieder zählte, meistens junge Menschen aus nicht-orthodoxen Strömungen; sie waren in der Regel eng miteinander befreundet und trafen sich regelmäßig zum Beten, Torah-Studium, Feiern und Meinungsaustausch. Seit dem Ende der 1960er Jah- re entstanden in den USA Dutzende von Chavurot, die sich als individualisti- sches Alternativ zum jüdischen Establishment begriffen. Im Lauf der 1970er Jahre verbreiteten sich sowohl unabhängige wie auch ״synagoge-affiliatecf‘ Chavurot, und 1980 fand schließlich die erste ״National Havurah Conference“ in der Rutgers University statt. Klein wie sie war - nicht mehr als einige Tau- send Mitglieder insgesamt - übte die Bewegung dennoch großen Einfluss auf das main-stream conservative, reform und reconstructionist Judaism aus.2
1 Aus dem Hebr. ״Gemeinschaft“. Bereits an dieser Begrifflichkeit wird der Bezug zu Bubers Philosophie deutlich, die auch bei den Zeitgenossen offensichtlich sehr präsent war. S. Joseph Reimer, Looking Back at the Havurah, Response 10-11 (1976), 243-246.2 Riv-Ellen Prell, Prayer & Community. The Havurah in American Judaism, Detroit 1998, 12-29; Chaim I. Waxman, America’s Jews in Transition, Philadelphia 1983, 213f.; Charles E. Silberman, A Certain People. American Jews and Their Lives Today, New York 1985,206f.
Ran HaCohen260
Eine typische Publikation der Chavurot-Bewegung war The Jewish Catalog,3 entstanden 1973 nach dem Erfolg und Vorbild des Whole Earth Catalog. Dieser -do-it-yourself kit“ zum jüdischen Leben, herausgegeben und verfasst von Mit״gliedern der Chavurot, bietet sowohl praktische Anweisungen, aber auch eher abstrakt gehaltene Abhandlungen über eine Vielzahl von Themen, von Candles bis Calendar, von Alijah bis Death and Burial. So zitiert zunächst ein typischer Eintrag wie ״How to bring Messiah“ den Tannaiten Jochanan ben Zakkai:4 ״If you’re planting a tree and you hear Mashiah has come, first finish planting and then run to the city gates to teirhim Shalom“, um dann zu empfehlen (S. 250):
Plant a tree somewhere as a small tikkun olam ~ fixing up the world ~ wher- ever the olam most needs it. Plant a tree in Vietnam in a defoliated former
forest. Go there to plant it i f possible (even i f difficult) [...]
Everett Fox’ Übersetzung der Bibel - das Thema dieses Beitrags - ist genau in dieser kulturellen Atmosphäre entstanden. Es war die avantgardistische, intel- lektuelle Umgebung der Havurot, die sein Werk zunächst maßgeblich geprägt hat.
Everett Fox wurde 1947 geboren und wuchs in Manhattan auf. Von 1964 bis 1968 studierte er Near Eastern and Judaic Studies an der Brandeis University; nach einem kurzen Intermezzo am Jewish Theological Seminary o f America in New York Ende der 1960er Jahre kehrte er an die Brandeis University zurück, wo er 1975 promovierte. 1968 lernte er die Verdeutschung der Schrift von Mar- tin Buber und Franz Rosenzweig kennen, die er auch gleich als Thema für seine von Nahum N. Glatzer betreute Dissertation wählte.5 Schon im selben Jahr (1968) begann Fox mit der Arbeit an dem, was sich im Läufe der nächsten Jahr- zehnte sukzessive zu seinem Lebensprojekt entwickeln wird: die englische Übersetzung der hebräischen Bibel nach der Verdeutschung der Schrift von Bu- ber und Rosenzweig, eine Bibel ״in English dress but with a Hebraic voice“, wie Fox es selbst formulierte.6
3Richard Siegel, Michael Strassfeld and Sharon Strassfeld (eds.), The Jewish Catalog, Philadel-
phia 1973.4 Avot de-Rabbi Natan 52, 31.5 Everett Fox, Technical Aspects o f the Translation o f Genesis o f Martin Buber and Franz Rosenzweig, Brandeis University Ph.D. 1975.6 The Five Books ofM oses (1995), ix.
261Buber-Rosenzweig in Amerika
Bereits als Entwurf fand die neue Übersetzung Aufnahme in der innerhalb der CA<3vwro/-Bewegung tonangebenden Gruppe Havurat Shalom (Somerville, Massachusetts), wie Fox selbst überliefert hat:
A year later [1969, RH], while in Israel (I was officially a rabbinical Student at J. T. S.), I gave a copy o f my draft o f Genesis to David Roskies (now [2013, RH] Professor o f Yiddish atJ. T. S. and Ben-Gurion); he requested it fo r use at Havurat Shalom, and I was happy to agree. In that sense, there was a counter-culture home fo r what I admittedly saw as a counter-culture work.7
Die ersten Proben der Übersetzung erschienen innerhalb eines von ihm verfass- ten Aufsatzes im Winter 1971/1972 in Response, der Zeitschrift der Havurot.8 Unter dem Titel ״We Mean the Voice“ stellte Fox den amerikanisch-jüdischen Lesern die Buber-Rosenzweig’sche Bibelübersetzung vor und verwies dabei vor allem auf den von Buber und Rosenzweig verwendeten und von ihnen auch immer wieder eingeforderten mündlichen Stil dieser Übersetzung. Für ihn, Fox, stellte dieser auf den hebräischen Urtext zurückgehende mündliche Stil den Kern der Übersetzungstheorie der Verdeutschung der Schrift dar.
Vor allem Martin Buber war zu diesem Zeitpunkt im englischen Sprachraum bereits wegen seiner Dialogphilosophie, seines politischen Denkens, seiner Schriften zum Chassidismus und auch als Bibelinterpret bekannt; Fox’ Aufsatz markiert jedoch die Anfänge einer Rezeption von Buber als Übersetzer der Bi- bei in der englischsprachigen Welt. Als ein Jahr später (1973) der Jewish Ca- talog erschien, enthielt er bereits (S. 185) ein kurzes Zitat aus Fox’ Genesis- Übersetzung, deren erste vollständige Version allerdings schon im Sommer 1972 als Nummer 14 von Response erschienen war. Die Rezeption unter der Chavurot ging deutlich über den reinen Publikationskontext hinaus, wie sich an Fox’ folgender Äußerung nur wenige Jahre später ablesen lässt: Sein Werk, so schreibt Fox, war
fairly early [...] championed by the ״ havurah” movement. [...] Several o f the havurot have used my In the Beginning in study and liturgical settings,
7Persönliche Mitteilung von E. Fox, Januar 2013.gEverettFox, We Mean the Voice: The Buber-Rosenzweig Translation o f the Bible, Response 12
(Winter 1971-1972), 29-42.
Ran HaCohen262
and seem to fin d that it stimulates people to rethink and rehear the Biblical text, as well as disciplining them to focus on its ,plain ’ meaning.9
Wie haben wir uns Fox’ Werk nun konkret vorzustellen? Die Ähnlichkeiten mit Der Schrift von Buber und Rosenzweig sind schon in dieser ersten Ausgabe so- fort sichtbar: Der Titel lautet nicht etwa Genesis, sondern ״In the Beginning“, analog zu der von Buber und Rosenzweig gewählten Formulierung ״Das Buch Im Anfang“. In dieser Wendung scheinen aber auch bereits die Grenzen von Fox5 Übersetzungsmöglichkeiten auf: Eine genauere Bezeichnung als ״An Eng- lish Rendition“ konnte Fox als Äquivalent zu Buber / Rosenzweigs Begriff Ver- deutschung10 nicht geben: ״Americanization“ oder ״Englishing“ kam schon aus semantischen Gründen nicht in Frage.
Auch auf textueller Ebene fällt zunächst die große Ähnlichkeit mit der Bibel- Übersetzung von Buber und Rosenzweig ins Auge:
Die Kapitel- und Versnummem werden von Fox analog zur Ausgabe von Bu- ber/Rosenzweig nur einmal am oberen Seitenrand angegeben, nicht vor jedem Vers.
Auch der Zeilenumbruch und sogar der Zeilenabstand ist mit dem deutschen Prätext von wenigen Ausnahmen abgesehen identisch; diese entsprechen be- kannterweise der ״kolometrischen“ Auffassung Bubers und sollen den Leser zum (richtigen) Vorlesen zwingen.11
qEverett Fox, A Buber-Rosenzweig Bible in English, Amsterdamse Cahiers voor Exegese en
Bijbelse Theologie 2 (1981), 9-22, Zitat S. 19.Verdeutscht von“ (Die Schrift, 1926״ ,“Zu verdeutschen unternommen״ 10 ,4f.). Vgl. dazu Martin Buber und Franz Rosenzweig, Scripture and Translation, übers, von Lawrence Rosenwald mit Everett Fox, Bloomington and Indiananpolis 1994, x-xi.11 In diesem Zusammenhang verwies Dr. FJ. Hoogewoud (Haarlem, Niederlande) auf den großen Einfluss, den Bubers Verwendung der Kolometrie sowie sein sog. Leitwortstil vor allem auf das Umfeld des Amsterdamer Alttestamentlers Martinus A. Beek (1909-1987) ausgeübt hatte. Beek selbst hatte bereits 1963 zur Verleihung des Erasmuspreises die Laudatio auf Buber gehalten. In den 1970er Jahren bot man den beiden niederländischen Bibelgesellschaften Übersetzungsproben von insgesamt zehn Bibeln an, die anschließend publiziert wurden: Een vertaling om voor te lezen (vgl. www.societashebraica.nl). Die letzten Ausgaben wurden zweisprachig herausgegeben. In diesem Kontext war vor allem Karel Deurloo, Beeks Nachfolger, schon zu einem sehr frühen Zeitpunkt auf die ersten Übersetzungen von Everett Fox aufmerksam geworden. Fox wurde ein- geladen, um über seine Arbeit zu berichten (Amsterdamse Cahiers 2, 1981). Ein Schüler von Deurloo, der reformierte Pfarrer Bart Stobbelaar, der englische Bibelkurse u.a. für interessierte Gemeindemitglieder und Studenten in Haarlem und Zambia abhielt, griff bei der Behandlung der
263Buber-Rosenzweig in Amerika
Weiterhin versuchte Fox auch die philologischen und akustischen Effekte, de- nen in der Übersetzung durch Buber und Rosenzweig eine so zentrale Bedeu- tung zukommt, aufzunehmen; erwähnt seien hier nur:
- Alliterationen und andere Lautwiederholungen:
Hebräisch Buber-Rosenzweig (letzter Hand)
Fox
Gen 1,2 Tובהו תהו Irrsal und Wirrsal confusion and chaos (1972), wild and waste (1995)
Gen 4,12 TT Tונד נע Schwank und schweifend
wavering and wandering
Num 11,4 ף9האס? der Mischmasch the riff-raff
- Übersetzung nach Wurzel:
Hebräisch Buber- Rosenzweig (letzter Hand)
Fox (1972) Fox (1995)
Gen מעבר את ויעבר und fuhr über and went over to cross the32,2 !בלו• die Furt des the ford of the Yabbok cross-2f. Jabbok, Yabbok, ing.
ויעברם ןיקןחם er nahm sie, he took them, He took themונעבר הנחל את führte sie über had them go and broughtלו אעזר את den Fluß und over the river them across the
fuhr über and had that river; he brought
was sein war. which was his go over.
across what be- longed to him.
Genesis auf die Übersetzung von Everett Fox zurück (vgl. The Yosef-Cycle, 2 vols [s.l. 2009]). A uf diesen verschlungenen Wegen gelangte ein Echo von Martin Bubers Bibelübersetzung von den USA über die Niederlande auf den afrikanischen Kontinent.
Ran HaCohen264
- die konkordante Übersetzung von Vokabeln, zum Beispiel ״rushing-spirit of God hovering over the face of the waters” (Gen 1,2) gegenüber ״like an eagle protecting its nest, over its young-birds hovering, he spread out his wing” (Dtn 32,11).12
- die Übersetzung unter Bezugnahme auf die jeweilige Wurzel - -Altar, B) מזבח R: Schlachtstatt) ist slaughter-site,קרבן (Opfer, B-R: Nahung) ist near-ojfering. Am letzten Beispiel sieht man auch die Grenzen der englischen Sprache gegen- über dem Deut schen: יב קרבן להקר (Luther ״ein Opfer tun“, z. B. Lev 1,2) ist bei Buber und Rosenzweig ״eine Nahung damahen“, bei Fox hingegen to bring- near a near-ojfering. Die deutsche flgura etymologica ״eine Nahung damahen“ klingt (mir) biblisch, wie etwa ״den Schlaf der Gerechten schlafen“; das engli- sehe to bring-near a near-offering lässt diesen biblischen Charakter vermissen und klingt vielmehr wie ein ziemlich unbeholfenes Doppelgemoppelt.
In diesem Zusammenhang muss allerdings angemerkt werden, dass Fox gene- rell den Konsistenz- und Genauigkeitsgrad von Bubers Werk beim Auseinan- derhalten der Synonyma wie auch bei der Übersetzung auf der Basis der jewei- ligen Wurzel nicht einmal annährend erreicht, wie die folgende Tabelle zeigt. Ob dies nun den sprachstrukturellen Unterschieden zwischen dem Englischen und dem Deutschen geschuldet ist, oder auch von der Virtuosität des Überset- zers abhängt, kann hier nicht endgültig entschieden werden.
Hebräisch Buber/Rosenzweig Fox (1995)
Lev 19,15 Lev 19,36 Deu 1,16
צדק Wahrheitwahrhaftwahrheitlich
equityequityequity
Gen 15,6 Gen 18,19 Deu 6,25
צדקה BewährungWahrhaftigkeitBewährung
righteous-meritjustrighteous-merit
Gen 7,1 Gen 18,23 Ex 23,7 Deu 25,1
צדיק bewährtBewährtebewährtbewährt
righteousinnocentinnocentinnocent-one
12 Hebr ף ח ר ; zu diesem Beispiel vgl. in Bubers ״Schlussbemerkungen“ zur Verdeutschung der Schrift, MBW 14,223.
265Buber-Rosenzweig in Amerika
Ex 23,7 Deu 25,1
הצדיק bewährtsprechenbewahrheitete
acquitdeclare-innocent
V צ-ד-ק V wahr V acquitV equityV iimocent VjustV righteous
Ein Hauptmerkmal der Buber / Rosenzweig’sehen Übersetzung ist ihr hohes Sprachregister. Dies entsteht nicht nur durch die ungewöhnliche, hebraisierte Syntax, sondern auch durch die Verwendung seltener Vokabeln. Schon in den ersten Kapiteln von Genesis stößt man auf eine Vielzahl von Wörtern und Komposita, die in der deutschen Sprache alles andere als gebräuchlich sind: z. B. Irrsal, Urwirbel, Braus (Gen 1,2), befittlichte (Vögel, 1,21), Kriechgerege (1,24), Fischvolk (1,26), Üppigland (2,8), Flußköpfe (2,10). Bekanntermaßen wurde dieser Wortgebrauch bereits von den Zeitgenossen scharf kritisiert. Am bekanntesten ist sicherlich Siegfried Krakauers harsches Urteil, in dem er Buber eines Wagnerianischen Sprachgebrauchs bezichtigte, woraufhin Buber sich ver- anlasst sah, jedes inkriminierte Wort im historischen Wortschatz des Deutschen, d. h. im Deutschen Wörterbuch der Brüder Grimm nachzuweisen. Wie immer man auch zu Bubers Sprachgebrauch steht, ohne Zweifel sind es gerade diese archaisierenden Worte, die bis heute die Besonderheit von Bubers Übersetzung ausmachen.
In Fox’ Werk hingegen ist kaum etwas Ähnliches zu finden. Anstatt seltsamer, archaischer Vokabeln enthält es gängige englische Wörter, die fester Bestandteil des alltäglichen Sprachgebrauchs sind: Irrsal ist chaos bzw. waste; Urwirbel ist waters; befittlichte Vögel sind winged fowl; Kriechgerege ist crawling things usw. Gleichsam als Kompensation verwendet Fox ganz oft von ihm geprägte Komposita, die er mittels eines Bindestrichs formt: rushing-spirit für Braus (hebr. Ruach); Üppigland (hebr. [Gan] Eden) ist Land-of-delight bzw. Land-of- pleasure. Manchmal scheint gerade in diesen Komposita der deutsche Prätext (Bubers Übersetzung) auf, denn die englischen Begriffe sind nichts anderes als Nachbildungen der von Buber gebildeten Komposita - sozusagen Lehnüber- Setzungen - so etwa stream-heads für Flußköpfe (wo allerdings das Hebräische הארץ כל .noch mitklingt), oder earth-folk für Erdvolk (Hebr ראשים , Gen 9,19). Andere, für Fox typische Komposita (und zugleich Wortbildungen) sind set-of- words, come-now, mountain-country, slaughter-site, living-things, beginning-
Ran HaCohen266
month, resting-place, New-Moon, well-springs, existing-things, winged-sphinx- es, u.v.a.m. Dabei bleibt es mitunter nicht bei zwei Elementen: Es finden sich noch längere ״tölpelhafte Zusammensetzungen“ mit Bindestrichen - wie eine Rezensentin es einmal formuliert hat,13 zum Beispiel be-accorded-honor (Lev 10,3), turn-them-into-smoke (Ex 29,13) oder sogar provide-that-he-be-healed (Ex 21,19), die auf diese Weise jeweils ein einziges Wort der hebräischen Vor- läge wiedergeben sollen.
In den 1980er Jahren erschienen in New York, bei Schocken Books,14 sowohl eine Neuausgabe von In the Beginning als auch Fox’ Übersetzung des Buches Exodus. Aber erst 1995, d. h. fast 25 Jahre nach der Erstausgabe von Genesis, erschien als Prachtausgabe The Five Books o f Moses, die Übertragung des ge- samten Pentateuch.
Wie bereits angedeutet, unterscheiden sich die Ausgaben erheblich voneinan- der. Bezeichnenderweise gab Fox bereits in der zweiten Ausgabe von 1983 Bu- bers Nur-Text-Prinzip - der reine Bibeltext soll für sich selbst sprechen - wie- der auf und versah seine Übersetzung mit ausführlichen Paratexten, d. h. sowohl mit einem Stellenkommentar, wofür auch die zuvor weggelassenen Kapitel- und Verszahlen wieder eingefuhrt wurden, als auch mit Einleitungen zu jedem Buch und zu jedem Teil des Buches.
Bei einem Vergleich der beiden englischen Ausgaben könnte man Fox’ Vorge- hensweise als eine Art Emanzipationsprozess bezeichnen: Fox ״befreit“ sich nämlich gleichsam vom Einfluss der Verdeutschung Bubers und nähert sich nun sowohl mitunter der hebräischen Vorlage, mitunter jedoch auch der englischen Sprachnorm an. Diese Entwicklung möchte ich nun anhand von einigen Versen aus der Geschichte des Turmbaus zu Babel (Gen 11) illustrieren:
Gen 11,1, Hebr.: חךים וךברים אחת שפה הא.ךץ כל ויהי$
B/R: Über die Erde allhin war eine Mundart und einerlei Rede.
Fox 1: All over the earth was one tongue and one kind of speech.
Fox 2: Now all the earth was of one language and one set-of-words.
13 F. Eberstadt, The Uses o f Exodus, Commentary, June 1987,25-33, Zitat S. 26: ״gawky formu- lations”.14 Siehe Anhang.
261Buber-Rosenzweig in Amerika
- Im Hebräischen dient ״die Erde“ tatsächlich als Subjekt, nicht als Adjunkt der Ortsangabe; Bubers Präposition Über entspricht der hebräischen Vorlage dem- nach nicht, das Gleiche gilt auch für Fox’ erste Version ״over the earth“. Fox’ zweite Version hat sich von Buber entfernt, steht aber dafür der hebräischen Vorlage wieder näher.
- Auch die in der zweiten Ausgabe durchgängig vorgenommene Ersetzung von tongue durch language ist dem Hebräischen שפה näher,15 bildet jedoch auch einen Indikator für die Bevorzugung von Worten aus dem alltäglichen Ge- brauch.
- orte set-of-words vertritt die hebräische Pluralform אחדים דברים weitaus bes- ser als Bubers Singularform ״Rede“ oder Fox’ früheres ״kind of speech“.
Gen 11,2, Hebr . : שם וישבו שנער בא.ןץ בקעה ויוצאו מ?ןךם בנ?עם ויהי .
B/R: Da wars wie sie nach Osten wanderten: sie fanden ein Gesenk im Lan- de Schinar und setzten sich dort fest.
Fox 1: And it was when they wandered to the east: they found a clefit-place in the land of Shinar and settled there.
Fox 2: And it was when they migrated to the east that they found a valley in the land of Shinar and settled there.
- Die erste Version wandered steht noch deutlich unter dem Einfluss des Deut- sehen wanderten, während das Verb migrated diesen Einfluss überhaupt nicht mehr erkennen lässt.
- Das Kompositum cleft-place versucht die hebr. Wurzel von בקעה wiederzuge- ben, ähnlich wie Buber es zuvor mit dem Wort Gesenk versucht hatte; in der zweiten Ausgabe gibt Fox den Versuch auf und verwendet ganz einfach das Wort valley.
- Das Hinzufügen der Konjunktion that (it was ... that they found anstatt der Parataxe it was... : they found) schafft in der zweiten Ausgabe einen herkömm- liehen englischen cleft sentence - eine deutliche Anpassung an die syntakti- sehen Normen der Zielsprache.
Gen 11,3, Hebr . : ו יאמר יש ו ו אל א נה הבה רעה ים נלב נ נשךפה לב לשרפה ן
15 Tongue wird in der 2. Ausgabe für לשון verwendet, Buber hatte hier das Wort ״Zunge“ benutzt (z. B. Gen 10,5).
Ran HaCohen268
B/R: Sie sprachen ein Mann zum Genossen:Heran! backen wir Backsteine und brennen wir sie zu Brande!
Fox 1: They said (each) man to his fellow:Come-now! let us bake bricks and let us bum them to buming!
Fox 2: They said, each man to his fellow:Come-now! Let us bake bricks and let us bum them well-bumt!
- Auch hier ahmt Fox’ erste Version das Deutsche wie das Hebräische nach: - zu Brande = לשרפה to buming׳, in der späteren Version wird stattdessen einem geläufigen englischen Kompositum der Vorzug gegeben: well-burnt.
Am auffälligsten zeigt sich Fox’ ,Emanzipation’ von Bubers Verdeutschung jedoch bereits im ersten Vers der Bi bel , ית יאש ו הא.ךץ ןאת השמלם את אליהים ברא ב - ״ Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde“. In seiner ersten Version bleibt Fox dieser Interpretation treu: ״In the beginning God created the heavens and the earth“ (wie erwähnt, hatte sich Fox dafür entschieden, diese Wendung auch als Titel seines Werkes zu verwenden). In der zweiten Ausgabe von 1995 entscheidet sich Fox hier jedoch für eine andere Interpretation, eine Interpretati- on nämlich, die das erste Wort בראשית als status constructus liest, wie es bereits Raschi im 11. Jahrhundert getan hatte, und übersetzt dementsprechend: ״At the beginning of God’s creating of the heavens and the earth, [when the earth was wild and waste ... God said]“ - eine Interpretation, die nicht unbedingt die cre- atio ex nihilo impliziert. Mit dieser Auffassung hätte sich Fox allerdings auch auf einen Vorläufer im englischen Sprachraum berufen können: Die renommier- te New Revised Standard Version übersetzte nämlich bereits Ende der 1980er Jahre: ״In the beginning when God created the heavens and the earth ...“.
Bevor nun die Rezeption von Fox’ Werk einer genaueren Betrachtung unterzo- gen wird, muss zunächst der übersetzungsideologische Hintergrund beleuchtet werden, der der Bibelübersetzung von Fox zugrunde liegt. Bereits im 19. Jahr- hundert hatte Schleiermacher zwischen zwei Methoden des Übersetzens unter- schieden, nämlich ״Entweder der Übersetzer läßt den Schriftsteller möglichst in Ruhe, und bewegt den Leser ihm entgegen, oder er läßt den Leser möglichst in Ruhe und bewegt den Schriftsteller ihm entgegen“.16 Buber und Rosenzweig hatten in ihrer Bibelübersetzung eindeutig die erste Methode favorisiert, also den Leser dem biblischen Text entgegen zu bewegen, eine Methode, der im
16 zit. nach Hans Joachim Störig, Das Problem des Übersetzens, 2. Aufl. Darmstadt 1969, 47.
269Buber-Rosenzweig in Amerika
deutschen Sprachraum offensichtlich bereits im frühen 19. Jahrhundert durch- aus eine gewisse Legitimation zuerkannt wurde. Ganz anders war die Lage im englischsprachigen Raum. Der amerikanische Übersetzungstheoretiker Law- rence Venuti subsumiert die Unterscheidung Schleiermachers unter das Be- griffspaar foreignizing gegenüber domesticating translation, um damit eine kri- tische Geschichte der angelsächsischen Übersetzungsnormen darlegen zu kön- nen. Venuti kann nämlich auf diese Weise ein deutliches Monopol der sog. do- mestizierenden Übersetzungen im englischen Sprachraum diagnostizieren, und zwar nicht nur in erzählenden Texten, sondern auch in den Bibelübersetzungen. Ein Beispiel für die Dominanz dieser Vorgehensweise bietet das Konzept der dynamic equivalence, das von Eugene Nida (1914-2011), dem Übersetzungsthe- oretiker der American Bible Society, entwickelt worden ist. Mit seiner Forde- rung nach einer complete naturalness o f expression stellt es geradezu ein Mus- terbeispiel für die Vorrangstellung des domestizierenden Modells dar, denn, so formuliert es Nida, ״the translator must be a person who can draw aside the cur- tains of linguistic and cultural differences so that people may see clearly the re- levance of the original message”17 - d. h. also, die Leser, um noch einmal auf die Formulierung Schleiermachers zurückzugreifen, sollten nach Möglichkeit in Ruhe gelassen und die Bibel ihnen entgegen bewegt werden. Nicht ohne Grund beschuldigt daher Venuti das gesamte englischsprachige Verlagswesen
producing cultures in the United Kingdom and the United States that are aggressively monolingual, unreceptive to the foreign, accustomed to fluent translations that invisibly inscribe foreign texts with English-language val- ues andprovide readers with the narcissistic experience o f recognizing their own culture in a cultural other.18
Vor diesem Hintergrund der Dominanz des domestizierenden Konzepts im eng- lischsprachigen Raum müssen nun auch Fox5 Bibelübersetzungen gelesen wer- den, in denen er zunächst eindeutig dem foreignizing-Konzept den Vorzug ge- geben hatte. Denn, genau wie in der ersten Methode Schleiermachers (der Über- setzer läßt den Schriftsteller möglichst in Ruhe und bewegt den Leser ihm entgegen), will Fox gerade nicht (wie Nida) ״ [to] draw aside the curtains o f lineuistic and cultural differences sondern genau das Gegenteil: ״ to draw the
17 Nida and de Waard 1986, 14, zit. nach Lawrence Venuti, The Translator’s Invisibility, London& New York 1995,21. Meine Hervorhebung - RH.18 Lawrence Venuti, The Translator’s Invisibility, London & New York 1995,15.
Ran HaCohen270
reader into the world o f the Hebrew Bible throush the power o f its lanzuase “19. Zwar fehlt in Fox’ Übersetzungsprojekt die kulturkritische Tiefe, in dem Sinne, wie sie von Buber in seinem Aufsatz ״Mensch von heute und die jüdische Bi- bei“ erörtert worden ist, Fox riskiert jedoch nichts Geringeres als eine direkte Konfrontation mit den herrschenden Übersetzungsnormen des Englischen. Dies erklärt auch, warum sein Werk gerade im Umfeld der alternativen Szene der cöunterculture konzipiert und dort auch so positiv aufgenommen wurde.
Von der Kritik hingegen wurde die ersten Übersetzungen von Fox vor allem in den 1970er und 1980er Jahren kaum beachtet, und wenn in Ausnahmefallen doch, so waren die Reaktionen eher verhalten: ״ The Everett Fox translation is bound to be controversial in a healthy way, for its audacious approach differs from customary translations o f the Bible“, bemerkt ein Rezensent 1984.20 Ein anderer Kritiker stellt die rhetorische Frage:
But has the translator passed the boundaries o f acceptable English style and punctuation? The excess o f exclamation marks seems to cheapen theproduct [....] The English can be effective when read aloud by a good reader but it does not look quite like literary English on the page.21
Das Werk, das, wie erwähnt, in einem eher radikalen, gegenkulturellen Milieu entstanden war, blieb ift seinem Einfluss zunächst marginal. Der Durchbruch scheint erst Mitte der 1990er Jahre gekommen zu sein, mit der Veröffentlichung der Pentateuch-Übersetzung im Herbst 1995 - eine ganze Generation nach den Anfängen von Fox’ Arbeit. Nun war der Zeitgeist offensichtlich ein gänzlich anderer: Venutis eben erwähnte Arbeit The Translator’s Invisibility, die nicht nur eine Geschichte der domesticating translation aufrollt, sondern zugleich auch ein Manifest für die Methode der foreignizing translation darstellt, er- schien bezeichnenderweise im selben Jahr. Ein Jahr zuvor hatte Lawrence Ro- senwald in Zusammenarbeit mit Everett Fox das Werk Scripture and Translati
19 Everett Fox, The Five Books o f Moses: Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, New York 1995, ix. Meine Hervorhebungen - RH.20 E. Rauch, Parabola 9 (January 1984), 99.21 R. S. Hanson, Journal o f Biblical Literature 104.4 (December 1985), 694. In einer anderen Be- sprechung von einigen Werken zum Buch Exodus wünscht die Rezensentin, dass ״Fox had exert- ed greater pressure upon the English”, meint allerdings - um das Werk eher: die Übersetzung vielleicht doch als domestiziert darstellen zu können - dass es ״looks and sounds to Contemporary reader like nothing so much as an Anglo-Saxon epic, after the manner o f The Battle o f Maldon or Beowulf ’ (Fernanda Eberstadt, The Uses o f Exodus, Commentary, June 1987, 25-33, hier S. 26).
271Buber-Rosenzweig in Amerika
on veröffentlicht, eine Übersetzung von Die Schrift und ihre Verdeutschung, d. h. aller Aufsätze von Buber und Rosenzweig zur Übersetzung der Schrift, ein Werk, das in den USA mit großer Aufmerksamkeit rezipiert wurde.22
Die Veröffentlichung von Fox’ Pentateuch - dem ersten Band der sog. ״ Scho- cken Bible“ - wurde nun groß gefeiert: Am 18. Dezember 1995 fand in der Cathedral of Saint John the Divine“ in New York eine öffentliche Lesung aus״dem Werk mit bekannten Schauspielern statt; anwesend waren etwa 2000 Zuhö- rer in der angeblich ״world’s largest Christmas-Hanukkah celebration“23. Eine solche Lesung entsprach in hohem Maße der Betonung des gesprochenen Cha- rakters der Schrift, die Fox mit Buber und Rosenzweig teilt; sein Werk sieht er am liebsten als performance an, als Ausführung im musikalischen Sinne. In der New York Times, die über diesen Abend ausführlich berichtete, fand das Werk in den nächsten zwei Wochen Eingang in die Bestseller-Liste.24
In den Rezensionen blieb Fox’ Werk allerdings auch weiterhin umstritten, aber die Anzahl der Rezensionen und die Prominenz der Kritiker wie der Rezensi- onsorgane belegen das Gewicht, das der Übersetzung nun beigemessen wurde: Die New York Times Magazine widmete ihm im Oktober 1995 drei ausführliche Rezensionen und zwar von zentralen Vertretern der Literatur- und Bibelwissen- schaft. Dabei war Frank Kermodes Tonfall eher zurückhaltend: ״ Fox ’s boldness has its rewards ", gab er zu, fand aber die vielen Neologismen - die neugepräg- ten Komposita - eher störend; sein allgemeines Urteil war denn auch eher di- plomatisch formuliert: ״ The measure o f his success is fo r the reader to judge. “ Auch Robert Alter, dessen eigene erfolgreiche Pentateuchübersetzung nur we- nige Monate später erschien, kritisierte etliche stilistische Mängel des Werks, lobte jedoch Fox dafür, dass er ״ boldly swims against the tide o f insipidness o f all other modern English versions “25. Der Schriftsteller und Bibelkenner Rey- nolds Price gab sich hingegen begeistert:
Fox has attempted the most ambitious English translation o f Genesis since the King James Version o f 1611. Not only does Fox ’s English appear to mir- ror the Hebrew with a scrupulous and admirable economy, but also the sound and rhythm o f his language arrive with a freshness that may recall
22 S. Leora Batnitzky, Translation as Transcendence: A Glimpse into the Workshop o f the Buber- Rosenzweig Bible Translation, New German Critique 70 (1997), 87-116.23 S. Bruce Weber, At Church, Scripture, Song and Celebrity, The New York Times, 19.12.1995.24 Am 31.12.1995 und am 7.1.1996.25 Robert Alter im New York Times Magazine, 22.10.1995.
Ran HaCohen272
some part o f the shock and consolation with which these old words confront- ed their original audience, and centuries o f subsequent listeners and read- ers.
Jon Levenson bezeichnete das Werk als ״a major achievement in the history of English translations of the Bible”,26 und der Rezensent der London Review o f Books schrieb:
fo r all o f its misplaced pieties and sometimes fussy readings, Fox ’s version deserves to be seen as the one real modern successor to Tyndale ’s.27
Es lässt sich an diesen Besprechungen ablesen, dass Fox foreigning Überset- zungsideologie nun durchaus zur Kenntnis genommen und auch gewürdigt wurde, selbst wenn ihre tatsächliche Umsetzung nicht durchgängig auf Zustim- mung stieß.28
Ein weiterer Beleg für Fox’ Erfolg ist die Aufnahme sowohl seiner wie auch der Buber / Rosenzweig’schen Übersetzung in die entsprechenden Anthologien der Übersetzungswissenschaft. Im deutschen Sprachraum war Bubers Aufsatz ״Zu einer Verdeutschung der Schrift“ bereits 1963 in der Anthologie von Hans Joa- chim Störig Das Problem des Übersetzens aufgenommen worden. Vergleich- bare englische Anthologien mit zentralen Texten der Übersetzungswissenschaft, auch wenn sie z. B. in der Regel Walter Benjamin aufnahmen, nannten den Bei- trag Bubers hingegen nicht: In den Anthologien von Andre Lefevere (1977),29 William Frawley (1984),30 Rosanna Warren (1989),31 John Biguenet und Rainer Schulte (1992)32 und sogar in Lawrence Venutis33 Translation Studies Reader
First Things 62 (April 1996): 56.27 GeraldHammond, London Review o f Books, 23.5.1996.28 Neben den hier genannten Faktoren, die zum Erfolg seines Pentateuchs (mehr als 87,000 verkaufte Exemplare) beigetragen haben, nennt Fox selber auch noch ״the growth o f adult Jewish study groups, and Christian interest in Jewish approaches (bringing them closer to ״the world o f Jesus”), in the ‘nineties. The realities o f a chaotic world, and renewed interest in spirituality, willundoubtedly continue to spur interest.” (Persönliche Mitteilung, Januar 2013)29- Andre Lefevere (ed.), Translating Literature: the German Tradition, Amsterdam & Assen 1977. Franz Rosenzweig ist mit dem kleinen Aufsatz ״Die Schrift und Luther“ in dieser Anthologievertreten.30 William Frawley (ed.), Translation: Literary, Linguistic, and Philosophical Perspectives, New-ark, London, Toronto 1984.31 Rosanna Warren (ed.), The Art o f Translation: Voices from the Field, Boston 1989.32
John Biguenet and Rainer Schulte (eds.), Theories o f Translation: An Anthology o f Essays from Dryden to Derrida, Chicago and London 1992.
273Buber-Rosenzweig in Amerika
(2000) bleibt Martin Buber unerwähnt. Erst in der umfangreichen Anthologie Translation - Theory and Practice von Daniel Weissbort und Astradur Eys- teinsson (Oxford 2006)34 sind Buber und Rosenzweig mit mehreren Auszügen vertreten - aber auch Everett Fox selbst mit einem langen Auszug aus seiner Einleitung zu The Five Books o f Moses. Es scheint daher festzustehen, dass die englische bzw. amerikanische Rezeption von Bubers Übersetzungstheorie un- trennbar mit den Bibelübersetzungen von Everett Fox verbunden ist.
Anhang: Fox’ Übersetzungen biblischer Texte
1972 In the beginning (.Response 14, Summer 1972).
״ 1974 Yona: An English Rendition”, Response 22 (Summer 1974): 7-22.
״ 1977 Job 1, 2 - A translation” und ״Psalm 137 - A Translation”, Response 33 (Spring 1977): 27-30, 40.
״ 1978 The Samson Cycle in an Oral Setting” Aicheringa: Ethnopoetics 4.1 (1978): 51-68.
1986 Now These are the Names: a New English Rendition of the Book of Exo- dus, New York: Schocken Books.
1983 In the Beginning: a New English Rendition of the Book of Genesis, New York: Schocken Books.
1990 Genesis and Exodus: a New English Rendition, New York: Schocken Books.
1995 The Five Books o f Moses: Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuter- onomy (The Schocken Bible, Volume 1), New York: Schocken Books. (Pbk edition 1997)
1999 Give us a king! Samuel, Saul, and David: a New Translation of Samuel I and II, New York: Schocken Books.
33 Lawrence Venuti, The Translation Studies Reader, London & New York 2000; Venuti erwähnt das Werk von Buber und Rosenzweig kurz in der Einleitung, S. 13.34 Daniel Weissbort and Astradur Eysteinsson (eds.), Translation - Theory and Practice, Oxford 2006.