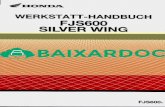Benefit of governance in DROught adaPtation - Ein Handbuch für regionale Wasserakteure
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Benefit of governance in DROught adaPtation - Ein Handbuch für regionale Wasserakteure
Ein Handbuch für regionale Wasserakteure
Praktische Anwendung Beispielmaßnahmen
Benefit of governance in DROught adaPtation
Vorwort 4
Einleitung 6
Das DROP-Projekt und dieses Handbuch 7
Der Aufbau dieses Handbuchs 8
Dürre, Wasserknappheit und Klimawandel in Europa 9
Pilotprojekt Natur 12
Allgemeine Einleitung 13
Pilotprojekt Natur - Waterschap Vechtstromen, Region Twente 14
Fakten 14
Beschreibung des Pilotprojekts 16
Pilotprojekt Natur - Somerset County Council, Region Somerset 20
Fakten 20
Beschreibung des Pilotprojekts 22
Inhaltsverzeichnis
Pilotprojekt Landwirtschaft 26
Allgemeine Einleitung 27
Pilotprojekt Landwirtschaft - Vlaamse Milieumaatschappij, Region Flandern 28
Fakten 28
Beschreibung des Pilotprojekts 30
Pilotprojekt Landwirtschaft - Waterschap Groot Salland, Region Salland 34
Fakten 34
Beschreibung des Pilotprojekts 36
Pilotprojekt Süßwasser 40
Allgemeine Einleitung 41
Pilotprojekt Süßwasser - Institution d’Aménagement de la Vilaine, Region Bretagne 42
Fakten 42
Beschreibung des Pilotprojekts 44
Pilotprojekt Süßwasser - Wasserverband Eifel-Rur, Region Eifel-Rur 48
Fakten 48
Beschreibung des Pilotprojekts 50
Fünf Voraussetzungen für die Anpassung an Trockenheit 54
Impressum 62
4
26 40 5412
6 9
DROP Handbuch | 3
Wasserknappheit und Dürren sind auf dem
Vormarsch und werden sich aufgrund des
Klimawandels voraussichtlich weiterhin
verschärfen. Es sind dringend Maßnahmen
erforderlich, um sich auf diese Veränderungen
vorzubereiten. Das Projekt ’Benefi t of
governance in DROught adaPtation (DROP)’
zielt darauf ab, die Region Nordwesteuropa
auf Perioden von Dürre und Wasserknappheit
besser vorzubereiten und so widerstands-
fähiger zu machen.
Die Grundpfeiler des DROP-Projekts sind
der transnationale Austausch und die
Bündelung von Fachkenntnissen aus
Wissenschaft, Politik und Praxis und der
Wissensaustausch zwischen regionalen
Behörden mit Hilfe von Dürre-Experten
sowie zwischen Praxis und Wissenschaft
durch Governance-Assessment.
Zunächst ist es in erster Linie dringend
erforderlich, alle Betroffenen für die
Problematik von Dürre und Wasser knappheit
zu sensibilisieren. Bisher zählten Dürre und
Wasserknappheit in Nordwesteuropa im
Gegensatz zu Hochwasser zu den weniger
wichtigen Fragen der Wasserwirtschaft.
Der Schlüssel zur Lösungsfi ndung besteht
darin, dass Wasserknappheit und Über-
fl utungen als zwei Seiten derselben
Medaille betrachtet werden.
Es gibt große Unterschiede bei den
Vorgehensweisen und organisatorischen
Ansätzen der Partner, ganz zu schweigen
von den Unterschieden in Bezug auf die
geografi schen Gegebenheiten und die
Raumordnungspolitik der beteiligten Länder.
Mit Hilfe von gemeinsamer Entwicklung
können wir diese Unterschiede überbrücken.
Das DROP-Projekt hat gezeigt, dass die
Dürre- und Wasserknappheitsproblematik
ein breites Spektrum an technischen Lösungen
in Verbindung mit einem Water-Governance-
System erfordert, mit dem geeignete Lösungen
auf lokaler, regionaler und nationaler Ebene
ergriffen werden können.
Dieses Handbuch beschreibt eine Vielzahl
von Maßnahmen und Aktivitäten, die zur
Dürrebekämpfung eingesetzt werden können
und kann damit eine Inspirationsquelle für
andere regionale Wasserakteure sein.
Ich möchte mich an dieser Stelle sehr herzlich
bei allen Partnern des DROP-Projekts bedanken.
Ohne die Pilotprojekte in den Regionen und
die damit erzielten Ergebnisse wäre dieses
Handbuch nicht zustande gekommen.
Stefan Kuks,
Vorsitzender des internationalen
Lenkungsausschusses DROP
’Wasserknappheit und Dürren sind auf dem Vormarsch
und werden sich aufgrund des Klimawandels
voraussichtlich weiterhin verschärfen.’
Im Jahr 2013 hat die Europäische Kommission eine EU-Strategie zur Anpassung
an den Klimawandel verabschiedet, die von den EU-Mitgliedstaaten begrüßt wurde.
Ziel dieser Strategie ist es, Europa klimabeständiger zu machen.
DROP Handbuch | 5
Wasserknappheit und Dürre können
negative Folgen für die Landwirtschaft,
Natur und Wasservorräte haben.
Obwohl die Probleme, die in Nord-
westeuropa durch Dürre verursacht
werden, zurzeit nicht übermäßig
sichtbar sind, müssen rechtzeitig
Maßnahmen ergriffen werden,
um die Kosten einzudämmen und
Schäden zu vermeiden. Wie können
die europäischen Regionen ihre
Einzugsgebiete widerstandsfähiger
gegen Dürreperioden machen?
In diesem Buch werden die wichtigsten
Erkennt nisse der drei Pilotprojekte (Natur,
Landwirtschaft und Süßwasser) im Rahmen
des DROP-Projekts (Benefit of governance
in DROught adaPtation) präsentiert.
In dem Zeitraum von 2012-2014 haben elf
Organisationen aus Praxis und Wissenschaft
durch ihre Zusammenarbeit bei den Pilotmaß-
nahmen und bei der Governance-Bewertung
voneinander gelernt. Das Ergebnis dieser
Zusammenarbeit besteht darin, dass die nord-
westeuropäischen Regionen besser auf Dürre
und Wasser knappheit vorbereitet sind und über
eine größere Widerstandsfähigkeit verfügen.
Das DROP-Projekt wird aus Mitteln des
INTERREG IVB Programms für Nordwesteuropa
mitfinanziert.
Das DROPProjekt und dieses Handbuch
In dem jüngst veröffentlichten ’Blue Print
on European Waters’ erklärt die Europäische
Kommission, dass die aktuelle Klimaanpassungs-
politik zwar gut ist, dass jedoch insbesondere
die Anwendung von (technischen) Lösungen
für Probleme sorgt. Deswegen steht Europa
künftig vor der Aufgabe, die Umsetzung
von Anpassungsmaßnahmen zu verbessern,
und zwar sowohl in technischer Hinsicht als
auch im Governance-Kontext. DROP zielt
auf beide Aspekte für Nordwesteuropa ab:
zum einen technische Maßnahmen zur
Anpassung an Trockenheit und zum anderen
die Bewertung des Governance-Rahmens
der Regionen. Alle sechs regionalen
Wasserakteure (die Praxispartner) haben
Untersuchungen durchgeführt und Maßnahmen
zur Anpassung an Wasserknappheit ergriffen.
Diese Maßnahmen waren am wirkungsvollsten,
wenn die jeweiligen Betroffenen beteiligt und
unmittelbar in die Maßnahmen zur Anpassung
an Trockenheit einbezogen wurden. Damit die
unterschiedlichen Interessen von Stakeholdern
auf den unterschiedlichen Ebenen von Politik
und Praxis miteinander in Einklang gebracht
werden können, ist eine starke Governance
erforderlich. Aus diesem Grund wurde das
Projektkonsortium um fünf Forschungs- und
Wissenseinrichtungen (Wissenspartner) ergänzt,
die ein Governance-Toolkit entwickelt haben.
Die Praxispartner haben dieses Toolkit in den
sechs Regionen eingesetzt. Das Toolkit und
einige Ergebnisse dieser wissenschaftlichen
Arbeit werden in einem anderen DROP-Bericht
beschrieben, und zwar im ’Governance Assess-
ment Guide’. Das vorliegende Handbuch
befasst sich schwerpunktmäßig mit den
Maßnahmen und Untersuchungen, die von
den Praxispartnern durchgeführt wurden.
Es möchte eine Inspirationsquelle und ein
Leitfaden für andere regionale Behörden/
Akteure bei der Suche nach innovativen
Anpassungslösungen für Dürre und
Wasserknappheit sein. Die Pilotprojekte
werden ausführlicher auf der Internetseite
www.dropproject.eu beschrieben.
Die einzelnen Kapitel zu den Themen Natur,
Landwirtschaft und Süßwasser könnten den
Eindruck erwecken, dass diese Themen
voneinander unabhängig zu betrachten
sind. Nichts ist weniger wahr. Wenn es um
den Umgang mit Dürre und Wasserknappheit
geht, sind Natur, Landwirtschaft und
Süßwasser eng miteinander verbunden.
Einleitung
DROP Handbuch | 7
DROPPartner
DROP ist ein transnationales Projekt, das Fachkenntnisse aus Wissenschaft,
Politik und Praxis miteinander vereint. Sechs Praxispartner und fünf Kenntnispartner
arbeiten gemeinsam an der Realisierung des Projekts. Aus den Niederlanden sind
die ’Waterschap Vechtstromen’ (Lead Partner), die ’Waterschap Groot Salland’
sowie die ’Universität Twente’ beteiligt. Deutschland wird vom ’Wasserverband
Eifel-Rur’ vertreten. Die französischen Partner sind die ’Institution d’Aménagement
de la Vilaine’, das ’IRSTEA’ und die ’Université François Rabelais’. Belgien wird von
der ’Vlaamse Milieumaatschappij’ und der Brüsseler Filiale des ’Ecologic Institute’
vertreten. Für Großbritannien beteiligen sich der ’Somerset County Council’
und die ’University of Manchester’.
Zur Darstellung dieser Verbindung endet
das Buch mit einer Abbildung von drei sich
überschneidenden Kreisen, die den Zusam-
menhang zwischen den drei Pilotprojekten
symbolisieren (Seite 60). Die DROP-Studien
und -Maßnahmen in den Kreisen verdeut-
lichen, dass der Einfluss der meisten Studien
und Maßnahmen über die Bereiche Natur,
Landwirtschaft oder Süßwasser hinaus reicht.
Der Aufbau dieses Handbuchs
Das vorliegende Handbuch ist folgender-
maßen aufgebaut: Im Anschluss an die
Beschreibung des allgemeinen Rahmens
in Bezug auf Dürre, Wasserknappheit und
Klimawandel in Europa (Kapitel 2) wird auf die
drei Pilotprojekte eingegangen, und zwar das
Pilotprojekt Natur (Kapitel 3: Regionen Twente
und Somerset), das Pilotprojekt Landwirtschaft
(Kapitel 4: Regionen Salland und Flandern) und
das Pilotprojekt Süßwasser (Kapitel 5: Regio-
nen Eifel-Rur und Bretagne). Jedes Kapitel
umfasst eine Beschreibung der Untersuch-
ungen und Maßnahmen, die in der jeweiligen
Region durchgeführt wurden. Diese Kapitel
werden mit Textkästchen vervollständigt,
die Informationen über den spezifischen
Governance-Kontext in den Regionen ent-
halten und somit eine zusammenfassende
Bewertung des jeweiligen Governance-Teams
darstellen. In Kapitel 6 werden die Erfahrungen
und Empfehlungen der DROP-Partner aus
den drei Pilotprojekten formuliert.
Die einzelnen Kapitel zu den Themen Natur,
Landwirtschaft und Süßwasser könnten
den Eindruck erwecken, dass diese Themen
voneinander unabhängig zu betrachten sind.
Nichts ist weniger wahr. Wenn es um den
Umgang mit Dürre und Wasserknappheit geht,
sind Natur, Landwirtschaft und Süßwasser
eng miteinander verbunden. Zur Darstellung
dieser Verbindung endet das Buch mit einer
Abbildung von drei sich überschneidenden
Kreisen, die den Zusammenhang zwischen
den drei Pilots symbolisieren (Seite 60).
Die DROP-Studien und -Maßnahmen in
den Kreisen verdeutlichen, dass der Einfluss
der meisten Studien und Maßnahmen über
die Bereiche Natur, Landwirtschaft oder
Süßwasser hinaus reicht.
Das Phänomen der Wasserknappheit und Dürre
tritt immer häufiger und in immer größeren
Teilen der Europäischen Union auf. Die sich
daraus ergebende Herausforderung wird in
der Mitteilung ’Antworten auf die Heraus-
forderung von Wasserknappheit und Dürre
in der Europäischen Union’ (2007) und in dem
’Blueprint to Safeguard Europe’s Waters’ (2012)
anerkannt. Entsprechende Studien zeigen,
dass im Jahr 2007 11 % der europäischen
Bevölkerung und 17 % des EU-Gebiets
von dieser Problematik betroffen waren.
Dürre, Wasserknappheit und Klimawandel in Europa
’Veränderte Trocken
perioden stehen in
unmittelbarem
Zusammenhang mit
veränderter Temperatur
und Flächennutzung.’
DROP Handbuch | 9
In der oben genannten Mitteilung erklärte die
Europäische Kommission, dass die Tatsache,
dass der Wasserbedarf die Wasserressourcen
übersteigt, ein strukturelles Ungleichgewicht
verursacht, das sich in Europa in zunehmendem
Maße zu einem Problem entwickelt. In den
vergangenen dreißig Jahren ist die Zahl und
Intensität der Dürreperioden in der EU steil
angestiegen. Veränderte Trockenperioden
stehen in unmittelbarem Zusammenhang mit
veränderter Temperatur und Flächennutzung.
Im vergangenen Jahrzehnt (2002-2011) lag
die Durchschnittstemperatur ganze 1,3 Grad
Celsius über der vorindustriellen Temperatur.
Prognosen zu künftigen Klimaverhältnissen
lassen erkennen, dass sich dieser Trend in
den kommenden Jahrzehnten wahrscheinlich
fortsetzen wird. In verschiedenen Regionen
treten Extremereignisse wie Hitzewellen,
Waldbrände, Überflutungen und Dürren
häufiger auf oder wird dies voraussichtlich
künftig der Fall sein. Eine veränderte
Flächennutzung verstärkt diesen Effekt,
was zu häufigeren und intensiveren
Dürre- und Wassermangelperioden führt.
Die Hitzewelle und Dürre, die Europa im
Sommer 2003 trafen, kosteten tausende
Menschen das Leben und verursachten hohe
Wirtschaftsschäden, die sich alleine in der
Landwirtschaft auf 10 Milliarden Euro beliefen.
Die Zahl der von Dürre (oder einem zeitweiligen
Rückgang der Wasserzufuhr) betroffenen
Gebiete und Menschen erhöhte sich von 1976
bis 2006 um 20 %. Es wird damit gerechnet,
dass sich der Wassermangel in naher Zukunft
weiter verschärft, wenn die Temperaturen
infolge des Klimawandels weiterhin steigen.
Gleichzeitig wird sich der Druck auf die immer
knapperen Wasserressourcen infolge des
veränderten und konkurrierenden Wasser-
bedarfs für Landwirtschaft, Trink- und
Brauchwasser und Umwelt-/Naturströme
weiter erhöhen. Eine Anpassung von
Nachfrage- und Angebotssystemen ist
erforderlich, um künftig hohe Kosten zu
vermeiden. Viele europäische Länder
entwickeln politische Konzepte und
Strategien zur Anpassung an Trockenheit.
Ihre Umsetzung steckt jedoch noch in den
Kinderschuhen. Es bedarf noch zahlreicher
Untersuchungen, um die Wirksamkeit von
Anpassungsmaßnahmen in Dürre- und
Wassermangelperioden zu erproben und
wichtige Stakeholder und Nutzer in die
Planung und Beschlussfassung einzubeziehen.
Die Zeit, dass Dürre und Wasserknappheit
nur in den heißen und trockenen Mittelmeer-
gebieten auftraten, ist vorbei. Mittlerweile wird
auch Nordwesteuropa mit diesem Problem
konfrontiert. Obwohl das Problem nicht
übermäßig sichtbar ist, müssen rechtzeitig
Maßnahmen ergriffen werden, um die Kosten
einzudämmen und Schaden zu vermeiden.
’Die Hitzewelle und Dürre, die Europa im Sommer 2003
trafen, kosteten tausende Menschen das Leben und
verursachten hohe Wirtschaftsschäden, die sich alleine
in der Landwirtschaft auf 10 Milliarden Euro beliefen.’
DROP Handbuch | 11
Die Aufgabe
Naturschutz, Produktion von Trink-
wasser und landwirtschaftliche
Erzeugung finden in der natürlichen
Umgebung häufig nebeneinander
statt. Der Wasserbedarf dieser
Sektoren steht jedoch nicht immer
miteinander im Einklang. Gerade in
Dürreperioden sollte dieser Bedarf
abgestimmt werden. Wenn Konflikt-
situationen auftreten, ist es wichtig,
dass die Widerstandsfähigkeit
von Naturgebieten erhöht wird,
damit negative Auswirkungen auf
Fauna und Flora ohne schädliche
Folgen für die angrenzende
Flächennutzung oder Trinkwasser-
gewinnung vermieden werden.
Obwohl die unterschiedlichen
Interessenslagen auf den ersten
Blick widersprüchlich erscheinen,
gibt es verschiedene Möglichkeiten
für eine Zusammen arbeit, die sich
positiv auf die Anpassung und
Widerstands fähigkeit in allen Sektoren
auswirkt. Die Aufgabe besteht darin,
Governance-Strukturen und praktische
Maßnahmen zu finden, die den
Natur schutz mit einer wirtschaftlich
vertretbaren und nachhaltigen
Landwirtschaft und Trinkwasser-
produktion vernetzen.
Pilotprojekt
NaturAllgemeine Einleitung
Die Effekte des Temperaturanstiegs und von Dürre auf die Natur sind nicht nur vielfältig
und komplex, sondern auch sehr weitreichend. Während einer Dürreperiode sinkt der
Grundwasserspiegel, konkurriert die Vegetation um Wasser, wodurch sie vertrocknet,
und es kann eine beschleunigte Mineralisierung (Eutrophierung) auftreten. Untersuchungen
haben ergeben, dass die zunehmende Dürre zum Teil für die vermehrte Emission von CO2
in die Atmosphäre verantwortlich ist, und zwar infolge der verstärkten Zersetzung von
totem organischem Material, beispielsweise in Moorgebieten. In Twente (NL) und Somerset
Levels (UK) wurden verschiedene innovative Maßnahmen im Zusammenhang mit Dürre
und Naturschutz erprobt und umgesetzt. Diese Projekte zeigen, wie sich Landwirtschaft
und Naturschutz miteinander vereinen lassen. Dieser Effekt lässt sich zusätzlich verstärken,
indem bei Landwirten und Naturschutzorganisationen durch Sensibilisierung und Einbindung
in die Maßnahmen ein Verantwortungsbewusstsein entwickelt wird.
’Wir möchten die richtige Menge Wasser in der
richtigen Qualität am richtigen Ort zur richtigen Zeit.’
DROP Handbuch | 13
Region
Twente, Niederlande
Projektumfang
Vom Landwirtschaftsbetrieb (weniger als 1 km2)
bis zum Einzugsgebiet (100 km2)
Projektverantwortung
Waterschap Vechtstromen
In Zusammenarbeit mit
Provinz Overijssel, Städten und Gemeinden
und Staatsbosbeheer.
Weitere Informationen
Waterschap Vechtstromen
www.vechtstromen.nl
Koen Bleumink: [email protected]
Fakten
T W E N T E | N I E D E R L A N D E
’Die grundwassersensible
Flora reagiert sehr schnell
auf wasserstandserhöhende
Maßnahmen. Innerhalb kürzester
Zeit gedeihen in dem Gebiet
besondere Pflanzen.’
Aufgabe
Die erste Aufgabe bestand darin, die Flexibilität und
Rückhaltekapazität des Gewässersystems zu erhöhen,
um die Natur und die Landwirtschaft bei Dürre und
Hochwasserereignissen zu unterstützen. Die zweite
Aufgabe bestand in der Sensibilisierung der Betroffenen.
Maßnahmen können ef fizienter umgesetzt werden,
wenn die Stakeholder sich der Folgen schwerer
Dürren bewusst sind. Die dritte Aufgabe umfasste
die Entwicklung eines gemeinsamen, umfassenderen
Ansatzes für eine Vielzahl von kleinen Einzelprojekten.
Pilotprojekt Natur ›
Waterschap Vechtstromen
Region Twente
1T W E N T E | N I E D E R L A N D E
DROP Handbuch | 15
Beschreibung des Pilotprojekts
Kontext
Der Wasserverband ’Waterschap
Vechtstromen’ im Osten der Niederlande
ist für die Wasserwirtschaft und Abwasser-
reinigung in der Region Twente zuständig.
In den vergangenen Jahren ist in trockenen
Sommern Wasserknappheit auf den Sand-
böden im Nordosten der Region Twente
aufgetreten. Infolge des Klimawandels
nimmt der durchschnittliche jährliche
Niederschlagsüberschuss (Niederschlag
abzüglich Verdunstung) ab. Das bedeutet,
dass schon bald weniger Wasser verfügbar
ist, was sowohl für die Landwirtschaft als
auch für die Natur durch Schäden an Nutz-
pflanzen und an der terrestrischen und
aquatischen Natur problematisch ist.
Ca. 90 % der Gewässer im Nordosten von
Twente führen bereits zu wenig Wasser oder
trocknen aus. Die Austrocknung hat eine
große Auswirkung auf das Leben im Wasser.
Niedrigere Grundwasserstände verringern
den Gewässerabfluss. Dieser Effekt tritt
insbesondere im Frühjahr und Sommer auf,
wenn die Niederschlagsmengen niedrig
sind und der Wasserstand im Fluss vom
Grundwasser aufrechterhalten wird.
Die Austrocknung wird nicht nur Schäden
an der Lebensgemeinschaft in Flüssen und
in Flusstälern verursachen, sondern auch auf
höher gelegenen Flächen im Einzugsgebiet.
Die Folgen für das Einzugsgebiet sind
erheblich und können nur teilweise durch
Maßnahmen beseitigt werden.
Strategie und Maßnahmen
Es wurden sieben Maßnahmen ausgeführt,
in deren Rahmen Entwässerungssysteme
entfernt, Gräben zugeschüttet, Gewässer
vertieft und Rückhalteflächen angelegt
wurden. Es wird damit gerechnet,
dass diese Maß nahmen zu einer Anhebung
des Grund wasserstands führen, wodurch
ein Wasser puffer für trockene Perioden
entsteht. Darüber hinaus wurden Wasser-
bewirtschaftungspläne für fünfzehn Land-
wirtschaftsbetriebe erstellt und es wurden
zwei Forschungsprojekte in Bezug auf
eine pegelgesteuerte Entwässerung und
Reduzierung des Oberflächenabflusses
durchgeführt.
Wasserbewirtschaftungspläne
Gemeinsam mit den Landwirten wurden
speziell auf ihre individuelle Situation
abgestimmte Wasserbewirtschaftungspläne
erstellt. Die Pläne enthalten praktische
Informationen darüber, wie das Wasser-
gleichgewicht durch Wasserrückhalt
beeinflusst werden kann. Von diesen
Maßnahmen profitieren sowohl die Landwirte
als auch die angrenzenden Naturgebiete.
Diese Pläne zielen auf die Entwicklung von
Maßnahmen zur Anpassung an Trockenheit
ab, die zwar einen kleineren Umfang haben,
jedoch in das Gesamtkonzept für das Gebiet
passen. Die intensive Kommunikation mit
den Landwirten hat eine Sensibilisierung
für das Thema bewirkt und auch andere
Stakeholder angeregt, sich mit der
Anpassung an Trockenheit zu befassen.
DROP Handbuch | 17
Governance
In den Niederlanden wird das Problem
der Dürre und Wasserknappheit erst
seit kurzem als solches erkannt.
Die staatlichen Präventivmaßnahmen
beschränken sich auf freiwillige
Vereinbarungen. Vor diesem Hinter-
grund sind Partnerschaften mit
möglichst vielen Stakeholdern am
erfolgversprechendsten. In Twente
wurde eine intensive Zusammenarbeit
mit den Stakeholdern entwickelt.
Es wurde ein Vertrauensnetzwerk
aufgebaut. So werden bei der Planung
von Maßnahmen zur Dürrebekämpfung
die Sichtweisen und Ziele der ver-
schiedenen Partner berücksichtigt.
Dadurch entsteht Kohärenz und es
wird eine erfolgreiche Umsetzung
von Maßnahmen ermöglicht.
Darüber hinaus kann diese
Vorgehensweise als erfolgreiche
Anpassung im Umgang mit einem
in vielerlei Hinsicht zersplitterten
Governance-Kontext für die
Umsetzung von Maßnahmen
zur Dürreprävention gelten.
Während Inkohärenz und
Zersplitterung normalerweise
zu einem Patt und schließlich zum
Desinteresse führen, ist in Twente
das Bewusstsein entstanden,
dass die Beteiligten aufeinander
angewiesen sind und dass sie nicht
die Dominanz des anderen fürchten
müssen.
Erprobung eines pegelgesteuerten
Entwässerungssystems in der Nähe
eines Naturschutzgebiets
Viele Vertreter der Wasserwirtschaft halten
die pegelgesteuerte Entwässerung für das
beste Mittel, um die Erschöpfung der Wasser-
ressourcen zu verringern und die landwirt-
schaftliche Nutzung von Flächen zu optimieren.
Für diese Annahme fehlte jedoch bisher
eine gute theoretische Beweisführung.
Über die Auswirkungen der pegelgesteuerten
Entwässerung auf die Natur ist relativ wenig
bekannt. Eine Studie im Naturschutzgebiet
Duivelshof, das inmitten von Flächen liegt,
die durch intensive Landwirtschaft ausgetrock-
net sind, zielte auf die Wasserversorgung
der Natur und der Landwirtschaft bei lang
anhaltenden Dürren ab. Die Waterschap
Vechtstromen hat zu diesem Zweck ein
pegelgesteuertes Entwässerungssystem
in Verbindung mit der Erhöhung der Entwäs-
serungsbasis eines kleinen, aus getrockneten
Naturschutzgebiets eingerichtet.
Untersuchungen und Maßnahmen zur
Reduzierung des Oberflächenabflusses
Oberflächenabflüsse im Nordosten der Region
Twente lassen sich in der Regel auf hügligem
Gelände beobachten, auf dem Erdschichten
mit einer geringen Durchlässigkeit an die
Oberfläche treten. Extreme Niederschlags-
ereignisse können in Verbindung mit
undurchlässigen oberen Erdschichten zu
einer Wasseransammlung an der Oberfläche
führen. Wenn die Niederschläge kurz nach
der Bodendüngung auftreten, bilden sich
Pfützen mit hohen Phosphatkonzentrationen
und es gelangen Phosphate in Oberflächen-
gewässer (Eutrophierung). Es wurden
Untersuchungen zur Beurteilung der poten-
ziellen Effekte möglicher Maßnahmen zur
Reduzierung des Oberflächenabflusses
durchgeführt (u.a. Konturpflügen und
Errichtung von Erdwällen an tiefer gelegenen
Feldabschnitten für die Versickerung von
Niederschlägen).
DROP Handbuch | 19
Standort
Somerset Levels, Großbritannien
Projektumfang
100 km2, 60.000 Einwohner
Pilotprojektverantwortung
Somerset County Council
In Zusammenarbeit mit
Farming & Wildlife Advisory Group South West
(FWAG SW), Royal Society for the Protection of Birds
(RSPB), Naturschutzverbänden, Landwirten und
(privaten) Grundstückseigentümern.
Weitere Informationen
Somerset County Council
www.somerset.gov.uk
Steve Dury: [email protected]
Fakten
S O M E R S E T | G R O S S B R I T A N N I E N
’Es ist eine große Herausforderung,
nach dem Extremhochwasser
im Jahr 2013 das Thema Dürre
anzusprechen. Wir arbeiten
an Maßnahmen, die sowohl
auf Hochwasser als auch auf
Dürre abzielen.’
Pilotprojekt Natur ›
Somerset County Council
Region Somerset
2S O M E R S E T | G R O S S B R I T A N N I E N
Aufgabe
Die Aufgabe bestand darin, die Bedürfnisse des Naturschutzes
und die Anforderungen und Bedürfnisse der Landwirtschaft
bei der Anpassung an Trockenheit miteinander in Einklang
zu bringen. Zu diesem Zweck war eine Überarbeitung der
wasserwirtschaftlichen Infrastruktur und des Governance
Kontextes erforderlich. Es wird damit gerechnet, dass der
Klimawandel erhebliche Folgen für die Landwirtschaft und
die Bodenbewirtschaftung haben wird. Vor dem Hintergrund
dieser Erkenntnis waren Maßnahmen für die Erhaltung von
Gewässersystemen erforderlich und es mussten innovative
Maßnahmen für das Wassermanagement untersucht werden.
DROP Handbuch | 21
Beschreibung des Pilotprojekts
Kontext
Die Somerset Levels sind ein dünnbesiedeltes
Feuchtgebiet im Herzen der Grafschaft
Somerset. Das Gebiet besteht aus
Seetonebenen an der Küste und Moorböden
im Inland. Die Moorböden der Somerset
Levels umfassen zahlreiche verschiedene
Ökosystemfunktionen wie etwa Nahrungs-
mittelerzeugung, Funktion als natürliches
Habitat, CO2-Speicherung und Schutz der
Kulturlandschaft. Die Moorböden reagieren
empfindlich auf plötzliche und irreversible
Veränderungen, die eine unmittelbare Folge
von Dürre sind. Bei diesen Veränderungen
kann es sich um eine Absenkung des Bodens
durch Wasserverlust handeln, was wiederum zu
Problemen führt, den künstlich eingestellten
Wasserstand auf Landschaftsebene noch in
einem effektiven Kosten-Nutzen-Verhältnis
aktiv zu regulieren. Aus diesem Grund ist
eine solide Wasserwirtschaft in diesem Gebiet
eine wichtige Voraussetzung für den Erhalt
von typischen Landschaftselementen wie etwa
exponierten Moorböden oder der Flora und
Fauna in Feuchtgebieten (Wiesen, Gräben).
In Somerset lassen sich infolge des Klima-
wandels veränderte Niederschlagsmuster
feststellen, die sich vermutlich in Form
von niederschlagsreicheren Wintern und
trockeneren Sommern manifestieren werden.
Die Folgen für die Bodenbewirtschaftung
und die Landwirtschaft sind einschneidend.
Zur Erzielung einer höheren Stabiltät bei sich
veränderndem Klima müssen die Infrastruktur
der Wasserwirtschaft und die Governance-
Bedingungen überarbeitet werden. Das Gebiet
benötigt Wasserrückhaltemöglichkeiten im
Winter zur Verringerung des Hochwasserrisikos
und zur Speicherung des geringfügigen
Sommerniederschlags. Für die Wasser-
retention gibt es verschiedene Möglichkeiten,
beispielsweise die Einrichtung von Rückhalte-
flächen in Flussauen, die Schaffung von
Feuchtgebieten als Lebensraum, von Teichen
zur Wasserspeicherung sowie Wasserrecycling,
Sammelschächte und -becken. In Bezug auf
Landwirtschaftsbetriebe wird sich der Klima-
wandel voraussichtlich ganz erheblich auf die
Bodenbewirtschaftung und die Landwirtschaft
auswirken.
Landwirte werden Maßnahmen zur Einsparung
von Wasser ergreifen und innovative Wasser-
wirtschaftsmethoden in der Landwirtschaft
ausprobieren müssen. Auch Naturschützer
haben bereits die Notwendigkeit erkannt,
auf Gebietsebene einer Landschaft zu arbeiten,
um Probleme mit verstreuten und isolierten
Lebensräumen angemessen zu erfassen.
Der Klimawandel bietet einen zusätzlichen
Anreiz auf Gebietsebene auch beim Manage-
ment und der Anpassung an Hochwasser
und Trockenheit zu agieren. Es besteht die
Notwendigkeit, dass ein Gebiet als Landschaft
erfasst wird, in der sich Flora und Fauna
beim Klimawandel angemessen und damit
nachhaltig verändern können.
DROP Handbuch | 23
Strategie und Maßnahmen
Somerset hat eine Reihe innovativer Methoden
zur Erhöhung der Dürrebeständigkeit
ein geführt. Die landwirtschaftliche Beratungs-
organisation FWAG SW hat am Oberlauf
des Flusses Parrett Modelle und einen
Technologietransfer in Bezug auf Bewässe-
rungspläne und das Wasserversorgungs-
management entwickelt. Der Wasserbedarf
für landwirtschaftliche Zwecke (u.a. Kartoffel-
anbau) ist in diesem Gebiet des ’Upper
Parrett’ hoch, und der in Zusammenhang
mit der Bewässerung erforderliche Wasser-
bedarf muss dringend reduziert werden.
Die Entnahme von Bodenfeuchtigkeitsproben
und die Datenanalysen haben einen wirk-
sameren und wirtschaftlicheren Einsatz
von Wasser für die Bewässerung ermöglicht.
Darüber hinaus hat FWAG SW in Zusammen-
arbeit mit Landwirten Versuche mit ver-
schiedenen bodendeckenden Pflanzenarten
zur Bildung von organischem Material durch-
geführt. Eine gesunde Bodenstruktur und
große Mengen organischer Stoffe sind eine
wichtige Voraussetzung für eine Beständigkeit
gegen über den Auswirkungen von Vernässung
und Aus trocknung. Dies ist insbesondere
für Ackerbaubetriebe wichtig, in denen
aufgrund der Entfernung von Biomasse
weniger organisches Material nachgeliefert
als entnommen wird. Die Ergebnisse belegen,
dass diese Methoden erfolgreich waren;
sie führten zu einer Erhöhung der organischen
Boden substanz, der Wasserspeicherfähigkeit
des Bodens, der Aktivität der Bodenmikro-
organismen und der Zahl der Regenwürmer
sowie zu einer Verringerung der Bodendichte.
’Somerset muss Fehl anpassungen zwischen
diesen beiden Handlungsfeldern verhindern
und die Anpassungsmaßnahmen für Hochwasser
und Dürren integrieren.’
Governance
Die Dürreperiode im Süden
Englands in dem Zeitraum 2010-2012
hat eine erhebliche Beschleunigung
der Anpassungs-, Vorbereitungs-
und Kommunikationsprozesse im
Zusammenhang mit Dürre und
Wasserknappheit bewirkt.
Mittlerweile wurden Dürre und
Wasserknappheit in unterschiedlicher
Form in die Wasser- und Krisen-
planung verschiedener Stakeholder
integriert, zu denen u.a. die regionalen
Wasserwerke, die Environment
Agency, der zuständige Wasser-
und Bodenverband und andere
Vertreter von Kommunen und
Beratungsstellen gehören.
Während und nach dieser Dürre-
periode hat man sich verstärkt um
die Koordinierung der Aktivitäten
der Betroffenen für Dürre und die
Wasserknappheit bemüht. Dies ist
eine Verbesserung im Vergleich zu
der fragmentierten Planung und
Kommunikation in Bezug auf Dürre
und Wasserknappheit in der Ver-
gangenheit. Da das Gebiet jedoch
auch hochwassergefährdet ist
(z.B. in den Wintern 2012 und 2013/14),
muss Somerset Fehlanpassungen
zwischen diesen beiden Handlungs-
feldern verhindern und die
Anpassungsmaßnahmen für
Hochwasser und Dürren integrieren.
In einer bewirtschafteten Landschaft des
Flachlandes ist der Erhalt von Moorböden und
der damit zusammenhängenden Lebensräume
von einem funktionierenden Gewässersystem
abhängig. In Dürreperioden können Probleme
im Gewässersystem eine Unterbrechung
der Wasserversorgung größerer Gebiete
verursachen, was zu einer Austrocknung der
Moorböden führt. Die Naturschutzverbände
RSPB und Somerset Wildlife Trust haben eine
Bestandsaufnahme der Probleme in dem
Gewässersystem von Naturschutzgebieten
vorgenommen, damit Maßnahmen zur
Verbesserung der Wasser zufuhr geplant
und umgesetzt werden können.
Ebenso wie an anderen Orten in Nordwest-
europa lässt sich etwa seit Beginn des
neunzehnten Jahrhunderts ein beträchtlicher
Rückgang von Flachlandhochmooren fest-
stellen. In Großbritannien hat sich die Fläche
des überwiegend unberührten Flachland-
hochmoores um schätzungsweise 94 %
verringert. Der Großteil des Moores ist
dem Torfabbau und der landwirtschaft lichen
Intensivierung zum Opfer gefallen. Die ver-
streuten Restmoore, die sich jetzt allesamt in
Naturschutzgebieten befinden, liegen höher
als das abgetragene Umland und lassen
sich deswegen nur schwer feucht halten.
Die größten Hochmoorreste (ca. 20 ha in
Westhay Moor und ca. 10 ha in Street Heath)
werden vom Somerset Wildlife Trust verwaltet,
der gemeinsam mit RSPB ein umfassendes
Maßnahmenprogramm geplant und
um gesetzt hat, um die Dürrebeständigkeit
dieses empfind lichen, aber wertvollen
Lebensraums zu erhöhen. Die Maßnahmen
umfassten u.a. die Ausdünnung von Sträuchern,
die Renivellierung von Moorböden und die
Verbesserung von Strukturen zur Regen-
wasserspeicherung.
DROP Handbuch | 25
Die Aufgabe
In der Vergangenheit haben sich
bereits Dürren mit schweren Folgen
für die Agrarproduktion ereignet.
Es wird damit gerechnet, dass
Dürren infolge des wachsenden
Wasser bedarfs und des Klimawandels
künftig noch größere Auswirkungen
haben werden. Die Zunahme der
Häufigkeit, Dauer und Intensität von
Dürren und Wasserknappheit wird
zu größeren Risiken beim Anbau von
Nutzpflanzen und somit zu häufigeren
und schwereren dürrebedingten
Agrarkrisen führen.
Die Landwirtschaft steht vor der
Aufgabe, ihre nachhaltige Beständig-
keit gegenüber Dürre und Wasser-
knappheit zu erhöhen und gleichzeitig
wirtschaftlich lebensfähig zu bleiben.
Hierbei sind ihre Umwelt- und
Sozialwerte zu erhalten. Es wird
angenommen, dass die proaktive
Investition in Strategien und in die
Entwicklung von Landwirtschaftsmaß-
nahmen zur Anpassung an Trockenheit
günstiger sind als die Kosten, die der
Wirtschaft, Umwelt und Gesellschaft
infolge künftiger Dürren entstehen.
Das Pilotprojekt Natur hat bereits
einige Aspekte der komplexen
Zusammen hänge beleuchtet, wenn
man Natur schutzgebiete an die
Trockenheit anpasst, in denen auch
Landwirtschaft betrieben wird. Das
Pilotprojekt Landwirtschaft wird diese
komplexen Zusammenhänge aus der
Sicht der Landwirtschaft untersuchen.
Pilotprojekt
LandwirtschaftAllgemeine Einleitung
Das Dürrephänomen kann aus verschiedenen Perspektiven betrachtet werden. Die meteorologische
Perspektive bezieht sich auf das Ausmaß der Dürre, gemessen an einem Normal- oder Durch-
schnittswert, und auf die Dauer der Dürreperiode. Die hydrologische Perspektive konzentriert
sich auf den – Monate oder Jahre dauernden – niedrigen Wasserabfluss in Fließgewässern
oder Speichern. Hydrologische Dürre kann ein natürliches Phänomen sein oder das Ergebnis
menschlicher Tätigkeiten, die auf der Kultivierung des Landes beruhen. Veränderungen in der
Landnutzung und der Umfang der Bodendegradation können die Stärke und Häufigkeit von
hydrologischen Dürren beeinflussen. Die agrarwirtschaftliche Perspektive bezieht sich auf den
Effekt von meteorologischer und hydrologischer Dürre auf die Agrarproduktion und konzentriert
sich auf Niederschlagsdefizite, Differenzen zwischen aktueller und potenzieller Evapotranspiration,
Bodenwasserdefizite, niedrige Grundwasserpegel, Speichervorräte und so weiter. In Flandern (B)
wurden Instrumente für die Modellierung des Einflusses auf und die Überwachung von agrarwirt-
schaftlicher Dürre entwickelt. In Salland (NL) wurde ein Pumpwerk mit einer innovativen Steuerung
errichtet, das Wettervorhersagen nutzt.
’Die Bewältigung der Auswirkungen von Dürre auf die
Landwirtschaft erfordert die Anpassung von bestehenden
Instrumenten für diese neuen Herausforderungen und
zwingt verschiedene Interessensgruppen gemeinsame
Lösungen zu erarbeiten.’
DROP Handbuch | 27
Region
Flandern, Belgien
Projektumfang
In ganz Flandern wurden Dürre-Indikatoren für die Über-
wachung entwickelt. Für die Einzugsgebiete der Velpe und
der Dommel wurden hydrologische Modelle entwickelt.
Projektverantwortung
Vlaamse Milieumaatschappij
In Zusammenarbeit mit
Verschiedenen Referaten und Dienststellen der
flämischen Regierung, Vertretern von Wasserbehörden,
Landwirtschaftsverbänden, lokalen Behörden.
Weitere Informationen
Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)
www.vmm.be, www.waterinfo.be
Willem Defloor: [email protected]
Fakten
F L A N D E R N | B E L G I E N
’Ein besseres Verständnis
des Auftretens und der Effekte
von Dürren sorgt für effektivere
und effizientere Zukunfts
strategien zur Anpassung
an und zur Bekämpfung
von Trockenheit.’
Aufgabe
Die Aufgabe bestand darin eine Methode zu entwickeln,
die eine Überwachung und Berichterstattung über den
Zustand der Trockenheit in Flandern beinhaltet und so ein
proaktives Wassermanagement ermöglicht. Dieses beinhaltet
auf der Ebene Flanderns eine Abschätzung der Auswirkungen
von Dürre auf die Landwirtschaft sowie die Bewertung von
Maßnahmen für die Anpassung an die Trockenheit und für
eine Bekämpfung der Dürre.
Pilotprojekt Landwirtschaft ›
Vlaamse Milieumaatschappij
Region Flandern
1F L A N D E R N | B E L G I E N
DROP Handbuch | 29
Kontext
Die vorhandenen Überwachungs- und
Model lierungstools der Wasserwirtschaft
sind wesentlich stärker auf Hochwasser aus-
gerichtet als auf Dürre. Dennoch können
landwirtschaftliche Dürren schwere soziale
und wirtschaftliche Folgen haben, wenn sie
nicht korrekt vorhergesagt und überwacht
werden. In Flandern musste eine Auswahl
von Indikatoren für die Überwachung und
Berichterstattung über den Dürrezustand
getroffen werden. Zudem müssen bestehende
hydrologische Modelle dahingehend
angepasst werden, dass sie für die
Modellierung niedriger Abflüsse und
zur Unterstützung bei der Formulierung
von Strategien für die Anpassung an Trocken-
heit für die Landwirtschaft verwendet werden
können. Mit diesem Projekt wurden zwei
Ziele verfolgt: zum einen die Einrichtung von
geeigneten Tools für die Dürreüberwachung
und Impact-Modellierung, und zum anderen
die Bereitstellung wichtiger Informationen
für künftige Dürremanagementstrategien.
In diesem Pilotprojekt wurden Dürreüber-
wachungsindikatoren für ganz Flandern
entwickelt. Spezifische Dürre-Impact-Modelle
wurden für die Einzugsgebiete der Velpe
(141 km²) in der belgischen Lehmregion und
für das Einzugsgebiet der Dommel (176 km²)
auf Sandböden in Ostflandern entwickelt.
Beschreibung des Pilotprojekts
Strategie und Maßnahmen
Es wurde ein operatives Indikatorenset für die
Dürreüberwachung und -berichterstattung
entwickelt (u.a. standardisierter Niederschlags-
index, Niederschlagsdefizit, standardisierter
Gewässerabflussindex). Mit diesen Indikatoren
können unterschiedliche Dürre-Arten (meteo-
rologische, agrarwirtschaftliche und hydro-
logische Dürre) auf lokaler Ebene (Messstation)
und auf einer übergeordneten Ebene (in diesem
Fall Flandern) überwacht werden. Die Integration
dieser Indikatoren in den bestehenden Daten-
management- und Berichterstattungsrahmen
bei VMM wirkte sich positiv auf eine wirksamere
Berichterstattung über den Dürrezustand aus
und ist gleichzeitig ein technischer Schritt
hin zur Entwicklung einer integralen Wasser-
wirtschaftsstrategie, die sowohl auf hohe
Abflüsse (Hochwasser) als auch auf niedrige
Abflüsse (Dürren) abzielt. Im Jahr 2014 wurde
gemeinsam mit fünf flämischen Wasser behörden
das Webportal www.waterinfo.be eingerichtet.
Dürre ist eines der vier Kernthemen dieses
Portals. Auf dieser Website werden die Dürre-
Indikatoren veröffentlicht, die im Rahmen des
DROP-Pilotprojekts entwickelt werden.
Es wurden Modellierungstools entwickelt,
die sich mit den Auswirkungen von Dürren auf
verschiedene Aspekte des Gewässersystems
(u.a. Bodenfeuchte, Gewässerabfluss) und
auf die Agrarproduktion (Ertragseinbußen)
befassen.
Niederländische und flämische Stakeholder aus dem Agrarsektor diskutieren während
eines Treffens mögliche Lösungen für die dürrebedingte Landwirtschaftsproblematik.
DROP Handbuch | 31
’Die Modellierungs
ergebnisse für die
PilotEinzugsgebiete
lassen unterschiedliche
DürreEffekte erkennen.’
Für die beiden Pilot-Einzugsgebiete wurden
SWAT- (Soil and Water Assessment Tool) und
SWAP- (Soil - Water - Atmosphere - Plant)
Modelle eingerichtet. Mit diesen Modellen
können die Folgen von Dürre für die Wasser-
versorgung und die Nutzpflanzenproduktion
eingeschätzt werden. In der Vergangenheit
aufgetretene Dürren (zum Verständnis der
aktuellen Dürre-Effekte), aktuelle Dürren
(für operative Dürrewirtschaft) und prognos-
tizierte künftige Dürren (zur Unterstützung von
Maßnahmen zur Anpassung an Trockenheit)
können modelliert werden. Die Modellierungs-
ergebnisse für die Pilot-Einzugsgebiete lassen
unterschiedliche Dürre-Effekte erkennen,
je nach Schwere der Dürre, Jahreszeit,
in der die Dürre auftritt, und Boden- und
Nutzpflanzenart.
Während sich die derzeitigen Modellierungs-
ergebnisse auf die Projektgebiete beschränken,
wird der künftige Einsatz dieser Modellierungs-
tools in ganz Flandern wesentliche Infor-
mationen zur Unterstützung der Entwicklung
einer Strategie zur Anpassung an Trockenheit
und zur Dürrebekämpfung in Flandern
vermitteln. Im Rahmen der Modellierung
für die Projektgebiete werden ebenfalls
Wissens- und Informationslücken beschrieben,
die durch weitere Modellverbesserungen
und eine intensivere Zusammenarbeit von
verschiedenen Experten und Stakeholdern
zu schließen sind. Es fehlen beispielsweise
exakte Angaben zur Bodenfeuchte; dies ist
eine wichtige Variable für die Beurteilung
von Dürre-Effekten auf die Agrarproduktion.
Governance
’Ein starker GovernanceKontext
für die Anpassung an Trocken
heit setzt jedoch nicht nur
die Entwicklung technischer
Fachkenntnisse voraus,
sondern auch Mechanismen
zur Anregung der Beteiligung
relevanter Stakeholder.’
In Flandern ist die Vlaamse Milieu-
maatschappij (VMM) der wichtigste
Akteur bei der Sensibilisierung für die
Trockenheitsproblematik in der Region.
Im Allgemeinen sind sich viele Stake-
holder-Gruppen nur in begrenztem
Umfang der Problematik von Dürre
bewusst. Die VMM möchte dies ändern,
indem sie eine wissenschaftliche Basis
und damit Argumente für praktische
Maßnahmen liefert, die Stakeholder
bei Dürre ergreifen sollten. Aus diesem
Grund hat die VMM wissenschaftliche
Ergebnisse zur Stärkung des Bewusst-
seins und als Basis für eine Diskussion
über mögliche Maßnahmen zur An-
passung an Trockenheit in der Region
eingesetzt. Eine dieser Maß nahmen
ist beispielsweise die Ent wicklung
von Trockenheits-Indikatoren für die
Landwirtschaft.
Einen ähnlichen Ansatz hat die VMM
bereits erfolgreich im Hochwasser-
bereich entwickelt. Bei der regionalen
Sensibilisierung für die Dürreproble-
matik wird also eine durchgängige
’organisatorische Logik’ eingehalten.
Ein starker Governance-Kontext für die
Anpassung an Trockenheit setzt jedoch
nicht nur die Entwicklung technischer
Fachkenntnisse voraus, sondern auch
Mechanismen zur Anregung der
Beteiligung relevanter Stakeholder.
Die Dürreproblematik wird mittlerweile
in einigen Strategien und Leitbildern
berücksichtigt und es wurden ver-
schiedene politische Instrumente
entwickelt. Diese Instrumente stammen
aus unterschiedlichen Strategien,
weshalb die Kohärenz und Synergie
zwischen diesen Instrumenten fehlt.
Diese Lücke muss mit Hilfe eines Mess-
programms in den Projektgebieten
geschlossen werden.
Der implementierte Dürreüberwachungs-
und Modellierungsrahmen kann von
Entscheidungs trägern wie Wasserbehörden,
dem Landwirtschaftsministerium und den
Landwirtschaftsverbänden zur Analyse der
Auswirkungen von Dürre und die Ergreifung
geeigneter Maßnahmen genutzt werden.
Wenngleich dieser Rahmen in erster Linie
auf die Landwirtschaft abzielt, kann er auch
auf dürreempfindliche Naturschutzgebiete,
Grundwasserentnahmen, die Gewässergüte
und die Navigation auf Wasserstraßen
übertragen werden. Gleichzeitig wurde
eine Koordinierungsplattform eingerichtet,
an der alle staatlichen Stellen und lokalen
Organisationen im Bereich der Wasser-
wirtschaft und Landwirtschaft beteiligt sind.
Mit dieser Plattform wird die Zusammenarbeit
der verschiedenen Stakeholder, zu denen u.a.
das flämische Landwirtschaftsministerium,
regionale und nationale Wasserbehörden,
die Provinzen und die Kommunen gehören,
gefördert. Ziel ist es, diesen Ansatz dahin-
gehend weiterzuentwickeln, dass er auch
in anderen Ländern genutzt werden kann.
DROP Handbuch | 33
Region
Salland, Niederlande
Projektumfang
Das Projekt ist Bestandteil eines größeren Projekts,
das sich über eine Fläche von 180 km2 erstreckt.
Pilotprojektverantwortung
Waterschap Groot Salland
In Zusammenarbeit mit
Provinz Overijssel, Landwirten,
Vitens (Wasserversorgungsunternehmen)
Weitere Informationen
Waterschap Groot Salland
www.wgs.nl/streukelerzijl
Hilde Buitelaar - van Mensvoort: [email protected]
Wilgert Veldman: [email protected]
Fakten
S A L L A N D | N I E D E R L A N D E
’Vertreter aus unterschiedlichen
Funktionen und Fachbereichen
haben sich getrof fen, um die
künftige Arbeitsweise des Systems
zu besprechen. Es ist gut, dass alle
diese verschiedenen Perspektiven
eingebunden sind.’
S A L L A N D | N I E D E R L A N D E
Aufgabe
Die Aufgabe im Rahmen dieses Projekts bestand darin,
ein Gewässersystem herzustellen, das nachhaltig auf
extreme und sich ändernde Witterungsbedingungen
reagiert. Hierzu wurde ein Einzugsgebiet in zwei
Einzugsgebiete aufgeteilt. Das neue Gewässersystem
wird hierdurch eine Doppelfunktion haben: Wasserzufluss
aus der Vechte in das Einzugsgebiet und Wasserabfluss
aus dem Einzugsgebiet in die Vechte.
Pilotprojekt Landwirtschaft ›
Waterschap Groot Salland
Region Salland
2
DROP Handbuch | 35
Kontext
Das Verbandsgebiet der Waterschap
Groot Salland (NL) liegt im Nordosten
der Niederlande. Das Einzugsgebiet der
Pumpwerke Streukelerzijl und Galgenrak
im nordöstlichen Teil des Waterschaps-
Gebiets ist aufgrund eines unzureichenden
Entwässerungssystems hochwassergefährdet.
Mit diesem Projekt soll dieses ca. 18.000 ha
große Einzugsgebiet vor Hochwasser und
Dürre geschützt werden. Dafür ist ein
Gewässersystem erforderlich, das in der
Lage ist, genügend Wasser unter nassen
und trockenen Witterungsbedingungen
abzuleiten bzw. zuzuleiten und zusätzlich
rasch und zweckmäßig auf sich ändernde
Witterungsbedingungen zu reagieren.
Eine wichtige Voraussetzung für eine gut
funktionierende Wasserbewirtschaftung ist
ein geeigneter Mechanismus zur Regulierung
des Gewässersystems. Darüber hinaus stand
das Projekt vor der Aufgabe, einen Einblick in
die Frage zu bekommen, wie die Zusammen-
arbeit mit allen Beteiligten angeregt und ver-
bessert werden kann, damit neue Maßnahmen
zur Vermeidung von dürrebedingten Einbußen
in der Landwirtschaft entstehen können.
Beschreibung des Pilotprojekts
Strategie und Maßnahmen
Ein Großteil des Einzugsgebiets wurde
zur Bildung eines neuen Einzugsgebiets
abgetrennt. Dies geschah aus zwei Gründen:
um die Grundwasserentnahme des Wasser-
versorgungsunternehmens auszugleichen
und um die Wasserversorgung der landwirt-
schaftlichen Betriebe im Einzugsgebiet
sicher zu stellen. Zwei neue Bauwerke im
Gewässersystem und ein geplantes Pump-
werk an der Vechte werden gemeinsam die
ordnungsgemäße Entwässerung dieses neuen
Einzugsgebiets gewährleisten. Die neuen
Pumpwerke haben eine Doppelfunktion:
sie leiten Wasser in die Vechte ab und pumpen
Wasser aus der Vechte in das Einzugsgebiet.
Bis das neue große Zu- und Ableitungs-
pumpwerk an der Vechte seinen Betrieb
aufnimmt, wird für die Wasserversorgung
des neuen Einzugsgebiets eine provisorische
Wasserzuleitung eingesetzt, die sich oberhalb
des geplanten Pumpwerks befindet. Das aus
dem neuen Einzugsgebiet abgeleitete Wasser
wird vorübergehend über einen bestehenden
Wasserlauf in nordwestliche Richtung
abgeleitet.
Eröffnung des Projekts Streukelerzijl. Schulkinder geben das Startzeichen
für die Inbetriebnahme des Pumpwerks.
DROP Handbuch | 37
Governance
’Der Fokus der EU und
nationalen Politik auf
die Bewirtschaftung des
Einzugsgebiets hält die
regionalen Wasserbehörden
zur Koordinierung ihrer
Tätigkeiten an.’
Bei dem Projekt wurde ein starker
Governance-Kontext festgestellt.
Der Fokus der EU- und nationalen
Politik auf die Bewirtschaftung des
Einzugsgebiets hält die regionalen
Wasserbehörden zur Koordinierung
ihrer Tätigkeiten an. Bei einer regio-
nalen Initiative handelte es sich um
die Entwicklung und Umsetzung
einer gemeinsamen Bewässerungs-
politik, die auf einen ausgewogenen
Wasser verbrauch von Landwirt-
schaftsbetrieben in der Nähe von
Naturgebieten abzielt. Die Prüfung
des Governance-Kontextes hat
ergeben, dass sich alle Stakeholder
bei der Besprechung des Themas
’Bewässerung’ auf Wasser (-mangel)
konzentrierten. Diese Sichtweise
ist in der Region stark kulturell und
historisch verwurzelt. Der Fokus der
Politik ver lagerte sich daraufhin zur
Zonen einteilung, einer Lösung,
die darauf abzielt, das knappe
Wasser in Dürreperioden der Natur
vorzubehalten. Aus der Governance-
Analyse ergaben sich jedoch auch
Hinweise darauf, dass die Stakeholder
durch die Teilnahme an der regionalen
Initiative dazu neigen, die Dürre-
problematik als Einzelphänomen
zu betrachten. Im Rahmen einer
regionalen Initiative, die auf den
Erhalt und die Verbesserung der
Wasservorräte in der Region abzielt,
lernen die Stakeholder nämlich,
Dürre als Einzelphänomen zu
betrachten, das die mögliche
’Verwundbarkeit’ und die
’Anpassungsfähigkeit’ ihrer
Tätigkeiten beeinflusst.
Für dieses Gewässersystem mit Doppelfunk-
tion wurde außerdem eine Optimierungsstudie
durchgeführt. Die neuen Pumpwerke sind
daher mit einem neuen, innovativen Regel-
mechanismus ausgestattet, der sich auf die
Erkenntnisse der Optimierungsstudie stützt.
Dabei handelt es sich um ein ferngesteuer-
tes System, das an den Output von Wetter-
vorhersagemodellen gekoppelt ist.
DROP Handbuch | 39
Die Aufgabe
Abnehmende Wassermengen
brauchen innovative Lösungen zur
Gewährleistung der Gewässergüte
und eine Optimierung des Manage-
ments der Ressource Wasser in den
Reservoiren. Mit Hilfe von Stauanlagen
für die Wasserspeicherung kann die
natürliche Variabilität des Wassers
räumlich und zeitlich beeinflusst
werden. So lassen sich zu große
Wassermengen (Hochwasserschutz)
oder extrem niedrige Wasserstände
(Dürremanagement) regulieren.
Probleme können entstehen,
wenn Wasserspeicher mehrere
Nutzungszwecke und Benutzer
haben (z.B. Wasserversorgung,
Landwirtschaft, Tourismus, Natur-
schutz) und die Wasserverfügbarkeit
wegen geringerer Qualität oder
Quantität (z.B. geringer Niederschlag,
der zu niedrigeren Gewässerabflüssen
führt) begrenzt ist.
Allgemeine Einleitung
Weltweit haben zahllose nicht nachhaltige Bewirtschaftungsbeispiele gezeigt, dass Wassermangel
erhebliche wirtschaftliche und soziale Folgen haben kann. Geringere Abflüsse in Fließgewässern
sowie niedrigere Wasserstände in Seen und niedrige Grundwasserstände wirken sich negativ auf
die Qualität der Oberflächengewässer aus, da es weniger Wasser zum Verdünnen beispielsweise
von Schadstoffen gibt. Außerdem steht nicht genügend Wasser zur Verfügung, um den Bedarf
für Umwelt und Industrie sowie die Nachfrage von Privathaushalten nach aufbereitetem Wasser
zu decken. Mit Hilfe von Infrastruktureinrichtungen der Wasserwirtschaft (z.B. Überleitungen,
Talsperren und Entsalzungsanlagen) und effiziente Dürreüberwachungs- und Vorhersagesysteme
können kritische Zustände der Wasserknappheit vermieden oder gemanaged werden. Die Bilanz
von Angebot und Nachfrage sowie die Notwendigkeit der Einsparung und Effizienzsteigerung
auf der Nachfrageseite sind Bestandteil nachhaltiger Lösungen für den Umgang mit länger
anhaltendem Wassermangel. Lösungen für ein nachhaltiges Wasserressourcenmanagement
einschließlich der optimierten Bewirtschaftung von Talsperren mit Mehrfachnutzungen
sind weiterhin erforderlich, um die Beständigkeit gegenüber Dürre und Wasserknappheit zu
erhöhen. In Anbetracht der wirtschaftlichen Interessen an Reservoiren und der wachsenden
Nachfrage ihrer unterschiedlichen Nutzer besteht ein dringender Bedarf an neuen Management-
strategien. Das Pilotprojekt Süßwasser beschreibt die Erfahrungen bei der Umsetzung innovativer
technischer Maßnahmen für die Speicherbewirtschaftung in der Bretagne (Frankreich) und in
der Eifel mit dem Ziel eines besseren Managements bei lang anhaltender Trockenheit und
der Vermeidung von möglichen Engpässen bei der Wasserversorgung.
’Ohne Anpassung kann eine Veränderung des Niederschlagsmusters
selbst in wasserreichen Regionen zu Wassermangel in Reservoiren führen.’
Pilotprojekt
Süßwasser
DROP Handbuch | 41
Standort
Arzal, Morbihan, Frankreich
Projektumfang
Der Arzal-Staudamm liegt in der Nähe
der Mündung der Vilaine, eines Flusses mit
einem Einzugsgebiet von ca. 10.000 km2.
Die Arzal-Talsperre hat eine Speicherkapazität
von ca. 50 Millionen m3 und versorgt in den
Sommermonaten fast eine Million Menschen
(Einheimische und Touristen) mit Wasser.
Projetverantwortung
Institution d’Aménagement de la Vilaine (IAV)
und IRSTEA (Institut national de recherche en
sciences et Technologies pour l’environnement
et l’agriculture)
In Zusammenarbeit mit
lokalen und regionalen Gebietskörperschaften
Weitere Informationen
Institution d’Aménagement de la Vilaine
www.eptb-vilaine.fr
Jean-Pierre Arrondeau:
Aldo Penasso: [email protected]
IRSTEA: www.irstea.fr
Maria-Helena Ramos:
Louise Crochemore:
Fakten
B R E T A G N E | F R A N K R E I C H
’Der Nieselregen und die
langen Winter sind keine
Garantie gegen Dürren.’
Pilotprojekt Süßwasser ›
Institution d’Aménagement de la Vilaine
Region Bretagne
1B R E T A G N E | F R A N K R E I C H
Aufgabe
Die Aufgabe im Rahmen dieses Projekts bestand darin,
für einen ausreichenden Wasserstand in der Stauanlage
zu sorgen, damit alle Nutzungsfunktionen möglich
sind und gleichzeitig weitgehend verhindert wird,
dass Salzwasser in den Wasserspeicher eindringt.
Die Süßwasserqualität muss somit erhalten und
die Trinkwasserversorgung sichergestellt werden.
DROP Handbuch | 43
Kontext
Das Einzugsgebiet der Vilaine ist ca. 10.000 km²
groß. Es entwässert hin zum Arzal-Stausee,
der im Mündungsbereich kurz vor dem
Atlantik liegt. Der 1970 gebaute Staudamm
war ursprünglich zum Schutz des Hinterlands
(insbesondere der Stadt Redon) vor Über-
flutungen gedacht. Zu diesem Zweck wurde
die Tidewelle des Meeres von der Flutwelle
im Fluss abgetrennt. Obwohl der Hochwasser-
schutz auch heute noch eine wichtige Aufgabe
des Staudammes ist, besteht eine andere
wichtige Aufgabe in der Regulierung des
Süßwasserspeichers (50 Millionen m3),
insbesondere während niedriger Abflüsse.
Die Regulierung zielt auf die Kontrolle
der Wasserstände und die Verhinderung
des Eindringens von Salzwasser ab.
Die Trinkwasser aufbereitungsanlage,
die aus dem Süßwasser speicher des Arzal-
Staudammes gespeist wird, versorgt im
Sommer fast eine Million Menschen
(Einheimische und Touristen) mit Wasser.
Die Aufgabe der Süßwasserregulierung im
Arzal-Stausee ergibt sich überwiegend aus
der Nutzung des Sperrwerks für verschiedene
Zwecke. Der Staudamm erfüllt nicht nur eine
wichtige Aufgabe bei der Wasserversorgung,
sondern auch bei der Agrarproduktion und
im Freizeitsektor (z.B. Segeln, Angeln).
Daraus können sich schwerwiegende
Konflikte zwischen den Nutzern ergeben,
insbesondere in Dürreperioden und bei
drohender Wasserknappheit.
Beschreibung des Pilotprojekts
Die IAV, die für den Arzal-Staudamm zuständig
ist, sieht sich in der Jahreszeit mit niedrigen
Abflüssen (Juni bis Oktober) vor zahlreiche
Aufgaben im Zusammenhang mit der Ver-
meidung des Eindringens von Salzwasser
und der Speicherbewirtschaftung gestellt.
In dieser Jahreszeit gibt es einige ein-
schränkende Faktoren für die Wasser qualität
und -quantität. Das Salzwasser dringt
insbesondere dann in den Speicher ein,
wenn Boote die Schleuse im Damm passieren.
Wenn der Zufluss in der Regel am geringsten
ist (bei niedrigen Abflüssen), sind die touris-
tischen Aktivitäten, zu denen u.a. das Segeln
gehört, meistens am intensivsten (da es sich
um die Sommermonate handelt), und hierdurch
dringt das meiste Salzwasser in den Speicher
ein und gefährdet die Süßwasserqualität.
Zur Verhinderung des Eindringens von
Salzwasser wurden oberhalb des Damms
Siphons eingebaut, um das verschmutzte
Wasser aus dem Speicher zurück ins Meer
zu pumpen.
Dieses System führt jedoch auch zu erheblichen
Süßwasserverlusten, wodurch sich die Proble-
matik der Wasser versorgung weiter verschärft.
Zurzeit kann das Eindringen von Salz wasser
– und dadurch auch die Pumpverluste –
ausschließlich dadurch verringert werden,
dass die Benutzung der Schleuse in den
Sommermonaten, also in der Zeit mit dem
stärksten Bootsverkehr, eingeschränkt wird.
Dadurch sind Konflikte vorprogrammiert.
Dieses hat die IAV veranlasst, mit Hilfe dieses
Projekts neue Lösungen zu erarbeiten.
Vor dem Hintergrund des Klimawandels,
der sich voraussichtlich zusammen mit
längeren und intensiveren Perioden mit
niedrigen Abflüssen und längerer Trockenheit
in der Region vollzieht, und in Anbetracht
der Verschärfung von Konflikten werden diese
neuen Lösungen zur verbesserten nachhaltigen
Anpassung an die Trockenheit beitragen.
Die Möglichkeit einer neuen Schleuse zur Vermeidung des Eindringens von Salzwasser
in den Süßwasserspeicher ist untersucht worden. Mit einem wissenschaftlichen Modell
wurde das technische Konzept dieses innovativen Projekts verifiziert.
DROP Handbuch | 45
Strategie und Maßnahmen
Bei den beiden wichtigsten strategischen
Bewirtschaftungszielen des Arzal-Stausees
bei niedrigen Abflüssen handelt es sich um:
1. die Gewährleistung eines ausreichenden
Wasserstands im Speicher zur Ermöglichung
aller Nutzungsfunktionen
2. die weitgehende Verhinderung des Eind-
ringens von Salzwasser für den Erhalt der
Süßwasserqualität und die Sicherstellung
der Trinkwasserversorgung.
Die gegenwärtigen und künftigen Aufgaben
im Zusammenhang mit der rückläufigen
Wasserqualität und -quantität erfordern
den Einsatz automatisierter und integrierter
Tools zur Realisierung eines besseren
Dürremanagements und effizienter
Anpassungsinitiativen für den Arzal-
Staudamm. Die IAV und das nationale
Forschungsinstitut IRSTEA arbeiten bei
der Bewältigung dieser Aufgaben intensiv
zusammen, insbesondere beim Bau einer
neuen Schleuse und der Entwicklung
von Trockenheitsvorhersage- und Risiko-
managementinstrumenten.
Die IAV hat eine innovative Schleuse entwickelt,
die verhindert, dass Salzwasser eindringen
kann, wenn Boote den Staudamm passieren.
Die Anstrengungen konzentrierten sich unter
anderem auf die Entwicklung eines Miniatur-
modells der neuen Schleuse. Mittlerweile
wurden alle Vorstudien, die Modellkalibrierung
und sämtliche Simulationen abgeschlossen.
Die Gesamtkosten des Projekts werden auf
20 Millionen Euro veranschlagt (auf der
Grundlage der Vorstudien).
Außerdem hat das IRSTEA ein Tool
entwickelt, das während der Jahreszeit,
in denen niedrige Abflüsse auftreten,
den Zufluss in den Speicher vorhersagt,
und im Rahmen des Risiko managements
bei der Vorbereitung auf kritische Dürre-
situationen hilft. Das Tool verarbeitet
Informationen aus einem hydro logischen
Vorhersagemodell zu einer grafischen
Darstellung des Dürrerisikos. Das Modell
transformiert mögliche künftige Wetters-
zenarien für das gesamte Einzugsgebiet
der Vilaine in Zuflüssen in das Gewässer
oberhalb des Damms.
Governance
’Maßnahmen zur
Anpassung an
Trockenheit können
rasch entwickelt
und umgesetzt werden.’
Die IAV ist nicht nur für die Bewirt-
schaftung des Arzal-Staudamms
zuständig, sondern tritt ebenfalls
als Koordinator des lokalen Wasser-
komitees auf, in der die Wasserfragen
mit allen Stakeholdern besprochen
werden. Dieser Ausschuss erstellt
den Bewirtschaftungsplan für
das Einzugsgebiet der Vilaine.
In diesem werden unter anderem
für verschiedene Nebenflüsse
Maßnahmen zur Verhinderung
niedriger Abflüsse formuliert.
Trotz geplanter Notmaßnahmen
fehlt ein übergeordneter Manage-
mentplan im Zusammenhang mit
den sich aus dem Klimawandel
ergebenden Dürrerisiken.
Insgesamt lässt sich feststellen,
dass es zurzeit ein geringes Dürre-
risikobewusstsein gibt, wohingegen
man sich sehr wohl der Hochwasser-
risiken bewusst ist. Das fehlende
Dürrerisikobewusstsein lässt sich
unmittelbar auf den Umstand zurück-
führen, dass es in der Region in den
vergangenen Jahren keine kritischen
Dürrezustände gab und dass keine
Kultur der Dürrevorhersage und
Risikokommunikation vorhanden
ist. Es wird jedoch damit gerechnet,
dass aufgrund der vorhandenen
effizienten Wasser-Governance
für Süßwasser im Einzugsgebiet,
die sich auf ein dichtes Netzwerk
von Stakeholdern unter Leitung
der IAV stützt, rasch Maßnahmen
zur Anpassung an Trockenheit
entwickelt und umgesetzt werden
können, sobald das Dürrerisiko-
bewusstsein zunimmt.
Die grafische Darstellung des Dürrerisikos
wird durch eine visuelle Auswertung
des Risikos ermöglicht, die beschreibt,
ob bestimmte kritische Niedrigabfluss-
schwellen werte in den kommenden Wochen
oder Monaten erreicht werden oder nicht,
und zwar sowohl in Bezug auf die Abflussin-
tensität als auch die Dauer (d.h. Durchschnitts-
abfluss und Zahl der Tage unterhalb des
kritischen Schwellenwerts). Dieses Visualisie-
rungstool für die Risikobewertung unterstützt
die Entscheidung, ob Wasser aus dem
Speicher abgelassen wird oder nicht und
wie die ent sprechenden Steuerungselemente
im Damm zu bedienen sind. Das Tool kann
in verschiedene Bedienungs- und Bewirt-
schaftungsvorschriften integriert werden,
um die verschiedenen Nutzungsfunktionen
des Reservoirs schon vor der Ausführung
von Maßnahmen ganzheitlich zu betrachten.
DROP Handbuch | 47
Standort
Eifel, Nordrhein-Westfalen, Deutschland
Projektumfang
Das Einzugsgebiet des Projektes ist 662 km²
groß. Dies entspricht einem Drittel des
Verbandsgebietes des WVER (2.087 km2)
Pilotprojektverantwortung
Wasserverband Eifel-Rur
In Zusammenarbeit mit
Bezirksregierung Köln, Trinkwasserversorger,
Energie versorgungsunternehmen,
Nationalpark Eifel, Vereine
Weitere Informationen
Wasserverband Eifel-Rur
www.wver.de
Christof Homann: [email protected]
Herbert Polczyk: [email protected]
Antje Goedeking: [email protected]
Fakten
E I F E L R U R | D E U T S C H L A N D
’Obwohl unser Einzugsgebiet im Prinzip eine sehr wasserreiche Region
ist, schenken wir langanhaltender Trockenheit mehr Aufmerksdamkeit.’
E I F E L R U R | D E U T S C H L A N D
Pilotprojekt Süßwasser ›
Wasserverband EifelRur
Region EifelRur
2
Aufgabe
In den letzten Jahren war es im Frühjahr in der Region
der EifelRur relativ trocken. Dadurch fließt weniger Wasser
in die Staubecken. Stillwasser und sinkende Wasserstände in
den Stauseen erhöhen das Risiko, dass sich die Gewässergüte
verschlechtert und die Aufbereitung des Wassers arbeitsauf
wändiger wird oder möglicherweise Probleme bei der Trinkwas
serversorgung auftreten. Der Klimawandel, der wahrscheinlich
längere Trockenperioden mit sich bringen wird, wird zu einer
Verschärfung dieser Probleme führen.
DROP Handbuch | 49
Kontext
Der Wasserverband Eifel-Rur hat ein Projekt
zur Optimierung der Talsperrenbewirtschaftung
durchgeführt. Das Projekt befasst sich in einer
Studie mit dem großen Talsperrensystem
am Oberlauf der Rur in den Hügeln der Eifel.
Dort wurden neun Staudämme errichtet,
von denen sechs vom Wasserverband
bewirtschaftet werden. Die Staudämme
des WVER bilden ein zusammenhängendes
System, in dessen Mittelpunt die Rurtalsperre
steht, Deutschlands größte Talsperre.
Das System der Talsperren, deren Gesamt-
volumen 300 Millionen Kubikmeter beträgt,
wurde ursprünglich zum Schutz vor Hoch-
wasser und zur Niedrigwasseraufhöhung in
Trockenwetterzeiten errichtet. Diese Aufgaben
haben auch heute noch hohe Priorität. Darüber
hinaus spielen die Talsperren eine wichtige Rolle
bei der Trinkwasserversorgung. Und schließlich
übt das Gebiet wegen der guten Wasser-
qualität und des Naturreichtums eine große
Anziehungskraft auf den Tourismus aus.
Beschreibung des Pilotprojekts
Strategie und Maßnahmen
Das vorrangige Ziel des Pilotprojekts bestand
darin, die Verschlechterung der Gewässergüte
in den Stauseen zu verhindern. Zu diesem Zweck
wurden mögliche Veränderungen des Zuflusses
in den vergangenen Jahrzehnten untersucht.
Auf der Grundlage der so gewonnen Erkennt-
nisse wurden die im Bewirtschaftungsplan
enthaltenen Bestimmungen in Bezug auf den
Abfluss unterhalb des Stausees überprüft und
es entstehen neue Ideen für eine Anpassung
des Bewirtschaftungsplans.
Das Rurtalsperrensystem
Die Talsperren in der Nordeifel erfüllen mehrere
wichtige Aufgaben, die nicht immer miteinander
im Einklang stehen. Manchmal ist ein kontrol-
lierter, hoher Abfluss aus dem Staubecken
erforderlich, um etwa die Hochwasserrück-
haltekapazität der Talsperren länger nutzen
zu können und so Überflutungen im Unterlauf
zu verhindern. Das ist jedoch nur in begrenztem
Umfang möglich, da genügend Wasser für
die Trinkwasserbereitung und die Aufrechter-
haltung des Abflusses in der Rur unterhalb
der Stauseen verbleiben muss.
DROP Handbuch | 51
Governance
Die Planungsprozesse für Natur
und Wasser in der Region Eifel-Rur
zeichnen sich traditionell durch
einen kooperativen Ansatz mit
einer freiwilligen Durchführung
von Maßnahmen aus. Seit den
frühen neunziger Jahren kam
dieser Ansatz beim Naturschutz,
dem Schutz der biologischen
Vielfalt und der Wasserwirtschaft
zum Tragen. Aus den DROP-Unter-
suchungen zur Governance für die
Anpassung an die Trockenheit gingen
die Vorteile dieser Vorgehensweise
für die Region klar hervor, ebenso
wie die Probleme, die diesbezüglich
zurzeit in der Praxis auftreten.
Während die Akteure sich darüber
einig sind, dass der Ansatz zu
Ergebnissen führt, hat der Mangel
an politischem Willen bei manchen
politischen Prozessen (z.B. Umsetzung
der EU-Wasserrahmenrichtlinie) zur
Folge, dass sich Akteure hinter ihrer
Position verschanzt haben. In diesen
Diskussionen geht es nicht so sehr um
die Umsetzung, sondern um das Ziel
selbst. Deswegen hat es den Anschein,
dass der kooperative, relativ zurück-
haltende Ansatz der Behörden an
seine Grenzen stößt, wenn Themen,
über die verhandelt wird, wesentliche
Belange von Stakeholdern berühren:
die Sicherstellung der Wasserver-
sorgung (und somit der Wirtschafts-
produktion) und die Kosten der
Maßnahmen.
Bevor die Bewirtschaftungspläne unter
diesem Aspekt angepasst werden können,
müssen Grundlagenuntersuchungen durch-
geführt werden. Der Wasserverband hat daher
für die einzelnen Talsperren die Zuflussmuster
analysiert. Auf der Grundlage der Ergebnisse
wurde das Bewirtschaftungssystem der
Talsperren hinsichtlich der Wasserquantität
und -qualität überprüft. Daraus ergaben
sich Vorschläge für die Anpassung des
Bewirtschaftungsplans: einer der besten
war die Aufnahme eines Dürreindexes in
den Bewirtschaftungsplan; damit lässt
sich ein zu hoher Wasserabfluss in einem
früheren Stadium als bisher verhindern und
es entstehen zusätzliche Wasservorräte für
Trockenzeiten. Neben den Maßnahmen für
die großen Talsperren wurde bei Ürsfeld auch
noch ein kleines Projekt geplant, in dessen
Rahmen das Hochwasserrückhaltebecken
Ürsfeld aus dem Abflussgeschehen eines
Baches herausgenommen wurde, was sich
positiv auf die Wasserqualität auswirkt.
DROP Handbuch | 53
Die zentrale Erkenntnis des
DROP-Projekts lautet, dass Dürre
und Wasserknappheit komplexe
Wasserwirtschaftsprobleme sind,
die erhebliche Folgen für die
Landwirtschaft, die Natur und für
die Talsperren zur Wasserversorgung
haben. Diese komplexen Aspekte sind
konkret sichtbar und werden infolge
des Klimawandels und eines Anstiegs
von extremen Trockenperioden und
Hochwässern aller Voraussicht nach
weiterhin zunehmen.
Einführungstext
Fünf Grundvoraussetzungen
Eine Reihe von Faktoren trägt zu den komplexen
Aspekten von Dürre und Wasserknappheit bei.
Erstens ist die Dürre- und Wasserknappheits-
problematik größtenteils unsichtbar. Bei Aus-
trocknung fehlt Wasser in den Kapillaren des
Gewässersystems, ganz im Gegensatz zur der
überwältigenden Präsens des Wassers bei
Überflutungen in vielen nordwesteuropäischen
Regionen. Zweitens lässt sich, teilweise auch
als logische Folge des ersten Aspekts,
ein mangelhaftes Bewusstsein für eine
Reihe von Risiken feststellen, die mit dem
Klimawandel zusammenhängen. Bei vielen
Wasserverbänden und -behörden in Nord-
westeuropa zielt das Risikomanagement in
erster Linie auf zu viel Wasser ab, nicht auf
zu wenig Wasser. Dies gilt in gewisser Weise
auch für zahlreiche Wasserverbraucher und
lokale Stakeholder, deren Risikobewusstsein
in Bezug auf Hochwasser viel ausgeprägter
ist als in Bezug auf Dürre. Drittens gibt es
die (angeblich) widersprüchlichen Interessen
des Hochwasserschutzes und des Schutzes
vor Dürre und Wasserknappheit, die,
obwohl sie sich auf unterschiedliche Ebenen
und Zeiträume beziehen, in Ermangelung
eines integralen Hochwasser- und Dürre-
risikomanagements sich im europäischen
Wasserwirtschaftssektor möglicherweise
verstärken.
In den Pilotprojekten des DROP-Projekts haben
Partner mit verschiedenartigen Strategien und
Maßnahmen zur Anpassung an Trockenheit
experimentiert. Dabei standen sie vor speziellen
Herausforderungen und sie hatten die Gelegen-
heit, Informationen über die Vor- und Nachteile
dieser ’Anpassungslösungen’ auszutauschen.
Aus den Erfahrungen der Pilotprojekte haben
wir fünf Punkte abgeleitet, die für den Umgang
mit der Komplexität der Anpassung an Trocken-
heit und Wasserknappheit vor dem Hintergrund
des Klimawandels und der vermehrt auftreten-
den Wetterextreme wichtig sind.
Erkenntnisse und Datenverwertung
Es werden mehr gemeinsame Erkenntnisse über
die Problematik der Dürre und Wasserknapp-
heit benötigt. Dies umfasst bessere Kenntnisse
der natürlichen Prozesse, die Dürren zugrunde
liegen, wie der Zusammenhang zwischen
Grundwasser- und Oberflächenwassersystemen,
die Wechselwirkung von Wetter- und Klima-
variablen mit den Prozessen in der Bodenober-
fläche und die Folgen des Klimawandels für
die Bilanz von Angebot und Nachfrage.
Diese Notwendigkeit besteht insbesondere
während trockener Sommerperioden,
damit die Modellierung der gegenseitigen
Abhängigkeiten verbessert wird und die
Auswirkungen der derzeitigen Regeln beim
Risikomanagement und die künftigen Maß-
nahmen für die Anpassung an Trockenheit
zuverlässig vorhergesagt werden können.
Fünf Voraussetzungen für die Anpassung an Trockenheit
DROP Handbuch | 55
Über umfassende Messprogramme sind
häufig Angaben über klimatologische
Variablen, Abflüsse, Bodenfeuchte oder
Grundwasser stände verfügbar. Diese Daten
müssen jedoch in Informationen (das Ver-
ständnis von Zusammen hängen), in Wissen
(das Verständnis von Mustern) und letztlich in
Erkenntnisse (das Verständnis von Grundsätzen)
umgesetzt werden, um angebotsseitige
Indikatoren mit Informationen zum nach-
frageseitigen Bedarf in Zeiten von Witterungs-
extremen zu versorgen. Das Webportal der
Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) ist ein
gutes Beispiel für die Umsetzung von Daten
in Informationen (d.h. Dürreindikato ren),
die den Wasserbehörden, Landwirtschafts-
betrieben und anderen Stakeholdern zur
Verfügung gestellt werden. Andere Tätigkeiten
im Bereich von hydrologischer Modellierung,
von Risikobewertungs-Tools und von Wahr-
scheinlichkeitsanalysen waren Bestandteil
des DROP-Projekts und leisteten einen
Beitrag zu der Verbesserung von Wissen und
Erkennt nissen über extreme Trockenheit für
die praktische Anwendung in Nordwesteuropa.
Es bedarf größerer Investitionen in das
Verständnis der potenziellen Veränderungen,
die unter unterschiedlichen Klimabedingungen
in Bezug auf den Bedarf der Nutzer – d.h.
Haushalte, Industrie, Unternehmen, Land-
wirtschaft – auftreten können und darüber,
wie auf diesen unterschiedlichen Nutzerebenen
Anpassungen stattfinden und gleichzeitig die
Bedürfnisse der Natur berücksichtigt werden
können, beispielsweise durch möglichst geringe
’environmental flows’.
Engagement und Bewusstsein
Des Weiteren wird in ganz Nordwesteuropa
mehr Engagement und ein höheres Bewusst-
sein in Bezug auf Dürre und Wasserknappheit
benötigt. Maßnahmen können effizienter
um gesetzt werden, wenn sich Stakeholder,
Ent scheidungsträger und die Öffentlichkeit
der möglichen Folgen extremer Trockenheit
bewusst sind, wenn sie sich über die aktuellen
Forschungsergebnisse der physischen und
sozialen Wissenschaften informieren und wenn
sie in die Umsetzung neuer Lösungen im Bereich
des Wassermangel-Managements und der
Anpassung an Trockenheit einbezogen werden.
Alle Akteure profitieren von einer transparen-
teren, engagierten und transdisziplinären
Vorgehensweise (unter Einbeziehung mehrerer
Disziplinen bei der Definition neuer Lösungs-
ansätze, die das disziplinäre Silo-Denken
übersteigen). Die Pilotprojekte in der Bretagne
und der Region Eifel-Rur haben gezeigt,
dass Strategien für die Anpassung an
Trockenheit sogar in Gebieten mit größeren
Niederschlagsmengen eine immer wichtigere
Rolle bei den für die Wasserversorgung
Verantwortlichen spielen, da sich der Klima-
wandel auf die Niederschlagsmuster auswirkt.
Dem DROP-Projekt selbst und insbesondere
den regionalen Projekten ist es gelungen,
die Aufmerksamkeit auf die Problematik der
Dürre und des Wassermangels zu lenken,
indem man auf unterschiedlichen Ebenen
an die Akteure herantritt: Sensibilisierung
der Mitarbeiter in den Pilot-Organisationen;
grenzüberschreitende Zusammenarbeit von
Wasserverbänden/-behörden und regionalen
Stakeholdern in den sechs Regionen;
Governance-Teambesuche und Diskussionen
mit verschiedenen Stakeholdern von lokaler
bis hin zu regionaler Ebene in jedem der sechs
Einzugsgebiete sowie regionale, nationale und
internationale Verbreitung.
Individuell abgestimmte Maßnahmen
Die Sensibilisierung ist besonders wichtig in
Regionen, in denen Dürre und, im allgemeinen
Sinne, die Auswirkungen des Klimawandels
auf die Wasserwirtschaft in gesellschaftlichen,
politischen und wirtschaftlichen Netzwerken
nicht für problematisch gehalten werden.
Sensibilisierung ist aber nur ein erster Schritt.
Auch in Regionen, in denen das Bewusstsein
für extreme Trockenheit erhöht wird, müssen
konkrete, individuell abgestimmte Maßnahmen
zur Anpassung an diese Trockenheit folgen.
Dabei müssen spezielle Maßnahmen entwickelt
werden, die die Folgen des Klimawandels und
von Dürre/Wassermangel in der jeweiligen
Region aufgreifen. Es ist wichtig, dass die Maß-
nahmen speziell auf die Region abgestimmt
werden, da Maßnahmen zur Anpassung an
Trockenheit, die in der einen Region gut
funktionieren, in anderen Regionen versagen
können. Eines der offensichtlichsten Argumente
für regional abgestimmte Maßnahmen ist
die regionale Variabilität von Klimaeffekten,
die Einfluss auf die Art und Weise hat,
wie frühere extreme Trockenheiten wahr-
genommen wurden. Regional abgestimmte
Maßnahmen sind ebenfalls aufgrund der
Variabilität von Governance-Prozessen
zwischen Regionen und Ländern erforderlich.
Die Governance-Prozesse, die der Wasser-
wirtschaft zugrunde liegen, sind je nach Region
und Land in Europa sehr unterschiedlich in
Bezug auf die Frage, ob die Wasserwirtschaft
privatisiert ist oder nicht, in Bezug auf die
Ebene, auf der die Wasserwirtschaft organisiert
ist (lokale Behörden gegenüber Einzugsgebiets -
grenzen), den Umfang, in dem die Öffentlich-
keit und Stakeholder in die Wasserwirtschafts-
prozesse einbezogen werden, und in Bezug
auf die Frage, ob es in der Vergangenheit
bereits Erfahrungen mit der Anpassung an
Trockenheit und Wasserknappheit gab (und es
somit Maßnahmen gibt, auf die man aufbauen
kann) oder ob die Maßnahmen von Grund auf
konzipiert und umgesetzt werden müssen.
In der Bretagne hat sich beispielsweise gezeigt,
dass Reden über den Klimawandel eigentlich
nicht die beste Art ist, mehr Aufmerksamkeit
auf Dürre und Wasserknappheit zu lenken.
Der Klimawandel wird nicht unbedingt als
Problem bewertet, wohingegen der Trink-
wasserqualität und der Verteilung des Wassers
bei unterschiedlichen, manchmal zeitgleich
stattfindenden Nutzungen Aufmerksamkeit
geschenkt wird (bei niedrigen Abflüssen).
DROP Handbuch | 57
Ein anderes Beispiel ist Somerset, wo das
Extremhochwasser im Winter 2013-2014 ver-
deutlicht hat, dass es sehr schwierig sein kann,
inmitten der von einem schweren Hochwasser
verursachten Verwüstung über Maßnahmen
zur Dürre zu sprechen. In manchen Kontexten
können die Sensibilisierung für Dürre und
die Umsetzung individuell abgestimmter
Maßnahmen zur Anpassung an Dürre eine
große Herausforderung darstellen, für die nicht
nur Argumentations- und Überzeugungsarbeit
erforderlich ist, sondern eine ausgesprochen
subtile und kohärente Weise beim Umgang
mit Gewässerfragen in allgemeinem Sinn.
Integraler Ansatz
Als vierter Punkt ergab sich im DROP-Projekt,
dass für die Lösung der Problematik von Dürre
und Wassermangel ein integraler Wasser- und
Risikomanagementansatz erforderlich ist.
Mit einem integralen Ansatz ist die Suche
nach durchdachten Kombinationen gemeint,
die für die Lösung der Probleme von Wasser-
knappheit und Hochwasser innerhalb dessel-
ben Rahmens sorgen. Das Hochwasser in
Somerset hat gezeigt, dass trotz der Tatsache,
dass Wasser knappheit und Hoch wasser
’zwei Seiten derselben Medaille’ sind und
es einer integralen Wasserwirtschaft bedarf,
die Gefahr besteht, dass Entwick lungen auf
der einen Seite der Medaille – z.B. Hoch-
wasserpolitik als Reaktion auf Klimaextreme
– unerwünschte Folgen für die andere Seite
der ’Klimaanpassungsmedaille’ – nämlich für
die Dürrepolitik – haben. Diese Integration
beschränkt sich nicht auf den Zusammenhang
zwischen zu viel und zu wenig Wasser, sie geht
weiter. Der gesamte Raumkontext muss in eine
sowohl auf Hochwasser als auch auf Dürre
abzielende Wasserwirtschaft integriert werden,
damit die Umsetzung wirklich wirk samer und
klimabeständiger Strategien für die Zukunft
möglich ist.
Strategien und Maßnahmen auf mehreren Ebenen
Auf Makroebene produzieren, reproduzieren
und kommunizieren Wissenschaftler, Politiker,
Medien, Umweltschützer und Wasserbehörden/
-verbände bestimmte theoretische Abhand-
lungen unter Einsatz allgemeiner Modelle,
abstrakter Theorien und allgemeiner Konzepte
für Dürre und Wasserknappheit.
Auf Mikroebene gibt es die Landwirte, Mit-
arbeiter von Wasserverbänden und -behörden
und ehrenamtliche Helfer von Naturschutz-
verbänden, die praktische Erfahrungen haben,
von diesen Erfahrungen berichten, konkrete
Maßnahmen ergreifen und in alltäg lichen Ge-
sprächssituationen ihre Standpunkte vertreten.
Nur wenn wir dafür sorgen, dass die theore-
tischen Abhandlungen auf Makroebene und
die regionale, nationale und internationale
Politik die Erfahrungen auf Mikroebene und das
Handeln von Menschen, die Wasserwirtschaft
tagtäglich praktisch umsetzen, widerspiegeln
und unterstützen, können wir in Nordwest-
europa Fortschritte bei der Anpassung an
Trockenheit und bei der Verbesserung der
Klimabeständigkeit erzielen.
In den sechs Pilotprojektregionen des DROP-
Projektes haben die Partner im Rahmen der
Dürre- und Wassermangelbekämpfung an
unterschiedlichen Maßnahmen und auf unter-
schiedlichen Ebenen (von der Feldebene bis
hin zur regionalen und wissenschaftlichen
Ebene) gearbeitet. Bei einigen Maßnahmen
handelte es sich um den Bau von wasserwirt-
schaftlichen Anlagen auf Bauernhöfen zur
Beeinflussung der Wasserwirtschaft auf Land-
schaftsebene (Twente, Somerset, Salland);
bei anderen handelte es sich um Unter-
suchungen zu Bewirtschaftungsplänen
(Eifel-Rur) oder um die Entwicklung wissen-
schaftlicher Kenntnisse, die Auswahl von Tools,
den Bau von Modellen und die Kommunikation
wissenschaftlicher Risiken (Flandern, Bretagne).
Die DROP-Partner haben auf Mikro-, Meso-
und Makroebene gearbeitet und damit nach-
gewiesen, dass es keine ’richtige Ebene für die
Anpassung an Trockenheit’ gibt, im Gegenteil:
Extreme Trockenheit muss auf einer Vielzahl
unterschiedlicher Ebenen gleichzeitig bekämpft
werden. Während eine regionale wissenschaft-
liche Übersicht über z.B. Klimarisiken verdeut-
lichen wird, welche Ebene und welcher Umfang
für die Realisierung physischer Veränderungen
in einem Wasserwirtschaftssystem am
wichtigsten sind, bestimmt der lokale und regi-
onale Governance-Kontext, auf welcher Ebene
die Beteiligung zur Förderung der sozialen,
wirtschaftlichen und politischen Vorbereitung
auf Dürre und Wasserknappheit unter den
heutigen und künftigen Klimabedingungen
in der Region möglich und wünschenswert
ist (einschließlich der Anerkennung seitens
der Stakeholder, dass das Thema Dürre und
Wasserknappheit Aufmerksamkeit verdient,
oder dass es eine ’gratis’ Lösung ist, wenn
andere Anpassungsmaßnahmen im Rahmen
des Hochwasserschutzes umgesetzt werden).
DROP Handbuch | 59
• Bau von zwei neuen wasser-
wirtschaftlichen Anlagen:
ein Wehr und ein Zu- und
Ableitungspumpwerk (NL)
• Erprobung eines pegelgesteuerten
Entwässerungssystems in der Nähe
eines Naturschutzgebiets (NL)
• Untersuchungen
und Maßnahmen zur
Reduzierung des Ober-
fl ächenabfl usses (NL)
• Entwurf eines Regelmechanis-
mus für die Bewirtschaftung
des Gewässersystems mit
Doppelfunktion, der eine
rasche und zweckmäßige
Reaktion auf sich ändernde
Witterungsbedingungen
ermöglicht (NL)
• Versuche mit
verschiedenen boden-
deckenden Pfl anzen-
arten zur Förderung
der Bildung von organi-
schem Material (UK)
• Datenverbreitung über die
Website www.waterinfo.be (B)
• Entwicklung eines Tools, das während
der Jahreszeit, in denen niedrige
Abfl üsse auftreten, den Zufl uss in
den Speicher vorhersagt und das im
Rahmen des Dürrerisikomanagements
bei der Vorbereitung auf kritische
Situationen im Einzugsgebiet hilft (F)
• Einrichtung einer Plattform zur
Förderung der Zusammenarbeit
von staatlichen Stellen und lokalen
Organisationen im Bereich
der Wasserwirtschaft und
Landwirtschaft (B
• Entwicklung von Tools
zur Modellierung der
Auswirkungen von Dürren
auf das Gewässersystem
und die Agrarproduktion (B)
• Entwicklung von Modellen für
die Einschätzung der Auswirkungen
von Dürre auf die Wasserversorgung
und die Nutzpfl anzenproduktion (ein
Bewertungsmodell für Boden und
Wasser sowie ein Modell für Boden-
Wasser-Atmosphäre-Pfl anzen) (B)
Pilotprojekt Landwirtschaft
Dieses Handbuch enthält gesonderte Kapitel zu den Themen Natur,
Landwirtschaft und Süßwasser. Dadurch könnte der Eindruck entstehen,
dass diese Themen voneinander unabhängig zu betrachten sind.
Nichts ist weniger wahr. Wenn es um den Umgang mit Dürre und
Wasserknappheit geht, sind Natur, Landwirtschaft und Süßwasser
eng miteinander verbunden. Diese Abbildung von drei sich über-
schneidenden Kreisen symbolisiert den Zusammenhang zwischen
den drei Pilots. Die DROP-Studien und Maßnahmen in den Kreisen
verdeutlichen, dass der Einfl uss der meisten Studien und Maßnahmen
über die Bereiche Natur, Landwirtschaft oder Süßwasser hinaus reicht.
• Untersuchungen und
Maßnahmen zur Reduzierung
des Oberfl ächenabfl usses (NL)
• Versuche mit
verschiedenen boden-
deckenden Pfl anzen-
arten zur Förderung
der Bildung von organi-
schem Material (UK)
• Renaturierung und
Wiederherstellung
von Wasserläufen
an verschiedenen
Standorten (NL)
• Erprobung eines pegel-
gesteuerten Entwässerungs-
systems in der Nähe eines
Naturschutzgebiets (NL)
• Analyse der Zufl ussmuster
in den einzelnen Talsperren
und Untersuchung des Bewirt-
schaftungssystems der Talsperren
hinsichtlich der Wasserqualität
und -quantität (D)
• Entwicklung einer innovativen
Schleuse, die verhindert, dass
Salzwasser eindringen kann,
wenn Boote den Staudamm
passieren (F)
• Entwicklung eines Miniatur-
modells der neuen Schleuse
(Kalibrierung, Simulationen) (F)
• Bestandsaufnahme
der Probleme in dem
Gewässersystem von
Naturschutzgebieten
für die Planung und
Umsetzung von Maß-
nahmen zur Verbesserung
der Wasserzufuhr (UK)
• Verbesserung der
Dürrebeständigkeit
von Hochmooren (UK)
• Modellierung und
Technologietransfer
im Einzugsgebiet des
Upper Parrett in Bezug
auf Bewässerungspläne
und Wasserversorgungs-
management (UK)
Pilotprojekt Natur
Pilotprojekt Süßwasser
DROP Handbuch | 61
Impressum© März 2015
Hauptpartner
Waterschap Vechtstromen
Partner
Waterschap Vechtstromen (lead partner)
Waterschap Groot Salland
University of Twente
Wasserverband Eifel-Rur
Institution d’Aménagement de la Vilaine
IRSTEA
Université François Rabelais
Vlaamse Milieumaatschappij
Brussels office of Ecologic Institute
Somerset County Council
The University of Manchester
Autor
Nanny Bressers in Kooperation mit allen Partnern
Gesamttitel
Benefit of Governance in DROught AdaPtation
– Praktische Anwendung - Beispielmaßnamen
Benefit of Governance in DROught AdaPtation
Förderung
INTERREG-programme IVB/
North West Europe (NWE)
Koredaktion
Tauw bv
Fotos
Alle Partner, Bas Worm, Wilco de Bruijne
Layout und Druck
Catapult creëert
Download www.dropproject.eu
Alle Rechte vorbehalten. Nichts aus dieser Ausgabe darf ohne ausdrückliche Zustimmung in
irgendeiner Weise vervielfältigt werden. Alle Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt und
werden mit freundlicher Genehmigung der jeweiligen Inhaber und/oder ihrer Vertreter veröffentlicht.