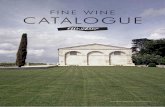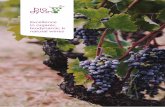Accumulation of nitrate in grape wines 1. Part: Investigation on musts and wines in the grape...
-
Upload
hochschule-geisenheim -
Category
Documents
-
view
4 -
download
0
Transcript of Accumulation of nitrate in grape wines 1. Part: Investigation on musts and wines in the grape...
Nitratanreicherung in Reben1. Mitteilung: Erhebungsuntersucbungen an Mosten und Weinen im Rheingau
Accumulation of nitrate in grape wines1. Part: Investigation on musts and wines in the grape growing area "Rbeingau" .
Accumulation de nitrate a la vigne1. Part: Recherche aux mouts et vins dans la region "Rheingau"
VonK.SCHALLER
Institut für Bodenkunde und Pflanzenernährung der Forschungsanstalt für Weinbau, Gar-tenbau, Getränketechnologie und Landespflege Geisenheim
O. Einleitung
Die Nitratanreicherung in pflanzlichen Materialien beschäftigt gegenwärtig sehr stark denGartenbau, und hier insbesondere die Gemüseerzeugung. Für den Weinbau scheint das bisheute eher ein marginales Problem zu sein, abgesehen von einigen spektakulären Fäl-schungsprozessen, bei denen mit Hilfe angeblich überhöhter Nitratgehalte im Wein ein ver-botswidriger Wasserzusatz zum Most nachgewiesen werden sollte. Der Grundgedankehierzu stammt von REBELEIN (37), der aufgrund von N03-Gebaltsbestimmungen in ca.500 Weinen zum Schluß kam, daß bei Überschreiten eines bestimmten N03-Gehaltes - vonihm wurden anfangs f;; 7,2 mg NOl!1 genannt - die Möglichkeit eines Wasserzusatzes nichtmehr auszuschließen ist. Er weist aber auch daraufhin, daß bei hochwertigen Weinen dieGehalte sehr hoch sein können (> 90 mg N03!1). Er nennt 26-35 mg/I NOl als natürlicheGrenzen beim Wein.
Bevor jedoch auf die speziellen Bedingungen des Weinbaues eingegangen wird, erscheint esnotwendig ganz allgemein die Faktoren der Nitratanreicherung in pflanzlichen Systemen zubetrachten.
Die Nitrataufnahme erfolgt über das Wurzelsystem und wird über das Xylem an die Stellendes Bedarfes hintransportiert. Das bedeutet, daß alle Pflanzenteile mit einem großen Leitge-fäßanteil, wie Blattstiele, Blattrippen, Stamm und Stielgerüste immer hohe Nitratgehalteaufweisen. Das von der Pflanze aufgenommene Nitrat wird anschließend unter Aufwen-dung von Stoffwechselenergie mit Hilfe des Nitratreduktasesystems reduziert und in orga-nische Verbindungen unter Bildung von Aminosäuren eingebaut.
Die in Pflanzen festgestellte N03-Konzentration ist demnach zu jedem Zeitpunkt der Aus-druck eines dynamischen Gleichgewichtes, denn es stellt die Differenz dar zwischen derAufnahmerate und der Einbaurate innerhalb der Pflanze. Ist z. B. die N03-Aufnahme auf-grund eines geringen Angebotes in der Bodenlösung der limitierende Faktor, dann spielenVerlagerung und nachfolgende Assimilation eine untergeordnete Rolle und die N03-Kon-zentration wird immer niedriger sein. Bei einem exzessiven Angebot hingegen wird es zu ei-ner starken Anreicherung kommen, da unter optimalen Wuchs bedingungen die Aufnahmeund der Transport die nachfolgende Reduktion überwiegt.
113
Die Reduktion des aufgenommenen N03 kann in verschiedenen Pflanzenteilen geschehen,Voraussetzung ist in jedem Fall, daß die Nitratreduktase in dem jeweiligen Organ gebildetwerden kann, da sie ein induzierbares Enzymsystem darstellt.
So stellt SCHRADER erst eine merkliche Induktion des Enzyms bei 100 mM N03 im Kul-turmedium fest (44). WALLACE und PATE (52), sowie PATE (38) fanden, daß in denWurzeln von Xanthium pennsylvanicum kaum Nitrat reduziert wird. Andererseits wurdeaufgrund der Arbeiten von ECKERSON (12) an Apfelbäumen angenommen, daß verhol-zende Pflanzengattungen ausschließlich Nitratreduktase-Aktivität im Wurzelsystem ent-wickeln und so in den oberirdischen Teilen kein Nitrat nachweisbar ist resp. keine Anreiche-rung stattfinden kann. Diese Ansicht kann aufgrund der Arbeiten von KLEPPER und HA- .GEMAN (25) nicht mehr aufrechterhalten werden. Sie ermittelten, daß bei einem hohenNOrAngebot im Wurzelmedium auch in den Blättern perennierender Pflanzen die Induk-tion der Nitratreduktase eingeleitet wird und nachfolgend N03 reduziert werden kann.BEEVERS und HAGEMAN (5), sowie OAKS (35) steUten fest, daß die Hauptmasse anN03 in den Blättern reduziert wird.Unter Freilandbedingungen werden die Verhältnisse mit Sicherheit verkompliziert, da jenach N03-Angebot in der Bodenlösung der jeweilige bevorzugte Reduktionsort (Wurzeloder Blatt) wechseln kann. Ist es niedrig, wird mit Sicherheit der größte Teil des N03 imWurzelbereich reduziert, ist es dagegen hoch, so erfolgt die Reduktion im Blatt.
Das Nitratreduktase-System ist ein substratinduzierbares System, d. h. es wird nur bei ent-sprechendem Angebot an N03 von der Pflanze gebildet. Es stellt somit den begrenzendenFaktor zwischen Nitrat und Eiweiß dar. Seine spezifische Aktivität ist dafür entscheidend,inwieweit der Pflanze reduzierter Stickstoff zum Aufbau von Protein zur Verfügung stehtbzw. große Mengen nicht verarbeiteten N03 in der Pflanze verbleiben.
Unter den Bedingungen des Freilandes spielen diejenigen Faktoren, die Aufnahme, Trans-port und Assimilation des NOl beeinflussen, eine wesentliche Rolle bei der Nitratanreiche-rung in Pflanzen.Ein Rückgang der Lichteinstrahlung ist in der Regel mit steigender NOrKonzentration inPflanzen verbunden (45, 51, 55). Die Nitratreduktase verliert im Dunkeln ihre Aktivität (8,16). Hieraus resultiert dann ein diurnaler Rhythmus des N03-Gehaltesin Pflanzenorganen.
Oie Bestandsgeometrie scheint ebenfalls einen Einfluß auszuüben. So fand KNIPMEYER(26), daß eine gegenseitige Beschattung von Blättern zu höheren N03-Konzentrationen inden beschatteten Pflanzenorganen führte.
Die Temperatur scheint wechselnde Einflüsse auszuüben: NOrAnreicherungen wurden so-wohl bei hohen Umgebungstemperaturen (27, 56), als auch bei niederen gefunden (34).
CANTLIFFE (9) stellte in seinen Untersuchungen eine Temperatur x Stickstoff-Interak-tion fest, und zwar dergestalt, daß bei ,,0 - N" eine merkliche NOrAnreicherung in denPflanzen erst bei> 15°C einsetzte, hingegen bei 50 kg N/ha und 200 kg N!ha eine Akku-mulation bereits bei> 10°C resp. > 5 "C begann. Schlußfolgerung ist, daß bei hohem NOrAngebot die Aufnahme in die Pflanze wesentlich erleichtert wird.
HUFFACKER (19) zeigte, daß eine angespannte Wasserversorgung der Pflanze zu einemRückgang der Nitratreduktase-Aktivität führt, aller Wahrscheinlichkeit nach wird die Neu-synthese verlangsamt. Dies führt ebenfalls zu N03-Anreicherungen. Zusätzlich konntenROBINSON und GACOKA (40) feststellen, daß bei Trockenheit durch den kapillaren
114
Wasseraufstieg größere Mengen N03 in der Wurzelzone angereichert werden. Dies hat na-türlich zur Folge, daß mehr N03 aufgenommen werden kann. Die Einflüsse von Luftfeuch-te und Transpirationsleistung der Pflanze sind noch nicht eindeutig geklärt. Hohe Lichtin-tensität und hohe Transpirationsraten sind meist eng miteinander korreliert und zeitigeneine starke N03-Anreicherung.
Andererseits zeigt sich aber auch eine Erhöhung des NOrSpiegels in Pflanzen bei hoherLuftfeuchte. Wahrscheinlich spielen noch andere Faktoren eine Rolle (51).
Schließlich ließ sich auch zeigen, daß angereichertes und nicht reduziertes NO] in der Zen-tralvakuole abgestellt wird und auch nicht mehr von der Nitratreduktase verarbeitet wird(21, 30). Aus dieser Tatsache sind mit großer Sicherheit auch die unterschiedlichen An-reicherungsmuster verschiedener Pflanzengattungen z. T. erklärbar.
Der bedeutendste Faktor bei der NOrAnreicherung ist die Nährstoffversorgung der Pflan-ze und im speziellen die StickstofTdüngung. Hier spielen Höhe, Stickstoffquelle, Anwen-dungszeitpunkt und Applikationsmethode eine wichtige Rolle. Es läßt sich generell feststel-len, daß mit zunehmenden Angebot die Anreicherungsrate steigt (1,3,4,39,50). Eine über-mäßige K-Düngung führt nach verschiedenen Autoren zur N03-Anreicherung. TOURAI-NE und GRIGNON (49) liefern den physiologischen Beweis, denn sie konnten zeigen, daßKalium den Eintransport des NO] in das Xylem stimuliert, Folge kann dann eine Akkumu-lation in oberirdischen Pflanzenteilen sein. Beide Nährelemente werden z. T. miteinanderaufgenommen, um innerhalb der Pflanze eine elektrochemische Neutralität aufrecht zu er-halten (55, 33). Derartige Effekte lassen sich am stärksten auf gekalkten Böden nachweisen.
Aus den meisten Untersuchungen geht eindeutig hervor, daß der bevorzugte Anreiche-rungsort für NO] die vegetativen Pflanzenorgane sind, nämlich Blätter, Stiele etc. Je nachGattung und jeweiligem Pflanzenteil schwanken die Gehalte von 20-7000 ppm NO]. InEinzelfällen können sie sogar noch größer sein (17).
In Früchten sind die Gehalte niedriger, können aber je nach Behandlung ebenfalls sehr starkvariieren. Die Schwankungsbreite liegt bei 0-270 ppm. Für Tomaten wurden Werte bis zu1254ppm NO] berichtet (17, 53).
Früchte werden, soweit sie selbst nicht sehr stark transpirieren, in der Reifephase über dasPhloem versorgt. Ein Phloemtransport des Nitrats scheidet jedoch nach den derzeitigenKenntnissen aus, so daß die N03-Anreicherung in Früchten bzw. Fruchtorganen ein nochnicht aufgeklärtes Problem darstellt.
Die Anreicherung von N03 in Reborganen, Mosten und Weinen ist sehr früh Gegenstandwissenschaftlicher Untersuchungen. EGGER (13) wies als erster Nitrat im Wein nach. SEI-FERT und KASERER kamen zu dem Schluß, daß in Naturweinen kein Nitrat zu finden ist.Aufgrund dessen war dann das Vorhandensein von Nitrat ein Indiz für Wasserzusatz. InLaborversuchen stellten sie jedoch fest, daß Nitrat in den Wein übergehen kann. Sie konsta-tierten gewisse Einflüsse der Düngung, Bodenart und der Witterung vor der Lese (46). ME-TELKA bestätigte diese Ergebnisse, mit dem Hinweis, daß Nitrat in allen Reborganen vor-kommen kann und auch zu jedem Entwicklungszeitpunkt nachweisbar ist (32).
TILLMANNS (48) und JANKOWIC (22) weisen NOrGehalte in Weinen von 0-21,6 mgN03/1 und 7,4-25,1 mg N03!1 nach. REBELEIN ermittelte bei der Untersuchung von 500Traubenmosten und Weinen Gehalte von 5,1-64,4 mg NO]!l. Die hohen Gehalte werdenvon ihm als "Ausfaller" bezeichnet und als anormal nicht aufnatürliche Arterklärbare NOr
115
Gehalte eingestuft. Weiters nimmt er an. daß absolute Gehalte von> 17-23 mg N03/l alsanormal, sprich verfälscht einzustufen sind (37). SCHNEYDER und VLCEK hingegenkonnten an authentischen österreichischen Weinen zeigen, daß durchaus Gehalte bis 27 6mg N0
3/1 auftreten können (42). Lneiner Diskussionsbemerkung weisen sie daraufhin, d~ß
in Weinen aus trockenheitsgeschädigten Lesegut Werte bis 42,2 mg N03!1 nachzuweisenwaren (43). JUNGE (24) findet bei der Untersuchung von 90 deutschen Weinen, daß 5,5,%> 23 mg N0
3/! aufweisen und bestätigt die von REBELEIN (74) vorgeschlagenen Werte
GÄRTEL (15) berichtet von Düngungsversuchen, in denen auf zur Vernässung neigende~Standorten bis zu 100 mg N03/1 gefunden wurden. HOLBACH und WOLLER fandenebenfalls Werte bis> 40 mg N03/l (18). .Untersuchungen in Splinien durch MERINERO et al. (31) zeigten, daß 4 % Gehalte von>11-26 mg N03/1 aufweisen. Bei der Untersuchung von Rioja-Weinen wurden nur Mengenvon 0,3-6,7 mg N03/1 gefunden (20). Der letzte Autor schlägt vor, den N03 -Gehalt als einen
Reifeindikator des Weines einzuführen.In Italien weisen COPPOLA (11), CAPORALl und ROMAGNANI (10), LOTTl undBALDACCI (28) sowie PALLOTTI et al, (36) daraufhin, daß die Nitratgehalte sehr nied-rig liegen, die Schwankungsbreite bei allen Autorengruppen bewegt sich von 0,6-8 mg
N03/l·In Ungarn zeigen SIMKO und MATTYASOVSZKY (47) an einer Untersuchung von 982Weinen der Jahre 1963-67 aus verschiedenen Anbauregionen, daß die N03-Gehalte von
3,4-14,1 rng/l schwanken.MATTY ASOVSZKY (29) stellt im Folgejahr fest, daß Harnstoffspritzungen den Nitratge-halt der Weine leicht erhöhten. Insgesamt waren die Gehalte aber noch immer< 20 mgNOJl. JUHASZ et al. (23) berichten über Veränderungen des Nitratgehaltes währendder Reife. Die höchsten Nitratmengen belaufen sich in ihren Untersuchungen auf 43,7 mgNOJl. Die geringsten Gehalte ermittelten sie an Müller-Thurgau. Sie stellten weiterhin fest,daß sowohl eine N _Düngung, als auch eine starke K -Diingung den Nitratgehaltder Weineer
höht.1980 bestimmten OUGH und CROWELL (57) die Nitratgehalte amerikanischer Rot- undWeißweine und stellten erhebliche Schwankungsbreiten fest: In Rotweinen fanden sie von0,9-41,4 mg N0
3/l und in Weißweinen 2,1-53,7 mg NO)/l. Eine Anreicherungdurch Wäs
serung schließen die Autoren aus, da die N03-Gehalte der californischen Trinkwässer Zdniedrig liegen. Sie fanden im Gegensatz. zu JUHASZ (23) keinen Einfluß der Düngung.
Aufgrund der sehr widersprüchlichen Ergebnisse führten wir im Anbaugebiet Rheingaund Hessische Bergstraße eine Erhebungsuntersuchung durch, mit dem Ziel einen besserEinblick in die Nitratanreicherungen authentischer Weine und Mosten zu erreichen.
116
1. Material und Methoden
1.1. WeineAlle untersuchten Weine stammten aus der Prüfstelle des Weinbauamtes Eltville. Es hdelt sich um Weine der Jahrgänge 1971 und 1972. Die Entnahme der Proben erfolgteran
l
misiert, um einen ungefähren Durchschnitt des Gebietes zu erhalten. Die Proben wurden100 ml PE- Weithalsflaschen abgefrilIt und jeweils am gleichen Tag untersucht. InsgesauJ41wurden 1971 134 Weine untersucht und 1972 300. Es handelte sich ausschließlichRieslingweine, die alle eine Prüfnummer erhalten hatten.
1.2. Moste
Die untersuchten Moste stammten ohne Ausnahme aus dem Jahr 1973 und wurden vonden Wein kontrolleuren und Beratern für Kellerwirtschaft im Rheingau resp. der Hess,Bergstraße aus dem durchmischten Preßmost entnommen. Die Untersuchung erfolgte je-weils am nachfolgenden Tag. Insgesamt standen 266 Mostproben zur Verfügung."
1.3. Quarzsandkulturversuch
Aus einem Quarzsandkulturversuch zu Reben, bei dem den Pflanzen täglich 150 mg N03/1bis zum Traubenschluß angeboten wurde, konnten die Moste aus dem Jahr 1981 unddie Weine aus 1980 und 1981 auf Nitrat untersucht werden. Insgesamt standen Weine undMoste von 4 Sorten, nämlich Riesling, Miiller-Thurgau, Ehrenfelser und Reichensteiner zurVerfügung. *
1.4. Untersuchungsmetboden
Die Bestimmung der Nitratgehalte erfolgte nach dem von REBELEIN vorgeschlagenenVerfahren (37).
Naphthylamin wurde durch I-N-Naphthylendiamin und die Sulfanilsäure durch Sulfanil-amid ersetzt. Über diese Modifikation berichten OUGH und CROWELL (57).
2. Ergebnisse
2.1. Weine der Jahrgänge 1971 und 1972
Aus dem Jahr 1971 standen 134 Weine zur Verfügung. Die Verteilung der NOrGehalte inverschiedene Gehaltsklassen ist in Abb. 1 dargestellt. Man erkennt, daß sich ca. 89 % deruntersuchten Weine auf die Klassen x 2,3-12,7 mg N03!1 aufteilen. Die Verteilung weisteine ausgesprochene Linksschiefe auf. Die restlichen 11 % verteilen sich fast gleichmäßig
#. 11
'"-"""';'0:I:
1971 Abb, J: Verteilung derNitratgehalte in Wei-nen des Jahrganges1971 in verschiedeneGehaltsklassen.
20
18
16
14
n=134
4
2
O~~~~~~~~~~~~~~~~L_ ___c: 23 35 5.8 8.1 '0.4 17J 15 17.3 19.6 Z,-' ~ 23.4 Klassenmitte ( mgNOJIlI
An dieser Stelle sei Herrn Reg. Dir. Dr. KNAPP und den Mitarbeitern der Priifstelle, den Herren DERSTROFF,HüHN und SCHILLER herzliehst für ihre Mithilfe gedankt.
• Herrn Dip!. Ing. agr, R. RIES danke ich, daß er die Moste und Weine zur Verfügung stellte.
117
auf die Klassen 15-< 23,4 mg N03/!. In der letzten Klasse sind dann auch Weine enthaltenderen N03-Gehalte bis 40 mg/l reichen. '1972 wurden aus dem Gebiet Rheingau 300 Weine untersucht, Die Verteilung der N03-Ge-halte auf die verschiedenen Gehaltsklassen ist in Abb, 2 dargestellt.
AbO . z: ve0 Nitratgehal
1972 nen des Jahl 1972 in ver; ,.-- Gehaltsklas
.-+ "--1-- n= 3002
f--
0 ,..-
8
6 f--1--
~ m-2
0
rteilung derein Wei-rgangeschiedenesen.
2
~ 2.3 3.5 5.8 8.1 10.. 121 15 173 19.6 21.9 ~23;' Klassenmitte (mg NOJIlI
Auf die Klassen< 2,3-12,7 mg N03!1 entfallen ca. 75 % aller untersuchten Weine. Im Ver-gleich zu 1971 sind das 14 % weniger. Diese Verschiebung geht, wie unschwer zu erkennenist, zugunsten der höheren Gehaltsklassen. Die Verteilung auf diese Klassen erfolgt nichtgleichmäßig. Eindeutig bevorzugt ist hier die Klasse> 23,4 mg NOl!l, es finden sich hier9 % aller untersuchten Weine. Die Verteilung selbst weist ebenso wie die von 1971 eine aus-geprägte Linksschiefe auf.Die hier vorgestellten Verteilungen lassen den Schluß zu, daß das untersuchte Material auskeiner homogenen Grundgesamtheit stammt. Aus diesem Grunde wurde eine Auf teilungnach Herkünften vorgenommen. Einteilungskriterium istim wesentlichen die geomorpholo-gisehe Gliederung des Weinbaugebietes gewesen und natürlich zusammengehörige Boden-gruppierungen. Das Ergebnis dieser Aufgliederung ist in Tab. 1 aufgeführt.
Für 1971 erkennt man, daß die Mittelwerte für die einzelnen Gebiete relativ eng-zusammen-liegen: sie schwankten mit Ausnahme des Gebietes Hochheim von 5,5-9,7 mg NOJ/I.Hochheim fällt mit 12,3 mg NOJiI etwas aus dem Rahmen.
Weit aufschlußreicher sind hingegen die Spannbreiten und die jeweiligen Variationskoeffi·zienten. Die NOrGehalte der einzelnen untersuchten Weine aus den verschiedenen Aus-bau bereichen weisen beträchtliche Schwankungen auf. Die Untergrenze liegt bei 0,1-1,0wobei der erste Wert, bedingt durch die Untersuchungsmethodik, gleich Null zu setzenwäre. Die Obergrenze der ermittelten Spann breiten reicht von 10,3-40,0 mg N03!l. Diemaximale Spannbreite von 39 mg N03/1 wurde im Bereich Hochheim ermittelt, die minima-le mit 1,6 mg N03/l im Bereich Bergstraße.Die Variationskoeffizienten, d. h. die Streuung um den Mittelwert sind z. T. beachtlich. Dengeringsten Wert findet man im Bereich Hochheim mit 8,9 %, den höchsten im Bereich Elt-ville-Walluf mit 96,9 %. Mit Ausnahme des erstgenannten Bereiches liegen alle Varia-tionskoeffizienten über 50 %. Das bedeutet aber auch, daß es im Grunde unzulässig ist, die
118
~I "'·1 *f ;r ~·I ~.I1 I I I~ ;? __,. ...0
0-
"' I I ~ I ~t: r- ';2" 0"- ;f :;:.~I ~"I r!... CO" ~. ~. I,
~~I ::'1;'1 ~.I~·I :;"~- o.. r-
U"I00g
......r-I
Nr-o....r-~r-
0\VI
60>C'Qj.J::.et::
CQICQI""CQI
EuVI...QI>
VIQj
""C
CGICoClQIL.::;)
CI~«
~N'
~",-
~..
r--
U"ICX)-
Nr-'
E~rrn
.QjI ~ CX)-
s:~-51 I Ln:~ c, ;::.' ..0:.3 ~,L/)
VIscQj
C.Qj
3.!::
~,N.... ~",'
'" C>
c;.
~~.
N -s:.... ~. 'i.e0--
0 0
-c t.~ 1 ~m - ~
0--1CO ~ 0. 0. 0.
",. a-- ;;; CD0-- ~. ~. (7)-
~ N
o'-1.~.
8-
~·I~1 ~ 11
1:-1 ~-I ~e--, '"~. ",. ~.--o0 0
e--, e-,CX) r::; }40--.r-
0 C>
U"I ~ -or-. N
r-
v;., m.1 ;., ;;.(T1 L/) N fY')
• 0"l ....~~-INI:;; I ;i.... - -• 0--N eoci
11- ." ~ JI ;1 Ne--,
~ I~ E_ e ""QJ Vlc;: ~~:::I-;2.il §,~ ~~ g'~
C :,;::,t::! ::l c. ::I )(
C o~ ~ - ~-g__ 'L Q.I !:;)O( .:=Vl CO V"! V'l>.>c
119
errechneten Mittelwerte als Mittelwert des Datenkollektiv anzusehen. Besser wäre es, dannnur die Spannbreiten zu betrachten. Die errechneten Vertrauensbereiche für die Streuungum x sind in den Zeilen 4 und 5 der Tab. I angegeben. Sie zeigen, daß mit einer Irrtums-wahrscheinlichkeit von P = 1% fast alle bestimmten Werte als zum Datenkollektiv gehö-rig anerkannt werden müssen. Ein Ausreißertest, der für die sehr hohen Werte von 40 mgN0
3/! im Bereich Hochheim durchgeführt wurde, bestätigte die Zugehörigkeit dieser Werte
zum Datenmaterial.Vergleicht man die einzelnen Standorte untereinander, so kann man feststellen, daß sich für1971 die Bereiche Hochheim und Bergstraße signifikant von allen anderen Bereichen des. Rheingaues unterscheiden. Einzige Ausnahme sind die höher gelegenen Bereiche Hallgar-ten-Rauenthal, die ebenfalls hohe N03-Gehalte zu verzeichnen haben. Die anderen Ein-zugsgebiete lassen sich untereinander nicht trennen. Dieses Ergebnis zeigt, daß es sehr pro-blematisch ist, mit Gebietsmittelwerten zu arbeiten. In jedem Falle wird eine derartige Be-trachtungsweise dazu führen, daß man einen Teil zu schwach gewichtet, den anderen hinge-
gen zu stark.
Tab. 2: DifTerenzentabelle nach dem t-Test der einzelnen Anbauregionen für Weine des Jahrganges
1971(x = signifikant auf dem 5 % Niveau).
RUOESH(1t1 ASSHANNSI"\. GEISENHElH HATTEN HEIM ELTVllLE HOCHHEIH
ASSHANNS -
GEiSENHEiM - -
HATTENHEiM 6,2' - 3,7'
ELTViLLE 5,0' - 2.3' -
HOCHHEIM - - - 4,4 • 3,2'
BERGSTR. - - - 4,9· 3.7t. -
Im Jahr 1972 konnte festgestellt werden, daß die untersuchten Weine in ihrem mittlerenN0
3-Gehalt generell höher lagen (Tab. 1). Die Zunahmen schwanken von 0,9 N03/l imBe-
reich Bergstraße, bis 6,3 mg N03!1 im Bereich Eltville-Walluf. In Tabelle 3 sind die Diffe·renzen dargestellt und die zugehörigen Grenzdifferenzen. Man sieht, daß in 3 Gebieten dieZunahmen nicht mehr zufällig sind.Es fällt weiter auf, daß in 1972 die Spannbreiten der Nitratgehalte mit Ausnahme des Be-reiches Hochheim wesentlich größer sind als 1971. Die Untergrenze liegt bei 0,1 bis 5 mgN0
3!1, die Obergrenze reicht von 21,4 bis 46,0 mg N03/!. Die maximale Spannbreite weis!
120
Tab. 3: Differenzen der mittleren NOJ-Gehalte zwischen Weinen der Jahre 1971 und 1972 in ver-schiedenen Bereichen des Rheingaues (mg NOJ!!)(x == signifikant auf dem 5% Niveau).
Rüdesheim Geisenheim Hettenheim Hallgarten <v111e Hochheim Bergstraße71 - 72 71 - 72 71 - 72 71 - 72 71 - 72 71 - 72 71- 72
Differenz 2.8 n.S. 1,J x 4,6 x 2.5 n~S. 6,) x 2,1 n.S. 0,9 n.s]-JGD", J,4 1.0 J.J 6,7 5.7 6.1 J,J
der Bereich Hallgarten-Rauenthal mit 45,9 mg NOil auf, die minimale das Gebiet Hoch-heim mit 24,5 mg N03/l.Die Variationskoeffizienten sind gegenüber 1971 in den Bereichen Rüdesheim, Hattenheim,Hallgarten, Hochheim und Bergstraße von 8,8 bis 55,2 Prozentpunkte angestiegen. In denrestlichen Gebieten traten keine gravierenden Änderungen auf. Hier wird erneut die Proble-matik der Angabe eines Mittelwertes allein für ein eng begrenztes Einzugsgebiet aufgezeigt.
Die errechneten Vertrauensbereiche (Zeile 4 und 5 der Tab. 1) zeigen, daß mit einer Irr-tumswahrscheinlichkeit von p = 1 % fast alle gefundenen Werte als zum Datenkollektiv gehö-rig anerkannt werden müssen. Die teilweise sehr hohen Werte von> 40 mg N03!1 konntennicht als Ausreißer eingestuft werden; sie liegen noch im Bereich < 4s.
Ähnlich wie für 1971 wurde auch für die einzelnen Gebiete versucht, eine Trennung nachdem t-Test vorzunehmen. Die Ergebnisse sind in der Tabelle 4 zusammengestellt.
Tab. 4: Differenzentabelle nach dem t-Test der einzelnen Anbauregionen für Weine des Jahrgangs1972(x = signifikant auf dem 5% Niveau).
RÜDESHEiM GEiSENHEiM HATTENHEiM HALLGART. ELTViLLE HOCHHEiM
GElSENHEIM -
HATIENHEiM - 3,2"
HALLGARTEN - - -
ELTVILLE - - - -
HOCHHEiM 6,1" 5,9" - - -
BERGSTR. - - - - - --
Aufgrund der insgesamt höheren N03-Gehalte und der stärker zusammengerückten Mittel-werte, läßt sich nur noch der Bereich Hochheim von den Gebieten Rüdesheirn und Geisen-
121
heim signifikant trennen, und Hattenheim von Geisenheim. Hier wird wiederum deutlichdaß es nicht sinnvoll erscheint, mit einem "großen" Mittelwert zu arbeiten, sondern die ein:
zeinen Bereiche allein zu betrachten.Betrachtet man aus rein erhebungstechnischen Überlegungen heraus die Mittelwerte desGesamtgebietes für die Jahre 1971 und 1972 (Zeile 6 und 7 in Tab. 1), so wird ersichtlichdaß der Mittelwert zwischen beiden Untersuchungsjahren um 3,5 mg N
03!l differiert. B;
zogen auf das Basisjahr 1971 ist das eine Zunahme um 52 %. Die vorgegebenen Ver-trauensbereiche sind ebenfalls in Abhängigkeit vom Jahr relativ großen Schwankungen un-terworfen. Daraus mußte ebenso wieder der Schluß gezogen werden, daß es unzulässig istvon fest vorgegebenen Obergrenzen für den Nitratgehalt in Mosten und Weinen auszuge-
hen.
2.2. Moste des Jahres 1973Im Jahr 1973 konnten 266 Preßmoste aus dem gesamten Weinbaugebiet R:heingau undHessische Bergstraße aufN03 untersucht werden. Die Verteilung der Nitratgehalte in ver-
schiedene Gehaltsklassen ist in Abb. 3 dargestellt.
~23 3.5 5.8 8) 10.4 H.7 15 17.3 19.6 21.6 ~23.4 Klassenmilte.(mgN03/11
Das Histrogramm zeigt eine fast ideale Normalverteilung. Es fällt allerdings auf, daß.3,4 %der untersuchten Preßmoste N03-Gehalte > 23,4 mg N03!1 aufwiesen. Der größere Teildieser stark N03-haltigen Moste wies Gehalte> 30-40 mg N03!1 auf.
\ Die Aufgliederung in die einzelnen Gebiete zeigt Tab. 5.Anstelle des Bereiches Hallgarten-Rauenthal, von dem aus rein technischen Gründen 1973keine Moste untersucht werden konnten, wurde der Bereich Assmannshausen binzugenom-
men. Hier handelt es sich ausschließlich um Rotweinmoste.Die einzelnen Mittelwerte weisen eine beachtliche Schwankungsbreite auf, so ist der niedrig-ste 6,4 mg N0
3im Bereich Hattenheim und der höchste 12,6 mg N03 im Bereich Rüdes-
heim festzustellen. Ähnlich wie bei den untersuchten Weinen ergeben die Mittelwerte keinrealistisches Bild des Datenmaterials. Dies vermittelt erst die zugehörige spannweite undder Variationskoeffizient. Die Unter grenze liegt bei ?,3-4,1 mg N03!1 und die Obergrenze
10
18,
16
14
11-t.~ 10...0<.
$:;>
~ 6
122
1973 Abb. 3: Verteilung derNitratgehalte in Mo-sten des Jahrganges1973 in verschiedeneGehaltsklassen.
n= 166
2
Tab. 5; Nitratgehalte in Mosten aus verschiedenen Anbauregionen des Rheingaues 1973 (mg N03/!).Rüdesheim - Assmanns- Geisenheim- Hattenheim- ELtville - Hochheim Bergstraße GesamtLorch hausen Oestrich Erbach Wallu!
Mittelwert x 12,6 10,6 10.0 6,~ 7,6 10,8 11,3 10,2
Spann breite 2.4 . :ro,O 4,1 . 34.3 0,5 • 16,9 2.4 - 13,9 0.3 . 14,6 0,4 • 40.0 2,0 . 40.0 0,3 • 40,0
Variations - 57.3 75.3 39,6 53,9 47,S 81,6 49.1 3~.2koeffizient 1%1
streuunil(,S%1 ii 0 . 26.8 0 . 26,2 2.3 . rT.7 0 - 13.2 0,5 • 14,5 0 . 28,1 0,4 . 22.2 0 . 21,7
streuun9!, 1%1~ 0 '. 31,2 0 . 31.l 0 • 20.1 0 . 22,0 0 . 17,0 0 - 33.6 0 . 26,6 0 . 25,3
bei 13,9-40 mg N03!!. Die maximale Spannbreite von 39,6 mg N03!1 wurde im BereichHochheim gefunden, die minimale von 11,5 mg N03/! im Gebiet Hattenbeim.
Die Variationskoeffizienten sind im Vergleich zu den untersuchten Weinen etwas geringerund deuten damit vielleicht eine bessere Homogenität an, jedoch liegen sie mit Ausnahmedes Bereiches Geisenheim um 50 % oder sogar weit darüber. Es wird wiederum bestätigt,daß es im Grunde unzulässig ist, den Mittelwert allein zu betrachten, ohne nicht gleichzeitigdie Spannbreite und den Variationskoeffizienten zu kennen.
Die errechneten Vertrauensbereiche für die Streuung um x in Zeile 4 und 5 der Tab. 1 zei-gen, daß fast alle Werte zum jeweiligen Datenkollektiv des betreffenden Bereiches gehören.Die über die Vertrauensbereiche hinausgehenden Werte konnten nicht als Ausreißer identi-fiziert werden. Auffallend ist, daß während der 3 Untersuchungsjahre immer die Bereiche
Tab. 6: Differenzentabelle nach dem t-Test der einzelnen Anbauregionen für Moste des Jahrganges1973.
RÜDESHEiM GEiSENHEiM HATTENHEiM HALLGART ELTVi LLE HOCHHEiM
GElSENHEIM -
HATTENHEiM - -
HALLGARTEN - - -
ELTViLlE - - - -
HOCH HEiM 6,S- 4,S' 5,0- - 6.2"
BERGSTR. 4.2x 2,5- 2,1' - 3,2x - I123
Hocbheim und Bergstraße mit sehr hohen NOrGehalten in Weinen und Mosten aus demgesamten Untersuchungsmaterial herausragten.
Versucht man mit Hilfe des t-Testes signifikante Unterschiede zwischen den Gebieten zufinden, so ergeben sich die in Tabelle 6 angeführten Differenzen. Die Gebiete Hochheimund' Bergstraße Jassen sich gegen Hattenheim und Eltville signifikant abgrenzen, ebensoRüdesheim und Geisenheim gegen die beiden letztgenannten.
An dem Untersuchungsmaterial konnte auch der Frage nachgegangen werden, ob zwischenMostgewicht, Säure und Nitratgehalt irgendwelche Beziehungen existieren. Exemplarischsind sie für die Bereiche Hochheim und Hessische Bergstraße dargestellt (Abb. 4 undAbb. 5). Man sieht sehr deutlich, daß keine systematische Beziehung vorhanden ist. Dervon REBELEIN (37) vermutete Zusammenhang, daß mit steigenden Mostgewichten auchdie NOrGehalte zunehmen, konnte nicht bestätigt werden. Eher wird man aus den Darstel-lungen das Umgekehrte ablesen können.
3
4025bergstralle t
~20~rn0
:z 15
85#' 4 5 8 9 10 Säure [%.1
Abb. 4: Zusammenhang zwischen Nitratgehalt, Mostgewicht und Säure an Mosten aus dem Bereich"Hessische Bergstraße"
Andeutungsweise läßt sich aus der Abb. 4 ablesen, daß bei niederen Mostgewichten und ho-hen Säuregehalten eine Tendenz zu höheren NOr-Gehalten im Most gegeben scheint. ImBereich Hocbheim (Abb. 5) erkennt man eine gleichmäßige Streuung in der aufgespanntenFläche von Mostgewicht und Säuregehalt.
124
:1 toO
Hochh.lm j_20"
·E0'15z
10
5
Abb. 5: Zusammenhang zwischen Nitratgehalt, Mostgewicht und' Säure an Mosten aus dem Bereich»Hochheim"
Zu der gleichen Problemstellung wurden am gleichen Material multiple Regressionsglei-chungen errechnet mit dem Nitratgehalt als Zielgröße und als unabhängige EinflußgrößenMostgewicht und Säure. Es sollte versucht werden, durch Aufdecken in Interkorrelationeneventuelle "echte" Beziehungen zu finden.
Die Schätzgleichungen für die einzelnen Gebiete und die errechneten Bestimmtheitsmaße(B ::::r2 • 100) sind nachfolgend verzeichnet.
Bereich Rüdesheim-Lorchy:::: 65,2 - 0,54 . °Oe - 1,78 . %0 SäureBereich Geisenheim-Winkely ::::3,26 + 0,11 . °Oe + 0,56 . %0 Säure
mg N03!1 Most:
Bereich Hattenheim- Erbachy ::::20,32 - 0,20 . °OeBereich Eltville- Wallufy :::: - 10,71 + 0,26 . °OeBereich Hochheimy = 1,20 + 1,1 . %0 SäureBereich Bergstraße keine Beziehung errechenbar.
B:::: 18 % n.S.
B = 6 % n.S.
B:::: 6 % n.S.
B = 10 % n.S.
B = 8% n.S,
125
Keine der errechneten Beziehungen ist nach dem F-Test absicherbar.
Auffallend ist, daß Mostgewichte und Säure sowohl negativ als auch positiv zur ZielgrößeNitrat in Beziehung stehen können. Das deutet auch daraufhin, daß die gefundenen Zusam-menhänge keineswegs kausaler Natur sind. Die Bestimmtheitsmaße sind extrem niedrig. Sieliegen im Bereich von 6-18 %, d. h. von der vorhandenen Varianz der Nitratgehalte in denMosten der einzelnen untersuchten Bereiche werden nur 6-18 % durch die Schwankungender Mostgewichte und Säuregehalte erklärt. Es bleibt demzufolge eine unerklärte Restva-rianz von 82-94 %! Aufgrund dieser Ergebnisse muß die Vermutung, daß hochgradige Mo-ste einen höheren N03-Gehalt haben können, zurückgewiesen werden, denn das Umgekehrtekann bei derartig schwachen Beziehungen ebenfalls der Fall sein.
2.3. Quarzsandkulturversuch zu Reben
Bei den in Quarzsandkultur angezogenen Reben handelt es sich um die 4 Sorten Riesling,Miiller-Thurgau, Ehrenfelser und Reichensteiner. Die beiden ersten Sorten dienten als Ver-gleich zu den beiden Neuzüchtungen. Ehrenfelser wird mehr riesling ähnlich eingestuft undReichensteiner mehr dem Miiller-Thurgau näherstehend, jedoch noch frühreifender.
Die Entwicklung der Reben unter diesen Bedingungen war absolut normal und war mit je-nen unter Feldbedingungen wachsenden absolut identisch. Die Erntemengen schwankten1980 von 0,5-1,2 kg und 1981 von 3,0-5,2 kg Trauben!Stock.
Nitratgehalte. Mostgewichte, sowie Nitrat-Ascheverhältnisse für 1980 und 1981 sind inTab. 7 zusammengestellt.
Tab. 7: Einfluß von Sorte und Jabr auf Mostgewicht und Nitratgehalt von Mosten und Weinen beiReben in Quarzsandkultur (rng N03!1).
Mo~t Wein
Sorte 1980 1981 !980 1991
DOe NO) ODe NOl NOl N'°3/Asche NO) N03/Asche
Riesling 68 n.b. 57 16.8 53.9 15.2 17 .9 9.0
Maller- Thurgau 86 n.b. 72 7.2 49.8 13.1 9.8 4.5
Ehrenfelser 71 n.b. 71 62.4 90.3 42.0 5'(.3 29.2
Befchenateäner- 96 n.b. 86 3.3 20.6 6.9 4.7 2,9
Wie nicht anders zu erwarten. liegen die Mostgewichte bei den frühreifenden Sorten höherals bei den mittelfrüh bis spätreifenden Sorten Ehrenfelser und Riesling. Ein Jahreseinflußist unverkennbar. An den Mosten des Jahres 1980 konnte keine Nitratbestimmung durchge-führt werden, da kein Material mehr vorhanden war. Die Werte des Jahres 1981 zeigen ei-nen deutlichen Sorteneinfluß: Reichensteiner weist nur 3,3 mg N03!1 Most auf, Ehrenfelser,nimmt mit 62,4 mg N03!1 Most die Spitze ein. Vergleicht man hierzu die NOrGehalte derkorrespondierenden Weine, so wird deutlich, daß das Nitrat vom Gärvorgang unbeeinflußtbleibt. Die geringen Abweichungen sind durch die Schwankungsbreite der Methode be-dingt.
126
Aufgrund dieser Erkenntnis scheint es danach auch zulässig, die Nitratgehalte der Weineaus 1980 mit den damaligen N03-Gehalten der Moste gleichzusetzen. Hierbei erkennt mannun, daß zwischen den Jahren extreme Sprünge in den Nitratgehalten der Moste auftretenkönnen. Die größte Spannbreite findet sich bei Müller-Thurgau mit ~ 500 %, gefolgt vonReichensteiner mit 438 % und Riesling mit 300 %. Die geringste Spannung findet sich beider Sorte Ehrenfelser mit 158 %, obwohl hier absolut gesehen die höchsten N03-Gehalte inden Weinen vorzufinden sind. Die gleiche Reihenfolge ergibt sich ebenfalls für die Nitrat!Ascheverhältnisse. Zu dieser letztgenannten Relation bleibt zu bemerken, daß die Weinedes Jahrgangs 1980, mit Ausnahme des Reichensteiners, zu Beanstandungen Anlaß gege-ben hätten; 1981 wären mit Sicherheit Riesling und Ehrenfelser aufgefallen, obwohl es sichin allen Fällen um authentische Weine handelte.Hinzuweisen ist bei der Sorte Ehrenfelser auf eine weitere Besonderheit: Trotz gleicherMostgewichte in beiden Jahren schwanken die Nitratgehalte um knapp 60 %.
3. DiskussionÜberhöhte Nitratgehalte werden nach wie vor als ein Kriterium angesehen, mit dem maneine unerlaubte Streckung der Moste mit nitrathaitigern Wasser nachweisen kann. Grundla-ge hierfür sind die von REBELEIN (37) und JUNGE (24) durchgeführten Untersuchungen.Beide Autoren unterstellen ohne ausführliche Begründung, daß Weine, bei denen die Nitrat-gehalte > 26 mg N03!1 betragen, als verfälscht einzustufen sind. Dies ist umso verwunderli-cher, als bereits 1968 SCHNEIDER und VLCEK (42, 43) darauf aufmerksam machen,daß unter spezifischen Anbaubedingungen weitaus höhere N03-Gehalte vorzufinden sind.
Die Auswertung der eigenen Erhebungsuntersuchung an Mosten und Weinen stimmt inso-fern mit den Ergebnissen von REBELEIN (37) und JUNGE (24) überein, als festgestelltwerden muß, daß immer ein gewisser Prozentsatz der Moste und Weine hohe oder überhöh-te Nitratgehalte aufweist. So waren es 1971 2,2 %, 1972 9 % und 1973 bei den' Mosten3,4 %. Da es sich bei dieser Erhebungsuntersuchung in allen Fällen um authentisches Mate-rial gehandelt hat, kann der von REBELEIN (37) gezogene Schluß, daß es sich bei diesenrelativ hohen Gehalten um unerlaubte Streckungen handeln muß, nicht nachvollzogen wer-den. Gewichtige Gründe sprechen vielmehr gegen eine solche Auffassung. Bei den Weinenaus dem Jahr 1971 handelte es sich ausschließlich um Prädikatsweine der Kategorie Kabi-nett bis Auslese, bei denen ein unerlaubter Wasserzusatz mit an Sicherheit grenzenderWahrscheinlichkeit nicht stattgefunden hat. Für 1972 wäre diese Vermutung durchaus be-rechtigt gewesen, da meist nur Qualitätsweine und wenige Prädikatsweine geerntet wurden.Darüberhinaus war 1972 im Rheingau die Naßverbesserung noch erlaubt, so daß man an-nehmen könnte, daß über diesen Weg zusätzliche Nitratmengen in den Wein gelangt seinkönnten. Der Anteil von 9 %Weinen mit NOrGehalten > 23 mg N03!1 spräche eigentlichdafür. Dem muß allerdings entgegengehalten werden, daß die NOrGehalte der Trinkwäs-ser im Rheingau, die damals ohne Ausnahme von den Riedwerken geliefert wurden, im Be-reich von 3-5 ppm N03 schwankten. Demzufolge können bei einer 10%igen Naßverbesse-rung kaum Gehalte von 30-40 mg N03!1 erreicht werden, eher sind Verdünnungen zu er-warten. Zu ähnlichen Überlegungen kommen OUGH und CROWELL (57).
Die relativ hohen Nitratgehalte des Jahres 1972 sind vielmehr eine Nachwirkung des Trok-kenjahres 1971. Mit Sicherheit sind nicht verbrauchte Reststickstotfmengen, die in Formvon NOl noch im Boden vorlagen, 1972 zur Wirkung gekommen. Dies steht in Einklangmit MATTYASOVSZKY (29) und JUHASZ (23), die als Folge einer N-Düngung eine Er-
127
höhung der N03-Gehalte im Most nachweisen. Aus der allgemeinen Pflanzenernährung istzudem bekannt, daß es für die Pflanze unerheblich ist, aus welcher Quelle der aufnehmbareStickstoff kommt, sei es aus Mineraldünger oder Boden. Von Bedeutung ist nur die Konzen-tration in der Bodenlösung, die zu einer entsprechenden Anreicherung in den oberirdischenTeilen der Pflanze führen kann (1, 3, 4, 39, 44, 50).
Die Ergebnisse aus Spanien (20, 31) und Italien (IO, 11, 28, 36) stehen mit diesen Überle-gungen in vollem Einklang, denn die dort gefundenen niederen N03-Gehalte sind in ersterLinie auf mangelndes N03-Angebot vom Boden her zurückzuführen, da erstens dort dieDüngungsintensität sehr gering ist und zweitens wegen geringen Wasserangebotes währendder Vegetationszeit keine starke NOrAufnahme erfolgen kann.
Diese Auffassung wird auch dadurch bestärkt, daß es möglich ist, Teilgebiete des Weinhau-gebietes aufgrund unterschiedlicher NOrGehalte in Weinen gegeneinander abzugrenzen.Daraus wird ersichtlich, daß bodenbürtige und eventuell auch kleinklimatische Einflußgrö-ßen eine weitaus größere Rolle spielen, als bisher angenommen wurde. Eine wesentlicheSchlußfolgerung aus diesen Ergebnissen wäre dann zwangsläufig, daß es eines extrem dich-ten Untersuchungsnetzes sowohl räumlich als auch zeitlich bedürfte, wollte man den NOyGehalt von Mosten oder Weinen als Kriterium für eine unerlaubte Streckung heranziehen.Wie gezeigt werden konnte, kann die Verwendung eines Mittelwertes, der sich aus Erhebun-gen in sehr vielen Einzelgebieten eines Weinbaugebietes zusammensetzt, zu eklatanten Fehl-einschätzungen führen. Wenn man noch berücksichtigt, daß das zur Untersuchung heran-gezogene Weinbaugebiet Rheingau keine allzu starke kleinräumliche und bodentypologi-sche Gliederung aufweist, so dürften in anderen Gebieten mit weitaus kräftigerer Gliede-rung sehr viel größere Schwankungen auftreten.
Ein weiterer wichtiger Punkt, der bis zum heutigen Zeitpunkt nicht geklärt ist, stellt der Sor-teneinfluß dar. Wie die Versuche unter kontrollierten Bedingungen zeigten, existieren ausge-prägte Sorten- und Jahreseinflüsse im Hinblick auf die Nitratanreicherung. Die Sorte Mül-ler-Thurgau, die eine sehr große ökologische Streubreite besitzt, zeigt auch hinsichtlich derNitratgehalte in Mosten eine extreme Streubreite. Unter diesem Aspekt gesehen, dürfte esdann sowieso sehr schwierig, wenn nicht unmöglich sein, exakte Obergrenzen für tolerier-bare NOJ-Gebalte im Wein festzulegen.
Andererseits scheinen aber auch Sortentypen zu existieren, die grundsätzlich eine hohe Ak-kumulationsrate, wie z. B. die Sorte Ehrenfelser, aufweisen.
Aufgrund dieser angedeuteten Zusammenhänge ist zu vermuten, daß die Nitratanreiche-rung in Mosten ein sehr komplexes Problem darstellt. Es muß angenommen werden, daßdas zeitliche Stickstoffangebot vom Boden her und dessen Höhe eine wichtige Rolle spielen,was man als Jahreseinfluß charakterisieren kann. Eine nicht minder gewichtige Bedeutungdürfte die genetische Veranlagung der Rebe haben, aufgenommenes Nitrat zu reduzierenund in Aminosäuren einzubauen. Da diese Fähigkeit ebenfalls von äußeren Faktoren beein-flußt wird, wie einschlägige Untersuchungen zeigen (8, 16, 19,26,27, 34, 45, 51, 55, 56),dürfte es beim gegenwärtigen Kenntnisstand sehr schwer sein, schon heute Obergrenzen ei-ner höchstmöglichen N03-Anreicherung in Mosten angeben zu können. Umgekehrt scheintes deshalb auch nicht möglich, aufgrund einer stark eingeschränkten Stichprobe, bei über-schreiten eines bestimmten NOrGehaltes bereits von unerlaubten Verfälschungen zu spre~chen. Bis man das kann, müssen erst alle möglichen natürlichen Mechanismen der N03-Anireicherung in Reben aufgeklärt werden.
128
4. Zusammenfassung
1. An einer Erhebungsuntersuchung von 134 Weinen aus dem Jahr 1971, sowie 300 Wei-nen aus dem Jahr 1972 aus dem Weinbaugebiet Rheingau und Hessische Bergstraßekonnte gezeigt werden, daß 2,2 % resp. 9 % des untersuchten Materials Gehalte bis 46mg N03!1 aufwiesen. Einzelne Anbauregionen innerhalb des Anbaugebietes unterschie-den sich signifikant voneinander.
2. Die Untersuchung von 266 Preßmosten aus dem gleichen Anbaugebiet im Jahr 1973 be-stätigt im wesentlichen die an den Weinen gewonnenen Ergebnisse. An diesem Materialkonnte auch gezeigt werden, daß keine Beziehung zwischen NOrGehalt, Mostgewichtund Säure existiert.
3. Untersuchungen an Mosten und Weinen, die aus 4 Sorten stammten, und unter konstan-ten Bedingungen und gleichbleibendem Nitratangebot von 150 mg N!I Nährlösung inQuarzsand kultiviert worden waren, zeigten, daß N03·Gehalte von 20,6-90,3 mg Noilim Jahr 1980, und 4,7-57,3 mg N03!1 im Jahr 1981 auftraten. Zusätzlich wurden gra-vierende Sorteneinflüsse festgestellt.
Sommaire
1. Examinant 134 vins en 1971 et 300 vins en 1972 on pus dementre que 2,2 % resp. 9 %de toutes les vins avaient jusqu'a 46 mg NOJ!]. TI y a aussi tres grandes differences entredivers subregions en Rheingau. C'est pourquoi il est possible qu'existe une influence dessols et aussi du microclimat ä I'accummulation de nitrate.
2. Examinant 266 mouts en 1973 on pus confirrne les resultat trouves en vins. En outre onpus dementre qu'il n'existe pas une relation entre I'accumulation de nitrate et le contenuen glucides et/ou l'acidite du mout.
3. Examinant des mouts et vins de 4 varietes cru en sable et fertilise avec 150 mg NOl!1 so-lution de nutritive, on pus dementre qu'iJ y a une accumulation de nitrate en mout et vinde 20,6 a 90,3 mg N03!1 en 1980, et de 4,7 a 57,3 mg N03!l en 1981. On peut aussi ob-serve qu'il existe une tres grande influence des varietes a l'accumulation de nitrate.
Summary
1. Testing 134 wines from 1971 and 300 wines from 1972 for nitrate it could be shown that2,2 % resp. 9 % of all tested wines bad nitrate contents up to 46 mg N03/l. Some areaswithin the great area Rheingau differed significantly from each other. There fore it maybe possible, that there exist an influence of soils and microclimate on nitrate accummula-tion.
2. Testing 266 musts in 1973 confirmed the results found on wines. Further could beshown, that there is no relationship between nitrate accumulation, sugar content of mustand/ or acidity.
3. Testing musts and wines from 4 varieties grown in quartz sand culture and a constant ni-trogen supply with 150 mg NOJIl nu trient solution, showed that there is a nitrate accu-rnulation in musts and wines from 20,6-90,3 mg NOJ!I in 1980 and 4,7-57,3 mg N03!1in 1981.. We further observed a high influence ofvariety on nitrate accummulation.
129
Literatumachweis1. ARORA, S. K. and LUTHRA, Y. P.: Plant and Soil34, 283-293 (1971)
2. BAR-AKIVA, A. etal.: Hort Science 2, 51-53 (1967)
3. BARKER, A. V. et al.: Agron. J. 63, 126-129 (1971)4. BARKER, A. V. and MAYNARD,D. N.: Comm. SoilSci. Plant Analysis 2,471-478 (1971)
5. BEEVERS, L. and HAGEMAN, R. H.: Arm, Rev. Plant Physiol. 20, 495-522 (1969)
6. BLEVINS, D. G. et al.: Plant Physiol. 57, 458-459 (1976)·7. BRUNETTI, N. and HAGEMAN, R. H.: Plant Physiol. 58, 583-597 (1976)
8. CANDELLA, M. I. et al.: Plant Physiol. 32, 280-288 (1957)
9. CANTLIFFE, D. 1.: J. Amer. Soc, Hortic. Sei, 97,674-676 (1972)10. CAPORALI, L. und ROMAGNANl: Bollettino dei Chimici dei Laboratori Provinciali 6,
609-611 (1980)11. COPPOLA, V.: Rivista di Viticoltora e di Enologia 30,248-257 (1977)
12. ECKERSON, S. H.: Bot. Gaz. 77, 377-390 (1924)
13. EGGER, A.: Archiv f. Hygiene 2,373 (1885)14. EITRICH, G. L. and HAGEMAN, R. H.: Drop. Sci.13, 59-66 (1975)15. GÄRTEL, W.: Forschungsring des Deutschen Weinbaues, Jahresbericht, 11-12 (1973)
16. HAGEMAN, R. H. and FLESHER: Plant Physiol. 35, 635-641 (1960)
17. HERRMANN, K.: Ernährungsumschau 11, 398-402 (1972)18. HOLBACH, B. und WOLLER, H.: Der Nitratgehalt von Wein und seine Aussagekraft im Hin-
blick auf die Weinbeurteilung. - Vortrag am 9. 5.1973 in Bernkastel-Kues, Jahrestagung des
FDW19. HUFFACKER, R. C. et al.: Crop. Sci. 10, 471-474 (1910)20. INIGUEZ, CRESPO, M.: Semana Vitivinicola 35, 1143-1145 (1980)
21. JACKSON, W. A. etal.: Plant Physiol. 51,120-127 (1973)22. JANKOWIC,: zit. bei REBELEIN, H. Dt. Lebensm. Rdsch. 63, 233-239 (1967)23. JUHASZ, 0., KOZMA, P. und GYULAY, B.: Kertesz. Egyet. KÖzlemen. 44, 27-32 (1981)
24. JUNGE, Ch.: Dt. Lebensm. Rdsch. 66, 422-424 (1970)25. KLEPPER, C. A. and HAGEMAN, R. H.: Plant Physiol. 44, 110-114 (1969)
26. KNIPMEYER, J. W. et al.: Crop Sei. 1, 1-5 (1962)
27. KRETSCHMER, A. E. jr.: Agron. J. 50, 314-316 (1958)28. LOTTl, G. und BALDACCI, P. V.: Rivista di Viticoltora e di Enologia 23, 262-272 (1970)
29. MATTYASOVSZKY, P.: Eleirniszervizsgalati Koezlemenyek 17, 209-215 (1971)
30. MENARY, R. C. und JONES, R. H.: Austr. J. Biol. Sei. 25, 531-544 (1972)31. MERlNERO, B., FERN ANDEZ, M. J. und LLAGONO, C.: Rivista de Agroquimica Y Teclmo·
logia de Aliemtos 8, 367-369 (1968)32. METELKA, M.: Z. Landw. Versuehsw. Österr. 7,725-730 (1904)
33. MINOTTI, et al.: Soil Sei. Soc. Am. Proe. 32, 692-697 (1968)
34. NIGHTlNGALE, G. T. et al.: Plant Physiol. 6, 605-630 (1931)35. OAKS, A.: In "Nitrogen Assimilation of Plants". Aeademie Press, New York (1979)36. PALLOTTI, G., BENCIVENGA, B., GRAZIANl, A. und PALMIOLl, A.: Industrie delle Be-
vande 10, 408-409 (1980)
130
37. REBELEIN, H.: Dt. Lebensm. Rdsch. 63, 233-239 (1967)38. PATE, J. S.: Soil. Bio!. Biocbem. 5,109-114 (1973)39. REGAN, W. S. et al.: Proc. Am. Soc. Hort. Sci. 93,485-492 (J 968)40. ROBINSON, J. B. D. and GACOKA, P.: J. Soil Sci. 13, 133-139 (1962)41. SCHALLER, K.: Untersuchungen über die Nitratreduktase-Aktivität in Rebenblättern. - Jah-
restagung des "Forschungsringes des Deutschen Weinbaues" 1980, Geisenheim42. SCHNEYDER, J. und VLCEK, G.: Mitt. Klosterneuburg 18, 92-97 (1968)43. SCHNEYDER, J. und VLCEK, G.: Mitt. Klosterneuburg 18,383 (1968)44. SCHRADER, L. E.: "Uptake, Accumulation, Assimilation, and Transport ofNitrogenin Higher,
Plants" in "Nitrogen in the Environment" Vol. 2, Academic Press. New York - London (1978) \,____ /45. SCHUPHAN, E. et al.: Qual. Plant. Mater. Veg. 14, 317-330 (1967)46. SEIFERT, W. und KASERER, H.: Zt.landw. Versucbsw. Österr. 6, 555-565 (1903)47. SIMKO, N. und MATTYASOVSZKY, P.: Eleimiszervizsgalati Koezlemenyek /6, 27-30
(1970)48. TILLMANNS: zit. bei REBELEIN, H. Dt. Lebensm. Rdsch. 63, 233-239 (1967)49. TOURAINE, B. et GRIGNON, Cl.: Physiol. vegetale 20,23-31 (1982)
50. TREVINO, I.C. and MURRAY, G. A.: Crop. Sci. 15, 500-502 (1975)51. VTETS, F. G. jr. and HAGEMAN, R. H.: U.S. Dep. Agric., Agric. Handb. 413 (1971)52. WALLACE, W. and PATE, J. S.: Arm. Bot. 31, 214-228 (1967)53. WILSON, J. K.: Agron, J. 41, 20-22 (1949)54. WITT, H. H. und JUNGK, A.: Landw. Forschung 30,2. Sonder heft (1972)55. WRIGHT, M. 1. and DAVIDSON, K. L.: Adv. Agron. 16, 197-247 (1964)56. YOUNIS, M. A. et al.: Crop Sei, 5,.321-326 (1965)57. OUGH, C. S. und CROWELL, E. A.: Am. J. Enol. Vitic 31, 344-346 (1980)
Anschrift des Verfassers: Prof. Dr. K. SCHALLER, Leiter des Instituts für Bodenkunde und Pflanzenernährungder Forschungsanstall für Weinbau, Gartenbau, Getränketechnologie und Landespflege Geisenheim, Postfach1154,D·6222 Geisenheim/Rhein
131