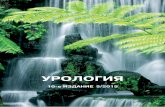28/3/2014 Das Chinabild bei Karl May
Transcript of 28/3/2014 Das Chinabild bei Karl May
28/3/2014 Das Chinabild bei Karl May | Eva M. Stolberg - Academia.edu
http://www.academia.edu/2906177/Das_Chinabild_bei_Karl_May 1/26
Das Chinabild bei Karl May by Eva M. Stolberg
more
Search People, Research Interests and Universities
28/3/2014 Das Chinabild bei Karl May | Eva M. Stolberg - Academia.edu
http://www.academia.edu/2906177/Das_Chinabild_bei_Karl_May 2/26
28/3/2014 Das Chinabild bei Karl May | Eva M. Stolberg - Academia.edu
http://www.academia.edu/2906177/Das_Chinabild_bei_Karl_May 3/26
28/3/2014 Das Chinabild bei Karl May | Eva M. Stolberg - Academia.edu
http://www.academia.edu/2906177/Das_Chinabild_bei_Karl_May 4/26
4 Eva-Maria Stolberg
Christentums in der wilhelminischen Kriegstheologie, wie sie deutlichin der ‚Hunnenrede‘ des Kaisers zum Ausdruck kam, spiegelt die tiefeVerstrickung in die koloniale Eroberungspolitik des Deutschen Reichesin China während des Boxeraufstandes wider. Dies war den Zeitgenos-sen im Kaiserreich durchaus bewusst, und es entwickelte sich eine öf-
fentliche Polemik, in die nicht nur die ‚Hunnenrede‘, sondern auch dasMay‘sche Werk einbezogen wurde. Der Boxeraufstand von 1900, eintypischer Kolonialkrieg, war ein Topos der nationalen Deutungskämp-fe. Die schon damals oft zitierte ‚Hunnenrede‘ des Kaisers kann alsLeitmetapher einer ‚Gründungsgewalt‘ (violence fondratice) der nochjungen deutschen Nation angesehen werden.12 Vergleicht man die hierangeführten Zitate der deutschen kolonialen Elite in China mit der‚Hunnenrede‘, so fallen nicht nur die Analogien im Umgang mit kolonia-ler Gewalt (gerade auch in der sprachlichen Form) auf. Vielmehr stellt die ‚Hunnenrede‘ des Kaisers einen Höhepunkt, eine Steigerung dar. Eswird eine imaginierte deutsche Schicksalsgemeinschaft konstruiert, dieauf einem christlich-abendländischen Fundament basiert:
Große überseeische Aufgaben sind es, die dem neu entstandenen Deut-schen Reiche zugefallen sind, Aufgaben weit größer, als viele MeinerLandsleute es erwartet haben. Das Deutsche Reich hat seinem Charakternach die Verpflichtung, seinen Bürgern, wofern diese im Ausland be-drängt werden, beizustehen. Die Aufgaben, welche das alte RömischeReich deutscher Nation nicht hat lösen können, ist das neue DeutscheReich in der Lage zu lösen. Das Mittel, das ihm dies ermöglicht, ist unserHeer. In dreißigjähriger treuer Friedensarbeit ist es herangebildet wor-den nach den Grundsätzen Meines verewigten Großvaters. Auch ihrhabt eure Ausbildung nach diesen Grundsätzen erhalten und sollt nunvor dem Feinde die Probe ablegen, ob sie sich bei euch bewährt haben.Eure Kameraden von der Marine haben diese Probe bereits bestanden,sie haben euch gezeigt, daß die Grundsätze unserer Ausbildung gutesind, und Ich bin stolz auf das Lob auch aus Munde auswärtiger Führer,
das eure Kameraden draußen sich erworben haben. An euch ist es, esihnen gleich zu tun. Eine große Aufgabe harrt eurer: ihr sollt das schwe-re Unrecht, das geschehen ist, sühnen. Die Chinesen haben das Völker-recht umgeworfen, sie haben in einer in der Weltgeschichte nicht erhör-ten Weise der Heiligkeit des Gesandten, den Pflichten des GastrechtsHohn gesprochen. Es ist das um so empörender, als dies Verbrechen be-gangen worden ist von einer Nation, die auf ihre uralte Kultur stolz ist.Bewährt die alte preußische Tüchtigkeit, zeigt euch als Christen imfreundlichen Ertragen von Leiden, möge Ehre und Ruhm euren Fahnenund Waffen folgen, gebt an Manneszucht und Disziplin aller Welt einBeispiel. Ihr wißt es wohl, ihr sollt fechten gegen einen verschlagenen,
28/3/2014 Das Chinabild bei Karl May | Eva M. Stolberg - Academia.edu
http://www.academia.edu/2906177/Das_Chinabild_bei_Karl_May 5/26
Karl Mays China- und Ostasienbild 5
tapferen, gut bewaffneten, grausamen Feind. Kommt ihr an ihn, so wißt:Pardon wird nicht gegeben. Gefangene werden nicht gemacht. Führt eu-re Waffen so, daß auf tausend Jahre hinaus kein Chinese mehr es wagt,einen Deutschen scheel anzusehen. Wahrt Manneszucht. Der Segen Got-tes sei mit euch, die Gebete eines ganzen Volkes, Meine Wünsche beglei-ten euch, jeden einzelnen. Öffnet der Kultur den Weg ein für allemal!
Nun könnt ihr reisen! Adieu Kameraden!13
Die inoffizielle und korrekte Version des letzten Passus lautete:
Kommt ihr vor den Feind, so wird derselbe geschlagen! Pardon wirdnicht gegeben! Gefangene werden nicht gemacht! Wer euch in die Händefällt, sei euch verfallen! Wie vor tausend Jahren die Hunnen unter ihremKönig Etzel sich einen Namen gemacht, der sie noch jetzt in Überliefe-rung und Märchen gewaltig erscheinen läßt, so möge der NameDeutschland in China auf 1000 Jahre durch euch in einer Weise bestätigt werden, daß es niemals wieder ein Chinese wagt, einen Deutschenscheel anzusehen!14
Auffällig ist, dass die koloniale Mission, die auf die Errichtung einesdeutschen Übersee-Imperiums hinauslaufen sollte, als Friedensarbeit gepriesen wurde. Der Kaiser hob dabei nicht nur die deutschen Tugen-den hervor, ordnete diese in die Tradition des Heiligen Römischen Rei-ches deutscher Nation (und damit in die abendländische Zivilisation)ein, sondern arbeitete mit einem Gegensatz: die chinesische Kultur ha-be mit der Ermordung der Gesandten das Völkerrecht gebrochen undihre eigenen Tugenden verraten. Die Anspielung auf die Hunnen mutet in diesem Zusammenhang auf den ersten Blick irritierend an, erklärt sich jedoch m. E. dadurch, dass hier auf die asiatische Härte Bezug ge-nommen wurde – mit anderen Worten: Wilhelm II. deutete an, dass denChinesen mit ebendieser Härte zu begegnen sei.15
Abgesehen von diesen militaristischen Attitüden und kulturellenStereotypen (asiatische Härte) zeigte die innenpolitische Kontroverse,
die von der Rede des Kaisers ausgelöst wurde, wie fragil sich das Fun-dament des deutschen Nationalbewusstseins im Spiegelbild einer ande-ren Kultur erwies. Diese Fragilität verstärkte sich sicherlich in der ge-steigerten imperialistischen Konkurrenz der europäischen Großmächtein Ostasien. Zugleich warf das in der ‚Hunnenrede‘ plakativ angespro-chene nationale Heilsversprechen, die Konstruktion eines christlichenFortschrittsmythos, die Frage danach auf, welche Visionen vom neuen20. Jahrhundert entworfen wurden: Ein Jahrhundert des kriegerischenZusammenstoßes der Weltkulturen oder der Anbruch einer gewalt-freien Zukunft? Der Krieg erscheint nach Lars Koch als Imaginations-
28/3/2014 Das Chinabild bei Karl May | Eva M. Stolberg - Academia.edu
http://www.academia.edu/2906177/Das_Chinabild_bei_Karl_May 6/26
6 Eva-Maria Stolberg
raum, als „das Andere des zivilen Normalzustandes“. Die These lässt sich am Beispiel des Boxeraufstandes zuspitzen: Das Andere gewinnt im Kolonialen Fremden an Extreme.16
KarlMays China- und Ostasienbild in Und Friede auf Erden!
Eine intensive textkritische Auseinandersetzung mit Mays Reiseerzäh-lung Und Friede auf Erden! findet sich bereits in dem 2001 von DieterSudhoff und Hartmut Vollmer herausgegebenen Studienband.17 Der fol-gende Beitrag will Mays China- und Ostasienbild anhand einer china-wissenschaftlichen/sinologischen Zugangsweise untersuchen, d. h. denText mit den zeitgenössischen Ereignissen und Entwicklungen im Reichder Mitte zur Zeit der Boxerbewegung abgleichen. Im Blickpunkt solldaher nicht die deutsche Kolonial- und Imperialismuspolitik stehen,stattdessen wird der in Kürschners Sammelband und Mays Reiseerzäh-lung enthaltenen „‚abendländische[n]‘ Tendenz“ (XXX 491)18 die chine-sisch-ostasiatische Deutung gegenübergestellt. Diese Deutung ist inso-
fern interessant, als Karl May selbst mit bildhafter Verschlüsselung ar-beitete.19 An dieser Stelle ist leider kein Raum, den May’schen Text indie Orientalismuskritik Edward Saids einzubeziehen. Vielmehr ist da-rauf hinzuweisen, dass die chinesische Kultur selber traditionell Sym-bole, d. h. eine Verschlüsselung, schuf, also einen symbolschaffendenAkteur und nicht allein ein durch die westliche Welt symbolbehaftetesObjekt darstellte.20 Über das Symbolbehaftete trat Karl May in seinemSpätwerk Und Friede auf Erden! gleichzeitig in den Bereich des Philoso-phisch-Religiösen, d. h. in die Metaphysik. Auch hier bietet sich ein Blickin die chinesische Philosophie. Die innere Seelenbespiegelung, die sichin Und Friede auf Erden! (Et in terra pax ) findet, musste auf die deut-schen Leser, die an die May’schen Abenteuergeschichten gewöhnt wa-ren, befremdend wirken.21 Die innere Seelenbespiegelung des Autors
Karl May, hier letztendlich stellvertretend für die ‚deutsche Seele‘, rief durch ihre Gebundenheit an einen fremden Ort (China) vor dem zeithis-torischen Hintergrund des Boxeraufstandes eine tiefe Verunsicherungbeim deutschen Publikum hervor. So warfen in der Presse erschienenePolemiken Karl May vor, das Christentum zu verleugnen und stattdes-sen mit Und Friede auf Erden! einen religiösen Synkretismus den Wegzu bereiten.22
Auf seiner Orientreise 1899/1900, die die Vorlage für Et in terra pax bot, hat May China nicht besucht. Das Reich der Mitte stellt hier eineutopische Projektion dar.23 In der Überarbeitung für die Fehsenfeld-
28/3/2014 Das Chinabild bei Karl May | Eva M. Stolberg - Academia.edu
http://www.academia.edu/2906177/Das_Chinabild_bei_Karl_May 7/26
Karl Mays China- und Ostasienbild 7
Ausgabe (Band XXX der Gesammelten Reiseerzählungen, erschienen imSeptember 1904) findet sich die Ergänzung um das Kapitel Der Shen-Ta-Shi (XXX 490ff.). China ist hier vor allem Ort May’scher Allegorien:das so genannte „Land der Shen“, dessen Kultur der christlichen Missi-on Heilung vom Wahn verspricht. Diese Errettung stellt sich der auf
Kürschners Einband enthaltenen Allegorie des Kaisers entgegen, dievom Schutz der heiligen Güter Europas spricht („Völker Europas wah-ret Eure heiligsten Güter“).24 Sicherlich sind in diesem ZusammenhangAllegorien als rhetorisches Kampfmittel zu verstehen.25 Zugleich deu-ten sie auf spirituell-religiöse Zusammenhänge, was für Mays Und Frie-de auf Erden! zutrifft. Erst die Durchsicht der in der Reiseerzählungenthaltenen Motive, Orte, Dinge und Figuren liefert den Schlüssel zumVerständnis. Der Gebrauch von Allegorien hatte in Deutschland vomspäten 19. Jahrhundert über die Jahrhundertwende hinaus Hochkon-junktur. Schauplatz für Allegorien, für die Suche nach dem Magischen,waren oft exotische Länder.26
Gleich zu Beginn von Et in terra pax , in Kapitel 1 ( Am Thore des Ori-ents), tauchen in einem Hotel in Kairo zwei Chinesen (Vater und Sohn)als ‚Orientreisende‘ auf. Karl May spielt hier mit einem Bild:
Sie [die Chinesen] waren nicht in heimische Tracht gekleidet, sonderntrugen weiße Reiseanzüge nach französischem Schnitte. Ihre Zöpfewurden von den Tropenhelmen verborgen, die sie auch während derTafel nicht abzunehmen pflegten.27
Die Chinesen, Repräsentanten des Orients, schlüpfen in die Rolle/Ver-kleidung europäischer Orientreisender. Damit werden quasi die Stereo-typen zwischen Orient und Okzident miteinander verschmolzen undzugleich aufgelöst. Die äußere Aufmachung gleicht einem übersteiger-ten Exotismus: die Zöpfe der Chinesen wirken auf den europäischenBeobachter nicht minder exotisch, wie die weißen Tropenanzüge auf
den orientalischen Zeitgenossen. Andererseits stellt sich die äußere Er-scheinung, die sich im Zeitalter des Imperialismus oft mit ethnischenStereotypen verbindet, als eine Auflösung des Ethnozentrismus dar.Das Verhältnis von Kolonisator (Europäer, hier: Franzosen) und Kolo-nisierten (Chinesen) wird aufgehoben. Zugleich spielt Karl May mit dem Exotismus, allerdings in Abgrenzung zu der sonst in der Wilhelmi-nischen Zeit üblichen Kolonialliteratur.28
Der Sohn zeigt dem Vater gegenüber Ehrerbietung; hier greift Mayeine Tugend des Konfuzianismus auf. Nach Konfuzius sollte die chinesi-sche Gesellschaft auf der Grundlage der fünf Tugenden (‚wulun‘) funk-
28/3/2014 Das Chinabild bei Karl May | Eva M. Stolberg - Academia.edu
http://www.academia.edu/2906177/Das_Chinabild_bei_Karl_May 8/26
8 Eva-Maria Stolberg
tionieren: Vater-Sohn, Herrscher-Minister, Ehemann-Ehefrau, ältererBruder-jüngerer Bruder, Freund-Freund. Die ‚fünf Tugenden‘ gehörtenzu den so genannten Ewigkeitskonstanten, die die Stabilität des chine-sischen Kaiserreiches garantieren sollten.29 Zu den ‚fünf Tugenden‘ tra-ten die ‚vier Grundwerte‘ hinzu: Humanität, Rechtlichkeit, Wahrheit
und Tugend.30 Karl May beschreibt die chinesische Tugendhaftigkeit alsetwas, das „aus dem Innern“ kommt und „nichts Gemachtes, nichtsAeußerliches“ ist.31 Auch hier spielt May mit inneren und äußerlichenWirkungen, der konfuzianischen Ehrerbietung des Sohnes gegenüberdem Vater steht die Maskerade der Tropenanzüge entgegen.
Karl May verfügte offensichtlich über Kenntnisse der chinesischenKultur und Sprache. In dem Roman heißen die beiden Chinesen Fu undTsi, was ‚Vater‘ und ‚Sohn‘ bedeutet. Richtig ist auch Mays Feststellung,dass die Wörter im Chinesischen durch unterschiedliche Aussprache –hier ist die Intonation (d. h. mehrere Tonstufen) gemeint – eine unter-schiedliche Bedeutung erhalten und daher bei Ausländern Missver-ständnisse hervorrufen können.32 Das Erlernen der chinesischen Spra-che war Ende des 19./Anfang des 20. Jahrhunderts im Deutschen Reichkaum professionalisiert, das Universitätsfach Sinologie war gerade imEntstehen begriffen. Die in China tätigen Missionare und Missionarin-nen mussten sich die Sprache oft im Selbststudium aneignen, einen Pri-vatlehrer engagieren oder eine Schule besuchen. Sie berichteten überihre Schwierigkeiten:
Bis Montag habe ich fast noch nichts zu thun, sodaß ich mich allmählicheinleben kann. Nur chinesische Stunde hatte ich schon zweimal, und ichwünschte nur, Ihr könntet mal dabei sein. Der Lehrer mit dem Zopf undin seinem weißen Anzuge sitzt neben mir und spricht mir eine Stundelang die Wörter mit acht verschiedenen Tönen vor und ich habe nichtszu thun als sie nachzusprechen.33
Das Thema Mission in China greift Karl May auch in der folgenden Kon-versation zwischen dem amerikanischen Missionar Waller und denbeiden chinesischen Kaufleuten auf. Waller beklagt sich über die massi-ve Einwanderung von Chinesen in die Vereinigten Staaten.34 Es folgt einDisput über das Verhältnis von Christentum und Konfuzianismus. HerrFu räumt ein, bereits zum Christentum bekehrt zu sein, gleichzeitig be-kennt er sich jedoch zum Konfuzianismus, was bei seinem Gesprächs-partner Verwirrung auslöst. Dabei hatte der Synkretismus, die Vermi-schung vieler religiöser Anschauungen, eine lange Tradition im Reichder Mitte. Die großen Lehren des Buddhismus, Konfuzianismus und
28/3/2014 Das Chinabild bei Karl May | Eva M. Stolberg - Academia.edu
http://www.academia.edu/2906177/Das_Chinabild_bei_Karl_May 9/26
Karl Mays China- und Ostasienbild 9
Daoismus koexistierten gleichberechtigt, dogmatisches Denken warden Chinesen unbekannt, synthetische und synkretische Vorstellungenwaren daher verbreitet.35 Das Neben- und Miteinander einer Vielzahlphilosophischer und religiöser Strömungen machte das gesellschaftli-che Leben im Reich der Mitte vielschichtig.36 Das chinesische Konzept
der ‚drei Lehren‘ (‚sanjiao‘) befürwortete die religiöse Vielfalt und wur-de zugleich für viele Länder Ost- und Südostasiens Vorbild. Grundle-gend dabei ist, dass keine philosophische oder religiöse Strömung denAnspruch verfolgt, die anderen zu belehren, zu verändern oder zu do-minieren.37 Diesem Grundsatz ist auch Fus Aussage in Et in terra pax zuzuordnen: „Die Summe unseres Glaubens aber lautet: ‚Die wahreGlückseligkeit kommt uns vom Himmel hernieder, und die Menschensollen sie neidlos und friedlich unter sich verteilen.‘“38
Verwunderung löst bei dem amerikanischen Missionar Fus Erläute-rungen zum Ahnenkult aus.39 Die Verehrung der verstorbenen letztenvier Generationen hat im Konfuzianismus eine lange Tradition, die mit der bereits angesprochenen Pietät der Kinder gegenüber den Elternund deren Vorfahren zusammenhängt. Waller kann die Bedeutung desAhnenkultes nicht nachvollziehen und wertet ihn als Aberglauben ab –ein Urteil, das für christliche Missionare des 19. Jahrhunderts sympto-matisch war. Dem damaligen Zeitgeist in Europa und den VereinigtenStaaten entsprach es, den chinesischen Ahnenkult mit den Werten des‚aufgeklärten‘ Christentums für unvereinbar zu erklären.40
Auf der von May geschilderten Weiterreise nach Ceylon tritt einweiterer Chinese auf, der der Beamtenelite entstammt. Hier folgen eini-ge aufschlussreiche Bemerkungen zur Beamtentradition und zu demhohen sozialen Status von Gelehrten im Reich der Mitte.41 Diese strenghierarchisierte Gesellschaft war jedoch zur Entstehungszeit von Et interra pax erheblichen Veränderungen bzw. Umwälzungen unterworfen,von denen im Roman keine Rede ist. Der Einbruch der europäischen
Mächte in China hatte seit Mitte des 19. Jahrhunderts zu einem fort-schreitenden Öffnungsprozess geführt. Mit dem Aufkommen einer (imwestlichen Sinn) modernen Presse entstand eine öffentliche Meinungim Reich der Mitte; Information und Bildung waren nicht mehr Privilegeiner Beamten- und Gelehrtenelite.42
Fang, der chinesische Beamte und Gelehrte, führt eine Konversationüber die Friedfertigkeit der chinesischen Nation und ihre Fähigkeit, an-dere Völker zu assimilieren.43 Tatsächlich verbindet sich mit China derMythos einer friedliebenden Zivilisation, die die Harmonie zum Prinzipder außenpolitischen Beziehungen machte. Im Vordergrund stand nicht
28/3/2014 Das Chinabild bei Karl May | Eva M. Stolberg - Academia.edu
http://www.academia.edu/2906177/Das_Chinabild_bei_Karl_May 10/26
28/3/2014 Das Chinabild bei Karl May | Eva M. Stolberg - Academia.edu
http://www.academia.edu/2906177/Das_Chinabild_bei_Karl_May 11/26
28/3/2014 Das Chinabild bei Karl May | Eva M. Stolberg - Academia.edu
http://www.academia.edu/2906177/Das_Chinabild_bei_Karl_May 12/26
28/3/2014 Das Chinabild bei Karl May | Eva M. Stolberg - Academia.edu
http://www.academia.edu/2906177/Das_Chinabild_bei_Karl_May 13/26
28/3/2014 Das Chinabild bei Karl May | Eva M. Stolberg - Academia.edu
http://www.academia.edu/2906177/Das_Chinabild_bei_Karl_May 14/26
28/3/2014 Das Chinabild bei Karl May | Eva M. Stolberg - Academia.edu
http://www.academia.edu/2906177/Das_Chinabild_bei_Karl_May 15/26
28/3/2014 Das Chinabild bei Karl May | Eva M. Stolberg - Academia.edu
http://www.academia.edu/2906177/Das_Chinabild_bei_Karl_May 16/26
28/3/2014 Das Chinabild bei Karl May | Eva M. Stolberg - Academia.edu
http://www.academia.edu/2906177/Das_Chinabild_bei_Karl_May 17/26
28/3/2014 Das Chinabild bei Karl May | Eva M. Stolberg - Academia.edu
http://www.academia.edu/2906177/Das_Chinabild_bei_Karl_May 18/26
28/3/2014 Das Chinabild bei Karl May | Eva M. Stolberg - Academia.edu
http://www.academia.edu/2906177/Das_Chinabild_bei_Karl_May 19/26
28/3/2014 Das Chinabild bei Karl May | Eva M. Stolberg - Academia.edu
http://www.academia.edu/2906177/Das_Chinabild_bei_Karl_May 20/26
28/3/2014 Das Chinabild bei Karl May | Eva M. Stolberg - Academia.edu
http://www.academia.edu/2906177/Das_Chinabild_bei_Karl_May 21/26
28/3/2014 Das Chinabild bei Karl May | Eva M. Stolberg - Academia.edu
http://www.academia.edu/2906177/Das_Chinabild_bei_Karl_May 22/26
28/3/2014 Das Chinabild bei Karl May | Eva M. Stolberg - Academia.edu
http://www.academia.edu/2906177/Das_Chinabild_bei_Karl_May 23/26
28/3/2014 Das Chinabild bei Karl May | Eva M. Stolberg - Academia.edu
http://www.academia.edu/2906177/Das_Chinabild_bei_Karl_May 24/26
28/3/2014 Das Chinabild bei Karl May | Eva M. Stolberg - Academia.edu
http://www.academia.edu/2906177/Das_Chinabild_bei_Karl_May 25/26
28/3/2014 Das Chinabild bei Karl May | Eva M. Stolberg - Academia.edu
http://www.academia.edu/2906177/Das_Chinabild_bei_Karl_May 26/26
Job Board About Mission Press Blog Stories We're hiring engineers! FAQ Terms Privacy Copyright Send us Feedback
Academia © 2014