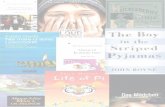Alteration of Wetlands - Institut für Geographie und Geologie
Thomas Dörfler/Eberhard Rothfuß - Raumbezogene Qualitative Sozialforschung. Konzeptionelle...
-
Upload
uni-bayreuth -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of Thomas Dörfler/Eberhard Rothfuß - Raumbezogene Qualitative Sozialforschung. Konzeptionelle...
Inhalt
Eberhard Rothfuß & Thomas Dörfler
Prolog – Raumbezogene Qualitative Sozialforschung. Konzeptionelle Überlegungen zwischen Geographie und Soziologie ………………………... 7�
Thomas Dörfler�Milieu und Raum – Zur relationalen Konzeptionalisierung eines sozio-räumlichen Zusammenhangs ………………………………………… 33�
Anne Vogelpohl
Qualitativ vergleichen – Zur komparativen Methodologie in Bezug auf räumliche Prozesse …………………………………………………………. 61�
Peter Dirksmeier�Zur Methodologie und Performativität qualitativer visueller Methoden – Die Beispiele der Autofotografie und reflexiven Fotografie ……………..... 83�
Thorsten Fehlberg�(Re)Produktion von rechtsextrem dominierten „Angsträumen“ …………… 103�
Leila Mousa�(Re)Produktion und (Re)Präsentation der Lebenswelt „Flüchtlingslager“ – Die Rolle von Film, Bild und interaktiven Forschungsansätzen ……………………………………………………….. 123�
Thomas Uhlendahl�Untersuchung von Beteiligungsprozessen in der Raum- und Umweltplanung – Ein methodischer Beitrag am Beispiel des Gewässermanagements …………………………………………………… 147�
6 Inhalt
Heidi Kaspar�Raumkonstruktionen aus Erzählungen rekonstruieren. Reflexionen aus einem Forschungsprojekt zur Untersuchung von „Park-Räumen“ …… 175�
Eberhard Rothfuß�Eine leibphänomenologische Reflexion über eine nomadische Raumkonzeption …………………………………………………………... 201�
Eva Kammann�Gender und Raum: Qualitative Zugänge zu Demütigung, sozialer Praxis und ungleichem Alltag in Guatemala …………………….. 221�
Thomas Dörfler�Die Praxis der relationalen Milieuforschung ……………………………... 245�
Ulrike Gerhard & Astrid Seckelmann�Kopf oder Zahl? Vermittlung qualitativer Methoden in der humangeographischen Hochschullehre …………………………………… 267�
Ulli Vilsmaier�Epilog – Und wo sind wir? Reflexionen auf den Ort der/des Forschenden in der raumbezogenen qualitativen Sozialforschung ……….. 287
Verzeichnis der AutorInnen ………………………………………………… 309
Prolog – Raumbezogene Qualitative Sozialforschung. Konzeptionelle Überlegungen zwischen Geographie und Soziologie
Eberhard Rothfuß & Thomas Dörfler
1 Einleitung
Einführend zum vorliegenden Band scheint es uns angeraten, die Frage aufzu-werfen, warum Qualitative Sozialforschung raumbezogen thematisiert werden soll. Oder, anders formuliert, warum diese semantische Verschiebung auf ein Feld erfolgt, das eine räumliche Epistemologie nicht im Zentrum seines Interesses hat? Wir möchten also klären, warum die Ausweitung des Blickes auf den Raum interessant erscheint, wo dieser doch – bis auf Ausnahmen – kaum als genuiner sozialwissenschaftlicher Gegenstand behandelt wurde? Damit stellt sich die Frage, ob es überhaupt möglich ist, räumliche Fragen von Vergesell-schaftung in Hinblick auf einen eigenständigen Erkenntnisweg, gar einer eigenen Methodologie zu reflektieren. Diese Überlegungen stehen im Zentrum des vorliegenden Beitrages und bedürfen näherer Erörterung.
Um diesen Fragen nachzugehen, ist an die Aussage eines aktuellen Methodenbuches zu erinnern, das aus geographischer Perspektive der sich in den letzten Jahren vollziehenden Verschiebung des epistemologischen Feldes der Sozialwissenschaften eine bemerkenswerte Note verleiht, die aus unserer Sicht zu diskutieren ist:
„The early twenty-first century marks a marvelous time for qualitative ge-ography. In concert with what some have called a ‘quiet methodological revolu-tion‘ across the social and policy sciences as well the humanities (Denzin and Lincoln 2005: IX), geography is fostering an efflorescence in the prevalence and sophistication of qualitative research“ (DeLyser et al. 2010: 1)
Was sich hier in der Einleitung von „Qualitative Geography“ als euphorische und metaphernreiche Anerkennung eines angenommenen, über Disziplingrenzen hinausgehenden status quo der qualitativen Methodik in der Humangeographie ankündigt, hat einen langen Diskussionsprozess hinter sich. Dieses Zitat sieht als gegeben an, was andernorts noch nicht Konsens der methodologischen Debatte ist, dass nämlich raumbezogene Sozialwissen-schaften (wie die Humangeographie) zu dieser ‚Blüte‘ und Erscheinungs-dominanz eine fruchtbare ‚Bestäubung‘ beitragen kann, um im metaphern-
8 Eberhard Rothfuß & Thomas Dörfler
gesättigten Bild des Zitats zu bleiben. Denn weder ist es so, dass diese Aussage selbstverständlich, noch der Zeitpunkt ihres Erscheinens zufällig ist. Sie impliziert einen methodologischen Paradigmenwechsel von den quantitativen Verfahren zu den qualitativen Methodologien, der sich die letzten 30 Jahre vollzogen hat, für den die Humangeographie aber bislang weder bekannt, noch als besonders prädestiniert zu bezeichnen wäre. Diese hat sich zwar an die Standards in sozial- und kulturwissenschaftlichen Nachbardisziplinen ange-glichen und trägt, so die Behauptung im Zitat, eigenständig dazu bei, jene auch weiterzuentwickeln (vgl. auch Blunt et al. 2003; Cloke et al. 2004; Crang 2002, 2003), aber solch eine nicht ganz unproblematische Ausdeutung muss im Weiteren angesichts ihrer Konsequenzen wie auch ihrer Begründung etwas näher erörtert werden.
Es ist aus unserer Sicht keineswegs so, dass die Humangeographie problemlos einen eigenständigen Beitrag zu ihnen zu leisten imstande wäre, denn allein die Wahl der Methoden garantiert dies nicht; es bedürfte dazu eines eigenständigen Epistems im Sinne Bachelards, d.h. einer disziplintypischen Denkweise und Thematisierung von Phänomenen, die eine eigene „Erkenntnis-art“ dieses Fachs gewährleisten würde – und zwar als Bruch mit dem Bestehen-den (Bachelard 1987 [1938]: 51, 54 ff.; Canguilhem 1979 [1963]: 10 ff.).
Eine solche paradigmenhafte Etablierung sehen wir allerdings kaum als gesichert in diesem Feld an, weswegen wir uns entschieden haben, mit einem eigenen Band zumindest darauf eine bescheidene Antwort geben zu können, welcher Typus von Forschung und Methodologie derzeit raumorientierte Empirie prägt bzw. diese in Zukunft prägen könnte. Notgedrungen können wir dabei nicht nur bei der geographischen Forschung verweilen, sondern möchten diese einbinden und im Hinblick auf die allgemeine sozialwissenschaftliche Methodendiskussion kritisch würdigen.
Die enthusiastischen Zeilen aus der Einführung von DeLyser et al. (2010) spiegeln deshalb nicht gänzlich die Wirklichkeit in der deutschsprachigen Humangeographie und verwandter sozialwissenschaftlicher Disziplinen in Bezug auf einen unterstellten methodologischen Paradigmenwandel wieder. Aber sie deuten auf eine veränderte Bedeutung qualitativer Sozialforschung innerhalb der raumorientierten Wissenschaften hin. Diese sind, von ihrem disziplingeschichtlichen Erkenntnisinteresse her, kaum an idiographischen Methodologien interessiert gewesen und konnten es, streng genommen, epistemologisch auch nicht sein, denn Raum, das war die Kategorie jenseits des Subjekts: Raum war anwesend, absolut, ermöglichend und „aufhebend“ im Hegelschen Sinne (Hegel 1998 [1832/1845]:140). Genaugenommen stand er sogar jenseits der Zeit und der Historie, denn er soll eine Naturgeschichte gehabt haben. Diese harrte ihrer Entdeckung, bis einige EuropäerInnen sich den
Prolog – Raumbezogene Qualitative Sozialforschung 9
Anspruch gaben, die Formenwelt der Erde zu verstehen. Dies war die Geburts-stunde der neuzeitlichen Geographie. Der Raum sollte in seinem natürlichen Werden und in seiner kulturellen Überprägung erforscht werden, Landschafts-typen als naturräumliche Ordnungsgestalten begriffen werden. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde dieser Romantizismus verwissenschaftlicht, und die Landschaftskunde von der Raumwissenschaft abgelöst. Deren Selbst-verständnis als ‚harte‘, quasi-naturwissenschaftliche Disziplin, wie sie Bartels (1968) zu konzeptionalisieren versuchte, hielt bis in die 1980er Jahre hinein, als dieser Anspruch fragwürdig wurde und man begann – als Bruch mit dem Beste-henden – Raum als ‚Menschenwerk‘ aufzufassen.
Durch Benno Werlens frühe Arbeiten (z.B. Werlen 1987), die man durch-aus als ‚Kopernikanische Wende in der Humangeographie‘ bezeichnen könnte, verschiebt sich Raum in das Möglichkeitsspektrum des Subjekts und rückt als „gemachter“ oder „produzierter“ in den Kreis der sozial konstituierten Phäno-mene der (sozialen) Welt ein. Einen wichtigen Schritt auf diesem Weg stellte vorher Ulrich Eisels Dissertation dar, worin er dieses Grundsatzprogramm ausformulierte und disziplinhistorisch herleitete (Eisel 1980). Da-durch wurde auch der Fokus der Methoden allmählich verschoben, und er ging nach und nach weg von den statistischen, raumwissenschaftlichen Zugängen hin zu den qualitativen, subjektbezogenen Methodologien.
So besehen hat die Tatsache, dass DeLyser et al. (2010) die eingangs er-wähnte Feststellung überhaupt artikulieren kann, eine Vorgeschichte und ist nicht als selbstverständlich anzusehen, weshalb ein kleiner Rückblick vonnöten ist, wie schwer sich bislang das raumwissenschaftliche Denken mit den sozial-wissenschaftlichen Methodologien (Geographie, Soziologie, Planung u.a.) tat.
2 Frühe Verschiebungen des Feldes
Einige als Pionierarbeiten zu bezeichnende Monographien und Sammel-bände bildeten den Anfang dieses Wandels innerhalb der Humangeographie hin zu einer qualitativen Methodologie (Pohl 1986; 1996; Birkenhauer 1987; Sedlazek 1989; Kanwischer und Rhode-Jüchtern 2002; Pott 2002), denen vereinzelte Publikationen und Studien nachfolgten, ohne dabei aber ein eigenständiges Forschungsparadigma etablieren zu können. Diese Beiträge blieben Solitäre, die weder Schulen noch Nachfolger ausbildeten, die in diesem Sinne prägend einen methodologischen Wandel herbeigeführt hätten. Dennoch waren dies mehr als erste Gehversuche, denn sie bemühten sich um das, was hier eingangs als notwendiger epistemologisch-methodologischer Wandel oder Bruch bezeichnet wurde, dessen Auswirkungen aber noch aufzuzeigen sind: einen eigenständigen
10 Eberhard Rothfuß & Thomas Dörfler
raumorientierten Zugang zu sozialen Phänomenen zu etablieren, der jenseits traditioneller Methoden angelegt war. Es blieben dies aber Einzelversuche, vielleicht, weil sie zu früh erfolgten, vielleicht, weil die Debatte noch zu sehr um grundsätzliche Fragen stritt, als dass man sich schon tiefgreifenden methodologischen Aspekten hätte zuwenden können (vgl. die teils sehr kontroverse Debatte um Benno Werlens neue handlungszentrierte Sozial-geographie zu jener Zeit, dem ‚Alleszertrümmerer‘ der geographischen Raum-wissenschaft; vgl. hierzu etwa Blotevogel 1999).
In jüngster Zeit scheint sich hingegen eine Verstetigung der Entwicklung durch Lehr- und Einführungsbücher zur methodologischen Reflexion in der Humangeographie anzudeuten (Reuber und Pfaffenbach 2005, Meier Kruker und Rauh 2005; Pfaffenbach 2011), weil sich die Hinweise verdichten, dass jene Schlachten der 1980er und 1990er Jahre geschlagen sein könnten.
Es kann deshalb vielleicht mit einem gewissen Recht behauptet werden, dass die Prämissen der sozialwissenschaftlichen Forschungsstandards mittler-weile in den Kanon humangeographischer Methoden integriert wurden. Dies ist, gemessen an den zwar bewährten, aber wenig ausdifferenzierten Arbeitsweisen des Fachs bis in die 1990er Jahre hinein, durchweg als Fortschritt zu bewerten. So erfreulich diese Übernahme qualitativer Forschungsmethoden aber ist, so unreflektiert blieb bislang ein eigenständiger Beitrag und Erkenntnisbezug zum Thema raumbezogene Sozialforschung auch und gerade in den Nachbar-disziplinen, der diese humangeographische Erfahrung mit einbezogen hätte. Denn der Vorteil der Humangeographie gegenüber der Soziologie liegt beispielsweise darin, dass es hier – anders als dort – zumindest zu einer Debatte über den problematischen Zugang zum Räumlichen kam, während sich der Rest der Sozialwissenschaften kritischen raummethodologischen Fragen zu ver-schließen scheint, und die diskursiven Implikationen des spatial turn quasi-affirmativ aufzunehmen im Begriff ist.
3 Die Verdichtung der Symptome
In den letzten Jahren sind also auch in der deutschsprachigen Geographie vermehrt Arbeiten veröffentlicht worden, die sich dezidiert dem Paradigma der qualitativen Sozialforschung verschrieben haben (vgl. etwa Struck 2000; Rothfuß 2004; Dirksmeier 2007; Deffner 2010; Dörfler 2010; u.a.). Sie tragen zu diesem Feld quasi selbstverständlich bei, wie sie ebenso frühere ‚naive‘ Zugänge eines unreflektierten „just-do-it“-Ansatzes (DeLyser et al. 2010: 2) zur qualitativen Epistemologie hinter sich zu lassen anstreben. Sie knüpfen damit aber auch an die Traditionslinie der phänomenologisch-hermeneutischen Philo-
Prolog – Raumbezogene Qualitative Sozialforschung 11
sophie und Soziologie an, wenn sie sich nun – anders als früher – zumindest in Teilen den schwierigen Problemen der Auswertung, Darstellung und Einarbei-tung qualitativer – und damit sinndeutender und rekonstruktiver – Inter-pretationen widmen, und bloßes ‚Belegen durch Zitieren‘ von Interview-passagen vermeiden, wie dies oft der missverstandene ‚qualitative‘ Fall war und ist.
Wir möchten diese Arbeiten in der Humangeographie deshalb einem neuen Feld der methodologischen Ausdifferenzierung sozialwissenschaftlicher Metho-dik zurechnen, nämlich den raumorientierten Sozialwissenschaften. Als solche charakterisieren wir hier alle Ansätze in den Humanwissenschaften (Soziologie, Humangeographie, Ethnologie, Geschichte u.a.), die sich in ihren Gegenstands-perspektivierungen und Erklärungsweisen auf räumliche Aspekte sozialer Interaktionen und Prozessformen konzentrieren.
4 Wie es dazu kam
Die Intention, Beiträge zur qualitativen Sozialforschung unter dem räumlichen Präfix zu versammeln, hat sich bei den Herausgebern in den letzten Jahren manifestiert, als die eigene Befassung mit dem sogenannten spatial turn ab etwa Mitte des letzten Jahrzehnts wirkmächtig sozialwissenschaftliche Debatten zu beeinflussen begann. Diese Neuthematisierung des Räumlichen, bei der einige GeographInnen auch und gerade dieses ‚Neue‘ in Zweifel zogen (Lippuner und Lossau 2004b; Schlottmann 2005; Hard 2008; Redepenning 2008; u.a.), zeigte sich in verwandten Sozialwissenschaften zumindest als eine Änderung der Se-mantik an, als verstärkt Arbeiten mit ‚räumlichen‘ Titeln oder ebensolchem kon-zeptionellen Bezug erschienen (zusammenfassend: Bachmann-Medick 2006 im Kapitel „spatial turn“). In der innergeographischen Fachdebatte haben diese Ini-tiativen in den Nachbardisziplinen aufgrund der hier vorherrschenden Skepsis dem Räumlichen gegenüber nicht zu einer vergleichbaren Anschlusskommuni-kation geführt. Die Humangeographie steht heute, paradox genug, als einzige Sozialwissenschaft diesem neuen Rauminteresse eher ablehnend gegenüber, weil der Streit um den ontologischen Status des Raumes das Facherbe so verun-sichert und in existentielle Debatten getrieben hat, dass sie bis heute nachwirken.
Dabei könnte, so wird erwartet, die Humangeographie als Wegbereiter eines neuen raumorientierten Forschungsparadigmas an erster Stelle stehen oder zumindest prominenter vertreten sein – versteht sie sich doch seit Mitte des 19. Jahrhunderts explizit als die Wissenschaft vom Raum. Auch zeitgenössisch verweisen etwa die Literatur- und Medienwissenschaftler Jörg Döring und Tristan Thielmann auf die Humangeographie und ‚adeln‘ das „geheime Wissen
12 Eberhard Rothfuß & Thomas Dörfler
der Geographen“, das bislang in den Kulturwissenschaften und auch der Soziologie weitgehend unentdeckt geblieben sei (Döring & Thielmann 2008: 7f.).
Wären aber nicht in der Disziplingeschichte der Geographie zweifelhafte Versuche unternommen worden, „Gesellschaft“ und „Raum“ zusammenzuden-ken, die bis heute zu ebenjener Skepsis raumlogisch erklärender sozialwissen-schaftlicher Erkenntnis gegenüber führen, könnte die Humangeographie viel-leicht tatsächlich einen entscheidenden Beitrag zur aktuellen Methodendis-kussion leisten. Aber der, wenn auch folgenschwerste, disziplingeschichtliche Fehler war es, zu einer bestimmten Zeit mit einem spezifischen Epistem beide Begriffe substanzlogisch zusammenzudenken und ersteres als „Volk“, letzteres als „Natur/Erde/Boden“ zu verstehen (oder als „Territorium“ und „Nation“).
Dieses raumessentialistische Selbstverständnis der Geographie ist aber seit langem brüchig geworden und massiv in die Kritik geraten, Teile jener „Raumwissenschaft“ oder der „Länderkunde“ dabei als obsolet verabschiedet worden. Während sich die Humangeographie also frühzeitig kritisch mit essentialistischen und reifizierenden Konzeptionalisierungen von Raum (etwa als ‚Container‘) auseinanderzusetzen begann, entstanden im letzten Jahrzehnt in verwandten Sozialwissenschaften viele Publikationen, die sich eines in der Eigenwahrnehmung verdrängten Teils sozialer Realität und ihrer Analyse durchaus essentialisierend annahm – nachdem die Humangeographie eine sol-che Raumfixierung mit einschlägigen Kritiken überzog, von denen einige hier vorzustellen sind.
Es kann daher als gewisses Paradox betrachten werden, dass in nahe-gelegenen Disziplinen in den letzten Jahren vermehrt Raum ontologisch in den Fokus des Interesses geriet, wo dieser Anspruch in der Humangeographie so-wohl von der handlungszentrierten Sozialgeographie Werlens, als auch von der ‚Neuen Kulturgeographie‘ (vgl. Gebhardt, Reuber & Wolkersorfer 2003) bereits – und vielleicht zu früh? – recht weitgehend zu Grabe getragen wurde (Döring & Thielmann 2008: 8).
Bis zum heutigen Tag bestätigt die Kritische Geographie diese Abneigung gegen die Vorstellung, Raum zur Erklärung sozialer Zusammenhänge – und sei es relational – heranzuziehen (vgl. Belina & Michel 2007). Diese Ablehnung ist aus unserer Sicht auch der Grund dafür, dass die zeitgleich einsetzende Renaissance qualitativer Methoden in diesem Fach explizit nicht auf räumliche Erkenntnisinteressen abzielte, wo sie unter Umständen und aufgrund ihrer Tradition (kritische) Perspektiven hätte einbringen können. Als Folge davon, so unsere These, verlief die Aneignung qualitativer Methoden bislang weitgehend apperzeptiv und wenig von eigenen (raumwissenschaftlichen) Impulsen geprägt.
Prolog – Raumbezogene Qualitative Sozialforschung 13
5 Die Folgen der Zumutungen
Mit der ‚Ausrufung‘ des spatial turn in verwandten Disziplinen begann sich auch eine allgemeine Reflexion auf den – eigentlich genuin geographischen – Forschungsgegenstand Raum bemerkbar zu machen (vgl. Günzel 2007; Döring und Thielmann 2008 u.a.), wenngleich von anderen Disziplinen ausgehend und notgedrungen mittels anderer Forschungsfragen. Diese neue Raumsemantik zieht sich durch nahezu alle Fächer, die sich in ihren Beiträgen an Neukon-zeptionalisierungen im Zuge des spatial turn versuchten, so in der Ethnologie (Low 2003; Gupta und Ferguson 2008), der Soziologie (Löw 2001; Schröer 2006), der Literaturwissenschaft (Dünne, Friedrich & Kramer 2009; Stock-hammer 2007; Böhme 2005) der Geschichtswissenschaft (Schlögel 2003, Gott-hard 2005) oder der Philosophie (Günzel 2006), um nur die populärsten zu nennen.
Bemerkenswerterweise kam es dabei zu einer dialektischen Asynchronität: Während insbesondere die deutschsprachige Soziologie ihr verschüttetes und nicht ganz unproblematisches Erbe Raum wiederzuentdecken glaubte (Löw 2001; Löw, Steets & Stötzer 2007; einen Kontrapunkt zu dieser Auffassung setzt Schroer 2007: 36), kam es, wie erwähnt, in der Anthropogeographie zu einer expliziten Absetzbewegung vom Rauminteresse. Während dort die Rück-kehr zum Raum nahezu gefeiert wurde und der spatial turn sogar in Einführungsbänden Einzug hielt (wiederum Bachmann-Medick 2009), setzte in der Humangeographie eine wiederholte Kritik an einem ‚Gespenst‘ an, das nicht vergehen will. Unfreiwillig schlug man dabei Schlachten, die man längst gewonnen glaubte und die die Disziplin bereits hinreichend prägten (z.B. Meus-burger 1999). Die Humangeographie und speziell die sogenannte ‚Neue Kulturgeographie‘ wähnte im spatial turn einen konservativen backlash im Gange, der vorgab, dort anzukommen, wovon man sich bereits vor drei Jahr-zehnten zu emanzipieren begonnen hatte: der Frage danach, ob Raum überhaupt eine erkenntnisleitende Kategorie sozialwissenschaftlicher Forschung darstellen kann. In der humangeographischen Debatte wurde und wird dies klar verneint, prononcierte Absagen an räumliche Epistemologie sind an prominenter Stelle vertreten (Werlen 1995, Hard 2008) und immer wieder aktualisiert worden. Döring & Thielmann (2008: 36) bestätigen hinsichtlich dieser fachbezogenen Absetzbewegung überaus trefflich:
„Vor dem Hintergrund der eigenen geographischen Fachgeschichte, in der die Ausdifferenzierung der Humangeographie zur Sozialgeographie als strikte Sozialwissenschaft gegen starke innerfachliche Widerstände historisch erst erkämpft werden musste, entsteht der Eindruck, die Sozialgeographen verübelten heute den Soziologen, gerade jene Lektion zu verraten, die sie selber
14 Eberhard Rothfuß & Thomas Dörfler
so spät gelernt und durchgesetzt hatten – zugespitzt gesagt: Konvertiten sind besonders strenggläubig“.
So ist insbesondere bei systemtheoretisch verfahrenden Humangeo-graphInnen beim Interesse am Raum eher nur ein Hinweis auf die Semantiken des Räumlichen zu entlocken, die es als einzige verbliebene Möglichkeit gesell-schaftlicher Raumbezüge – als Kommunikationsleistung über Raum – zu analy-sieren gäbe. Raum selbst (als irgendwie materiell oder physisch organisiertes Phänomen) kann und muss aus dieser Perspektive unbestimmbar und im systemtheoretischen Sinne uninteressant bleiben, weil es für die Frage anschlussfähiger Kommunikation für die Binnendifferenzierung sozialer Systeme irrelevant ist, ob es ihn, den Raum, tatsächlich gibt, wie es für Niklas Luhmann auch gleichgültig war, ob es sie, die Gesellschaft, gibt (vgl. hier auch die einschlägigen systemtheoretischen Arbeiten in der Geographie von Redepenning 2006; Egner 2008; Pott 2007; Egner, Ratter & Dikau 2008; Lippuner 2011 u.a.). Es zählt einzig, was über Raum (durch die Gesellschaft) kommuniziert wird. Die systemtheoretische Kritik aus der Geographie zielt deshalb noch stärker als Benno Werlens frühzeitig lancierte handlungs-theoretische Wende auf die Absage jeglicher physisch-materieller Gegenständ-lichkeit (auch als nachträgliche „Plazierungsleistung“ wie bei Löw 2001) als notwendige Grundlage für eine moderne, reflektierte Fachdisziplin ab (Lippuner 2008). Sie geht damit einen Schritt weiter als Werlens handlungsorientierte Sozialgeographie, die zwar betont, Raum vom Gesellschaftlichen her zu denken (wie er „gemacht“ wird) und weniger von konkreten physisch-materiellen Lokalitäten aus. Geprägt ist der Raum bei Werlen aber (und sei es imaginär) durch Handlungsentwürfe, die ihn auch als solchen erst etablieren. Raum wird zur Folge von Handlungen, die Werlen (1995) aus der Kombination der Schütz-schen Motivphänomenologie und den Geltungsbedingungen der Habermasschen Kommunikationstheorie ableitet. Davon nimmt die Systemtheorie wiederum explizit Abstand, da sie aus den genannten Gründen weder Motive noch Geltungsgründe benötigt, um operable Anschlusskommunikation zum Raum im Subsystem Wissenschaft beobachten zu können. Aus Sicht der Systemtheo-retikerInnen reicht Semantik als Gegenstand der Analyse quasi aus, womit selbstverständlich auch eine mehr oder weniger versteckte Kritik an angeblich essentialisierenden Vorstellungen vom Raum verbunden ist: Raum müsse für die raumerklärenden Wissenschaften immer etwas sein, wohingegen die Semantik des Raumes nicht Nichts ist, um einen philosophischen Gedanken von Gerhard Gamm zu zitieren (Gamm 2000: 7), aber doch Etwas, nämlich Kommunikation über Raum. Die in der deutschsprachigen Humangeographie gepflegte Systemtheorie will sich damit von der Vorstellung verabschieden, dass man zum Raum nur etwas Substanzielles beitragen könne, wenn man sich
Prolog – Raumbezogene Qualitative Sozialforschung 15
konkreten Auswirkungen räumlicher Praxis widme. Für sie ist es bereits hinreichend, auf die Raumsemantiken (wovon die hier an dieser Stelle gepflegte nur eine ist) hinzuweisen, also auf die Selbstthematisierung, die sich eine Gesellschaft (oder Teile von ihr) in Bezug auf Raum gibt. Die Diskussion über das Für und Wider des spatial turn ist nur ein spezifischer Teil dieser Möglichkeiten, und dies gilt ebenso reflexiv für die Systemtheorie.
Dies war und ist allem Anschein nach aber nicht immer die Phantasma-gorie der derzeitigen sozialwissenschaftlichen Forschung zum Thema Raum. Vielmehr begegnen wir dort oftmals der eigentlich obsolet gewordenen Semantik re-essentialisierender Raumbezüge, die man aus Sicht der human-geographischen Debatte zudem für überwunden hielt. Im spatial turn glauben einige augenscheinlich an „die Rückkehr auf gesichertes Terrain“1 zu etwas Konkretem, das handfest untersucht werden kann nach all den Verun-sicherungen durch flüchtige Diskurse und brüchige Konstruktionen, die seltsam abstrakt das Wissenschaftsgeschehen bestimmten.
Es sei an dieser Stelle auch knapp auf die fachspezifische ‚poststruktural-istische Bewegung‘ der Diskursforschung in der Humangeographie hingewiesen (vgl. Reuber & Mattissek 2004; Glasze & Mattissek 2009, Mattisek 2010, u.a.). Diese zeitgenössische Strömung nähert sich dem Räumlichen durch die Untersuchung von Diskurskonstruktionen und weist daher auf die Gemachtheit oder Performanz von „Geographien“ als Medien- oder Sprachphänomene hin. Diese Perspektivierung strebt für die Humangeographie eine gewisse Erweiter-ung des Methodenkanons an (vgl. Glasze, Husseini und Mose 2009), stellt aber (theorieimmanent) erkenntnis- und forschungslogisch nicht das Subjekt, sondern den Diskurs in das Zentrum der Betrachtung. Diese Setzung ist einschlägig und nicht ganz unproblematisch, bedeutet jedoch für eine räumlich orientierte qualitative Sozialforschung eine tendenzielle Unvereinbarkeit, da diese das Subjekt/das Subjektive und dessen Praktiken als zentrale Instanz der Raumproduktion ansehen muss. Die Untersuchung von alltäglichen Praktiken, unbenommen einer Vermittlung durch etwaige Diskursivitäten oder inkorporier-ten (Macht-)Strukturen wie dem Habitus (Bourdieu), dennoch aber immer noch getätigt von Subjekten, nennt Michel de Certeau deshalb eine „gewaltige ‚Exteritorialität‘“ des ‚Noch-nicht-Diskursiven‘ oder ‚Per-se-nicht Diskursivier-baren‘ und bringt damit diese implizite Konfrontationsstellung zwischen Praxis und Diskurs auf den Punkt (De Certeau 1988: 131).
Zudem gibt es in anti-poststrukturalistischer Ausdeutung eine funda-mentale und diskursiv unverfügbare Lagerung unserer Subjektivität, der Medien oder des Symbolischen, was in Lacanscher Diktion das Reale unserer Subjekti-
1 http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/termine/id= 5229 (28.01.2012)
16 Eberhard Rothfuß & Thomas Dörfler
vität darstellt (vgl. Lacan 1978; 1991; Žižek 2006: 17 ff.): die notwendige Eta-blierung jedweden subjektiven Weltzugangs anhand etwas Unverfügbarem und Unvereinnehmbarem durch ein Außen, weil es einem Außen/Anderen im Pro-zess der Subjektwerdung abgerungen wurde (vgl. abermals Hegel 1998 [1807]: 36), indem es sich seiner Symbolisierung – oder Althusserianisch ausge-drückt: „Anrufung“ – dialektisch widersetzen musste, um überhaupt Subjekt zu werden. „Dies ist die fundamentale Lagerung unserer Subjektivität, sie muss alle unsere (inbesondere unbewussten) Praktiken begleiten können, sonst wären wir psychotisch“, da die Vorstellung einer Fremdbestimmung durch „Diskurse, Medien, Geld das Patriarchat oder sonstige Mächte zum Zusammenbruch führen“ würde (Dörfler 2011: 97). Das Subjekt wird immer Widerstand gegen Diskursivierungen ‚äußerer Mächte‘ leisten (die ‚kritische‘ Haltung der Diskurs-theoretikerInnen gegenüber den ‚diskursiven Zuschreibungen‘ z.B. geschlech-terpolitischer Art sind nur ein Indiz dafür), und sei es ‚nur‘ sublimierend-neurotisch als Zwang der Enkulturation (Freud 1929), um ‚zu überleben‘, denn im Symbolisch-Imaginären wäre das Subjekt sonst ‚tot‘ (Lacan 1978: 280; Lacan 1991: 171): Keine Alltagshandlung ist möglich vor der An-nahme, dass die Spontanität ihrer Realisierung ‚fremdbestimmt‘ sei. Freilich sagt dies noch nichts über Strukturen und Zwänge aus, die sich auch diskursiv formieren. Um diese aber im Handlungshorizont der Subjekte zu finden (und sei es als unbe-wußte Abwehr der Zuschreibungen), sollte man jene aber befragen, die durch diese Abwehr Subjekt wurden.
Ein weiteres Argument für eine subjektlogische Betrachtung legt Maurice Merleau-Ponty im Vorwort seiner „Phänomenologie der Wahrnehmung“ (1966 [1945]) vor. Er bringt die existentielle Notwendigkeit und Nähe zur eigenen leiblichen Erfahrung ins Spiel, wenn er das Verhältnis des Subjekts zur Sprache und zum Diskursiven ausleuchtet:
„Nicht also heißt das Wesen des Bewußtseins erforschen die ‚Wort-bedeutung‘ Bewußtsein auslegen und der Existenz in das Reich des bloß gesagten entfliehen, vielmehr heißt es, die wirkliche Gegenwart meiner selbst bei mir selbst, das Faktum meines Bewußtseins wiederfinden, das letztlich doch Wort und Begriff des Bewußtseins besagen wollen. Dem Wesen der Welt nachfragen heißt nicht, sie reduzieren auf den Gegenstand unserer Rede und dann sie in die Idee erheben, vielmehr heißt es darauf zurückgehen, was vor aller Thematisierung die Welt faktisch für uns schon ist“ (Merleau-Ponty 1966 [1945]: 12, Herv. i. Orig.).
Entscheidend ist aus dieser phänomenologischen Perspektive daher nicht die Diskursivität des Sozialen, denn die Begriffe sind von geringerer Bedeutung für das subjektive Verstehen der Welt, als die Erfahrung derselbigen. Unzweifelhaft beinhaltet die Erfahrung der Welt die Sprache und den Umgang
Prolog – Raumbezogene Qualitative Sozialforschung 17
mit ihr, wesentlicher jedoch ist, dass die Sprache nur ein Teil der Welterfahrung ist, sie aber keineswegs der Welt übergeordnet oder sie alleinig strukturiert, wie man im Überschwang des linguistic turn seit den 1970er Jahren annahm.
Uns scheint in der ‚poststrukturalistischen‘ Humangeographie und Sozial-wissenschaft eher eine gegenteilige Auffassung vorherrschend zu sein, denn Macht, Subjekt und Interaktion sind dort nur noch sprachlich-diskursiv ver-mittelt konzipiert. Eine solche Thematisierung des Diskursiven wird aber, wenn sie Subjektivität in einer früh-naiven Lesart von Foucault lediglich als Unter-worfenes betrachtet, tendenziell zum paradoxen akademischen Selbstzweck: Subjekte äußern willentlich über den akademischen Publikationsbetrieb, dass es keine Subjekte mehr gäbe.
Ziel des vorliegenden Bandes ist es deswegen auch, die nicht-diskursivier-bare, praxeologische Seite gesellschaftlicher Handlungszusammenhänge wieder stärker in den Mittelpunkt zu rücken (vgl. hier auch Everts, Lahr-Kurten und Watson 2011). Durch eine gewisse Verschiebung auf das Nicht-Sprachliche, die Körper- und Leibaspekte von Intersubjektivität und auf habituelles, nicht lediglich diskursiv vorgeprägtes soziale Handeln (Doxa) wird die Auf-merksamkeit auf die praxisrelevante soziale Vermittlung auch räumlich-materieller Arrangements gelenkt.
Das bedeutet nicht, dass Sprache und Diskurse von einem solchen Zugang ausgeschlossen wären, aber es geht um die einfache Tatsache, dass jeder Diskurs erst subjektiv (körperlich, habituell) inkorporiert werden muss, um wirkmächtig zu werden, worüber im ‚Poststrukturalismus‘ keine Theorie, sondern nur essentialisierende Behauptungen eines solchen status quo exis-tieren. ‚Das Subjekt ist seit je her in Differenzkategorien organisiert‘ oder es habe ‚kein Zentrum mehr‘ usf. sind derartige Floskeln, die an entscheidenden Stellen zur Selbstlegitimation vereinseitigter Forschung vorgebracht werden: kein Wort wird dabei über Wahrnehmungen und Erfahrungen (auch des Räumlichen) verloren, die erst zu multiperspektivischen Identitäten und Sub-jektivitäten führen, von frühsozialisatorischen Erfahrungen der Widersprüch-lichkeit der Welt ganz zu schweigen.
Diese kurze Reflexion deutet an, dass im methodologischen Kontext raumbezogener Sozialforschung, wie sie hier perspektiviert werden soll, die diskursanalytische Einbettung eher nachgelagert erscheint, jedoch in Kombi-nation mit einer subjektzentrierten Forschungsperspektive die dialektische Bezogenheit von Diskurs und Subjekt hervorheben könnte. Hier gibt es bereits interessante Versuche der Zusammenführung von Hermeneutik und Diskurs-analyse. So versucht etwa Keller (2005) eine Verknüpfung der sozial-konstruktivistischen Wissenssoziologie von Berger und Luckmann (1970) und einer Weiterentwicklung im Programm der hermeneutischen Wissenssoziologie
18 Eberhard Rothfuß & Thomas Dörfler
mit den diskurstheoretischen Überlegungen von Foucault. Dies ermöglicht es, sowohl die Entstehung und Zirkulation gesellschaftlichen Wissens, als auch die Handlungen der Subjekte und deren Identitätskonstruktionen in den Blick zu bekommen, um dabei auch Machtdifferentiale zu reflektieren, etwa Diaz-Bone (2002; 2006), der Foucaults Diskurstheorie mit einer praxeologischen Perspek-tive von Bourdieu zu verbinden versucht.
6 Nachwirkungen der Debatte
Diese kurzen Ausführungen zur zeitgenössischen Lagerung ‚post-struktural-istischer‘ oder ‚postmoderner‘ Geographie zeigen, dass derzeit fast kein Raum-bezug mehr als Relevanzstruktur der Lebenswelt sowohl in Theoriebildung als auch in praktischer Forschung anerkannt wird, womit – so die Überzeugung der Herausgeber – oftmals das Kind mit dem Bade ausschüttet wird und man sich wichtigen Anschluss- und Erkenntnismöglichkeiten zeitgenössischer Sozial- und Kulturforschung verschließt.
An dieser Stelle soll deshalb eine kritische Korrektur und Neujustierung an derartigen Überzeugungen vorgenommen werden, weil wir denken, dass eine solche Positionierung Forschungspotential für humanwissenschaftlich angelegte Programme zum Thema Raum und deren empirischer Erforschung vergibt.
Es ist eine Intention des Bandes, beide Positionen gewissermaßen durch Praxis zu vereinen und zu zeigen, dass man a) weder essentialistisch denken muss, um sich räumlichen Fragen der Sozialität zu widmen, und wie man b) ebensowenig und quasi-automatisch zu etwas Wirklichem gelangt, wenn man sich nur (gleichwohl imaginierten) materiellen Aspekten der Lebenswelt widmet, wie dies teilweise innerhalb des Paradigmas des spatial turns geschieht.
Das zweite Unbehagen jenseits dieser Kämpfe über die Diskursdeutungs-hoheit zum Raumthema entstand aus einem weiteren Defizit, das uns nach und nach gewahr wurde: Untersucht man Arbeiten, die den Raumbezug explizit wiederentdeckt und als untersuchenswertes Forschungsthema eingeführt haben, dann fällt auf, dass die wenigsten hierzu einen eigenständigen konzeptionellen empirischen Beitrag anbieten, der eine explizite Darlegung des raumkon-stitutiven Erkenntnisprozesses beinhaltet. Es bleibt meist eigentümlich un-bestimmt (jenseits einer schnellen Einigung, dass ‚der Raum‘ wichtig sei), was und wie man sich den räumlichen Dimensionen der Sozialwelt konkret empirisch widmen sollte und vor allem methodologisch widmen könnte, ganz zu schweigen davon, dass ‚Raum‘ selbst dabei meist untheoretisiert bleibt, also nicht auf eine spezifische Raumtheorie rekurriert wird.
Prolog – Raumbezogene Qualitative Sozialforschung 19
Die Frage ist also aus unserer Sicht weiterhin offen, ob konkret gezeigt werden kann, wie Räumliches die Sozialwelt prägt, ohne in jene oben erwähnte dichotome Verengung und (Re-)Essentialisierung bzw. Verabschiedung des Raumes zu gelangen.
7 Zur Soziologie des Raumdiskurses
Aus konzeptionellen Gründen sollen deshalb hier einige Überlegungen formuliert werden, warum es zu dieser Engführung überhaupt kam und welche möglichen ‚Auswege‘ im Sinne von Anschlussmöglichkeiten für die empirische Forschung sich aus diesem spezifisch gelagerten Raumdiskurs ergeben. Dies soll die Karriere des Raumdenkens in jüngster Zeit beleuchten, nachdem es – vor allem in der deutschsprachigen Soziologie – aus durchaus wohlverdienten Gründen als substanzlogisches Denken bis weit in die 1980er Jahre hinein mehr oder weniger nicht existent war.
Den Anfang der Thematisierung sozio-räumlicher Arrangements bildete die Phänomenologie, der es in den Begriffen der Mitwelt, Umwelt und den konzentrischen Kreisen der Bekanntheit in der Lebenswelt immer auch um den (sozialen) Raum im weitesten Sinne ging, wenngleich dieser nie Gegenstand der Analysen selbst war, sondern Konsequenz phänomenologischer Erfahrung von der intersubjektiven Welt (Gurwitsch 1977, Heidegger 2006 [1927]). Einzige Ausnahme stellen die leibphänomenologischen Reflexionen von Maurice Merleau-Ponty dar, wie bereits oben angedeutet, die er in „Phänomenologie der Wahrnehmung“ (1966 [1945]: 127) entwickelt hat: „Endlich ist mein Leib für mich so wenig nur ein Fragment des Raumes, daß überhaupt kein Raum für mich wäre, hätte ich keinen Leib“.
Die Entwicklung einer spezifischen sozialwissenschaftlichen Raumtheorie blieb jedoch auch hier aus und wurde letztlich auch nicht angestrebt. Raum war die Aufschichtung der Lebenswelt in milieugebundener sozialer Umwelt und als solcher nicht eigens untersuchenswert, da er konzeptionell (allerdings als latentes Problem) aus der phänomenologisch inspirierten Biologie als Lebens-Umwelt übernommen wurde (Uexküll/Kriszat 1970 [1934]). Es überwog des-halb bis in die jüngere Zeit die Überzeugung, dass Raum für die Erklärung sozialer (Handlungs-)Zusammenhänge schlicht unerheblich sei, er also weder relevantes Kriterium der Erklärung für letzteres darstellen könne (paradig-matisch hierzu: Berger und Luckmann 1970: 29), noch eigenständig theoretisiert werden müsse. In gewissem Sinne war dies konsequent und logisch stringent: Da sich Gesellschaft nicht über Raum erklären lässt, sondern Raum nur über gesellschaftliche Praktiken herzuleiten ist („Handhabung“, also Räume poten-
20 Eberhard Rothfuß & Thomas Dörfler
tieller Reichweite bei Berger und Luckmann 1970: 39 ff.), waren alle Versuche, das Verhältnis ontologisch umzudrehen, zum Scheitern verurteilt. Den Raum seither in den Blick zu nehmen galt als überflüssig, bisweilen sogar als reaktio-när. Und in der pragmatisch-phänomenologischen Sichtweise war Raum wie erwähnt entweder Nebenprodukt oder lediglich distanzielle Notwendigkeit von Vergesellschaftung (räumliche Nähe für face-to-face-Interaktion u.ä.), aber ohne eigenen analytischen Wert.
Dennoch lassen sich seit den späten 1970er Jahren sporadische Versuche ausmachen, jenes geradezu vernichtende Diktum von Berger und Luckmann kritisch zu rejustieren (Konau 1977). Diese Arbeiten wandten sich zwar nicht explizit gegen Berger und Luckmanns Komplettabsage, begannen aber, das Paradox des Raumes als sozialwissenschaftlich vernachlässigtes, faktisch aber in den wichtigsten soziologischen Begriffen vorhandenes Latenzproblem zu thematisieren (Grenze, Territorium, Gesellschaft, Nation, Milieu, Inklusion, Exklusion etc.). Konau gelangte damit zu einer der ersten systematischen Dar-stellungen des Raumproblems in der Soziologie, die sensibel den jeweiligen sozialen Ausprägungen gegenüber eingestellt war. Auch Herlyn (1990: 9 ff.) wies in einer einschlägigen Veröffentlichung darauf hin, dass für sozial-wissenschaftliche Raumforschung nicht der physikalische Raum im Zentrum stehen könne, sondern immer nur der erlebte Raum, was aber gleichwohl wieder raumtheoretisch unreflektiert und soweit uns ersichtlich ohne Folgen für Theorie und Empirie blieben. Auch Bollnow leistete dies bereit 30 Jahre vorher in seiner Rekonstruktion des sozialen Raumbezugs (Bollnow 1963), was aber in der aktuellen Forschung zum Thema weitgehend unterbeleuchtet bleibt. Einen raumtheoretischen Entwurf mit phänomenologischer Grundstruktur legte eigentlich nur Henri Lefebvre (1974) vor, wobei dies aber gerne zugunsten seiner marxistisch-materialistischen Ausrichtung übersehen wurde. Lefebvre erfährt zwar in jüngster Zeit eine ungemeine Renaissance insbesondere in der Sozialgeographie (vgl. Schmid 2005; Horlitz & Vogelpohl 2009; Deffner 2010; Dörfler 2010; Vogelpohl 2011), wird aber dennoch als Inspirationsquelle für (qualitative) Methodologie bis heute vernachlässigt (Ausnahmen hierzu bilden Deffner 2010 und Dörfler 2011; Vogelpohl in diesem Band).
Als ein weiterer Protagonist wäre der bereits erwähnte Michel de Certeau zu nennen, der in „Die Kunst des Handelns“ (1988) ein Raumkonzept vorstellt, das sich ebenso auf Merleau-Pontys Phänomenologie der Wahrnehmung (ebd.) bezieht und zwischen Raum (espace) und Ort (lieu) unterscheidet: „Ein Ort ist (…) eine momentane Konstellation von festen Punkten. Er enthält einen Hin-weis auf eine mögliche Stabilität. (…) Der Raum ist ein Geflecht von beweg-lichen Elementen. Er ist gewissermaßen von der Gesamtheit der Bewegungen
Prolog – Raumbezogene Qualitative Sozialforschung 21
erfüllt, die sich in ihm entfalten. Er ist also ein Resultat von Aktivitäten (…)“ (De Certeau 1988: 218; vgl. Lippuner 2007: 271 ff.; Rothfuß 2012).
Die Differenzierung, die De Certeau zwischen Ort und Raum vornimmt, setzt unter handlungstheoretischer Perspektive dort ein, wo Foucaults Aus-führungen aufhören, denn während sich für De Certeau der Ort aus momentanen Konstellationen von festen Punkten zusammensetzt, die den „Lagerungen“ Foucaults gleichkommen (Foucault 1990: 36), ist sein Raum „ein Ort, mit dem man etwas macht“ (De Certeau 1988: 220). Er entsteht durch Handlungen und in der Behandlung, z. B. durch die Tätigkeit des Gehens und Begehens erhält dieser Prozess der Alltagspraxis gestalterisches, umwidmendes und kreatives Potential.
Diese ersten Raumzugänge verschwanden aber bald wieder von der diskursiven Oberfläche, da in den 1980er und 1990er Jahren ein anderes Paradigma die Soziologie beherrschte: die Zeit. Dieser Diskurs hat sich bereits seit den 1970er Jahren als dominierendes Analyseprinzip herausgebildet, als nach den strukturfunktionalistischen und heute als ‚positivistisch‘ geltenden Zugängen zu Gesellschaft die Entstehung sozialer Formen – und damit ihre Zeitlichkeit – in den Mittelpunkt rückte, und epistemologisch ein Wandel hin zu Fragen der Genesis sich vollzog. In der französischen Annales-Schule mit ihrem Blick auf die longue durée sozialer Konfigurationen stand dieses Denken sogar bereits länger im Mittelpunkt der Untersuchung des Sozialen, in Deutschland wurden diese Zugänge erst seit den 1970er Jahren populär.
Kontrafaktisch dazu standen aber die erwähnten ersten Thematisierungen des Raumes, die zunächst nicht weiter verfolgt wurden. Als nach dem Ende des Ost-West-Gegensatzes, der selber wie ein Manifest der Dauer erschien, die geänderte Räumlichkeit von Europäisierung und Globalisierung in den Blick geriet, änderte sich die Lage fundamental. Es war zwar noch ein weiter Weg hin zu den uns mittlerweile so vertrauten Begrifflichkeiten und Buchtiteln, die „Nation“, „Grenze“ oder „Territorium“ im Titel führen, aber ein gewisser Zweig der Sozialwissenschaften begann bereits hier, sich den sich neu aufdrängenden räumlichen Fragen zu stellen.
Seit jener Zeit sind die gesellschaftstheoretischen (aber auch -praktischen) Zusammenhänge veränderter Territorialität verstärkt ins Zentrum des Interesses gerückt. Die räumlichen Verschiebungen der Globalisierung führten auch und gerade zu – durchaus fragwürdigen – Rethematisierungen des Örtlichen, v.a in den Begriffen Eigenes versus Fremdes, Heimat versus Überfremdung etc. Die Sozialwissenschaften bemerkten seit jener Zeit eine Rückbesinnung auf Herkunft und Identität der unter globalisiertem Wandlungsdruck stehenden Gesellschaften, die bis heute die Ungleichheits- und Minoritätenforschung prägt, weil sie lebensweltlich für die Subjekte von neuem Interesse geworden
22 Eberhard Rothfuß & Thomas Dörfler
ist. Die Zunahme von Migrationsbewegungen tut ein übriges dazu, um wieder nach den Territorialitäten und damit Raumkonstruktionen des Sozialen zu fragen, dessen Diskurs von den Konflikten des Westens gegenüber dem Islam bis zur Diskussion um die ‚Festung Europa‘ reicht.
Dieter Läpples „Essay über den Raum“ kann daher als – heute paradig-matisch geltender – wichtiger Ideengeber für die weiteren Debatten angesehen werden (Läpple 1991), weil er zum ersten Mal in deutscher Sprache die unter-schiedlichen sozialwissenschaftlichen Zugänge zum Raum, auch der englisch- und französischsprachigen, in innovativer Weise systematisierte und zu einer neuen Forschungsperspektive verdichtete. Die Folge war in den 1990er Jahren eine gewisse gesteigerte Beschäftigung mit Raum als sozialwissenschaftlichem Gegenstand, der zu einigen interessanten Arbeiten führte, die aber keinen spezifischen Diskurs dazu ausbilden konnten. Für die allgemeine soziologische Debatte blieben sie letztlich unbekannt und ohne Einfluss. Eine Ausnahme stellt das Konzept der „locality“ dar, das die Soziologen Korff & Berner (1995) entwickelten und das eine spezifisch sozialräumliche Perspektive etablierte: „Localities are characterized by social relations and interdependencies among those using a particular space, and having a common understanding of it. They are socially defined and thereby created socio-spatial entities differentiated from other spaces by symbolic markers“ (Korff 2003: 9).
8 Der Stand der heutigen Debatte
Die ‚Raumvergessenheit‘ der Soziologie änderte sich grundlegend erst mit der – wie wir sie nennen möchten – dritten Phase der raumwissenschaftlichen Forschung in der deutschsprachigen Sozialwissenschaft, als die Habilitation von Martina Löw mit dem Anspruch erschien, eine „Raumsoziologie“ zu begründen (Löw 2001). Löw entwarf einen genuin raumtheoretischen Zugang („relationale Raumtheorie“), der zwar weder gänzlich neu, noch ohne Vorgeschichte war. Insbesondere Simmel, Giddens und Bourdieu reinterpretiert Löw raumwissenschaftlich und fragt nach den latenten, auch problematischen Raumstrukturen, die diese Theorien mit sich führen. Aber sie gelangt auch zu einem neuen theoretischen Heuristikum, das sich ebenso dafür eignet, in forschungspraktischen Zusam-menhängen angewandt zu werden: die raumkonstituierende Praxis der „Spacing und Syntheseleistung“ (Löw 2001: 158) (alltagsweltlicher) Subjekte (bei ihr noch: „Akteure“). Dies kann als großes Verdienst angesehen werden, auch wenn die gesellschafts- bzw. modernisierungstheoretischen Annahmen des Ansatzes (Hegelianische bzw. Eliassche quasi-teleologische Ausdifferenzierung der Raum- und Weltbilder, fragwürdige Interpretation der kognitionspsychologischen Er-
Prolog – Raumbezogene Qualitative Sozialforschung 23
kenntnisse von Piaget u.a.) durchaus Anlass für Kritik liefert. Die „Raum-soziologie“ kann dennoch als ein gewisser state of the art gelten und soll deshalb hier auch als ein möglicher Ausgangspunkt der Neubeschäftigung mit Raum gelten, dem sich auch die Humangeographie nähert, z. B. im neuen Band von Kemper und Vogelpohl (2011), der sich auch kritisch mit dem Konzept der „Eigenlogik“ von Berking & Löw (2007) und Löw (2010) auseinandersetzt.
9 Zur Anknüpfung der Raumdebatte an die qualitative Methodik
„Meanwhile, there has been a ‚spatial turn‘ as well, across a range of disciplines as many researchers look to the spatialities and geographies of the social world, and, as Hall suggests, attend to the spatialities of research itself“ (DeLyser et al. 2010: 1 ff.).
Im Folgenden soll daher noch eine knappe Darstellung darüber erfolgen, warum wir im jungen Wandel hin zur Qualitativen Sozialforschung einen Erkenntnisfortschritt sehen, den parallel sich etablierenden spatial turn jenseits essentialisierender und apperzeptiver Logiken zu fundieren.
Wir denken daher, dass die neue Perspektivierung von Raum in den letzten zwei Dezennien als hergestellte, produzierte, konstituierte und/oder konstruierte Räumlichkeit dann an die Grundlagen und Prämissen qualitativer Methodologie angeschlossen werden kann, wenn der Methodenbezug dabei die als wesentliche Stärken dieser Forschungsrichtung erkannten und akzeptierten Vorgehens-weisen inkorporiert und auf das Räumliche der Gesellschaft bezieht.
So gibt es keinen Zugang zur sozialen Welt jenseits des Subjekts, da die Welt bzw. das Wissen von ihr in Texten, Geschichten und Körpern nur je subjektiv erfahren werden kann. Aufgabe der empirischen Sozialforschung ist es, dieses Subjektive durch geeignete Methoden zu verobjektivieren, das Allgemeine im Idiographischen zu finden, das Typische im je Subjektiven. Dies bedeutet nun, dass rekonstruktiv verfahrende empirische Forschung Erkenntnis erst generieren kann, wenn sie sich lebensweltlich und erfahrungsnah der sozialen Wirklichkeit annähert (Girtler 1984).
Das interpretative Paradigma, das die Subjekte als Handelnde und Reflektierende in einer von ihnen hergestellten und mit Sinn belegten (Alltags-) Welt zu verstehen suchen, zielte bereits frühzeitig darauf ab, die „gesellschaft-liche Konstruktion von Wirklichkeit“ wie es Berger & Luckmann (1970) formuliert haben, zu entdecken. Das Handeln der Menschen in der Herstellung und Interpretation von Bedeutungen in intersubjektiven Interaktions-verhältnissen zu erforschen, ist die zentrale Perspektive, die das qualitative Paradigma dem quantitativen gegenüberstellt, das demgegenüber die Menschen
24 Eberhard Rothfuß & Thomas Dörfler
verhaltenstheoretisch weitgehend auf Wesen reduziert, die auf soziale Normen reagieren (zur Kritik vgl. z.B. Flick 2005).
Die vielschichtigen Interaktionen der Subjekte mit ihrer Umwelt können als Konsequenz letztendlich nur dann angemessen erforscht werden, wenn eine Methodologie zugrunde liegt, die sich ihrem Gegenstand durch „Methoden-adäquanz“ anpasst (Schütz 1971: 39 ff.). Die Aufgabe der Forscherin oder des Forschers ist es dann, diese soziale Wirklichkeit und die Sinnwelten der Subjekte zu rekonstruieren, ihre kontextuellen Handlungsrationalitäten zu ver-stehen und deutend nachzuvollziehen (vgl. Rothfuß 2009 für die interkulturelle Geographie). Diese sind auch, darauf hat die Raumsoziologie und einige daran anschließende Arbeiten hingewiesen, räumlich organisiert, etwa im Sinne der dort vorgebrachten Perspektive der Synthese- und spacing-Leistungen alltags-weltlich handelnder Subjekte. Raum als sozio-materielle Anordnungspraxis ist nicht nebensächlich, sondern konstitutiv für subjektives Alltagshandeln, und seien es vorgegebene, territoriale Exklusionslogiken, mit denen schlicht umge-gangen werden muss.
Jenseits methodologischer und methodischer Orthodoxien erscheint uns aber hier auch erwähnenswert, dass es grundlegend um eine redliche und respektvolle Grundhaltung des Forschenden der sozialen Welt und den Subjekten gegenüber gehen muss, wie es auch Bourdieu (1997: 779) zutreffend formuliert hat:
„Deshalb glaube ich nicht, daß man sich auf die unzähligen sogenannten methodologischen Schriften über Befragungstechniken verlassen kann. (...) Jedenfalls scheint es mir, daß diesen Schriften etwas entgeht, was diejenigen Forscher immer gewußt und getan haben, die ihren Gegenstand mit größtem Respekt behandelt haben und einen Blick hatten für die quasi unendlichen Subtilitäten der Strategien, die die gesellschaftlichen Akteure in ihrem gewöhnlichen Alltagsleben anwenden.“
Konstitutiv für dieses qualitative Axiom des Respekts vor dem Menschen stellen Offenheit und Flexibilität zwei zentrale Grundsätze qualitativer Sozial-forschung nach Lamnek (1995: 21 ff.) dar. „Das Prinzip der Offenheit besagt, dass die theoretische Strukturierung des Forschungsgegenstandes zurückgestellt wird, bis sich die Strukturierung des Forschungsgegenstandes durch die Forschungssubjekte herausgebildet hat“ (Hoffmann-Riem 1980: 343). Die Methoden werden dem Erkenntnisinteresse sowie ihrer Angemessenheit entsprechend ausgewählt (vgl. auch Strauss & Corbin 1996). So stellt sich der Forschungsprozess der qualitativen Sozialforschung als vor allem entdeckend und induktiv dar, während dessen es sich erst herausstellt, ob und was Raum zur Konstitutionsleistung des Sozialen und Gesellschaftlichen beiträgt. Damit ist kein Jota an die Kritik am Raumessentialismus verloren, wie sie bereits oben
Prolog – Raumbezogene Qualitative Sozialforschung 25
mehrfach erwähnt wurde, sondern deren Ablehnung a priori eines Rauminter-esses einer kritisch-praktischen Überprüfung anheim gegeben. Ob Raum für untersuchte soziale Beziehungen eine Rolle spielt, sollten die sozialen Beziehungen und nicht die diskursiven, bisweilen hegemonialen Tabus in den wissenschaftlichen Debatten entscheiden.
Qualitative Sozialforschung begreift weiterhin Kommunikation und Bezie-hungen zwischen ForscherIn und Beforschten als konstitutiven Bestandteil des Forschungsgeschehens – Forschung wird in dieser Perspektive also als Interakt-ionsprozess verstanden, weder als diskursive Praktik, noch als Semantik alleine. Grundlegend für „gelungene Kommunikation“, ein „echtes Gespräch“ im Sinne von Buber (1997: 293), ist die ernste Berücksichtigung alltäglicher kommunika-tiver Interdependenz sowie einer gemeinsamen Verständigungsebene bei der Schaffung einer möglichst natürlichen Kommunikationssituation in der Alltags-welt der Beforschten (Kommunikativität und Naturalistizität; vgl. Lamnek 1995: 19 ff.). Hier offenbart sich auch die epistemologische Grundhaltung und -idee, dass nicht der/die WissenschaftlerIn (all-)wissend ist, sondern die Untersuchungs-personen als die eigentlichen ExpertInnen ihrer Lebensrealität angesehen wer-den (müssen), über die der/die ForscherIn Erkenntnisse gewinnen möchte – ohne dass dies bedeuten würde, unkritisch zu verweilen; dennoch kann diese Haltung kaum Sinn der Praxis sein, sondern der ihrer Reflexion und Auswertung.
Weiterhin ist die Selbstreflexivität der/s Forschenden integraler Bestandteil des qualitativen Paradigmas. Durch Hinterfragen und Explorieren des eigenen Vorwissens, Vorverständnisses und Alltagswissens wird dies kritisch beleuchtet und im Interpretationsprozess berücksichtigt. Die eigenen Interessen werden bewusst gemacht. Dies trägt dazu bei, dass der Interpretations- und Rekon-struktionsprozess transparent(er) und dadurch objektiviert wird. Hier möchten wir auf den Epilog von Ulli Vilsmaier in diesem Band verweisen, die sich die vorliegenden Beiträge des Bandes in ihrer Reflexivität des eigenen Subjekt-standpunktes angenommen hat.
Implizite Forderung ist, dass Hypothesen nicht ex ante festgelegt werden, sondern erst als Ergebnis und Prozess auf der Grundlage erhobener Daten generiert werden. Während des Forschungsprozesses werden Annahmen und Ergebnisse reflexiv behandelt und durch neue Erkenntnisse im Verlauf revidiert oder bekräftigt. Glaser und Strauss (1998) sprechen hierbei vom Postulat des „ständigen Vergleichs“ während der gesamten Forschung. Die grounded theory nach Glaser & Strauss 1998 bzw. Strauss & Corbin 1996 versucht einen datenbasierten Erkenntnisweg, der auf apriorische Kategorien verzichtet und den Entdeckungszusammenhang von Forschung und Erkenntnis in das Zentrum rücken möchte. Der spezifische Fokus, unter dem dies von statten gehen soll und der hier verfochten wird, ist der sozioräumliche. Die nahezu erdrückend re-
26 Eberhard Rothfuß & Thomas Dörfler
levanten Einsichten der wiedergewonnenen räumlichen Perspektive in den Sozial- und Kulturwissenschaften (Territorialität, Translokalität, Identität, Herkunft, Raum, u.v.a.m.) verlangt dringlich eine methodologische Fundierung, will sie nicht im Metaphernhaften oder Assoziativen verbleiben.
10 Fazit
Mit dem vorliegenden Band sind aus diesem Grunde zwei wesentliche Ziele verbunden. Zum einen geht es uns um die Überwindung eines unreflektierten „just-do-it“-Ansatzes, der die Humangeographie methodisch weitgehend unvor-bereitet ins Feld gehen ließ und die vergangenen Jahrzehnte geprägt hat. Diese Kritik stellt sich vor dem Hintergrund, dass es Studierenden wie Graduierenden oftmals schwerfällt zu entscheiden, Raumbezüge in eigenen Arbeiten nicht-essentialistisch auszuweisen. Von zentraler Bedeutung ist deswegen, dass der Erkenntnis- und Interpretationsprozess qualitativer Forschung offengelegt wird.
Zum anderen soll dabei deutlich werden, dass eine eingehende metho-dologische Reflexion – im Kontext der ForscherInnenrolle, dem Prozess der Datenerhebung und Interpretation – kein redundantes Zubrot oder einen lässlichen Arbeitsschritt darstellt, sondern entscheidender Bestandteil quali-tativer Forschungslogik sein muss. Deshalb möchte sich dieser Band – als Versuch einer ersten Annäherung – mit den Qualitäten, den Merkmalen und der theoretischen Fundierung einer räumlich orientierten, qualitativen Sozial-forschung auseinandersetzen. Gefordert ist hierfür eine Debatte sowohl über die theoretischen Grundlagen einer solchen Positionierung, als auch die Diskussion ihrer praktischen Umsetzungen in der empirischen Forschung.
Wir möchten explizit demonstrieren, dass die vorliegende Publikation einen Weg gehen möchte, wie mit der Differenzkategorie Ort und Raum qualitativ verfahren werden kann und inwiefern eine Sensibilität hinsichtlich praxeo-logischer Raumbezügen die qualitative Sozialforschung zu bereichern vermag. „We recognize the complexity of everyday reality, the multitude of influences that shape lived experience, and the importance of the spatial contexts of human inter-action“ (DeLyser et al. 2010: 6). Diese epistemische Verortung wird auch bei Werlen (2008: 372) deutlich: „Eine praxiszentrierte Forschungsperspektive hingegen eröffnet die Möglichkeit, die Statik der Raumanalyse zu vermeiden und sich in der Erforschung alltäglicher Konstitutionsprozesse gesellschaftlicher Raumverhältnisse zuzuwenden“ um dabei aber eben auch räumliche Kontexte und Kontextualisierungen nicht zu vernachlässigen.
Letztlich ist mit einem derartigen Band auch die bescheidene Hoffnung verbunden, dass es mit einer ernst gemeinten Sensibilität dem Räumlichen
Prolog – Raumbezogene Qualitative Sozialforschung 27
gegenüber gelingen könnte, dem Fächerkanon eine weitere Perspektive zuzu-fügen: Dass nämlich eine raumbezogene Sozialforschung, deren Perspektive kritisch und reflektiert bleibt, den methodologischen Paradigmenwechsel weiter voranzubringen vermag und damit einen wichtigen Beitrag für die Sozial- und Kulturwissenschaften leisten kann.
Literatur
Bachelard, Gaston (1987): Die Bildung des wissenschaftlichen Geistes. Beitrag zu einer Psychoana-lyse der objektiven Erkenntnis. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
Bachmann-Medick, Doris (Hrsg.) (2009): Cultural turns. Neuorientierungen in den Kulturwissen-schaften. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt-Taschenbuch-Verlag.
Bachmann-Medick, Doris (2009): Spatial Turn. In: Bachmann-Medick (2009): 284–328. Bartels, Dietrich (1968): Zur wissenschaftstheoretischen Grundlegung einer Geographie des Men-
schen. Band 19 von Erdkundliches Wissen. Wiesbaden: F. Steiner. Belina, Bernd/Michel, Boris (Hrsg.) (2007): Raumproduktionen. Beiträge der Radical Geography.
Eine Zwischenbilanz. Münster: Westfälisches Dampfboot. Berger, Peter L./Luckmann, Thomas (1970): Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit.
Eine Theorie der Wissenssoziologie. Frankfurt am Main: Fischer. Berking, Helmuth/Löw, Martina (2008): Die Eigenlogik der Städte. Neue Wege für die Stadtfor-
schung. Frankfurt; New York: Campus. Berner, Erhard/Korff, Rüdiger (1997): Globalization and Local Resistance: The Creation of
Localities in Manila and Bangkok. Working Paper No. 274. Bielefeld. Bertels, Lothar Herlyn Ulfert (Hrsg.) (1990): Lebenslauf und Raumerfahrung. Opladen: Leske +
Budrich. Birkenhauer, Josef (1987): Hermeneutik: Ein legitimer wissenschaftlicher Ansatz in der Geogra-
phie? In: Geographische Zeitschrift 75. 2: 111–121. Blotevogel, Heinrich (1999): Sozialgeographischer Paradigmenwechsel? Eine Kritik des Projekts
der handlungszentrierten Sozialgeographie von Benno Werlen. In: Meusburger (1999): 1–34. Blunt, Alison (2003): Cultural Geography in Practice. London, New York: Arnold, Oxford Universi-
ty Press. Böhme, Hartmut (2005): Topographien der Literatur. Deutsche Literatur im transnationalen Kon-
text. Stuttgart: Metzler. Bollnow, Otto Friedrich (1963): Mensch und Raum. Stuttgart: Kohlhammer. Bourdieu, Pierre (1997): Das Elend der Welt. Zeugnisse und Diagnosen alltäglichen Leidens an der
Gesellschaft. Konstanz: UVK Verlagsgesellschaft. Buber, Martin (1997 [1962]): Das dialogische Prinzip. Ich und du; Zwiesprache; Die Frage an den
Einzelnen; Elemente des Zwischenmenschlichen; Zur Geschichte des dialogischen Prinzips. Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus.
Canguilhem, Georges (1979 [1963]): Wissenschaftsgeschichte und Epistemologie. Frankfurt: Suhr-kamp.
Certeau, Michel de (1988): Kunst des Handelns. Berlin: Merve Verlag. Cloke, Paul J./Cook, Ian/Crang, Philip/Goodwin, Mark/Painter, Joe/Philo, Chris (2004): Practising
Human Geography. London: SAGE. Crang, Mike (2002): Qualitative methods: the new orthodoxy? In: Progress in Human Geography
26. 5: 647–655.
28 Eberhard Rothfuß & Thomas Dörfler
Crang, Mike (2003): Qualitative methods: touchy, feely, look-see? In: Progress in Human Geogra-phy 27. 4: 494–504.
Deffner, Veronika (2010): Habitus der Scham - die soziale Grammatik ungleicher Raumproduktion. Eine sozialgeographische Untersuchung der Alltagswelt Favela in Salvador da Bahia (Brasili-en). = Passauer Schriften zur Geographie 26. Passau: Selbstverlag Fach Geographie der Univ. Passau.
DeLyser, Dydia/Herbert, Steve/Aitken, Stuart/Crang, Mike/McDowell, Linda (2010): Introduction. In: DeLyser et al. (2010): 1–18.
DeLyser, Dydia/Herbert, Steve/Aitken, Stuart/Crang, Mike/McDowell, Linda (Hrsg.) (2010): The SAGE handbook of qualitative geography. Los Angeles, London: SAGE.
Denzin, Norman K./Lincoln, Yvonna S. (Hrsg.) (2005): The Sage handbook of qualitative research. Thousand Oaks, London, New Delhi: SAGE.
Diaz-Bone, Rainer (2002): Kulturwelt, Diskurs und Lebensstil. Eine diskurstheoretische Erweite-rung der Bourdieuschen Distinktionstheorie. Wiesbaden: VS Verlag.
Diaz-Bone, Rainer (2006): Zur Methodologisierung der Foucaultschen Diskursanalyse. In: Histori-cal Social Research 31. 2: 243–274.
Dirksmeier, Peter (2007): Urbanität als Habitus. Zur Sozialgeographie städtischen Lebens auf dem Land. Bielefeld: transcript.
Dörfler, Thomas (2010): Gentrification in Prenzlauer Berg? Milieuwandel eines Berliner Sozial-raums seit 1989. Bielefeld: transcript.
Dörfler, Thomas (2011): Antinomien des (neuen) Urbanismus. Henri Lefebvre, die HafenCity Hamburg und die Produktion des posturbanen Raumes: eine Forschungsskizze. In: Raumfor-schung und Raumordnung 69. 2: 91–104.
Döring, Jörg/Thielmann, Tristan (2008): Einleitung: Was lesen wir im Raume? Der Spatial Turn und das geheime Wissen der Geographen. In: Döring; Thielmann (Hrsg.): Spatial Turn. Das Raumparadigma in den Kultur- und Sozialwissenschaften. Bielefeld: transcript: 7–48.
Dünne, Jörg/Friedrich, Sabine/Kramer, Kirsten (Hrsg.) (2009): Theatralität und Räumlichkeit. Raumordnungen und Raumpraktiken im theatralen Mediendispositiv. Würzburg: Königshau-sen & Neumann.
Dünne, Jörg/Günzel, Stephan/Doetsch, Hermann (Hrsg.) (2010): Raumtheorie. Grundlagentexte aus Philosophie und Kulturwissenschaften. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
Egner, Heike (2008): Gesellschaft, Mensch, Umwelt - beobachtet. Ein Beitrag zur Theorie der Geographie. = Erdkundliches Wissen 145. Stuttgart: Steiner.
Egner, Heike/Ratter, Beate/Dikau, Richard (Hrsg.) (2008): Umwelt als System - System als Um-welt? Systemtheorien auf dem Prüfstand. München: Oekom.
Eisel, Ulrich (1980): Die Entwicklung der Anthropogeographie von einer "Raumwissenschaft" zur Gesellschaftswissenschaft. Urbs et Regio, Kasseler Schriften zur Geografie und Planung, Band 17, Kassel
Everts, Jonathan/Lahr-Kurten, Matthias/Watson, Matt (2011): Practice matters! Geographical inquiry and theories of practice. In: Erdkunde 65. 4: 323–334.
Flick, Uwe (2005): Qualitative Sozialforschung. Eine Einführung. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt-Taschenbuch-Verlag.
Foucault, Michel (19902): Andere Räume. In: Aisthesis. Wahrnehmung heute oder Perspektiven einer anderen Ästhetik. Leipzig: Reclam: 34-46.
Freud, Sigmund (2000): Das Unbehagen in der Kultur (1930 [1929]). In: ders. (2000): Studienaus-gabe, Bd. IX. Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag: 191–270.
Gamm, Gerhard (2000): Nicht nichts. Studien zu einer Semantik des Unbestimmten. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
Gebhardt, Hans/Glaser, Rüdiger/Radtke, Ulrich/Reuber, Paul (Hrsg.) (2007): Geographie. Physische Geographie und Humangeographie. München: Spektrum Akademischer Verlag.
Prolog – Raumbezogene Qualitative Sozialforschung 29
Gebhardt, Hans/Reuber, Paul/Wolkersdorfer, Günter (Hrsg.) (2003): Kulturgeographie. Aktuelle Ansätze und Entwicklungen. Heidelberg, Neckar: Spektrum Akademischer Verlag.
Girtler, Roland (1984): Methoden der qualitativen Sozialforschung. Anleitung zur Feldarbeit. Wien: Böhlau.
Glaser, Barney G./Strauss, Anselm L. (1998): Grounded Theory. Strategien qualitativer Forschung. Bern, Göttingen, Toronto, Seattle: Huber.
Glasze, Georg/Husseini, Shadia/Mose, Jörg (2009): Kodierende Verfahren in der Diskursforschung. In: Glasze; Mattissek (2009): 293–314.
Glasze, Georg/Mattissek, Annika (Hrsg.) (2009): Handbuch Diskurs und Raum. Theorien und Methoden für die Humangeographie sowie die sozial- und kulturwissenschaftliche Raumfor-schung. Bielefeld: transcript.
Gotthard, Axel (2005): Wohin führt uns der ‚spatial turn‘? Über mögliche Gründe, Chancen und Grenzen einer neuerdings diskutierten historiographischen Wende. In: Wüst; Blessing (2005): 15–50.
Günzel, Stephan (Hrsg.) (2007): Topologie. Zur Raumbeschreibung in den Kultur- und Medienwis-senschaften. Bielefeld: transcript.
Günzel, Stephan (2010): Einleitung (Teil I und II). In: Dünne et al. (2010): 14–194. Gupta, Akhil/Ferguson, James (2008): Beyond 'Culture': Space, Identity, and the Politics of Differ-
ence. In: Oakes; Price (2008): 60–67. Gurwitsch, Aron (1977): Die mitmenschlichen Begegnungen in der Milieuwelt. Berlin: de Gruyter. Hard, Gerhard (2008): Der Spatial turn, von der Geographie her betrachtet. In: Döring; Thielmann
(2008): 263–316. Häussermann, Hartmut (Hrsg.) (1991): Stadt und Raum. Soziologische Analysen. Pfaffenweiler:
Centaurus Verlagsgesellschaft. Heidegger, Martin (2006 [1927]): Sein Und Zeit. Tübingen: Niemeyer. Herlyn, Ulfert (1990): Zur Aneignung von Raum im Lebensverlauf. In: Bertels (1990): 7–34. Hoffmann-Riem, Christa (1980): Die Sozialforschung in einer interpretativen Soziologie. Der
Datengewinn. In: Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie 32. 3: 339–372. Horlitz, Sabine/Vogelpohl, Anne (2009): ‘Something Can Be Done!‘. A Report on the Conference
'Right to the City. Prospects for Critical Urban Theory and Practice‘, Berlin November 2008. In: International Journal for Urban and Regional Research 33. 4: 1067–1072.
Kanwischer, Detlef/Rhode-Jüchtern Tilman (2002): Qualitative Forschungsmethoden in der Geographiedidaktik. Bericht über einen HGD-Workshop in Jena, 21. – 23. Juni. Nürnberg.
Keller, Reiner (Hrsg.) (2005): Die diskursive Konstruktion von Wirklichkeit. Zum Verhältnis von Wissenssoziologie und Diskursforschung. Konstanz: UVK Verlagsgesellchaft.
Kemper, Jan/Vogelpohl, Anne (Hrsg.) (2011): Lokalistische Stadtforschung, kulturalisierte Städte. Zur Kritik einer "Eigenlogik der Städte". Münster: Westfälisches Dampfboot.
Konau, Elisabeth (1977): Raum und soziales Handeln. Studien zu einer vernachlässigten Dimension soziologischer Theoriebildung. Stuttgart: Enke.
Korff, Rüdiger (2003): Local Enclosures of Globalization. The Power of Locality. In: Dialectical Anthropology 27: 1–18.
Lacan, Jacques (1978): Das Freudsche Unbewußte und das unsere. In: Lacan (1978): 165–204. Lacan, Jacques (Hrsg.) (1978): Das Seminar XI. Weinheim: Quadriga. Lacan, Jacques (Hrsg.) (1991 [1975]): Schriften II. Weinheim: Quadriga. Lacan, Jacques (1991 [1975]): Subversion des Subjekts und Dialektik des Begehrens im Freudschen
Unbewußten. In: Lacan (1991 [1975]): 165–204. Lamnek, Siegfried (1989): Qualitative Sozialforschung. Band 1 und 2. München: Beltz PVU. Läpple, Dieter (1991): Essay über den Raum. Für ein gesellschaftswissenschaftliches Raumkonzept.
In: Häussermann (1991): 159–207. Lefebvre, Henri (1974): La production de l'espace. Paris: Anthropos.
30 Eberhard Rothfuß & Thomas Dörfler
Lippuner, Roland (2011): Operative Geschlossenheit und strukturelle Kopplung. Zum Verhältnis von Gesellschaft und Umwelt aus systemtheoretischer Sicht. In: Geographische Zeitschrift 98. 4: 194–-212.
Lippuner, Roland (2007): Sozialer Raum und Praktiken. Elemente sozialwissenschaftlicher Topolo-gie bei Pierre Bourdieu und Michel de Certeau. In: Günzel (2007): 265–277.
Lippuner, Roland: Objekte und Stellen. Eine systemtheoretische Interpretation von Raum und Architektur. In: Wolkenkuckucksheim. Internationale Zeitschrift zur Theorie der Architektur 12. 2. 2008. Zum Interpretieren von Architektur - Theorie des Interpretierens. http://www.cloud-cuckoo.net/. 24.01.2012.
Lippuner, Roland/Lossau, Julia (2004): In der Raumfalle. Eine Kritik des spatial turn in den Sozial-wissenschaften. In: Mein; Rieger-Ladich (2004): 47–64.
Low, Setha M./Lawrence-Zúñiga, Denise (Hrsg.) (2003): The anthropology of space and place. A reader. Oxford: Blackwell.
Löw, Martina (2001): Raumsoziologie. Frankfurt am Main: Suhrkamp. Löw, Martina (2010): Soziologie der Städte. Frankfurt am Main: Suhrkamp. Löw, Martina/Steets, Silke/Stoetzer, Sergej (Hrsg.) (2007): Einführung in die Stadt- und Raumso-
ziologie. Stuttgart: UTB. Mattissek, Annika (2010): Analyzing city images. Potentials of the “French School of Discourse
Analysis”. In Erdkunde 64. 4: 315–326 Meier Kruker, Verena/Rauh, Jürgen (2005): Arbeitsmethoden der Humangeographie. Darmstadt:
Wissenschaftliche Buchgesellschaft. Mein, Georg/Rieger-Ladich, Markus (Hrsg.) (2004): Soziale Räume und kulturelle Praktiken. Über
den strategischen Gebrauch von Medien. Bielefeld: transcript. Merleau-Ponty, Maurice (1966 [1945]): Phänomenologie der Wahrnehmung. Berlin: de Gruyter. Meusburger, Peter (Hrsg.) (1999): Handlungszentrierte Sozialgeographie. Benno Werlens Entwurf
in kritischer Diskussion. Stuttgart: F. Steiner. Oakes, Tim/Price, Patricia L. (Hrsg.) (2008): The Cultural Geography Reader. London [etc.]: Rout-
ledge. Pfaffenbach, Carmella (2011): Methoden qualitativer Feldforschung in der Geographie. In: Gebhardt
et al. (2011): 157–175. Pohl, Jürgen (1986): Geographie als hermeneutische Wissenschaft. Ein Rekonstruktionsversuch. =
Münchner Geographische Hefte 52. Kallmünz/Regensburg: M. Lassleben. Pohl, Jürgen (1996): Ansätze zu einer hermeneutischen Begründung der Regionalen Geographie,
Landes- und Länderkunde als Erforschung regionaler Lebenspraxis? In: Bericht zur deutschen Landeskunde 70. 1: 73–92.
Pott, Andreas (2002): Ethnizität und Raum im Aufstiegsprozess. Eine Untersuchung zum Bildungs-aufstieg in der zweiten türkischen Migrantengeneration. Opladen: Leske + Budrich.
Pott, Andreas (2007): Sprachliche Kommunikation durch Raum – das Angebot der Systemtheorie. In: Geographische Zeitschrift 95. 1 und 2: 56–71.
Redepenning, Marc (2006): Wozu Raum? Systemtheorie, critical geopolitics und raumbezogene Semantiken. = Beiträge zur Regionalen Geographie Europas 62. Leipzig: Leibniz-Institut für Länderkunde.
Redepenning, Marc (2008): Eine selbst erzeugte Überraschung: Zur Renaissance von Raum als Selbstbeschreibungsformel der Gesellschaft. In: Döring; Thielmann (2008): 317–340.
Reuber, Paul/Mattissek, Anika (2004): Die Diskursanalyse als Methode in der Geographie – Ansätze und Potentiale. In: Geographische Zeitschrift 92. 4: 227–242.
Reuber, Paul/Pfaffenbach, Carmella (2005): Methoden der empirischen Humangeographie. Be-obachtung und Befragung. Braunschweig: Westermann.
Rothfuß, Eberhard (2004): Ethnotourismus - Wahrnehmungen und Handlungsstrategien der pasto-ralnomadischen Himba (Namibia). Ein hermeneutischer, handlungstheoretischer und methodi-
Prolog – Raumbezogene Qualitative Sozialforschung 31
scher Beitrag aus sozialgeographischer Perspektive. = Passauer Schriften zur Geograhie 19. Passau: Selbstverlag Fach Geographie der Univ. Passau.
Rothfuß, Eberhard (2009): Intersubjectivity, intercultural hermeneutics and the recognition of the other. Theoretical reflections on the understanding of alienness in human geography research. In: Erdkunde 63. 2: 173–188.
Rothfuß, Eberhard (2012): Exklusion im Zentrum. Die brasilianische Favela zwischen Stigmatisie-rung und Widerständigkeit. Bielefeld: transcript.
Schlögel, Karl (2003): Im Raume lesen wir die Zeit. Über Zivilisationsgeschichte und Geopolitik. München: Carl Hanser.
Schlottmann, Antje (2005): RaumSprache. Ost-West-Differenzen in der Berichterstattung zur deut-schen Einheit: Eine sozialgeographische Theorie. Stuttgart: Steiner.
Schmid, Christian (2005): Stadt, Raum und Gesellschaft. Henri Lefebvre und die Theorie der Pro-duktion des Raumes. = Sozialgeographische Bibliothek 1. Stuttgart: F. Steiner.
Schroer, Markus (2007): Raum als soziologischer Begriff. Programmatische Überlegungen. In: Wehrheim (2007): 35–54.
Schroer, Markus (2006): Räume, Orte, Grenzen. Auf dem Weg zu einer Soziologie des Raums. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
Schütz, Alfred (Hrsg.) (1971): Gesammelte Aufsätze I. Das Problem der sozialen Wirklichkeit. Den Haag: Nijhoff.
Schütz, Alfred (1971): Zur Methodologie der Sozialwissenchaften. In: Schütz (1971): 3–54. Sedlacek, Peter (1989): Programm und Praxis qualitativer Sozialgeographie. = Wahrnehmungstheo-
retische Studien zur Regionalentwicklung 6. Oldenburg: Bibliotheks- u. Informationssystem d. Universität Oldenburg.
Stockhammer, Robert (2007): Kartierung der Erde. Macht und Lust in Karten und Literatur. Mün-chen: W. Fink.
Strauss, Anselm L./Corbin, Juliet M. (1996): Grounded Theory. Grundlagen qualitativer Sozialfor-schung. Weinheim: Beltz PVU.
Struck, Ernst (2000): Erlebnislandschaft Franken, Perspektiven für fränkische Weindörfer. = Schrif-tenreihe Materialien zur Ländlichen Entwicklung 37. München: Bereich Zentrale Aufgaben der Bayerischen Verwaltung für Ländliche Entwicklung.
Uexküll, Jakob von/Kriszat, Georg (1970): Streifzüge durch die Umwelten von Tieren und Men-schen. Ein Bilderbuch unsichtbarer Welten: Bedeutungslehre. Frankfurt am Main: Fischer Ta-schenbuch Verlag.
Vogelpohl, Anne (2011): Städte und die beginnende Urbanisierung. Henri Lefebvre in der aktuellen Stadtforschung. In: Raumforschung und Raumordnung 69. 4: 233–243.
Wehrheim, Jan (Hrsg.) (2007): Shopping Malls. Interdisziplinäre Betrachtungen eines neuen Raumtyps. Wiesbaden: VS Verlag.
Werlen, Benno (1987): Gesellschaft, Handlung und Raum. Grundlagen handlungstheoretischer Sozialgeographie. = Erdkundliches Wissen 89. Stuttgart: Steiner.
Werlen, Benno (1995): Sozialgeographie alltäglicher Regionalisierungen. Bd. 1: Zur Ontologie von Gesellschaft und Raum. = Erdkundliches Wissen 116. Stuttgart: Steiner.
Werlen, Benno (2008): Körper, Raum und mediale Repräsentation. In: Döring; Thielmann (2008): 365–392.
Wüst, Wolfgang/Blessing, Werner (Hrsg.) (2005): Mikro-Meso-Makro. Regionenforschung im Aufbruch. Erlangen: Zentralinstitut für Regionalforschung.
Žižek, Slavoj (2006): Parallaxe. Frankfurt am Main: Suhrkamp.