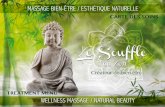Young's Schema Questionnaire – Short Form Version 3 (YSQ ...
Nominalprädikat versus Eigenschaftskonstruktion. Das Schema être X im Französischen
-
Upload
lmu-munich -
Category
Documents
-
view
3 -
download
0
Transcript of Nominalprädikat versus Eigenschaftskonstruktion. Das Schema être X im Französischen
Aufsätze und Berichte
Nominalprädikat versus Eigenschaftskonstruktion
Das Schema être X im Französischen
Von Ulrich Detges
Abstract
In Modern French, the pattern être X includes various types of complex predicates, thatis, copular predicates (être heureux, être professeur), a certain type of light verb construction(être en alerte), as well as various periphrastic constructions, such as the stative passive (êtredéçu), the dynamic passive (être battu par qn.) and the progressive (être en train de faire qc.).According to the “standard analysis” (e.g. Hengeveld 1992, Detges 1996), copulas and lightverbs are grammatical devices which indicate that non-verbal elements (nouns, adjectives,prepositional phrases) are – “against their nature” – used as predicates. In this paper, I willargue that this view is problematic for the French être X pattern, since the latter includessub-constructions which are already verbal in nature (the two passives and the progressive)and therefore cannot be interpreted as devices to turn non-verbs into predicates. FollowingCroft (2002), I will show that a construction grammar approach is far more apt than the“standard analysis” for capturing the syntactic and distributional properties of the être Xpattern and the relations between its various sub-patterns.
1. Vorbemerkung
Unter „Nominalprädikaten“ will ich im Folgenden komplexe Prädikate verste-hen, die aus einer adjektivischen oder substantivischen Kopfkonstituente1 sowieaus einem kopulativen Verb oder einem Funktionsverb bestehen. Typische Nomi-nalprädikate sind unter (1) dargestellt (der Terminus „Funktionsverbgefüge“ wirdeingehender in Abschnitt 3 erläutert).
(1) Nominalprädikate, Beispielea. Kopula + ADJ Marie est heureuseADJ
b. Kopula + Substantiv2 Paul devient médecinN
c. Funktionsverbgefüge Luc fait attentionN au moindre détail
1 Zur Frage der Kopfkonstituente in solchen Konstruktionen s. Detges (1996: 82).2 Die Kategorie „Substantiv“ wollen wir im Weiteren als N abkürzen. Diese Entscheidung
ist insofern nicht ganz konsequent, als N ja eigentlich für „Nomen“ steht. Als „nominal“im weiteren Sinne werden aber im Folgenden die Kategorien „Adjektiv“ und „Substan-tiv“ verstanden. Trotzdem steht das Kürzel N hier, in Einklang mit der allgemeinen Kon-vention, nur für „Substantiv“ im engeren Sinne.
DOI 101515/roma.60.2Bereitgestellt von | Universitaetsbibliothek der LMU MuenchenAngemeldet
Heruntergeladen am | 11.03.15 11:02
Thema der folgenden Überlegungen soll eine Untergruppe von Nominalprädika-ten sein, die die Form être X3 aufweist – X ist hier als wortartenunabhängigerPlatzhalter zu verstehen, der verschiedene lexikalische Kategorien und Konstitu-ententypen repräsentiert, beispielsweise die Wortart „Adjektiv“ (Marie est heu-reuse), die Kategorie „Substantiv“ (Paul est médecin) oder komplexe Konstituen-ten der Form „Präposition Substantiv“ (Max est en rage). Das Schema être Xwirft insofern ein Problem auf, als zur Besetzung von X nicht nur nominale (d. h.adjektivische und substantivische4) Elemente infrage kommen, sondern, wie wirsehen werden, auch Elemente verbaler Herkunft. Dieser Befund ist Anlass, dieKategorie „Nominalprädikat“ einer kritischen Prüfung zu unterziehen.
Zum Verständnis der nachfolgenden Argumentation ist es notwendig, die„Standardsichtweise“ auf Nominalprädikate und auf ihre Funktion im Sprachsys-tem zu skizzieren, wie sie beispielsweise noch in Detges (1996) vertreten wird. Auf-bauend auf der syntaktisch-distributionellen Analyse eines bestimmten Typs vonNominalprädikaten, nämlich der Konstruktionen des Schemas être X, möchte ichzeigen, dass dieser Ansatz eklatante Schwachstellen aufweist. In den Abschnitten 7und 8 werde ich deshalb eine alternative Interpretation der syntaktischen Datenvorschlagen, die maßgeblich an konstruktionsgrammatischen Ansätzen (Croft2002, Goldberg 1995) orientiert ist.
2. Die „Standardsichtweise“: Nominalprädikate zwischen Wortart und propositionaler Funktion
In der Diskussion um die Wortarten (die, wie wir sehen werden, bestimmteImplikationen für eine Theorie der Nominalprädikate beinhaltet) müssen zweiEbenen auseinandergehalten werden. Dabei handelt es sich einerseits um die pro-positionalen Funktionen der Prädikation und der Benennung5 – beide sind als uni-versell zu betrachten –, andererseits um das System der Wortarten (Luuk 2009),das grundsätzlich einzelsprachlichen Charakter besitzt und historischem Wandelunterworfen ist. Beide Ebenen sind insofern untrennbar miteinander verknüpft,als einerseits die propositionalen Funktionen sich stets in bestimmten Verwendun-gen der Wortarten manifestieren, während andererseits die Wortarten sich nur imRekurs auf die propositionalen Funktionen sinnvoll beschreiben lassen. Die Wort-arten „Substantiv“, „Adjektiv“ und „Verb“, wie wir sie aus dem Deutschen oderdem Französischen kennen, stellen Klassen von Prädikatoren dar, die jeweils aufeine bestimmte propositionale Funktion spezialisiert sind. Diese übernehmen siesozusagen im „Naturzustand“ (Werner 1975: 455), d. h. in unmarkierter Verwen-
Ulrich Detges30
3 Diese Notation geht zurück auf Danlos (1980).4 Zu dieser Auffassung von „Nominalität“ vgl. Wunderli (1989: 105).5 Der Begriff der „Benennung“ entspricht dem, was bei Knobloch (1990, 1991) als „Nomi-
nation“ bezeichnet wird. Ich verwende ihn anstelle des üblicheren Terminus „Referenz“als Oberbegriff für verschiedene Arten von „hinweisenden Akten“ (Koch 1981: 67), vondenen Referenz – im strengen Sinne singulär-definiter Referenz – nur einer ist.
Bereitgestellt von | Universitaetsbibliothek der LMU MuenchenAngemeldet
Heruntergeladen am | 11.03.15 11:02
dung, während ein Eintreten in eine andere Funktion mit zusätzlichem morpho-syntaktischen „Aufwand“ verbunden ist (Croft 2002: 98).
Unter der Funktion der Prädikation will ich im Folgenden die sprachliche„Stiftung von Sachverhalten“ verstehen, wie sie beispielsweise in (2a) durch dasflektierte Verb critique geleistet wird. Dagegen stellt die Benennung einen Teilaktder Referenz auf außersprachliche Individuen dar; sie kann durch volle lexika-lische NPn erfolgen wie im Fall von le patron in Beispiel (2b), durch Eigennamen(Luc) oder durch Pronomina. Die Funktion der Eigenschaftsangabe, die in (2c)durch das Adjektiv nouveau markiert wird, stellt einen untergeordneten Teilakt derBenennung dar, bei dem weitere Merkmale zur Identifikation des Referenten an-gegeben werden, die nicht bereits in der Kopfkonstituente patron enthalten sind.
(2) Propositionale Funktionena. Prädikation: Luc critique le patron. Stiftung von Sachverhaltenb. Benennung: Luc critique le patron. Identifikation von Referentenc. Eigenschaftsangabe: Luc critique le nouveau patron. Teilakt der Benennung
Die Spezialisierung der Wortarten auf jeweils eine der genannten Funktionen lässtsich an bestimmten distributionellen (im Wesentlichen morphologischen und syn-taktischen) Eigenschaften ablesen. So manifestiert sich die Affinität der Wortart„Verb“ zur Funktion der Prädikation / Sachverhaltsdarstellung in der Tatsache,dass Verben in der Regel über Valenz verfügen, also über die Fähigkeit, Leerstellenfür Sachverhaltspartizipanten zu eröffnen (in Beispiel (2a) Luc und le patron).Zwar verfügen nicht selten auch Substantive und Adjektive über Valenz, doch istdiese im Falle der Verben, anders als bei Substantiven und Adjektiven, systema-tisch6. Eine weitere morphosyntaktische Besonderheit der Wortart „Verb“ bestehtin der Tatsache, dass Verben stets in Bezug auf Tempus und Modus flektieren (By-bee 2000: 804). Dies bedeutet, dass Verben immer Informationen über den Gradder Gültigkeit des betreffenden Sachverhaltes im Bezug zum Sprechzeitpunkt aus-drücken müssen. Die enge Beziehung der verbalen Flexion zur Prädikatsfunktionwird deutlich, wenn man eine Prädikation wie Luc critique le patron mit ihrer No-minalisierung vergleicht: In la critique de Luc contre le patron wird der betreffendeSachverhalt nicht mehr explizit „gestiftet“ (also prädiziert), sondern er wird be-nannt; seine Prädikation (und damit seine Gültigkeit) ist hier lediglich präsuppo-niert.
Der enge Bezug der Wortart „Substantiv“ zum Akt der Benennung manifes-tiert sich in der Tatsache, dass Substantive in der Regel in Bezug auf die Kategorie
Nominalprädikat versus Eigenschaftskonstruktion 31
6 So gilt für die Aktanten von Substantiven grundsätzlich, dass sie niemals obligatorischrealisiert werden müssen, vgl. la critique de Luc contre son nouveau patron gegenüber lacritique, wo keiner der Aktanten des Substantivs realisiert ist, ohne dass deshalb eine ab-weichende Struktur entsteht. Dagegen müssen Verben, bis auf wenige Ausnahmen, stetsmindestens einen Aktanten (in der Regel als Subjekt), in vielen Fällen auch weitere Mit-spieler obligatorisch realisieren, vgl. Luc critique le nouveau patron vs. *Luc critique oder*critique le nouveau patron bzw. *critique. Zum Zusammenhang zwischen diesen grund-legenden syntaktischen Eigenschaften der Wortarten Verb und Substantiv und den propo-sitionalen Funktionen der Benennung und der Prädikation vgl. u. a. Detges (2004: 18).
Bereitgestellt von | Universitaetsbibliothek der LMU MuenchenAngemeldet
Heruntergeladen am | 11.03.15 11:02
Numerus und Genus flektieren. Numerus und Genus geben im einfachsten FallInformation über Anzahl (le patron vs. les patrons) und Art (le patron vs. la patronne)der Individuen an, auf die der jeweilige Akt der Benennung sich bezieht. Außer-dem lassen sich Substantive stets durch Determinanten spezifizieren, die u.a. weitereInformationen über die Beziehung des Referenten zum Sprecher (und ggfs. zumHörer) angeben, z. B. über seine Bekanntheit (le patron vs. un patron) oder überseine relative Nähe zum Sprecher (ce patron-là).
Auf den Teilakt der Eigenschaftsangabe sind Adjektive spezialisiert. Der nach-geordnete Charakter dieses Teilaktes spiegelt sich in den morphosyntaktischenEigenschaften der Adjektive wieder, die sich in Numerus und Genus dem Substan-tiv anpassen, das sie jeweils ergänzen.
Aus dem Gesagten ergibt sich, dass Wortarten funktional motivierte Distribu-tionsklassen sind7. Indirekt haben wir eine weitere wichtige Eigenschaft von Wort-arten angesprochen: Nicht alle Mitglieder einer gegebenen Wortart teilen im selbenMaße deren distributionelle Eigenschaften. So gibt es Verben ohne Partizipanten(il neige), Substantive, die ausschließlich im Singular oder nur im Plural auf-treten (l’air, les lunettes), und es gibt Adjektive, die nicht kongruieren (une demi-heure, des souliers marron). Wortarten sind heterogene Distributionsklassen, diesowohl zentrale als auch randständige Mitglieder enthalten. Wortartensystemesind, mit anderen Worten, prototypisch aufgebaut (Knobloch / Schaeder 2000:685).
Wortartensysteme sind nun insofern flexibel, als sie es erlauben, ihre Mitgliederauch in Funktionen eintreten zu lassen, auf die diese jeweils nicht spezialisiertsind. So können beispielsweise Substantive und Adjektive (also Nomina) als Prä-dikate fungieren. Ein solcher markierter Gebrauch erfordert in der Regel jedocheinen gewissen morphosyntaktischen „Mehraufwand“. Im Falle von Substantivenund Adjektiven wird das Eintreten in die Prädikatsfunktion durch eine Kombina-tion mit Kopulaverben (Bsp. 3a, 3b) oder Funktionsverben (Bsp. 3c) markiert.Einfacher gesagt: Kopulaverben und Funktionsverben machen aus Nomina Prädi-kate (Dik 1989: 161 ff., Hengeveld 1992, Detges 1996: 129)8.
(3) a. Kopula + ADJ Marie ist kompetentADJ
b. Kopula + Substantiv Willy ist LegasthenikerN
c. Funktionsverbgefüge Hans gibt ObachtN auf den Türsteher
Eine stärker formulierte Fassung der eben skizzierten Sichtweise könnte lauten:Kopulae und Funktionsverben dienen dazu – und nur dazu –, N und ADJ in Prä-dikate zu verwandeln. Diese Auffassung müsste dann als erwiesen gelten, wennsich zeigen ließe, dass Unterschiede wie die zwischen hungern, hungrig sein undHunger haben wie in (4) rein grammatisch-formaler Art wären – wenn also der ver-
Ulrich Detges32
7 Croft (2000, 2002 und 2005) charakterisiert sie dagegen als Konstruktionen.8 In der Terminologie der Tesnièreschen Translationstheorie (Tesnière 31969: 361 ff.), die
nicht zwischen Wortart und propositionaler Funktion unterscheidet (vgl. Lambertz1991), würde die entsprechende Formulierung lauten: Kopulaverben und Funktionsver-ben machen aus Nomina Verben.
Bereitgestellt von | Universitaetsbibliothek der LMU MuenchenAngemeldet
Heruntergeladen am | 11.03.15 11:02
bale Ausdruck hungern einfach den unmarkierten, d. h. den grammatisch einfachs-ten und „normalsten“ Ausdruck des fraglichen Sachverhaltes darstellte und wenndemgegenüber hungrig sein und Hunger haben dasselbe, freilich in etwas aufwändi-gerer grammatischer Form, bedeuteten. Wie wir später sehen werden, drückt aberhungrig sein eine semantische Nuance aus, die an das syntaktische Schema être Xgebunden ist und die dementsprechend in hungern und Hunger haben fehlt.
(4) Verbale und nominale Prädikate
Verbalprädikate Nominalprädikate
Prädikative ADJ Prädikative Substantive
Paul hungert Paul ist hungrig Paul hat Hunger
Die folgenden Überlegungen liefern Argumente für die bei Croft (2000, 2002,2005) dargelegte Sichtweise, der zufolge Schemata des Typs être X einzelsprach-spezifische, konventionelle Verbindungen aus Form und Inhalt – d. h. Konstruk-tionen – sind, deren Funktion nicht einfach darin besteht, einen propositionalenFunktionswandel des Elements X zu markieren, sondern die darüber hinaus stetseinen bestimmten Inhalt ausdrücken.
3. Funktionsverbgefüge des Typs être Präposition Nomenund verwandte Konstruktionen
Bevor ich die syntaktisch-distributionellen Eigenschaften des Schemas être Xdiskutiere und die Probleme herausarbeite, die dieser Konstruktionstyp für die in2. skizzierte „Standardtheorie“ der Wortarten aufwirft, möchte ich kurz den amwenigsten geläufigen Untertyp dieses Schemas vorstellen, nämlich die Funktions-verbgefüge (FVG) der Form être Präposition Substantiv (im Folgenden être PräpNFVG). Ein Beispiel hierfür wäre etwa être en alerte ‚in Alarmbereitschaft sein‘ mitaspektuellen bzw. valenzverändernden Varianten wie z. B. rester en alerte, mettreqn. en alerte und tenir qn. en alerte (zu dieser Art der Variantenbildung s. Detges1996: 7 f.).
Generell bestehen FVG aus einem Funktionsverb und einem prädikativen No-men (vgl. dazu Detges 2008). Im besonderen Fall der FVG des Typs être PräpNFVG wird dieses Nomen von einer Präposition regiert (in der Regel en oder de,seltener à 9, sous10 oder sur 11). Das Funktionsverb erfüllt vor allem grammatischeFunktionen. Es ist Träger der Kategorien Person, Tempus und Modus und drücktdaneben insbesondere aspektuelle Informationen aus. Bestimmte Funktionsverben
Nominalprädikat versus Eigenschaftskonstruktion 33
9 Z. B. in être au travail ‚bei der Arbeit sein‘ (vgl. Kotschi / Detges / Cortès 2008, s. v.travail).
10 Z. B. être sous l’influence de ‚unter dem Einfluss stehen von‘ (vgl. Kotschi / Detges / Cor-tès 2008, s. v. influence).
11 Z. B. être sur le départ ‚sich im Aufbruch befinden‘ (vgl. Kotschi / Detges / Cortès 2008,s. v. départ).
Bereitgestellt von | Universitaetsbibliothek der LMU MuenchenAngemeldet
Heruntergeladen am | 11.03.15 11:02
wie mettre oder tenir dienen zudem der Kausativierung von Sachverhalten (vgl.mettre qn. en alerte ‚jem. in Alarmbereitschaft versetzen‘ vs. être en alerte ‚sich inAlarmbereitschaft befinden‘). Träger der konzeptuellen Bedeutung des gesamtenkomplexen Prädikates ist das Nomen, das durch das Funktionsverb in die Funk-tion eines Prädikativs eingesetzt wird. Formal unterscheiden sich Verbindungenaus Funktionsverb und prädikativem Nomen von Sequenzen aus Vollverb unddessen Aktanten dadurch, dass Aktanten mithilfe des Vollverbs erfragt bzw. pro-nominalisiert werden können (vgl. 5a)12, während prädikative Nomina (bzw. Se-quenzen aus Präpositionen und Nomina) in der Regel keinerlei Erfragung oderAnaphorisierung zulassen (vgl. 5b)13:
(5) a. Peter gab dem Türsteher Trinkgeld, Maria gab ihm keines.b. Peter gab Obacht auf den Türsteher, *aber Maria gab sie nicht / gab keine.
Eine wichtige Ausnahme von dieser Regel stellen nun gerade die FVG des Typsêtre Präp N (und ihre deutschen Entsprechungen) dar, denn sie bieten die Mög-lichkeit, die Konstituente Präp N durch die Pro-Form le (bzw. im Deutschen durches) zu anaphorisieren14:
Allerdings ist die genus- und numerusinvariable Pro-Form le (ebenso wie ihredeutsche Entsprechung es) hier kein Indikator für einen Aktantenstatus dererfragten Konstituente15; vielmehr handelt es sich um einen „Pseudoaktanten“(Koch 1981: 189), der im Gegenteil die Prädikatsfunktion der anaphorisierten Se-quenz indiziert. Dies ist offenkundig in Fällen, in denen die durch le / les anapho-risierten Konstituenten ganz eindeutig Prädikatsstatus besitzen, wie dies etwa imFranzösischen und im Deutschen beim Vorgangspassiv (im Folgenden als VOPAabgekürzt) der Fall ist:
(7) Si la majorité est battue, elle le sera par elle-même. (Le Monde 20.6.87: 6)‚Wenn die Mehrheitsfraktion geschlagen wird, so wird sie es durch eigene Schuld.‘
Die Funktionsverbgefüge des Typs être Präp NFVG stellen einen in vieler Hinsichtheterogenen Konstruktionstyp dar. Zunächst einmal ist das Schema als solchesvoll produktiv, was die relativ große Zahl an ad hoc gebildeten, semantisch trans-parenten Konstruktionen erklärt. Wenn man z. B. weiß, dass augmentation ‚An-stieg, Erhöhung (von Löhnen / Preisen / Mieten usw.)‘ bedeutet, dann ist klar, dass
Ulrich Detges34
12 Waltereit (2008: 270).13 S. aber Detges (1996: 23), Gaatone (1981: 67).14 Zu weiteren Eigenschaften s. Detges (1996: 4–19).15 Dagegen lassen Funktionsverbgefüge des hier interessierenden Typs – anders als Sequen-
zen aus Vollverb und lokalem Aktant – niemals eine Anaphorisierung durch y ‚dort‘ zu:*La police est en alerte et les pompiers y sont aussi.
(6) La police est en alerte, et les pompiers le sont aussi.
,Die Polizei ist in Alarmbereitschaft, und die Feuerwehr ist es auch.‘
▼
Bereitgestellt von | Universitaetsbibliothek der LMU MuenchenAngemeldet
Heruntergeladen am | 11.03.15 11:02
être en augmentation bedeutet, dass ‚(Löhne / Preise / Mieten) sich im Anstiegbefinden‘. Ähnlich lässt sich die Bedeutung des eher seltenen être en débâcle ausder Konstruktionsbedeutung von être Präp NFVG einerseits sowie aus der lexikali-schen Einzelbedeutung von débâcle ‚Zusammenbruch (einer Institution)‘ anderer-seits erschließen.
(8) Typ 1: voll produktives Schemaa. être en augmentation ,sich im Anstieg befinden‘ ← augmentation ,Anstieg‘b. être en débâcle ,zusammenbrechen‘ ← débâcle ,Zusammenbruch‘
Seltener als der voll produktive Typ 1 sind idiomatisierte être Präp NFVG, die sichdiachronisch auf Ausdrücke des Typs 1 zurückführen lassen und deshalb oft auchsynchronisch durch Ausdrücke des Typs 1 motiviert sind. Beispiele für diesen Fallsind être en souffrance ‚(Rechnung) unerledigt sein‘ und être en train1 ‚gut aufge-legt sein, gute Laune haben‘, in denen die lexikalische Bedeutung des prädikativenNomens einen Wandel durchlaufen hat.
(9) Typ 2a: idiomatische Ausdrücke, die auf FVG des Typs 1 zurückgehena. être en souffrance ‚(Rechnung) unerledigt sein‘ (< souffrance ,Leiden, Qual‘)b. être en train1 ,gut aufgelegt sein‘ (< train ‚Gangart, Schwung‘)
Ein weiterer Typ von être Präp N ist dadurch charakterisiert, dass er, wie die Kon-struktionen des Typs 2a, über eine idiomatische Bedeutung verfügt. Im Gegensatzzu den Konstruktionen des Typs 2a lässt er sich jedoch diachronisch nicht auf êtrePräp NFVG des Typs 1 zurückführen, sondern auf Verb-Aktanten-Konstruktionen,in denen être ursprünglich ein örtliches Befinden ausdrückt. Ein einfaches Beispielfür diesen Fall ist être dans la lune ‚zerstreut sein, nicht bei der Sache sein‘, dasdiachronisch auf eine Verb-Aktanten-Verbindung des örtlichen Befindens in derBedeutung ‚sich auf dem Mond befinden‘ zurückgeht. Die Grenzziehung zwi-schen dieser Gruppe und dem Typ 2a ist in vielen Fällen aufgrund rein synchroni-scher Kriterien schwierig. Während bei den beiden Beispielen in (10) unmittelbarevident ist, dass sie durch Konstruktionen aus être als Vollverb des örtlichenBefindens und einer Lokalergänzung motiviert sind, sind Grenzfälle wie etwa nepas être dans son assiette ‚nicht recht in Stimmung sein‘16 für den Sprachbenutzeroft schwer entscheidbar. Für eine Klassifikation solcher Konstruktionen ist hierder Umstand maßgeblich, dass selbst relativ mühelos motivierbare Fügungen wieêtre dans la lune ‚zerstreut sein, nicht bei der Sache sein‘ oder être dans les eaux dequelqu’un ‚unter jemandes Einfluss stehen‘ als Folge ihrer Idiomatisierung diesel-ben syntaktisch-distributionellen Eigenschaften besitzen wie die FVG der Typen 1und 2a (vgl. Detges 1996: 255 f.). Obwohl es sich also diachronisch gesehen beidieser Gruppe um etwas Anderes handelt als um FVG, weisen die Ausdrücke, diesie enthält, ähnliche synchrone Eigenschaften auf wie „echte“ FVG.
Nominalprädikat versus Eigenschaftskonstruktion 35
16 Die wörtliche Bedeutung von assiette, die dieser phraseologisch festen Fügung zugrundeliegt, lautet nicht ‚Teller‘, sondern ‚(Sitz-)Position, Haltung‘ (Kotschi / Detges / Cortès2009, s.v. assiette).
Bereitgestellt von | Universitaetsbibliothek der LMU MuenchenAngemeldet
Heruntergeladen am | 11.03.15 11:02
(10) Typ 2b: idiomatische Ausdrücke, die auf Verb-Aktanten-Konstruktionen zurückgehena. être dans la lune ‚unkonzentriert, zerstreut sein‘ (< lune ‚Mond‘)b. être dans les eaux de qn. ,unter jds. Einfluss stehen‘ (< eaux pl. ,Kielwasser‘)
Eine weitere Sondergruppe, die für die weitere Argumentation von zentralerBedeutung sein wird, stellen verbale Periphrasen dar, die aus FVG der Gruppen 1oder 2a oder aus idiomatischen Ausdrücken der Gruppe 2b hervorgegangen sind.Meistens haben diese Periphrasen modale Bedeutung, wie être en état de faire qc.,être en position de faire qc., être en situation de faire qc. oder être à même de faireqc. (alle ‚in der Lage sein, etwas zu tun‘), oder es handelt sich um Aspektperiphra-sen, wie im Falle von être en train de faire qc. ‚dabei sein, etw. zu tun‘, être en voiede faire qc. ‚dabei sein, etwas zu tun‘, être en passe de faire qc. ‚auf dem Wege sein,etwas zu tun‘ oder être sur le point de faire qc. ‚kurz davor stehen / gerade dabeisein, etwas zu tun‘17. Die Besonderheit dieser Konstruktionen besteht darin, dasssie nur zusammen mit infiniten Verben komplette Prädikatsausdrücke bilden. Spe-ziell für die Aspektperiphrasen des Typs être en train de faire qc. gilt, dass dieKonstituente être Präp N semantisch-konzeptuell und syntaktisch unselbständigist und der aspektuellen Modifizierung des jeweiligen infiniten Verbs dient.
(11) Typ 3: diachronisch aus Typ 1, 2a oder 2b hervorgegangene Aspektperiphrasen a. être en train2 de faire qc. ,dabei sein, etw. zu tun‘ (< train ‚Gangart‘)b. être sur le point de faire qc. ,dabei / davor sein, etw. zu tun‘ (< point ‚Punkt‘)
Die Aspektperiphrasen des Typs 3 machen nun ein theoretisches Dilemma deut-lich, das in den folgenden Abschnitten im Mittelpunkt stehen wird. Einerseitsscheint es sich hier um eine Unterklasse des Konstruktionstyps être X zu han-deln18. Diesen Konstruktionstyp haben wir den Nominalprädikaten (in dem inAbschnitt 2 definierten Sinn) zugewiesen. Andererseits stellen nun aber grammati-kalisierte Aspektperiphrasen des Typs être en train de faire qc. oder être sur le pointde faire qc. periphere Formen des verbalen Flexionsparadigmas dar. Wichtigernoch als die Frage, ob es sich bei diesen Konstruktionen um verbale oder nomi-nale Prädikate handelt, ist das Problem, anhand welcher Kriterien sich diese Frageentscheiden lässt. Dieser letztere Gesichtspunkt soll im folgenden Abschnitt disku-tiert werden.
4. FVG der Form être Präp NFVG und andere Nominalprädikate
Eine wichtige distributionelle Eigenschaft, welche alle in Abschnitt 3 genann-ten Konstruktionstypen, also auch die Periphrasen, und hier insbesondere dieAspektperiphrasen des Typs être en train de faire, teilen, ist die Möglichkeit, dieKonstituente Präp N einschließlich aller von ihr dependenten weiteren Elementedurch den pro-prädikativen „Pseudoaktanten“ le zu ersetzen, der seinerseits durchêtre gestützt wird:
Ulrich Detges36
17 Noch komplexere Konstruktionen wie etwa être en cours de N (z. B. in le nouveau modèleest en cours de fabrication) wollen wir im Folgenden unberücksichtigt lassen.
18 Wie wir jedoch in den Abschnitten 5 und 6 sehen werden, ist dies nicht so.
Bereitgestellt von | Universitaetsbibliothek der LMU MuenchenAngemeldet
Heruntergeladen am | 11.03.15 11:02
(12) Luc est en train de rouspéter, mais Max ne l’est pas. PERI,Luc ist dabei zu meckern, aber Max ist es nicht.‘
Wie wir bereits weiter oben in Beispiel (6) gesehen haben, das hier der Einfachheithalber wiederholt wird, betrifft diese Eigenschaft im Französischen auch das Vor-gangspassiv19:
(6) Si la majorité est battue, elle le sera par elle-même. (Le Monde 20.6.87: 6)‚Wenn die Mehrheitsfraktion geschlagen wird, so wird sie es durch eigene Schuld.‘
Weitere Nominalprädikate, die sich durch l’être ‚es sein‘ anaphorisieren lassen,sind Prädikate der Form être Adjektiv (ADJ), être Substantiv (N) sowie das Zu-standspassiv (ZUPA)20:
Das Kriterium der Anaphorisierbarkeit durch l’être ist diejenige distributionelleEigenschaft, welche die être X (im Französischen repräsentiert durch die Kon-struktionen être Adjektiv (ADJ), être Substantiv (N), être Präposition Substantiv(FVG), être en train de faire qc. und ähnliche Periphrasen (PERI) sowie durch dasZustands- und das Vorgangspassiv (ZUPA bzw. VOPA)) insgesamt definiert. Die-ser Schluss ist das erste Ergebnis unserer Analyse (vgl. Tab. 1).
Dieser Befund wirft nun aber ein Problem auf, das wir am Ende des letztenAbschnittes bereits angesprochen haben: Mindestens drei Untertypen des Sche-mas être X, nämlich die Aspektperiphrase, das Zustandspassiv und das Vorgangs-passiv (die wir hier ja vorläufig alle den Nominalprädikaten zugerechnet haben),lassen sich mit mindestens derselben Berechtigung als Verbalprädikate kategori-sieren:
Nominalprädikat versus Eigenschaftskonstruktion 37
19 Dies verhält sich im Deutschen anders, wo die verbale Konstituente des Vorgangspassivsja werden lautet.
20 Das Kriterium der Anaphorisierbarkeit durch l’être ist übrigens auch bei Konstruktionender Art être dans la lune (Typ. 2b in Abschnitt 3) erfüllt.
sympathique ‚sympathisch‘ ADJ(13) Max est professeur ‚Lehrer‘ N
déçu ‚enttäuscht‘ ZUPA
… mais Luc ne l’est pas,… aber Luc ist es nicht.‘
Tab. 1: Distributionelle Eigenschaften von être X.
ADJ N FVG PERI ZUPA VOPA
l’être ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Bereitgestellt von | Universitaetsbibliothek der LMU MuenchenAngemeldet
Heruntergeladen am | 11.03.15 11:02
Diese Übersicht zeigt, dass Wortarten (und Wortartengrenzen) nicht sozusagen„von selbst“ hervortreten, sondern das Resultat theoretischer Abstraktion sind.Wie wir in Abschnitt 2 bereits festgehalten haben, besitzen Wortarten ein Zentrumund eine Peripherie. Die Darstellung (14) zeigt nun, dass der Konstruktionstypêtre X zu den Peripherien der Wortarten „Nomen“ und „Verb“ quer liegt. Dieswirft die Frage auf, wo genau hier die Grenze zwischen beiden Wortarten verläuftund mit welchen Kriterien sie sich bestimmen lässt. Außerdem stellt sich die Frage,ob der Konstruktionstyp être X, der ja selbst eine Abstraktion aus verschiedenenkonkreten Konstruktionen ist, über ein Zentrum und eine Peripherie verfügt. Mitanderen Worten: Gibt es unter den in Tab. 1 aufgeführten Konstruktionen solche,die typischer für das Schema être X sind neben solchen, die eher untypisch sind?Ferner haben wir in Abschnitt 2 festgehalten, dass Wortarten funktional moti-vierte Distributionsklassen sind. Aus dieser Bestimmung lässt sich die Frage ablei-ten, ob die Konstruktion être X ihrerseits nicht auch durch eine bestimmte Funk-tion motiviert ist. Zur Klärung dieser Fragen sollen im Folgenden weitere distri-butionelle Eigenschaften der Konstruktionen des Typs être X dargestellt werden;dabei wird sich zeigen, dass nicht alle Untertypen dieser Konstruktion die jeweili-gen Eigenschaften teilen.
5. Weitere distributionelle Eigenschaften der Konstruktionen des Typs être X
Für die Homogenität des Konstruktionstyps être X spricht der Umstand, dasssich Mitglieder fast aller Unterkonstruktionen miteinander koordinieren lassen.
5.1. Koordination
Das folgende Beispiel, das einem echten Text entnommen ist, belegt die Koor-dination eines Adjektivprädikats, eines Zustandspassivs und eines Funktionsverb-gefüges21. Im Fall von être dépassé ist schwer zu entscheiden, ob hier tatsächlich(noch) ein Zustandspassiv oder (schon) ein Adjektivprädikat vorliegt:
(15) Comme Noah l’avant-veille, Boris Becker était groggyADJ, dépasséZUPA, en retard surFVG
les balles, contraint ZUPA à la faute. (Le Monde 7./8.6.1987: 8)
Ulrich Detges38
21 Zum Folgenden vgl. auch Detges (1996: 134), Danlos (1980: 54 ff., 1981: 60, 1988: 23 f.).
(14) Konstruktionen des Typs être X – Nominal- oder Verbalprädikate?a. sympathique ‚sympathisch‘
b. professeur ‚Lehrer‘
Max est c. en rage ,in Wut‘
☞ d. en train de rouspéter ,am meckern‘
☞ e. déçu ‚ist enttäuscht‘
☞ f. battu ,wirdgeschlagen‘
ADJN
FVG
PERI
ZUPA
VOPA
NO
MIN
AL
VE
RB
AL
Bereitgestellt von | Universitaetsbibliothek der LMU MuenchenAngemeldet
Heruntergeladen am | 11.03.15 11:02
,Wie Noah zwei Tage vorher, war Boris Becker groggy, überfordert, zu spät am Ball, zuFehlern (geradezu) gezwungen.‘
Wie das folgende (konstruierte) Beispiel zeigt, lässt sich diese Analyse auch auf dieAspektperiphrase ausweiten, die sich ebenfalls mit Adjektivprädikaten (ebenso wiemit dem Zustandspassiv und den Funktionsverbgefügen des Typs être Präp NFVG)koordinieren lässt:
(15a) Boris était groggyADJ et en train dePERI s’endormir.,Boris war groggyADJ und amPERI einschlafen.‘
Einzig im Falle des Vorgangspassivs ist eine Koordination ausgeschlossen. Beispiel(16) ist nur in dem Maße akzeptabel, wie sich être critiqué nicht als Vorgangs-,sondern als Zustandspassiv interpretieren lässt:
(16) ?Son comportement est scandaleuxADJ et critiquéVOPA par tout le monde.?,Sein Verhalten ist skandalösADJ und von allen kritisiertVOPA.‘
Als vorläufiges Fazit dieses Untersuchungsschrittes können wir also das folgendeResultat festhalten:
Wie ist nun dieses Ergebnis, insbesondere die Sonderrolle des Vorgangspassivs, zuinterpretieren? Miteinander koordinierbar sind offensichtlich nur Unterkonstruk-tionen von être X, welche Zustände – genauer: ein ‚X sein‘ – bezeichnen. Das Vor-gangspassiv (il est critiqué ‚er wird kritisiert‘) bezeichnet dagegen Vorgänge. Mitanderen Worten: Bei der Konstituente être des Vorgangspassivs handelt es sich umetwas Anderes als um das être der übrigen être X. Das Vorgangspassiv ist eine for-mal diskontinuierliche verbale Flexionsform, die bloß diachronisch auf den Vor-läufer einer weiteren Subklasse von être X, nämlich ein Zustandspassiv der Formvlt. *essere ‚sein‘ + Part. II, zurückgeht. Während être in den übrigen être X dieRolle einer Zustands-Kopula spielt, handelt es sich bei être im Vorgangspassiv umein Auxiliar (vgl. Thieroff 2007: 176).
5.2. Die double analyse
Die Anaphorisierung der être X durch l’être ‚es sein‘ (s. o., Abschnitt 4) kanngrundsätzlich in zweierlei Form erfolgen: Entweder nimmt die Pro-Form le dasprädikative Element und all seine Komplemente wieder auf (vgl. 17a), oder aberes anaphorisiert allein das prädikative Element und regiert seinerseits eigene Kom-plemente (s. 17b). Diese syntaktische Flexibilität wird im Zusammenhang miteinem bestimmten Typ von Funktionsverbgefügen bei Giry-Schneider (1978, 1987:45 f.) und Gross / Vivès (1986: 12 f.) als double analyse bezeichnet.
Nominalprädikat versus Eigenschaftskonstruktion 39
Tab. 2: Die Koordinierbarkeit der Untertypen von être X.
ADJ N FVG PERI ZUPA VOPA
Koordination ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ *
Bereitgestellt von | Universitaetsbibliothek der LMU MuenchenAngemeldet
Heruntergeladen am | 11.03.15 11:02
Die übrigen Subklassen von être X teilen nun größtenteils diese Eigenschaft (vgl.18–20), ein Umstand, dessen theoretische Implikationen bei Gunnarson (1983,1986) und Detges (1996: 72–82) diskutiert werden. Aus Platzgründen habe ich in(18), (19) und (20) jeweils nur die syntaktisch „aufwändigere“ Variante aufgeführt,also den Fall, dass le eigene Komplemente regiert.
(18) être NMax est très amiN avec Marie, et Luc l’est avec Paul.‚Max ist gut Freund mit Maria, und Luc ist es mit Paul.‘
(19) ZUPACe serveur est bien protégéZUPA des virus mais il ne l’est pas des attaques directes.,Dieser Server ist gut gegen Viren geschützt, aber er ist es nicht gegen direkte Angriffe.‘
(20) VOPASi la majorité est battue, elle le sera par elle-même. (Le Monde 20.6.87: 6)‚Wenn die Mehrheitsfraktion geschlagen wird, so wird sie es durch eigene Schuld.‘
Die einzige Subklasse der être X, welche diese Möglichkeit ausschließt, ist dieAspektperiphrase:
(21) *PERIMax est en trainPERI de laver la vaisselle, * et Marie l’est de faire les courses.,Max ist dabei, das Geschirr zu spülen, *und Marie ist es, Einkäufe zu machen.‘
Das Resultat der Diskussion ist in Tab. 3 festgehalten.
Wie lässt sich nun die Unverträglichkeit der Aspektperiphrase mit der double ana-lyse interpretieren? Offensichtlich ist im „Normalfall“ das Element X in der Lage,alleine Komplemente zu regieren, vgl. ami avec qn., protégé de qc., battu par qn.Dagegen ist in être en train de V das verbale Element V kein Komplement von entrain de, sondern stellt seinerseits den Prädikatskern dar. Dies hängt ursächlichdamit zusammen, dass en train de ein nur mehr grammatisches Funktionselementohne semantisch-konzeptuelle Bedeutung ist, das selbst keine Komplemente re-giert. Aus diesem Grund ist auch sein „Stellvertreter“ le in (21) nicht in der Lage,
Ulrich Detges40
Tab. 3: Die Untertypen der être X und die double analyse.
ADJ N FVG PERI ZUPA VOPA
double analyse ✓ ✓ ✓ * ✓ ✓
(17) Die double analyse bei être ADJa. Luc est contentADJ d ’avoir gagné, et Max l’est aussi.
,Luc ist stolz darauf, gewonnen zu haben, Max ist es auch.‘
b. Luc est contentADJ d’avoir gagné, et Max l’est de ne pas avoir perdu.
,Luc ist stolz darauf, gewonnen zu haben, Max ist es darauf, nicht verloren zu haben.‘
▼
▼
Bereitgestellt von | Universitaetsbibliothek der LMU MuenchenAngemeldet
Heruntergeladen am | 11.03.15 11:02
Komplemente zu regieren. Einfacher gesagt: Die Unverträglichkeit der Verbalperi-phrase mit der double analyse resultiert daraus, dass être en train de V ein verbalesPrädikat ist.
5.3. Gradierbarkeit durch très ,sehr‘
Für die Verwendung der Gradpartikel très existieren im FranzösischenBeschränkungen, die wesentlich stärker sind als die für dt. sehr. Im Gegensatz zusehr (vgl. 22a) ist nämlich très grundsätzlich nicht zur Gradierung verbaler Sach-verhalte geeignet (vgl. 22b). Dieser Umstand wird in traditionellen Darstellungen(Grevisse 1986: § 954) häufig so interpretiert, dass très nur mit Adjektiven kombi-nierbar sei (vgl. 22c), und zwar unabhängig davon, ob das betreffende Adjektivprädikativ wie in (22c) oder attributiv wie in (22d) auftritt22:
(22) a. dt. Diese Arbeit gefällt ihm sehr. Verbb. fr. Ce travail lui plaît {*très; beaucoup}. Verbc. fr. Ce travail est très plaisant. Adjektiv, prädikativd. fr. un travail très plaisant Adjektiv, attributiv
Dass die Auffassung, très verbinde sich nur mit Adjektiven, zu kurz greift, zeigendie Beispiele (23)–(25): Ein großer Teil der Unterkonstruktionen von être X teiltdiese Eigenschaft mit être ADJ23. Wie man aus den b-Beispielen ersehen kann, giltdies auch dann, wenn die betreffenden Unterkonstruktionen (durch Wegfall vonêtre) attributiv verwendet werden.
(23) être Na. Les garçons étaient très fillesN. (Krefeld 1991: 89),Die Jungen waren sehr mädchenhaft [eig. sehr Mädchen].‘b. Des garçons très fillesN
(24) ZUPAa. J’ai également été très déçu par le geste de Zidane. (http://snomelli.free.fr),Ich war ebenfalls sehr enttäuscht über die Geste von Zidane.‘b. Un spectateur très déçu par le geste de Zidane
(25) être Präp NFVG
a. Nos services sont très en demande. (http://www.redcross.ca),Unsere Dienstleistungen sind sehr gefragt [wörtl.: sehr in Nachfrage].‘b. Des services très en demande
Dagegen schließen die beiden Unterkonstruktionen von être X, die wir bisher alsverbal identifiziert haben, très klar aus:
Nominalprädikat versus Eigenschaftskonstruktion 41
22 Allerdings wird bei Grevisse immerhin auf die Möglichkeit verwiesen, bestimmte Nomi-nalprädikate mit très zu erweitern: cela lui fait très peur, il en a très envie usw. (vgl. Gre-visse 1986: § 964).
23 Vgl. dazu Detges (1996: 136), Danlos (1980: 62 ff., 1981: 60, 1988: 23).
Bereitgestellt von | Universitaetsbibliothek der LMU MuenchenAngemeldet
Heruntergeladen am | 11.03.15 11:02
(26) VOPAa. *Le candidat de la majorité a été très battu par son opposant.,Der Kandidat der Mehrheit ist von seinem Opponenten sehr geschlagen worden.‘b. *Un candidat très battu par son opposant
(27) PERIa. *Le candidat de la majorité est très en train d’être battu.,Der Kandidat der Opposition ist sehr dabei, geschlagen zu werden.‘b. *Un candidat très en train d’être battu
Das Ergebnis dieses Tests ist in Tab. 4 festgehalten.
Wie ist nun dieses Ergebnis qualitativ zu interpretieren? Zunächst einmal trenntdieser Test alle verbalen être X außer dem Zustandspassiv, also das Vorgangspas-siv und die Aspektperiphrase, von den nicht-verbalen Unterkonstruktionen êtreADJ, être N, être PRÄP NFVG. Darüber hinaus zeigt sich, dass die traditionelleAuffassung, der zufolge das Vorkommen von très an die Wortart „Adjektiv“gebunden sei, durchaus unzutreffend ist. Wie aus Tab. 4 hervorgeht, lassen sich jaauch être N, être PRÄP NFVG und das Zustandspassiv durch très gradieren. Offen-sichtlich verweisen die strengen Auftretensbeschränkungen, denen très im Franzö-sischen unterworfen ist, nicht auf eine bestimmte Wortart (die Wortart „Adjek-tiv“), sondern très ist der Indikator einer semantischen Funktion. Durch trèskönnen generell nur Eigenschaften gradiert werden, gleich, ob diese ihrem Trägerprädikativ (wie in 23a, 24a und 25a) oder attributiv zugeschrieben werden (wie in23b, 24b und 25b). Damit sind wir nun aber indirekt der semantischen Funktionder être X näher gekommen: Alle Unterkonstruktionen des Schemas être X (mitAusnahme der Aspektperiphrase und des Vorgangspassivs) sind Eigenschaftsprädi-kationen (vgl. in typologischer Perspektive Croft 2002: 92). Diese semantischeFunktion ist die Konstruktionsbedeutung des Schemas être X (ebenso wie die vondt. X sein). Genau dadurch unterscheidet sich beispielsweise dt. Paul ist hungrig,wo dem Subjekt eine Eigenschaft zugeschrieben wird, von Paul hungert, wo dasSubjekt einfach nur als Partizipant eines unspezifizierten Sachverhaltes charakteri-siert wird. Während Paul ist hungrig nur eine einzige Lesart besitzt (nämlich die,dass Paul Träger der Eigenschaft HUNGRIG SEIN ist), ist der verbale Sachver-halt Paul hungert offen für eine ganze Reihe von Interpretationen: Möglicherweiseunterzieht sich Paul absichtlich einer Hungerkur – dann wäre hungern ein Hand-lungs-Verb im Sinne von Koch (1981: 232) – oder Paul hungert aus Not – in die-sem Fall wäre hungern als Nur-Tun-Verb (Koch 1981: 227) kategorisiert. Dieseinterpretative „Elastizität“ ist eine Eigenschaft der Wortart „Verb“ (Koch 1981:248 f., 256 f.), über welche die Eigenschaftsprädikate des Typs X sein / être X auf-grund ihrer festgelegten Konstruktionsbedeutung nicht verfügen.
Ulrich Detges42
Tab. 4: Die Gradierbarkeit der être X durch très.
ADJ N FVG PERI ZUPA VOPA
très ✓ ✓ ✓ * ✓ *
Bereitgestellt von | Universitaetsbibliothek der LMU MuenchenAngemeldet
Heruntergeladen am | 11.03.15 11:02
Aus der Diskussion in diesem Abschnitt lässt sich folgender vorläufiger Schlussziehen: Die zentrale Funktion des Schemas être X ist es nicht, Nicht-Verben inPrädikate zu verwandeln (s. o., Abschnitt 2). Vielmehr ist être X ein Konstruk-tionsschema, dessen Funktion darin besteht, Eigenschaften zu prädizieren. Mitanderen Worten: être X ist eine Konstruktion im Sinne der Konstruktionsgramma-tik (Goldberg 1995, Croft 2002), d. h. die konventionelle Verbindung einer Formêtre X mit einer Bedeutung.
6. Nominalprädikate als Eigenschaftsprädikationen
Nachdem wir in den vorangegangenen Abschnitten die wichtigste Funktionder être X herausgearbeitet haben, können wir uns nun einer weiteren Fragezuwenden: Gibt es einen Untertyp von être X, der als Prototyp dieses Konstruk-tionsschemas betrachtet werden kann, der also in gewisser Weise weniger markiertist als die übrigen Untertypen?
Einer gängigen Auffassung zufolge lassen sich die zentralen Wortarten „Verb“und „Substantiv“ unter dem Gesichtspunkt der (Zeit-)Stabilität unterscheiden(Givón 2001: 51 ff., Bhat 2000): Ein prototypisches Verb bezieht sich unter norma-len Umständen auf Sachverhalte, die keine Stabilität in der Zeit besitzen, etwa(der Chef) spricht, (Maria) gähnt24. Dagegen verweisen prototypische Nomina,etwa (der) Chef, auf zeitstabile Entitäten. Allerdings werden wir gleich sehen,dass der Begriff der „Stabilität“ bzw. „Nicht-Stabilität“ sich auch anders als tem-poral interpretieren lässt.
Givón (2001: 51 ff.) zufolge liegt die Wortart „Adjektiv“ insofern in der Mittezwischen Verb und Nomen, als sie unter dem Gesichtspunkt der Stabilität unmar-kiert ist; Adjektive (gleich, ob sie attributiv oder prädikativ verwendet werden)können grundsätzlich sowohl auf nicht-stabile als auch auf stabile Eigenschaftenverweisen (vgl. 28a, b). Diese prinzipielle Offenheit ist offenbar so charakteristischund relevant für die Wortart „Adjektiv“, dass manche Sprachen zur Prädikationstabiler und nicht-stabiler Eigenschaften unterschiedliche Kopulae vorsehen, wieetwa das Spanische mit ser und estar. Für Verhältnisse wie im Französischen undDeutschen folgt aus dieser Überlegung: Unter den Eigenschaftsprädikaten derForm être X ist die Unterkonstruktion être ADJ der unmarkierte Prototyp, da –wie wir gleich sehen werden – alle anderen Untertypen im Hinblick auf ihre Stabi-lität (oder Nicht-Stabilität) in der einen oder anderen Weise markiert sind.
(28) être ADJ: stabile und nicht-stabile Eigenschaften aller Arta. Pierre est furieux. NICHT-STABILb. Pierre est colérique. STABIL
Zustandspassiva geben per definitionem die Resultate bzw. Nachzustände verbalerHandlungen an; diese Resultate sind aus der vorangehenden Handlung hervorge-
Nominalprädikat versus Eigenschaftskonstruktion 43
24 Es sei denn, eine solche Dauer in der Zeit würde mit zusätzlichen Mitteln, etwa durchbestimmte Zeitadverbien, eigens festgelegt (z. B. der Motor läuft Tag und Nacht).
Bereitgestellt von | Universitaetsbibliothek der LMU MuenchenAngemeldet
Heruntergeladen am | 11.03.15 11:02
gangen und deshalb per definitionem zeitlich beschränkt und damit nicht-stabil25.In anderen Fällen erlaubt das Zustandspassiv zwar die Zuschreibung zeitlichdauerhafter Eigenschaften, doch evoziert es in diesem Fall stets Alternativen. Diesdrückt sich häufig darin aus, dass in solchen Fällen das Partizip durch ein weiteresElement obligatorisch modifiziert werden muss – in (29b) durch à la main, dessenFehlen die Grammatikalität von (29c) fragwürdig macht26. Dieses modifizierendeElement wird stets mit Kontrastfokus betont; dadurch evoziert es eine alternative,im Diskurskontext angelegte Erwartung (vgl. Maienborn 2007: 109), so z. B. in(29b) die Erwartung, dass der betreffende Brief mit der Maschine geschrieben seinkönnte. Diesen impliziten Alternativbezug möchte ich als einen Spezialfall fehlen-der Stabilität interpretieren. In Sprachen wie dem Spanischen würde auch in die-sem Fall stets die auf nicht-stabile Zustände spezialisierte Kopula estar verwendet(vgl. Delbecque 1997).
(29) ZUPA: Nachzustände und evozierte Alternativena. Pierre est enragé. NICHT-STABILb. La lettre était écrite à la main. NICHT-STABILc. ?La lettre était écrite. NICHT-STABIL
Im Gegensatz dazu sind die Verhältnisse bei Eigenschaftsprädikaten der Form êtreN völlig unproblematisch; diese prädizieren grundsätzlich stabile Eigenschaften:
(30) être N: stabile Eigenschaftena. fr. Pierre est hémophile. STABILb. dt. Peter ist Choleriker. STABIL
Bei den Funktionsverbgefügen der Form être Präp NFVG hängt die Frage nachdem stabilen oder nicht-stabilen Charakter der betreffenden Eigenschaft in hohemMaße von der jeweils vorliegenden Präposition ab; Konstruktionen mit der Präpo-sition en verweisen stets auf nicht-stabile Eigenschaften (vgl. Detges 1996: 185),Konstruktionen mit de können dagegen auch auf stabile Eigenschaften verweisen.In (30a) wird im Gegensatz zu (30b) ausgesagt, dass es sich bei dem fraglichenMantel um ein Exemplar handelt, das – im Gegensatz zu anderen denkbarenExemplaren – aus Wolle gefertigt ist. Die Präposition en gibt hier also an, dass zuder fraglichen Eigenschaft des Mantels Alternativen existieren27. Im Spanischenwürde im Fall (30a) in der entsprechenden Konstruktion das auf nicht-stabileZustände spezialisierte Kopulaverb estar verwendet.
Ulrich Detges44
25 Scheinbare Gegenbeispiele wie dt. Peter ist mit wenig Humor ausgestattet widerlegen dieseAuffassung nicht, da sie in der Regel Produkte von Lexikalisierungsprozessen sind. DerAusdruck mit wenig Humor ausgestattet sein ist kein ad-hoc abgeleitetes Zustandspassiveiner aktivischen Konstruktion *jemanden mit wenig Humor ausstatten. Vgl. hierzu auchMaienborn (2007: 87).
26 Es sei denn, man interpretiert den Satz resultativ im Sinne von ‚fertig geschrieben‘. Indiesem Fall denotiert das Zustandspassiv einen zeitlichen Nachzustand.
27 Zum Unterschied zwischen un manteau de laine und un manteau en laine vgl. Tamba-Metz (1983).
Bereitgestellt von | Universitaetsbibliothek der LMU MuenchenAngemeldet
Heruntergeladen am | 11.03.15 11:02
(30) être Präp NFVG: Abhängigkeit von Präpa. Le manteau était en laine. NICHT-STABILb. Le manteau était de laine. STABIL
Die Gegenüberstellung von (30a) und (30b) bedeutet nun keineswegs, dass derKonstruktionstyp être Präp NFVG hinsichtlich der Parameter „momentan“ und„stabil“ im selben Sinne unmarkiert wäre wie der Typ être ADJ. Vielmehr lassensich die Verhältnisse bei den être Präp NFVG derart interpretieren, dass diese wie-derum verschiedene Unterkonstruktionen umfassen – u. a. solche mit der Präposi-tion en und solche mit de –, die in jeweils unterschiedlicher Weise auf die Prädika-tion stabiler oder nicht-stabiler Zustände spezialisiert sind.
Wie die Diskussion in Abschnitt 5 gezeigt hat, sind die Aspektperiphrase unddas Vorgangspassiv keine Eigenschaftsprädikate, sondern periphere grammatika-lische Formen der verbalen Flexion. Aus dieser Überlegung ergibt sich vorläufigfolgende Anordnung aller bisher diskutierten Konstruktionen, bei der der „Proto-typ“ ganz links steht und die weniger prototypischen Eigenschaftsprädikate nachrechts hin aufgereiht sind.
Das Zentrum der Konstruktion être X mit der Funktion ‚Eigenschaftsprädikat‘bildet die Unterkonstruktion être ADJ. Sie repräsentiert gleichsam den unmar-kierten Prototyp der Eigenschaftsprädikate. Die Aspektperiphrase und das Vor-gangspassiv am anderen Ende der Skala teilen mit der Konstruktion être X zwardie Form, aber nicht die Konstruktionsbedeutung ‚Eigenschaftsprädikat‘. Aus derBestimmung, der zufolge Konstruktionen konventionelle Paare aus Form und Be-deutung sind, folgt, dass beide eigene Konstruktionen repräsentieren. Alle anderenUnterkonstruktionen stehen in taxonomischer Relation zu den Eigenschaftsprädi-katen der Form être X, oder einfacher gesagt: Sie sind Subtypen dieser Konstruk-tion.
Wie lässt sich nun das Verhältnis der beiden verbalen Konstruktionen, also derAspektperiphrase und des Vorgangspassivs zu den Eigenschaftsprädikaten be-schreiben?
Obwohl sie selbst keine Eigenschaftsprädikation, sondern eine verbale Kon-struktion darstellt, teilt die Periphrase eine Reihe von Merkmalen mit den Eigen-schaftsprädikaten der Form être X. Die semantische Besonderheit der Aspektperi-
Nominalprädikat versus Eigenschaftskonstruktion 45
Tab. 5: Fazit: Die syntaktischen und semantischen Eigenschaften der être X.
ADJ N ZUPA FVG PERI VOPA
l’être ,es sein‘ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Koordination ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ *
double analyse ✓ ✓ ✓ ✓ * ✓
très, plus ✓ ✓ ✓ ✓ * *
Eigenschaft – + stab – stab + stab/ * *– stab
Bereitgestellt von | Universitaetsbibliothek der LMU MuenchenAngemeldet
Heruntergeladen am | 11.03.15 11:02
phrase wird deutlich, wenn man die verschiedenen Möglichkeiten überprüft, siemittels der Pro-Form le zu anaphorisieren. Anders als die Eigenschaftsprädikatio-nen der Form être X lässt sich die Periphrase nicht allein durch die Pro-Form l’être‚es sein‘ wiederaufnehmen, sondern sie erlaubt, sofern sie mit einem Handlungs-verb auftritt28, auch eine Anaphorisierung durch le faire ‚es tun‘ (vgl. 31a und31b).
Das verbale Prädikat être en train de rouspéter, das in (31a, b) vorliegt, besitzteinen doppelten Charakter. Einerseits handelt es sich um ein verbales Handlungs-prädikat, das dementsprechend durch le faire ‚es tun‘ anaphorisiert werden kann.Die Anaphorisierbarkeit durch le faire ist eine Eigenschaft des Verbs rouspéter, diedieses auch außerhalb eines komplexen Prädikates besitzt (il rouspète, et il le faitdepuis ce matin). Gleichzeitig wird être en train de rouspéter in (31b) aber durch dieAnaphorisierbarkeit per l’être als Zustandsprädikat ausgewiesen. Der Zustands-charakter von être en train de rouspéter wiederum ist eine Eigenschaft von être entrain de. Diese Janusköpfigkeit, die sich in der zweifachen Anaphorisierungsmög-lichkeit äußert (einerseits als Handlungs- oder Vorgangsprädikat29, andererseits –und gleichzeitig – aber auch als Zustandsprädikat), legt die eigentliche Funktiondieser Konstruktion frei: Aspektperiphrasen der Form être en train de V dienendazu, Handlungen oder Vorgänge sekundär als momentane Zustände darzustel-len. In (31a, b) wird beispielsweise über das Subjekt Pierre ausgesagt, dass es sichvorübergehend im Zustand des Meckerns befindet.
Die Theorie der Konstruktionsgrammatik (Goldberg 1995) geht davon aus,dass die Konstruktionen einer Sprache in taxonomischen Beziehungen zueinanderstehen. Solche Relationen äußern sich darin, dass viele Konstruktionen alle, man-che oder auch nur einzelne Eigenschaften anderer, verwandter Konstruktionen„erben“ (Goldberg 1995: 67 ff.). Der Zustandscharakter von être en train de V istnun offensichtlich ein Erbe der Eigenschaftsprädikate être X (mit X = Präp N),deren verschiedene Unterkonstruktionen normalerweise mindestens über eineZustandsstufe (z. B. être en alerte ‚in Alarmbereitschaft sein‘), eine Vorgangsstufe(se mettre en alerte ‚in Alarmbereitschaft treten‘ und eine kausative Handlungs-stufe (mettre qn. en alerte ‚in Alarmbereitschaft versetzen‘) verfügen. Von diesen
Ulrich Detges46
28 Bei Vorgangsverben lautet die entsprechende Pro-Form cela se passer (vgl. Koch 1981:215 f.), z. B. in il est en train de neiger, et cela se passe depuis ce matin. Diese Möglichkeitwollen wir im Folgenden der Einfachheit halber außer Acht lassen.
29 Zu Vorgangsprädikaten vgl. vorige Fußnote.
(31) a. Pierre est en train de rouspéter, et il le fait depuis ce matin.
,Pierre ist am meckern, und das tut er schon seit heute morgen.‘
b. Pierre est en train de rouspéter, et il l’est depuis ce matin.
‚Pierre ist am meckern, und das ist er schon seit heute morgen.‘
▼
▼
Bereitgestellt von | Universitaetsbibliothek der LMU MuenchenAngemeldet
Heruntergeladen am | 11.03.15 11:02
verschiedenen Möglichkeiten erbt die Aspektperiphrase lediglich die Zustands-stufe mit être. Außerdem übernimmt sie insbesondere von den être Präp NFVG mitder Präposition en die Eigenschaft, momentane Zustände zu prädizieren. Genauwie die être Präp NFVG und die übrigen Eigenschaftskonstruktionen être X lässtsich être en train de V darüber hinaus (unter Ausfall von être) als Attribut einesNomens konstruieren (un homme en train de rouspéter). Wie wir in 5.3. an der Un-möglichkeit der Gradierung mit très gesehen haben, lässt sich diese Möglichkeitjedoch nicht als Zuschreibung einer Eigenschaft interpretieren. Mit anderen Wor-ten: Trotz formaler und funktionaler Ähnlichkeiten mit den Eigenschaftsprädika-ten der Form être X ist die Aspektperiphrase grundsätzlich etwas Anderes. Es han-delt sich um eine verbale Konstruktion, die Vorgänge und Handlungen sekundärals momentane Zustände darstellt und diese dem Satzsubjekt zuschreibt – andersals die Eigenschaftsprädikate der Form être X schreibt sie dem Subjekt dadurchaber keinerlei Eigenschaft zu.
Weniger kompliziert sind die Verhältnisse beim Vorgangspassiv, das, wie wirgesehen haben, ebenfalls eine verbale Form ist. Von den Eigenschaftsprädikatender Form être X erbt das Vorgangspassiv lediglich den diskontinuierlichen Bau,d. h. die Eigenschaft, aus être und einem weiteren Element – einem Partizip II – zubestehen, das seinerseits prädikative Funktion besitzt.
Die eben skizzierten synchronen Beziehungen der Eigenschaftsprädikationender Form être X zu den beiden verbalen Konstruktionen (Vorgangspassiv undAspektperiphrase) beruhen ursächlich darauf, dass letztere sich diachronisch (zuunterschiedlichen Zeitpunkten) aus den Eigenschaftsprädikaten entwickelt haben.Der Bedeutungswandel, den sie dabei jeweils durchlaufen haben, betrifft beim Vor-gangspassiv vor allem die Konstituente être, die hier keinen Zustand mehr aus-drückt (s. o., 5.1.), bei der Aspektperiphrase dagegen die Konstituente en train de,das keine Eigenschaft mehr abbildet (s. o., 5.2.)30.
7. Schluss
Wie ich hoffe gezeigt zu haben, repräsentieren Prädikate der Form être ADJ,être N, être Präp NFVG und das Zustandspassiv eine Konstruktion im Sinne vonGoldberg (1995), in der sich eine konventionelle Form être X mit einem konventio-nellen Inhalt, der Eigenschaftsprädikation, verbindet. Das Vorgangspassiv und dieAspektperiphrase, die diesen konventionellen Inhalt nicht teilen, sind keine Unter-konstruktionen der Eigenschaftsprädikation, obwohl sie jeweils gewisse Eigen-schaften mit dieser teilen.
In den Abschnitten 2 und 5.3. habe ich argumentiert, dass Verben unmarkiertePrädikatoren sind, mit denen sich Sachverhalte aller Art darstellen lassen. Wennjedoch ein Sachverhalt als Eigenschaft ausgedrückt werden soll, so geschieht diesmithilfe der speziellen Konstruktion être X. Diese Überlegung erklärt den seman-tischen Unterschied zwischen Paul hungert und der Eigenschaftsprädikation Paul
Nominalprädikat versus Eigenschaftskonstruktion 47
30 Diese Überlegung verdanke ich einer mündlichen Anregung von Peter Koch.
Bereitgestellt von | Universitaetsbibliothek der LMU MuenchenAngemeldet
Heruntergeladen am | 11.03.15 11:02
ist hungrig. Daraus folgt, dass die These, der zufolge Konstruktionen der Formêtre X dazu dienen, Nicht-Verben wie N, ADJ und Präp N in Prädikate zu verwan-deln, zu kurz greift: Die fraglichen Konstruktionen dienen vielmehr in erster Liniedazu, Eigenschaften zu prädizieren. Ohne diese Überlegung bleibt unerklärlich,wieso es das Zustandspassiv gibt, also ein être X mit Partizip II, das ja bereitseinen verbalen Ursprung besitzt. Aus welchem Grund sollte eine ohnehin verbaleForm noch einmal in ein Prädikat verwandelt werden31? Erst der Rekurs auf denInhalt von être X führt zu einer zufrieden stellenden Antwort: Das Partizip II istdiejenige grammatische Form, die einen verbalen Inhalt als (aus dem verbalenSachverhalt resultierende) Eigenschaft darstellt. Entsprechend unterscheidet sichdas Zustandspassiv eines gegebenen Verbs von anderen Formen desselben Verbsdadurch, dass es eine prädikative Zuschreibung dieser Eigenschaft leistet, oder,einfacher gesagt, dadurch, dass es eine Unterkonstruktion der Eigenschaftsprädi-kation darstellt.
München, im Februar 2010
Bibliographie
Bhat, D.N.S. (2000): „Word classes and sentential functions“, in: Petra M. Vogel / BernardComrie (Hrsg.), Approaches to the Typology of Word Classes, Berlin usw.: Mouton / deGruyter, 47–63.
Bybee, Joan (2000): „Verb“, in: Geert Booij (Hrsg.), Morphologie. Ein internationales Hand-buch zur Flexion und Wortbildung, Bd.1, Berlin: de Gruyter, 794–808.
Cattell, Ray (1984): Composite Predicates in English, Sidney: Academic Press.Croft, William (2000): „Parts of speech as language universals and as language-particular
categories“, in: Petra M. Vogel / Bernard Comrie (Hrsg.), Approaches to the Typology ofWord Classes, Berlin usw.: Mouton / de Gruyter, 65–102.
Croft, William (2002): Radical Construction Grammar. Syntactic theory in typological per-spective, Oxford: University Press.
Croft, William (2005): „Logical and typological arguments for Radical Construction Gram-mar“, in: Jan-Ola Östmann / Mirjam Fried (Hrsg.), Construction Grammars. Cognitivegrounding and theoretical extensions, Amsterdam / Philadelphia: Benjamins, 273–314.
Danlos, Laurence (1980): Représentation d’informations linguistiques. Les constructions Nêtre X. Thèse de 3e cycle, Paris: L.A.D.L.
Danlos, Laurence (1981): „La morphosyntaxe des expressions figées“, in: Langages 63,53–73.
Danlos, Laurence (1988): „Les phrases à verbe support être Prép“, in: Langages 90, 23–37.Delbecque, Nicole (1997): „The Spanish Copulas ser and estar“, in: Marjolijn Verspoor /
Kee Dong Lee / Eve Sweetser (Hrsg.), Syntactical Constructions and the Construction ofMeaning, Amsterdam / Philadelphia: Benjamins, 247–270.
Ulrich Detges48
31 Die Antwort auf diese Frage lautet bei Maienborn (2007: 111): Das Zustandspassiv istdie „prädikative Verwendung eines adjektivierten Partizips II“. Aus dem bisher Gesagtendürfte nun aber deutlich geworden sein, dass in Maienborns Sichtweise Wortart (Adjektivbzw. Adjektivierung) und Funktion (Eigenschaftsprädikation) verwechselt werden.
Bereitgestellt von | Universitaetsbibliothek der LMU MuenchenAngemeldet
Heruntergeladen am | 11.03.15 11:02
Detges, Ulrich (1991): „Französische Funktionsverbgefüge vom Typ être PRÄP N. ZumVerhältnis von lexikalischer Kategorie und propositionaler Funktion“, in: Peter Koch /Thomas Krefeld (Hrsg.), Connexiones Romanicae. Dependenz und Valenz in romanischenSprachen, Tübingen: Niemeyer, 253–277.
Detges, Ulrich (1996): Nominalprädikate. Eine valenztheoretische Untersuchung der französi-schen Funktionsverbgefüge des Paradigmas être Präposition Nomen und verwandter Kons-truktionen, Tübingen: Niemeyer.
Detges, Ulrich (2004): „Argument inheritance as a metonymic effect“, in: Metaphorik.de 06,1–30.
Detges, Ulrich (2008): „Funktionsverbgefüge“, in: Ingo Kolboom / Thomas Kotschi / Ed-ward Reichel (Hrsg.), Handbuch Französisch. Sprache – Literatur – Kultur – Gesellschaft.2., verb. Aufl., Berlin: Erich Schmidt, 245–248.
Dik, Simon C. (1989): The Theory of Functional Grammar. Part I: The structure of theclause, Dordrecht: Foris.
Dixon, Robert M.W. (1982): Where Have All the Adjectives Gone? And Other Essays inSemantics and Syntax, Berlin: Mouton.
Eisenberg, Peter (2006): „Funktionsverbgefüge – Über das Verhältnis von Unsinn und Me-thode“, in: Eva Breindl / Lutz Gunkel / Bruno Strecker (Hrsg.), Grammatische Unter-suchungen. Analysen und Reflexionen, Tübingen: Narr, 297–317.
Engelen, Bernhard (1968): „Zum System der Funktionsverbgefüge“, in: Wirkendes Wort 18,289–303.
Gaatone, David (1981): „Les ,locutions verbales‘: pour quoi faire?“, in: RRo 16, 49–73.Giry-Schneider, Jacqueline (1978): „Interprétation aspectuelle des constructions à double
analyse“, in: Linguisticae Investigationes 2, 23–53.Giry-Schneider, Jacqueline (1987): Les prédicats nominaux en français: les phrases simples à
verbe support, Genf: Droz.Givón, Talmy (2001): Syntax: An introduction, Amsterdam: Benjamins.Goldberg, Adele E. (1995): Constructions. A construction grammar approach to argument
structure, Chicago / London: Chicago University Press.Grevisse, Maurice (1986): Le bon usage. Grammaire française. Douzième édition refondue
par André Goosse, Paris: Duculot.Gross, Gaston (2004): „Pour un Bescherelle des prédicats nominaux“, in: Linguisticae Inves-
tigationes 27 (2), 343–358.Gross, Gaston / Vivès, Robert (1986): Syntaxe des noms, Paris: Larousse.Gunnarson, Kjell-Åke (1983): „Dans l’attente d’une solution. Analyse syntaxique d’une
construction prédicative“, in: RRo 18, 3–22.Gunnarson, Kjell-Åke (1986): „Predicative structures and projections of lexical depen-
dencies“, in: Linguistic Inquiry 17, 13–47.Hengeveld, Kees (1992): Non-Verbal Predication. Theory, typology, diachrony, Berlin: Mou-
ton / de Gruyter.Hengeveld, Kees / Rijkhoff, Jan / Siewierska, Anna (2004): „Parts-of-speech systems and
word order“, in: Journal of Linguistics 40, 527–570.Heringer, Hans-Jürgen (1968): Die Opposition von kommen und bringen als Funktionsverben,
Düsseldorf: Schwann.Knobloch, Clemens (1990): „Wortarten und Satzglieder. Theoretische Überlegungen zu
einem alten Problem“, in: Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur(PBB) 112, 173–199.
Knobloch, Clemens (1991): „Bemerkungen zur Nomination und zur Nominalphrase imDeutschen“, in: Z.Phon.Sprachwiss.Kommun.forsch (ZPSK) 44, 80–92.
Knobloch, Clemens / Schaeder, Burkhard (2000): „Kriterien für die Definition von Wort-
Nominalprädikat versus Eigenschaftskonstruktion 49
Bereitgestellt von | Universitaetsbibliothek der LMU MuenchenAngemeldet
Heruntergeladen am | 11.03.15 11:02
arten“, in: Geert Booij (Hrsg.), Morphologie. Ein internationales Handbuch zur Flexionund Wortbildung, Bd. 1, Berlin: de Gruyter, 674–692.
Koch, Peter (1981): Verb, Valenz, Verfügung. Zur Satzsemantik und Valenz französischer Ver-fügungsverben, Heidelberg: Winter.
Kotschi, Thomas / Detges, Ulrich / Cortès, Colette (2009): Wörterbuch französischer Nomi-nalprädikate. Funktionsverbgefüge und feste Syntagmen der Form être Präposition No-men, Tübingen: Narr.
Krefeld, Thomas (1991): „Wörter und ihre (Un-)Arten. Unmarkierte Translationen imFranzösischen“, in: Peter Koch / Thomas Krefeld (Hrsg.), Connexiones Romanicae.Dependenz und Valenz in romanischen Sprachen, Tübingen: Niemeyer, 81–106.
Lambertz, Thomas (1991): „Kritische Anmerkungen zu Tesnières Translationstheorie“, in:Peter Koch / Thomas Krefeld (Hrsg.), Connexiones Romanicae. Dependenz und Valenz inromanischen Sprachen, Tübingen: Niemeyer, 53–79.
Luuk, Erkki (2009): „The noun / verb and predicate / argument structures“, in: Lingua 119,1707–1727.
Lyons, John (1991): „Towards a notional theory of the ,parts of speech‘“, in: ders. (Hrsg.),Natural Language and Universal Grammar: Essays in Linguistic Theory, Bd. 1, Cam-bridge: Cambridge University Press, 110–145.
Maienborn, Claudia (2007): „Das Zustandspassiv: Grammatische Einordnung – Bildungs-beschränkung – Interpretationsspielraum“, in: ZGL 35, 84–116.
Persson, Ingemar (1975): Das System der kausativen Funktionsverbgefüge. Eine semantisch-syntaktische Analyse einiger verwandter Konstruktionen, Lund: Glerup.
Polenz, Peter von (1987): „Funktionsverben, Funktionsverbgefüge und Verwandtes: Vor-schläge zur satzsemantischen Lexikographie“, in: ZGL 15, 169–189.
Pustet, Regina (2003): Copulas: Universals in the Categorization of the Lexicon, Oxford: Ox-ford University Press.
Tamba-Metz, Irène (1983): „La composante référentielle dans un manteau de laine et unmanteau en laine“, in: LFr 57, 119–128.
Tesnière, Lucien (31969): Eléments de syntaxe structurale, Paris: Klincksieck.Thieroff, Rolf (2007): „Sein. Kopula, Passiv- und / oder Tempus-Auxiliar?“, in: Ljudmila
Geist / Björn Rothstein (Hrsg.), Kopulaverben und Kopulasätze: innersprachliche undintrasprachliche Aspekte, Tübingen: Niemeyer, 165–180.
Van Pottelberge, Jeroen (2001): Verbonominale Konstruktionen, Funktionsverbgefüge. VomSinn und Unsinn eines Untersuchungsgegenstandes, Heidelberg: Winter.
Waltereit, Richard (2008): „Verb, Valenz, Satzbaupläne“, in: Ingo Kolboom / Thomas Kot-schi / Edward Reichel (Hrsg.), Handbuch Französisch. Sprache – Literatur – Kultur – Ge-sellschaft. 2., verb. Aufl., Berlin: Erich Schmidt, 267–274.
Werner, Otmar (1975): „Zum Problem der Wortarten“, in: Ulrich Engel / Paul Grebe(Hrsg.), Sprachsystem und Sprachgebrauch, Teil 2, Düsseldorf: Schwann, 432–471.
Wunderli, Peter (1989): Französische Lexikologie. Einführung in Theorie und Geschichte desfranzösischen Wortschatzes, Tübingen: Niemeyer.
Ulrich Detges50
Bereitgestellt von | Universitaetsbibliothek der LMU MuenchenAngemeldet
Heruntergeladen am | 11.03.15 11:02