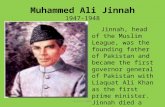Maria erscheint in Sievernich. Plausibilitätsbedingungen eines katholischen Wunders, in: Wunder....
Transcript of Maria erscheint in Sievernich. Plausibilitätsbedingungen eines katholischen Wunders, in: Wunder....
Mchr Wunder als im 20. Jahrhundcrr gab cs nie, dcnn ubcrkommcnc Wundcrvorsrcllungcn bcsrandcn fort, wahrerid sich in Naturwissenschaften und Technik. Politik und Wirtschaft ganzlich neue Wunderwelten eraffneten. Als ErkHirungcn ungewohn1icher Ercignisse und Erfahrungen reduzierten Wundcrzuschreibungcn Kompicxirac, cnrfalrctcn aber auch ihre ganz eigenen Dynamikcn. Die Bcitragc dicscs Bandcs analysiercn den Umgang mit ciner Vicl7.ahl wundcrhaftcr Bcgcbcnhciten def Zcitgeschichte und kni.ipfen aus unrcrsch icd lichcn dk.liplinarcn Pcrspcktiven an Debactcn tiber die Wicdcrvcr/.aubcrung def Welt, die Grcnzen mcnschlichcr Erkenntnis und die Episrcmologicn des Obcrsinnlichcn an. Enrfalrct wird cin ungewohnlichcs Panorama dcr unmirtclbarcn Vorgcschichtc unscrcr wundcrsamen Gcgenwart.
Alexander C. T. Geppert Ieitet die Emmy-Noether.Nachwuchsgruppe .. Die Zukunft in den Stemen: Europaischcr Astrofmurismus und auBcrirdisches Lcben im 20. Jahrhundew( am Fricdrich-Meineckc-Insrirur der Frcien Universi(3.r Bcrlin. Till Kassler ist Wissenschafdicher Assistent an det Abteilung fur Neueste Gcschichrc und Zcirgcschichrc dcr Ludwig-Maximilians-Universitat Mi.inchcn.
Wunder Poetik und Politik des Staunens
im 20. Jahrhundert
Herausgegeben von Alexander C. T Geppert
und Till Kassler
Suhrkamp
20il
Helmut Zander Maria erscheint in Sievernich.
Plausibilirarsbedingungen eines karholischen Wunders
Hans Waldcnfcls zurn 80. Gcburtstag
1. Maria, Wunder, Sievernich
In den Jahren 2002 bis 2005 »erschien« Maria in der Voreifel. Ort des Geschehens: Sievernich, ein kleines Dorf mit etwa 460 Einwohnern. 30 km sudwestlich von Koln. Mariens Medium: die »Seherin« Manuela Strack, zu Beginn der Erscheinungen im »jesuanischen« Alter von 33 Jahren. Damit hatte auch das 21. Jahrhundert sein Marienwunder, und es wird nicht das letzte gewesen sein . Seitdem pi lgern am ersten Montag eines jeden Monats Menschen in die katholische pfarrkirche von Sievernich, urn im Gedenken an diese Mariencrschcinungen und in Erwartung weircrer Wunder zu beten. 2004 wuiden bei jedem Gebetstreffen durchschnitdich 400 Personen gezahlL'
Fur die Glaubigen ist Sievernich ein gleich in mehrfacher Hinsicht wundetbarer Ort: Die Erscheinung Mariens gilt ihnen als ein nachweisbares Ereign is, LInd das »Versprechen( clef Gottesmutter, »immer in Sicvernich anwesend zu sein«, nehmen sie als Zusage, dass sich die Wunder mit dem Ende der Erscheinungen nicht ver-
Vgl. (www.sicvcrnich.culinformationcn/pun .htm>, ic[ztcr Zugrilf 04.01.2010.
Dicsc Z:lhl wurdc in def Loblprcssc bcstatigr. Bci mcincm cigcncn Bcsuch am 0 1. 02.. 2elO warcn. bci allcrdings dr:l.Inatischcn wimcrl ichcn Srr:l.Rcnvcrhaltnisscn, weniger :tIs 200 Tcilnchmcr anwcscnd; die Zahl wurde von allen Tcilnehmern als auBcrgcwohnlich gering bctrachtct. An cincm Montag ohne anschlicBendc Eucharislic am 10. oS. 20 IC waren ::tllcrdings nur c.1.. 40 Pcrsoncn anwcscnd. Bci den ers[en Erschci nungen sollen zwischen 2000 und 4000 Mcnschcn gc:-.a.hl t worden se in, so Mich::tcl M:mi. »Ma ri::t crscheim um 18 Uhr 20i'. in: Nmt Ziircher Zt'iwng
mn Sonntag (15.12.2002), S.79. W:-i.hrend der Icc7.tcn Erschcinung im Okmbcr 2005 seicn 2000 Menschcn ::tnwcscnd gcwcscn; vgl. Peter Schilder, »Wundcr niche :lusgcsch lossen. Die Wegc def Sehcrin Manueb im Eifcldorf Sicvcrnich blcibcn wundcrlich«, in: Frt111kfitrtcr Aligandm ZcitlWg (09. 10. 2002), S. 9.
146
lieren werden' Und so erwarten sie weitere Wunder: Heilungen. Diese erhofft man an einem Wasserheiligtum, einem Brunnen, der auf GeheilS Manuela Stracks, die sich wiederum auf eine Mitteilung Marias berief. im August 2008 hinter dem Pfarrhaus abgeteuft wurde. Denn "die Gottesmuttet wunscht in Sievernich einen Immaculata-Brunnen zur Linderung der Leiden«' Deshalb wird im Eaten van Sievernich, dem Mitteilungsblatt det dortigen marianischen Anhanger, dazu aufgerufen, "Heilungen oder arztlich belegte gesundheitliche Besserungen« zu melden.' Und erste Heilungen hatten sich beteits ereignet, schrieb Frau Strack dem Papst 2004' Die Zeit der Wunder ist fur die Matienverehrer und -verehrerinnen von Sievernich gerade erst angebrochen.
Wer jeczt an alte Traditionen denkt, an die Thaumaturgen der Antike oder an friihmittelalterliche Wunderheilungen oder an die Visionen der Brigitta von Schweden im '4. Jaluhundert, muss einen Gang zuruckschalten. Fur den H istoriket liegen die entscheidenden Wurzeln dieser Marienerscheinungen im 19. Jahrhundert. Und man vetsteht die Wunderberichte von Sievernich nut, wenn man sie im Zusammenhang der Religionsgeschichte dieses so religionsproduktiven vorletzten Jahrhunderts liest, dessen lange Schlagschatten bis ins 21. Jahrhundert reichen. Seit den 1830er Jahten gibt es einen neuen, bis -heute virulenten Typus der Marienfrommigkeit, dessen Karriere am Beginn des 21. Jahrhunderts ungebrochen ist: Matien"erscheinungen«, bei denen Maria physisch oder zumindest wie physisch zugegen ist. Immerhin konnte man diese Erseheinungen in Kontinuitat zu alteren Marienwundern sehen, etwa der seit der Spatantike nachweisbarcn Vorstellung der Aufnahme Matiens in den Himmel ("Mariae Entschlafung«) oder der im 15. Jahrhundert eingefuhrten Verehrung des Geburrshauses Mariens, das durch einen Engel von Nazareth nach Loreto (Marken/Italien) transloziert worden sei. Doch wenn man cine Brillc mit schirferen hermeneutischen Linsen aufsetzt, wird klar, dass wir in den Marienerscheinungen einer der grolSen Innovationen der jungetell europaischen Religionsgeschichte gegenuberstehen.
2 Vgl. (vlW\Y.sicycrnich.cu). IC(7.tcr Zugriff 04.01. 2010.
1 Ebd. 4 (w\vw.sicvcrnich.cuflnfobl:ur/aktucll_Infobbrt.pdf). le C7.ter Zugriff 04. 01. 2010.
5 Brief von Manuda Strack an Papse Benedikt XVI., in: Martin Muller (Hg.), Alit'
Nationtn TUft ich z u mir! Dit' Botschafim von Sit'llanich. Bd. 2, Kisslegg 2005, S. I5.
'47
Diese Erseheinungen wurden seir del' Mitte des 19. Jahrhunderrs auBerordenrlieh popular, fan den bis heure aber nur begrenzr ihren Weg in die hegemoniale TIleologie und verblieben in einer Grauzone zwischen universirarer Theologie und popularer Frommigkeit. Weil die fur die Normierung der Marienrheologie und der Sreuerung der Frommigkeirspraxis veranrworrliehen professionellen Deurer, die karholisehen TIleologen, niehr deren Iniriaroren waren , konnren sie bei fasr allen Erseheinungen nur naehrraglieh die (De-)Legirimierung und die Regulierung del' Praxis vornehmen. Allerdings isr die Sache insofern komplizierrer, als die Auseinanderserwng um die Deurung die TIleologie inrern in Gegner und Befurworrer spaltere. Die per saldo berrachrliche Disranz der marianischen Erseheinungsfrommigkeir wr akademisehen Theologie hatte zur Folge, dass in der popularen Marienverehrung ein objekrivisriseher Wunderbegriff srark blieb, in den anrinaruralisrisehe Relarivierungen und subjekrbezogene PlaLlsibilisierungen der akademisehen Theologie nur beschrankr Eingang fanden und finden' Die Offenheir fur religiose Phanomene, die nichr unmirrelbar von der Bibel gedeckr waren, blieb in der auBeruniversiraren karholischen Weir hoeh, auch fur quasi korperliche Marienerscheinungen. D iese begrenzre Konrrolle der Universirarsrheologie war wohl cine Bedingung der weiren Verbreirung von Marienerscheinungen. Dadurch enrwickelren sich illl 20 . Jahrhunderr Spannungen zwischen den Marienwundern und dem Mainstream der karholischen TIleologie, die sich neu an der Bibel orientierre. Zugleich aber fand cin ncutcsran1cndichcs Element, das in den Kirchen spates tens mit dem Gang durch die Aufklarung an den Rand gedrangr wld im (Neu-)Proresranrismus reilweise aueh eliminierr worden war, einen neuen Orr: Wunderheilungen. In diesem Feld waren die Marienerscheinungen ein eharaluerisrisch karholisches Phanomen. Aus groBerer D isranz betrachrend siehr man, dass die Marienwunder damir auf der Grenze zwischen biblischer und allgemeiner Religionsgeschichre sranden und die weir uber die Grenzen des Chrisrenrums hinausreichenden Erseheinungsphanomene in den Karholizismus hineinholren.
Fur die folgcndcn Dberlcgungcn isr enrscheidend, dass sich die Maricnerscheinungcn mit diesen Verbindungcn zu untcrschicd-
6 Lorraine: Dasmn, Peter Galison, Objccliv;ty. New York 2007 (dt.: Objcktivitiit.
rrankfurt/M. 2007)·
148
Heilen rel igiosen Feldern prazlse in der Religionsgeschichre des 19· Jallfhunderrs veronen lassen. Insofern bilden die Weichensrellungen des 19. Jallfhunderrs das Disposiriv der Marienwunder des 20. Jallfhunderrs. Jedoch wird bei den Einzelheiren der Marienerscheinungen - von den Bezugen auf das Zweire Varikanische Konzil bis zur AulWerrung der Rolle Manuela Stracks als Offenbarungsrragerin - deurlich werden, wo im 20. JaIlrhunderr ganz eigene Alczenre geserzt wurden . Die Marienwunder besirzen damit einen spezifiseilen sozialen Plausibilitatsindex und sind, enrgegen der Selbsrwallrnehmung ihrer Tragergruppen, kein »objektives«, sondern ein kulturrelarives Phanomen. Wunder erlebr auch in Sievernieh nur, wer bereir ist, in diesem (karholischen) Konrexr zu glauben. Anders gesagr: Wunder gibr es aueh in Sievernich nur in gedeuteren Konrexren, nichr als auronomen Texr.
2. Historische Kontexre Die Marienerscheinungen des 19. Jahrhunderrs
Die Marienfrommigkeir isr nach ihrer rheologischen Legirimarion im Konzil von Ephesos im JaIlr 43', wo Maria als theotokos (Gorresgebarerin) definien wurde,' zu einem der viralsren Frommigkeirsbereiche des Chrisrenrums geworden. Bezeichnenderweise war der in Ephesos verhandelre Gegensrand die Chrisrologie und die Marienrheologie nur ein Nebenschauplarz, doch enrwickelre sich die Mariologie von diesem Ausgangspunkr her relariv eigensrandig, sowohl als dogmarischer Topos wie als praxis pietatis. Diese Verselbsrandigung hat viele Grunde: Maria war cine weibliche Idenrifikationsfigur fur Frauen wie fi.ir Manner, galr als menschliche und nalle Person gegenuber einem absrrakr gedachren und fernen Gott und beforderre die Feminisierung einer mannlichen Gottesvorsrellung. All diese Morive lassen sich noch in Sievernich finden.
Signifikanr fur die Marienverehrung im 20. Jallfhundert sind jedoch verandene Frommigkeitsformen, die im 19. JaIlrhunderr enrstanden. Seir den 1830er Jallren kam es zu einer groBen ZaIll von Marienerscheinungen (pdizise ware im Folgenden immer zu
7 Heinrich Den2.inger, Peter Hiincrmann, Enchiridion symboforum dp,nilionum el dulararionum de rebusfidci et morum, Frciburg im Brcisgau )92001, Nr. 251, S. 431 .
'49
sagcn : zu Bcrichtcn von Mariencrscheinungcn),8 mit - nach cincm bislang noch kaum erforschten Vorlauf' - innovativen Elementen: So ctwa crschien Maria haufig Kindem, die Obermittlung einer Botschaft wurde zu einem cntscheidenden und massiv verstarkten Strukturmcrkmal, vor allcm abcr bm es zu einer Materialisierung, einer nachgerade haptischen Physikalisierung der Erscheinung, indem Maria von cinem inneren Bild zu einem aulleren Phanomen wurde. Aufgrund dieser materiellen "Objektivierung" lassen sich die Mariencrscheinungen in cinen spezifischen Plausibilitatsrahmen des 19 . Jahrhundens stellen, der sic erst als Wunder denkbar, »erschcinbar« werden licK
Die ganz liberwiegendc Zahl dieser neuen Erscheinungen, die wahrend des 19. und Anfang des 20. Jaluhunderrs im katholischen Europa aus dem Boden schossen und cine eigene marianische Landkarte in Europa bildeten, wurde kirchlich nicht anerkannr. Von den wcnigcn ancrkannten Erscheinungsoftcn erhielten vier cine uberregionale Bedeutung: 1O
8 1m Oberblick Kbus Schreiner, Maria. }ungfrall, MlittU. H~rT1chcrin, Munchen u.:t. 1994. Zu den Erscheinungen lex ikaJisch (wenngleich komparaciscisch schwach) Monika H:tuf, Marim~T1chdmmgm. Hintagriindc dncJ Phiinom~m. Dusseldorf 2006; zur Vorgeschichte siehe :tuch David Blackbourn. »)O ie von dcr Gottheic i.ibcraus bevorz.ugccn Magdleinl. Maricnerscheinungen im Bisma.rckreich«. in: Irmcraud. Gocz von Olcnhuscn (Hg.), Wtmdubflr~ ErJchcinungm.
Fmflcn lind knrholischc Friimmigkcit im 19. lind 20.}l1hrlmntkrt, Paderborn u. a. 1995, 5.171-20 1. hier S. Il' f. Grundlcgend Rir aile theologischen Fragen in der deutschsprachigen Liter:Hur: Wolfgang Beinert (Hg.), /-/andbuch d~r Mari~nl.:un
dc, 2. Bde., Regellsburg 2'996/97, und: Remigius Baumer u. a. (Hg.), MarimIcxikon, 6 Ede., St. Otti li ell '988-1994 (mit st5rker rr:l.dirionaler Ausriehtung). Seh r vic! Material zu Maricnerschcinungcn. a1lerd ings fast unbertihrt von hiscorisch·krilischer Qudlcnanalyse. bet Gottfried Hienenbergcr, Ono Nedomansky, ErJchtinungm und BOlSchaften dcr Gotmmuuer Maria, Augsburg 1993; [eilweisc zuruckgrcifend auf die historisch cbenfalls unkrirische Marerialsammlung von Robert Ernst, uxikon d~r MarieneT1cheimmgcn [1 1949]. AJlotting 1989. Zur spannungsvol len Illterferenz zwischcn univcrsitarer und popularcr Thcologie vgl. aus ganz anderer mari enhistorischer Perspektivc Chrisriane Schafer, "Wund~T1chjjn priichtig~f( G~chichte dnCJ Mllrimlied~, Tubingen 2006.
9 Vennud ich begannen wichrige ncuerc Elllwicklungen mit der Marienvision von GuaddoupclMcxiko im Jah r '531. Fromrnigkcitsgcschichrlich sind die Transform::uionen der Maricnfrommigkcit in der Gcgenrcformation/Katholischen Reform und im Barock von hoher Bedeutung.
10 AJlgemeine Information en in der in Anm.S gcnanncen Licerarur. Eine Arbeic iibr.:r Lourdes. die in ihrcll sozialsrrukturdlcn Analyscn auch auf andere Marien-
15 0
1. 1830, Paris, Rue du Bac. .Eine Ordensfrau, die 24-jahrige Vinzentinerin Catherine Laboure, hatte in ihrem Kloster Erscheinungserlebnisse. Sic sah eine Frau auf einer Kugel stehen, unter ihren Fullen eine Schlange, Bilder aus der Ikonografie der apokaIyptischen Maria. Sie liell sich den Visionen Laboures .zufolge als Mittlerin von Gnadengaben darstellen; dies rekurriert auf cine seit dem Mittclalter gefiihrte Debatte urn Maria als Mediatrix gratiarum, a1s Gnadenmittlerin . Maria habe angeordnet, uber einzelne Mitteilungen Stillschweigen zu bewahren und scWielllich den Auf trag erteilt, cine Medaille zu pragen, die in ihrer Umschrift die Theologie von Maria als Immaculata, als unbeAeckt empfangener Jungfrau, propagierte. Dieser Anhanger fand im 19. Jahrhundert cine sehr weite Verbreitung (Abb. pl.
2. 1846, La Salette (Frankreich/nalle Grenoble). Hier sahen die knapp 15-jahrige Melanie Calvat und der e1fjahrige Ma..ximin Giraud eine Gestalt in einem Lichtkranz, die belle dame, die von Theologen als Maria identifiziert wurde. Sie habe von den Kindem cine regelmallige Frommigkeitspraxis gefordert, etwa die Einhaltung des Verbots zu Auchen, und die Verbreitung ihrer Mitteilungen. Wiederum habe sie geheime Botschaften iibermittelr, deren Inhal t die Kinder nicht preisgeben soli ten. Mit La Salette ist auch ein Quellwunder verbunden: am Erscheinungsort entspringe seitdem eine Quelle.
3· 1858, Lourdes (Frankreich/Pyrenaen). Die 14-jahrige Bernadette Soubirous berichtete von Erscheinungen einer Frau in einer Hohle, die sie "Aquer6« ("das da«) nanme und die ein weilles Klcid mit blauem Giirtel getragen habe. Spater wurde die Erscheinung von Theologen als Maria idenrifiziert. Die Frau fordere Bulle, gebe sich als die Unbefleckte Empfangnis zu erkennen und habe angewiesen, aus der in der Hohle nun neu enrspringenden Quelle zu trinken. Bernadette wurde Nonne, starb jedoch bereits im Alter von 35 Jahren . Die Borschaften, die sie erhalten habe, hat sie trorz des Drangens ihrer geisdichen Begleiter nicht offentlich gemacht. Noch wahrend der Erscheinungen sollen sich Heilungen ereignet haben. Lourdes wurde schnell zu einem bevorzugten Ort fur er-
erschcinungcn iibertragcn werden kann, stammt von Patrick Donddinger, Die
ViJiollen dcr Bernadette Sal/biram und da Beginn der Wtmderhcilungen in Lourdes, Regensburg 2003; zu F:itima siehe Mon iquc Scheer, ROJmkranz und KricgJviJiJon~n. Marien~T1cbcimmgskult~ im 20. }ahrlmndert, Tubingcn 2006.
r 5 r
Abb. J.l: Medaille dec in dec Rue du Bac crschienenen Maria nach den Angaben von Catharine Laboure (undaricne Pragung)
wartete Wunderhei lungen, wo ein Stab von Arzten uber die Authentizitat der Heilungen entschied, deren Kriterien unter Pius X., Papst von 1903 bis 1914, festgelegt wurden (rel igiose Begrundung dcr Heilung, unheilbare Krankheit, Heilung nicht in einer kritischen Phase, in der die Heilung erwartbar war, Ausschluss der Wirkung von Medikamenten, plotzliche, dauerhafte und vollstandige Heilung).
4. 1917, Fatima (Portugal) . Die zehnjahrige Lucia dos Santos, der neunjahrige Francisco Marto und dessen siebenjahrige Schwester Jacinta hatten im Sommer die Erscheinung einer »schonen Frau«, die sieh als Maria von der Unbefleekten Empfangnis zu erkennen gegeben und Suhneleistungen, Rosenkranzgebet sowie die Weihe Russlands an Maria gefordert habe, urn Unheil zu verhindern. Tm Laufe der Erschein ungen im Sommer und Herbst 1917 versammelten sich sehlieBlich Tausende von Menschen an der Erscheinungsstelle und behaupteten, Naturwunder (Schnee im September, eine rotierende und springende Sonne) edebt zu haben. Als Postulantin und schlieBlich als Nonne habe Lucia 1925 und 1929 wei tere
152
Erscheinungen gehabt. Einige Botschaften, die sie geheim hiclt, wurden erst im Jallr 2000 der bffentlichkeit zuganglich gemacht.
Diese Erscheinungen teilen wichtige Charakteristika mit der westeuropaischen Religionsgeschichte des 19. Jahrhunderts: 11 Sie feminisicrten die Religion, namentlich in der Zuweisung religioser Empfindsamkcit an Frauen in einem Zeitaltcr der patriarchalen Steucrung von Religion. Sodann funktionieren sie mit neuen, haufig paranormal anmutenden Kommunikationsformen, die im 19. Jaluhundert nicht nur als abseitig oder pamologiseh ausgegrenzt wurden, sondern auch als dania cri einer sich vor den Naturwissenschaften veran twortenden religiosen Praxis gelten konnten. Weiterhin dokumemieren Marienerseheinungen ein neues, massenmediales Zeitalter der Religion. Die in MiJlionenaufiage gepragte Medaille der Catherine Laboure und die nach Hunderttausenden zahlenden Pilgerstrome zu den Wallfahrtsorten stehen Mobilisierungsformen nahe, wie es sie moglicherweise zuletzt im Spatmittelalter und im 16. Jahrhundert gegeben harte. SchlieBlich macht ein Komext kiar, dass die Marienerscheinungen auch in die politisehe Gesehichte des 19. Jahrhunderts gehoren: Marienwallfahrten gerieten in den Sog des Nationalismus, trotz der Transnationalitat der kamolischen Kirche. Wie »franzosisch« Lourdes sei und ob es auch »deutsche« Marienerscheinungen gebe, war ein konAikttrachtiger Gegenstand. Theologisch dominierte in der Deutung der Erscheinungen die Vorstellung der Immaculata, zu def weitere Themen rreten konnten, etwa eine mystische Hefzensspiritualitat (Paris) oder apokalyptische Prophetien (La Salette). In sozialhistorischer Perspektive ist aufF:illig, dass Menschen aus nie-
I I Zur Narionalisierung im Spannungsfdd von Deutschland und Frankreich siche Andre3S J. Kocu11a, Naeh Lourdes! Du franzOsisc/u MaricllwallfohrlJort und dic Ivuholikcn im Dcutsc!un Kaiscrrcieh (1871-1914), Miinchen 2006, und David Blackbourn, Marpingcn. Apparitions 0/ thc Virgill Mary in Bismarekian GermallY, Oxford 1993 (de.: ~lln ihr sic scht. fragt wer sic sci. Maricnuscheimmgcn in Mtlrpingcn. Allfitieg und Niedergang des dcutschen Lourdes, Rcinbck bci Hamburg 1997. erweitcrte Ausg.: Marpingen. Dos deutschc Lourdes dcr Bismarckzcit. Saarbriicken ~2007). Es gab allerdings auch die aminacionale Perspckrivc, C1:Wa bci clem Mainz.er Bischof von Ketteier, der hofFtc. dureh Marienc:rseheinungc:n worden die »schroff gerrcnncen Nationen wieder vcreinigrIC; ziriert naeh: Michael Prosser, IIRaumll, in: Michael Pammer (Hg.), Handbuch der Rcligionsgeschichtc im dClftschspraehigcn Raum. Sd.5: I750-1900. Paderborn u.:t. zo07, S.319-334, hier 5·323·
153
deren Bildungsschichten oder mit niedrigein Sozialptestige die Ma, ricncrscheinungcll nurzten, urn ihre soziale Position zu verbessern und ihrc Frolnmigkeit zu lcgitimicren.
Fiir die Wunderthematik sind wissensehaftshistorische Konrexte , naherhin Tendenzen ciner Objekcivicrung dec Erscheinungen, von besonderem Interesse, denn im Hinccrgrund dieser Wunder stand die Erfolgsgeschichte der Naturwissenschaften und ihrer technischen Umsetzung im 19. Jahrhundert. Ihre Epistemologie eincr subjektfreien Objektivitat lZ iibte einen immensen Druck aueh auf kulrurelle Lebenswelten aus, nicht zuletzt auf die Theologie und die gelebre Frommigkeit. In diesem Horizonr lassen sich Marienerscheinungen als Versuehe der empirisehen Objektivierung religioser Erfahrungen Iesen, die so verlasslich sein soli ten wie die Messergebnisse der Physiker. Begriffsgeschichrlich kann man diese Auscinandcrsetzung an den Termini »Visio111( und »Erscheinung« nachvoUzichcn . Der innercn »Visiol1« wurde zunehrnend die aulSere Erscheinung (apparition) zur Seite oder enrgegengestell t. In Lourdes [iihrte die Auseinandersetzung um diese Terminologie zu einem bezeichnenden Dissens, da Bernadene Soubirous von Visionen sprach, wahrend lokale Pciester (gegen andere Theologen) die Terminologie »Erscheinung« praferierten und durchsetzten.13 Matienphanomene wurden fiir die Glaubigen, verkiirzt gesagt, von inncren Erfaluungen zu auBeren Erscheinungen und damit von subjektiven Gewissheiten zu objektiven Sicherheiten.
Nun sind handgreiBich-plausible Wunder keine Erlindung des 19. Jahrhunderrs, sondern Teil einer katholischen Tradition, die Welt der Heiligen mit der irdischen Welt zu verbinden . Die Maria,
12 D:lston, Galison. Objectivity, umcrschcidcn drci Phascn def Konstruktion von Objcktivir;tr. die mit cler new science scit der Friihcn Ncuzeir enrstehc: Einc Phase im IS. Jahrhunden, in der es um die Nawrwahrhcit gehe. in cler das Typische das Merkmal von Objektivil;tr sci. dann die Phase cler mechanischen Objcklivirar, die ohne die »Einmischung« des Subjekrs [unktioniere, und cine akwelle Phase, in cler Objekrives nur mit Hilfe eLnes geschulrcn Uneils wahrnehmbar sci. Ma· rienerseheinungen rallen dabci in die Phase der :unbitioniertcsren Auspragung des mechanisehcn Objcktividitsdenkcns. Die Implamicrung hcrmeneurischer DetLtungsmusrer in Objektivitamheoreme. die Daston und Galison fUr cine sparere Emwicklung haleen , trifh aHcrdings gerade rur die rheologischen Ob· jektivitarsdebatten niche zu. wo subjektive Dimcnsionen durch den Druck der
univcrsirarcn Thcologic immcr prasclH waren. I} Dondclinger. Die Visiol1en dcr Bernadette Soubirous. S. 102.
154
die dem Generalprior der Karmeliten, Simon Srock, 1251 ein Skapulier iiberreicht haben soli, oder die in der Friihen Neuzeit hauligen Marienbilder, die Tranen weinen, gehoren in diesen materiellen Dbergangsbereieh von irdischer und h immlischer Welt. Aber die Marienerscheinungen des 19. Jahrhunderts markieren gleichwohl ein neues Feld: Sic beantworten die Frage naeh der Realitat des Jenseits. und damit des Himmels. Sic reagierten damit auf eine bemerkenswerte Innovation, denn der Begriff »Jenseits« wurde erst am Ende des 18. Jahrhunderts in der deutschen Sprache kreierr. l < Fiir den Begriffshistoriker ist klar, dass neue Begriffe neue kulturelIe Problemlagen indizieren. Und so steht auch hinter der Erlindung des Substantivs »Jenseits« eine tief greifende Veranderung der Kosmologie. Der neue Begriff antwortete auf den Ersatz des metaphysischen Himmels durch den physikalisch analysierbaren Himmel in der Friihen Neuzeir. In diesem Prozess war der Himmel von einer gotrlichen zu einer physikalischen Sphare geworden, der der Metaphysik entzogene Himmel wurde als Jenseits neu konsrruiert. D ieses Jenseits benotigte und erhielt neue Evidenzen: objektive Erscheinungen aus dem Jenseits. 15 Hier liegen auch die Wurzeln der Sievernicher Marienerscheinung.
Derartige Erscheinungen galten im spateren 19. Jahrhundert auch in anderen SegmenteI1 der wesrliehen Religionsgeschichte als Beweise einer jenseitigen Welt, etwa iIn Spiritism us, wo man gewisse Erscheinungen ebenfalls als empirischen Beleg fiir die Existenz des Jenseits ansah. Allerdings linden sieh bei den Marienwundern die Tendenzen einer eindimensionalen Vernaturwissenschafrlichung wie etwa bei den spiritistischen Materialisationen, die in der zweiten HaIfte des 19. Jahrhunderts Karriere machten, nicht. Vermutlich war dies cine Foige des EinBusses der Theologen, die in einem komplexen Wechselspiel mit den laikalen Medien eine subjektive Zustimmung, den Glauben, einforderten. Aber den Anspruch auf eine subjektiv eingefarbte Objektivitat gab es auch, und das maeht die Sache bei den Medien, die Maria zum Greifen nahe
l4 Lucian Holscher (Hg.), Dos J~nseits. Facctten eincs religioun BcgrifJs in dcr Ncuzeit. Goccingcn 2007 .
15 Helmur Zander, IIH6hcrc Erkcnntnis. Die Erfindung des Fernrohrs und die Konscrukeion crwcitcrrer Wa11fnehmungsf.ihigkeitcn zwischen dem 17. und clem 2o.Ja.hrhundcrtcc, in: Marcus Hahn, Erhard Scbiictpelz (Hg.), Tranccmedit:n u!1d
neue Medien um I900. Ein andcrcr BLick auf die Modeme. Bielefeld 2009. S. 17·55.
I 5 5
sahen, kompliziert. Denn Marienerscheinungen hane eben nichr jeder, sie blieben insofern subjektiv, wahrend die Wirkungen, erwa die Wunderheilungen, im Prinzip objektiv sein soli ten. Die darin liegende Ambivalenz, wiederholbare Empirizitat und einmalige Erfahrung als Wunder der Erscheinung zu verschmelzen, hat die Marienfrommigkeit des 19. und zo. Jallfhunderts nie verloren.
Die (universitare) ReRexionstheologie hane in den 1830er Jahren, als sich die Marienerscheinungen zu verb rei ten begannen, die intellekruelle Auseinandersetzung urn die dal1intersrehenden erkennmistheoretischen Probleme in der Kirchengeschichte nicht zum ersten Mal hinter sich: Mit der Auseinandersetzung um Subjekrivitat und Objektivitat in der Debatte um »Fideismus« und "Rationalismus« im fruhen 19. Jal1thundert lag diese Debatte gerade hinter der katholischen Theologie. In Lehrentscheidungen hane die romische Theologie Mine der 1830er Jahre extreme Positionen des Subjektivismus und Objektivismus ausgegrenzt: den Fideismus als anti rationale Glaubensvergewisserung und den Rationalismus, der auf die unabgegrenzten Anspruche der Erklarung theologischer Gegenstande insbesondere durch die Philosophie (erwa im Hennesianismus der 18zoer und 1830er ]omre) und die Naturwissenschaften ziclte.'G Diese Rationalismuskritik liell sich im Prinzip kritisch gegenuber Marienerscheinungen lesen, denn diese beanspruchten - in dominicrendcn Variancen ihrcr popularen Rezeption -, jcnseitigc Wirkungen objektiv, also wic in den Naturwissenschaften, zu dokumentieren . Da die Erscheinungen wie beobachtbare Narurphanomene sichtbar und nachweisbar sein sollten, fielen sie im Prinzip unter das Verdikt des Rationalismus.
In dieser Tradition stehend, Theologie in einer M ine zwischen extremcn Positioncn zu bccrcibcn , verweigerte der Mainstream der akademischen 1heologie die objektivistische Vereindeutigung der Marienerscheinung, weil sie an dem Anspruch festhielt, das Wunder auch als subjektive Erfahrung zu bestimmen. Vermudich wird in der popularen Rezeption der Marienerscheinungen dieser theologische Spannungsbogen nicht gehalten worden sein, denn bei den Marienverehrern war gerade die naturwissenschafdiche Evidenz attral<tiv, und genau in diesem Punkt trafen sie auf den prinzipiellen (wenngleich auch elastisch formulierten), aber schwer
16 Dcnzingcr, Hlincrm:'1nn, Enchiridion rymb%rum, c:[Wa N r. 2751 (5. 1840) und
Nr.27J8 (5. ,835).
15 6
durchsetzbaren Widerstand der kirchlich approbierten Reflexionstheologie.17
Der hohe Stellenwert subjektiver Zustimmung zu Wundern bei der Mehrhei t der Theologen ging auf Oberlegungen zuruck, die in die Antike zuruckreichen, aber fur das 19. Jal1thundert in der mittelalterlichen Scholastik als gi.i.ltig formuliert galten . 1homas von Aquin beispielsweise, der im 19. Jal1thundert zur zentralen Referenz der Neuscholastik aufstieg, hatte Wunder als Zeichensystem gottlichen Wirkens gedeutet, die vor dem mentalen Hintergrund eines jeden Menschen eine je unterschiedliche Plausibilitiit entfalten: "SO wundert sich der Bauer uber die Sonnenfinsternis, nicht aber der Sternkundige.«18 Jeder Mensch erfahre also sein eigenes Wunder. Objektive Wunder, die den Menschen zur Einsicht in die Existenz Gottes zwingen wurden, lehnte Thomas abo Marienerscheinungen (oder die mit ihnen verbundenen Heilungswunder) als eine Art narurwissenschafdicher Gottesbeweis waren damit inkompatibel.
Die theologische Debatte im Umfe1d der Marienerscheinungen war insofern nochmals komplexer, als diese subjektbezogene Theologie innertheologische Gegner hatte, die in einer »supranaturalistischen« Theologie eben die Obj~krivitiit zu verankern such ten, welche auch die Marienerscheinungen versprachen. Zudem waren d ie 1heologen, die den Supranaturalismus abschwiichen wollten, in ihren Moglichkeiten beschrankt, bei Laien eine 111eologie der Gewissheit gegenuber den Erwartungen von Objekrivitat zu implementieren. Die Millionen von Menschen, die erwa nach Lourdes pilgerten, waren in der Frage, ob sie das dortige Erscheinungswunder und die Wunderheilungen als subjektive Zurechnung oder als objektive Ereignisse betrachteten, nur begrenzt zu beeinRussen. Zudem gab es innertheologische Bremsen gegen eine allzu rigide Disziplinierung der laikalen Frommigkeit, da der semus fide/ium einschlieillich der spirituellen Praxis der Glaubigen als eigene theologische Erkenntnisquelle galt. Diese offene Grenze zwischen praktizierter Spirirualitat und hegemonialer (und in sich pluraler) theologischer ReRexion lasst sich an den Heilungswundern erwa von Lourdes gut illustrieren: 19 Sie wurden, sofern man sie kirchlich
17 Dondelingcr. Die Visionm der Bant1.detu SoubirottJ. S. 64-154. 18 1l1omas von Aquin, Summa d~ thea/agia, art. 7, q. 105, ad 3 (= die deutsche 1110·
mas;;tusgabe. Bd. 8, Heidelberg u. a. 1951, S. 67 f.). 19 Dieser Zustand offcncr Grenz.cn ist kennz.eichncnd fUr potenziclt aporctischc Di·
157
anerkannrc. nicht als Wunder, sondern in einer Variante ncgativcr 1heologie als »unerkhrliche« Phanomene qual iliziert - was viele Glaubige (und Theologen) nicht davon abhielt, darin iibernatiirl iche, objektive Wunder zu sehen. Auch insofern fanden die Marienwunder des 19. Jahrhunderts in einer Grauzone zwischen theologischer Reflexion und popularer Praxis statt.
Mariencrschcinungen wurdcn in dicscm Inrerferenzfcld von Naturwissenschaften und katholischer Theologie zu einem wichtigcn wissenschafts- und ideengesch ichdichen Exempcl fiir diejenige nichthegemoniale Spiritualitatsgeschichte des 19. und 20. Jallfhundefts, die empirische NatUrwissenschaft und religiose Erfahrungen miteinander zu verb inden suehte. Sie beansprucllte wohl als Erste, (auch) objektive Belege fiir die Existenz des Jenseits und fiir das Eingreifen einer iibernatiidichen Welt durch materialisierende Erscheinungen zu bieten. D ie Auseinandersetzung mit dem entstehonden Spiritismus um die Deutung der Marienerscheinungen stand denn auch bald auf der Tagesordnung und ist bereits in den 1840er JalUCIl greifbar: Marienerseheinungen als katholischer Spiritismus sozusagen .20 H isrorisch kommt man hier in ein komplcxes Feld von Wechselwirkungen. Sp;ritisten formulierten zwar analoge Anspriiche, begannen damit jedoch erst einige Jahre spater und sind vermudich in wichtigen Aspekten von den Marienerscheinungen abhangig. Beide Entwicklungen gehoren in ein Feld von Erscheinungsphanomenen des spaten 18.Jahrhunderts,21 die wie-
mcnsioncn clCf (nclIZcirl ichcn) katholischcn Thcologie. Ein promincnres Beispiel ist cler exp!i7.ire Vcr.:icht auf ei ne Entschcidu ng im naclueformatorischcn Gna~ denstreic zwischen den span ischen jcsuiten und den Ib.ndrischcn Augllsrinisrcn.
20 Donddingcr. Dir Visiol1m der Banaduu Soubirous, S. 81 f. Zu der in den 1850cr Jahrcn :lUfbrcchcndcn Faszination unter Katholi kcn lind der amtskirchli chen Ablchnung vgl. Jo hn Warne Monroe, Laboratories of Fai/h. Mcsmuism, Spiritism, flnd OCCllftisni in lv/odem France. Ithaca, NY 2008. S. 23~37. In den Dokumcntcn 7.lI L1 S;l !crre ist die exp!i7.it :uHispiritistische Argumenr:uion seit sparestens Ende cler 1840er Jahre bclegt; vgl. (www.marienerscheinungen.netlu_Salene.htm), IClzrcr Zugriff c6. 08. 2010. Der spiritistische Hype begann nach den Ereignisscn im amerikan ischen Hydesville 1848, hanc aber sowohl in Frankreich als auch in den USA eine noch wenig auFgearbeitete Vorgcschicllte.
21 Nur exemplarisch: Dicrhard Sawicki, ),Dic Gespenster lind ihr Ancien regime. Gcistcrglauben als )Nachtseire( der Spataufk.b.rung«, in: Monika Neugebauer~
W61k uncl Holgcr Zaunsrock (Hg.) Aufkliirung und £Soterik. Hamburg 1999. S. 364~396; clers.: Lebm mit den TolCll. GeistergulIIbm ltnd die Enmehtmg des 5pi~
ritisnlus in DCUl.Jchland 1j70-1900, Paderborn 2.002. S.41-1 2.8 ; Helmut Zander.
15 8
derum in eine Geschichte der Transformation der Anthropologie im Kontext alternativrdigioser Erfahrungen in den Jahrzehnten urn 1800 gehoren, die gerade erst erforscht wird."
3. Sievernich Manuela Strack und die Erscheinungswunder
nach dem Zwei(en Vatikanischen Konzil
D ieser theologische D iskurss(and blieb im 20. Jahrhundert, bei zuriickgehender Bedeutung von Marienfrommigkeit und Marientheologie, erhalten." Schon in den Dogmatiken vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil (1962-1965) linden sich Marienerscheinungen nur als Marginalien der Mariologie verzeichnet," nach dem Konzil verschoben sich die DeutungsanSatze zumindest in der deutschsprachigcn Theologie nochmals deudich. Maria wurde vom biblischen Kontext her rcinterpretiert, die nachbiblische Traditionsgeschichte rdativiert. Die Frommigkeitspraxis, namendich der Umgang mit Marienerscheinungen, kam in den Lehrbiichern (wie iiblich) kaum vor." Doch die Situation is t vidschichtiger und letzt-
Geschichte dcr 5edenwandcrung in Europa. Alternative religiose Traditionen von dcr
Antike bis heuu. Darmstadt 1999. S. 397 f.; Paul Schwartz.. "Ocr Geisterspuk um Friedrich Wilhelm Il.ii. in: Mitteilungen des Vcreins for die Geschichte BcrLins 47 (1930). S.45-60. Zum Kolltexc Renko D. Geffanh, Religion IOld arkl1nc Hierar
chic. Der Orden dcr Gold- und ROSCIzkrcuur als gchrime Kirchc im 18.jllhrlmndcrt,
Leidcn u. a. 2007. 22 Eine bahnbrechende Pionierarbeit ist Karl Baier, Meditlllion und Moderne. Zllr
Gene!e eiTw Kernbereichs moderner SpirilulJ,litiit ill dcr Wcchse/wirkllng zwischen
Wcsteuropa, Nord.amerika tmd Asien, Wun.burg 2.009; ein systematischer Elllwurf bei Erhard Schiinpdz.. ~Med ium ismus und moderne MedienK, unveroffendicllt.
23 Petcr H. Gorg. 115agt an, wcr ist doch dies(lf. Inhale, Rang lind Entwicklung der Mari%gic in dogmatischen Lchrbiichem und Publikationcn deutschsprtlchigrr Dog~
nll1tii:er des 19. tmd 2o.jllhrhzmdertJ, Bonn 2007. S. 393~395. 24 Vgl. die wcitverbrcitctc Dogmatik von Michael Schmaus. Kirchliche Dogmatik,
Bd.5= Mariologie, Munchen 21961, S. 433-439 (dicser Abschnitt fehft allerd ings in der ErstauAage von 1955).
25 VgL exempbrisch Georg Soil, Mariologir. Freiburg im Bre isgau u.a. 1978 (= Handbuch der Dogmengcschichte, Bd. 111.4); Franz COllrth. Mariologie, Graz u. a. 199t (= Tcxte w r Dogmacik 6). oder Alois Muller, Dorothea Sattler, ~Mario~
logie'i. in: 1heodor Schneider (Hg.), Handbuch dcr DOgTTlIltik. Bd. 2. Dusseldorf J992, S.155-1 87. Zur Dogmcngcschichte Marion Wagner, Die himm/isclJC Frau.
159
lich antagonistisch, weil im 19. und zo. Jahrhundert unter Federfuhrung einer Fraktion der 1heologen gleichwohl Mariendogmen definiert wurden: das Dogma der Unbefleckten Empf<ingnis (1854) und dasjenige der leiblichen Aufnahme Mariens in den Himmel (1950). Darin spiegelt sich eine 1heologie, die sich als traditionsgeleitete Forrschreibung des biblischen Lehrbestands verstand, also sich in die Tradition jahrhundertelanger Rcflexionen stellte, de facto aber zumindest ebenso stark in theologische Innovationen mundete.
In diesem antagonistischen Deurungsfdd ist das zo. Jaluhunderc w einem weiteren Jahrhunderc der Marienerscheinungen geworden. Natiirlich gab es den Bedeurungsverlust von Marienwallfahrtsorcen (wie La Salerre), aber auch neue Erscheinungsorte: das schon genannte Fatima (1917), Banneux (1933), San Damiano (1961), Medjugorje (1981) oder Marpingen (emeut 1999) sind nur die bekanntesten im zo. Jahrhundere. '6 Allerdings hat die marianisehe Erscheinungsfrommigkeit auch an Popularitat verloren, CLWa
durch die Konkurrenz der 'Y/allfalut wm Grab Padre Pios im apulischen San Giovanni Rotondo mit angeblich rund sieben Millionen Pilgern pro JaluY
In diesem fluiden Feld von Octen, die beanspruchen, die Moglichkeit wunderbarer Erfahrungen ·zu bieten, ist Sievernich eine der jiingsten Erscheinungsstarren. Vom 8. Juni 2000 bis zum 3· Oktober zo05 beanspruchte Manuela Serack, geboren am 13. April 1967 und von Beruf Anwaltsgehilfin, Maria gesehen und Botschaften von ihr erhalren zu haben ." 1m Gegensatz zu den Medien
Mnrienbdd rmd Fmllcnbild in dogml1lischen Htzndbiichcrl'l des 19. ulld 2o.Jl1hrhundem. Rcgcnsburg 1999.
26 Sichc Hauf. Marit:n(!rJchcillllllgcn; HicrLcnbcrgcr, Ncdomansky. Erschcimmgm tmd Bouchllfim da GOltcStnlltlcr Maria; Ernst, uxikon d~r Marit:nt:l1chcinungm.
27 Vgl. wm noch bum crforschrcn Riickgang der Marienvcrchrung im 20.J:l.hrhundcrr Anna Maria Zumhoh .. »Die Rcsisrcnz. des katholischcn Milieus. Seherinncn und Stigmatisiertc in der ersu:n Hiilfce des 20.Jahrhundcrrscc, in: Gorz von Olenhusen (Hg.). Wundcrbarc Ersc/;dnllngen. S.221-251. Zu Padre Pio siehe Urte Krass. "Kontrollierter Gcsichtsverlust. Padre Pia und die Fotograficcc, in: Zciuchrifi /fir Idcmgcschichtc 4.2 (2010), S.71-96 (fur cine Kri[ik an def immer wieder kolportierten Zahl von sieben Millionen Pilgern s. S.72, Anm. 3) sowie ihrcn Beitrag im vorliegenden Band.
28 Allerdings hane Frau Strack bereits im Oktober 2002 crstlnals das Ende ihrer Mitteilungen angekundigt; vgl. Schilder, "Wund<;:r niche ausgcschlossell4C. Mehrere Inform:l.Ilten wollten nicht namendich genannt werden; ihre Aussagen werden anonymisierr bclegt.
160
des 19. Jahrhunderts besitzt sie nicht das marianische Kennzeichen der korperliehen Jungfraulichkeit; Serack ist verheiratet und Mutter eines Sohnes. Wie sie die Botschaften genau erhielt, bediirfte einer quellenkritischen Prufung. Sie empfing und verkundete sie grolStenteils in der Kirche von Sievernich, offenbar folgendermalSen: Zuerst habe sie die Erscheinungen in einem abgeschlossenen Oratorium an der Sudseite der Apsis gehabe. Spater salS sie in der Kirche, vorne in der sudlichen Bankreihe, wo man sie horre, wenn sie mit Maria redete. Anscheinend fertigte sie unter den Augen des Pfarrers Heribert K1eemann Aufzeichnungen an, anschlielSend habe sie mit den Besuchern dariiber vor der Kirche, spater dann im Jugendheim gesprochen. 1m Laufe der Zeit schrieb eine Dame, neben ihr sitzend, die Offenbarungen mit. Noch nachts habe Strack die Texte dann niedergeschrieben und per Fax an ihr nahestehende Menschen versande." Es gibt aber auch Hinweise, dass schon in der Kirche Tonbandgerate mirliefen.30 Manuela Strack selbst berichtet, dass es ihr dabei immer »sehr heilS« gewesen sci; sie habe die »Gottesmutter« oft »ganz ldar« gesehen, ihre Umgebung hingegen »etwas verschwommen oder im Nebel«.31
Was in solchen Berichten wie der unvermittelte Einbruch von Transzendenz aussieht, gehort bei niherer Betrachtung in ein mikrosoziales Netz, in dem (katholische) religiose Erfahrungen cine wichtige Rolle spiden. Frau Strack soll aus einer Familie stammen, in der auch die Mutter vergleichbare religiose ErfailCungen gehabt hat. Sie selbst war als 1z-Jihrige mit ihrer Murrer im Marienwallfahrtsort Banneux, wo sie Botschaften empfangen haben soil." Am zz. September 1984 erat sie im Alter von 17 Jalu-en erstmals mit eigenen Erfahrungen an die bffenrlichkeit. In der RTL-Sendung Mystery-Show - unglaubliche Geschichten berichtete sie, ein Medium fur Jesus zu sein: »Jesus uug mir auf, seine Botschaften niederzuschreiben.«l3 In Sievernich uaf sie dann auf ein Milieu,
29 Informant D. 30 So Informanc A. Ein :lJlderer Auge01,cuge (Informant B) berichtete. anfangs habe
Frau Strack in der Kirche dic Botschafccn aufgcschrieben. 31 Manuela Strack, "Fragcn an Manuela Strack (Seherin von Sievernich)cc IIncer
view], in: Muller, All~ Nationcn ruft ich zu mir!, S. 83-93, hier S. 83. 32 lnformanrcn B und C; "Mutter Gones erschcint am Montagcc, in: {http://www.
derwcsccn.del}, (04.10.2002.), lerzter Zugriff 04.10.2002; "Das ist Manuela, die Seherin von Sievernich«, in: Exprm (15- 05. 2002.), S. 3.
33 Marti, "Maria erschcint urn 18 Uhr 20te.
16,
das fiir ihre Erfahrungen offen war. Die »Blaue Oase«, die Gebetsgruppe, in der die Erscheinungen statrfanden und die bis heure den Rahmen fur die Gebetsrreffen am ersten Montag im Monat bildet, soli schon vor ihren Erscheinungen bestanden haben." Zugleich blieben die Ereignisse in der Kirche nicht der einzige Orr ihrer Erfahrungcn; sic habe auch, wie ihr zeitweiliger geisrlieher Begleiter Heriberr Kleemann sagte, »viele andere Erfahrungen [ . .. J in ihrem privaten Bereich« gemacht." SchlieBIich ist das Sievernicher Nen iiber personliche Bezieh ungen mit anderen marianischen Gruppen verknii pft."
Solche Gruppenbildungen produzieren auch Konflikte, die hier insoweit interessant sind, als sie auf den Erscheinungsvorgang zuriickwirken. In der pfarrei von Sievernich regte sieh Widerspruch gegen d ie neuen Entwicklungen, deren Anhanger zudem zum aIlergrollten Teil nicht aus Sievernich kamen. Zudem wussten sehr viele vor Orr lange Zeic niche, was cs mit den Vcrsammlungen am Montag auf sich hatte, weil es an schein end in der Anfangsphase keine offene Informationspolitik gab. Der Bischof von Aachen, Heinrich Mussinghoff, brachte die »Belastungen« fiir die Orrsgemeinde und seine Sorge urn d ie »Eintracht« in der Pfarrgemeinde sehr offen zur Sprache. Man suchte nach einem Kompromiss und fand ihn . Bei Gesprachen habe ihm Frau Strack mitgeteilt, so Mussinghoff am 17. September zooz, dass am 7. Okrober die »letzte grolle Erscheinung« stattfinden werde: das sei der Seherin mitgeteilt worden." Aullerdem verzichtete Strack darauf, in der Sievern icher Kirche cine Marienstatue aulZustellen, auf der Maria so, wie sie ihr erschienen war, dargestellt war und die die Kiinsrlerin Yasmin Kalmllrh-Biiyiikdere eigens geschaffen
34 info rll1:t nt C ; Peter Schi lde r. "Die Erschcinungcn von S icvcrnich oc , in: Frnnkfur~ ur Allgemeine Zcitung (23.04.2002), S. 12; "Warren :luf die neue BO[schafclC, in :
cbd., (11 .°5.2002), S.IO. 35 Hcribcrt K.!ccITIann, •• Dcr Himmel kann sich offcnbarcnltc, in: pur. Magttzin fiir
PoLiti!.: tlnd Rcligiollll (2002), 5,16-19, hier S.17. 36 Etw:l mit clem in Ki:iln ans:i.ss igcn .. Aposrolat« lIMyri:un von Naza.fcrh«; Franz
Sicpc, ) \Xfundcrsamc Gcgcnw:irrigkeit. Anmerkungcn zu Maricnerschcillungcn im Rhcinlancl«, in: Rheillisclu Hdmatpflcge (47) 2010, S.122-139, hier S.139, Anm·58.
37 Heinrich Mussinghoff. II Brief an die Pfarrgcmcinde in Sievernieh vorn 17. September 2002«, in: Martin MUller (Hg.), Ich bin Maria, die MaJullou. Die BOl
IchttfiCll VOll SicIJcrnich, Kisslegg 32005 , S.10.
162
hatte." Die Kirchengemeinde habe bereits eine Fitimarnadonna, laurete eine Begriindung; Strack musste ihre Statue in ihrer Privatwohnung aufstellen. Die Aachener Kirchenzeitung brachte die mit dem Ende der Erscheinungen verbundenen Erwartungen auf den Punkt: Das »Bistum hofft, dass sich die Situation jetzr beruhigr«.39 Gleichwohl erwies sich diese Ankiindigung yom Ende der Erscheinungen als Falschmeldung. Die offendichen Mitteilungen von Maria und anderen Heiligen gingen bis zum Jahr zo05 weiter.
Auch hier ware nach moglichen Konflikten bei der Wiederaufnahme der Mitteilungen durch Strack zu frage n. AuffaIlig ist jedoch, dass sie sich in ihren veroffendichten Allllerungen demonstrativ zuriickhaltend hinsichdich ihres eigenen Sachverstandes auBerte. Sie wisse nicht, ob ihr Zustand eine ))Ekstase(( gewesen sei, sie besitze »keine facWiehe Kompetenz«. Und wenn sie eine Antwort geben solie, ob die von ihr iibermittelte Botschafr »eine prophetische Dimension« besicze, sci zu fragen, w ieweit ))ich dies beurteilcn darf und iiberhaupt kann«.'·
In ihren Mitteilungen berichtete Strack zuerSt von Elementen, die zum Kanon der Botschaften auch anderer Marienerscheinungsorre gehoren:" Sie zeichnete ein Krisenszenario der aktuellen hisrorischen Lage (>.In der Welt herrscht der grolle Glaubensabfall« [07.08.2000]) und forderre zu traditionellen Praktiken wie dem Rosenkranzgebet sowie wr Identifizierung der Maria als Immaculata auf Aber auch die theologische respektive chrisrologische Finalisierung der Botschaft Mariens (die gebiete, GOttes Willen zu tun und verlange: »Fiihrr den Willen meines Sohnes aus« [Z5. 07· 2000]) ist deudich. Hier sind die Spuren der universitaren Theologie zu sehen, die die Mariologie im zo . Jahrhunderr an die Chrisrologie angebunden hat. Viele ikonografische Details in Stracks Wahrnehmungen stirn men mit denen der Erscheinungen aus dem 19. Jahrhundert iiberein: Maria, im 19. Jahrhundert haufig ohne Kind, erscheint auch in Sievernich ohne Jesus und im weillen Kleid (Abb. 5.Z), oft auch mit blauem Mantel und in einer ovalen
38 Emk, »Bisturn hofft, class sieh die Situation jctz.c bcruhigt~~ , in: Kirchcnzcitlmgfor diu Biml111 Aachen 42 (2002) . S. 30; Diirt:lla Nachrichten (07. 10.l002), D. S. 6.
39 Emk, .. Bistum holft, class sich die Situacion jc[Zc bcruhigt«. 40 Strack, »Fragen an Manuela Strack«, S. 85.88. 41 Allc Inhalrc uncl Zitacc untcr (www.sicvcrnich.cu). lc["acr Zugriff J4. 01. 2010,
untcr clem Link »Borsehaf((:n«.
16}
t
.~
Abb. f.2 : Maricnsraruc )Maria, die Makcllosc(( (GroBe 150 eln, Fertig gcstcllt 20°3) , aufgcstellr in def 2005
ncucrbauren Kapellc in Sicvcrnich
Form wie schon 1830 bei Catherine Laboure in Paris. Auch die starke nationalreligiose Einfarbung gehort in die Tradition des 19. Jahrhunderts (»Ihr [ ... J wisst, dass meine Trinen, [ . .. J besonders flir Deutschland gedacht sind. [ .. . J Wenn ich auf Deutschland scha.ue, sehe ich, dass die Herzen der Menschen sich von meinem Sohn gewandt haben« [04.09.2000]) . Zugleich lassen sich in der Deutung dieses Nationalismus Verschiebungen beobachten. Denn ein Band mit »den Botschaften von Sievernich« erschien 2005 umer dem Titel Aile Nationen rufo ich zu mirY Darin kann man ein Korrektiv 42 Mtillcr, Aile NtlliollC1l ruft ich zu mir!, Bd.2.
,64
der nationalen Ausrichmng lesen, mutmalSlich umer Einfluss der Theologen. Schlidslich gibt es drei »personliche Schllissei«, von Strack geheim gehaltene und nur dem Papst personlich libergebene Mitteilungen; hier ist Fatima das groBe Vorbild.
Aber andere Dimensionen sind neu. Die Botschaften erstreckten sich nicht mehr liber Tage, sondern liber Jahre; ihr Umfang ist von wenigen Satzen aufTraktadange angewachsen. Dabei hat sich die Liste der verhandelten Gegenstande zu einem kleinen Katechismus summiert: Die Familien seien zu erhalten, Priester solI ten ihren Dienst ernsdlaft versehen, die Beichte sei zu praktizieren und die Eucharistic zu feiern . Besonders bemerkenswert ist die Ausweitung der Erscheinenden und Mitteilenden liber Maria hinaus: Scit Ende 2000 seien Heilige erschienen, darumer Engel, die heilige Charbel, die heilige Barbara und der Jesuit Robert Bellarmin (1542-1621). Padre Pio (1887-1968) war erstmals Anfang 2001 darumer. Seit Mitte 2004 folgten liber Monare hinweg Gebete und Anweisungen, die die Karmelitin Therese von Avila (1515-1582) Strack gegeben habe und die einen umfangreichen Teil der Mitteilungen ausmachen.
2003 teilte Strack mit, sic sehe einc blutbcfleckte Hostie bci der Elevation, nun spreche sogar Jesus Chrisms pc[sonJich zu ihr; cinc Zcit lang solI sich Strack als Schreibmedium von Jesus betrachtet haben .'3 Am 3. November berichtete sic von ciner physischcn Manifcstation: Nach einer Marienerscheinung sci ein kreisrunder Eindruck im' Gras ihrcs Gartens zurlickgebliebcn, dcr auch nach zweimaligem Rasenmahen nicht verschwunden sci (Abb. H). Damit war die Grenze subjektiver Erfahrung auf dic materiellc Prascnz Marias hin ))cn1pirisch« iiberschritrcn.
Am 3. Oktober 2005 schlielSlich habe Maria die Offenbarungcn beendet:
Heute mochtc ieh mich von cueh vcrabschicdcn. Immcr werdc ich an dicscm Orr bei euch sein. Alles habe ich gcsagt. [ . . . J Gernc mochec ich cuch aUe im Himmel wiedersehen. Die Gottesmutter segru:te uns aLle ein fetztes Mal. Durch den Segen der Make/ksm trugen aile Beter ein kleines Lichtkreuz auf dt:r Stirn. Sie hie!t mir das Skapulier vom Berge Karmel hin, so dass ich es beriihren durfie. [ . . . J Dann schwebte sie ruckwiirts liichelnd in das Licht ttnd entschwand, ebenso der Monch ndmens Benedikt [der HI. Benedikt von Nursial"
43 Informant C. 44 Hcrv. und Erg. im Orig.
,65
Abb. 5.3: Fotografic der »physischen« Eindruckstellen Marias nach einer Erschcinung im Rascn
Mit solchen Atisfuhrungen zu einer Vielzahl theologischer Loci und mit der Erweiterung des erscheinenden Personenkreises wird ir. Sievernich ein Offenbarungskorpus konstituiert, das sich signifikant von den M itteilungen bei den Erscheinungen des 19. Jahrhunderts unterscheidet. Die veranderten Inhalte stehen in Zusammcnhang lnit Veranderungen in der Rezipientenschicht. Die neuen Nachrichten setzen beim Medium wie bei den Harern cine vertieftC religiose Bildung voraus lind reagieren insoweit auf erweiterte Wissensbestande im katholischen Milieu. Aber auch als Person partizipiert Manuela Strack am katholischen Bildungszuwachs. Auf clef Website von Sicvernich sind die Mitteilungen Marias selbstbewusst als »Privaroffenbarungen« gckennzeichncc.-iS
Analysicrt man die Mitteilungen in Sievernich theologichis-
4 5 Daruntcr vcrStdH die k:llho lischc 111cologic cine Offcnbarung nach dem Ab~ schluss des biblischcn Kano ns (cine Deurungskategorie, die es in den protcstantischcn GroBkirchcn so nichr gibe) . Einc Privatoffcnbarung gche an cine einzdne Person und mussc im Einklang mit def kirchlichen Tradition s(ehen, durfe ihr
aber wmindesr nichr widcrsprcchcn.
166
torisch, so fallt auf, dass vor allem solche katholischcn Praktiken eingefordert werden, die vor dem Zweiten Vatikanum selbsrverstindlich waren, erwa die Beichte oder die eucharistische Anbetung. Auch die hohe Wertschatzung der KJeriker geharte in einen vorkonziliarcn Frammigkeitsstil, wobei es bemerkenswerterweise Laicn sind, die die Resakralisierung des Priesteramtes fordern." Das Geschehen in Sievernich gehort damit zu einer in minoritaren, traditional ausgerichteten Kreisen des Katholizismus teilweise massiv »gefuhlren« Verlustgeschichte durch das Zweite Vatikanische Konzil. Auch die nationale Einfarbung ist eine Dimension, die dem Mehtheitskatholizismus in Deutschland in dieser Deudichkeit fremd geworden ist. Man kann die Botschaften als kompensarorische Trastung eines Mitgliedersegments in der katholischen Kirche lesen, das im 20 . Jahrhundert in cine RandJage gekommen ist und dessen Spiritualitatspraluiken nachkonziliaf erlauterungsbedurftig und nachgerade legitimierungsbedutftig geworden sind.
Diese Interpretation der Botschaften hat aber ein wichtiges, vielleicht zentrales Feld fur die Plausibilitat derartiger Marienerscheinungen seit dem 19. Jahrhundert noch nicht beruhrt. Es geht nicht nut urn die Beibehaltung von Lehren und die Achtung vor Texten, die in vorkonziliarer Zeit hegemonial waren. Vielmehr gcht es immer auch urn starke Bilder, fur die Medien wie fur die anderen Glaubigen. Deren primare Evidenz liegt in der sichtbaren Erscheinung, nicht in der geharten Botschaft. In Marienerscheinungen schlagt sich die katholische Theologie des Auges nieder, die Bildern und Ritualen cine hohe theologische Dignitat zuspricht. In dieser Tradition durfte sich Strack mit ihren hochasthetischen Walunehmungen legitimiert sehen. Am 12. November 2001 erwa berichtete sie:
Die hcilige Jungfrau schwebrc in der Lufr. Sie bcfand sich im AJtarraum. Dann schwcbte sie uber uns hinweg. lch sah, dass ihr Hen offcn war. Aus ihrem Herzen kamen buntc Strahlcn zu uns. Wir aIle waren in diesc StraI1-len eingctaucht. Auf dem Boden reclus und links von def Mutter Gones sah ich zwei heilige Engel, die goldene Schalcn crugen . Die heilige Jungfrau war so groB, dass sic fase den ganzen Altarraum ausft.il(rc. Sic sprach: ),Licbc Kinder, kommc und besucht mich in mcincr B(aucn Gebecsoasc. Hier bin ieh wahrhafr gcgcnwarrig. In dcr SaJbung kommt mcio Sohn Jesus wahrhaft zu cuch. lch bin zu cuch gekommen, damit ihr mich Spurt,
46 Sicpc, »Wundcrsame Gegcnwanigkcir«, 5.137.
167
mcinc Gcgcnwart. Dam it ihr Spurt. dass ich bci cuch bin. an curen Sorgen und Noten tcilhabc. Ich lasse cuch nicht alleine! lhr musst nur zu mir finden, offnet euch. Offner euch fUr meinen gocdichen Sohn Jesus!« Urn das Hcrz dcr Muttcr Gottcs war cine goldene Dornenkrone gcwunden. Sic ging mit den Engeln. die ihr folgten. zu den Menschcn . Die erscc Schale der beidcn Engel war mit einer durchsichtigcn Flussigkcic, die zwcicc SchaIe mit cincr durchsichrigcn SaJbc gcfiillt.
In diesen Passagen steckt mehr als der Anspruch des Mediums Manuela Strack auf eine ubernaturliche Kommunikation mit Maria. Vielmehr durfte sich hier ein weiterer »gefiihlter« Verlust fur ein traditionales katholisches Milieu durch das Zweite Vatikanum spiegeln: die Reduzierung oder die partielle Eliminierung asthetischer Praktiken in der Lirurgie. Dieses Konzil hatte die Inszenierung der »Realprasenz« des Gottlichen in einem synasthetisehen Ritual mit Bewegungsablaufen, Farben, Geruchen, Musik und Worten, wie sie im Gefolge des Konzils von Trient (1545-1563) emwiekelt worden war, als Standardgottesdienst emthront. In der trideminischen Litu'gie war die Wandlung der Hostie und deren Elevation das Paradigma einer liturgischen Frommigkeit gewesen, die das Gottliche im »Zeichen« des Brotes ers:heinen Sall. Auch hier hatte die Theologie, analog zu Marienerseheinungen, die subjektive Zustimmung als theologische VorauSSetZLlI1g gelehrt, und auch hier durfte in der popularen Frommigkeit die Grenze zum Glauben an cine objektive, physische Prasenz des Gotdiehen immer wieder ubersehritten worden scin. Diese Erseheinungsrituale in der Eucharistiefrommigkeit waren im 19. Jaluhunderr der Bezugshorizom fur Maricnerscheinungcn gewescn, die groBtentcils analog konstruiert waren. Strack ruft diese Asthetik des vorkonziliaren Kamolizismus auf Die im Altattaum »sehwebende« Maria assoziiert die uber den Kopf des Priesters erhobene Hostie, die Strallien von ihrem Hetzen erinnern sowohl an die Hetz-Jesu- und die Hetz-Marien-Frommigkeit als auch an Monstranzen, in deren Mirte die konsekrierte Hostie, oft von Strahlen umgeben, in der eucharistischen Anberung prasemiert wurde. Aber im Gegensatz zur Situation bis zur Mirte des 20. Jahrhunderts, wo sich Marienerscheinung und eueharistisehe Realprasenz wechsdseitig bestatigten, parrizipierr die Mariencrscheinung in Sievcrnich nicht an einer theologisch abgesicherten eucharistisehen Schaufrommigkeit, sondern muss genau diesen Plausibilitatskontext sdbst begrunden.
J68
I
Wissenssoziologisch ist dabei bedeutsam, dass Asthetik mehr ist als cine Welt bunter Bilder oder synasthetischer Wahrnehmungen. Asthetik relativierr eine textbezogene Spiritualitat und erleichtert oder ermoglieht nichtkognitive spiriruelle Praktiken. Weil diese im Vergleieh zu textbasierten Augerungen einer geringen KontrolIe durch Theologen unterliegen, haben Laien hier einen grogeren Freiraum der Gestalrung. In den Visionen von Strack tauchen die genannten Elemente der tridentinisehen Liturgie wieder auf, die Laien in der regularen gemeindliehen Liturgie des Zweiten Vatikanums kaum durchsetzen konnen . Die Marienwunder in Sievernich bewirken damit auch an dieser Stelle cine komplexe Interaktion zwischen Theologie und popularer Frommigkeit, in der untersehiedliehe Positionen ausgehandelt werden . Die in der Volkskunde beziehungsweise Europaisehen Ethnologie erarbeitete These, dass Bedurfnisse ))von unten« und Angebote ))von oben« unterschiedIiche soziale Milieus verbinden," eroffnet ein Feld von Weehselwirkungen zwischen Akteuren, das man fur Sievernich komplexitatssteigernd prazisieren kann: Die Impulse kommen »von unten«, aus dem weibliehen Laienmilieu, und die ReHexionstheologie ist wieder (nur) im Stande, durch nachtragliche Interpretationen die Ereignisse in Sievernich in die kirchliche Debarte ruckzubinden. Und wieder ist die laikal-theologische Frondinie durch Interferenzen perforiert. Denn die popularrheologische Position von Manuela Strack ist durch Vorstellungen der akademisehen Theologie geformt, sowohl durch altere Theologumena, etwa der asthetischen Reprasentation des Heiligen, als auch durch jungere, etwa in der biblischen Interpretation der Marienfrommigkeit. Allerdings fehlt die im 19. Jahrhundert weitverbreitete amtskirchliehe Forderung der Erscheinungskulte in Sievernieh augenblicklich, dafur gibt os kirchcnimerne Differenzen im Umgang mit den Siovernicher Er-
47 Gottfricd Korff. ltZwisdlC:n Sinnlichkcit und Kirchlidlkcic. Notizcn zurn Wandel popularer Frommigkcit im 18. und 19. Jahrhundcn«, in: Juna Held (Hg.), Ku/mr zwischen Biirgatum und VaLk, Berlin 1983, S.136-148. Die AuAoSllOg des binarcn Amagonismus dec normacivcn Konzcptc von »Hochthcologic« und >.Volksfrommigkeit« in cin Rhizom von imcraktivcn Beziehungen ist vidf.1Ch 7.U bcobachtcn, vgl. Michael N. Ebertz., "Typen popularer Rdigiositat«. in: MoniCl Juncja, Margrit Pernau (Hg.). R~/igion und Grenun in Indicn und Deutschland. Aufdem wt-g Z1I ciner transnationalm Historiogrnphie, Goctingcn 2008, S.379-392. lnwicfern Aktcur-Ncnwcrk-Thcoricn mit jhrer Egalisicrung def Aktcurc hiIfrcich scin
konotcn, ware Zll iibcrprufcn.
169
scheinungen - vergleichbar mit den Kontroversen im 19. Jahrhundert - 'bis auf die bischiifliche Ebene."
4. Hermeneutische Zwischenbilanz
Mariencrscheinungen, wie sic fur Sicycrnich bcrichtct werden, sind »katholische« Wunder, wei I sie Plausibilitat nUI in einem katholischen Milieu besitzen, das bestimmte soziale Bedingungen erfwlt: partielle Ausriehtung am vorkonziliaren Katholizismus, ein starkes religionsbezogenes Traditionsprinzip gegenuber der Bibelorientierung, Offenheit fur ein tradirionel1es narionalstaatliehes Denken. Hinzu kommt eine schwache Rezeption hermeneurischer Deutungskulturen, wie sie sich in der historisch-kritischen Exegese oder in religionspsychologisehen Analyseverfahren durehgeserzr haben. Die Relativismusdrohungen, die Illir diesen Verfahren seir dem spaten 19. Jahrhunderr breitenwirksam prasent waren, versucht man in Sievernich mit einer zweigleisigen Straregie zu bekampfen, die im 19. Jahrhunderr von der 1heologie gegenuber den Naturwissenschaftcn enrwickdt worden war: Jllir def Gcwissheit »innerer« und der Objektivitar »aulSerer« Erfallfungen.
Die Marienc'rscheinungcn in Sicvcrnich bictcn beide Dimensionen an : Die nur Srrack und glaubigen Anhangern zuganglichen Erscheinungserfaluungen - von Maria uber Heilige und Engel bis zu Jesus - sind subjekrive Vergewisserungen, die aber zugleich mit dem Anspruch auf Objekrivirar jenseirs persiinlicher Erfahrungen vorgetragen werden . Das Angebor der Reflexionstheologie, salehe Erscheinungswunder gerade als persiinliche Erfaluungen srark zu machen," holr zwar die hermeneurische Reflexionsgeschichre (letzdich seit der Antike) ein , triffr jedoch vermudich nicht
48 Ocr Ko lncr Bischof Joachim Meisner. cler alIcrdings nicht fur Sievcrnich zu-standig isr. da cler Orr im Biswm Aachen licgt. kommt den Anlicgcn Manuela Str:l.cks weir entgcgen. Auf der Website der Sicvcrnichcr Maricncrschcinungcn werden woh lwollcndc AuBcrungcn Mcisncrs abgedruckt, wohingegen vcrgleichbare Stcllungnahmen dcs Aachcner Bischofs Heinrich Mussinghoff fchlen. Dcr h:me M:lIlucla Strack »einen Priester als Scclcnfuhrer 1.ur SeiIe gcgeben«, werst Joh:ulIles Biindgens (scit 2.006 Wcihbischof in Aachen), dann Hcribcrt Klccmann (t 2004); inzwischcn ::umicrt cin drincr Pricster als gcisdicher Begleitcr.
49 Patrick Dondclinger, Bcrt1ltdcttt: Soubirol/.s. Visiom:n lind Wimda. Kcvclacr 2.007.
S.1 57-161.
170
die Erwarrungen und die gelebre Spiritualitat in Sievernich. Die Miiglichkeir des Sprungs von der Gewissheir in objekrives Wissen namlich, fur den die Marienerscheinungen stehen, steUt die rheologische Fundierung des subiekriven Gehalts jeder Deurung in Frage. Das akademische Wunderverstandnis, dem zufolge man wunderbare Erfahrungen nur innerhalb sozial definierter und somir relarivcr Lebenswelren mach en kann , und die daran anschlieLlende Folgerung, in subjektiv bestimmten Erfaluungen eine Befreiung aus dem Dererminismus der Objektivirar zu sehen, durfre in Sievernich eher als Bedrohung durch die Relativitat des Subjekrivismus wirken. Dass die objektivistische Sieht der Sievernicher Marienglaubigen der rheologischen Dogmarik wie der wissenschafdichen Kontexrualisierung widerspricht, weil man die erscheinende Maria in Sievernich wohl doch fur einen Ausdruck »realer Gegenwart« hair, isr fur die historiographische Perspektive ohnehin kein Argument. Hisrorische Wissenschafr urreilt nichr uber die Waluheir von Erscheinungen, sondern interprerierr nur die Texte und Bilder, die von den Medien dieser Wahrnehmungen WI Verfugung gesrellt werden.
1m 21. Jahrhundert, so lautet die einfache »Bo tschaft« von Sicvernich, sind Wunder miiglich. Der H istoriker muss prazisierend dazu sagen: in besrimmren Milieus und unter Annahme bestimmter Episremiken isr die Rede davon miiglich. Den rationalistischen Wunderdiskurs der AufkJarung, die aile Wunder auf natudiche Ursachen zuruckfwute, haben die Proragonisten der Marienerscheinungen praktisch ignorien - Maria crschcint schlicht, sic »maCh[11 sichtbar und »rut« Wunder. Zugleich bedienen sich die Marienverehrer und -verehrerinnen der rationalistischen Beweistheorie des 19. Jahrhunderts - Maria hintedassr Spuren noch im Rasen der Eifel. Mit glaubigem Rarionalismus gegen den ungUiubigen Rationalismus, begleiter von einer Theologie, die auf der Unverzichtbarkeir von Subjekt und Glaube besrehr, das isr die hermeneutische M ischung, mir der auch im 21. Jahrhunderr noch Wunder deurbar sind.
'7 '
5. Wunder nach dem Wunder Sievernich heute
Ein Wunder wird erst dann richtig wunderbar, wenn es nicht folgenlos bleibt. Aber jeder, der mit Berichten uber aulSergewohnliche Ereignisse umgell(, weilS, dass die Erfahrung des AulSerailtaglichen nur durdl Veralltaglichung bewahn werden kann. Eben dies ist auch die Schwiche des Marienwundcrs in Sievernich - und seine Starke zugleich. Der religiose Alltag begann schon in der Endphase der »Offenbarungen« Stracks. Die Journalisten waren hdlhorig geworden, vor der Kirche in Sievernich standen die Obenragungswagen des Westdeutschen Rundfunks und anderer Medien, Forografen der Boulcvardzeirung Express sranden unangemdder vor der Hausrur Stracks und uberschutteren die uberraschre Seherin gegen ihren Willen mir einem Blirzlichrgewitter, als sic die Tur offnere. In der Sievernicher Kirche drangren sich die Menschen bis auf den Friedhof hinaus, wahrend Srrack ihre M ineilungen verkundere, und es war ublich geworden, alles, was sie sagre, sofon aufzuzeichnen. Das Fluidum des Unfassbaren war dabei, im Medienrummel umerzugehen. Vielleichr war aud, das tin Grund, weshalb die offenrlichen Offenbarungen im Jahr 2005 endgulrig enderen.
Aber zu diescm Zeirpunkr befand sich das Wunder von Sievernich bereirs auf dem Weg in den rdigiosen Alltag, weil man noch wah rend der Erscheinungen begonnen hane, das Charisma der Seherin in cine Srrukrur und damir in Wiederholbarkeir und Tradirion zu uberfuhren. Bereirs 2003 wallfahnere man ersrmals am Montag der Karwoche von Gurzenich nach Sievernich. Und es enrsrand das, was ein Marienwallfahnsorr an Grundaussranung ublicherweise besirzr: Bibdgesprache wurden eingerichrer, eine Internerprasenz geschalrer, eine Marienkapelle gebaur, ein Forderkreis gegrunder, Gebershefre und kleine Bucher gedruckr, Toilenen fur die Pilger gebaut. Und ein fur weirere Wunder wichtiger Orr kam hinzu. Himer dem pfarrhaus von Sievernich gibr es inzwischen den schon genanmen Brunnen, an der Stelle, wo Snack die »drei Schlussei« mir den besonderen Borschafren empfangen hane und den H inweis erh idr, nach Wasser Zll bohren. Hier isr der On, wo kunfrige Wunder erwartet werden.
Vor all em aber enrsrand die »Blaue Gebersoase« (in der klassischen Farbe der Maria), ein regeimalSiges Treffen am ersren Mon-
172
rag eines Monars. Zu dieser lirurgischen Veransralrung finden sich in der Regel die eingangs genanmen etwa 400 Menschen ein, die aus einem Einzugsraruus von circa 100 Kilomcrern komnlcn, von Wuppenal bis Belgien, von Monchengladbach bis Bonn, und narurlich viele Menschen aus der Eifel. Sie nmzen dazu die Sievernicher Kirche, die seir 20IC keine eigensrandige pfarrkirche mehr isr, sondern zu Ginem Pfarrverbund gehon, aber in der gleichwohl die Orrsgemeinde weirerhin ihre Gonesdiensre feiert. Hier sind die Marienglaubigen zu Gast. Dann srehr vor dem Alrar eine Kerze mir einem Jesusbild, aus dessen Herz Lichrsrrahlcn ausrreren, ein im 19. Jaluhundert aulSerordendich bcliebres Bildmoriv, aber neben dem Seirenalrar hangr auch ein Baum mir den Sievernicher Kommunionkindern als Papiercollage. Orrsgemeinde und Mariengemeinde haben sich nebeneinander und mireinander eingerichrer.
Wenn das Geber urn '5 Uhr beginm, isr die Kirche meisr voll besem." Die Menschen sind durchgangig einfach gekleider, eher von C&A als von H&M, und die Mehrheir durfre im Durchschnin uber 60 Jalue air sein. Manche Glaubige verbleiben wahrend der ganzen Zeir in der Kirche, andere kommen und gehen, einige z.'pfen am Brunnen himer dem pfarrhaus Wasser: Drei Srunden bis zum Beginn der Eucharisriefeier sind eine lange Zeit. K1assische Gebershalrungen der karholischen Frommigkeir haben hier noch Konjunkrur: Man lmier nieder, wenn man am Tabernakel vorbeigeht. Manche haben die Hande Aach aneinander gelegr, ahnlich wie Dtirers Betende Hiinde, nur nichr so locker, haufig halren sie zwischen den Fingern Ginen Rosenkranz. Wahrend der langen Andachr schwingen die Glaubigen mir dem reperitiven Geber des Rosenkranzes in ihre Frommigkeir ein. Ein eigener, liminalef Raum des Salrralen emsrehr. Laien leiren den Gorresdiensr und ubernehmen die Rolle def Vorberer. Bis urn 18.15 Uhr die »Heilige Messe« beginnr, besrimmen die marianischen »Gesatze« des Rosenlrranzes den Gebersrhythmus, unterbrochen insbesondere von Marienliedern, darunrer viele, die in dem 1975 eingeflihrren Goteeslob, dem Gebet- und Gesangbuch der deurschsprachigen Bisrumer, nicht enrhalten oder in die diozesanen Anhange verschoben sind. Viele Gebete srammen aber auch aus einem eigenen Geberbuch konsefvariven Zuschnitts, dem Adoremus.
50 Die folgcndcn Beobachtungcn wurdcn w:ihrcnd cines Bcsuchs am OJ. 02. 2010
gcmacht.
173
Ganz im Zentrum steht Maria, auch wcnn ilTI Rosenkranz die »Geheimnisse« des Lebens Jesu mediriert werden. Maria isr der Spiegel, in dem man Jesus berrachrer. Sdbsr klassische Theologumena werden marianisch unterlegt, etwa wcnn die trinitarische Doxologie (»Ehre sei dem Varcr und dem Sohn und dem Heiligen Geisr,,) auf der Melodie des »Ave Maria" von Lourdes gesungcn wird . Man singr laur, inbrlinsrig. Ganz besonders srichr die Zentral idit Marias in den rein marianischen Gebeten heraus, etwa wenn man die »Weihe der Welr an Mariens UnbeAeckres Herz" berer, die Papsr Pius XlI. [942 eingeflihrt har. Darin werden klassische Gorresprad ikare und -gebere auf Maria liberrragen: »Wir vertrauen nichr auf unsere Verdiensre, sondern einzig auf die unendliche Glite deines mlinerlichen Herzens." »Vermirrlerin von allen Gnaden", heillr es in einem anderen Geber; marianische ·und jesuanische Gnadentheologie gehen ineinander liber. Maria isr wmrend dieser drei Srunden der zentrale Fokus der Flirbinen, ihre Hilfe wird »erlleh(", sic is( der emorionale Angelpunkr: »Du meine Mur(er, ich dein Kind." Flir die Glaubigen selbs( gehort all das in den Bcrcich cine( Frommigkci(, die »durch Maria zu Jesus" flihre, aber in dcr Aullenpc(spckrive von eine:n Polyrheismus nichr immer zu un terscheidcn ist.
Kriscnmcraphern durchziehcn den Gonesdiensr. Das genannte Geber Pius XlI., gesprochen in der Hochphase des Zweiren Welrkriegs und mir unverkennbaren Bezligen auf die damalige polirische Situarion, wird zum lndikaror der Gegenwart: Die Welr »isr ein Opfer der eigenen Slinde, [ .. . J brennend in den Flammen des Hasses" . »Erllehe", heillr es an Maria gerichrcr, »Frieden und volle Freiheir der heiligen Kirche Gones! Halre die wachsende Flur des Neuhcidenrums auf!« Und immer wieder berer man in der Sievernicher Andachr flir »heiligmafSige Priesrer". »5egne Du, Maria, unsern Priesrersrand, reichen Segen spende jeder Priesrerhand!", singr d ie Gcmcindc auf der Melodie des bekannren Marienliedes »Segne Du Maria, segnc mich Dein Kind", das man dem Adoremus entnimmr. Einc Tcxrganung fehlr jedoch: Die Offenbarungen Stracks spiclcn in dieser Lirurgie keine Rolle. Da muss man schon zu einem Hefrchen greifen, das in einem Schrifrensrand auAiegr, der Novene zu Maria, der Makellose", mit Betrachtungen aus den Botschaften von Sievernich.
Dann, urn [8 :[5 Uhr, beginnt ein neues Kapirel, die Eucharis-
174
tiefeier, die man hier gerne weiterhin »Heiligc Messe« nennt. Zu Beginn liesr cine Frau eine Vielzal,l von Messintentionen vor, also von Bi nen, die mir dcm Gonesdiensr vorgerragen werden, doch von jerzr an sind die Priesrer die zentralen Akreure. An diesem Monrag, dem 1. Februar 2010, feiern vier K1eriker die Messe. Drei rragen die Messgewander, wie sic seir denl Zwciten Varikanischcn Konzil liblich sind, nur einer tragr die Dalmatik des Diakons in der tridentinischen Tradition. Diese Gewander sind wie cine Merapher flir den gesamten Gonesdienst. Sie zeigen neben vielen anderen Details, dass der Gonesdiensr auf dem Boden der nachkonziliaren Liturgie stehr. Die Gebete sind an Jesus gerichtet, die Zenrrierung auf Maria ist verschwunden. Die Predigt behandelt den »vollkommenen Schmerz« als Korrelat und Bedingung des vollkommenen Friedens, in der eng biblische Mariologie und Chrisrologie verknlipft werden. Dann der Empfang der Kommunion: Einige knien, urn die Hostie auf die Zunge gelegt zu bekommen, andere srehen und nehmen die Hostie mit Mundkommunion, wieder andere stehen eben falls und erhalten die Hostie auf die Hand. Dies ist ein signifikantes Bild fur drei unterschiedliche Frommigkeirsstile zwischen traditionalen und reformierten Haltungen, die sich in Sievernich nebeneinander linden und das Bild eines rein konservativen Milieus als Projekrion erweisen.
Nach der Eucharistiefeier werden Andachtsgegenstande geweihr. Die Glaubigen sollen sie hervorholen, und allenfalls dies lielle sich als »magisches" Rudiment deuren. Aber hinter dem Wcihegebet des Priesrers sreht eine semiotische Theoric: Diese Gcgensrande seien Zeichen und Hilfsminel der eigenen Frommigkeit. Den Abschluss bildcr ein K1assiker der karholischen Schaufrommigkeir, auch er isr in vi den Gemeinden selten geworden: die Ausserzung des »Allerheiligsren" und der sakramenrale Segen. Damit ender die Lirurgie. Offenbarungsrexte von Srrack haben auch in diesem Gonesdiensr keine Rolle gespielr. Sie sclbsr sirzr unprarentios in der Kirche, flihrt anschl iellend an dicsem Abend noch das eine odcr andere Gesprach, mehr nichr.
Dieser priesrerzentriercc Gottesdiens[ is[ ein Konrrastprogramm zur laikalen Andacht zuvor. Die tradirional orientierte Andachr wird in cine Liturgie liberfiihrt, die dem Zweiten Vatikanischen Konzil verpAichrer ist. Vor dem Hintergrund der Eucharisriefeier wirken die Gebersstundcn in der »Blauen Oase« wie ein Refugium
[75
marianischer Friimmigkeit aus vorkonziliarer Zeit. Diese beiden Liturgiestile sind signiflkam fur die Veralltiigl iehung des Wunders von Sievernieh: Eine Marienfriimmigkeit, in der traditional oriemiene Laien die Leitung haben, ist eng mit einem Gottesdienst verbunden, in dem die zelebrierenden Priester cine Brucke in die nachkonziliare Gegenwart bauen. Offen bar kiinnen beide Seiten damit leben, der Bischof von Aachen als lerzte kirchenamcliche Instanz auf der einen und Strack und die Menschen in ihtem Umfeld auf der anderen. Das Offenbarungscharisma von Frau Strack und die institutionelle Ral1mung durch die Amtskirche haben den Boden fu r eine veralltaglichte Tradierung des Wunders von Sievernich gelegt. Soweit der Stand 2010; das Ende ist offen.
176
II. Mirabilia - Naturwunder