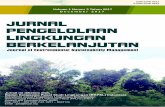konsens 2017 - Deutscher Akademikerinnenbund
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of konsens 2017 - Deutscher Akademikerinnenbund
1
I N F O R M AT I O N E N D E S D E U T S C H E N A K A D E M I K E R I N N E N B U N D E S E . V.
KONSENS
KO
NSE
NS
2017
Cornelia Schleime: „Diener zweier Herren“, 2017, Acryl, Schellack, Asphaltlack auf Leinen, 1,60 x 1,40 m
• FE
MIN
ISM
US
KO
NTR
OV
ERS
• D
IGIT
ALI
SIER
UN
G U
ND
FRA
UEN
• D
AB
INTE
RNAT
ION
AL
VER
NET
ZT
Konsens_2017_final.qxp_Konsens 21.12.17 08:37 Seite 1
Innovation hat man uns eingeimpft:Seit 1898.
Neben einer Vielzahl von Therapeutika erforschen und entwickeln wir seit mehr als 100 Jahren auch Impfstoffe. Impfstoffe und Therapeutika können Menschen auf der ganzen Welt helfen, gesund zu bleiben und es zu werden. Nach über 20 Jahren erfolgreicher Zusammenarbeit mit Sanofi Pasteur vertreiben wir unsere Impfstoffe in Europa ab 2017 wieder unter dem Namen MSD.
Erfahren Sie mehr auf: www.msd.de
CORP
-118
6339
-000
2 1
1/16
Konsens_2017_final.qxp_Konsens 21.12.17 08:37 Seite 2
ANSPRECHPARTNERINNEN, AUSSCHÜSSE UND KOMMISSIONEN 2017 – 2019
KONSENS 2017 3
Bayreuth
Irene Münch [email protected]
Berlin-Brandenburg Ursula Sarrazin [email protected]
Bielefeld Dr. Katharina Kreutzer [email protected]
Bochum Dr. Renate Klees-Möller [email protected]
Bonn-Rheinschiene Dr. Brigitte Witter [email protected]
Bremen Sabine Kopp-Danzglock sabine.kopp-danzglock@ web.de
Detmold Liebegard Wagner Rosenstr. 33, 32756 Detmold T+49 5231 26196
Dresden
Manuela B. Queitsch [email protected]
Düsseldorf (DAB-DUS) Dr. Sybille Buchwald-Werner [email protected] Gudrun Reissert [email protected]
Erlangen-Nürnberg Dr. Ingeborg Lötterle [email protected]
Essen
Dr. Patricia Aden [email protected]
Frankfurt
Dr. Rosemarie Killius (kommissarisch) [email protected]; [email protected]
Freiburg
Maike Busson-Spielberger M.A. [email protected]
Hannover
Ursula Früh [email protected]
Heilbronn (DAB Württemberg e.V.)
Prof. Dr. Ursula Probst [email protected]
Karlsruhe Michaela Geiberger [email protected]
Kiel
Dr. Mechthild Freudenberg [email protected]
Köln (Rheinschiene) Dr. Brigitte Witter [email protected]
Paderborn
Prof. Dr. Ruth Hagengruber [email protected]
Rhein-Neckar-Pfalz Ute Spendler [email protected]
Stuttgart (DAB Württemberg e.V.)
Prof. Dr. Ursula Probst [email protected]
Young Members im DAB Catrin Ebbinghaus [email protected]
Ausschüsse und Kommissionen des DAB2017-2019
• Wahlausschuss Prof. Dr. Sigrid Metz-Göckel Dr. Renate Vöcks Ute Spendler
• Rechtsausschuss Beatrix Oehmen Gudrun Altehoefer
• Förderausschuss Helene Haun Prof. Dr. Anne Schlüter (Vorsitzende) Dr. Renate Klees-Möller
• Rechnungsprüferinnen Juliane Schmidt Christa Hollnagel
DEUTSCHERAKADEMIKERINNEN
BUND E.V.M E M B E R O F U N I V E R S I T Y W O M E N E U R O P E ( U W E )
Bundesgeschäftsstelle BerlinDr. med. Patricia Aden,BundesvorsitzendeMichaela Gerlach, Leiterin der Geschäftsstelle
Sigmaringer Straße 110713 Berlin/GermanyTel. 030 - [email protected]
Konsens_2017_final.qxp_Konsens 21.12.17 08:37 Seite 3
ANSPRECHPARTNERINNEN INHALTSVERZEICHNIS
4 KONSENS 2017
• Antragskommission Dr. Patricia Aden Dr. Irmgard Kahl Erdmute Geitner
• Schiedskommission Prof. Dr. Sigrid von den Steinen Antonia Wigbers
• Beauftragte für das HPV-Frauennetzwerk Dr. Patricia Aden
• Beauftragte UN Women Prof. Dr. Elisabeth de Sotelo
• Delegierte für den Deutschen Frauenrat Elisabeth Thesing-Bleck
• Beauftragte Europäische Bewegung Prof. Dr. Elisabeth de Sotelo
• Delegierte der BAGSO Prof. Dr. Sigrid von den Steinen
Arbeitskreise• Frauen in Naturwissenschaft und Technik Dr. Ira Lemm (Sprecherin)
• Frauen, Politik & Wirtschaft Erdmute Geitner (Sprecherin)
• Arbeitskreis PHA – Frauen in derPharmazie
Annette Dunin v. Przychowski Dr. Anne Lewerenz und Antonie Marqwardt
■
homepage: www.dab-org.ev
SeiteAnsprechpartnerinnen 3Editorial der Bundesvorsitzenden Dr. Patricia Aden 6
NACHRICHTEN DAB-Rückblick Maria von Welser 7Seyran Ates Kandidatin für den Anne-Klein-Frauenpreis 2017 8Berliner Ehrennadel für Maren Heinzerling 10Deutscher Bücherpreis 2017 an Maren Heinzerling 11Engagement mit und für Studentinnen 12
AUS DER PRESSEVorrang für das »Wir-Prinzip« 13Petra Justenhoven Managerin des Jahres 2017 14Die Pharmazie ist weiblich 16Ehrenamtliche Arbeit unterstützt den Weg der Frauen in die Politik! 18Ute Spendler – Starthilfe für Akademikerinnen 19Gleichstellungspolitik muss auf die Agenda! 20Anneliese Uhlig. Die Frau, die sich Goebbels widersetzte 21
IM FOKUS „Ad Fontes!“ – Das Digitale Deutsche Frauenarchiv" 24Die Promotion 25Was macht die Macht mit Frauen? 28Die Telemann-Edition 31
DAB-AKTIVMitgliederversammlung des DAB 32Neustart der Regionalgruppe Berlin-Brandenburg 33DAB-DUS stellt sich vor 34DAB Rhein-Neckar-Pfalz Mitgliederversammlung und 60-Jahr-Feier 37Fachbeitrag für den Deutschen Frauenrat 39YouTube-Channel für den DAB Bremen 40
GEBURTSTAGE / NACHRUF 41
INTERNATIONALUWE-Konferenz in Graz 43D-A-CH-Treffen in Chur 45
ARBEITSKREISE UND AUSSCHÜSSEFrauen geben Technik neue Impulse 48women & work 2017 49Wechsel in der Leitung des AK-FNT 49Tagung des Arbeitskreises Frauen, Politik und Wirtschaft:
„Digitalisierung, Liberalisierung, Rollenverständnis“ 51Frau Architekt 54Frauen in der Pharmazie 54Erfolgreich im Ehrenamt 55Förderausschuss 2016/17 56 FORUMHPV-Frauen-Netzwerk in Berlin 58Die Wissenschaft einer ganz besonderen Barriere 59Impulsrede zur Sozialen Marktwirtschaft 60Die Energiewende ist ein Friedensprojekt 62Ein Jahr Center for the History of Women 64Ausblick auf die indigene Architektur Mittelamerikas 65 LITERATURDie Löwenstrategie 67Die verschleierte Gefahr 67
Die Künstlerin des Titelbildes 68Impressum 69
Konsens_2017_final.qxp_Konsens 21.12.17 08:37 Seite 4
ANSPRECHPARTNERINNEN
KONSENS 2017 5
DAB-Vorstand 2017 – 2019
1. VorsitzendeDr. Patricia Aden
2. Vorsitzende Manuela B. Queitsch
SchatzmeisterinClaudia Eimers
Schriftführerin Prof. Dr. Sigrid von den Steinen
CERDr. Rosemarie Killius
CIRDr. Oda Cordes
BeisitzerinAndrea Buchelt
BeisitzerinProf. Dr. Petia Genkova
BeisitzerinProf. Gudrun Schmidt-Kärner
© A
nne
Jüng
ling
Konsens_2017_final.qxp_Konsens 21.12.17 08:37 Seite 5
EDITORIAL
6 KONSENS 2017
Liebe Kolleginnen
Im Jubiläumsjahr der Reformation wurdenoch einmal deutlich, dass die kulturellen
Auswirkungen von Luthers Thesenanschlagbis heute in alle Lebensbereiche wirken –auch und besonders die von Frauen. Be-kannt ist, dass die Reformation einen Bil-dungsschub in Gang setzte. Volksschulenmit Schulpflicht wurden eingerichtet, aufausdrücklichen Wunsch von Luther auchfür Mädchen. Fast noch von größerer Be-deutung scheint mir, dass Luther, der ehe-malige Mönch, heiratete und mit seinerFrau eine für damalige Zeiten moderne Eheführte. Das war so etwas wie eine spirituelleRehabilitation der Frau. Denn nach der tra-ditionellen Auffassung der Kirche war dieFrau weniger würdig als der Mann. Begrün-det wurde das mit ihrem weiblichen Körperund ihrer Fähigkeit, Kinder zu gebären.
Die Verächtlichmachung des weiblichenKörpers hat sich bis in unsere Tage erhaltenund dient auch heute noch als Vorwand,Frauen aus bestimmten Bereichen auszu-schließen.
Sie äußert sich aber auch in sexueller Ge-walt, die aktuell im Fokus der öffentlichenDiskussion steht. Man mag es für übertrie-ben halten, dass 30 Jahre zurückliegendeFehltritte thematisiert und sozusagen aufZuruf Karrieren zerstört werden. Aber se-xuelle Belästigung ist nur die erste Eskala-tionsstufe von Gewalt gegen Frauen, dieüber Vergewaltigung und Freiheitsberau-bung nicht selten mit der Tötung endet.Erstmalig haben wir, auch in unseren eu-ropäischen Nachbarländern, eine breite ge-sellschaftliche Diskussion darüber und einenKonsens, dass sexuelle Belästigung kein Ka-valiersdelikt ist.
Die aktuelle Debatte wurde durch einenTweet mit dem Hashtag #MeToo bei Twitterausgelöst, ähnlich wie bei dem Hashtag#Aufschrei, der junge Netzfeministinnen
in der Öffentlichkeit bekannt gemacht hat.Die Auseinandersetzungen mit den The-men frauenfeindliches Verhalten, sexuelleBelästigung und sexuelle Übergriffe machendeutlich, dass es einen Generationenkonfliktum die Deutungshoheit zwischen alten undjungen Feministinnen gibt. Bei #MeTooallerdings hat sich ohne erkennbaren Ein-fluss von Meinungsführerinnen die Öffent-lichkeit selbst zu Wort gemeldet.
Die Digitalisierung wird oft als Zukunfts -vision beschworen, aber sie hat schon längstEinzug in unser Leben gehalten. Der Ar-beitskreis des DAB Frauen, Politik & Wirt-schaft hat sich im November mit den Aus-wirkungen in einer Fachtagung beschäftigt.
An dieser Stelle möchte ich Sie alle schonjetzt zu unserer nächsten öffentlichen Ta-gung im September 2018 nach Berlin ein-laden. Unter dem Thema „Kultureller Wan-del“ geht es um Digitalisierung und um Mi-gration, zwei sehr unterschiedliche Prozes-se, die jeder für sich unser Leben nachhaltigverändern.
Die Anregung für das Tagungsmotto habenwir von der UWE-Tagung in Graz mitge-nommen. Auch die DACH-Tagung in Churbrachte noch einmal viele Denkanstößedazu. Der DAB bleibt auch in Zukunft in-ternational orientiert, für viele unsererneuen Mitglieder war gerade dies derGrund für ihren Eintritt in den Verband.
Unsere Arbeit beruht auf dem Engagementvieler Kolleginnen, die in Regionalgruppenund Arbeitskreisen nachhaltige Projekte or-ganisieren und durchführen und so zumgesellschaftlichen Zusammenhalt und zurpositiven Außenwahrnehmung des DABbeitragen.
Nicht zuletzt gilt das für die Vorstandsmit-glieder, die neben der überregionalen Ver-tretung oft im Stillen ihre Arbeit bewältigen.Ihnen allen gilt mein Dank für die geleisteteArbeit für und mit dem DAB.
Im Namen des Vorstandes grüße ich Sieund wünsche Ihnen allen ein gutes Jahr2018
Ihre
Dr. Patricia Aden, 1. Vorsitzende
Bitte an alle Mitglieder:
Senden Sie uns IhreE-Mail-Adressen!Das erleichtert dieKommunikation.
Konsens_2017_final.qxp_Konsens 21.12.17 08:37 Seite 6
Da ich aus gesundheitlichen Gründenmeinen zweiten Vorsitz und auch
sonst so alle anderen Ehrenämter aufgebe,möchte ich – wie es aus meiner Sicht guterBrauch ist – quasi einen Bilanz-Bericht ab-geben: über meine vier Jahre, als zweiteVorsitzende des DAB, als Chefredakteurindes KONSENS und als Verantwortliche fürdie website.
Denn Sie alle haben mich ja damals ge-wählt und mir diese Ämter übertragen. Daist es nur guter Stil, zu berichten, was ichhiermit tue.
Erinnern Sie sich noch an die alte website??Da „staubte“ es ein wenig, und darumhaben wir auf einer der ersten Vorstands-sitzungen bereits 2013 beschlossen, diesewebsite neu zu gestalten. Von den einzel-nen Schritten habe ich Ihnen ja dann auchimmer wieder berichtet und heute – ichweiß nicht, wie es Ihnen so geht dabei –heute können wir uns gar nicht mehr erin-nern, dass es anders gewesen sein könnte.Das frische Layout in allen Blautönen, dielockere Anmutung, die klare Gliederung.Wie einfach es jetzt ist, dort auch denKONSENS nachzulesen...
Es war ein dickes Brett, diesen Web-Auf-tritt so zu gestalten, dass er einfach und wievon selbst zu begreifen ist – selbsterklärendist das Wort heute dazu – und dass wir auchimmer alle Wünsche und Vorschläge zeit-nah umgesetzt haben. Zusammen mit An-drea Dittler in Hamburg und Dineke Baar-link, die sich intensiv mit dem äußeren Auf-tritt beschäftigt hat, ist das gut gelungen.Und mit Michaela Gerlach in Berlin, diesich sehr schnell eingefunden hat und in-zwischen die website technisch prima
betreut …Vielleicht mögen Sie in einer un-serer Pausen auch mal wieder draufgucken... es macht wirklich Spaß darin zu klickenund zu lesen...
Dann haben wir einen neuen Flyer aufden Weg gebracht. Auch das: nicht so ein-fach. Aber jetzt ist er da, wird dann auchhin und wieder mal verbessert, wenn je-mand gute Textvorschläge hat, das ist keinallzu teurer Vorgang. Es gibt ihn jetzt auchin Englisch, Französisch und Spanisch,danke Rosemarie Killius.
Sie haben, damit Sie auch immer auf demLaufenden sind, was so im Vorstand ge-schieht, was so in der Geschäftsstelle pas-siert, alle drei Monate einen Rundbrief vonFrau Dr. Aden und mir erhalten. Das hatsich sehr bewährt.
Und schließlich sprechen wir im Vorstandso alle zwei Monate per Telefonkonferenzmiteinander, da gibt es dann auch eine Ta-gesordnung. Telefonkonferenz auch des-halb, damit nicht immer zu hohe Reisekos-ten anfallen, wenn sich der Vorstand in Han-nover oder in Berlin zusammenfindet.
Schließlich haben wir ein Mentoring-Pro-gramm auf den Weg gebracht. Dabei sinderst mal alle Vorstandsmitglieder und auchalle anderen Frauen im DAB angefragt wor-den, wer sich als Mentorin zu Verfügungstellen mag. Die Resonanz war ermutigend.Es wurden dann die Lebensläufe und be-ruflichen Kenntnisse der Mentorinnen desDAB auf der website zusammen mit einemFragebogen eingestellt und die ersten jün-geren Interessierten haben sich – fast allein Berlin – bei Frau Gerlach gemeldet. In-zwischen betreuen Frau Dr. Oda Cordesund Frau Buchelt Mentees. Ich habe mich
konsequenterweise auch hier ausgeklinkt.Aber je mehr die website akzeptiert wirdund angeklickt, umso mehr interessiertejunge Frauen werden sich melden...
Da gerade in den Anfängen mit website,KONSENS, Flyer, Neuaufstellung und Er-arbeitung eines auf den DAB ausgerichtetenPresseverteilers viel an neuen Aufgaben an-stand, hatten wir bis vor Kurzem auchimmer eine junge Studentin als quasi Refe-rentin in der Geschäftsstelle. Inzwischenist alles so eingespielt, dass Frau Gerlach inZusammenarbeit mit Frau Dittler super mitdem Einstellen der Texte und Bilder auf diewebsite zurechtkommt, sodass dieser Auf-gabenbereich jetzt wegfällt.
DAB-Rückblick Maria von Welserauf vier Jahre als zweite Vorstandsvorsitzende,
Chefredakteurin KONSENS und verantwortliche Redakteurin der website
Auf der DAB-Mitgliederversammlung am 2. September 2017 in Frankfurt
NACHRICHTEN
KONSENS 2017 7
Fotovermerk: Schneiderpreis
Konsens_2017_final.qxp_Konsens 21.12.17 08:37 Seite 7
Mit Beginn des Jahres 2014 habe ich ins-gesamt 4 KONSENS-Ausgaben verantwor-tet. 280 Heftseiten. Es war mir, als Journa-listin mit Leib und Seele, eine große Freudeund Herausforderung.
Nur noch einige unserer wichtigsten The-men zur Erinnerung: Häusliche Gewalt imVisier, Null Toleranz bei Genitalverstüm-melung, NRW Hochschulgesetz muss über-arbeitet werden. Wir forderten die Teilhabevon Frauen an den syrischen Friedensge-sprächen in Genf – da hat uns dann auchdie damalige Frauenministerin ManuelaSchwesig geantwortet.
In einem großen Interview stand Wissen-schaftsministerin Johanna Wanka Rede undAntwort und forderte unter anderem dasEnde einer gläsernen Decke. Helene Haunberichtete bereits 2014 über einen span-nenden Vortrag von Prof. Dr. Martina Ha-venith-Newen, unserer Sophie-Roche-Preis-trägerin 2016. Und jetzt DAB-Mitglied. Dazeigt sich dann für mich auch wieder, dasses lang geplanter kluger Strategien bedarf,wollen wir mehr und auch junge Mitgliedergewinnen.Aus finanziellen Gründen haben wir unsdann 2015 im Vorstand entschlossen, nureinen KONSENS herauszubringen. Wissen-
schaft und Kinder- kein Problem? Und dasbeindruckende Interview von RosemarieKillius mit der Literatur-NobelpreisträgerinSwetlana Alexijewitsch – das waren diegroßen Themen.
Aber auch: das Verdienstkreuz an unsereehemalige Vorsitzende Dagmar Pohl-Lau-kamp, dann ein Ausblick auf den „PreisFrauen Europas“ mit der Preisträgerin deskommenden Jahres Adriana Lettrari, miteiner Liste, welche Frauen in DeutschlandUniversitäten und Hochschulen leiten( kannjederzeit nachgebessert und vervollständigtwerden.)
Ein großes, wichtiges und kontroversesThema war dann der Austritt aus derIFUW/GWI. Und die Kopftuchdiskussion,nicht nur im öffentlichen Dienst. Die ja bisheute noch nicht beendet ist.
Das Heft 2016 geriet mit 88 Seiten beson-ders dick. Auch weil ich groß und breit dasJubiläum „90 Jahre DAB“ abgebildet habe.Mit allen Reden und Grußworten. Ichdenke, das Heft ist bis zum heutigen Taglesenswert und eine gute Nachschlage-Un-terlage für uns alle im DAB.
Netzwerke in der Wissenschaft war dasThema von Prof. Dr. Anne Schlüter, die
„Managerin des Jahres“ kam zu Wort, eineVeranstaltung unseres Mitglieds Prof. Dr.Ulrike Detmers.
Unsere deutschen Arbeitsgruppen undihr Einsatz, ein Blick in das UN-Headquarterund auf die Kommission für die Rechtsstel-lung der Frau. Diese Überschriften nur nochzu Erinnerung.
Und da auch der KONSENS unabhängigseiner Inhalte vom Titel und vom Bild lebt:Prof. Dr. Elisabeth de Sotelo hat für jedesHeft spannende Künstlerinnen aufgetanund wunderbare Cover vorgeschlagen. Me-teoritenfalle – Ab aufs Feld – Rückblick aufdie Hochzeit von Vater und Mutter. Daswaren nur einige Titel …
Jetzt wünsche ich dem neu zu wählendenVorstand viel Glück, Freude an der span-nenden Arbeitt – und es ist Arbeit – undbedanke mit vor allem bei Patricia Aden fürdiese harmonischen, guten Jahre der Zu-sammenarbeit. Zwischen uns hat einfachkein Blatt Papier gepasst. Nur so geht es –und nur so wird es was. Ich denke in diesenvier Jahren: da ist vieles „geworden“...
■
NACHRICHTEN
8 KONSENS 2017
Seyran Ates eine herausragende Kandidatinfür den Anne-Klein-Frauenpreis 2017Auf der Mitgliederversammlung am 2. September in Frankfurt am Main schlägt Prof. Dr. Elisabeth de Sotelo alsKandidatin 2017 RA Seyran Ates vor. Sie skizziert den Lebenslauf und die bisherigen Lebensleistungen der deutsch-türkischen Juristin, Schriftstellerin und Aktivistin. Die Mitglieder der MGV stimmen dem Vorschlag einstimmigzu.
Seyran Ates, Initiatorin und Mitbegrün-derin der Ibn-Rushd-Goethe-Moschee
in Berlin, ist eine kämpferische Juristin, diesich für die Gleichstellung von Frauen, Re-ligionsfreiheit und die Nichtdiskriminierungsexuellen Verhaltens engagiert. Unter Ein-satz ihres Lebens verfolgt sie ihre Prinzipien
der Trennung von Religion und Staat, derSelbstbestimmung von Frauen und der In-tegration von MigrantInnen.
Als deutsche Rechtsanwältin, Autorin undFrauenrechtlerin türkisch-kurdischer Her-kunft befasst sie sich in Berlin hauptsächlich
mit Strafrecht und Familienrecht und hatsich außerdem in der deutschen Auslän-derpolitik engagiert. Sie war Mitglied derDeutschen Islamkonferenz (27.09.2006 inBerlin) und nahm am Integrationsgipfel derBundesregierung teil, der ab 2006 jährlichstattfindet.
Konsens_2017_final.qxp_Konsens 21.12.17 08:37 Seite 8
NACHRICHTEN
KONSENS 2017 9
Seyran Ates, deren Mutter Türkin undderen Vater Kurde ist, hat 2003 in ihremautobiografischen Buch „Große Reise insFeuer – Die Geschichte einer deutschenTürkin“, die beengten Verhältnisse beschrie-ben, aus denen sie sich persönlich befreithat. Im Alter von sechs Jahren zog sie vonIstanbul zu ihren Eltern nach Berlin-Wed-ding. Die Eltern kamen nach Deutschlandals Gastarbeiter. In der sehr kleinen BerlinerWohnung hatte sie die herkömmliche Frau-enrolle zu erfüllen. Sie musste ihren Bruderund die Eltern bedienen und durfte nichtalleine das Haus verlassen. Für Ungehorsamwurde sie geschlagen und beschimpft. Inder Vorschule blieb sie als einzige Türkinmangels hinreichender deutscher Sprach-kenntnis zunächst sozial isoliert. Sie lernteaber sehr schnell Deutsch und gehörte be-reits in der 1. Klasse zu den besten Schülern.Mit einer Empfehlung für das Gymnasiumging sie schließlich aus eigener Entschei-dung auf eine Gesamtschule und machteim Hinblick auf ihren Wunsch, Jura zu stu-dieren, das Abitur am OberstufenzentrumWirtschaft-Verwaltung-Recht. Auf der Ge-samtschule wurde sie zur Schulsprecheringewählt. Die Entfremdung zwischen re-pressiver Erziehung und schulischer Aner-kennung ertrug sie nicht länger. Mit 17 ver-ließ sie heimlich das Elternhaus und lebtebis zum Abitur in einer Wohngemeinschaftbei einer befreundeten Rechtsanwältin.
Zur Finanzierung ihres Jurastudiums ander Freien Universität Berlin arbeitete siein dem Kreuzberger Treff- und Informati-onsort für Frauen aus der Türkei TIO fürtürkische und kurdische Migrantinnen, diesich vor der häuslichen Gewalt in ihren Fa-milien schützen wollten. 1984 erschosswährend der Beratung ein Mann ihre Klien-tin Fatma E. und verletzte Seyran Ates le-bensgefährlich. Dabei hatte Ates ein Nah-toderlebnis. Der Tatverdächtige wurde vonihr und sechs anderen Zeugen identifiziertund später konnte seine Mitgliedschaft inder nationalistischen türkischen GruppeGraue Wölfe nachgewiesen werden, für dieer als Auftragskiller gearbeitet haben soll.Nachdem der Tatverdächtige freigesprochen
wurde und bis heute unbehelligt in Berlin-Kreuzberg lebt, warf Ates den BehördenErmittlungsfehler und Schlamperei vor. EinVertreter des Verfassungsschutzes äußerte,dass es keinen Verein mit dem NamenGraue Wölfe gäbe, daher könne er sichnicht äußern. Die Genesung und Heilungvon den Folgen des Attentats zog sich übersechs Jahre hin. 1997 legte sie ihr zweitesStaatsexamen am Kammergericht Berlin abund beendete damit erfolgreich ihr Rechts-referendariat.
Sie wendet sich in der Integrationsdebattegegen das in ihren Augen gescheiterte Kon-zept der Multikulturalität und vertritt statt-dessen die Idee der Transkulturalität. Siekämpft mit Vorträgen und Veröffentlichun-gen gegen das Kopftuch (ungeachtet ihrerteilweise kopftuchtragenden Mutter, dieihren Einsatz unterstützt), gegen Zwangs-heirat und Ehrenmorde. Sie setzt sich fürmehr aufsuchende Sozialarbeit in Familienmit türkischer und kurdischer Herkunft einund forderte als erste einen eigenen Straf-tatbestand gegen Zwangsverheiratung, derFrauen und Männer besser vor Zwangsehenschützt. Sie gehörte zu den Unterstützerin-nen der Mahnwache für das Ehrenmord-Opfer Hatun Sürücü.
Wegen gewalttätiger Angriffe und Bedro-hungen durch Prozessgegner sowie wegenAnfeindungen von verbandspolitischer Seitegab sie im August 2006 vorübergehend ihreAnwaltszulassung zurück. Im Oktober2009 teilte der Ullstein Verlag mit, dass sichAtes nach neuen Morddrohungen und un-mittelbarer Gefahr für sie selbst und ihreFamilie ganz aus der Öffentlichkeit zurück-ziehen werde. Erst wieder seit Sommer2011 tritt sie erneut in der Öffentlichkeitauf, im Sommer 2012 eröffnete sie erneutihre Anwaltskanzlei.
Die Ibn-Rushd-Goethe-Moschee ist eine li-berale Moschee in Berlin. Sie wurde am16. Juni 2017 eröffnet. Ihre Gründung gehtmaßgeblich auf die Rechtsanwältin undFrauenrechtlerin Seyran Ates zurück. Wei-tere Gründer sind unter anderem der Arzt
und Schriftsteller Mimoun Azizi, die Men-schenrechtsaktivistin Saïda Keller-Messahli,die Politologin Elham Manea und der Is-lamwissenschaftler Abdel-Hakim Ourghi.Die Moschee besitzt kein eigenes Gebäude,sondern benutzt zurzeit einen Raum ineinem Nebengebäude der evangelischenKirche St. Johannis in Berlin-Moabit, einKarl-Friedrich-Schinkel-Bau von 1835.
Die Benennung der Moschee erfolgtenach dem andalusischen Arzt und Philoso-phen Averroës (arab. Ibn Ruschd, 1126 –1198), der im Mittelalter für seine Kom-mentare zum Werk von Aristoteles bekanntwar, sowie nach dem deutschen Schriftstel-ler Johann Wolfgang von Goethe (1749 –1832) in Würdigung seiner Auseinander-setzung mit dem Islam, z. B. im West-Öst-lichen Divan.
In der Moschee soll ein liberaler Islampraktiziert werden. So sollen Frauen undMänner gemeinsam beten, auch die Predigtsoll von Frauen gesprochen werden kön-nen. Homosexuelle Männer und Frauenseien ausdrücklich willkommen. Ferner solldie Moschee verschiedenen islamischenKonfessionen offenstehen, darunter Sunni-ten, Schiiten, Aleviten und Sufis.
Zu Ehren Anne Kleins vergibt die Heinrich-Böll-Stiftung den Anne-Klein-Frauenpreis.Anne Klein hat als kämpferische Juristinund offen lesbisch lebende Politikerin fe-ministische Pionierarbeit geleistet. Sie wardie erste feministische Frauensenatorin inBerlin. Mit dem Preis fördern die Heinrich-Böll-Stiftung jährlich Frauen, die sich durchherausragendes Engagement für die Ver-wirklichung von Geschlechterdemokratieauszeichnen. Der Preis ist mit 10.000 €dotiert.
Der Anne-Klein-Frauenpreis 2017 ist nichtan Frau Ates, sondern an NomarussiaBonase gegangen, Kämpferin für Frauen-rechte und Gerechtigkeit in Südafrika.
Der DAB gratuliert Frau Bonase zu diesemPreis.
■
Konsens_2017_final.qxp_Konsens 21.12.17 08:37 Seite 9
NACHRICHTEN
10 KONSENS 2017
Der Berliner Senat für Migration, Arbeitund Soziales verleiht unserem lang-
jährigen Mitglied im DAB-Arbeitskreis„Frauen in Naturwissenschaft und Tech-nik“, Dipl.-Ing. Maren Heinzerling, die Ber-liner Ehrennadel für ihre unermüdliche undkonstante ehrenamtliche Tätigkeit.
Seit dem Eintritt in die 3. Lebensphase –wie Maren Heinzerling die Zeit ihres Ru-hestandes nennt – ist sie mit unermüdli-chem Einsatz in Berliner Grundschulen eh-renamtlich aktiv. Gestartet hat die pensio-nierte Eisenbahningenieurin Dipl.-Ing.Maren Heinzerling vor mehr als 10 Jahrendas Projekt „Zauberhafte Physik“ mit demZiel, bei Mädchen und Jungen insbesonderein Berliner Brennpunkt-Grundschulen dasInteresse für Naturwissenschaft und Tech-nik zu wecken. Gemeinsam mit engagiertenSenioren_innen hat sie Physikexperimentemit Materialien aus dem Umfeld der Kinderentwickelt, die einfach nachzubauen sind.Entstanden ist inzwischen eine Sammlungvon mehr als 100 Experimenten aus denThemenfeldern Ruhende Luft, BewegteLuft, Wasser, Strom, Magnete, Kraft, Hebel,Reibung und Akustik, die seit 2007 in über40 Berliner Grundschulen entwickelt underprobt werden konnten.
Die Experimente sprechen auch Erwach-sene an, werden dadurch Seniorinnen undSenioren sensibilisiert, ihr Wissen an Kinderweiterzugeben. Und ans Feiern hat Maren
Heinzerling auch gedacht – mit den viel-fältigen Party-Versuchen.
Die Zauberhafte Physik ist sukzessive wei-ter-entwickelt worden über „ZauberhaftePhysik mit Unterrichtsmodulen“ bis zu„Zauberhafte Physik mit Sprach- und Sach-kisten“ und „Zauberhafte Physik mit Flücht-lingskindern“, was ihr eine Nominierungfür den diesjährigen Integrationspreis derKanzlerin einbrachte. Mit der „Zauberhaf-ten Physik“ ist Maren Heinzerling ein wun-derbares Experiment gelungen: Die Kinderlesen selbst die Versuchsanleitungen, lernendabei die deutsche Sprache zu begreifenund können dann die physikalischen Ge-setze der Natur in einem selbst gebautenVersuch mit ihnen bekannten Materialienkennenlernen. Der jüngst erschiene Doku-mentationsfilm zeigt die Lebendigkeit einerUnterrichtsstunde mit Flüchtlingskindern– siehe //www.zauberhafte-physik.netunter den „Neuigkeiten“.
Flüchtlingskinder in den Altersgruppenvon 6 bis 9 Jahren, von 9 bis 12 Jahren undälter arbeiten zu zweit und mit viel Neugierdurch einen stark vereinfachten Anleitungs-text, um das beschriebene physikalischeExperiment zusammenbauen zu können.Maren Heinzerling ist begeistert von denlebendigen und findigen Kindern aus allerHerren Länder und von den Lehrkräftender Flüchtlingsklassen, die sich engagiertins Zeug legen, um ihren Schützlingen dieAnfangsgründe der deutschen Sprache bei-
zubringen, bis sie dem Unterricht in Regel-klassen folgen können und in die Regelklas-sen versetzt werden.
Heinzerling ist überzeugt, wenn ihreSchützlinge irgendwann in ihre Heimatlän-der zurückkehren, werden sie vielleichtvergessen, ob es „die Schere“ oder „dasSchere“ heißt, aber die physikalischen Er-fahrungen und das durch die Experimentegeweckte Interesse wird sie nachhaltig be-gleiten...
Das Engagement und die spielerische Art,Kindern gleichzeitig Deutsch und Natur-wissenschaft beizubringen, werden jetztvon der Stadt Berlin öffentlich anerkannt.Wir gratulieren Maren Heinzerling ganzherzlich für die Auszeichnung mit der Ber-liner Ehrennadel!
Die Lesetexte, Versuchserfahrungen undEinkaufstipps veröffentlicht Heinzerlingzum kostenlosen Download und Nachma-chen auf der Webseite www.zauberhafte-physik.net. Einige Lehrkräfte sind bereitsso fit, dass sie die Lesekisten selbst zusam-menstellen. Sie müssen ihre Freizeit dafüraufwenden, denn noch fehlt ein Hersteller.
18.07.2017Dr. rer. nat. Sabine Hartel-SchenkArbeitskreis „Frauen in Naturwissenschaftund Technik“ im Deutschen Akademiker-innnenbund e.V.http://www.dab-ev.org/de/wer-wir-sind/ak-fnt.php
■
Maren Heinzerling erhält die Berliner Ehrennadel für ihre langjährigeehrenamtliche Tätigkeit
Die Zeitschrift KONSENS erscheint einmal im Jahr und kann auch ohne Mitgliedschaft im DAB abonniert werden.
Sigmaringer Straße 1 · 10713 Berlin · Tel. 030 - 3101 6441 · E-Mail: [email protected] · Internet: www.dab-ev.orgAbonnementpreis siehe Impressum Seite 69
Konsens_2017_final.qxp_Konsens 21.12.17 08:37 Seite 10
NACHRICHTEN
KONSENS 2017 11
Der Deutsche Bürgerpreis ist der höchs-te Ehrenamtspreis, der in Deutschland
vergeben wird. Eine Jury aus Bundestags-abgeordneten, dem Deutschen Städtetag,dem Deutschen Landkreistag, dem Städte-und Gemeindebund sowie den Sparkassenverleiht den Preis für herausragendes Eh-renamt. Allein in diesem Jahr wurden mehrals 1.400 Personen dafür vorgeschlagen.
Am 15.11.2017 wurde der Preis im ZDF-Hauptstadtstudio feierlich von Bundesprä-sident Dr. Frank-Walter Steinmeier an unserlangjähriges Mitglied Maren Heinzerlingfür ihr Lebenswerk überreicht. Die Ober-bürgermeisterin von Ludwigshafen Dr. jur.Eva Lohse hielt die Laudatio. Ein eigens zudiesem Anlass fertiggestellter Film der FirmaMACONDO löste große Begeisterung beimAuditorium aus.
Maren Heinzerling war 1958 die einzigeFrau, die sich für ein Studium des Allgemei-nen Maschinenbaus an der TH Münchenzusammen mit 300 Kommilitonen einge-schrieben hatte. Ihr Berufsweg war vonSchwierigkeiten, wie sie die Vereinbarkeitvon Beruf und Familienaufgaben mit sichbringt, geprägt. Während ihrer zehnjährigenFamilienphase arbeitete Maren Heinzerlingals selbständige technische Lektorin im Sie-mens-Fachbuchverlag. Danach übte sie 15Jahre lang eine Teilzeittätigkeit aus, umdann im Jahre 1993 als Vertriebsleiterin fürNahverkehrssysteme für die Regionen Afri-ka, Aus tralien und Asien nach Berlin beru-fen zu werden. Personalverantwortungtrotz Teilzeit war zu dieser Zeit noch un-denkbar, doch sorgte dieses Beschäftigungs-verhältnis dafür, dass sie immer dort einge-setzt wurde, wo gerade Engpässe entstan-den waren: in der Berechnung, der Ent-wicklung, der Systemtechnik, im Marketingund im Kundendienst.
„Aufgrund meines Teilzeit-Handicapsdurchlief ich quasi ein Trainee-Programm
und konnte später, als die Familienaufga-ben eine Vollzeittätigkeit zuließen, aufeinen breit gefächerten Erfahrungsschatzaufbauen. Ich habe meinen Beruf stets alszuverlässigen und interessanten Freunderlebt, der mich zudem wirtschaftlich un-abhängig gemacht hat“, so Maren Hein-zerling während der Preisverleihung.
Mit dieser Einstellung hat Maren Hein-zerling sich Jahrzehnte ihres Lebens darumbemüht, junge Menschen, insbesonderejunge Frauen, für diesen Beruf zu begeistern.Der Arbeitskreis „Frauen in Naturwissen-schaft und Technik“, den sie 1986 zusam-men mit Dipl.-Ing. Barbara Leyendecker imDeutschen Akademikerinnenbund e.V. grün-dete, hat sie dabei unterstützt und ihr auchimmer wieder neue Anregungen gegeben.
Nach ihrer Pensionierung bereiste sie zu-nächst drei Jahre lang mit dem Rucksackihr geliebtes Asien. Danach warb sie zu-sammen mit der Arbeitsgruppe „Multimo-bil“ im Verein Deutscher Ingenieure e.V.für eine bessere Verknüpfung der öffentli-chen Verkehrssysteme und insbesonderefür eine werbende Hinleitung zum Nahver-kehr. Angeregt durch den Schulwechselihrer Enkelin wandte sie sich 2007 der Mo-tivation von Grund schü ler_innen für Physikzu. Zusammen mit der Bürgerstiftung Berlinrief sie 2007 die „Zauberhafte Physik mitUnterrichtsmodulen“ ins Leben, 2013 danndas darauf aufbauende Projekt „ZauberhaftePhysik mit Sprach- und Sachkisten“. Diesegelungene Kombination von Sprach- undPhysikförderung für 7- bis 12-jährige Kinderschult nicht nur feinmotorische Fähigkeitenund sinnerfassendes Lesen, sondern trainiertauch handlungsorientiertes Arbeiten. Damitlegt das Projekt einen spielerischen Grund-stein für die Begeisterung der Naturwissen-schaft in einer entscheidenden Schulphase.
Zusammen mit ihrem Team von Physik-paten hat sie die Sprach- und Sachkisten
für Flüchtlingskinder modifiziert. „Deutschlernen mit Physik“ macht den Kindern ausvielen Ländern großen Spaß. Die gesamteDokumentation gibt es zum kostenlosenDownload auf: www.zauberhafte-physik.net
Das nächste Ziel ist es, das Projekt bundes-weit zu verbreiten. Dafür braucht sie leis-tungsstarke Partner im Bildungsbereich undeinen Schirmherrn oder eine Schirmherrin,um das Projekt weiterzutragen.
Wir gratulieren Maren Heinzerling sehrherzlich zum Deutschen Bürgerpreis fürdie Anerkennung ihres unermüdlichen En-gagements.
15.11.2017Autorin: Manuela B. Queitsch, ZweiteVorsitzende des Deutschen Akademiker-innnenbundes e.V.Mehr Informationen unter: http://www. dab-ev.org/de/wer-wir-sind/ak-fnt.php ■
Verleihung des Deutschen Bürgerpreises2017 an Maren Heinzerling
Maren Heinzerling mit der Laudatorin Dr. EvaLohse (OB Ludwigshafen) und dem ModeratorMitri Sirin
Konsens_2017_final.qxp_Konsens 21.12.17 08:37 Seite 11
NACHRICHTEN
12 KONSENS 2017
Im Jahr 1987 wurde ich als Diplom-Poli-tologin und damalige wissenschaftliche
Mitarbeiterin am Otto-Suhr-Institut für Po-litikwissenschaft (OSI) zur Frauenbeauf-tragten gewählt. Mit den Stimmen nahezualler Studentinnen, die sich an der Wahlbeteiligten, erhielt ich diese Funktion alsehrenamtliche Aufgabe.
Der Deutsche Akademikerinnenbund for-derte bereits 1985 „eine Professorin alsFrauenbeauftragte an jeder Hochschule mitweitgehenden Kompetenzen“; 1990 sprachsich auch das Plenum der WestdeutschenHochschulrektorenkonferenz für die Insti-tutionalisierung von Frauenbeauftragtenan Hochschulen aus. In dieser Zeit wurde,beispielsweise an den Universitäten in Ham-burg und Frankfurt, intensiv über die Eta -blierung von Frauenbeauftragten diskutiertund diese Idee allmählich auf andere Hoch-schulen übertragen.
Dass die Studentenbewegung der „68er“am OSI besonders aktiv war und in man-chen universitären Veränderungen oft eineVorreiterrolle spielte, lag in der Natur derSache. So war auch die neue feministischeFrauenbewegung dort besonders virulentund aktiv. Dies galt ebenso für die gesamteFreie Universität, denn beispielsweise gabes eine Einrichtung für Frauenforschung,bevor es Frauenbeauftragte gab.
Ich erinnere mich am OSI nicht nur ansehr bewegte Zeiten, sondern auch an ver-schiedene „linke“ politische Auseinander-setzungen in der Studentenschaft und denProfessorinnen. Ebenso an das große Enga-gement der Studentinnen, aus welchemdie feministische Frauenbewegung ent-stand. Aber die unterschiedlichen Strömun-gen innerhalb der feministischen Bewegunghatten dennoch gemeinsame Ziele imKampf um Gleichberechtigung und Chan-cengerechtigkeit für Studentinnen und Stu-
denten, in der Wissenschaft und Forschung.Entsprechend habe ich meine Funktion
als erste Frauenbeauftragte am OSI begrif-fen, als Engagement und Arbeit mit und fürdie Studentinnen. Es galt, ihre Interessenim Studium und hinsichtlich einer mögli-chen wissenschaftlichen Laufbahn inner-halb der Universität zu unterstützen. Spe-zielle Sprechstunden gab es bei mir nicht;ich hatte eine Ganztagsstelle mit Anwesen-heitspflicht und so war meine Bürotürimmer für Gespräche offen. In Einzelge-sprächen waren es sehr unterschiedlicheProbleme, die ich mit den Studentinnenbesprach. Die Palette reichte bis zur Pro-blematik sexueller Belästigung.
Als Frauenbeauftragte war es im Wesent-lichen meine Aufgabe, AnsprechpartnerinAnsprechpartnerin für Studentinnen zusein, für ihre Probleme im Studium oder inanderen universitären Situationen. DieseBegrenzung lag daran, dass wir alle allge-meinen Interessen bezogen auf Lerninhalte,Prüfungsformen, feministische Thematiketc. in diversen Gruppen besprachen undversuchten, die Ergebnisse in Institutsrats -sitzungen durchzusetzen. Dabei kam esvor, dass wir den Professoren bei den Rats-sitzungen Blumensträuße überreichten odereben auch mal Eier durch die Luft flogen.Das Besondere bestand für mich darin, dasswir viele Forderungen das Frauenstudiumbetreffend gemeinsam zu verwirklichensuchten, trotz mitunter unterschiedlicherfeministischer Auffas sungen.
So gab es eine Zeitlang sogenannte Frau-enseminare, in denen Studentinnen dieMöglichkeit hatten, sich mit frauenspezifi-schen Themen, wie der Rolle der Frauenim politischen System der Bundesrepublik,zu befassen. Die Schwierigkeit dabei warArtikel 3, Absatz 2 des Grundgesetzes (GG),denn wir ließen in unseren Frauensemina-
ren keine männlichen Studenten zu. Nachlangen strittigen Auseinandersetzungen mitder Professorenschaft am Institut wurdenaber diese Veranstaltungen „geduldet“.Eines Tages erschien zu einer meiner Se-minarveranstaltungen ein Student mit Baby,Kinderwagen und Zubehör und nahm nunständig an dem Seminar teil. Wir freutenuns darüber und hatten nun auch Artikel3 Absatz 2 GG erfüllt.
Ein anderes Arbeitsfeld war, wenn manso will, die Etablierung einer sogenanntenFrauenprofessur. Diese spezielle Professurwar von den professoralen Mitgliedern desInstitutsrates natürlich nicht gewollt unddie Auswahl wurde lange intensiv und kon-trovers in den Frauengruppen diskutiert.Letztendlich gelang es, eine habilitierte Frauzu berufen. Doch der Einfluss der Frauen-beauftragten war nicht groß genug, um eineinheitliches Votum unter den Frauen zuerreichen. Als der Direktorenposten für diegroße Präsenzbibliothek des Institutes neuzu besetzen war, war ich als Frauenbeauf-tragte natürlich Mitglied der Einstellungs-kommission und hatte so auch darin Stimm-recht. So gelang es, erstmals eine Frau alsDirektorin dieser Bibliothek einzustellen.
Schließlich wurde ich auf Vorschlag „DerGrünen“ am OSI einstimmig als Kandidatinfür die Wahl zum Akademischen Senat derFreien Universität gewählt. So hatte ichdann die Gelegenheit, mich durch Gesprä-che im Akademischen Senat für eine be-stimmte Bewerberin für die Stelle der Zen-tralen Frauenbeauftragten zu engagierenund einzusetzen, welche letztlich auch ge-wählt wurde. Im Akademischen Senat er-lebte ich noch den Mauerfall und die erstenBegegnungen mit Vertretern der Humboldt-Universität zu Berlin. Zu dieser Zeit began-nen dann auch lebhafte Kontakte zu denfrauenpolitisch engagierten Frauen in Ost-
Erinnerungen: 30 Jahre Frauenbeauftragte an der Freien Universität Berlin
„Engagement mit und für Studentinnen“ Von Erdmute Geitner
Konsens_2017_final.qxp_Konsens 21.12.17 08:37 Seite 12
NACHRICHTEN
KONSENS 2017 13
AUS DER PRESSE
Berlin. Sie bildeten eine wichtige Grundlagefür die nachfolgende Zusammenarbeit inder Landeskonferenz der Frauenbeauftrag-ten an Berliner Hochschulen ab 1991.
Autorin: Erdmute Geitner, DAB-Mitglied,ist Diplom-Politologin und heute Spreche-rin des DAB-Arbeitskreises „Frauen, Politikund Wirtschaft“ in Berlin. Sie war Frauen-
beauftragte am Otto-Suhr-Institut von 1987bis 1991. [email protected]
■
Gesellschaftliches Engagement wird beider Gütersloher Großbäckerei Meste -
macher großgeschrieben. Gerade erst wurdeder neue Wettbewerb »Gemeinsam leben«kreiert. Die Ziele und Erfahrungen mit denbisherigen Preisen erläutert die geschäfts -führende Gesellschafterin Prof. Ulrike Det-mers im Gespräch mit Bernhard Hertlein.
Wie lange gibt es Social Marketing?Ulrike Detmers: Wenn man unter CSR,
also Corporate Social Responsibility, undSocial Marketing in erster Linie das sozialeEngagement von Unternehmen versteht,gibt es das seit ewigen Zeiten. Die Wissen-schaft hat vor etwa 20 Jahren begonnen,daraus ein systematisiertes Konzept zu ent-wickeln.
Und wie hat das Konzept den Weg zuMestemacher gefunden?
Detmers: Unser erstes Projekt, »Panemet Artes«, also die Verbindung des ProduktsVollkornbrot mit Kunst, startete 1994. Wasden Schwerpunkt Gleichstellung der Ge-schlechter in der Wirtschaft sowie die Ver-knüpfung von Beruf und Familie betrifft,so gibt es natürlich einen engen Zusammen-hang mit meinem wissenschaftschaftlichenEngagement als Professorin an der Fach-hochschule Bielefeld. Wir starteten 2001mit der Auszeichnung von Kindertagesstät-ten. Der Preis Managerin des Jahres hatauch mit der Rolle starker Frauen in unse-
rem Familienun-ternehmen zu tun.Sofie Mestema-cher und Friederi-ke Detmers habendie Firmen durchden Ersten Welt-krieg gebracht.Auch MagdaleneDetmers und LoreSchittenhelm, ge-borene Mestema-cher, waren alshelfende Familien-angehörige starkam Erfolg beteiligt.
Panem et Artes, Kita-Preis, Managerindes Jahres, Frauenkalender, Spitzen-vater des Jahres: Gab es da nicht Stim-men, die nachgefragt haben, ob Sie dasmittelständische Familienunternehmenüberfordern?
Detmers: Nein, niemals. Sicher gab eshier und da eine gewisse Skepsis, was denvergleichsweise feministischen Ansatz derPreise betrifft. Aber darüber haben wir dis-kutiert. Und heute ist »das, was die Detmersda macht«, allseits anerkannt.
Wie viel Euro wird das Pumpernickel-Brot durch die Sponsoring-Aktivitätenteurer?
Detmers: Keinen Cent. Schließlich macheich als Miteigentümerin den größten Teilder praktischen Arbeit, also das Konzeptio-nieren, Organisieren und das Marketingselbst.
Nun aber kommt noch der neue Preis»Gemeinsam leben« hinzu…
Detmers: Auf der anderen Seite habenwir den Kita-Preis 2013 auslaufen lassen.Auch »Panem et Artes«, also die Kunst aufder Brotdose, legt gerade eine Pause ein.
Worum geht es bei »Gemeinsamleben«?
Detmers: Wir wollen Projekte auszeich-nen, die neue Formen des Zusammen lebens
Vorrang für das »Wir-Prinzip«Ulrike Detmers begründet den neuen Mestemacher-Preis »Gemeinsam leben«Von Bernhard Hertlein/Westfalen-Blatt, Gütersloh
Ulrike Detmers will mit den Mestemacher-Preisen Impulse für eine bessereGesellschaft geben. Foto: Bernhard Hertlein
Konsens_2017_final.qxp_Konsens 21.12.17 08:37 Seite 13
umsetzen. Darunter fallen beispielsweiseGroßfamilien; Mehrgenerationenhäuser,besondere Wohngemeinschaften, aber auchliberale Einrichtungen und Clubs, die Men-schen unterschiedlicher Religionen zusam-menführen oder als bisher reine Männer-gesellschaften auch Frauen integrieren.Wichtig ist, dass die Anstöße nicht vomStaat, sondern aus der Mitte der Gesellschaftkommen. Das Preisgeld von 10.000 Eurowird auf vier Projekte verteilt werden.
Glauben Sie, dass der Staat über flüssigwird?
Detmers: Nein. Es ist uns im Gegenteilwichtig, dass die privaten Initiativenmöglichst auch staatliche Angebote odersoziale Dienste wie Kinderkrippen, Kinder-tagesstätten und Pflegeangebote integrieren. Vorrangig ist das Wir-Prinzip. Ich halte denautistischen Egoismus, der einige Teile derGesellschaft beherrscht, für wenig zukunfts-fähig. Es kommt mehr heraus, wenn vielePersonen ihre Ideen zusammentragen undkooperieren.
Sehen Sie, dass die bisherigen Preisedie gesellschaftliche Realität veränderthaben?
Detmers: Sie haben zumindest dazu bei-getragen. Zum Beispiel haben wir den Kita-Preis früh mit der Idee verbunden, dass Kin-der auch männliche Vorbilder und darummännliche Erzieher benötigen. Das ist heuteallgemein anerkannt.
Was schätzen Sie denn insgesamt anunserer deutschen Gesellschaft – undwas sehen Sie eher kritisch?
Detmers: Ich schätze ihre relative Stabi-lität, die Verlässlichkeit, die Rechtsstaatlich-keit, die Akzeptanz für liberale Lebensfor-men. Eine Gefahr sehe ich darin, dass dersoziale Aufstieg zu wenig gefördert wird.Ich hatte selber die Chance, weiterzukom-men. Die Hierarchie muss durchlässig blei-ben. Menschen, die experimentieren undetwas wagen, werden in Deutschland zuwenig geschätzt. Dabei ist Scheitern normal.Jeder hat eine zweite oder auch dritte Chan-ce verdient.
Gibt es eine Auszeichnung, die Sie viel-leicht selbst gerne bekämen – sei esfür sich persönlich oder auch für dasUnternehmen?
Detmers: Darüber habe ich mir nochkeine Gedanken gemacht. Wir vergebenlieber selbst Preise und sind froh, wenn wirdas gut auf die Reihe bekommen.
■
AUS DER PRESSE
14 KONSENS 2017
Zur Person
Prof. Dr. Ulrike Detmers (61) ist Unter-nehmerin (geschäftsführende Gesell-schafterin bei Mestemacher), Wissen-schaftlerin (an der Fachhochschule Bie-lefeld) und Frauenrechtlerin. Bei Meste-macher leitet sie das Ressort ZentralesMarkenmanagement und Social Marke-ting. 2013 wurde sie als erste Frau andie Spitze des Verbandes DeutscherGroßbäckereien gewählt und am Sonntagbei der Tagung in Kopenhagen zum drit-ten Mal bestätigt. Am 15. Septemberwird Detmers wieder eine erfolgreicheFrau als „Managerin des Jahres“ aus-zeichnen.
Mestemacher Preis
MANAGERIN DES JAHRES 2017Gleichstellungspreis für PETRA JUSTENHOVEN
„Petra Justenhoven erhält 2017 den „MESTEMACHER PREIS MANAGERIN DES JAHRES“. Die Strategin hates meisterhaft hinbekommen, im Verlauf ihrer Berufsjahre zur Top-Managerin der deutschen Wirtschaft aufzusteigenund gemeinsam mit ihrem Ehemann, ebenfalls leitend tätig, Tochter und Sohn großzuziehen. Hut ab! Respekt! Umdas vielfältige Aufgabenbündel zu bewerkstelligen, bedarf es zielführender Handlungskonzepte und zweckrationalemEntscheiden und Handeln. Petra Justenhoven vermag offenkundig beides: Souveräne Entscheidungen treffen undsich dann auf den wohlüberlegten Weg machen, der positive Ergebnisse erwarten lässt.“
2013 ist Petra Justenhoven als erste Frauin den Vorstand der Pricewaterhouse-
Coopers AG (heute GmbH) Wirtschaftsprü-fungsgesellschaft berufen worden. Zunächstleitet sie den Großkunden bereich Markets& Industries. Seit 2015 trägt sie im Vorstanddie Verantwortung für den Bereich Wirt-schaftsprüfung und prüfungsnahe Beratung
in Deutschland und seit Juli 2016 auch fürPwC Niederlande, Belgien, Österreich undTürkei. Ihre Domäne ist die Prüfung undBeratung internationaler Konzerne aus ver-schiedenen Branchen, u. a. im Bereich Au-tomotive und Transportation. Zudem leitetsie die Entwicklung innovativer Zukunfts-lösungen mit besonderem Augenmerk auf
digitale Themen wie Big Data, KünstlicheIntelligenz und Industrie 4.0.
Die zweifache Mutter ist die 16. Preis-trägerin und die erste Wirtschaftsprüferin,die die wertvolle Silberstatue „OECONO-MIA“ und das Preisgeld für soziale Zweckein Höhe von 5.000 Euro überreicht be-kommt.
Konsens_2017_final.qxp_Konsens 21.12.17 08:37 Seite 14
Die gebürtige Kemptenerin hat 1986 amAllgäu-Gymnasium das Abitur abgelegt. Ander Bayerischen Beamtenfachhochschulein Herrsching studiert sie Finanzwesen.„Allerdings wollte ich keine Beamtenkar-riere machen“, äußert sie. Mit dem Steu-erdiplom in der Tasche entscheidet sichPetra Justenhoven, ein internationales BWL-Studium draufzusatteln. Als Stipendiatinder ERASMUS-Stiftung an der NormandyBusiness School und der Hochschule fürWirtschaft in Bremen erwirbt sie den Ab-schluss zur Diplombetriebswirtin (FH).1997 erfolgt die Ernennung zur Steuerbe-raterin, 2001 zur Wirtschaftsprüferin. Part-nerin bei PwC wird die Finanzexpertin2007. Der Inhouse-Aufstieg geht weiter,2013 wird Petra Justenhoven zur Vorstän-din bestellt. Durch Umfirmierung der PwCAG WPG in PwC GmbH WPG wird siezum Mitglied der Geschäftsführung.
Passion und Profession mit Leben füllen,das ist ihr Lebensentwurf. Im Zuge ihrerberuflichen Entwicklung konzentriert sichPetra Justenhoven von Anfang an mit großerLeidenschaft auf inhaltliche Aufgaben, diesie fordern, an denen sie wachsen kann.„Kontinuierliches Lernen war für mich
immer ein starker Antrieb“,sagt die diesjährige Preis-trägerin. Petra Justenhovenist eine Expertin, die Gehörfindet. Ihre Fachbeiträgesind in einschlägigen Zei-tungen abgedruckt.
Die Vereinbarkeit vonBeruf und Familie gelingtPetra Justenhoven gut: Als1999 ihr Sohn Paul gebo-ren wird, findet sie mit derUnterstützung ihres Chefsund Mentors ein individu-elles Arbeitszeitmodell. Siebleibt am Ball, hält denKontakt zu Kollegen undKunden und entwickeltsich weiter. 2005 wirdTochter Pia geboren. Nach kurzer Zeit istdie zweifache Mutter zurück am Arbeits-platz. Neben der Unterstützung ihres Ehe-mannes kann sie auf ein vielfältiges Netz-werk mit Kinderfrau, KiTa, Ganztagsschule,Großeltern zurückgreifen.
Mit PwC hat sie einen Arbeitgeber, der ihrFreiheiten lässt. „Neben den spannendenund vielfältigen beruflichen Herausforde-rungen hatte ich immer ein erfülltes Fami-lienleben. Und beides hat sich gegenseitigbefruchtet. Ich würde es jederzeit genausowieder machen", sagt sie. Die Voraus- setzungen müssen allerdings da sein. Beiihr waren dies vor allem die Flexibilität ihresArbeitgebers und ihr Ehepartner, der – selbstFührungskraft – sich keinen Zacken aus derKrone bricht, wenn er zuhause mit anpackt.
Ihre Erfahrungen gibt Petra Justenhovenheute als Mentorin an Nachwuchskräfteweiter. Als Jungpartnerin gründet sie zu-sammen mit Kolleginnen die InitiativeWomen@PwC. Für mehrere Jahre verant-wortet sie das Thema Diversity & Inclusionim Vorstand. „PwC unterstützt seine Mit-arbeiter mit ganz unterschiedlichen Maß-nahmen dabei, Familie und Beruf gut zuvereinen. Bei entsprechender Flexibilität,die die Erreichbarkeit für unsere Mandanten
gewährleistet, ist unsere Arbeit beliebig teil-bar“, erklärt Petra Justenhoven. Und sie istsich sicher: „Die vielen neuen digitalenMöglichkeiten eröffnen uns dabei ganz neueWege der Zusammenarbeit. Davon könnenFamilien schon heute, künftig aber nochviel mehr profitieren.“
Autorin: Prof. Dr. Ulrike DetmersMitglied der Geschäftsführung und Gesell-schafterin der Mestemacher-Gruppe undDAB-Mitglied.
■
AUS DER PRESSE
KONSENS 2017 15
Petra Justenhoven, Mitglied der Geschäftsführung, Leiterin Assurance,PwC Deutschland, PwC Europe
Petra Justenhoven, Laudatorin Mirja Viertelhaus-Koschig
Prof. Dr. Ulrike Detmers, Petra Justenhoven
Konsens_2017_final.qxp_Konsens 21.12.17 08:37 Seite 15
„In Austria the pharmaceutical profes-sion is female-dominated which also
contributes to the skills and the spirit ofthese 89 percent of all Austrian pharmacists– and their male colleagues too!“ fuhrteRaimund Podroschko, Vizepräsident derApothekerkammer und VAAÖ-Präsident,in seiner Eröffnungsrede zum 12th Euro-pean Women Pharmacists Meeting aus, dasam 30. September im Festsaal des Apothe-kerhauses in der Spitalgasse in Wien uberdie Buhne ging. Vor den zahlreichen Teil-nehmerinnen, die aus weiten TeilenEuropas angereist waren, zog er den Ver-gleich zum „Wunderteam“ des österrei-chischen Frauenfußballs 2017 und meinteim Sinne des diesjährigen Mottos weiter:„Women Pharmacists – always one stepahead – not too far ahead of men I hope butahead in shaping the future for our profes-sion. The future’s still bright for pharmacists,but we need to be innovators and gamechangers instead of fast adapters and adop-ters to the change that is to come.“
Entsprechend ambitioniert war auch dasProgramm der Tagung mit vier Workshopsneben den aufschlussreichen Vorträgen,einem Empfang beim Wiener Burgermeisterund dem anschließenden, wohlverdientenHeurigenabend. Als weitere Gäste des Mee-
tings – bestens organisiert von ChristinaFuchs und ihren Kollegen – begrußten El-friede Dolinar, emerit. Leiterin der Anstalts-apotheke des Wiener AKH, und NorbertValecka, Direktor des VAAÖ, die Referen-tinnen aus Holland, England, Island, Irlandund Deutschland sowie die Teilnehmerin-nen, darunter auch EAHP-Präsidentin JoanPeppard.
Von Frauen fur Frauen
Dolinar, die das Meeting nach Österreichgebracht hatte, betonte die Einzigartigkeitdieser Veranstaltung, denn diese sei nichtnur ein Meeting von Frauen fur Frauen aufeuropäischem Level, sondern biete auchdie Möglichkeit, dass sich europäische Apo-thekerinnen, die in unterschiedlichsten Be-reichen tätig sind, austauschten und ver-netzten. Das erste derartige Treffen erfolgte2004 in Frankfurt und hatte den Aufbaueines europäischen Netzwerkes fur Phar-mazeutinnen zum Ziel. Dolinar vertrat da-mals die österreichischen Apothekerinnen.Wie damals, so Dolinar, so stehe auch heuteeine durchdachte, professionell strukturierteFort- und Weiterbildung am Beginn jederEntwicklung, die die Apotheker fit fur dieZukunft mache. Dolinar ging zudem auf
die Notwendigkeit der Erschließung neuerTätigkeitsbereiche ein. Denn immerhinkamen 2016 181 Apotheker auf 47 freieStellen, während 2013 noch 73 Stellenan-gebote fur 82 Apotheker verfugbar waren.In den UK ist man diesbezuglich bereits eingutes Stuck weiter, wie Helen Killminster,klinische Pharmazeutin in England, darleg-te, die uber ihre durchwegs positiven Er-fahrungen als Pharmazeutin in einer Arzt-praxis berichtete.
Nach einer Grußadresse von Kammer-präsidentin Ulrike Mursch-Edlmayr erläu-terte Dolinar die Institutionen des Apothe-kerhauses, wobei die Pharmazeutische Ge-haltskasse von Ulrike Mayer, Past-Präsiden-tin des VAAÖ, in einem eigenen Vortragvorgestellt wurde und breites Interesse undBewunderung auslöste.
Gesponsert wurde die Tagung von Jans-sen, IMS, Kwizda und dem Apotheker-Ver-lag, letztere waren auch jeweils mit einemStand vertreten.
Starke Angestellte
VAAÖ-Direktor Valecka stellte in seinemReferat die Situation der angestellten Apo-theker in Österreich näher vor und erläu-terte die Bedeutung des VAAÖ, des Verban-
AUS DER PRESSE
16 KONSENS 2017
Das 12th European Women Pharmacists Meeting in Wien
Die Pharmazie ist weiblichDie Pharmazie ist weiblich – und das nicht erst seit heute. So wie die Frauen heuer dem österreichischen Fußballden Spirit wiedergegeben haben, so sind auch die Apothekerinnen – ob sie nun an der Tara, im Krankenhaus etc.tätig sind – in ihrem täglichen Patientenkontakt „die Seele“ der Pharmazie, wie die Teilnehmerinnen am 12th
European Women Pharmacists Meeting anschaulich unter Beweis stellten.
Konsens_2017_final.qxp_Konsens 21.12.17 08:37 Seite 16
AUS DER PRESSE
KONSENS 2017 17
des Angestellter Apotheker Österreichs, derimmerhin seit 1891 die Anliegen der An-gestellten vertritt. Nahezu zwei Drittel derderzeit angestellten Apotheker sowie 889pensionierte und 110 Studierende sindVAAÖ-Mitglieder, insgesamt 3.487. Davonsind uber 80 Prozent Frauen. Als eine dervielen Errungenschaften fur die Angestelltenhob Valecka die Möglichkeit der flexiblenTeilzeittätigkeit hervor, die den Apothekernwie kein anderer akademischer Beruf eineWork-Life-Balance ermögliche, ohne nega-tive Auswirkungen befurchten zu mussen.Weitere Aufgaben des VAAÖ seien die Ver-tretung der Interessen der angestellten Apo-theker bei den Kollektivvertragsverhand-lungen, in den Institutionen Kammer undGehaltskasse, bei der Gesetzgebung sowiefur jeden Einzelnen Beratung in Rechtsfra-gen bis hin zur Vertretung in arbeitsrecht-lichen Belangen, auch vor Gericht. Um einefundierte, strukturierte Fort- und Weiter-bildung anbieten zu können, wurde ge-meinsam mit der ARGE Krankenhausapo-theker, einem Zweig des VAAÖ, die AFA,die Apotheker-Fortbildungsakademie, ge -grundet. Valecka freute sich zudem uberdas breite Interesse vor allem der Jungen –Studierenden wie Pharmazeuten – fur dasPostgraduate-Studium, das im Jänner 2018startet.
Internationale Highlights
Wie Fort- und Weiterbildung in Hollandaufgebaut sind und wie dort ein – auch post-graduales – beeindruckendes Curriculumentwickelt werden konnte, schilderte Mar-tina Teichert von der Uni Leiden in ihremVortrag. Interessant war ubrigens die vonihr eingangs durchgefuhrte Umfrage unterden internationalen Teilnehmerinnen, dieergab, dass fur zwei Stunden Review je nachLand zwischen 35 und 70 Euro von denKostenträgern erstattet werden. Jedenfallsist Teichert der Überzeugung, dass Apothe-ker, um in der Apotheke einen „guten Job“machen zu können, in allen Aspekten derGesundheit am Laufenden sein mussten,z. B. auch auf dem Gebiet der Nanotech-
nologie. Denn sie hätten die Verantwortungdie Patienten soweit zu informieren, damitdiese entsprechende Entscheidungen treffenkönnten. Diesbezuglich brach Teichert eineLanze fur den Community Pharmacy Spe-cialist, also fur eine Spezialisierung nichtnur im Krankenhaus, sondern eben auchin der öffentlichen Apotheke. Die Pharma-zie ist in Leiden zudem an der medizini-schen Fakultät und nicht an der naturwis-senschaftlichen angesiedelt, was die Inter-disziplinarität auf Augenhöhe wesentlicherleichtere. Die meisten Bachelors bildensich dort laut Teichert zum Master weiter.
Verena Plattner, AGES MEA, brachte denZuhörerinnen Aufbau und Funktionen derösterreichischen AGES näher und erläuterteanhand dieser Institution die potenziellenvielfältigen Aufgabenbereiche, in denen einApotheker tätig sein kann, – auch abseitsvon Tara und Krankenhaus. So sind z. B.die Tätigkeiten eines Inspektors fur Phar-makovigilanz sehr breit gefächert, wobeiein entsprechendes postgraduales Trainingihn optimal fur diese Aufgabe vorbereitet.Aber selbstverständlich ist auch hier LifelongLearning unabdingbar, wie auch in Bezugauf den Klinischen Apotheker im Kranken-haus, uber dessen Aus- und Weiterbildungdurch das in Entstehung befindliche CTF,das Common Training Framework, EAHP-Präsidentin Joan Peppard referierte.
In den Workshops wurden die Tätigkeiteneines Apothekers in der Praxis eines Allge-meinmediziners, das neue Rollenbild derKrankenhauspharmazie, die Möglichkeiteiner Spezialisierung auf den Industriephar-mazeuten sowie Public Adminis- tra tion imGesundheitswesen näher beleuchtet.
Zukunft Klinische PharmazieBemerkenswert war jedenfalls auch bei die-ser Tagung wieder festzustellen, dass dieKrankenhausapothekerinnen (neben denbeiden Gastgebern waren ausschließlichDamen anwesend) sowohl, was die Fort-
und Weiter-bildung, alsauch, wasdie Weiter-entwicklungdes Berufsbil-des angeht,immer vorne mit dabei sind. So zog sichdie Klinische Pharmazie als Zukunftsthemawie ein roter Faden durch die Vorträge undDiskussionsbeiträge, wobei es hier je nachLand unterschiedliche Entwicklungs- und„Anerkennungs“-stufen durch die öffentli-che Hand gibt, was sich naturlich auch ineiner entsprechenden Honorierung – odereben nicht – niederschlägt. Jedenfalls zeigtesich anhand der Berichte durchgehend, dasses diesbezüglich stark auf die Eigeninitiativeund die Hartnäckigkeit des Apothekerstan-des ankommt.
Es gehe darum, so Podroschko in seinenAusfuhrungen, den Apotheker als anerkann-ten Gesundheitsdienstleister näher an denPatienten zu bringen und ihn und seine Ex-pertise stärker in den Therapieprozess mit-einzubeziehen, und zwar immer dann,wenn diese gefragt ist, – sei es in der Apo-theke oder im Krankenhaus, sei es im Pfle-geheim, in PVEs oder zu Hause. Mit diesemKlinischen Apotheker, der zu den Patientengeht, könnten nicht nur hochqualifizierteArbeitsplätze geschaffen werden, sondernes erfolge eine Optimierung der Therapiebei einem ökonomischeren Einsatz von Arz-neimitteln. Voraussetzung dafur sei, dassauch in Österreich – analog zu etlichen Län-dern Europas – die vielfältigen Dienstleis-tungen entsprechend ihrem Wert fur dasGesundheitssystem abgegolten werden.Damit könnten dann auch Arbeitsplätzeder angestellten Apotheker fur die Zukunfterhalten und ausgebaut werden, auch durchneue Betätigungsfelder, z. B. „als Außen-dienst“ einer Apotheke.
Ein großer Schritt in diese Richtung stellefur die österreichische Pharmazie das neuepostgraduale Master-Studium dar, das derVAAÖ gemeinsam mit der Robert Gordon-University anbietet. Podroschko: „Dennder Apotheker weiß so viel mehr, aber er
Konsens_2017_final.qxp_Konsens 21.12.17 08:37 Seite 17
darf es zumindest derzeit nicht anwenden.Das wollen wir ändern!“ Das Curriculumist als berufsb gleitendes Studium besondersflexibe gestaltet, sowohl was den Zeitauf-wand als auch die Orts(un)gebundenheitbetrifft. Besondere Schwerpunkte seien v.a. Schnittstellenmanagement, Teamwork& Leadership, Gesundheitsökonomie, Um-setzung von Therapieleitlinien insbesonderebei Polypharmazie, Gesundheitskommuni-kation und v. a. Fallstudien aus der Praxis.Dass ein solches Angebot den Anforderun-gen in einem sich wandelnden Gesund-heitssystem entspricht, zeigte sich auch inden Referaten der Vortragenden.
Ohne Kommunikationgeht’s nicht
Abschließend betonte Podroschko, dass esalso nicht nur notwendig sei, die Versorgungder Bevölkerung sicherzustellen und denApotheker-Beruf zukunftsfit zu gestalten,sondern „wir mussen diese unsere Ange-bote an die Menschen auch kommunizie-ren, – und zwar jeder von uns, Tag fur Tag!(…) Und hier schließt sich der Kreis: Denndie Pharmazie ist nicht nur hinter der Taraweiblich, sondern auch davor. Es sind vorallem die Frauen, die als Gesundheitsma-nager ihrer Familie in die Apotheke kom-
men und kompetente Beratung und einepersönliche Ansprache möchten, brauchenund diese auch zu schätzen wissen.
Hier im Gespräch mit unseren KundIn-nen und PatientInnen ist der Kristallisa -tionspunkt unseres Berufes, im Mitein-ander, in der Interaktion, in einer vertrau-ensvollen Kommunikation – und das sehroft von Frau zu Frau.“
ÖAZ 22 | 23. Oktober 2017Mag. Monika HeinrichChefredakteurin der ÖsterreichischenApotheker-Zeitungwww.apoverlag.at ■
AUS DER PRESSE
18 KONSENS 2017
Die ehrenamtliche Arbeit in Vereinenist eine optimale Vorbereitung für eine
spätere politische Tätigkeit. Der Umgangmit den Regeln der Demokratie und dasAushalten von Konkurrenz werden in denVereinen eingeübt. „Der Verein ist ein ge-schützter Raum, in dem man sich über seineErfahrungen austauschen und von anderenlernen kann“, so die Vorsitzende Dr. PatriciaAden bei der Tagung des FrauenRat NRWe.V. „Frauen in die Politik! – Neue Wegeder Vernetzung.“
Immer noch sind zu wenige Frauen in denParlamenten, in den Gremien und in denpolitischen Ämtern vertreten. Nach der letz-ten Bundestagswahl ist der Anteil der Frau-en im Deutschen Bundestag noch geringergeworden. Allerdings gibt es bezüglich desFrauenanteils in der Partei mitgliedschaftund bei den Mandaten erhebliche Unter-schiede zwischen den Parteien.
Eine grundlegende Schwierigkeit ist, Frau-en überhaupt für eine politische Tätig-keit zu gewinnen. Immer noch wirken sichGeschlechterstereotype aus, von denen
man glaubt, sie seien längst überwunden.Wissenschaftliche Untersuchungen zeigen,dass man Frauen weniger Sachkompetenz,weniger Durchsetzungsvermögen und ge-ringere rhetorische Fähigkeiten zutraut.Frauen werden mit diesen Vorstellungensozialisiert. Leider übernehmen sie diesedann oft unbewusst.
Stetige Präsenz und Sichtbarkeit ist einunverzichtbarer Karrierebaustein. Geradedas ist für eine Frau in der Familienphaseschwieriger zu leisten. Neue Spielregelnsind für Gremien und Parteiarbeit gefragt,damit Frauen nicht durch Pflege und Kin-derbetreuung benachteiligt werden. DieDigitalisierung eröffnet Frauen Chancen,die sie nicht durch unbegründete Bedenkenverspielen dürfen. Soziale Medien sind vir-tuelle Räume, in denen Frauen ortsunab-hängig kommunizieren können. Auch inihnen muss man ständig präsent sein, dazubedarf es einer klaren Strategie.
Eine politische Karriere ist nicht auf Par-lamente und in Ministerien beschränkt,auch die Arbeit im Landesfrauenrat und sei-nen Mitgliedsverbänden ist Politik. Unsere
Verbandsfrauen sind Expertinnen in be-stimmten Feldern unserer Gesellschaft undarbeiten zielstrebig daran, ihre Erkennt -nisse umzusetzen. Sie liefern den Ministe-rien und den Abgeordneten wertvolle In-formationen. Ihre Ausarbeitungen findensich in Parlamentsdebatten und in Gesetzenwieder. Und das alles geschieht ehrenamt-lich.
Wir über uns:Der FrauenRat NRW e.V. ist ein Zusammen-schluss und ein Netzwerk von 57 Frauen-verbänden und Frauengruppen gemischterVerbände in Nordrhein-Westfalen. DerDachverband ist unabhängig, überparteilichund überkonfessionell. Er vertritt die Inte-ressen von über zwei Millionen Frauen ausden unterschiedlichen gesellschaftlichenBereichen.
Pressekontakt:FrauenRat NRW e.V.www.frauenrat-nrw.deVorsitzende: Dr. Patricia Aden
■
Ehrenamtliche Arbeit unterstütztden Weg der Frauen in die Politik!
Konsens_2017_final.qxp_Konsens 21.12.17 08:37 Seite 18
Vernetzen, diskutieren, austauschen:Dies verwirklichen Akademikerinnen,
die sich dafür regelmäßig treffen. Sie sindorganisiert im Verein „Deutscher Akademi -kerinnenbund“ (DAB). Die SchwetzingerinUte Spendler ist Vorsitzende der Regional-gruppe Rhein-Neckar. Sie lächelt, wenn siein die Geschichte des Bundes blickt und
seine gegenwärtige Bedeutung hervorhebt.Frauen mit akademischer Ausbildung sindzwar keine Ausnahme mehr, meint sie,auch besetzen sie immer häufiger Spitzen-positionen in den verschiedensten Berei-chen, „dafür haben sie aber lange kämpfenmüssen“. Hätten sie sich im 20. Jahrhundertnicht zusammengeschlossen, wäre eine sol-che Gleichstellung wohl nicht möglich ge-wesen. Zu verdanken haben sie dies auchdem Deutschen Akademikerinnenbund(DAB), der im vergangenen Jahr sein 90-jähriges Jubiläum in Berlin feierte.
Erstaunlich, wie jugendlich Ute Spendler,Jahrgang 1950, wirkt, wenn sie begeistertüber ihre Erfahrungen mit der Regional-gruppe spricht, der sie seit 1983 angehört,über ihre Zeit als Vorsitzende ab 1990, diesie wegen eines Fulltimejobs und Familieunterbrach, sich ab 2007 jedoch wiederaktiv einbrachte mit dem Wunsch, etwaszu bewegen. 2009 und 2015 wurde siewieder jeweils für zwei Jahre als Vorsitzendegewählt, „da fand ich völlig veränderteStrukturen vor“, erzählt sie über die neuenHerausforderungen ihrer Arbeit und die Er-füllung, die sie dabei empfunden habe.Auch sonst ist ihr Auftritt einnehmend,wenn sie erkennen lässt, dass ihr Fragenüber den Verband lieber sind, als über sichzu sprechen.
Befragt über ihren Werdegang, erfahrenwir von Spendler, dass sie wieder dortwohnt, wo sie geboren wurde, in Schwet-zingen, Abitur am Hebel-Gymnasium mach-te, danach Germanistik und Anglistik ander Uni Mannheim studierte. Nach einigenLehraufträgen an der Uni Mannheim sowieals Lehrerin in Speyer und Ludwigshafenwar sie bis zur Pensionierung 2014 als stell-vertretende Schulleiterin an einer Berufs-bildenden Schule in Ludwigshafen tätig.
„Am Anfang galt es, die Rechte, die denFrauen gesetzlich eingeräumt wurden, prak-tisch zu nutzen. Der Zusammenschluss1926 in einen Verein ermöglichte es denAkademikerinnen, sich auszutauschen, Stra-tegien zu entwickeln und praktische Hilfezu gewährleisten.“ Und heute? Im Zeitaltervon Netzwerken setzt der Akademikerin-nenbund andere Prioritäten, überflüssig ister nicht, dies brachte die Frontfrau plausibelzum Ausdruck. „Natürlich ist es nicht mehrso wie früher, als Frauen nicht studierenund nicht wählen durften. Heute ist er da,um ihnen Rückhalt zu geben, sich für Lohn-gleichheit und die Vereinbarkeit von Familieund Beruf einzusetzen. Denn immer nochmüssen sie vieles einfordern, was Männerneinfach gewährt wird“, ist die Erfahrungvon Ute Spendler. „Mitglieder im Akade-mikerinnenbund sind Frauen jeden Altersund verschiedenster Fachrichtungen sowiejunge Hochschulabsolventinnen. Bei unse-ren Vortragsabenden und den Treffen jedenersten Mittwoch im Monat haben wir Ge-legenheit, ins Gespräch zu kommen und
AUS DER PRESSE
KONSENS 2017 19
Im Porträt: Ute Spendler ist Vorsitzende der DAB-Regionalgruppe Rhein-Neckar-Pfalz / Auch nach Pensionierung noch engagiert
Sie gibt Starthilfe für Akademikerinnen
Hintergrund
Der Deutsche Akademikerinnenbund(DAB) ist eine 1926 gegründete inter-disziplinäre Akademikerinnenorganisa-tion und international vernetzt. Er setzt sich ein für den wissenschaftli-chen Nachwuchs, die Motivation vonMädchen für MINT-Berufe, Mentoringfür junge Studentinnen und Berufsan-fänger, Akademikerinnen in der Famili-enphase, familienfreundliche Arbeits-bedingungen, gleiches Geld für gleicheArbeit, für die Rechte der Frauen inDeutschland und weltweit.
Der DAB ist in mehreren Landesfrau-enräten vertreten und wird als NGOauch zu Beratungen der Bundesregie-rung hinzugezogen. Der Bund ist orga-nisiert in über 20 Regionalgruppen undArbeitskreisen.
Für die Regionalgruppe Rhein-Neckar-Pfalz ist Ute Spendler Ansprechpartne-rin, E-Mail: [email protected].
Mitglied kann jede Frau werden, dieeine Hochschule abgeschlossen hat, aberauch Studentinnen ab dem 3. Semester. Der Mitgliedsbeitrag, inklusive des Be-zuges der Verbandszeitung „Konsens“ist 85 Euro, Studentinnen 25 Euro.
Gäste sind nach Anmeldung jederzeitwillkommen.
Konsens_2017_final.qxp_Konsens 21.12.17 08:37 Seite 19
so über das eigene Metier hinauszuschauen.Das war und ist heute noch eine faszinie-rende Sache.“
Während sie das sagt, tauchen in ihrerErinnerung Fälle auf, wo dem akademi-schen Nachwuchs ganz konkret geholfenwerden konnte, zunächst mit einem Prak-tikum, dem eine Festanstellung folgte. „Aufder Suche nach einen Job können Akade-mikerinnen beim DAB Kontakt zu Frauenaufnehmen, die über berufliche Erfahrungverfügen und bereits vielfach vernetzt sind.Ein Mentorinnenprogramm wird ebenfallsvom Bundesverband angeboten.“
Zu Ute Spendlers Geschichte gehört auchdie Geburt einer Tochter und sie weiß, dass
nun die Frage folgt, wie sie selbst Beruf undFamilie unter einen Hut gebracht habe.„Das war nicht immer einfach. Ich habeeine Kinderfrau engagiert“, und dies, weiles für sie unvorstellbar gewesen wäre, nichtim Beruf zu bleiben, den sie gerne und mitviel Leidenschaft ausübte. Dass sie mit Leibund Seele auch Vorsitzende ist, zeigt ihreBereitschaft, sich auch nach der Pensionie-rung weiterhin mit großem Engagementfür den Regionalverband stark zu machen.„Nicht nur die regelmäßigen Treffen berei-chern uns, wir organisieren auch Veranstal-tungen mit kulturellen Schwerpunkten.Dazu gehören Ausflüge, Theater- und Mu-seumsbesuche, Vorträge zu den unter-
schiedlichsten Themen.“ Hier findet sieauch Erholung wie beim Lesen, Reisen oderdem Bekochen von Freunden.
Zwei Dinge sollten noch erwähnt wer-den: Der Kontakt zu den Menschen ist fürUte Spendler wichtig und Frauen zu zeigen,was alles möglich ist, und das, ohne explizitFeministin zu sein. Sie ist überzeugt, dassin einer Gesellschaft, in der Gleichstellungfunktionieren soll, auch die Männer mitge-nommen werden müssen, und dass es nochviel zu tun gibt.
Dieser Artikel ist am 22.8.17 in der Schwet-zinger Zeitung von der freien JournalistinMaria Herlo erschienen. ■
AUS DER PRESSE
20 KONSENS 2017
Pressemitteilung der Berliner Erklärung 2017
Regierungsbildung
Gleichstellungspolitik muss auf die Agenda!
Berlin, 30. November 2017: Die BerlinerErklärung 2017 stellt fest: Gleichstel-
lungspolitik gehört ganz nach oben auf dieAgenda aller Parteien und zukünftigenRegierungskonstellationen.
Andere europäische Staaten machen esvor: Frankreichs Präsident Emmanuel Ma-cron erklärte in seiner einstündigen Redeanlässlich des Internationalen Tages gegenGewalt gegen Frauen die Gleichberechti-gung von Frauen und Männern zum zen-tralen Thema seiner Amtszeit. In Deutsch-land genießen die drängenden Fragen derGleichstellungspolitik derzeit keinen ver-gleichbaren Stellenwert. Ein Anhaltspunktdafür sind lediglich zwei Zeilen, die in denSondierungspapieren des gescheiterten Ja-maika-Bündnisses diesem Thema gewidmetwaren.Gleichstellungspolitik ist eine Querschnitts-aufgabe, die nicht nur mitgemeint oder mit-gedacht werden kann, sondern mitverhan-delt werden muss. Um Verbesserungen zuerreichen, bedarf es wie in anderen Politik-bereichen konkreter Ziele und Maßnah-
men. Auf diese muss in allen Verhandlun-gen über eine Regierungsbildung hingear-beitet werden. Gleichstellungspolitik ist injedem künftigen Regierungsbündnis Pflichtund keine Kür.
Die Gleichstellung von Frauen und Män-nern weiter voranzubringen, ist eine Auf-gabe für alle demokratischen Parteien. Alsweibliche Zivilgesellschaft erwarten wir,dass unsere Kernforderungen von allen Par-teien berücksichtigt werden, die über eineRegierungsbeteiligung nachdenken: • gleichberechtigte Teilhabe, • gleiche Bezahlung und• Verbindlichkeit, Transparenz und Moni-
toring von Gleichstellungspolitik. Die Berliner Erklärung 2017 hat vor der Bun-destagswahl diese drei Kernforderungen denParteispitzen überreicht und intensive Ge-spräche geführt. Auch die Jamaika-Sondie-rungen wurden intensiv verfolgt und beglei-tet. Die Erwartungen der beteiligten 31 Ver-bände und Organisationen, die zusammen12,5 Millionen Frauen repräsentieren, rich-ten sich nun auf oder an die verändert zu-
sammengesetzten, handelnden AkteurIn-nen, die im Vorfeld der Bundestagswahlmehr Gleichstellung eingefordert hatten. Siemüssen nun ihre vorher formulierten Zielezur Gleichstellung nach der Bundestagswahlin die Verhandlungen einbringen und in denweiteren Gesprächen über eine möglicheRegierungsbildung auf die Agenda setzen.
Die Forderungen der Berliner Erklärungkönnen Sie unserer Website entnehmen:http://www.berlinererklaerung.de/
Das überfraktionelle Bündnis der Ber-liner Erklärung existiert seit 2011. Ak-tuell gehören ihm 17 Frauenverbändeals Initiatorinnen an:• Business und Professional Women (BPW)Germany, 1.600 Mitglieder (Deutschland),30.000 Mitglieder in 100 Ländern, UtaZech, Präsidentin, www.bpw-germany.de • Deutscher Ärztinnenbund e.V. (DÄB),1.800 Mitglieder, Dr. Christiane Groß M.A.,Präsidentin, www.aerztinnenbund.de• Arbeitsgemeinschaft Anwältinnen im
Konsens_2017_final.qxp_Konsens 21.12.17 08:37 Seite 20
AUS DER PRESSE
KONSENS 2017 21
DAV, 270 Mitglieder, Silvia Groppler, Vor-sitzende. www.davanwaeltinnen.de• Deutscher Frauenrat (DF), Dachverbandvon 60 Mitgliedsverbänden, in denen mehrals 12 Millionen Frauen organisiert sind.Mona Küppers, Vorsitzende, www.frauen-rat.de • deutscher ingenieurinnenbund e.V. (dib),400 Mitglieder, Sylvia Kegel, Vorstand,www.dibev.de • Deutscher Juristinnenbund e.V. (djb)2.700 Mitglieder, Prof. Dr. Maria Wersig,Präsidentin · www.djb.de • Deutscher LandFrauenverband e.V. (dlv),500.000 Mitglieder, Brigitte Scherb, Präsi-dentin · www.landfrauen.info • EAF Berlin | Europäische Akademie fürFrauen in Politik und Wirtschaft, 2.000 Un-terstützer/innen, Dr. Helga Lukoschat, Vor-sitzende, www.eaf-berlin.de • European Women’s Management Deve-lopment International Network e.V.(EWMD Deutschland), 470 Mitglieder inDeutschland; 900 Mitglieder europa- undweltweit, Sieglinde Schneider, Past Presi-dent, www.ewmd.org• FidAR – Frauen in die Aufsichtsräte e.V.,730 Mitglieder, Monika Schulz-Strelow,Präsidentin, www.fidar.de Frauen im Management e.V. (FIM), 180Mitglieder, Bärbel Jacob, Bundesvorstand,www.fim.de
• Journalistinnenbund e.V. (jb), 400 Mit-glieder, Rebecca Beerheide, Vorsitzende,www.journalistinnen.de • ProQuote Medien e.V., 200 Mitglieder,5.000 Unterstützerinnen und Unterstützer,Maren Weber, Vorsitzende, www.pro-quote.de • ProQuote Medizin, 700 unterstützendeUnterschriften, davon 80 Professoren undProfessorinnen, Prof. Dr. Gabriele Kacz -marczyk, Initiatorin, pro-quote-medizin.de • ProQuote Regie e.V., 1.000 Unt er -stützer*innen, Barbara Rohm, Vorsitzende,www.proquote-regie.de• Verband deutscher Unternehmerinnene.V. (VdU), 1.800 Mitglieder und Interes-sentinnen, 16 Landesverbände, StephanieBschorr, Präsidentin, www.vdu.de • Working Moms – Pro Kinder Pro Karrieree.V. (WM), 450 Mitglieder, Ina Steidl, Vor-sitzende Verbandsvorstand, www.working-moms.de
Folgende Verbündete tragen die Forde-rungen der Berliner Erklärung 2017 mit:• BAG kommunaler Frauenbüros undGleichstellungsstelle, www.frauenbeauf-tragte.de• Bücherfrauen e.V., ww.buecherfrauen.de• bukof – Bundeskonferenz der Frauen-und Gleichstellungsbeauftragten an Hoch-schulen, www.bukof.de
• Deutscher Akademikerinnenbund e.V.www.dab-ev.org• Digital Media Women, www.digitalme-diawomen.de • Fondsfrauen, www.fondsfrauen.de• Frauen in der Immobilienwirtschaft e.V.,www.immofrauen.de• Landesfrauenrat Berlin e.V., www.lfr-ber-lin.de• Landesfrauenrat Rheinland-Pfalz e.V.www.landesfrauenrat-rlp.de• Pro Quote Bühne e.V., www.proquote-buehne.de • Soroptimist International Deutschlandwww.soroptimist.de • Verband alleinerziehender Mütter undVäter Bundesverband e.V., www.vamv.de• Verband berufstätiger Mütter (VBM) e.V.,www.vbm-online.de• Webgrrls.de, www.webgrrls.de• Women in Film and Television Germany(WIFTG), www.wiftg.de• ZONTA, www.zonta-berlin.de
Im September 2017 ist der DAB derBerliner Erklärung beigetreten
Weitere Informationen: www.berlinererklaerung.dePressekontakt: Monika Schulz-Strelow, Prä-sidentin FidAR e.V., Tel: 030 887 14 47 16
■
Die Frau, die sich Goebbels widersetzteVon Rosemarie Killius
Die Schauspielerin und Journalistin Anneliese Uhlig wollte nicht um jeden Preis bei den Nazis spielen und setzte damitihre Karriere als Ufa-Star aufs Spiel. Sie ist am 17. Juni d. J. in ihrem Haus in Kalifornien gestorben.
Am 1. August sollte meine Hommagezu Anneliese Uhligs Geburtstag statt-
finden, der sich am 27. August zum 99.Mal jährt. Diesen Termin hatte ich vor ei-nigen Wochen mit dem FilmmuseumFrankfurt ausgemacht, möglichst zeitnah,denn Anneliese Uhlig ging es seit wenigen
Tagen nicht mehr so gut und alle ihre Freun-de und Fans und ich auch, wollten, dass siediesen Termin noch erleben könne. Sieselbst freute sich riesig, dass in Deutschlandnoch an sie erinnert und sogar ihr liebsterFilm „Solistin Anna Alt“ eingespielt würde.
Am 16. Juni schickte sie mir per Mail
noch ihre Grußworte, am 17. Juni ist siedann abends in ihrem Haus in Santa Cruzin Kalifornien für immer eingeschlafen. Anihrem Geburtstag soll sie im Pazifik bestattetwerden.
Bis einen Tag vor ihrem Tod saß AnnelieseUhlig noch an ihrem Schreibtisch und ar-
Konsens_2017_final.qxp_Konsens 21.12.17 08:37 Seite 21
AUS DER PRESSE
22 KONSENS 2017
beitete am Computer – die große Dame desUfa-Films und der drei Karrieren. Kennzei-chen: Fleiß, Intelligenz, Zivilcourage. Eineaußergewöhnliche Biografie.
Viele Filme mit den großenKollegen dieser ZeitIhr Lebensweg führte sie von Essen, wo sie1918 geboren wurde, zur Schauspielausbil-dung nach Berlin. Dort wurde sie von Theavon Harbou, der zweiten Frau von RegisseurFritz Lang entdeckt.
1937 debütierte sie mit der Hauptrolle in„Manege“ mit Attila Hörbiger unter derRegie von Carmine Gallone. 1938 stand sieim Schillertheater auf der Bühne („Der Rich-ter von Zalamea“ von Calderón) und gingauf eine mehrmonatige Europatournee unterder Leitung von Heinrich George.
Danach folgten gleich mehrere Filme mitden großen Kollegen dieser Zeit: Willy Bir-gel, Gustav Diessl, Hans Söhnker, Will Quad-flieg u.a.
In ihren Filmen („Die Stimme aus demÄther“, Regie Harald Paulsen, „Kriminal-
kommissar Eyck“, Regie Boleslav Barlog,oder „Der Vorhang fällt“ mit Gustav Knuthu.a.) verkörperte sie hintergründige undverdächtige Frauen. Schon mit 20 Jahrengalt sie so als die „geborene“ Dame.
Es folgten Bühnenrollen etwa in Goldonis„Diener zweier Herrn“ mit Joachim Gott-schalk und René Deltgen. Anneliese Uhliggehörte bald zur Spitzengarnitur der deut-schen Schauspieler.
Doch als sie 1940, mit 22 Jahren, dieAvancen des Propagandaministers Goebbels,dem Schirmherrn des deutschen Films,abwies und ihm ihr NEIN ins Gesicht schleu-derte (er darauf: „So werden sie natür -lich keine Karriere machen“), rächte er sich,indem er sie für den deutschen Film sperrte.
1943 wurde sie nachDeutschland zurück-beordert
Durch Vermittlung ihrer besten Freundin,der bekannten Kammersängerin Maria Ce-botari, gelang ihr aber die Verpflichtung im
italienischen Film. Dort fand sie sich als Pro-tagonistin unter der Regie von Carlo Ponti(dem späteren Ehemann von Sophia Loren)in einem gemeinsamen Filmprojekt („LaFornarina“) mit der aus Deutschland ver-jagten Goebbels-Geliebten Lida Baarova wie-der. Nach ihrem 5. italienischen Film wirdsie aber 1943 kriegsdienstverpflichtet nachDeutschland zurückbeordert und bei derTruppenbetreuung eingesetzt.
Dank ihrer Italienischkenntnisse war sievor Kriegsende eine Zeit lang als Dolmet-scherin und Gesellschafterin für die sich inDeutschland befindliche Familie des ent-machteten Mussolini in einem bayrischenSchloss beschäftigt. Zugleich konnte sie nochin einigen Hauptrollen in weiteren Erfolgs-filmen brillieren, etwa in ‘Der Majoratsherr“mit Willy Birgel, und in ihrer „schönstenRolle in einem deutschen Film“, wie sie inihrer Autobiografie schrieb, in „Solistin AnnaAlt“ mit Will Quadflieg. Ihr letzter Film vorKriegsende war „Frau über Bord“ von Wolf-gang Staudte mit Heinrich George.
In den Nachkriegsjahren musste sie wieso viele um ihre Existenz kämpfen. So pro-
© akg-images Anneliese Uhlig als Sängerin Barbara Sydow in dem Film „Kriminalkommissar Eyck" von 1940
Konsens_2017_final.qxp_Konsens 21.12.17 08:37 Seite 22
AUS DER PRESSE
KONSENS 2017 23
duzierte sie Shows für amerikanische Trup-pen in Österreich und Frankfurt am Mainund trat mit Marika Rökk und Loni Heuseru.a. in „Glory Road“ auf.
1948 geht sie mit ihrem amerikanischenEhemann, dem Oberleutnant und Kunst-historiker Douglas B. Tucker, als Soldaten-frau in die Vereinigten Staaten. Dort begannsie eine erfolgreiche Karriere als Journalistin.Als solche war sie sogar im Weißen Hausakkreditiert.
Auslandskorrespondentinfür deutsche Zeitungen
Anneliese Uhlig war ungewöhnlich vielsei-tig. So drehte sie zwar auch weiter Filmein Deutschland, 1956 spielte sie zum Bei-spiel in „Dany, bitte schreiben Sie“ (RegieEduard von Borsody) an der Seite der be-kannten Nachkriegsstars Sonja Ziemannund Rudolf Prack. Doch sie lehrte auch alsDozentin für Dramaturgie und Deutsch ander Thammasat University in Bangkok,nachdem ihr Mann 1963 nach Vietnamund Thailand versetzt worden war.
Seit den fünfziger Jahren schrieb siezudem als Auslandskorrespondentin fürdeutsche Zeitungen, Agenturen und Radio-sender, spielte nebenher immer mal wiederTheater, und seit den Siebzigern wiederholtauch in deutschen Fernsehproduktionenmit – in Filmen wie „Das Klavier,“ RegieFritz Umgelter, „Der Winter, der ein Som-mer war“, ebenfalls unter Umgelters Regieund 1983 mit Heinz Rühmann „Es gibtnoch Haselnuss-Sträucher,“ Regie VoitechJasny. Zuletzt war sie in einer Dokumenta-tion über Heinrich George aus dem Jahr2013 zu sehen.
Anneliese Uhlig hat in rund 30 Kino- undmehr als 15 Fernsehfilmen sowie vielenTheaterproduktionen mitgewirkt, unter an-derem auch bei den Jedermann-Festspielenin Heppenheim. Sie war eine mutige Frau,die in der Diktatur Goebbels persönlich Wi-derstand leistete und die sogar noch genugZivilcourage hatte, ihren JugendfreundFriedrich Goes vor dem Volksgerichtshofzu verteidigen.
Sie lebte bis zum Schlussin ihrem Haus
Ihre Autobiografie „Rosenkavaliers Kind –Eine Frau und drei Karrieren“ ist ein inte-ressantes Werk der Zeitgeschichte und über-trifft alles, was sich sonst an Schauspieler-biografien auf dem Markt findet. Und ihrBuch „Einladung nach Kalifornien“ ist einimmer noch gut zu lesender Reiseführer.Anneliese Uhlig wurde 1989 für ihre Ver-dienste um die deutsch-amerikanische Ver-ständigung mit dem Bundesverdienstkreuz1. Klasse geehrt. Vor ihrer zweiten Ehe mitDouglas B. Tucker, er starb 2009, war siekurz mit dem Schauspieler Kurt Waitzmannverheiratet – ihr gemeinsamer Sohn Peterstarb 2013.
Mit fast 99 Jahren, bis zu ihrem Tod lebteAnneliese Uhlig noch in ihrem Haus inSanta Cruz. Ich habe sie dort vor einigenJahren besucht, als ich über den Schauspie-ler Joachim Gottschalk recherchierte. Siewar wohl der letzte Mensch auf Erden, derGottschalk noch kannte und mit ihm nochkurz vor seinem Tod auf der Bühne gestan-den hatte. Gottschalk, verheiratet mit einerJüdin, tötete sich mit seiner Frau und demgemeinsamen Sohn 1941 in Berlin.
Dieser Artikel von DAB-Mitglied Dr. Rose-marie Killius wurde in der Frankfurter All-gemeinen Zeitung am am 5. Juli veröffent-licht.
■
Konsens_2017_final.qxp_Konsens 21.12.17 08:37 Seite 23
IM FOKUS
24 KONSENS 2017
„Aber hier stand ich tatsächlich vor der Tür, die in die Bibliothek selbst
führt. Ich muss sie geöffnet haben, dennaugenblicklich erschien, wie ein Schutzen-gel mit einem Geflatter schwarzen Talarsstatt weißer Flügel den Weg versperrend,ein abwehrender, silbriger, freundlicherHerr, der indes mich fortwinkte, mit leiserStimme bedauerte, dass Damen nur Zutrittzu der Bibliothek haben, wenn sie voneinem Fellow des Colleges begleitet werdenoder ein Empfehlungsschreiben vorwei-sen.“1 In dieser berühmten Eingangsszeneihrer ebenfalls nicht minder legendärenSchrift „Ein eigenes Zimmer“ klagte VirginiaWoolf die Exklusion von Frauen aus demuniversitären Bereich an. Sie selbst kam inden „Genuss“ einer für damalige Verhältnis -se für Mädchen gebührenden Ausbildung:Während ihre Brüder eine Schule und spä-ter eine Universität besuchten, erhielt diehochintelligente und wissensdurstige Vir-ginia Hausunterricht von ihren Eltern.
Logos und Weiblichkeit unvereinbar
Nicht nur im spätviktorianischen England,sondern auch im damaligen Deutschen Kai-serreich galt die Frauenrolle mit den Ideenvon Bildung und Wissenschaft als unver-einbar. „Die Akademische Frau“, so dergleichnamige Titel der 1897 veröffentlich-ten Studie von Arthur Kirchhoff, galt alsAbnormität des damals vorherrschendenFrauenbildes: Logos und Weiblichkeitwaren unvereinbar.2 In seinem „Gutach-ten“ beschäftigte sich der Althistoriker Prof.Dr. Georg Busolt mit der Zulassung der Frauzum Studium der Geschichtswissenshaftenund kam dabei zu folgendem Schluss: „Wasaber meine Disciplin, die Geschichte, be-
trifft, so gehört zur Lösung der von ihr ge-stellten Aufgaben: ein lange methodischgeschulter, streng auf die Erforschung derTatsachen gerichteter Blick, eine reife Le-benserfahrung und Menschenkenntnis, einpolitisches Urteil und ein das ganze Gebietdes wirtschaftlichen Lebens umfassendesWissen. Dies sind Eigenschaften, die […]eine Frau ihrer ganzen Natur nach nichtbesitzen kann, so daß auch die fähigste nie-mals sich zum Historiker eignen wird.“3
Nicht nur „der Wissenschaftler“ wurde alsein maskulines Wesen imaginiert. Auch dasBild vom Studenten war stark männlich ge-prägt. Frauen, so die damalige zeitgenössi-sche Auffassung, seien weder geistig zueinem Studium befähigt, noch für den Stildes Studentenlebens geeignet.
Als der Essay von Virginia Woolf 1929erschien, waren die ersten Kämpfe der Frau-enbewegungen für den Zugang der Frauenan den Universitäten längst erfolgreich aus-getragen. Die Frauenbewegungen warenvon Beginn an stets auch eine Bildungsbe-wegung gewesen. Die Frage der Frauen-und Mädchenbildung war ein zentralesThema der Frauenbewegungen des späten19. und frühen 20. Jahrhunderts. Zugleichtrugen sie maßgeblich dazu bei, dass zuBeginn des 20. Jahrhunderts die Pfortender Alma Mater für Frauen in Deutschlandsich zu öffnen begannen. Frauen strömtenin die Universitäten und Hörsäle. Nebenden Naturwissenschaften zählten auch diegeisteswissenschaftlichen Fächer, wie z. B.die Historiographie, zu den favorisiertenStudienbereichen.
Historikerinnen und die Erforschung dereigenen Bewegung spielten innerhalb derFrauenbewegung eine zentrale Rolle. Be-reits in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhun-
derts lässt sich der Prozess der histo rischenAnbindung in den frühen Nummern dervon Louise Otto-Peters herausgegebenen„Neuen Bahnen“ feststellen – eine Entwick-lung, die sich auch in den späteren Frauen-bewegungszeitschriften fortsetzte.4 In denAusgaben erschienen beispielsweise Porträtsüber historische Frauenfiguren, deren Leis-tungen als beispielgebend hervorgehobenwurden. Gemäß der Losung „Ad fontes!“(„Zu den Quellen!“) begannen sie in derWeimarer Republik wichtige historischeQuellen über die Frauenbewegung bereit-zustellen. Eine wichtige Rolle hierbei spielteder Akademikerinnenbund und ihre Mit-begründerin Agnes von Zahn-Harnack. Siegab zusammen mit Hans Sveistrup 1934die „Quellenkunde zur Frauenfrage inDeutschland“ heraus.5
Geschichte der Frauenbewegungwissenschaftlich betrachtetDie wissenschaftliche Auseinandersetzungmit der Frauenbewegungsgeschichte setzteallerdings erst seit den 1970er-Jahren ein.Diese Entwicklung ist mit dem Aufschwungder Frauenbewegung seit den späten1960er-Jahren und der seit der zweitenHälfte der 1970er-Jahre aufkommendensowie professionalisierenden (histo rischen)Frauenforschung eng verknüpft. Eine neueGeneration von Historikerinnen widmetesich den An- und Abwesenheiten von Frau-en als historisches handelndes Subjekt –ein Sujet, das auch Virginia Woolf in ihrenWerken immer wieder thematisierte.
Parallel dazu entstanden mit den „neuen“Frauenbewegungen seit den 1970er-Jahrenzunächst vor allem in den westlichen eu-ropäischen Ländern neue Archive, die spe-
„Ad Fontes!“ –Das Digitale Deutsche Frauenarchiv"
Von Jessica Bock
Konsens_2017_final.qxp_Konsens 21.12.17 08:37 Seite 24
IM FOKUS
KONSENS 2017 25
ziell die vergangenen und gegenwärtigenfeministischen Kämpfe dokumentierten.Stellvertretend hierfür sind das FFBIZ (Ber-lin), das Archiv der deutschen Frauenbe-wegung in Kassel, das Lesbenarchiv Spinn-boden (Berlin), das Archiv „ausZeiten“ inBochum, der Kölner Frauengeschichtsver-ein oder belladonna in Bremen zu nennen.
Mit dem Zusammenbruch der DDR ent-standen zu Beginn der 1990er-Jahre auchin Ostdeutschland Frauenarchive und-bibliotheken, die vornehmlich die Ge-schichte der Frauenbewegung in der ehe-maligen DDR und in den neuen Bundes-ländern dokumentieren. Beispielsweise dasArchiv GrauZone, das FrauenstadtarchivDresden und die feministische BibliothekMONAliesA in Leipzig. Diese Frauen-/Les-benarchive und -bibliotheken entwickeltensich in den Folgejahren zu zentralen kultu-rellen und historischen Gedächtnisortender Frauenbewegungen in Deutschland.Diese und weitere Frauen-/Lesbenarchive,-bibliotheken und -dokumentationsstellenaus dem deutschsprachigen Raum habensich zu einem Dachverband i.d.a. (infor-mieren, dokumentieren, archivieren) zu-sammengeschlossen. Die dort archivierteVielfalt an Zeugnissen frauenbewegten En-gagements reichen von Protokollen, Nach-lässen ehemaliger Akteurinnen über Plakatebis hin zu audiovisuellen Mitschnitten.
Dieser Quellenfundus bildet das Funda-ment des „Digitalen Deutschen Frauenar-chivs“ (DDF). Ziel dieses vom BMFSFJ ge-
förderten Vorhabens ist ein Fachportal, dasüber die Geschichte der deutschsprachigenFrauenbewegungen seit 1800 informiert.Mit Hilfe von Essays und ausgewählten di-gitalisierten Beständen werden Akteurin-nen, Strömungen, Themen, Netzwerke undEreignisse sichtbar und erfahrbar gemacht.Neben der Abbildung der Geschichte derFrauenbewegungen im deutschsprachigenRaum werden multimediale Bildungs- undForschungsangebote auf dem Portal bereit-gestellt. Im Rahmen einer feministischenSommeruniversität, die in Berlin stattfindensoll, wird das Fachportal im September2018 der Öffentlichkeit präsentiert und on-line geschaltet.
Besondere Schwerpunkte hierbei bildender Kampf der Frauen um den Zugang zuUniversitäten, die Geschichte des Frauen-studiums, die Entstehung und Institutiona-lisierung der Frauen- und Geschlechterfor-schung an den Hochschulen und die Uni-versität als Ort der Frauenbewegung undfeministischen Kämpfe (z. B. die autonomenFrauen- und Lesbenreferate). Die hierfürzentralen Bestände lagern in den i.d.a.-Ein-richtungen wie dem Helene-Lange-Archiv.Dort befinden sich nicht nur die Organisa-tionsunterlagen des „Bundes DeutscherFrauenvereine“ oder des „Deutschen Aka-demikerinnenbundes“, sondern auch Nach-lässe von bedeutenden Frauenrechtlerinnenwie Helene Lange, Louise Otto-Peters oderAnna Pappritz. Weiterhin sind das „Alice-Salomon-Archiv“ der gleichnamigen Hoch-
schule zu nennen sowie das Archiv desLette-Vereins. Sie bewahren wertvolle Un-terlagen zu Themenbereichen wie sozialeArbeit, Ausbildung und Berufstätigkeit vonFrauen. Aber auch andere i.d.a.-Archiveund Dokumentationsstellen werden zu die-sen Themen bislang unbekannte Beständeaufbereiten und Texte beisteuern.
Das Digitale Deutsche Frauenarchiv lädtein, die vielfältige und spannende Geschich-te der deutschen Frauenbewegungen derletzten 200 Jahre zu entdecken und zu er-forschen – sowohl digital als auch analogvor Ort und ganz ohne Begleitung einesFellows oder eines Empfehlungsschreibens.Virginia Woolf hätte bestimmt ihre Freudedaran.
Autorin: M.A. Jessica Bock, geb. 1983,Studium der Mittleren und Neueren Ge-schichte, Promotion zur ostdeutschen Frau-enbewegung von 1980 bis 2000 am Bei-spiel Leipzigs, wissenschaftliche Mitarbei-terin beim DDF und Beisitzerin im Landes-frauenrat Sachsen.
1 Woolf, Virginia: Ein eigenes Zimmer, Frankfurt/Main2002, S. 11.
2 Kirchhoff, Arthur: Die akademische Frau: Gutachtenhervorragender Universitätsprofessoren, Frauenlehrerund Schriftsteller über die Befähigung der Frau zumwissenschaftlichen Studium und Berufe, Berlin 1897.
3 Kirchhoff, Frau, S. 185.4 Paulus, Julia/Wolff, Kerstin: Selber schreiben – Be-
schrieben werden – Erforscht werden – 150 Jahre Frau-enbewegung in Deutschland im Spiegel der (Selbst-)Erforschung, in: Ariadne, 2015(67/68), S. 20-29, hierS. 20.
5 Paulus/Wolff, S. 22. ■
Die Promotion: Eine Beförderung in der WissenschaftVon Oda Cordes
In diesem Beitrag geht es weniger um denrechtlichen Aspekt des Promotions -
verfahrens, als um hilfreiche Tipps. Die Pro-motion ist eine besondere wissenschaftlicheLeistung und hebt sich von der wissen-schaftlichen Leistung der Master-Arbeit,
dem ersten Staatsexamen oder der Diplom-arbeit ab, weil Neues für die Wissenschafterarbeitet wird.
Auf der Suche nach dem Thema
Das Thema sollte selbstbestimmt gewähltwerden. Es lässt tief blicken, wenn die Pro-movendin der Doktormutter in einem ers-ten Gespräch gegenübertritt und danachfragen muss, ob die Doktormutter einThema für sie hat. Es darf von der Akade-
Konsens_2017_final.qxp_Konsens 21.12.17 08:37 Seite 25
IM FOKUS
26 KONSENS 2017
mikerin erwartet werden, dass sie als zu-künftige Promovendin in der Wissenschaftgeistig und fachlich verbunden und in derLage ist, anhand der aktuellen Forschungs-lage und ihrer historischen Entwicklungeine eigene Fragestellung (These) innerhalbeines selbst gewählten Themas in Konturenzu entwickeln. Besonders zielführenderweisen sich Themen oder Fragestellun-gen, die sich aus bisherigen Prüfungs- oderSeminarleistungen bei der Doktormutterentwickelt haben. Die neuesten Veröffent -lichungen der Doktormutter helfen derPromovendin zu erkennen, ob ihr selbstge wähltes Thema im Forschungsfeld derDoktormutter eingebettet ist. SindThe ma und Doktormutter gefunden, solltedie Doktormutter in jedem Falle um eineschriftliche Erklärung über die Betreuungdes Themas unter Angabe eines vorläufigenArbeitstitels gebeten werden.
Auf der Suche nach der geeigneten „Doktormutter“
Der Begriff „Doktormutter“ ist eine alltags-gebräuchliche Bezeichnung für die einwissenschaftliches Thema betreuende unddie wissenschaftliche Arbeit erstbegutach-tende Professorin. Die Bezeichnung „Dok-tormutter“ ist nicht Inhalt der Regelungender Promotionsordnungen und bezeichnetin keinem Falle das Verhältnis zwischender Professorin und der Promovendin. Diepromovierende Wissenschaftlerin muss diewissenschaftliche Leistung eigenverant-wortlich erbringen. In dieser arbeitsinten-siven Zeit ist die Wissenschaftlerin auf sichallein gestellt. Schließlich ist sie es, die eineneue Erkenntnis entwickeln, durchdenken,begründen und verteidigen muss. Die erst-begutachtende Professorin begleitet dieseneigenverantwortlichen Prozess im Idealfallkonstruktiv. Es ist nicht immer ratsam, sicheine in der Fachdisziplin bekannte oder garberühmte Betreuerin für das Thema zusuchen, insbesondere wenn die Promoven-din noch nicht mit ihr zusammen gearbeitetoder bei ihr noch keine Prüfung abgelegt
hat. Die wissenschaftliche Aufmerksamkeitentsteht für die Promovendin nicht mit demHinweis auf die an gesehene Professorin,sondern nur in intensiver eigener Gedan-ken-Arbeit. Berühmte oder fachlich ange-sehene Professorinnen ihrer Disziplin sindin besonderem Maße mit Publikationsver-pflichtungen, Kongressen, Gutachten undwissenschaftspolitischen Verpflichtungenzeitlich und fachlich in Anspruch genom-men, sodass für das betreuende Gespräch,Korrekturhinweise, Tipps für weiterführen-de wissenschaftliche, insbesondere inter-disziplinäre oder transnationale sowie trans-atlantische Bezüge des wissenschaftlichenThemas wenig Zeit bleibt. Für das wissen-schaftliche Vorhaben mag die Promovendingut beraten sein, sich eine junge Lehrstuhl-inhaberin zu suchen, die zeitlich in der Lageund willens ist, das wissenschaftlicheThema durch ausführliche Gespräche zubegleiten und Freude daran hat, zu beob-achten, wie sich die Konturen der wissen-schaftlichen Thesen und Abschnitte einerneuen wissenschaftlichen Erkenntnis Stückfür Stück durch eine intensive gemeinsameDiskussion herausschälen.
Durchhaltevermögen –Zeit – Organisation –Solidarität
Die Promotionsordnungen unterschied-lichster Fakultäten bieten eine sogenannteGraduate-School an. Das hat für die Pro-movendin den Vorteil, dass sie in einemengmaschigen System einer wissenschaft-lichen Begleitung und im Austausch mitanderen Wissenschaftlerinnen in bestimm-ten Zeitabschnitten einen Bericht über denStand ihrer wissenschaftlichen Arbeitabliefern muss und in einer wissenschaft-lichen Gemeinschaft vortragen, ihre Thesensowie die Entwicklung ihrer Arbeit vorstel-len und diskutieren kann. Sie behält stetsvor Augen, ob die Arbeit für die offizielleVorlage an der Fakultät und damit für eineEröffnung des Promotionsvorhabens aus-gereift ist.
Das private Erleben tritt in der Zeit desBearbeitens und des Fertigens der Disser-tation in den Hintergrund. „Ich brauch dasjetzt nur zusammenzuschreiben“, ist einehäufige Äußerung von Promovendinnen.Diese bestätigt nur, dass Material gefunden,abgegrenzt, aber in der Folgezeit systema-tisiert, beurteilt und zu einem in der Wis-senschaft weiterführenden neuen Ergebniswissenschaftlicher Erkenntnis zusammen-geführt werden muss. Eine Hauptaufgabein der Wissenschaft, die alle nur erdenklichegeistige Kraft von der Wissenschaftlerin ver-langt. Mit diesem Schritt fängt die eigent-liche wissenschaftliche Arbeit erst an.
Die Familie, insbesondere Lebensgefähr-tinnen/Lebensgefährten, Ehefrauen undEhemänner müssen in dieser Phase lernen,dass die Promovendin jede nur erdenk licheFreiheit für ihre wissenschaftliche Arbeitbenötigt. Sie muss von privaten Verpflich-tungen freigestellt werden, damit ihre wis-senschaftliche Arbeit gelingt. Das Gefan-gensein im Thema lässt sich nicht zeitlichvorausbestimmen, geschweige denn termi-nieren. Trotz guten Willens und vorherigerAbsprache können von der Promovendinprivate Zusagen nicht immer eingehaltenwerden. Das muss mit den nahestehendenAngehörigen, Freunden und Bekannten imVorweg besprochen werden. Hier muss umVerständnis geworben werden. Solidaritätmit der Promovendin, ohne dass sie sichschuldig fühlen muss, ist von allen gefordert.Im jeweiligen Einzelfall müssen von beidenSeiten alle nur erdachten Grenzen über-wunden werden. Nur die Rücksichtnahmeauf und die Nachsicht für die Promovendinführen das Vorhaben weiter.
Das gilt insbesondere dann, wenn diePromovendin ihr wissenschaftliches Vor-haben nicht als wissenschaftliche Mitarbei-terin an einem Lehrstuhl, sondern „neben-beruflich“ betreibt und der Lebensunterhaltin wissenschaftsfernen beruflichen Tätig-keiten verdient werden muss. Mag eine an-dere Situation denkbar sein, wenn die be-rufliche Tätigkeit eng mit der Fachdisziplinverzahnt ist, wie z. B. in einem universitä-ren Klinikum oder in einer überörtlichen
Konsens_2017_final.qxp_Konsens 21.12.17 08:37 Seite 26
IM FOKUS
KONSENS 2017 27
Anwaltskanzlei. In der Regel hört die „am-bulante“ Promovendin nicht „das Gras“ fürÄnderungen in Theorie und Praxis „wach-sen“, weil sie vom Wissenschaftsbetrieb einStück weit entfernt arbeitet und darauf an-gewiesen ist, sich die Kenntnis über weiterewissenschaftliche Entwicklungen in ihrerFachdisziplin selbst zu besorgen. Das kostetZeit und Mühe. In dieser Situation kanneine wissenschaftliche Würdigung einmalfehlgehen oder wissenschaftliche Fragestel-lungen werden ausufernd behandelt, wasrecht spät bemerkt wird. In diesem engenZeitkorsett verbleibt für die wissenschaft-liche Arbeit nur das Wochenende oder derUrlaub, weshalb ein Abschied von einertradierten Rollenverteilung in der Familiehilfreich ist.
Der Genderaspekt eines wissenschaftlichenVorhabens
Der Genderaspekt zeichnet sich insbeson-dere dadurch aus, dass Frauen, anders alsMänner, mit familiären Betreuungen vonKindern, von älteren oder kranken Ange-hörigen selbstverständlich in Anspruchgenommen werden. Diese typische Rollen-erwartung in unserer Gesellschaft und inder Familie wird nach wie vor gelebt. Esgilt, während der Promotion eine neue Rol-lenverteilung in der Familie umzusetzen.Wenn sich die nahen Angehörigen, dieFreunde und Bekannten öffnen und daswissenschaftliche Vorhaben der Promoven-din unterstützen, indem sie ihre freie Zeitdafür geben, dass die Promovendin den er-forderlichen zeitlichen Freiraum erhält, leis-ten sie einen konstruktiven Beitrag für dieWissenschaft und für einverändertes Rol-lenverständnis in der Gesellschaft. Sie wer-den ein Vorbild für zukünftige Generationenin ihrer eigenen Familie und für fremdeFamilien sein.
Klares Verfahren
Eine Promotion ist zunächst erst einmal einoffenes Ergebnis. Es wird in einem erstenSchritt auf Empfehlung der Erst- und Zweit-gutachterin an der Fakultät die vorgelegteFassung der Dissertation angenommen. DieErst- und die Zweitgutachterin haben in derBewertung der wissenschaftlichen Leistungeinen Beurteilungsspielraum, der vor einemGericht nicht überprüft werden kann. NachAnnahme der Dissertation wird der nächsteSchritt des Promotionsverfahrens eingelei-tet: die Disputation/das Rigorosum oderdie Verteidigung vor einer von der Fakultäteingesetzten Promotionskommission. DiePromovendin legt nicht eine akademischePrüfung für eine zukünftige Berufsberech-tigung ab. Vielmehr steht am Ende einesPromotionsverfahrens eine neue Erkenntnisfür die wissenschaftliche Fachdisziplin, wes-halb die Promovendin mit der Annahmeihrer Dissertation und einer erfolgreichenmündlichen Prüfung von der Promotions-kommission an der Fakultät promoviertwird.
Und wenn es mal schief läuft?
Dann ist noch nicht aller Tage Abend. Aberwohl der Promovendin, die ihren Arbeit-geber nicht allzu früh von ihrem wissen-schaftlichen Vorhaben in Kenntnis gesetzthat. Vor der offiziellen Abgabe der Disser-tation an der Fakultät sollte der Entwurfder Dissertation auf dem Schreibtisch derErstgutachterin liegen und ein vorläufigesinternes Votum über die wissenschaftlicheArbeit eingeholt werden. Fordert die Erst-gutachterin zur Überarbeitung der Disser-tation auf, hat die Promovendin noch alleMöglichkeiten, ihre wissenschaftliche Leis-tung unter Beweis zu stellen und das Vor-haben erfolgreich abzuschließen. Das ver-
langt von der Promovendin und der Erst-gutachterin noch einmal viel Kraft undMühe. Vor diesem Schritt steht eine um-fassende gemeinsame Analyse über dieFrage, was und vor allem wo es schiefge-laufen ist. Lehnt die Erstgutachterin die Dis-sertation nicht ab, teilt der Promovendinaber mit, dass eine Überarbeitung für eineAnnahme der Dissertation dringend not-wendig ist, gleichwohl bei ihr eine weitereBetreuung des Themas aus besonderenGründen weiterhin nicht erfolgen kann,sollte reiflich über diesen Vorschlag nach-gedacht werden. Nicht in jedem Falle führteine anstrengende und zeitraubende Rund-reise auf der Suche nach einer neuen Be-treuerin und Erstgutachterin zu einem er-folgreichen Ende. Zumal die Promovendindie neue Erstgutachterin über die zurück-liegenden Ereignisse der Betreuung des The-mas wahrheitsgemäß in Kenntnis setzenmuss. Gegebenenfalls wäre ebenfalls denk-bar, dass die ehemalige Erstgutachterin dieChance für die Erkenntnis bei der Promo-vendin reifen lassen wollte, dass das wis-senschaftliche Vorhaben nicht zu einemglücklichen Ende führen könnte. In dieserSituation und vor der Rücknahme einer ander Fakultät eingereichten Dissertation sollterechtlicher Rat eines neutralen Dritten ein-geholt werden, weil diese Schritte die fach-liche und rechtliche Entwicklung des wis-senschaftlichen Vorhabens bestimmen. Esgibt keinen Rechtsanspruch promoviert zuwerden. Rückblickend bleibt eine ereignis-reiche und arbeitsreiche Zeit, die eine neueErkenntnis in der Wissenschaft beförderthat und jede Promovendin ist um eine Wis-senschaftserfahrung reicher.
Autorin: Dr. iur. Oda Cordes ist Mentorinund Coordinator of International Relations(CIR)
■
Die Zeitschrift KONSENS erscheint einmal im Jahr und kann auch ohne Mitgliedschaft im DAB abonniert werden.Sigmaringer Straße 1 · 10713 Berlin · Tel. 030 - 3101 6441 · E-Mail: [email protected] · Internet: www.dab-ev.org
Abonnementpreis siehe Impressum Seite 69
Konsens_2017_final.qxp_Konsens 21.12.17 08:37 Seite 27
IM FOKUS
28 KONSENS 2017
1. Ausgangspunkt 40 Jahre EMMA: Dissens oder Diffamierung?
In den meisten Frauen-Gruppen gibt esAuseinandersetzungen um die ‚richtige‘
politische Position, aber auch Solidarität,wie wir aus der neuen und auch aus derersten Frauenbewegung wissen. Nicht derStreit um politische Deutungen, der sehrwohl produktiv sein kann, ist problematisch,wohl aber die Art und Weise, wie er ausge-tragen wird, dann nämlich, wenn es um dasFertigmachen von Personen und ihre Dif-famierung geht.
In der Jubiläumsausgabe zum 40-jährigenErscheinen von EMMA fällt der Artikel überjunge Feministinnen „Szene in Berlin. DieHetz-Feministinnen“ (Heft 1, 2017, S. 78–81) deutlich aus dem Rahmen, ebenso nach-gekartet in Heft 2, 2017 „Hetzfeministin-nen: Wer ist die Autorin?!“
In beiden Artikeln werden Anne Wizorekund ihr politisches Umfeld (z.B. die Redak-tion des Missy Magazins) dif famierendkommentiert. Anne Wizorek erhielt 2016den Preis der „Stiftung Aufmüpfige Frauen“.Diese Stiftung2 hat das Motto „Nur werquer denkt, kann die Richtung ändern“und zeichnet Frauen aus, die dem Feminis-mus ein gutes wie kritisches Ansehen ver-leihen.
Ebenfalls zum 40. Jubiläum erschien inder Frankfurter Rundschau (26.01.2017:20-21) der Beitrag von Bascha Mika ‚Es wareinmal eine Königin‘. Darin wird AliceSchwarzer „Mutti des deutschen Feminis-mus“ und ‚Oberfeministin‘ genannt und ihr„jahrzehntelanger, fataler Einfluss auf diefrauenpolitische Debatte hierzulande“ be-hauptet.
2. Schwesternstreit um feministische Deutungshoheit
Anne Wizorek und Alice Schwarzer be-zeichnen sich beide als Feministinnen, tre-ten für Fraueninteressen ein und könnensouverän mit den öffentlichen Medien um-gehen. Es trennen sie 40 Jahre Lebens- undPolitikerfahrung. Was wirft EMMA denNetz-Feministinnen vor?• Meinungswandel und Abgrenzung ge-
genüber Alice Schwarzer.Die ganze Szene wird ‚Rechtgläubige‘ ge-nannt, „die ihre Dogmen inzwischenrigoros durchsetzen“ (Emma 2017, H.1:81).
• Naivität und Verrat der Netzfeministin-nen an wichtigen Frauenthemen wieProstitution und Frauenhandel.
• Unverständliche Sprache bzw. Sprach-verirrung, z. B. Cis-Geschlecht3
• Meinungsterror und Einflussnahme aufdie Universitäten.
Das Fehlverhalten dieser jungen Feminis-tinnen-Generation ist aus Sicht der EMMA,dass sie nicht in den gleichen Kategoriendenken wie die Feministinnen der 1960 –70er-Jahre, die ihre provokante Sicht aufder Straße und in eigens geschaffenen Me-dien geäußert haben. Die Jungen dagegenverbreiten ihre persönlichen Erfahrungenund politischen Themen über die sozialenMitmach-Medien wie #aufschrei, #aus-nahmslos, Blogs, YouTube, Twitter, facebookund Instagram.
Aus Sicht von Schwarzer geht es denNetzfeministinnen um „Deutungshoheitnicht nur gegenüber den Medien, sondernauch innerhalb der feministischen Szene“und an den Universitäten (Emma 2017, H.
1: 78). Diese Deutungshoheit beanspruchtsie aber auch für sich selbst und ihre Zeit-schrift, begründet ihre Kritik aber mit grund-sätzlichen politischen Differenzen. Für siestehen die Frauenbelange an erster Stelle,für die jungen Feministinnen stünden sieunter ferner liefen. Bei dieser Auseinander-setzung ist eine Haltung im Spiel, die Mehr-deutigkeit, unterschiedliche Deutungen undSchwerpunktsetzungen von Frauenthemennicht als Herausforderung, sondern als be-drohliche Relativierung des eigenen femi-nistischen Verständnisses sieht.
Die Kritikerinnen andererseits werfenSchwarzer einen Kampagnen-Journalismusvor und eine frauenthematische Veren gungauf Prostitution und Islamkritik, so Lohausvon der Missy-Redaktion. Gegen diesen Al-leinvertretungsanspruch verwahren sichauch Mika wie Wizorek.
Alice Schwarzer gehört unbestritten zuden Pionierinnen der neuen Frauenbewe-gung, aber Pionierinnen sind es immer nurauf Zeit, dann folgen andere und Jüngereauf ihren Wegen, indem sie in der abgren-zenden Auseinandersetzung eigene Aus-drucksformen für ihre Problemwahrneh-mung entwickeln. Diese Neuerfindung sorgtfür soziale Veränderung wie sie selbst auchAusdruck von Veränderung ist.
Interessanter als die Generationen-Proble-matik erscheint uns jedoch die Frage, wieLoyalität und Kritik gegenüber ‚verdienst-vollen’ Personen zusammengehen können.
3. Rassismusvorwurf versusMännerfreundlichkeit
Die jungen Netzfeministinnen haben sichdeutlich gegen sexuelle Übergriffe in unserer
Schwesternstreit-Streit oder Was macht die Macht mit Frauen?1
Sigrid Metz-Göckel unter Mitarbeit von Felizitas Sagebiel
Konsens_2017_final.qxp_Konsens 21.12.17 08:37 Seite 28
IM FOKUS
KONSENS 2017 29
Gesellschaft gewehrt (#aufschrei), sich aberauch dagegen verwahrt, für sexuelle Über-griffe z.B. in der Kölner Silvesternacht2015/16 nur muslimische (fremdländische)Männer, die sich an (deutschen) Frauenvergehen, verantwortlich zu machen (#aus-nahmslos). Diese Differenzierung in derSache hat zu beidseitigen Unterstellungengeführt, seitens der Netzfeministinnen zumRassismusvorwurf gegenüber Alice Schwar-zer, die gegen muslimische bzw. fremdeMänner hetze, und seitens der EMMA-Redaktion einer naiven Ausländer- undMännerfreundlichkeit der Netzfeministin-nen, die sich jeglicher Kritik an deren Frau-enfeindlichkeit enthielten.
Die Rassismus-Etikettierung ist eine ver-breitete Form der Verunglimpfung, sofernrassistische Einstellungen willkürlich un-terstellt werden. Alice Schwarzer reagiertdarauf verletzt, weil sie sich völlig falschwahrgenommen fühlt, denn sie machtgrundsätzlich die Unterscheidung zwischenden muslimisch Gläubigen und dem poli-tischen Islam (Schwarzer 2002)4. Ande-rerseits kann Toleranz, die den Netzfemi-nistinnen als Männerfreundlichkeit vorge-worfen wird, repressiv sein, wenn die ge-samtgesellschaftliche Situation unberück-sichtigt bleibt und Toleranz auch gegenüberGruppen geübt wird, die andere (struktu-rell) ausgrenzen.
Die jungen Feministinnen sind in einemliberalen gesellschaftlichen Klima aufge-wachsen und über die neuen Medien in-ternational vernetzt. Sie beobachten ihrgesellschaftliches Umfeld aus einem breitenHorizont, der sie – auf Augenhöhe mit denMännern – die Vielfältigkeit der Geschlech-terzuschreibungen, aber auch Diskriminie-rungen vielfältiger Art wahrnehmen lässt.Anne Wizorek (2014) artikuliert diskrimi-nierende Erfahrungen nicht nur im Netz,sondern ist online wie offline aktiv mit Vor-trägen, Diskussionen und Lesungen zuihrem Buch „Weil ein Aufschrei nicht reicht.Für einen Feminismus von heute“. Geradeweil die netzaktiven Feministinnen in einerrelativ offenen Gesellschaft aufgewachsensind, nehmen sie den Anspruch der Offen-
heit und ‚Redefreiheit‘ ernst. Sie kritisierendie fortwährenden subtilen und harten Dis-kriminierungen und die Differenz zwischender liberalen Programmatik und der aus-grenzenden gesellschaftlichen Realität, dieviele Gruppen und Frauen aufgrund ihrerHerkunft, regionalen und religiösen Bin-dungen benachteiligt.
4. Die Macht der Worte oder was macht die Machtmit den Frauen?
Bascha Mika hat ihren Artikel mit dem Un-tertitel versehen: „Seit 40 Jahren will die„EMMA“ eine Zeitschrift von Frauen fürFrauen sein, doch eigentlich geht es dabeinur um eine Frau“. Das ist maßlos übertrie-ben, denn es geht in der EMMA immer vor-rangig um andere Frauen, selbst wenn sichAlice Schwarzer sehr wichtig nimmt. Mika5
rekonstruiert die Entwicklung der EMMAvom gemeinsamen Projekt frauenbewegterFrauen zum Alleinunternehmen von AliceSchwarzer. Diese sei inzwischen ein aus-laufendes Modell, selbstüberheblich, selbst-bezogen, eine Alleinherrscherin, auf derenWeg viele ‚Frauenleichen’ liegen. Mit Hilfeder Medien habe sie es geschafft, „eineneindimensionalen, intellektuell schlichtenFeminismus in der Öffentlichkeit zu eta -blieren (Mika 2017: 20). Sie unterstelltSchwarzer „via ‚Emma‘ Denkverbote“, aberauch eine Allmächtigkeit.
Es handelt sich hier um einen Streit zwi-schen Kolleginnen auf Augenhöhe, die sichals öffentliche Personen gut kennen undbeobachten, nicht um Generationen-Un-terschiede zwischen Jung und Alt. Beideverfügen über die Macht der Worte undkönnen diese öffentlich einsetzen. Als Chef-Redakteurinnen sind sie in einer mächtigenPosition, um nicht zu sagen in einer Män-ner-Position, entscheiden zu können, wasveröffentlicht wird und was nicht. DiesesPhänomen ist aber allgemeiner verbreitetund nicht nur auf heraus gehobene Frauenbeschränkt. Autoritär darauf zu insistieren,wie die gesellschaftliche Situation von Frau-
en zu sehen und zu deuten ist, kann nichtvon Dauer sein. Dazu sind die Problemeund Verhältnisse viel zu komplex, als dasssie von einer Person aus überblickt oder garbeherrscht werden könnten.
5. Deutungen zum Schwesternstreit undTradierung der Frauenbe-wegung
Sind es überhaupt Kolleginnen, die sich wieSchwestern gut kennen und doch so feind-selig verhalten? Oder verhalten sie sichnicht vielmehr wie Krieger im Feindeslandoder schlicht wie autoritäre Männer? Woherkommen diese heftigen Gefühle von pro-minenten Frauen, die je für sich großartigeFrauen sind?
Schwarzer und Mika verfügen beide übersymbolische Macht, die eine Form von Ge-walt eröffnet, die andere Menschen degra-dieren kann. Symbolische Machtpositionendieser Art sind ein ungewohntes Terrainfür Frauen und führen nicht unbedingt zurErweiterung des persönlichen Horizonts,eher zu einer egozentrischen Verengung,so unser Eindruck. Beide Starjournalistinnenagieren wie im ‚Auftrag einer übergeord-neten Macht’, hier der männlichen Hege-monie zur Verhinderung von Frauensoli-darität.
Um unsere Irritation über diesen ‚Schwes-ternstreit’ zu erklären, greifen wir auf eineliterarische Studie aus einem anderen Kon-text sowie auf eine psychoanalytische Deu-tung zurück. „Jeder mordet ein bisschen“,schreibt Amos Oz über die Generation derPioniere der Kibuz-Bewegung zur Zeit derGründungsphase des Staates Israel und überdie Späteren (‚Der perfekte Frieden“ 1982:478). Die Nachfolgenden sind einerseitsauf die Erzäh lungen der Vorderen ange -wiesen, andererseits befinden sie sich ineiner anderen Situation und machen eigeneErfahrungen in der veränderten Umwelt.Oz beschreibt viele kleine und große Ent-täuschungen und Verletzungen, die sich inder Auseinandersetzung mit der veränder-
Konsens_2017_final.qxp_Konsens 21.12.17 08:37 Seite 29
IM FOKUS
30 KONSENS 2017
ten, doch weiterhin schwierigen Realitätfür die mutigen Pioniere und für die ‚Nutz-nießer‘ ihrer Pionierleistungen einstellenund die Kommunikation zwischen ihnenbelasten. Diese literarische Beschreibungeiner sozialen Bewegung und ihrer Folgengibt einen Einblick in die Probleme beimVersuch, das soziale Gedächtnis einer so-zialen Bewegung zu tradieren. Beide Seitenhaben die Kibbuz-Bewegung sehr unter-schiedlich erlebt. Für die einen ist sie un-mittelbar Teil ihres Lebens und eine iden-titätsrelevante ‚Erinnerung’, für die Nach-folgenden eröffnete sich auch eine kritischeAuseinandersetzung mit den Mängeln undNebenfolgen dieser Bewegung.
Alice Schwarzer und Anne Wizorek unter-scheiden sich darin, wie sie sich zur Frau-enbewegung verorten. Die erste sieht sichals eingreifende Akteurin, ja als ‚Subjektder Frauenbewegung’, die viel bewegt, aberauch viel Ablehnung und Kritik eingesteckthat. Anne Wizorek verhält sich als nach-denkliche ‚Nutznießerin’, die erkämpfteErrungenschaften einerseits genießt, dieseandererseits auch kritisch betrachtet undandere Gruppen einbezieht. Sie registrierteinen verbreiteten Sexismus im Alltag undformuliert mit ihren Mitstreiterinnen eineradikale Sicht auf die ‚globale Unterdrü-ckung von Frauen’.
Anders verhält es sich mit den Kontra-hentinnen Alice Schwarzer und BaschaMika. Beide sind Zeitzeugen der neuenFrauenbewegung, ihre Position legt eineIdentifizierung mit dem nahe, was alsmännlich gilt und sie noch größer erschei-nen lässt. Sie verhalten sich – psychoana-lytisch betrachtet – im klassischen Sinn alsVater-Töchter mit einem ambivalenten Ver-hältnis zur Mutter. „Die Identifizierung mitdem Vater kann für das Mädchen viele Be-deutungsfacetten haben, (…) auch die, einSubjekt zu finden, das Anerkennung, Au-tonomie, Begehren und Erregung ver-spricht“ (Benjamin 1992: 821).
Vielleicht ist für die ältere Frauengenera-tion ihre Identifizierung mit dem Vater undein ambivalentes Verhältnis zur Mutter
naheliegender als für die Jungen, die wieAnne Wizorek berufstätige und selbststän-dige Mütter erlebt haben und ihren männ-lichen Altersgenossen auf Augenhöhe be-gegnen können, was Alice Schwarzer undBascha Mika sich erst erkämpfen mussten.Beide Chef-Redakteurinnen vereinen inihrer Pionierrolle Männliches und Weibli-ches und erscheinen als Karrierefrauen, dieum breitere Anerkennung in den öffentli-chen Medien und bei den Frauen konkur-rieren. Die Definitionsmacht über denFeminismus kann aber keine einzelne Frauund auch keine Zeitschrift allein beanspru-chen. Auf Dauer ist eine soziale Bewegungkaum aufrechtzuerhalten, sie geht meist in institutionalisierte Formen über unddamit in eine gewisse Erstarrung, gegen diesich nächste Generationen dann erneutwenden.
6. Resümee
Die frauenpolitischen Unterschiede zwi-schen Schwarzer und Wizorek sowie Mikaund Schwarzer erscheinen uns geringer, alsihre teils diffamierenden Einschätzungendies nahelegen, weil die persönliche Ab-grenzung in der Konkurrenz die Unterschie-de vergrößert. Das macht es so schwierigund kontrovers, das Gedächtnis einer so-zialen Bewegung zu tradieren. Alle dreiFeministinnen kritisieren die männlicheDominanz und benachteiligende Unter -drückung von Frauen. Dieser Streit um dieTradierung und Fortführung der Frauenbe-wegung ist politisch ein Streit um Machtund die ‚richtige Deutung‘ von Frauen -fragen. Mit der politikwissenschaftlichenGeschlechterforschung lässt sich die Ein-gangsfrage „Was macht die Macht mit denFrauen?“ mit Hanna Arendt beantworten.Macht stamme niemals aus den Gewehr-läufen und sei allen organisierten Gruppeninhärent. Sie „entspricht der menschlichenFähigkeit, nicht nur zu handeln oder etwaszu tun, sondern sich mit anderen zusam-menzuschließen und im Einvernehmen mitihnen zu handeln“ (Arendt 1990: 45). In
dieser Fähigkeit könnten sich die streiten-den Feministinnen bewähren, indem sieeine Toleranz der Differenz übten. Da diesesehr voraussetzungsvoll ist, gelingt sie denStreitenden unterschiedlich gut und kannauch misslingen.
Autorinnen: Prof. Dr. Sigrid Metz-Göckelist emeritierte Professorin für Sozialwis-senschaften an der TU Dortmund und Mit-glied des DAB.Prof. Dr. Felizitas Sagebiel ist emeritierteProfessorin für Sozialwissenschaften ander Bergischen Universität Wuppertal.
LiteraturhinweiseArendt, Hannah (1990): Macht und Gewalt. Mün-chen; Benjamin, Jessica (1992): Vater und Tochter:Identifizierung mit Differenz. Ein Beitrag zur Ge-schlechter-1-11Heterodoxie. In: Psyche, S. 821-846;Mika, Bascha (2017): Es war einmal eine Königin.Frankfurter Rundschau vom 26.01.2017: OZ, Amos(1990): Der Perfekte Frieden. Frankfurt a.M.; Schwar-zer, Alice (Hrsg., 2013): Es reicht. Gegen den Sexis-mus im Beruf. Köln; Schwarzer, Alice (2002): DieGotteskrieger und die falsche Toleranz. Köln; Wizorek,Anne (2014): Weil ein Aufschrei nicht reicht. Füreinen Feminismus von heute. Frankfurt a.M.; Wizo-rek, Anne (2013): Motive der #aufschrei-Initiatorin.In: Schwarzer, Alice (Hrsg., 2013): Es reicht. Gegenden Sexismus im Beruf. Köln, S. 37-43:
1 Gekürzte Fassung des Beitrags: Sigrid Metz-Göckelunter Mitarbeit von Felizitas Sagebiel: Streit unterFeministinnen oder was macht die Macht mit denFrauen? In: Journal Frauen und Geschlechterfor-schung NRW, Nr. 40/2017, S.53-59.
2 www.stiftung-aufmuepfige-frauen.de. Sigrid Metz-Göckel hat 2004 die ‚Stiftung Aufmüpfige Frauen‘gegründet, die alle zwei Jahre den Preis (3.000 €)‚Aufmüpfige Frau‘ in einer öffentlichen Veranstal-tung vergibt. Felizitas Sagebiel ist von Beginn anim Vorstand der Stiftung.
3 Cis-Mann, Cis-Frau sind in der Queer-Terminologiediejenigen Menschen, bei denen die Geschlechtsi-dentität mit dem ihnen bei Geburt zugewiesenenGeschlecht übereinstimmen.
4 Schwarzer hat zu Beginn der islamischen Republikunter Ayatollah Khomeni im Iran beobachten kön-nen, wie die Sittenpolizei der radikalisierten mus-limischen Männer ausnahmslos alle Frauen mit äu-ßerster Gewalt unter den Tschador gezwungen undvöllig unter männliche Herrschaft gestellt haben.
5 Von 1998-2009 Chefredakteurin der TAZ, jetzt derFrankfurter Rundschau.
■
Konsens_2017_final.qxp_Konsens 21.12.17 08:37 Seite 30
IM FOKUS
KONSENS 2017 31
Zu den Komponisten, die erst spät in denFokus der Musikwissenschaft rückten,
gehört Georg Philipp Telemann (1681–1767). Lange stand eine musikhistorischeGrundlagenforschung aus, insbesondere inForm einer Gesamtausgabe, wie sie für seineZeitgenossen Georg Friedrich Händel undJohann Sebastian Bach bereits im 19. Jahr-hundert etabliert wurden. Das Gedenkenan den 250. Todestag in diesem Jahr gibtAnlass, einen Blick auf ein Spezialgebietder Erforschung dieses berühmtesten deut-schen Komponisten des 18. Jahrhundertszu werfen, der alle musikalischen Gattun-gen bedient hat, der vielfältig vernetzt warund mit dessen Tod „die musicalische Welt“ihren „Vater der Music“ verlor, wie der sei-nerseits berühmte Komponist Johann Hein-rich Rolle (1716–1785) aus Magdeburg ineinem Kondolenzbrief schrieb. Im 19. Jahr-hundert fast vergessen, war Telemann nurnoch einem kleinen Kreis von Spezialistenbekannt. Allerdings spielte seine Instrumen-talmusik, ausgewählte Vokalwerke kamenerst viele Jahre später hinzu, eine Rolle inder sich entwickelnden Alte-Musik-Bewe-gung des 20. Jahrhunderts, die ihn musi-zierend wiederentdeckte.
Seit 1950 erscheint im Bärenreiter-VerlagKassel die Auswahlausgabe „Georg PhilippTelemann, Musikalische Werke“. In einerAuswahlausgabe werden wichtige undinstruktive Kompositionen bereitgestellt.Für Telemann wurde diese Form gewählt,weil bis zum Zeitpunkt der Gründung derAusgabe die Fülle von Telemanns Œuvrenoch nicht zu überschauen war. Eine Über-sicht wurde ab den 1960er-Jahren erarbeitetund für die Instrumentalwerke in den dreiBänden des Telemann-Werk-Verzeichnissesniedergelegt, die Vokalwerke sind im soge-
nannten Telemann-Vokal-Werke-Verzeich-nis aufgelistet.
Die Telemann-Edition gehörte von 1992bis 2010 zu den von der Union der Akade-mien der Wissenschaften geförderten undder Akademie der Wissenschaften undLiteratur Mainz koordinierten Ausgabenund ist heute ein Projekt der Landeshaupt-stadt Magdeburg und des Landes Sachsen-Anhalt. Seitdem gibt es in Magdeburg einehauptamtliche Redakteurin, die neben dereigenen wissenschaftlichen und heraus -geberischen Tätigkeit und der Betreuungder Manuskripte für die einzelnen Bändevon ihrer Erarbeitung bis zur Drucklegungvielfältige Koordinierungs- und Kommuni-kationsaufgaben zu erfüllen hat.
Bis ein Ausgabenband vorliegen kann,sind zahlreiche Vorarbeiten zu leisten, wozugrundlegend die Quellenrecherche und-bereitstellung gehört. Die Herausgebereines Bandes ordnen die erhaltenen Quellenfür das von ihnen zu edierende Werk undprüfen, welche als Referenz dienen kann.Denn nicht immer liegen Eigenschriftendes Komponisten vor, sodass anderweitigerhaltenes Material, seien es Stimmen oderPartiturabschriften, auf ihre Authentizitäthin zu befragen sind. Im Kritischen Apparatwerden die editorischen Entscheidungenbegründet und dokumentiert. Ein einfüh-rendes Vorwort enthält Informationen zurWerk- und Entstehungsgeschichte, zur Auf-führungs- und Rezeptionsgeschichte sowieaus den musikalischen und anderen Quel-len gewonnene Informationen zur zeitge-nössischen Aufführungspraxis. Bei Vokal-musik ist es zudem notwendig, die Text-vorlagen einzubeziehen und Auskunft überderen Verfasser zu geben.
Die intensive und immer Neues zum Vor-schein bringende Erforschung des Umfelds
ergänzt essentiell die kritische Erar bei -tung des Notentextes und des dazu ge -hörigen Apparats. Denn die Kompositionengehorchen ihrer musikalischen Logik, sindaber manchmal eingebunden in ganz un-terschiedliche, auch funktionale Zusam-menhänge, die zu beleuchten sind, wie esz.B. bei der Kirchenmusik oder Gelegen-heitswerken der Fall ist. Neuerdings wirddie Edition der Musik ergänzt durch eineEdition der vertonten Texte. Jedem Bandsind Faksimiles aus den musikalischen Quel-len der edierten Werke beigegeben. Ebensowerden gedruckte Libretti vollständig oderin Auszügen faksimiliert.
Die Erstellung und kritische Einrichtungdes Notentextes und des Apparats erfolgtnach Richtlinien, deren Einhaltung (undWeiterentwicklung) von der Redaktion inAbstimmung mit dem Editionsleiter über-wacht wird.
Die Telemann-Ausgabe legt hauptsächlichErsteditionen vor und stößt damit in Neuland vor, was teilweise nach neuenMethoden verlangt. Die Forschungsergeb-nisse werden (ohne digitale Anteile) reprä-sentativ in Buchform in einer vom Verlagfür die Reihe entwickelten Aufmachungpubliziert. Damit sind sie zugänglich – Fach-und andere Kollegen, Interpreten, Musik-vermittler und alle anderen, die sich für Te-lemann, seine Musik und seine Zeit inte-ressieren, können darauf zugreifen unddamit (weiter-)arbeiten. Jedes Jahr erschei-nen ein oder zwei Bände.
Durch die Erforschung des komplexen Wer-kes eines so vielseitigen und phantasievollenKomponisten wie es Telemann war, ge-winnt eine wichtige Gestalt in ihrer Zeitweitere Kontur, womit nicht zuletzt auch
Ein großes Werk aus Magdeburg: Die Telemann-EditionVon Ute Poetzsch
Konsens_2017_final.qxp_Konsens 21.12.17 08:37 Seite 31
IM FOKUS
32 KONSENS 2017
das musik- und kulturhistorische Wisseneine weitere Ausdifferenzierung erfährt.
Autorin: Dr. Ute Poetzsch, Magdeburg,ist als Musikwissenschaftlerin Redakteurinder Telemann-Ausgabe und Mitglied desDAB.
Literaturhinweise:• Klingende Denkmäler. Musikwissenschaftliche
Gesamtausgaben in Deutschland. Katalog zur Aus-stellung der Fachgruppe Freie Forschungsinstitutein der Gesellschaft für Musikforschung (2007)
• Ute Poetzsch: Zu welchem Nutzen werden WerkeTelemanns ediert?, in: Thomas Bein (Hrsg.): VomNutzen der Editionen. Zur Bedeutung modernerEditorik für die Erforschung von Literatur- undKulturgeschichte, Berlin und Boston (De Gruyter)
2015 (Beihefte zu editio, Bd. 39), S. 267–275• Ute Poetzsch: Die Editionen der Werke Georg Phi-
lipp Telemanns, in: Reinmar Emans/Ulrich Krämer(Hrsg.): Musikeditionen im Wandel der Geschich-te, Berlin und Boston (De Gruyter) 2015 (Bausteinezur Geschichte der Edition, Bd. 5), S. 178–196
• Zur Ausgabe, in: Georg Philipp Telemann, Musi-kalische Werke, Bd. 39ff. (2004ff.)
■
DAB-AKTIV
Auf eine in vieler Hinsichtpositive Entwicklung des
Deutschen Akademikerinnen-bundes konnten die Teilneh-merinnen der Mitgliederver-sammlung am Samstag, den 2.September 2017 in Frankfurtzurückblicken. Die von Rose-marie Killius im Hotel Fried-berger Warte organisierte Ver-anstaltung stand daher ganz imZeichen der Zukunftsgestal-tung, die der DAB unter ande-rem auch aufgrund der steigen-den Mitgliederzahlen anvisie-ren möchte.
Derzeit bewegt sich die Zahl der Neuein-tritte wieder leicht nach oben – eine Ent-wicklung, die sich auch finanziell bemerk-bar macht. Doch nicht nur die neuen Mit-gliedsbeiträge, sondern auch Zahlungen ausdem inzwischen beendeten Projekt Sanofisowie das Vereinsvermögen des Pharma-zeutinnenverbandes, dessen Mitgliederdem DAB beigetreten sind, haben für einenbeachtlichen Kontostand gesorgt. Bedingtdurch die gestiegenen Einnahmen wurde
angeregt, die Maßnahmen des Förderaus-schusses auszuweiten und u.a. höhereDruckkostenzuschüsse zu vergeben.
Inhaltliche Akzente setzte der DAB mitzwei bildungspolitischen Anträgen an dieBundesbildungsministerin, die die Orts-gruppe Bremen eingebracht hatte. Einstim-mig angenommen wurde der Antrag, dasKooperationsverbot zwischen Bund undLändern in Bildungsangelegenheiten auf-zuheben, um bundesweit gleiche Bildungs-
chancen für Kinder und Ju-gendliche, unabhängig von derfinanziellen Ausstattung derLänder und Kommunen,durchzusetzen. Der Antrag, dieAnstrengungen im Bereich derdigitalen Bildung insbesonderefür Mädchen und junge Frauenzu verstärken, wurde mit 22Stimmen, einer Gegenstimmeund drei Enthaltungen ange-nommen. Neben Berichten ausden Arbeitskreisen und Aus-schüssen wurde zudem be-schlossen, die Rechtsanwältinund Frauenrechtlerin Seyran
Ates als Kandidatin für den Anne-Klein-Preiszu nominieren.
Zentraler Programmpunkt der Mitglie-derversammlung, die bereits am Abend des1.9. durch ein Klezmer-Konzert der Klari-nettistin Irith Gabriely in ungezwungenemRahmen eingeläutet wurde, war die Wahleines neuen Vorstandes. Nicht mehr zurWahl standen Maria von Welser, bisherigestellvertretende Vorsitzende des DAB, dieihr Amt niederlegte, sowie die Beisitzerin-
Positive Bilanz bei derMitgliederversammlung des DeutschenAkademikerinnenbundes in FrankfurtVon Daniela Ringkamp
v.l.n.r. Prof. Dr. Sigrid von den Steinen, Gudrun Schmidt-Kärner, Prof. Dr. PetiaGenkova, Dr. Patricia Aden, Manuela B. Queitsch, Dr. Rosemarie Killius, ClaudiaEimers, Dr. Oda Cordes, Andrea Buchelt
Konsens_2017_final.qxp_Konsens 21.12.17 08:37 Seite 32
DAB-AKTIV
KONSENS 2017 33
nen Erdmute Geitner und Daniela Ring-kamp. Die übrigen Vorstandsmitglieder –Dr. Patricia Aden als Erste Vorsitzende, Prof.Dr. Sigrid von den Steinen (Schriftführerin),Claudia Eimers (Schatzmeisterin), Dr. Ro-semarie Killius (CER), Dr. Oda Cordes (CIR),Andrea Buchelt (Beisitzerin) und Prof. Dr.Gudrun Schmidt-Kärner (Beisitzerin) tratenwieder zur Wahl an. Als Zweite Vorsitzendekandidierte Manuela B. Queitsch, als Bei-sitzerin Prof. Dr. Petia Genkova.
Das Wahlergebnis war eindeutig: Vorsit-zende Patricia Aden wurde in ihrem Amt
bestätigt, als zweite Vorsitzende wurde Ma-nuela Queitsch gewählt. Alte und neueSchriftführerin ist Sigrid von den Steinen,während Claudia Eimers Schatzmeisterindes Deutschen Akademikerinnenbundesbleibt. In ihren Ämtern bestätigt wurdenebenfalls Rosemarie Killius als CER undOda Cordes als CIR. Ein ähnliches Bildergab sich bei den Beisitzerinnen: Hier wur-den Gudrun Schmidt-Kärner und AndreaBuchelt wiedergewählt, dritte und neueBeisitzerin ist Petia Genkova. Patricia Adendankte den ausgeschiedenen Vorstandsmit-
gliedern für ihre Arbeit und begrüßte denneu zusammengesetzten Vorstand, der inden Diskussionen mit den angereisten Mit-gliedern zahlreiche Anregungen für zukünf-tige Projekte erhielt.
Autorin: DAB-Mitglied Dr. Daniela Ring-kamp, Wissenschaftliche MitarbeiterinOtto-von-Guericke-Universität, Magdeburg,Lehrstuhl für Praktische Philosophie
■
Neustart der RegionalgruppeBerlin-BrandenburgVon Ursula Sarrazin
Der Beginn
Im Mai 2017 übernahm ich als 1. Vorsit-zende die Regionalgruppe Berlin-Bran-
denburg. Zur Seite steht mir Frau Ines Dan-nehl als 2. Vorsitzende.
Zuerst stellte ich einige Überlegungen an,welche Aufgaben der DAB sich gesetzt hat,und was ihn von den vielen anderen Frau-envertretungen unterscheidet.
Das Schöne am DAB ist, dass er so breit auf-gestellt ist. Nicht nur einzelne Fachrichtun-gen werden vertreten, wie zum Beispiel Ju-ristinnen oder Ärztinnen, sondern alle Aka-demikerinnen können sich einbringen undim DAB aktiv werden. Deswegen sind auchdie Themen und Arbeitskreise des DABbreit gestreut und wirken wieder in die Ge-sellschaft zurück. Der DAB sieht seine Auf-gabe also in der Förderung und Unterstüt-zung aller Akademikerinnen, ohne dabeifachspezifisch zu sein und sein zu können.Ihm liegt also vor allem an den Problemen,die alle akademischen Frauen in unsererGesellschaft haben, egal welcher Fachrich-tung. Viele dieser Probleme haben nun
zudem fast alle Frauen unserer Gesellschaft,auch die nichtakademischen Frauen. DerDAB sollte dies als Chance sehen, mit daraufhinzuwirken, dass sich die Stellung allerFrauen in unserer Gesellschaft verbessert,und, sollte, wie es Führungskräften gebührt,dabei eine führende Rolle einnehmen.
Mit diesen Gedanken im Kopf, machte ichmich daran, das Programm meiner Grup -pe in diesem Sinne attraktiv und interessantzu gestalten.
Ich versuchte, bei der Erstellung unseresdiesjährigen Programms beiden Aspektengerecht zu werden, nämlich, unseren eige-nen akademischen Rechten Geltung zu ver-schaffen, und, auf der anderen Seite, dieAufmerksamkeit darauf zu lenken, dass inunserer Gesellschaft viele Frauen unter Zu-rücksetzungen und Diffamierungen vielfäl-tiger Art zu leiden haben.
So hatten wir zu Beginn meiner Tätigkeitals 1. Vorsitzende Sandra Cegla vom Deut-schen Staatsbürgerinnenbund und Zana Ra-madani, Autorin des Buches „Die verschlei-erte Gefahr“, zu Gast, noch von meinerVorgängerin Erdmute Geitner organisiert,
aber ganz in meinem oben beschriebenenSinne.
Es folgte ein Vortrag von Kornelia Rupp-mann von life e.V., der zeigte, wie das In-teresse von Schulabgängerinnen an tech-nischen Berufen geweckt werden kann.Dieser Abend war also jungen Frauen ge-widmet, die wir auch zu Gast haben.
Der Vortrag von unserer Bundesvorsit-zenden Patricia Aden „Wozu noch Frauen-verbände?“ passte zu meinen Überlegungenund zeigte auf, wo heute die Problemeliegen.
Prof. Dr. Dieter Flader hat sich seit fünfJahren mit dem Phänomen „Mobbing“ wis-senschaftlich beschäftigt. Sein Vortrag be-reicherte uns um gruppendynamische Ein-sichten aus erster Hand.
Alle bisherigen Akademix-Abende wa rengut besucht von Mitgliedern und zahlrei-chen Gästen. Ich hoffe, das wird auch inZukunft so bleiben, denn es stehen nocheinige interessante Vorträge und Diskussio-nen auf dem Programm.
Meine Stellvertreterin Ines Dannehl or-ganisiert für November den Vortrag vonMartina Haas, Autorin des Buches „Die Lö-
Konsens_2017_final.qxp_Konsens 21.12.17 08:37 Seite 33
DAB-AKTIV
34 KONSENS 2017
wenstrategie“. Er schließt sich gut an denVortrag von Prof. Dieter Flader an, dennnun wird es um Durchsetzungsstrategiengehen.
Der Dezembertermin ist unserem tradi-tionellen Weihnachtsessen vorbehalten.
Ausblick: Programm 2018
Die Planungen bei uns in der Gruppe laufenvon Sommerpause zu Sommerpause. Dasschien uns sinnvoller und organischer.Daher steht unser Programm bis zum Juli2018 fest: • Das Thema im Januar greift wieder ein
gesellschaftliches Thema auf: Es geht umdie Lage der geflüchteten Frauen, vorge-tragen von Ingke Brodersen, die viel prak-tische Erfahrung und Wissen darüber mit-bringt.
• Im Februar folgt ein besonders schönes,alle Frauen interessierendes Thema:Dr. Brigitte Tietzel bringt uns Persönlich-keit und Stil von Jacqueline Kennedynäher.
• „Frauen und Karriere – ein Wider-spruch?“ heißt das nächste Thema, vor-getragen von Dr. Angelika Westerwelle.
• Gabriele Patschke wird uns über die vonihr gegründete „Akademie für Matriso-phie“ im April berichten.
• Dr. Oda Cordes folgt mit dem Vortrag„1918 – 2018 Familie und Geschlecht“im Mai.
• Und last not least wieder ein sehr ernstesThema: Herr Prof. Dr. med Paul Ger hardFabricius wird über die Problematik vonAbtreibungen sprechen, das Für undWider aus seiner reichen Erfahrung dar-legen.
Die Organisation der Vorträge ist mit man-chen Widrigkeiten verbunden: Die Refe-renten müssen akzeptieren, ohne Honorarvorzutragen. Nicht jeder ist dazu bereit. Jemehr Termine belegt sind, desto schwierigerwird es, Referenten zu finden, die Zeithaben. Am besten funktioniert es, wennman überall die Augen und Ohren offenhält, ob man jemanden entdeckt, der a) be-reit ist, überhaupt einen Vortrag zu halten;b) es überhaupt kann; c) dieses auch nochinteressant kann und d) überhaupt ein pas-sendes Thema beherrscht.
Ich hoffe, dass mir und meinem Vor-standsteam dies auch weiterhin gelingt!
Autorin: Ursula Sarrazin ist Pädagoginund 1. Vorsitzende der DAB-Regionalgrup-pe Berlin-Brandenburg
■
Mein Name ist Sybille Buchwald-Wer-ner und ich freue mich, Ihnen die
Regionalgruppe Düsseldorf im Namen derGründungsmitglieder vorstellen zu dürfen.Wir schauen auf 4 Monate DAB-DUS zu-rück und haben in dieser Zeit viel Spaß ge-habt und erste Ziele erreicht, aber auch ge-lernt, dass der Aufbau einer Regionalgruppeviel Engagement und Zeit benötigt.
Die Vorgeschichte:
Lassen Sie mich mit der Gründungsgeschich-te beginnen, die zum Teil auch meine per-sönliche Geschichte ist. Ich war viele JahreMitglied im Bund Deutscher Pharmazeu-tinnen, bis dieser Verein 2016 aufgelöstwurde und in den DAB übergegangen ist.Die Jubiläumsfeier zum 90-jährigen Beste-hen des DAB war für mich die perfekte Ge-legenheit, um erste direkte Kontakte zum
DAB und seinen Mitgliedern zu knüpfen.Ich war beeindruckt von den vielen charis-matischen Frauen, die mit Leidenschaft vonihren Aktivitäten berichteten. Ich hatte sofortdas Gefühl, dass der DAB anders ist als vieleFrauen-Netzwerke, die entweder als Kar-rierebeschleuniger dienen sollen oder alsKaffeekränzchen enden – und bei denensich die Frage stellt, ob sie noch zeitgemäßsind. Beim Abendessen habe ich dann Prof.Dr. Sigrid von den Steinen und Dr. Ellen Hil-debrandt aus der Regionalgruppe Essen ken-nengelernt. Als sie hörten, dass ich aus Düs-seldorf komme, erklärten sie mir, dass dorteine Regionalgruppe fehlt und dass es dochnicht sein kann, dass gerade in der Landes-hauptstadt keine Präsenz des DAB zu findenist. Sie waren sozusagen die Anstifterinnen.Sie haben mich motiviert und ihr Wissenund ihre Erfahrung für den poten ziellenAufbau einer Gruppe in DUS angeboten.
Der Aufbau:
Wieder zurück im Rheinland ließen die bei-den nicht locker, und zum ersten Treffenbrachten sie noch Dorothee Stender mit.Auch ich konnte mein erstes neu geworbe-nes DAB-Mitglied, Gudrun Reissert, vor-stellen, und mit Elisabeth Thesing-Bleck,ebenfalls eine Pharmazeutin, war das Grün-dungsteam vollständig. So wurde Ende2016 der Entschluss gefasst, eine Regional-gruppe in Düsseldorf aufzubauen, um diePräsenz des DAB zu erweitern und auchin der Landeshauptstadt Düsseldorf einePlattform zum Austausch von Akademike-rinnen aller Altersgruppen, Disziplinen undHerkunft zu schaffen.
Zunächst brauchten wir eine Identität.Da diese auch über das Logo vermitteltwird, wurde dieses im Team entwickelt. Essollte die Herkunft des Verbandes zeigen,
DAB-Regionalgruppe Düsseldorf (DAB-DUS) stellt sich vorVon Sybille Buchwald-Werner
Konsens_2017_final.qxp_Konsens 21.12.17 08:37 Seite 34
DAB-AKTIV
KONSENS 2017 35
daher knüpft es an das DAB-Bundeslogoan. Es sollte Düsseldorf repräsentieren, undso ist das Düsseldorfer Rot unsere Farbe.Es sollte Düsseldorf und auch die Regionrepräsentieren, und so wählten wir dasWappen der Stadt Düsseldorf, welches auchden Bergischen Löwen als Symbol für dasUmland beinhaltet. Es sollte unsere Inter-nationalität darstellen, und so wählten wirfür Düsseldorf die Abkürzung „DUS“, deninternationalen 3-Letter Code des Düssel-dorfer Flughafens.
Danach wurde der Flyer erstellt. Es warsehr schwierig, die richtigen Worte zu fin-den, um unsere Ziele und Aktivitäten zukommunizieren, und wir haben lange undausführlich diskutiert, bis wir zufriedenwaren.
Die Ziele des DAB-DUS:
• Eine Plattform zum Austausch von Aka-demikerinnen aller Altersgruppen, Dis-ziplinen und Herkunft zu schaffen
• Business-Coaching anbieten, um die in-dividuelle, berufliche Entwicklung vonFrauen aus dem In- und Ausland mit aka-demischem Hintergrund zu fördern
• Internationalität leben – regelmäßige Tref-fen in englischer Sprache
• Engagement für regionale frauenpolitischeThemen
Parallel wurde ein Finanzbudget aufgestellt,um unsere Ein-und Ausgaben abzuschätzenund einen Marketingplan zu erstellen. Kos-ten für den Druck des Flyers, Raummieten,Presse-Fotos, Kontoführungsgebühren etc.Sponsoren mussten her, um die Gründungrealisieren zu können. Wir konnten dieDeutsche Bank als Sponsor gewinnen, undso wird unser Konto kostenfrei geführt. Au-ßerdem haben wir Christine Sommerfeldt,eine Business-Fotografin, überzeugt, unsmit professionellen Fotos von unserenEvents zu unterstützen. Ganz herzlichmöchten wir uns für den Gründungszu-schuss vom DAB bedanken sowie für diepersönliche Spende des GründungsmitgliedsDr. Ellen Hildebrandt.
Die Gründung:
Die Regionalgruppe Düsseldorf (DAB-DUS)des Deutschen Akademikerinnenbundese.V. wurde mit einer festlichen Veranstal-tung am 3. Mai 2017 gegründet. Die Grün-dung fand im Haus der Universität, im Her-zen Düsseldorfs, statt, in einem Gebäude,welches Tradition und Moderne vereinigt,genauso wie der DAB, der auch auf einelange Tradition zurückblicken kann undmit aktuellen Themen punktet.
Der Einladung waren etwa 20 Interes-sentinnen gefolgt. Unsere Bundesvorsitzen-de, Dr. Patrizia Aden, stellte in ihrem Gruß-wort die Geschichte und die Ziele des DABdar. Nach meinem Festvortrag, der dieGründungsgeschichte, die Ziele und Akti-vitäten des DAB-DUS erläuterte, wurde dieRegionalgruppe offiziell gegründet und aufden DAB-DUS angestoßen. Das spontaneFeedback der Gäste in den individuellenGesprächen war sehr positiv und hat dasGründungsteam für die geleistete Arbeitbelohnt und für die zukünftigen Aktivitätenmotiviert. Die Gründungsmitglieder freuensich, die Themen des DAB in die RegionDüsseldorf zu übertragen und mit Lebenzu füllen.
Gründungsveranstaltung
Die ersten 4 Monate DAB-DUS:
Wir waren glücklich, dass die Gründungs-veranstaltung gut verlaufen ist und konzen-trierten uns auf unser Programm für 2017bestehend aus Netzwerktreffen und Vor-trägen. Pressemittlungen wurden versandt,die leider keine große Resonanz fanden,selbst nicht wenn VIP-Gäste wie die Bür-germeisterin von Düsseldorf angekündigtwurden. Weiterhin haben wir mit verschie-denen Organisationen (Verbände, Univer-sitäten, Hochschulen) gesprochen, um mög-liche Kooperationen zu eruieren und umunseren Bekanntheitsgrad zu steigern undMitglieder zu gewinnen. Die Liste von In-teressentinnen für den DAB-DUS wuchsund so haben wie heute einen Verteiler mit60 Frauen, die regelmäßig angeschriebenund zu unseren Treffen eingeladen werden.Die Statistik der ersten Veranstaltungenzeigt, dass 60 Kontakte durchschnittlich10 Zusagen ergeben. Nach der Gründungkonnten wir bisher ein neues Mitglied ge-winnen. Einige Frauen haben bereits Inte-resse an einer Mitgliedschaft geäußert, beiihnen werden wir auf jeden Fall nachfra-gen.
Unsere Ziele haben wir klar vor Augenund können auch schon einige Erfolge aus-weisen:
Konsens_2017_final.qxp_Konsens 21.12.17 08:37 Seite 35
DAB-AKTIV
36 KONSENS 2017
1. Internationalität leben: Unser erstes Netzwerktreffen in Englischhat stattgefunden und ist gut angenommenworden. Nicht nur von unserem inter -nationalen Mitglied, Ioanna aus Griechen-land, sondern auch von unseren er fahrenenDAB-Mitgliedern, die sich gefreut haben,mal wieder eine Möglichkeit zu haben, ihrEnglisch anzuwenden.
2. Engagement für regionale 2) frauenpolitische Themen:Im Juli fand unser erster Vortragsabend zumThema Frauenpolitik statt.
Elisabeth Thesing-Bleck hat einen Vortragmit Diskussion zum Thema Frauen-Netz-werke „So bringen Frauen ihre Interessenan den Mann!“ gehalten und eine Übersichtüber Struktur, Arbeitsweise und Themenvon Frauenorganisationen gegeben. DieDüsseldorfer Bürgermeisterin Frau ClaudiaZepunkte ist unserer Einladung gefolgt undhat den Vortrag mit Informationen zu Düs-seldorfer Frauenorganisationen ergänzt.Wir haben einen guten Kontakt zu Frau Ze-punkte herstellen können, und so ist derDAB-DUS nun in der Vorbereitungsgruppezum Internationalen Frauentag 2018 inDüsseldorf vertreten.
3. Business CoachingIm Oktober bieten wir einen Vortragmit Diskussion zum Thema Business-Coaching an. Referentin ist Gudrun Reissert.Wir möchten unsere Mitglieder und Gästeermutigen, auf die Erfahrung und das Wis-sen der Kolleginnen zurückzugreifen. Dieskönnen kurze Gespräche während einesNetzwerktreffens sein oder auch klassischeDAB-Mentoring-Tandems, die sich für einendefinierten Zeitraum zusammenfinden undkonkrete Ziele setzen.
4. Eine Plattform zum Austausch:Unsere ersten Netzwerktreffen hatten zumZiel, sich untereinander kennenzulernenund neue Interessenten über den DAB-DUSzu informieren. Allerdings haben wir ge-merkt, dass dies häufig zu Zweiergesprä-chen führt, und oft gerade die miteinandersprechen, die sich schon kennen. Wir habenuns überlegt, wie wir die Abende andersstrukturieren können, damit Neulinge dasGemeinschaftsgefühl spüren und trotzdemZweiergespräche nicht blockiert werden.In 2018 wird daher jedes Netzwerktreffenunter ein Thema gestellt, zu dem 5-10 Mi-nuten referiert wird, und anschließend star-tet die Diskussion, die natürlich auch in an-
dere Themen abdriften kann. RegelmäßigeTeilnehmer der Netzwerktreffen werdenin die Vorbereitung des Themas eingebun-den. Es sind auch Themen dabei, die fürFrauen indirekt wichtig sind, wie z.B. Fuß-ball, und es wird auch eine karnevalistischeSitzung geben, in der u.a. über die Rolleder Frau im Düsseldorfer Karneval referiertwerden wird.
Wenn Ihnen unsere Erfahrungen bekanntvorkommen oder Sie Tipps für den DAB-DUS haben, dann schreiben Sie mich docheinfach an: [email protected]
Ich würde mich sehr freuen.Herzliche Grüße aus Düsseldorf
Autorin: Dr. Sybille Buchwald-Werner istPharmazeutin und die 1. Vorsitzende derDAB-DUS Regionalgruppe Düsseldorf
■
DAB-DUS Mitglieder: (v.l.n.r.) Dr. S. Buchwald-Werner (1. Vorsitzende), G. Reissert (2. Vorsitzende) Dr. Ellen Hildebrandt, Dr. Patricia Aden (1. VorsitzendeDAB), Prof. Dr. Sigrid von den Steinen, Elisabeth Thesing-Bleck, Anna Grannas, Ioanna Naka
© Fotos Christine Sommerfeldt, Die Expertin für Businessfotografie.
28. April 2018:
women & workin Frankfurt am Main
Konsens_2017_final.qxp_Konsens 21.12.17 08:37 Seite 36
DAB-AKTIV
KONSENS 2017 37
Mitgliederversammlung und Neuwahl desVorstandes des DAB Rhein-Neckar-PfalzVon Ute Spendler
Am 11. Oktober 2017 wurde auf derordentlichen Mitgliederversammlung
der Regionalgruppe Rhein-Neckar-Pfalz einneues Vorstandsteam gewählt. Die Ver-sammlungsleitung übernahmen Frau Prof.Dr. Elke Platz-Waury und Uta Wingen, RA.
Der neu gewählte Vorstand setzt sich wiefolgt zusammen: Erste Vorsitzende, UteSpendler (Schwetzingen), StellvertretendeVorsitzende und Schatzmeisterin, MarianneStarr (Limburgerhof), Beisitzerinnen, ReginaSchaper und Uta Wingen (beide Ludwigs-hafen-Maudach), Kassenprüfung, FlorentineFischer (Altrip), Dr. Susanne Schlösser(Mannheim). Nicht mehr zur Wahl standendie Schriftführerin, Frau Dr. Frauke Kersten,die aus beruflichen Gründen noch währendihrer Amtszeit nach Bonn verzog, sowieFrau Almut von Seebach, die das Amt einerBeisitzerin über viele Jahre hinweg ausgeübthatte. Beiden Damen gebührt der großeDank der Gruppe für ihr Engagement.
In ihrem der Neuwahl vorangegangenenRückblick über die vergangenen beidenJahre konnte die Vorsitzende über eine trotzeiniger Austritte konstante Zahl von 39Mitgliedern berichten. Erfreulich ist, dassauch die Damen, die aus beruflichen Grün-den die Region verließen, der Regionalgrup-pe die Treue halten und immer wieder ein-mal an Veranstaltungen teilnehmen.
Positiv gestaltet sich die Zahl der an denVeranstaltungen des DAB-RNP teilnehmen-den Gäste. Hier beschloss die Mitglieder-versammlung, künftig jedem Nichtmitgliedbeim dritten Besuch eine Mitgliedschaft imDAB zu empfehlen, zumindest aber einesogenannte Schnuppermitgliedschaft vor-zuschlagen. Damit bietet die Regionalgrup-pe Interessentinnen die Möglichkeit, fürmaximal ein Jahr für einen Pauschalbetragvon 20 Euro an allen Veranstaltungen teil-zunehmen und sich danach zu entscheiden,ob eine Regelmitgliedschaft im DAB in Fragekommt. Mit der Einführung einer Schnup-permitgliedschaft wurden bereits in der Ver-gangenheit gute Erfahrungen gemacht.
Trotz dieser positiven Entwicklungen musserwähnt werden, dass sich – wie bei vielenanderen Verbänden – eine Nachfolgerege-lung für das Vorstandsteam schwierig ge-staltet. Alle Damen des neuen Vorstandessind langjährige Mitglieder des DAB undüben ihre Ämter zum Teil schon seit Jahrenaus. Hier bleibt zu hoffen, dass sich in derZukunft Mitglieder, die bisher kein Amt über-nommen haben, dazu bereit erklären, in ge-eigneter Weise im Team mitzuarbeiten.
Für die kommenden beiden Jahre stehtneben dem Ausbau bestehender Kontaktezu anderen Verbänden in Mannheim und
Umgebung die Gewinnung neuer Mitglie-der im Vordergrund. Weiterhin wird einmalim Monat ein jour fixe jeweils am 1. Mitt-woch des Monats mit gemeinsamem Mit-tagessen angeboten sowie jeweils an einemein Abend pro Monat ein Vortragsabend.
Zunächst aber stand am 16. November2017 die Feier zum 60-jährigen Bestehendes DAB Rhein-Neckar-Pfalz an, der aus derursprünglich gegründeten Gruppe Mann-heim/Ludwigshafen und später der Zusam-menlegung mit dem DAB Heidelberg ent-standen ist. Hierzu waren Mitglieder ausanderen Regionalgruppen herzlich einge-laden.
■
60-Jahr-Feier des DAB Rhein-Neckar-Pfalz –Marianne Starr, Ute Spendler, Dr. RosemarieKillius
Kurzbericht zum 60-jährigen Jubiläum des DAB Rhein-Neckar-Pfalz
60 Jahre DAB Rhein-Neckar-PfalzVon Ute Spendler
Am 16. November 2017 feierte dieRegionalgruppe Rhein-Neckar-Pfalz
ihr sechzigjähriges Bestehen mit einem
abwechslungsreichen Programm und vielenGästen. – Im Jahre 1957 als DAB Mann-heim/Ludwigshafen von 24 Akademike-
rinnen der Region wiederbelebt, schlosssich die Gruppe nach der Auflösung desDAB Heidelberg zu einer Regionalgruppe
Konsens_2017_final.qxp_Konsens 21.12.17 08:37 Seite 37
DAB-AKTIV
38 KONSENS 2017
Rhein-Neckar-Dreieck zusammen. Um auchden linksrheinischen Mitgliedern gerechtzu werden und zu signalisieren, dass derDAB in der Region offen steht für Mitgliederaus der Pfalz, wurde der Verband 2009 inDAB Rhein-Neckar-Pfalz umbenannt. In-zwischen reicht der Einzugsbereich vonMannheim/Ludwigshafen über Heidelbergbis nach Biblis im Norden und Speyer undBad Dürckheim im Westen.
In all den Jahren seines Bestehens warder Verband mit seinen derzeit 40 Mitglie-dern ununterbrochen aktiv, mit monatli-chen Vorträgen, Museumsbesuchen, gele-gentlichen Ausflügen und Reisen. Die Ju-biläumsfeiern nach 25, 40 und 50 und nunnach 60 Jahren zeichnen ein lebhaftes Bilddieses aktiven Vereinslebens.
Wie gut der DAB inzwischen in der Me-tropolregion Rhein-Neckar vernetzt ist, zeigtu.a. die Gästeliste. Neben Vertreterinnenbefreundeter Frauenverbände konnte dieVorsitzende Ute Spendler auch die beidenGleichstellungsbeauftragten der StädteMannheim und Ludwigshafen begrüßen.
In deren sehr persönlich gehaltenen Gruß-worten betonten beide die gute Zusammen-arbeit mit dem DAB, sei es durch die Teil-nahme an Netzwerktreffen und Frauen-wirtschaftstagen oder durch die Organisa-tion von Vortagsreihen.
Frau Diehl, Gleichstellungsbeauftragteder Stadt Ludwigshafen hob in ihrem Rück-blick auf die Geschichte des DAB hervor,dass es „nicht zuletzt der organisiertenFrauenbewegung, also Frauenverbändenwie dem DAB und dem großen Engage-ment politisch interessierter und aktiverFrauen in diesen Verbänden zu verdanken(sei), dass wir heute auf Meilensteine zu-rückblicken können, die unsere Stellungals Frauen entscheidend geprägt haben“.
Frau Deilami, Gleichstellungsbeauftragteder Stadt Mannheim, hingegen ging insbe-sondere auf den Gedanken des Netzwerksein. Hier vor allem sei „es dem DAB gelun-gen, ein stabiles und breites Netzwerk zuimplementieren und zu pflegen“. DieserSchwerpunkt sei „deshalb wichtig, weilNetzwerkarbeit eines der Grundelemente
der Frauen- und Gleichstellungsbewegung“sei. Vom Netzwerkgedanken zum Vergleichmit den positiven Eigenschaften eines Spin-nennetzes wurde dann mit launigen Wortenein feiner Faden gesponnen.
Zuvor hatte Frau Dr. Killius, die dafür ei-gens aus Frankfurt angereist war, die Grüßedes Bundesvorstandes überbracht und aufdie Bedeutung eines lebendigen Austau-sches zwischen den DAB-Gruppen unddem Bundesvorstand hingewiesen. IhreAusführungen zu den internationalen Be-ziehungen des DAB und die Möglichkeiten,mit Hilfe der CER Kontakte zu anderen Ver-bänden im europäischen Ausland aufzu-bauen, dürften gerade auch für jüngere Mit-glieder interessant gewesen sein.
Die beiden Hauptrednerinnen des Abendssetzten mit ihren Reden sehr unterschied-liche Akzente. Unser Mitglied, Frau Dr. Su-sanne Schlösser, beleuchtete – wie immersehr lebendig – die „Aspekte weiblicher Be-rufstätigkeit im ersten Viertel des 20. Jahr-hunderts – aufgezeigt an Mannheimer Bei-spielen“. Dieser Ausflug in die Geschichteund die beruflichen Schwierigkeiten, mitdenen akademisch gebildete Frauen bis weitins 20. Jahrhundert hinein zu kämpfen hat-ten, aber auch ihre Erfolge, fand großen An-klang bei unseren Mitgliedern und unserenGästen.
Frau Annika Imsande von der Hochschuleder Bundesagentur für Arbeit in Mannheim
hingegen präsentierte die Ergebnisse ihrerForschung zum Thema „Arbeiten bis inshohe Alter? – Aktuelle Lage, Herausforde-rungen und Möglichkeiten“. Diese sehr ak-tuelle Fragestellung regte zu interessiertenNachfragen und zum intensiven Gedan-kenaustausch nach dem Vortrag an.
Nach diesem anspruchsvollen Programmstand der Sinn aller nach einem lockerenZusammensein bei einem delikaten Finger-foodbuffet, schön ausgerichtet vom bewähr-ten Team des Augusta-Hotels in Mannheim.
■
Ehrenmitglied Nadja Barg
Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Mannheim Zahra Deilami, Susanne Diehl (GB Ludwigshafen),Dr. Rosemarie Killius, Ute Spendler, die beiden Hauptrednerinnen, Dr. Susanne Schlösser und AnnikaImsande
Konsens_2017_final.qxp_Konsens 21.12.17 08:37 Seite 38
DAB-AKTIV
KONSENS 2017 39
Fachbeitrag für den Deutschen Frauenrat – Ausschuss für Gesundheit
Arzneimittelnebenwirkungen, die das Herz betreffen:
Frauen tragen ein höheres Risiko für Long-QT-Arrhythmien als MännerExpertise von Elisabeth Thesing-Bleck
Kardiale Arzneimittelnebenwirkungen betreffen das Herz. Sie können zu Herzrhythmusstörungen bis hin zumplötzlichen Herztod führen. Über 70 Prozent der iatrogen induzierten Long-QT-Arrhythmien betreffen Frauen. [1]
Aus einer Untersuchung in Frankreichgeht hervor, dass von 1 Million Ein-
wohnern 11 Patienten pro Jahr mit einerHerzrhythmusstörung aufgrund einer ver-längerten QT-Zeit in ein Krankenhaus ein-geliefert werden und eine Arrhythmie-Epi-sode überlebt haben [2]. Dem SchweizerPharmakovigilanz-System Swissmedic wur-den 2002 und 2003 jeweils 22 beziehungs-weise 23 Fälle gemeldet, was bezogen aufdie 7,6 Millionen Einwohner in der Schweizetwa in der gleichen Größenordnung liegtwie die Berichte aus Frankreich [3][1]. Wahr-scheinlich liegen die tatsächlichen Zahlendeutlich höher, da zumindest einige Torsa-de-de-pointes-Tachykardien (TdP) in tödli-ches Kammerflimmern münden und des-halb von den Pharmakovigilanz-Systemennicht erfasst werden können. [1]
Kardinale Arzneimittel-nebenwirkung
Torsade-de-pointes-Tachykardien könnenauch als kardiale Arzneimittelnebenwirkungauftreten. Die Anfälligkeit dafür ist vonMensch zu Mensch sehr unterschiedlich.Zahlreichen Risikofaktoren spielen dabeieine Rolle. Das weibliche Geschlecht giltals ein möglicher Risikofaktor von mehrerenUrsachen für Torsade-de-pointes-Tachykar-dien. Bei Frauen ist im Vergleich zu Män-nern das angeborene QT-Intervall im weib-lichen Geschlecht häufiger verlängert alsbei Männern. Eine QT-Verlängerung erhöht
das statistische Risiko für eine TdP-Tachy-kardie. Männer und Frauen tragen damitunterschiedlich hohe Risiken für Torsade-de-pointes-Tachykardien. Diese Sonderformeiner ventrikulären Tachykardie kann auchals Folge von unerwünschten Arzneimit-telwirkungen auftreten. Anders ausge-drückt, das weibliche Geschlecht ist anfäl-liger für eine QT-Zeit-Verlängerung unddamit für Arzneimittelnebenwirkungen,die das Herz betreffen.
Im Rahmen klinischer Studien für die Zu-lassung eines Arzneimittels werden bei ent-sprechenden Medikamenten die erforder-lichen EKG-Kontrollen durchgeführt. AlsErgebnis dieser Studien und ggf. weitererUntersuchungen und Erkenntnisse sorgt inDeutschland das Bundesinstitut für Arznei-mittel und Medizinprodukte dafür, dass dieProduktinformationen in den verschiedenenAbschnitten über alle für Arzt und Patientwesentlichen Aspekte eines Arzneimittelsinformieren – damit auch darüber, dass eineQT-Zeit verlängernde Wirkung auftretenkann. Trotzdem haben kardiovaskuläre To-xizitäten, die erst nach der Marktzulassungeines Arzneimittels bekannt wurden, in derVergangenheit zu Arzneimittelrückrufengeführt. [4]
Rote-Hand-Briefe informieren
Die gelebte Praxis zeigt, dass Rote-Hand-Briefe, die auch zu den Gefahren spezifi-
scher Arzneimittel oder Arzneimittelkom-binationen herausgegeben werden, in derärztlichen Praxis immer noch zu wenig Be-rücksichtigung finden. Deshalb fällt derApotheke mit Blick auf die Arzneimittel-therapiesicherheit und deren systematischeund kontinuierliche Überwachung geradeim Sinne einer patientenorientierten Phar-mazie eine bedeutende Rolle zu. [4]
Die Kenntnis geschlechtsspezifischer Ri-sikofaktoren ist für das Medikationsmana-gement unerlässlich. Apotheker*innen kön-nen Wechselwirkungen gleichzeitig appli-zierter Medikamente überprüfen und beiVerdacht mit dem verordnenden Arzt Rück-sprache halten. Bei Frauen, die bereits einMedikament mit einer QT-Zeit-Verlänge-rung regelmäßig einnehmen, muss beimEinsatz jedes weiteren Medikamentes eineverbindliche Risikoprüfung in Form einesMedikations-Managements durchgeführtwerden. Das gilt sowohl für den Einsatzvon rezeptpflichtigen als auch nicht rezept-pflichtigen Medikamenten. Zudem sind be-troffene Frauen regelmäßig darüber aufzu-klären, dass auch bestimmte Nahrungsmit-tel ein Risiko für Torsade-de-pointes-Tachy-kardien erhöhen können.
Fazit:
Zumindest einige Torsade-de-pointes-Ta-chykardien scheinen in ein tödliches Kam-merflimmern zu münden. Daher dürftendie tatsächlichen Zahlen kardialer Arznei-
Konsens_2017_final.qxp_Konsens 21.12.17 08:37 Seite 39
DAB-AKTIV
40 KONSENS 2017
mittelnebenwirkungen deutlich höher lie-gen, als die von den derzeitigen Pharma-kovigilanz-Systemen erfassbaren Ereignisse.[1] Deshalb ist zu fordern, dass geeignetegeschlechtsspezifische Erfassungsinstru-mente entwickelt werden müssen, um auchdie derzeit nicht erfassbaren Ereignisse denPharmakovigilanz-Systemen zur Kenntniszu bringen.Autorin: Elisabeth Thesing-Bleck ist Apo-thekerin für Geriatrische Pharmazie undMitglied des DAB
Quellen[1] Lutz Hein,L., Long-QT-Syndrom – Wenn das Herz aus demTakt gerät. In: Pharmazeut Ztg. Online (2009) Ausg. 10. Abrufbarin Netz. URL: http://www.pharmazeutische-zeitung.de/?id=29235 Zugriff: 26.02.2016
[2] Molokhia, M., et al., Case ascertainment and estimated inci-dence of drug-induced long-QT syndrome: study in SouthwestFrance. Br. J. Clin. Pharmacol. 66 (2208) 386-395.
[3] Ariel, H., et al., Molecular and clinical determinants of drug-induced long QT syndrome: an iatrogenic channelopathy. SwissMed. Wkly. 134 (2004) 685-694.
[4] Haberbosch,W. et Keiner, D., Medikationsmanagement -Mehr Sicherheit für das Herz; In: Pharmazeut Ztg. online (2014)Ausg. 47. Abrufbar in Netz. URL: http://www.pharmazeuti-sche-zeitung.de/index. php?id =55155 Zugriff: 26.02.2016
■
Um junge Frauen für unseren Verbandzu interessieren, sind Social Media der
Schlüssel. „Damit können wir sie dort ab-holen, wo sie heutzutage unterwegs sind– auf Facebook, Instagram und YouTube.“So erklärt Andrea Buchelt vom DAB Bre-men ihre Beweggründe, in Kooperation mitder Landesmedienanstalt Bremen (brema)einen YouTube-Workshop zu organisieren.Anmelden konnten sich alle interessiertenMitglieder der Verbände, die dem BremerFrauenausschuss/Landesfrauenrat ange-schlossenen sind.
23 Frauen nahmen Ende Juni/AnfangJuli 2017 an zwei mehrstündigen Terminenim Studio von RadioWeser.TV in Bremer-haven an einem Kamera- und einemSchnitt kurs teil und sind jetzt – zumindesttheoretisch – in der Lage, sendefähige Vi-deos zu drehen.
Inzwischen haben sich Andrea Bucheltund Kornelia Rendigs vom DAB Bremenbei der (brema) als Nutzerinnen registriertund können die Profitechnik jederzeit aus-leihen. Eine Film-AG wurde bereits gegrün-det, die künftig Aktivitäten des DAB beglei-tet, um den DAB Bremen und die aktuellenProjekte per Video-Clip im eigenen YouTu-be-Kanal und auf Facebook zu präsentie-ren.
Ein erstes Ergebnis aus dem Workshopist bereits online und kann bei YouTubeunter folgender Adresse besichtigt werden:https://youtu.be/MCaLNsPtKNs
■
YouTube-Channel für den DAB Bremen
Bremens Bildungssenatorin Dr. Claudia Bogedanund die Erste Vorsitzende des DAB Bremen, Sa-bine Kopp-Danzglock nach dem anregenden undfundierten Austausch, zu dem der DAB Bremeneingeladen hatte. Zum Thema "Ist das BremischeBildungssystem dem digitalen Wandel gewachsenund wo finden sich Mädchen und Frauen darinwieder?" wurde in engagierter Gruppe diskutiert.
Foto: Heike Mühldorfer
GLOSSARHerzaktion: Die Herzaktion ist die physiologische Grundlagefür die Pumpfunktion des Herzens. Sie setzt sich aus zweiPhasen zusammen, die sich rhythmisch wiederholen: EinerKontraktionsphase (Systole) und einer anschließenden Er-schlaffungsphase (Diastole). Quelle: http://flexikon.doccheck.com/de/ArrhythmieHerzfrequenz: Der Begriff Herzfrequenz bezeichnet in derMedizin die Anzahl der Herzaktionen während einer bestimm-ten Zeiteinheit (meist 1 Minute). In der Regel stimmt die Herz-frequenz mit der Pulsfrequenz überein. Quelle: http://flexikon.doccheck.com/de/HerzfrequenzHerzrhythmusstörungen: Unter Herzrhythmusstörungen(Arrhythmien) versteht man Unregelmäßigkeiten der Herz-aktion.Quelle: http://flexikon.doccheck.com/de/ArrhythmieQT-Zeit: Die QT-Dauer (QT-Intervall, QT-Zeit) ist eine Mess-größe bei der Auswertung des Elektrokardiogramms (EKG).Sie entspricht dem Zeitintervall vom Anfang des QRS-Kom-plexes bis zum Ende der T-Welle. Quelle: http://flexikon.doccheck.com/de/QT-DauerVerlängerung der QT-Zeit: Das QT-Intervall ist der Abschnittdes Elektrokardiogramms, der zwischen dem Beginn des QRS-Komplexes und dem Ende der T-Welle liegt. In diesen Zeitraumfällt die De- und Repolarisation der Herzkammern. ZahlreicheMedikamente können das QT-Intervall [...] verlängern. [...]Dies kann selten gefährliche Herzrhythmusstörungen auslösen,die schlimmstenfalls zu einem plötzlichen Herztod führen.In der Regel liegen dabei mehrere Risikofaktoren vor.Quelle.: http://www.pharmawiki.ch/wiki/index.php?wiki=QT-IntervallTachykardie: Die Tachykardie ist eine Überschreitung deraltersüblichen physiologischen Herzfrequenz (HF) z.B. über100 Schlägen pro Minute bei einem Erwachsenen. Quelle: http://flexikon.doccheck.com/de/TachykardieTorsade-de-pointes-Tachykardie: Als Torsade de pointes(TdP), Torsade-de-pointes-Tachykardie [...] oder kurz Torsa-de-Tachykardie [...] wird in der Kardiologie eine Sonderformder ventrikulären Tachykardie bezeichnet, die [...] Herzfre-quenzen über 150 bpm aufweist. Da sie in ein Kammerflim-mern übergehen kann, handelt es sich um eine potenziell le-bensbedrohliche Herzrhythmusstörung.Quelle. https://de.wikipedia.org/wiki/Torsade_de_pointesLong-QT: Das Long-QT-Syndrom (Long-QT-Arrhythmie) [...]ist eine seltene, lebensgefährliche Krankheit, die bei sonstherzgesunden Menschen zum plötzlichen Herztod führenkann. Es ist entweder vererbt [...] oder erworben, dann meistals Folge einer unerwünschten Arzneimittelwirkung.Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/QT-SyndromPharmakovigilanz Pharmakovigilanz bedeutet die laufende und systematischeÜberwachung der Sicherheit eines Fertigarzneimittels [...] mitdem Ziel, dessen unerwünschte Wirkungen zu entdecken,zu beurteilen und zu verstehen, um entsprechende Maßnah-men zur Risikominimierung ergreifen zu können. Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/PharmakovigilanzRote-Hand-Brief: Der Rote-Hand-Brief ist eine in Deutschlandgebräuchliche Form eines Informationsschreibens, mit dempharmazeutische Unternehmen heilberufliche Fachkreiseüber neu erkannte Arzneimittelrisiken informieren, fehlerhafteArzneimittelchargen zurückrufen oder sonstige wichtige In-formationen mitteilen.Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Rote-Hand-Brief
Konsens_2017_final.qxp_Konsens 21.12.17 08:37 Seite 40
42 KONSENS 2017
Im März dieses Jahres habenwir Abschied genommen
von Brigitte Marquardt, dienach einem reichen Lebennach längerer Krankheit imAlter von 90 Jahren verstorbenist.
Brigitte Marquardt wurde inder Gründungssitzung derGruppe Bochum im Mai 1966zur ersten Vorsitzenden ge-wählt und blieb dies für vier-zehn Jahre. Von ihr gingenviele wesentliche Aktionenaus, die unsere Gruppe kenn-
zeichneten. Ihre monatlichenVeranstaltungen waren immerinteressant, oft lehrreich, so-dass die Gruppe schnell wuchsund über eine lange Zeit eineder großen, sehr lebendigenGruppen im DAB blieb.
Wir verneigen uns in großerDankbarkeit und in Trauer voreiner starken und immer ein-satzbereiten Persönlichkeit, dieallen, die sie noch gekannthaben, in guter Erinnerungbleiben wird.
■
Dr. Brigitte Marquardt †Nachruf von Margarete Suerbaum, Bochum
Brigitte Marquardt bei einer Lesung ihrer Biographie im Hause Suerbaum
Weitere Gedenken:Ruth Ursula Schmidt Dr. Ilse Schneider Dr. Rosemarie Peiner Dr. Ruth BertholdDr. Leonore Machholz (64 Jahre im DAB) Dr. Marianne Faaß Dr. Britta Kretschmann
Die Zeitschrift KONSENS erscheint einmal im Jahrund kann auch ohne Mitgliedschaft im DAB abonniert werden.
Sigmaringer Str. 1 · 10713 Berlin · Tel. 030 - 3101 6441E-Mail: [email protected] · Internet: www.dab-ev.org
Abonnementpreis siehe Impressum Seite 69
Konsens_2017_final.qxp_Konsens 21.12.17 08:37 Seite 42
INTERNATIONAL
KONSENS 2017 43
Das Motto der diesjährigen UWE-(Universiy Women of Europe)-Konfe-
renz vom 24. bis 27. August 2017 hieß„Changing Cultures.“ Wie in der Einladungder UWE-Präsidentin Edith Lommerse undder österreichischen Präsidentin des VAÖElisabeth Györfy angekündigt, sollte dasThema die Veränderung von Kulturen be-handeln. Zwar war auch weiterhin zu lesen,dass dieses Thema sich speziell auf den Um-gang mit Flüchtlingen aus den verschie-densten Fluchtländern beziehen sollte.
Wir hatten das Thema nicht so eng gese-hen, denn unter dem Leitthema stelltenwir uns auch die Veränderung von Kulturenin den verschiedenen europäischen Länderndurch politische Umbrüche, psychologischeoder einfach soziale Gegebenheiten wie dieveränderte Lebenskultur von Frauen in denverschiedenen Stufen des Lebensalters vor.Aber immerhin hieß es:„What does this process of migration meanfor the women fleeting their home coun-tries, but also, what does it mean for thewomen in the countries accepting refugees?How does the social climate change?” Undweiter hieß es noch: “We are looking for-ward to meeting you, exchanging ideas andcontinuing to be engaged in the work to-wards an improvement of women’s lives inEurope and all over the world”.
Das war vielversprechend. Jedoch kamenwir nicht auf die Idee, dass es hier nur um(das kleine) Österreich als Aufnahmelandmit einer geregelten Obergrenze, also relativüberschaubaren Fakten gehen sollte. Dieswurde uns aber erst im Laufe der Konferenzund in den Arbeitsgruppen so richtig deut-lich. Irgendwie fühlten wir uns teilweisebeinahe fehl am Platz und konnten die öster-reichischen Umstände und Gegebenheiten
nicht so ohne Weiteres auf unser85 Millionen-Land übertragen.
Jetzt sollte ich doch einmal das„Wir“ erklären! Das waren vierMitglieder aus dem DAB-Vor-stand, Dr. Patricia Aden, Dr. Ro-semarie Killius, Prof. GudrunSchmidt-Kärner, Prof. Dr. Sigridvon den Steinen, die ständig mit-einander im Gespräch waren, au-ßerdem Gerda Heufelder ausFrankfurt sowie die beiden EinzelmitgliederDr. Ingeborg Lötterle und Gundi Tröger ausNürnberg-Erlangen. Insgesamt sind auf derTeilnehmerinnen-Liste 102 Frauen ver-merkt und zwar aus folgenden Ländern:Austria (30), UK (8), UK Scotland (6), Ire-land (12), Netherlands (11), Switzerland(2), France (3), Italy (2), Sweden (1), Finn-land (2), Romania (9), Iceland (4), Croatia(1), Slovenia (2), Israel (2). Spanien war austraurigem Anlass überhaupt nicht vertreten,weil gerade einige Tage vorher die sehr en-gagierte Maria Elisa Zorriqueta ausBilbao/Biskaya und Pastpräsidentin vonSpanien verstorben war, wie mir die jetzigespanische Präsidentin Nancy Bonce traurigmitgeteilt hat.
Am 24. August, einem sehr heißen Tag,reiste ich um die Mittagszeit mit Frau Heu-felder aus der Frankfurter Gruppe per LHnach Graz, wo die Temperaturen ähnlichhoch waren. Wir stellten unser Gepäck imgebuchten Hotel ab und beeilten uns, zurRegistrierung in das fußläufig gelegene Fran-ziskaner-Kloster zu kommen, im Zentrumvon Graz, inmitten von Fußgängerzone undAltstadt. Dieses schöne alte und kürzlichrenovierte Kloster sollte für die kommendenzwei Tage auch unser „Conference Center“ sein. Für den Abend waren die Teilnehme-
rinnen der UWE-Konferenz zum Empfang beim Bürgermeister im Rathaus geladen.Statt seiner begrüßte uns eine Vertreterinim historischen Sitzungssaal. Ebenso be-grüßte uns vom Verband der österrei-chischen Akademikerinnen (VAÖ) die CER,Maxie Uray-Frick, und natürlich unsereUWE-Präsidentin, Edith Lommerse. Danachbat die Stadt Graz zu einem warmen Steh-buffet, wo viele Gespräche mit alten undneuen Freundinnen aus ganz Europa ge-führt werden konnten.
Die Konferenz beginnt
Der Freitag, 25. August, begann um 9 Uhrmit dem Konferenz-Programm „Changingcultures“.
Zunächst begrüßte uns Abt Josef, derHausherr des Männerklosters, das 1241 ge-gründet wurde. Er wünschte der Konferenzviel Erfolg, gute Gespräche und ein freund-liches Miteinander. Letzteres konnten wir,die Frauen des DAB, gut gebrauchen, dennwir fühlten uns etwas unbehaglich, da wirvereinzelt doch als ungebetene Gästewegen unseres Austritts aus dem GWIangesehen wurden. Dann erfolgte dieBegrüßung aller Gäste durch die öster -
Changing Cultures –Motto der UWE-Konferenz in GrazVon Rosemarie Killius
Konsens_2017_final.qxp_Konsens 21.12.17 08:37 Seite 43
INTERNATIONAL
44 KONSENS 2017
reichische Präsidentin, Mag. ElisabethGyörfy.
Schließlich begann die frühere österrei-chische Bundesministerin für Frauen- fragen, Helga Konrad, mit dem ersten Vor-trag „Migrant/Refugee Women on theRadar.“
Sie hob diverse Fakten hervor, die ihr be-sonders erwähnenswert erschienen, imGrunde aber keine neuen Erkenntnisse dar-stellten: 1. Mehr als 200 Millionen Menschen leben
als Migranten außerhalb ihres Landes,2. Migration ist eigentlich Männersache,3. Frauen machen sich hauptsächlich aus
Gründen der Familienzusammenführungauf den Weg,
4. die Zahl der Frauen liegt bei 52 Prozent, 5. die Frauenflüchtlinge sind eher ohne Be-
schäftigung als die Männer, 6. sie stehen eher unter der Violence-Gefahr
als andere Frauen, 7. immer mehr Länder werden sich be-
wusst, dass sie dringend die Flüchtlingezur Arbeitsbeschaffung brauchten,
8. hiermit sind tiefgreifende Veränderungenund ein Umdenken in den Ländern not-wendig,
9. von Ausbeutung sind vor allem die Frau-en betroffen,
10. Flüchtlingsfrauen nehmen in den Auf-nahmeländern Jobs an, die weit unterihrem Ausbildungsniveau liegen,
11.da sie ihre Rechte nicht kennen, sindsie auch unterbezahlt,
12.davon profitieren dann kriminelle Or-ganisationen,
13.Flüchtlingsfrauen sind im Vergleich zuden Männern in allen Bereichen be-nachteiligt, weil sie auch nicht organi-siert sind.
Die Ministerin nannte als Beispiel für die-ses Dilemma Frauen mit Universitätsab-schluss, die sich in westlichen Ländern alsPutzhilfen verdingen müssten.
Nach der Kaffeepause ging es nun erst rechtum Österreich, denn jetzt erklärte die Vor-sitzende des österreichischen Integrations-büros für Flüchtlingsfragen, Integration und
europäische Belange, Bernadette Zsoldos,mit ihrem Vortrag Refugee Integration inAustria: reflections on values and social co-hesion“ die Situation. Sie gab konkret diefür Österreich wesentlichen Daten an:
Seit drei Jahren befinden sich Flüchtlingein Österreich, etwa 105.000 Personen,davon 72 Prozent Männer. Anfangs sinddie Menschen aus Syrien, Irak, Afghanistangekommen, jetzt vorwiegend aus Nigeria,Iran, Syrien. Es wird sicher 15 bis 20 Jahredauern, bis Flüchtlingsfrauen in den Ar-beitsmarkt integriert werden können. DasIntegrationsministerium bemüht sich sehrum ihre Eingliederung und um die Vermitt-lung der österreichischen Werte wie Frei-heit, Themen aus der Geschichte wie derWeltkriege beispielsweise, Organisation desAlltags u.a.m.
Sie hat mir freundlicherweise einige Linksgeschickt, damit sich jede Frau, die sich mitder österreichischen Flüchtlingspolitik be-schäftigen will, orientieren kann. Allgemei-ne Informationen zur Ausrichtung der öster-reichischen Integrationsarbeit finden sichim Integrationsbericht, der aktuelle Berichtist erst im August erschienen: https://www.bmeia.gv.at/fileadmin/user_uplo-ad/Zentrale/Integration/Integrationsbe-richt_2017/Integrationsbericht_2017.pdf.Zahlen, Daten und Fakten zum Bericht fin-den sich im statistischen Jahrbuch: https://www.bmeia.gv.at/fileadmin/user_uplo-ad/Zentrale/Integration/Integrationsbe-richt_2017/Statistisches_Jahrbuch_2017.pdf.
Eine statistische Darstellung mit Frauen-fokus ist auf der Webseite des Österrei-chischen Integrationsfonds unter http://www.integrationsfonds.at/themen/publi-kationen/zahlen-fakten/migration-integra-tion-schwerpunkt-frauen/ zu finden.
Nähere Informationen zum Integrations-gesetz stehen unter https://www.bmeia.gv.at/integration/integrationsgesetz/ zurVerfügung.
Die drei Workshops am Nachmittag, zweiin englischer Sprache, einer auf Deutschsollten das Thema verfestigen und zur Dis-
kussion anregen. Wie ich hörte und in mei-nem Workshop selbst erlebte, kam es inallen drei Workshops zu keiner offenen Dis-kussion, sondern es wurden stattdessenwieder Vorträge von Frauen, die in Grazmit Flüchtlingsfragen beschäftigt sind, ge-halten.
Dieser Konferenztag endete mit einemÖsterreichabend und der 95-Jahrfeier desVAÖ. Hier wurden die anwesenden jewei-ligen Präsidentinnen und die Arbeit desVAÖ gewürdigt. Bei traditioneller österrei-chischer Volksmusik gab es danach ein war-mes Buffet mit österreichischen Spezialitä-ten im Kultursaal des Franziskanerklosters.
DAB bleibt vollwertigesMitglied bei UWEAm nächsten Morgen, dem Samstag, 26.August, gingen wir DAB-Frauen gespanntin die Konferenz. Denn nun kam dasThema, das uns sehr beschäftigte, und wes-halb wir vor allem nach Graz gekommenwaren:
War der DAB nunmehr vollgültiges Mit-glied bei UWE, obwohl er bei GWI ausge-treten ist? Die Statuten sahen bisher anderesvor, nämlich dass alle Mitglieder von UWEauch Mitglieder bei GWI sein sollten. Umdie Internationalität des DAB zu sichernund um auch dem Wunsch der MitgliederRechnung zu tragen, konnte dies nur ver-wirklicht werden, wenn der internationaleUWE-Vorstand tatsächlich die UWE-Ver-
Konsens_2017_final.qxp_Konsens 21.12.17 08:37 Seite 44
INTERNATIONAL
KONSENS 2017 45
fassung ändern würde, wie die Präsidentin,Edith Lommerse, in den vergangenen Mo-naten mir immer wieder erklärte.
Nachdem die Präsidentin Lommerse dieKonferenz eröffnet und alle begrüßt hatteund die Vizepräsidentinnen Isabelle Trimail-le und Elena Flavia Castagnino Berlinghierials Mitglieder des UWE-Vorstandes ihre Jah-resberichte vorgestellt hatten, ging es umdie UWE-Verfassungsänderung, die vorherdurch eine Gruppe von Juristinnen unterFührung der Finnin Marita Salo erarbeitetworden war. Letztere war besonders be-troffen, da auch Finnland, ebenso wieDeutschland und andere Länder aus finan-ziellen Gründen kein Interesse mehr an ei-nem Verbleib bei GWI bekundeten.
Das Resultat der Änderung war dannnicht mehr, dass alle UWE-Mitglieder beiGWI und im UWE-Vorstand ebenfalls sämt-lich bei GWI sein sollten, sondern:
Der UWE-Vorstand besteht aus 5 Mitglie-dern (Präsidentin, 2 Vizepräsidentinnen,Generalsekretärin und Schatzmeisterin),die mindestens 3 Nationalitäten verkörpernmüssen und von diesen müssen 2 GWI-Mitglieder sein. (Article 12: The board shallconsist of members of at least three natio-nal federations of associations (NFAs) atleast two of which must be two fully paidup members of GWI)
Somit waren Deutschland und auch Finn-land, die den GWI aus finanziellen Gründenverlassen hatten, jetzt Vollmitglieder beiUWE!
Und auch das Budget, das vorher 1,53Euro per capita betragen hatte, konntedurch den nun regulären Beitritt dieser bei-den Länder auf 0,89 Euro verringert wer-den. Die Mitgliederzahlen stiegen damitvon 2384 auf 4027. Ein Mitgliederschwundist dennoch offensichtlich.
Als neue Vizepräsidentinnen, die jetztzur Neuwahl kandidierten, wurden Giu-seppina Foti (Italien) und Aisha Alshawaf(UK) gewählt. Die Wahl der Präsidentinwird nächstes Jahr erfolgen.
Als neues Mitgliedsland zeichnet sichdemnächst Israel ab.Die nächste UWE-Konferenz wird vom 14.bis 18 Juni 2018 in Rom stattfinden.
Stimmungsvoller Ausklangder Konferenz
Am Abend dieses für den DAB ereignisrei-chen Tages fand ein GALA-Dinner in einemRestaurant über den Dächern von Graz miteinem spektakulären Ausblick statt.
Den Abschluss der Konferenz bildetenam Sonntag Spaziergänge durch Graz und
verschiedene Exkursionen. Ich habe aneiner davon in das Weinland des Südensder Steiermark, das oft als die „Österrei-chische Toskana“ bezeichnet wird, teilge-nommen. Dort wurden wir in einer typi-schen südsteirischen „Buschenschank“ beieiner Winzerin mit einer traditionellenBrettljause und steirischem Wein verwöhnt.
Diese UWE-Tagung in Graz war trotz großerHitze, einigen Unsicherheiten, Unklarheitenund Irritationen zu Beginn sehr interessant,denn neue Freundschaften ergaben sichfast von selbst und besonders gefreut hatmich persönlich, dass die Präsidentinnenvon Österreich (Frau Mag. Györfy) und derSchweiz (Frau Boscardin), mir spontan ihrBedauern ausdrückten und sich quasi dafürentschuldigten, dass sie wegen einiger Miss-verständnisse nicht am D-A-CH-Treffen desDAB 2016 in Frankfurt am Main teilneh-men konnten.
Autorin: Dr. Rosemarie Killius ist Philolo-gin, DAB-Vorstandsmitglied (CER) und imVorstand der Regionalgruppe Frankfurt
■
Menschliches Miteinander baut BrückenD-A-CH-Treffen in ChurVon Vera Gemmecke-Kaltefleiter
Vom 6. bis 8. Oktober 2017 fand inChur/Graubünden/Schweiz das dies-
jährige D-A-CH-Treffen statt. D-A-CH, füralle die es noch nicht wissen, heißt:Deutschland, Austria, Confoederatio Hel-vetica.
Dieses Treffen wird jedes Jahr von einemanderen der drei nationalen Akademikerin-nenverbände organisiert: vom SVA (Schwei-
zerischen Verband der Akademikerinnen),vom VAÖ (Verband der AkademikerinnenÖsterreichs) und vom DAB (Deutscher Aka-demikerinnenbund). Es ist ein Freund-schaftstreffen, das dazu dienen soll, sich ge-genseitig besser kennenzulernen. Entspre-chend steht nicht der Inhalt der Tagung imVordergrund, sondern das menschliche Mit-einander. Insgesamt nahmen an dem Treffen
in Chur 41 Frauen teil, davon 6 ausDeutschland.
Die Schweizerinnen Manuela Schiess,Lore Fuchs und Jacqueline von Sprecheraus der Gruppe Graubünden hatten ein um-fangreiches Programm vorbereitet und sorg-ten für einen reibungslosen Ablauf.
Vielen Dank für die hervorragende Orga-nisation!
Konsens_2017_final.qxp_Konsens 21.12.17 08:37 Seite 45
INTERNATIONAL
46 KONSENS 2017
Man traf sich am frühen Freitagnachmittagfür die Einschreibung im „Café am Mar-tinsplatz“ und nicht in irgendeinem sterilenBürohaus. Eine Universität hat Graubündennicht. Nach einer Tasse Kaffee ging es, auf-geteilt in zwei Gruppen, zu einer Stadtfüh-rung. Zwei Stunden wanderten wir durchdie hübsche Altstadt von Chur und lerntenuns gegenseitig kennen sowie die wechsel-volle Geschichte der Stadt, die schon in derRömerzeit an einer der wichtigsten Han-delsrouten jener Zeit lag, von der Po-Ebeneüber den Splügen-Pass durch das Tal desHinterrheins und dann des Rheins zum Bo-densee.
Diese Verbindung nach Italien führte zueiner sehr frühen Christianisierung, wiedurch eine Vielzahl von romanischen Kir-chen und Kapellen noch heute zu erkennenist. Da die Schweiz auch führend im Kampfgegen die etablierte römische Kirche durchdie Reformatoren Zwingli, Calvin und an-dere war, hinterließ dieser Glaubenskampfauch deutliche Spuren in all den DörfernGraubündens. Diese konnten jeweils fürsich bestimmen, ob sie beim Altglaubenblieben oder zum neuen Glauben übertra-ten. So entstand ein großer Flicken teppichvon katholischen und refor mierten Dörfern,der auch Einfluss auf die Gestaltung deralten Kirchen hatte.
All dies konnten wir 500 Jahre späternoch in den Kirchen, die wir besichtigten,nachempfinden.
In Chur selbst gab es sowohl den römischenGlauben als auch den neuen reformiertenGlauben. Ihre Kirchen stehen in Rufweite:die reformierte Martinskirche und die ka-tholische Kathedrale, die Bischofskirche.Entsprechend unterschiedlich ist die jewei-lige Ausstrahlung. Hier die von Bildern undWandmalereien „befreite“ reformierte Kir-che, in der ursprünglich nichts vom gespro-chenen Wort ablenken sollte, dort das mit
alten Wandmalereien und einer Vielzahlvon Altären üppig ausgestattete Gotteshaus.
Vorbei an Weinbergen, dem Bischofssitzund vielen anderen historischen Gebäudenund mit Blick auf weitere Kirchen beende-ten wir unsere Stadtführung vor dem Ge-burtshaus der Angelika Kauffmann, einerder wenigen bekannten Malerinnen des18. Jahrhunderts, deren Porträts weltbe-rühmt sind.
Abends trafen wir uns noch zu einem ge-meinsamen Abendessen in einem Gasthausder Altstadt. Überhaupt, diese Essen botenuns die Möglichkeit zu einem intensivenGedankenaustausch.
Der Sonnabend war komplett für kulturelleGenüsse verplant. Um 8.30 Uhr ging es be-reits mit einem Bus in das Tal des Vorder-Rheins zur Kirche in Waltensburg mit ihrenWandmalereien eines unbekannten Malersaus dem frühen 14. Jh., der in rund 20Orten in Graubünden in der Hochgotikwundervolle, sehr farbintensive Wandma-lereien schuf und nach den Malereien inder Waltensburger Kirche als WaltensburgerMeister bezeichnet wird. Da auch dieseKirchengemeinde im 16. Jahrhundert zumreformierten Glauben wechselte, wurdendamals die Bilder übertüncht, um ja nichtdurch ihre Strahlkraft vom gesprochenenWort abzulenken. Erst in den 30er-Jahrendes 20. Jh. wurden sie bei Renovierungs-arbeiten wiederentdeckt und freigelegt. Indem kleinen Museum, das unterhalb der
Konsens_2017_final.qxp_Konsens 21.12.17 08:37 Seite 46
INTERNATIONAL
KONSENS 2017 47
Kirche in einem landestypischen Haus un-tergebracht ist, wurden uns dann noch dieübrigen Wirkungsstätten des WaltenburgerMeisters gezeigt und vor allem seine Mal-technik an einem Muster vorgeführt.
Auf der Weiterfahrt sprangen wir vom14. Jh. n. Chr. zurück ins 16. bis 12. Jh. v.Chr. und besichtigten die größte und wich-tigste Megalithanlage der Schweiz mit mehrals mannshohen Steinen.
Nach einem landestypischen Essen ginges dann mit dem Bus in das Tal des Hinter -Rheins nach Zillis zur Besichtigung der be-malten Kirchendecke in ebenfalls einer Mar-tinskirche aus der Zeit der Hochromantik.Obwohl die Kirchengemeinde ebenfallszum reformierten Glauben wechselte, bliebdiese Decke ohne Übermalung, aus wel-chem Grund auch immer. Es ist nichts da-rüber übermittelt. Sie besteht aus 153 qua-dratischen auf Holz gemalten Bildtafeln mitbiblischen Szenen von je 90 cm Seitenlänge.Der uns führende Kunsthistoriker warf inseinen Erläuterungen auch einen Blick aufdie Frauen, die in diesen biblischen Szenendargestellt wurden.
Insgesamt wurden alle Führungen vonhervorragenden Kennern ihrer Materie
durchgeführt, die z.T. wissenschaftliche Ar-beiten darüber verfasst hatten, was den Ge-nuss steigerte.
Die Rückfahrt nach Chur ging dann durchdie beeindruckende und in früheren Jahr-hunderten berüchtigte Viamala-Schluchtmit ihren bis zu 300 m hohen Felswänden.
Der Abend endete wieder mit einem ge-meinsamen Essen, diesmal oberhalb derStadt mit einem wunderbaren Blick auf dasglitzernde Chur tief unten im Tal.
Am Sonntag wurde uns dann aber noch einausgesprochenes Frauenthema geboten:der Besuch im Frauenkulturarchiv des Kan-tons Graubünden. Hier wurde seit 1997unter der fachkundigen Leitung von SilkeMargherita Redolfi mit vielen ehrenamtlichEngagierten ein Archiv über Frauen undihre Organisationen in Graubünden geschaf-fen, das beeindruckend in seinem Umfangist. Schon jetzt sind außerdem aus dieserArbeit mehrere umfangreiche Publikationenhervorgegangen. Frau Redolfi beschrieb unsdie Schwierigkeiten, die ein solches Archivhat, um an Wissen über Frauen heranzu-kommen, denn Frauen waren in der Ver-gangenheit weder für die Wissenschaft nochfür die Außenwelt sichtbar. Sie kamen nir-gends vor.
Aber auch die Technik des Archivierenseiner solch heterogenen Materialsammlungerklärte uns die Leiterin. Wir lernten etwaskennen, was auch deutschen Ländern zur
Nachahmung zu empfehlen wäre. Dadurchwird das Wissen über das Wirken von Frau-en im regionalen Umfeld in unvergleichli-cher Weise gebündelt.
Der Vormittag schloss mit einemkleinen Empfang ab und die Wege der Ta-gungsteilnehmerinnen gingen auseinander.Etwa die Hälfte traf sich noch zu einem letz-ten gemeinsamen Essen in der Stadt, danngehörte auch dieses schöne Treffen der Ver-gangenheit an, aber die Kontakte bleiben.
Im nächsten Jahr sind die Österreiche-rinnen die Gastgeberinnen des D-A-CH-Treffens.
Chur und die Kultur Graubündens werdenden Teilnehmerinnen unvergesslich bleiben.Nochmals vielen Dank an die Schweizerin-nen!
Autorin: Dr. Vera Gemmecke-Kaltefleiterist Dipl.-Volkswirtin und im Vorstand derDAB-Regionalgruppe Kiel
■
Konsens_2017_final.qxp_Konsens 21.12.17 08:38 Seite 47
ARBEITSKREISE UND AUSSCHÜSSE
48 KONSENS 2017
Kompetenzzentrum Technik Diversity Chancengleichheit e.V.
Frauen geben Technik neue ImpulseVon Sabine Hartel-Schenk, Sprecherin des AK-FNT im DAB
Die Förderung und Zukunftsgestaltungvon Frauen in technischen Berufen
gaben den Impuls für die bundesweite Ini-tiative „Frauen geben Technik neue Impul-se“, welche vor mehr als 30 Jahren vomBundesministerium für Bildung und For-schung, der damaligen Deutschen Bundes-post Telekom und der Bundesanstalt für Ar-beit ins Leben gerufen und einige Jahre spä-ter verstetigt wurde. Aus dieser Initiativeist der heutige Verein „KompetenzzentrumTechnik Diversity Chancengleichheit e.V.“hervorgegangen, welcher in Deutschlandzu den bedeutendsten Zusammenschlüssenzur Förderung von Chancengleichheit undVielfalt in Wirtschaft, Wissenschaft und Ge-sellschaft zählt.
Diesem Prozess sind wegweisende Kam-pagnen zur Sensibilisierung für das Thema„Frau+Technik“ vorausgegangen, welchedurch den Deutschen Akademikerinnen-bund e.V., vertreten durch den Arbeitskreis„Frauen in Naturwissenschaft“, angestoßenund gemeinsam mit anderen Frauenver-bänden umgesetzt wurden, wie der ersteStand von Frauen auf der männlich dom-minierten Hannover Messe Industrie (1988)und der erste Münchner-Mädchen-Tech-nik-Tag (1991).
Unter der Devise „gleiche Chancen fürFrauen und Männer, Respekt der Vielfaltsowie Nutzung der Kompetenzen aller“verfolgt das Kompetenzzentrum insbeson-dere die folgenden Ziele:– Entwicklung strategischer Konzepte zur
Reflexion des Rollenverständnisses vonMännern und Frauen in der Gesellschaft
– Förderung von Technikbildung und so-zialen Kompetenzen bei Mädchen undJungen, damit Berufe und Studiengängeunabhängig vom Geschlecht gewähltwerden können
– Vereinbarkeit von Beruf und Familie fürFrauen und für Männer
– Mitgestaltung der Innovations- und Wis-sensgesellschaft in Deutschland
Erfolgsfaktor für das Kompetenzzentrumist die umfangreiche bundesweite Vernet-zung mit einer Vielzahl von Partnerinnenund Partnern aus Wissenschaft, Wirtschaft,Politik und Verbänden, die als Mitglied imVerein oder in Kooperation bei der erfolg-reichen Umsetzung der vielfältigen Initia-tiven und Projekte mitwirken. GelungeneBeispiele sind der bundesweite „Girls Day– Mädchen-Zukunftstag“, der „Boys Day –Jungen-Zukunftstag“ im Rahmen die Initia-tive „Neue Wege für Jungs“ oder der Na-tionale Pakt für Frauen in MINT-Berufen„komm, mach MINT“.
Das Kompetenzzentrum hat seine Auf-gaben in mehreren Arbeitsbereichen ge-bündelt:
•Bildung, Weiterbildung und Beruf: Hierliegt der Fokus auf genderorientierter Be-rufs- und Lebensplanung entsprechendder individuellen Interessen und Fähig-keiten von Mädchen und Jungen. In Zu-sammenarbeit mit Partnerinnen und Part-nern setzt es sich zum Abbau von struk-turellen Barrieren ein. Erfolgreiche Pro-jektbeispiele für den Übergang von Schuleund Beruf sind die Kampagne „Gender-kompetent 2.0 NRW – kein Abschlussohne Abschluss“ und das Webportal „Kli-schee-frei.de“ zur Studien- und Berufs-wahl frei von Geschlechterklischees.
• Demographie: Zur Gestaltung der Aus-wirkungen der sich wandelnden Gesell-schaft in Deutschland müssen Strategienentwickelt werden. Das Kompetenzzen-trum ist Sitz der bundesweiten Geschäfts-stelle der Demographie-Werkstatt-Kom-munen.
• Digitale Integration: Veränderungen derquantitativen und qualitativen Internet-beteiligung werden zum Ausgangspunktfür praxisnahe Konzepte und Maßnah-men, um für allen Bevölkerungsgruppendie aktive Mitwirkung an der Informati-ons- und Wissensgesellschaft zu ermög-lichen. Als aktuelle Beispielprojekte sindder Digital-Kompass und die Evaluation„Digitale Nachbarschaft“ zu nennen.
• Hochschule, Wissenschaft und For-schung: Dieser Bereich befasst sich mitder Entwicklung kreativer Ideen und Lö-sungen zur Unterstützung der Zukunfts-fähigkeit technischer und naturwissen-schaftlicher Studienangebote und zurStärkung der beruflichen Chancen vonFrauen verschiedener Altersgruppen undHerkunft in der Wissenschaft. Als Betrei-berin der Geschäftsstelle von „komm,mach MINT“ leitet das Kompetenzzen-trum die bundesweite Initiative zur För-derung von Frauen in MINT-Berufen. Da-neben führt es aktuell verschiedene Stu-dien zur Thematik durch.
Interessierte können sich über die gegen-wärtigen Projekte auf der Homepage desVereins unter www.kompetenzz.de infor-mieren. Seinen Sitz hat das Kompetenzzen-trum in der Hochschule Bielefeld.
■
Bitte DAB-Mitgliedsbeitrag (85 €)
nicht vergessen!
Konsens_2017_final.qxp_Konsens 21.12.17 08:38 Seite 48
ARBEITSKREISE UND AUSSCHÜSSE
KONSENS 2017 49
Zum wiederholten Male war der Arbeits-kreis „Frauen in Naturwissenschaft und
Technik“ im DAB mit einem Informations-stand auf dieser Frauen-Karrieremesse ver-treten. Dr. Martina Firus und Birgit Zichführten den ganzen Tag spannende Gesprä-che – mit vielen interessierten Frauen ausverschiedenen Nationen, Generationen undmit ganz unterschiedlichen persönlichenHintergründen. Besonders haben wir unsüber Bewerberinnen gefreut, die ganz be-wusst das Gespräch mit uns gesucht habenund Interesse zeigten, sich in einem Netz-werk wie dem DAB zu engagieren.
Am 17. Juni 2017 waren über 100 Unter-nehmen im Konferenzzentrum in Bonn ver-treten, von Chemie- über Maschinenbau-und Elektrounternehmen bis zu Dienstleis-tern und Zeitarbeitsfirmen. Viele interes-sierte Frauen nutzten die kostenfreie Mög-lichkeit, erste Gespräche zu führen oderfür einen Check ihrer Bewerbungsunterla-gen. Daneben gab es ein großes Workshop-und Vortragsangebot für (Wieder-)Einstei-gerinnen sowie verschiedene Slams. Kon-
gressschwerpunkt 2017 war das Thema„Veränderung & Transformation“. Unterdem Motto Arbeiten 4.0 präsentierte das
Bundesministerium für Arbeit und Sozialesdie Zukunft der Arbeit.
Ob Studentin, Absolventin, erfahreneFachfrau, Wiedereinsteigerin, Führungskraftoder einfach nur ambitioniert – auf derwomen&work treffen Besucherinnen aufüber 100 Top-Arbeitgeber und können sichim Franchise-Forum und im Weiterbildungs-Forum über alternative Karrierewege infor-mieren. Außerdem waren Verbände undVereine vertreten, um über die Chancendes Networkings zu informieren.
Im nächsten Jahr wird Deutschlands größterMesse-Kongress für Frauen (Eigenwerbung)am 28. April in Frankfurt am Main stattfin-den. Der AK-FNT wird erneut mit einemInformationsstand präsent sein.
www.womenandwork.de
Birgit Zich ist Dipl.-Ingenieurin und Elek-troingenieurin. Sie ist Mitglied im Arbeits-kreis „Frauen in Naturwissenschaft undTechnik“.
■
Der Arbeitskreis „Frauen in Naturwissenschaft und Technik“repräsentiert den DABwomen & work 2017Von Birgit Zich
v.l. Birgit Zich, Dr. Martina Firus
Dr. Martina Firus (3. v.r.) diskutiert am Stand
„Frauen in Naturwissenschaft und Technik“ (AK-FNT)
Wechsel in der Leitung des ArbeitskreisesVon Manuela B. Queitsch
Nach 16-jähriger Tätigkeit als Spreche-rin des DAB-Arbeitskreises „Frauen
in Naturwissenschaft und Technik“ wirdDr. Sabine Hartel-Schenk diese Aufgabezum Jahresbeginn 2018 abgeben. Der Ar-beitskreis hat in seiner Sitzung am 4. No-
vember 2017 in Berlin Frau Dr. Ira Lemmzur Ersten Sprecherin und Frau Prof. Dr.Andrea Koch zur Zweiten Sprecherin je-weils mit großer Mehrheit gewählt.
Die Biologin Ira Lemm ist Leiterin derGeschäftsstelle des Helmholtz-Forschungs-
instituts in Mainz. Andrea Koch hat einenLehrstuhl für Optial Design an der FakultätNaturwissenschaften und Technik derHochschule für Angewandte Wissenschaftund Kunst in Göttingen inne. Beide Frauensind schon seit vielen Jahren aktive Mitglie-
Konsens_2017_final.qxp_Konsens 21.12.17 08:38 Seite 49
ARBEITSKREISE UND AUSSCHÜSSE
50 KONSENS 2017
der des „Frauen in Naturwissenschaft undTechnik“.
Seit seiner Gründung vor mehr als 30Jahren gehört der Arbeitskreis „Frauen inNaturwissenschaft und Technik“ zu denaktivsten und lebendigsten Gremien unse-res Verbandes. Er tagt regelmäßig zweimalim Jahr und ist durch seine Sprecherin miteiner Reihe von Frauenverbänden sowieInitiativen vernetzt, die alle das Ziel derFörderung von Frauen in naturwissenschaft-lichen und technischen Berufsfeldern ver-folgen. Sabine Hartel-Schenk fühlt sich demArbeitskreis nach wie vor eng verbunden,möchte aber künftig mehr in Projektenselbst arbeiten.
Seit den ersten Auftritten auf der HannoverMesse Industrie sind die Frauen des AK-FNT regelmäßig als Expertinnen auf Frau-en-Karrieremessen mit qualifizierten Work-shops zu Themen der Berufswahl oder desWiedereinstiegs, zu alternativen Karriere-möglichkeiten oder dem Selbstmarketingüber soziale Medien präsent. Dort reprä-sentieren sie den DAB mit einem Messe-stand, pflegen das Netzwerk zu anderenFrauenverbänden und stehen jungen Frau-en Rede und Antwort zu vielen themenge-bundenen Fragen. Nicht unerwähnt darfdie Tatsache bleiben, dass junge Frauen beidiesen Veranstaltungen als Mitglieder ge-worben werden.
Daneben hat der Arbeitskreis auch eigeneFachveranstaltungen organisiert.
Unter der Leitung von Dr. Sabine Hartel-Schenk hat sich der AK-FNT in der Vergan-genheit immer wieder mit Stellungnahmenzu frauenpolitischen Themen eingemischt.Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit wur-den beispielsweise Faltblätter für die Au-ßendarstellung und Mitgliederwerbungzum Arbeitskreis und zwei Publikationenzu Akademikerinnen veröffentlicht. Daszwanzigjährige Jubiläum zur deutschenWiedervereinigung war Anlass für die Ver-öffentlichung der vielbeachteten Publikation„Die Naturgesetze gelten in Ost und West– Biographien von Frauen in Naturwissen-
schaft und Technik“. Im Fokus standen ge-genseitige Interviews der AK-Mitglieder ausder ehemaligen DDR und der BRD mit Fra-
gen zu den Gründen für die Wahl einesMINT-Berufes sowie biographischen Erleb-nissen in Studium und Beruf in Ost undWest. Durch die gegenseitigen Interviewsenthält jede Biographie den „Blick von deranderen Seite“. Diese Publikation ist immernoch bei jungen Frauen nachgefragt undein Beitrag im Rahmen des nationalen Pakts„Komm, mach MINT“, in welchem derDAB, vertreten durch den AK-FNT, seit2009 Partner ist.
Daneben hat der AK-FNT die Eisenbahn-ingenieurin Maren Heinzerling aktiv beider Umsetzung und weiteren Bekanntma-chung des Projekts „Zauberhafte Physik mitSprach- und Sachkisten“ unterstützt. MarenHeinzerling ist für dieses Projekt mehrfachausgezeichnet worden.
Auch künftig wird sich der Arbeitskreis mitBildungsthemen beschäftigen, wobei derFokus insbesondere auf den BereichenHochbegabung, der Weitergabe von Bildungsowie dem Einfluss der Digitalisierung aufBildung, Arbeitswelten und die Gestaltungverschiedener Lebensabschnitte gerichtetist. Der Arbeitskreis möchte mit diesen The-menbereichen Impulse geben, um eine po-sitive Entwicklung insbesondere für Frauenin MINT-Berufen zu bewirken.
Kontinuität, Hartnäckigkeit, Kreativität undeine große Bereitschaft, Ideen konkret um-zusetzen, zeichnen die Arbeit der Kollegin-nen aus. Zum Kern des Kreises gehörennoch einige Frauen der ersten Stunde, an-dere arbeiten bereits seit vielen Jahren mit.
Ihnen allen und ganz besonders der bis-herigen Sprecherin, Dr. Sabine Hartel-Schenk, sei an dieser Stelle ausdrücklichim Namen des Bundesvorstandes gedankt.
Die positive Außenwirkung unseres Ver-bandes wird unter anderem auch durch dieder aktiven Mitarbeit in den Arbeitskreisen,wie dem AK-FNT geprägt. Den beidenneuen Sprecherinnen, Dr. Ira Lemm undProf. Dr. Andrea Koch, wünschen wir vielErfolg.
■
Dr. rer. nat. Sabine Hartel-Schenk
Dr. Ira Lemm
Prof. Dr. Andrea Koch
Konsens_2017_final.qxp_Konsens 21.12.17 08:38 Seite 50
ARBEITSKREISE UND AUSSCHÜSSE
KONSENS 2017 51
Bericht zur Tagung des Arbeitskreises Frauen, Politik & Wirtschaft
„Der Wandel des Arbeitsmarktes als Heraus-forderung für Frauen – Digitalisierung,Liberalisierung, Rollenverständnis“Von Patricia Graf
Industrie 4.0 – eine Chance für Frauen?Von Patricia Graf
Die digitalisierte Wirtschaft boomt! DieITK-Industrie ist mit einem Beitrag
von fünf Prozent zur Bruttowertschöpfunginzwischen ein wichtiger Wirtschaftsfaktorund auch in allen anderen Branchen schrei-tet die Digitalisierung voran. Schaut mansich aktuelle Debatten an, so wird die Di-gitalisierung der deutschen Wirtschaft auchgerne als Karrieremotor für Frauen geprie-sen. Flexible Arbeitsmodelle winken da,agile Führungsmodelle versprechen flacheHierarchien. Zudem wurden in den ver-gangenen Jahren zahlreiche Initiativen insLeben gerufen, um mehr Frauen in natur-wissenschaftlich-mathematisch-technischenBereichen auszubilden. Wie ist angesichtsdieser positiven Entwicklungen aber zu er-
klären, dass die Gestalter von Industrie 4.0,die Managementebene sowie die Startup-Szene eher jung und/oder männlich ist?Eher desillusionierend wirkt da auch einBlick in den Bundesgleichstellungsberichtsowie in jüngsten Studien zu Geschlech-tereffekten der Digitalisierung (z.B. Studieder Böckler-Stiftung) „Digitalisierung, Arbeitund Geschlecht“, die beide zeigen, dasssich momentan horizontale und vertikaleGeschlechtersegregation auf dem Arbeits-markt eher noch verschärfen. Grund genugfür den Arbeitskreis Frauen, Politik & Wirt-schaft, sich die Strukturen von „Industrie4.0“ und das Zusammen-wirken mit den Tenden-zen der letzten 20 Jahre
zur Flexibilisierung des Arbeitsmarktes ein-mal unter Geschlechterperspektive anzu-schauen.
Autorin: Prof. Dr. Patricia Graf ist seit 2011Mitglied des DAB und des ArbeitskreisesFrauen, Politik und Wirtschaft. Sie ist Pro-fessorin für Forschungsmethoden an derBSP Business School Berlin und arbeitetzu den Schwerpunkten Innovationpolitik,nachhaltige Innovationen und Geschlech-terperspektiven auf die Wirtschaft. Für denArbeitskreis moderierte sie die Tagung.
■
Am 10. November lud der ArbeitskreisFrauen, Politik & Wirtschaft des DAB
zur 7. Jahrestagung ein. Die Jahrestagungendes Arbeitskreises, der sich 2011 innerhalbdes DAB unter Vorsitz von Erdmute Geitner
gegründet hat, haben sich inzwischen alsPlattform zur Vernetzung des DAB mit Frau-enpolitischen Vertreterinnen der BerlinerWirtschaft etabliert. In diesem Jahr standdas Thema Industrie 4.0 zur Diskussion.
Im Folgenden drucken wir die Anmodera-tion von Prof. Dr. Patricia Graf sowie dieBeiträge der Referentinnen Prof. Dr. Jean-nette Trenkmann und Dr. Isabel Roesslerab.
Referentinnen und Teilnehmerinnen der Podiumsdiskussion
(von links nach rechts): Dr. Patricia Graf (Business School Berlin, Moderation desAK), Dr. Helga Lukoschat (Vorstandsvorsitzende der EAF (Europäische Akademiefür Frauen und Politik), Prof. Dr. Jeannette Trenkmann (Business School Berlin),Henrike von Platen (Präsident der Business und Professional Women), Brigitte TriemsExpertin EU-Gleichstellungspolitik, Erdmute Geitner (Vorsitzende des Arbeitskreises),es fehlt auf dem Foto: Dr. Isabel Roessler (Senior Projektmanagerin CHE Gemein-nütziges Centrum für Hochschul ent wicklung, Gütersloh
Konsens_2017_final.qxp_Konsens 21.12.17 08:38 Seite 51
ARBEITSKREISE UND AUSSCHÜSSE
52 KONSENS 2017
Wodurch die Informatik weiblich wird – und wodurch nichtVon Jeannette Trenkmann
Basierend auf der Expertise für den zwei-ten Gleichstellungsbericht der Bundes-
regierung referierte Prof. Dr. JeannetteTrenkmann auf der AK-Tagung Frauen, Po-litik & Wirtshaft zu Geschlechterunter-schiede in der Selbständigkeit.
Wie die Expertise zeigt, fällt der Einkom-mensunterschied zwischen Männern undFrauen in der Selbständigkeit mit durch-schnittlich 43 Prozent (OECD 2016) sogarhöher aus als bei den abhängig Beschäftig-ten. Dieser Gender Income Gap hängt, wieaus der Diskussion um den Gender Pay Gapbekannt, u.a. mit der horizontalen Segre-gation auf dem Arbeitsmarkt, geschlechts-hierarchisierenden Bewertungsmustern –die den von Männern ausgeführten Arbei-ten einen höheren Wert beimessen – undder Zuständigkeit von Frauen für Familienund Sorgearbeiten zusammen, welche mitkürzeren Arbeitszeiten von Frauen korres-pondiert. Männliche Selbständige sind ge-nerell in einkommensstärkeren Branchenanzutreffen, öfter im Vollerwerb selbständig,weisen etwas längere Arbeitszeiten undeinen höheren Kapitaleinsatz bei der Grün-dung auf. Bei einer insgesamt hohen Quotevon Alleinselbständigen (55 Prozent,Destatis 2016) sind nach wie vor mehrmännliche Selbständige mit Beschäftigtenanzutreffen als weibliche (51 versus 46 Pro-zent, Destatis 2016).
Obwohl die Selbständigen eine sehr hete-rogene Gruppe sind und die Spreizung derEinkommen insgesamt sehr groß ist, gibtes die geschlechtsspezifische Einkommens-lücke in allen Branchen und Berufen, wiedie Studie anhand einer Auswertung derEinkommenssteuerstatistik zeigt. Danachsind z.B. Ärzte Spitzenverdiener mit gut120.000 Euro Bruttojahreseinkommen,Ärztinnen geben dagegen nur 82.000 Euroan Im Handel liegt das Einkommen selb-ständiger Männern bei gut 31.000 Euro,das der Frauen bei nur 22.000 Euro (S.22ff.).
Insgesamt, das macht die Studie deutlich,stellt der Anstieg der Frauen in der Selb-ständigkeit von 950.000 im Jahr 2000 auf1,2 Millionen im Jahr 2015 (Destatis 2016)eine Herausforderung für die Gleichstel-lungspolitik dar. Denn die Problematik desEinkommensunterschiedes setzt sich beiFragen der sozialen Sicherung fort.
Lücken in der sozialen Sicherung, selbständige Frauen besonders betroffen
Die teilweise geringen Einkommen der Selb-ständigen führen zu einer unzureichendenAlterssicherung. Das hohe Maß an prekärerSelbständigkeit und die in der Konsequenzunzureichende soziale Sicherung betrifft inetwa ein Viertel aller Selbständigen. Darun-ter sind besonders häufig Solo-Selbständige,und es trifft besonders oft Frauen. Gut eineMillion Selbständige verfügt nicht über eineeigene Alterssicherung (S. 84). Ein Großteilder Frauen, die selbständig erwerbstätigsind, wird im Alter auf die Erwerbseinkünftedes Partners bzw. den daraus resultierendenSicherungsansprüchen angewiesen unddamit finanziell abhängig sein.
Die deutschen Sicherungssysteme weisenzudem Lücken in Bezug auf den Mutter-schutz für Selbständige auf. Rechtliche Re-gelungen, die selbständigen Frauen in dieserZeit vor und nach der Geburt eines Kindesgenerell Leistungen und Schutzrechte zu-sprechen, gibt es nicht. Zwar hat das El-terngeld eine partielle Angleichung vonselbständig und abhängig Erwerbstätigengebracht, für selbständige Frauen stellensich im Falle der Unterbrechung der Er-werbstätigkeit jedoch nicht nur Fragen nachdem Ausgleich von Einkommensausfällen,um den eigenen Lebensunterhalt zu si-chern. Hinzu kommt das Problem, wie indieser Zeit das Unternehmen – und damitder eigene Arbeitsplatz – erhalten werdenkann. Vermutlich auch aus diesen Gründenweisen selbständige Mütter kürzere Phasender Unterbrechung ihrer Erwerbstätigkeitnach der Geburt von Kindern auf als Mütterin abhängiger Beschäftigung.
Insgesamt, das zeigt die Expertise, gibtes in der Selbständigkeit einen erheblichenGender Gap, der im Wesentlichen auf struk-turelle Gründe zurückzuführen ist.
Autorin: Prof. Dr. Jeannette Trenkmannist Professorin für Allgemeine Betriebswirt-schaftslehre an der BSP Business SchoolBerlin. Gemeinsam mit Claudia Gather undLena Schürmann vom Harriet-Taylor-Mill-Institut der Hochschule für Wirtschaft undRecht erstellte sie die Expertise für denzweiten Gleichstellungsbericht der Bun-desregierung.
Die gesamte Expertise ist online abrufbar:http://www.gleichstellungsbericht.de/de/article/51.expertisen.html
■
Bitte DAB-Mitgliedsbeitrag
(85 €)nicht vergessen!
Konsens_2017_final.qxp_Konsens 21.12.17 08:38 Seite 52
ARBEITSKREISE UND AUSSCHÜSSE
KONSENS 2017 53
Um die Chancen von Digitalisierung undLiberalisierung unter Geschlechterper-
spektive zu diskutieren, bedarf es zunächsteiner Bestandsaufnahme der Lage von Aka-demikerinnen in der Informatik. Hier wurdein den vergangenen Jahren von Universitä-ten sowie der Bundes- und Landespolitikviel unternommen, um den Anteil an Infor-matikerinnen zu erhöhen. Wie es um dieFrüchte dieser Bemühungen bestellt ist, un-tersucht ein aktuelles Projekt des CHE Cen-trum für Hochschulentwicklung. Im DAB-Arbeitskreis „Frauen, Politik & Wirtschaft“hat Dr. Isabel Roessler das Projekt FRUIT„Erhöhung des Frauenanteils im Studien-bereich Informationstechnologie durch fle-xible, praxisorientierte und interdisziplinäreStudienganggestaltung“ vorgestellt.
Hierzu ein kurzes DAB-Interview:Wie soll es gelingen, denFrauenanteil in Informatikzu erhöhen?Im Projekt FRUIT nehmen wir die Gestal-tung der Studiengänge in den Blick. Konkretuntersuchen wir drei Aspekte. Die anwen-dungsnahe Gestaltung von Studienprogram-men, die räumliche und zeitliche Flexibi-lisierung des Studiums z.B. durch digitale
Lehrformate oder Teilzeitstudienangebotesowie den inhaltlichen Zuschnitt von Studi-enprogrammen. Letzteres wird vor allemdann interessant, wenn Informatik mit Fä-chern kombiniert wird, die einen hohenFrauenanteil aufweisen. Informatik + Medi -zin ist ein Beispiel dafür. Medizininformatikhat einen vergleichsweise hohen Anteil anFrauen. Bioinformatik oder Medieninforma-tik ebenfalls. Bei Technischer Informatik siehtes anders aus. Technische Fächer werdengenerell seltener von Frauen belegt.
Der Inhalt macht es also. Gibt es weitere Ergebnisse?Wir arbeiten erst seit März 2017 an demvom BMBF geförderten Projekt und habenerst einmal eine umfangreiche Literatur-analyse durchgeführt. Der Literatur nachkönnen hohe Praxisanteile im Studium zueinem höheren Frauenanteil unter den Stu-dierenden beitragen. Flexibilisierung ist fürFrauen auch ein sehr wichtiges Thema. Un-sere bundesweite Strukturanalyse, bei derwir bei über 1.000 Informatik-Studiengän-gen den Zusammenhang zwischen Praxis-orientierung und Flexibilisierung und demFrauenanteil untersucht haben, zeigte je-doch, dass das gar nicht für das Informatik-
Studium zutrifft. Der Frauenanteil in dualenoder berufsbegleitenden, also sehr praxis-orientierten Studiengängen war fast durch-gängig niedriger als in nicht dualen und nichtberufsbegleitenden Programmen. Gleichesbei Fernstudiengängen oder Teilzeitstudi-engängen, also den flexiblen Formaten.
Wie geht es jetzt weiter?
Derzeit befragen wir Studierende in Infor-matik-Bachelorstudiengängen. Wir wollenwissen, wie praxisorientiert, wie digital undwie flexibel das Studium für Frauen inInformatik sein soll. Daraus leiten wir dannHandlungsempfehlungen für die Praxisab.
Autorin: Dr. Isabel Roessler ist SeniorProjektleiterin der noch nicht beendetenStudie zur „Entwicklung von Handlungs-empfehlungen zur Steigerung des Frauen-anteils in Informatikstudiengängen und inder Folge in Arbeitsbereichen der IT Bran-che“ am Centrum für Hochschulentwick-lung (CHE). Das Projekt wird aus Mitteln des BMBFunter dem Förderkennzeichen01 FP1635 gefö[email protected] ■
Frauen in Informatik-StudiengängenVon Isabel Roessler
Podiumsdiskussion
Im Anschluss diskutierten die Referentin-nen gemeinsam mit weiteren Vertreterin-
nen aus Politik und Wirtschaft die in denVorträgen aufgeworfenen Probleme. Zur Po-diumsdiskussion waren dieses Jahr eingela-den:
Dr. Helga Lukoschat Die Politikwissenschaftlerin ist Vorstands-vorsitzende der EAF Berlin (EuropäischeAkademie für Frauen in Politik und Wirt-
schaft) und hat die EAF zusammen mit Bar-bara Schöffel Hegel gegründet. Von 2001 bis2014 war sie zudem Geschäftsführerin derFemtec GMBH. Ihre Publikationsliste zu denThemen Frauen, Führung und Innovationist umfangreich. Wenn es um die Beratungvon Unternehmen hinsichtlich der Fragenvon Parität, diversen Organisationskulturenund Familienfreundlichkeit sowie interna-tionale Projekte zur Förderung der politi-schen und gesellschaftlichen Partizipation
von Frauen, dann ist Helga Lukoschat ge-fragt.
Henrike von PlatenHenrike von Platen war bis 2016 Präsidentindes Frauennetzwerks Business and Profes-sional Women Germany und gehört zu denBegründerinnen des Aktionstags Equal PayDay. Mit ihrer frauenpolitischen Verbands-tätigkeit setzte sie sich insbesondere für eineparitätische Besetzung von Frauen und Män-
Konsens_2017_final.qxp_Konsens 21.12.17 08:38 Seite 53
ARBEITSKREISE UND AUSSCHÜSSE
54 KONSENS 2017
Arbeitskreis PHA –Frauen in der PharmazieVon Annette Dunin v. Przychowski
Seit seiner Gründung hat sich der neueArbeitskreis mit zwei europäischen Auf-
gaben befasst. Die Hauptaufgabe war dieBeteiligung an der Organisation des 12. Eu-ropäischenPharmazeutinnen Treffens am30. September 2017 in Wien.
Frau Dr. Anne Lewerenz, eine der dreiSprecherinnen des DAB PHA, sitzt im Or-ganisationkomitee. Das Komitee setzt sichaus Apothekerinnen aus Großbritannien,
Österreich, Niederlande, Island und FrauDr. Lewerenz für Deutschland zusammen.Es besteht aus Apothekerinnen aus der öf-fentlichen Apotheke, Krankenhausapothe-ke, Industrie, öffentliche Verwaltung, For-schung und Lehre.
Unter dem Motto „Pharmazeutinnen –immer einen Schritt voraus!“ fanden am30. September Vorträge und Diskussionenzu folgenden Themen statt:
nern in Führungspositionen und Entgelt-gleichheit ein. 2011 initiierte sie die partei-übergreifende Berliner Erklärung mit, ausder auch die Aktion Spitzenfrauen fragenSpitzenkandidaten im Mai 2013 hervorging.Henrike von Platen diskutierte nun schonzum zweiten Mal mit dem Arbeitskreis undbrachte auch dieses Mal die Probleme vonIndustrie 4.0 auf den Punkt.
Brigitte TriemsBrigitte Triems ist national und internationalin verschiedenen Frauennetzwerken tätig.Seit 1994 ist sie Vorsitzende des Demokra-tischen Frauenbundes e.V. Von 2008 – 2012war sie Präsidentin der Europäischen Frau-enlobby und 2010 – 2015 Mitglied im Sach-verständigenbeirat des Europäischen Insti-tutes für Geschlechtergleichstellung (EIGE)in Vilnius sowie von 2013 – 2015 Mitgliedim Verwaltungsrat der Europäischen Platt-form Sozialer Nichtregierungsorganisationenin Brüssel. Die EU Frauen- und Gleichstel-lungspolitik kennt Brigitte Triems aus ver-schiedenen Positionen und Perspektiven.Das größte Problem, um die Chancen vonIndustrie 4.0. für Frauen noch besser aus-schöpfen zu können, sieht sie momentandaran, dass Industriepolitik und Geschlech-terpolitik auf EU-Ebene derzeit noch zuwenig vernetzt sind.
Zu den Beiträgen in der PodiumsdiskussionFrau von Platen sprach sich für mehr Unter-nehmerinnengeist aus; eine zu hohe Risiko-scheu vor Selbständigkeit fände sie falsch.Von Strategien wie Industrie 4.0 fühlt siesich nicht angesprochen. Sie berichtete inihrem Beitrag über das von ihr mitgegründete„Fair Pay Innovation Lab“, das u. a. einenkreativen Beitrag zum Thema Vereinbarkeitund Arbeitszeit entwickelt hat: Die dort be-schäftigten vier Personen, Frauen und Män-ner, haben sich gemeinsam für ein Modellentschieden, in dem Vollzeit 32 Wochen-stunden beinhaltet.
Frau Lukoschat berichtete über ihre Bera-tungstätigkeit für Firmen im Rahmen derEAF Berlin. Dabei arbeitet sie vor allem mitgroßen Unternehmen. Ein wichtiges Themasind dabei die auch aufgrund der Digitalisie-rung veränderten Arbeitsbedingungen vonFührungskräften. Inzwischen gibt es aucheigene Interessenvertretungen von Führungs-kräften.
Frau Triems sprach über den Wandel in derBedeutung der EU für die Gleichstellungs-politik. In der Vergangenheit hatte die EUhier viel Positives bewirkt. Gegenwärtig gäbees aber keine neuen Initiativen, sondern es
seien eher Rückschritte zu beobachten. Imneuen Strategiepapier der EU spiele dasThema keine Rolle und die Quoten-Richtlinieder Kommission liege auf Eis – u. a. deshalb,weil Deutschland „mauere“. Frau Triemswies abschließend auf den europäischenGleichstellungsindex hin, der alle zwei Jahrevom „European Institute of Gender Equality(EIGE)“ herausgegeben wird. Der Durch-schnittswert für die EU-Länder liege bei 66Prozent.
In der anschließenden Diskussion wurde an-geregt, dass die Hochschulen in den fach-übergreifenden Angeboten für ihre Studen-tinnen und Studenten künftig auch die Mög-lichkeit eröffnen sollte, Kurse zu solchenThemen wie Selbständigkeit, Unternehmens-gründung und die Erstellung von Business-Plänen aufzunehmen, z. B. über die CareerCenter.
■
Frau ArchitektAusstellung im DeutschenArchitekturmuseum Frankfurt
Seit mehr als 100 Jahren gestaltenFrauen im Architekturberuf. Mehr
als die Hälfte der aktuell Studierendenist weiblich, aber nur knapp 30 Prozentkommen als Architektin im Beruf an. DieAusstellung FRAU ARCHITEKT portrai-tiert 22 Frauen, die Architektur maßgeb-lich beeinflusst haben oder derzeit nochprägen. Sie ist bis zum 8. März 2018 imDeutschen Architekturmuseum Frank-furt zu sehen. Begleitet wird sie voneinem umfangreichen Veranstaltungs-programm. Mehr Informationen finden Sie unterhttp://www.dam-online.de/portal/de/Start/Start/0/0/0/0/1581.aspx
Dr. Sabine Hartel-Schenk, Mitglied im AK-FNT im DAB ■
Konsens_2017_final.qxp_Konsens 21.12.17 08:38 Seite 54
ARBEITSKREISE UND AUSSCHÜSSE
KONSENS 2017 55
• Ausbildung der Pharmazeutinnen: An-passung an neue berufliche Herausforde-rungen
• Berufsfelder für Pharmazeutinnen: ver-schiedene Arten der Berufsausübung
• Praxisrelevante pharmazeutische For-schung: wesentlich für die Weiterent-wicklung des Berufs
• Vereinbarkeit von Familie und beruflichenAnforderungenInteressierte können sich bei der zweiten
Sprecherin des DAB PHA, Frau AntonieMarqwardt: [email protected], aus-führlicher informieren.
Bei der zweiten europäischen Aufgabeging es um das Thema Versandhandel mitverschreibungspflichtigen Arzneimitteln.
Von DocMorris, Tochter der Zur Rose AGaus der Schweiz, hatten DPV-Mitglieder(Deutscher Parkinson Verein) Boni erhalten,wenn sie ihre Rezepte an die niederländi-sche Versandapotheke schickten. Dagegenhatte die Wettbewerbszentrale geklagt. DasOberlandesgericht Düsseldorf (OLG) hatteden Fall dem EuGH vorgelegt. Im Oktober2016 entschieden die Richter, dass auslän-dische Versender nicht an die deutschenPreisvorschriften gebunden sind.
Aktueller Stand:
• Die Aktie von Zur Rose ist stark gestie-gen.
• Der Versandhandel mit verschreibungs-pflichtigen Arzneimitteln aus dem Aus-land ist gestiegen. Vor dem EuGH-Urteilbetrug der Anteil der verschreibungs-pflichtigen Arzneimittel am Gesamtver-sandumsatz gerade mal 4 Prozent.
• Inzwischen hat die Apothekenzahl inDeutschland den niedrigsten Stand seit1988 erreicht, es gibt nur noch insgesamt19.880 Apotheken. Auf dem Land un-kompliziert und schnell Arzneimittel zuerhalten, ist noch möglich, wird aber ge-rade im Notdienst zunehmend schwie-riger.
• Einzelne Krankenkassen denken laut überKooperationen mit diesen Konzernennach und darüber, Patienten zu bestrafen,die nicht über das Internet bei ausländi-schen Versandapothekenkonzernen be-stellen.
• Deutsche Versandapotheken profitierennicht, da sie keine Rabatte gewährendürfen und sich dies in dem Ausmaß auchnie leisten können.
Um auf die komplizierte Materie und dieKonsequenzen für die Bevölkerung hinzu-weisen, Negativ-Beispiele gab es inzwischenin mehreren Ländern, hat der DAB PHAeine Pressemitteilung herausgegeben, dieinsbesondere in der pharmazeutischen Pres-se veröffentlicht wurde. Es folgte eine In-formationsveranstaltung unter Leitung vonDr. iur. Oda Cordes in den Räumen derDeutschen Apotheker- und Ärzte-Bank undmit Beteiligung von Mitgliedern des Bun-destages. Eine Stellungnahme zum Gesetz-entwurf des Bundesministeriums für Ge-sundheit zum Verbot des Versandhandelsausschließlich mit verschreibungspflichtigenArzneimitteln wird demnächst vom Bun-desministerium für Gesundheit veröffent-licht werden.
Leider konnte sich die Politik bisher nichtauf eine Lösung des Problems einigen, waslangfristig die Qualität einer optimalen Arz-neimittelversorgung in ganz Deutschlandgefährdet.
Für den DAB PHA, Annette Dunin v. Przychowski
■
Erfolgreich im Ehrenamt –Bildung weitergebenVon Sabine Hartel-Schenk, Mitglied im AK-FNT im DAB
Im Rahmen der sich ändernden Gesell-schaftsstrukturen ist „frau“ als Expertin
erneut gefragt. Sie kann den Übergang vomArbeitsleben in die dritte Lebensphase aktivgestalten und ihr Wissen oder ihre Kompe-tenzen anderen zuteil werden lassen.
Ein erfolgreiches Beispiel für eine gelun-gene Gestaltung der sogenannten Ruhezeitist das Mitglied des AK-FNT im DAB, MarenHeinzerling, die mit unermüdlichem Ehr-geiz und Einsatz das Projekt „Zauberhafte
Physik“ ins Leben gerufen und weiterent-wickelt hat. Neben bereits erfolgten frühe-ren Ehrungen, wie dem Bundesverdienst-kreuz am Bande, wurde Maren Heinzerlingalleine in diesem Jahr für ihr Engagementmehrfach ausgezeichnet. Sie wurde für denNationalen Integrationspreis der Bundes-kanzlerin (das Bild mit der tanzenden Ei-senbahningenieurin mit der Kanzlerin gingdurch die internationale Presse) und denDeutschen Bürgerpreis nominiert und hat
im Juli die Berliner Ehrennadel erhalten.Maren Heinzerling hat damit einen „Steinins Rollen gebracht“, indem sie zeigt, wiewichtig die Weitergabe von Bildung undWissen im Ehrenamt durch Ruheständler/innen an Kinder und Jugendliche aus bil-dungsfernen Umfeld ist – und ist durch denregelmäßigen Umgang mit jungen Men-schen selbst enorm jung geblieben.
■
Bitte an alle Mitglieder:
Senden Sie uns IhreE-Mail-Adressen!Das erleichtert dieKommunikation.
Konsens_2017_final.qxp_Konsens 21.12.17 08:38 Seite 55
ARBEITSKREISE UND AUSSCHÜSSE
56 KONSENS 2017
Bericht über die Arbeit des Förderausschusses in den Jahren 2016/17Von Renate Klees-Möller, DAB-Mitglied
Der Förderausschuss tagt einmal jährlichund entscheidet über eingegangene
Anträge auf einen Druckkostenzuschussfür die Veröffentlichung einer Promotionoder einer anderen wissenschaftlichen Ar-beit. Einzelheiten zu dem Verfahren undden Beurteilungskriterien finden sich aufder Homepage des DAB unter dem Stich-wort „Förderausschuss“.
Im Jahr 2016 wurden 23 Anträge auf fi-nanzielle Förderung an den DAB gerichtet,davon richteten sich 19 Anträge auf die Un-terstützung der Veröffentlichung einer Dis-sertation und je ein Antrag auf die Veröf-fentlichung einer Habilitationsschrift bzw.Magisterarbeit. Zwei Anträge zielten aufdie Förderung anderweitiger Publikationenjunger Wissenschaftlerinnen. Die Themen
der eingereichten Arbeiten lagen überwie-gend in den Geistes-/Kultur- und Sozial-wissenschaften, aber auch die StudienfächerJura und Wirtschaftswissenschaften warenvertreten.
Der Förderausschuss bewilligte 7 Anträgemit einem Zuschuss von je 300,00 Euround einen Antrag mit einem Zuschuss von200,00 Euro.
• Dr. Anett Dippner: Miss Perfect. Neue Weiblichkeitsre-gime und die sozialen Skripte desGlücks in China (transcript- Verlag)
• Dr. Astrid Hackel: Paradox Blindheit. Inszenierungendes Sehverlusts in Literatur, Theater und bildender Kunst der Gegenwart(Neufeld-Verlag)
• PD Dr. Eva Kalny: Soziale Bewegungen in Guatemala.Eine kritische Theorie Diskussion (Campus-Verlag)
• Prof. Barbara Vogel (Hg.): Der Arbeitskreis Historische Frauen- und Geschlechter-forschung 1990 bis 2015
• Dr. Esther Richthammer: Spielräume für Geschlechterfragen eine kunstpädadgogische Arbeit (Springer Verlag)
• Dr. Katharina Stein: Drittwirkung im Unionsrecht.Die Begründung einer Horizontal-wirkung allein durch Vorrang und unmittelbare Anwendbarkeit (Nomos-Verlagsgesellschaft)
Auflistung der Geförderten und ihre eingereichten Arbeiten 2016
Konsens_2017_final.qxp_Konsens 21.12.17 08:38 Seite 56
FORUM
KONSENS 2017 57
• Dr. Gunda Werner: Die Freiheit der Vergebung.Eine freiheitstheoretische Reflexionauf die Prärogative Gottes im sakramentalen Bußgeschehen (Pustet-Verlag)
• Dr. Andrea Kretschmann: Die Regulierung des Irregulären.Carework und die symbolische Qualität des Rechts (Velbrück Wissenschaft)
Auflistung der Geförderten und Titel der eingereichten Arbeiten 2017
Im Jahr 2017 wurden 30 Anträge gestellt, davon sind fünf be-willigt worden, drei Anträge mit einem Zuschuss in Höhe von400,00 Euro, ein Antrag mit einem Zuschuss in Höhe von 700,00Euro, ein weiterer mit 1000,00 Euro.
• Dr. des. Karin Hassler: Das Paradox der Geschlechter-dichotomie – eine empirische Unter-suchung zur Bedeutung von Geschlechtfür die Einnahme von Spitzenpositionenim Kunstfeld (transcript-Verlag)
• Dr. des. Lara Jüssen: Citizenship Migration Labour –Latin American household and construction workers Resisting Crisisin Madrid (Springer VS Verlag)
• Dr. des. Miriam Oesterreich: Erdteilallegorien und ‘Bananenmädchen’. Inszenierungen ‘exotischer’ Körper in früher Bildreklame (FinkVerlag) – Noch nicht veröffentlicht!
• Dr. Rosa Reuthner: Oikonomos und Oikonomia – Die „Hausfrau“ und die Ökonomie des Hauses von der Antikebis ins 19.Jh. (Böhlau-Verlag) – Noch nicht veröffentlicht!
• Anne-Laure Briatte: Citoyens sous tutelle.Le mouvement feministe „radical“ dansl’Allemagne wilhelmienne (Übersetzungsprojekt; Campus Verlag,Reihe „Geschichte und Geschlechter“)
■
28. April 2018:women & work in Frankfurt am Main
21. bis 23.09.2018:Tagung des DAB zum Thema „Kultureller Wandel“
in Berlin
Konsens_2017_final.qxp_Konsens 21.12.17 08:38 Seite 57
FORUM
58 KONSENS 2017
Seit 2010 treffen wir uns jährlich inBerlin, aber in diesem Jahr war das
Netzwerktreffen keine Selbstverständlich-keit.
Der Kooperationspartner Sanofi PasteurMSD hat bisher unsere Treffen gesponsert,nach der Auflösung des Joint Ventures Ende2016 konnten wir nicht mehr mit einerFörderung rechnen. Umso erfreulicher ist,dass MSD Sharp & Dohme (MSD) das Spon-soring des Jahrestreffen 2017 ubernommenhat.
Erfreulich ist auch, dass unser Netzwerkwächst und Expertinnen aus allen Berei-chen – Gynäkologie, Kinderheilkunde, öf-fentlicher Gesundheitsdienst, Gesundheits-wissenschaften und Pharmazie – ihr Wissenund ihre Erfahrung beisteuern. Durch Pres-semitteilungen, Poster bei Fachtagungenund vor allem durch Aktionen vor Ort, set-zen wir uns fur den Schutz vor HumanenPapillomviren (HPV) ein.
Harald zur Hausen wurde 2008 der Nobel-preis zuerkannt fur den Nachweis, dass Hu-mane Papillomviren Gebärmutterhalskrebshervorrufen. Heute kennt man HumanePapillomviren außerdem als Verursachervon Genitalwarzen und weiterer Krebsar-ten. Auch bösartige Tumoren des Mund-bodens und der Mandeln stehen mit HPVin Zusammenhang.
Der Schwerpunkt unserer diesjährigen Ta-gung war die Jungenimpfung. Unser Refe-rent, Dr. Martin Terhardt, ist Kinderarztund Mitglied der STIKO (Ständige Impf-kommission am Robert-Koch-Institut). Erkonnte uns sehr genau erklären, welcheKontrollen und wissenschaftliche Begut-
achtungen ein Impfstoffdurchlaufen muss, bevordie STIKO eine Empfeh-lung ausspricht. Dabeireicht es nicht aus, dassein Impfstoff wirksamund sicher ist. Die Emp-fehlung richtet sich nachklar definierten Impfzie-len und nach medizini-scher Evidenz.
Wir hoffen, dass dieSTIKO im nächsten Jahreine Empfehlung fur dieJungenimpfung aus-spricht. Das ist auch dieAussage unserer Presse-erklärung:
Anlässlich ihresJahrestreffens 2017 fordertdas HPV-Frauen-Netzwerk:Auch Jungen vor Infektionenmit dem Humanen Papillom-virus (HPV) schützen!
Jungen können das Humane Papillomvirusauf Mädchen ubertragen, was Ursache fureinen späteren Gebärmutterhalskrebs derPartnerin sein kann. Die HPV-Impfung vonJungen wurde das Risiko einer Übertragungdes Virus auf ihre Sexualpartnerin minimie-ren.
Mädchen können sich zwar durch eineHPV-Impfung selber schutzen, aber bishermachen nur 45 Prozent der 12- bis 17-jäh-rigen Mädchen, so die Daten der KV Impf-surveillance am RKI von 2014, Gebrauchdavon. Das ist nicht zu verstehen, denn die
Impfung von Mädchen im Alter von 9 bis14 Jahren wird von den Kassen ubernom-men, dies gilt auch fur die Nachholimpfungbis 17 Jahre. Wir brauchen eine bessereAufklärung fur Eltern, Jugendliche undÄrzte, darin waren sich die Teilnehmerin-nen des Frauen-Netzwerkes zum Schutzgegen HPV-Erkrankungen bei ihrem achtenTreffen in Berlin einig. Länder mit Schul-impfprogrammen und zentralen Einladungs-verfahren, wie z. B. Großbritannien, errei-chen wesentlich höhere Impfquoten.
Die Jungenimpfung ist in den USA, Ka-nada und Australien längst empfohlen undeingefuhrt. Auch europäische Länder habenbereits nachgezogen, wie z. B. Österreich,Schweiz, Schweden, Norwegen und Bel-gien.
„Die Einfuhrung der HPV-Jungenimpfungin Deutschland ist längst uberfällig“, so die
Frauennetzwerk zum Schutz vor HPV-Erkrankungen trifft sich zum achten Mal in BerlinVon Patricia Aden
Konsens_2017_final.qxp_Konsens 21.12.17 08:38 Seite 58
FORUM
KONSENS 2017 59
Koordinatorin des Netzwerkes, Dr. PatriciaAden.
Bei der Jungenimpfung geht es nicht nurum den indirekten Schutz von Mädchen.Jungen können auch selbst an HPV-Infek-tionen erkranken, z. B. an den unangeneh-men und schwer behandelbaren Feigwar-zen sowie an bösartigen Tumoren des Penis
und des Darmausgangs. Deshalb muss Jun-gen der gleiche Schutz vor einer HPV-In-fektion angeboten werden wie Mädchen.
Dr. Patricia Aden ist Ärztin und Vorsitzende des DAB
■
Am 25.03.2017 fand in Göttingen imRahmen der Internationalen Tagung
der Deutschen NeurowissenschaftlichenGesellschaft ein Symposium mit dem Titel„Transport Mechanisms at the Blood-BrainBarrier“ statt. Der DAB hat das Symposium,das von seinem Mitglied PD Dr. P. Henrich-Noack organisiert wurde, unterstützt undso zum großen Gelingen beigetragen. Spre-cherInnen aus Berlin, Heidelberg, Magde-burg und Moskau konnten so die neuestenEntwicklungen auf ihrem Forschungsgebietvorstellen. Der Erfolg der Veranstaltung, zuder sich am letzten Konferenztag zahlreicheForscher eingefunden hatten, wurde auchdurch die regen Diskussionen mit dem Au-ditorium begründet, was alle aktiv Betei-ligten ermunterte, ein solches Meeting inZukunft regelmäßig zu organisieren.
Eine Barriere zum Schutz des Gehirns
Die Blut-Hirn-Schranke bezeichnet einespezielle Barriere-Funktion, die die Blutge-fäße im Gehirn auszeichnet. WährendNährstoffe und auch Arzneistoffe in anderenOrganen des Körpers durch Lücken zwi-schen den einzelnen Endothelzellen, diedie Gefäße bilden, in das Gewebe gelangenkönnen, ist der Übergang in das Gehirn -parenchym nur für sehr wenige kleine und
lipophile Stoffe möglich (z.B. Ethanol). Vieleder essentiellen Stoffe gelangen nur überspezifische Transportmechanismen in dasGehirngewebe. Dieses Blut-Hirn-Schran-kensystem ist prinzipiell eine notwendigeVoraussetzung zum Schutz unseres äußerstempfindlichen Denkorgans: Die Arbeit derNeurone und deren Überleben wären ge-fährdet, wenn Botenstoffe, Abfallprodukteoder Toxine aus der Peripherie des Körperszu ihnen vordringen würden. Allerdingshat diese eigentlich geniale Erfindung derNatur auch einen Nachteil: Im Falle vonKrankheiten und Verletzungen, die das Ge-hirn betreffen, bleiben die meisten poten-ziellen Pharmaka genauso außen vor.
Polymernanopartikel bahnenden Weg für Medikamente
Dem internationalen Publikum im gut be-setzten Hörsaal der Georg-August-Univer-sität Göttingen wurde in den Vorträgen vonProf. Gert Fricker (Universität Heidelberg),Dr. Svetlana Gelperina (Drug Technologies,Moskau) und der Doktorandin Qing You(Universität Magdeburg) Forschungsergeb-nisse im Bereich der nano partikulärenTrägersysteme für die Blut- Hirn-Schran-kenpassage vorgestellt. Nach Darstellungder Mechanismen, die der Behinderungdes Stofftransportes an der Blut-Hirn-Schran-
ke zugrunde liegen und andererseits auchder vorhandenen Möglichkeiten zur Über-windung, erläuterte Prof. Fricker, wie ab-baubare Polymernanopartikel durch geziel-tes Design ihrer Oberfläche als Art „Troja-nisches Pferd“ mit Arzneimitteln beladenin das Gehirngewebe vordringen können.
Die Arbeiten von Dr. Gelperina folgeneinem ähnlichen Ansatz, aber hier schonmit dem klaren Ziel, Patienten zu helfen.Sie berichtete von Phase I klinischen Stu-dien, in denen von ihr entwickelte Nano -partikel mit inkorporierten Krebstherapeu-tika getestet werden. Die vorläufigen Er-gebnisse zeichnen ein optimistisches Bild.
Dennoch gibt es in der Wissenschaftimmer Raum für Verbesserungen und sozeigte die Doktorandin Qing You erste Er-gebnisse zu modifizierten Nanopartikeln,wobei die Ergebnisse Teil einer Kooperationzwischen der Universität Magdeburg unddem Institut in Moskau sind.
Veränderungen der Durchlässigkeit unter patho-logischen Bedingungen
Ein weiterer wichtiger Punkt im Bereichder Blut-Hirn-Schrankenforschung ist dieFrage nach den Veränderungen der Gefäßeunter pathologischen Bedingungen. Hierkonnte Prof. Ingolf Blasig (Leibniz Institut
Die Wissenschaft einer ganz besonderen Barriere1
Von Petra Henrich-Noack
Konsens_2017_final.qxp_Konsens 21.12.17 08:38 Seite 59
FORUM
60 KONSENS 2017
für Molekulare Pharmakologie, Berlin) dieentscheidende Rolle der Moleküle (Clau-dine) darstellen, die für die Undurchlässig-keit der Endothelzwischenräume von zen-traler Bedeutung sind. Allerdings agierendie Claudin-Proteine unter pathologischenBedingungen, z.B. beim Schlaganfall, alszweischneidiges Schwert, da sie zwar wei-terhin das Gehirn vor Eindringlingen be-wahren können, aber auch Vorgänge zurEntlastung von gestressten Gehirnzellenbehindern.
In einem zweiten Doktorandenvortrag,gehalten von Sophie Dithmer (auch LeibnizInstitut, Berlin), wurden erste Umsetzungender Claudin-Forschung dargestellt, welcheauch in die Richtung Arzneimitteltransportzielen: Synthetische Peptide, die den Clau-
dins nachgeahmt wurden, können zur Ver-besserung der Blut-Hirn-Schrankenpassagevon Pharmaka eingesetzt werden.
Grundsätzliches zur Blut-Hirn-Schran-kenfunktion unter pathologischen Bedin-gungen präsentierte zum Schluss noch Dr.Anne Mahringer (Universität Heidelberg).Hier wurde dem Auditorium noch ein ganzanderer Ansatz vorgestellt: Nicht nur kanndie Blut-Hirn-Schranke durch Erkrankungenund Schäden des Zentralnervensystems be-einträchtigt werden, umgekehrt kann aucheine Dysfunktion dieser spezifischen Ge-fäßbarriere ursächlich für pathophysiologi-sche Veränderungen im Gehirn sein.
Zusammenfassend ermöglichte das Sym-posium einen wissenschaftlichen Austauschauf höchstem Niveau, wobei Grundlagen-
forschung als auch angewandte Aspekteberücksichtigt wurden und die für die For-schung essentiellen Brücken zwischen Wis-senschaftlern und ihren Ideen gebaut wur-den. Auch so werden erfolgreich Barrierenüberwunden.
Autorin: Privatdozentin Dr. Petra Henrich-Noack ist wissenschaftliche Mitarbeiterinam Institut für Medizinische Psychologieder Medizinischen Fakultät der Otto-von-Guericke Universität Magdeburg und Mit-glied des DAB
1 Forschungsergebnisse zur Blut-Hirn-Schranke, vor-gestellt auf der Tagung der NeurowissenschaftlichenGesellschaft in Göttingen
■
Rolle der Märkte im Wirtschaftssystem
Märkte spielen in unserem Wirtschafts -system eine zentrale Rolle. Doch durch dieFinanzkrise sind die Märkte in Verruf gera-ten. Ihr „freies Spiel" wird verantwortlichgemacht für die schweren Verwerfungen,welche die Welt in die größte Krise seit derWirtschaftskrise in den 1930er-Jahren stürz-ten. Das zunehmende Misstrauen gegen-über Märkten beschränkt sich aber nichtauf den Finanzmarkt. Auch andernorts wirdzunehmend in Frage gestellt, dass Markt-prozesse zu guten Ergebnissen führen …
In dieser Rede möchte ich unter anderemam Beispiel der Finanzmärkte illustrieren,dass nicht wünschenswerte Ergebnisse wiedie globale Finanzkrise meist nicht alleinauf ein Versagen der Märkte zurückgeführtwerden können. Häufig ist es eine Kombi-
nation von Markt- und Staatsversagen, daskrisenhafte Zuspitzungen erklärt …
Die wesentliche Antwort auf die Krisewar eine deutlich verschärfte Regulierung.So wurden auf globaler, europäischer undnationaler Ebene unzählige neue Regelwer-ke geschaffen, die vor allem deutlich erhöh-te Eigenkapital- und Liquiditätsanforderun-gen für Banken vorsahen. Auf der europäi-schen Ebene wurde eine makroprudenzielleAufsicht geschaffen, die der ErkenntnisRechnung trug, dass es nicht ausreichendist, wenn die Regulierung allein das Einzel-institut betrachtet. Stattdessen muss dieStabilität des gesamten Finanzsystems inden Fokus gerückt werden. Der wichtigsteSchritt war die Begründung der Europäi-schen Bankenunion, die die Aufsicht fürgrößere Banken im Rahmen des Einheitli-chen Aufsichtsmechanismus auf die euro-päische Ebene verschob und mit dem Ein-
heitlichen Abwicklungsmechanismus erst-malig ein spezielles Regime zur Abwicklungvon Banken schuf ….
Niemand – nicht einmal die Banken selbst– würde bestreiten, dass die Erfahrungenaus der schweren Finanzkrise eine strengereRegulierung des Finanzsektors notwendigmachten. Die entscheidende Frage ist je-doch, wie dies genau erfolgen sollte. Falschwäre es, die Krise blind mit einer Einschrän-kung von Marktmechanismen zu beant-worten. Denn so wie niemand ein Markt-versagen in der Finanzkrise bestreiten kann,so kann kein Zweifel daran bestehen, dassein Staatsversagen hinzutrat, das die Krisemitverursacht und verschärft hat …
In Ländern wie Deutschland kam eineenge Verflechtung des Bankensektors mitdem Staat über die öffentliche Eigentümer-schaft bei Landesbanken und Sparkassenhinzu ….
Wirtschaftspolitischer Club Deutschland verleiht erstmals Preis an eine Wissenschaftlerin:
Können wir Märkten noch vertrauen?Auszug aus dem Vortrag der Preisträgerin Prof. Dr. Isabel Schnabelanlässlich der Preisverleihung zur Schriftenreihe „Impulsrede zur SozialenMarktwirtschaft“
Konsens_2017_final.qxp_Konsens 21.12.17 08:38 Seite 60
FORUM
KONSENS 2017 61
Die staatliche Regulierung förderte auchdie Investition von Banken in heimischeStaatsanleihen. Denn diese werden in derRegulierung privilegiert behandelt und müs-sen bis zum heutigen Tage nicht mit Eigen-kapital unterlegt werden. Über impliziteRettungsgarantien und hohe Investitionender Banken in Staatsanleihen entstand einTeufelskreis zwischen Banken und Staaten,der wesentlich zur Schärfe der Krise im Eu-roraum beitrug. Die teuren Bankenrettun-gen gefährdeten die Solvenz der Staaten,und die zweifelhafte Solvenz einiger Staatengefährdete die Solvenz der Banken.
Aus der Finanzkrise lernen
Daher wäre es falsch, aus der Erfahrung derFinanzkrise zu schließen, dass man sich inZukunft generell stärker auf staatliche Ein-griffe verlassen sollte. Vielmehr geht esdarum, die Funktionsfähigkeit der Märktewiederherzustellen. Ein wesentliches Zielder Nachkrisenregulierung besteht daherdarin, die „Marktdisziplin" zu stärken. EineBank, die zu groß ist zum Scheitern, zahltkeine marktgerechten Risikoprämien, wasihre Risikobereitschaft noch erhöht. EinStaat im Euroraum, der damit rechnenkann, dass er zur Not von anderen Mit-gliedsstaaten gerettet wird, kann sich güns-tiger finanzieren, was seine Konsolidierungs-bereitschaft senkt. In beiden Fällen geht esdarum, die Marktmechanismen wieder inKraft zu setzen: im Falle der Banken durchdie Schaffung von Mechanismen, mit denensie ohne Auslösung einer systemischen Kriseabgewickelt werden können; im Falle derStaaten durch die Einführung eines Mecha-nismus zur Restrukturierung von Staats-schulden, ohne dass hierdurch wie damalsin Griechenland gleich die Stabilität des ge-samten Euroraums in Zweifel gezogen wird.
Steuerung über Marktpreiseund die angemessene Balance wahren
In beiden Fällen ist das Ziel, das Verhaltender Akteure über Marktpreise zu steuern
und nicht über direkte staatliche Eingriffe.Es geht also nicht darum, Märkte durchstaatliche Aktivitäten zu ersetzen, sonderndie Allokationsfunktion des Marktes wie-derherzustellen.
Der starke Preisanstieg hat nicht zuletztdamit zu tun, dass immer mehr Menschenin die Städte drängen, das Angebot anWohnraum aber gerade in Ballungsräumennicht mit der gestiegenen Nachfrage schritt-gehalten hat. Hierbei spielen auch die deut-lich gestiegenen Baukosten aufgrund immerschärferer Auflagen, beispielsweise zurEnergieeffizienz, eine wichtige Rolle …
Die logische Schlussfolgerung hierauswäre, das Angebot an Wohnraum zu stär-ken, beispielsweise durch die Ausweisungzusätzlichen Baulands oder eine punktuelleAbmilderung von Auflagen …
Ist eine Ausweitung des Angebots kurz-fristig nicht möglich, so ist es allemal besser,den sozial Schwächeren durch die Zahlungeines Wohngelds die Teilnahme am Marktzu ermöglichen, als den Marktprozess außerKraft zu setzen.
Auch der Mindestlohn stellt einen direk-ten Eingriff in Marktprozesse dar …
Es besteht allerdings die Sorge, dass Per-sonen, deren Produktivität nicht ausreicht,um den Mindestlohn zu erwirtschaften,aus dem Arbeitsmarkt ausgeschlossen wer-den könnten, wenn die Löhne sich nichtan die Marktgegebenheiten anpassen kön-nen. Eine Studie des Instituts für Arbeits-markt- und Berufsforschung (IAB) weist da-rauf hin, dass aufgrund des Mindestlohnsweniger neue Jobs entstanden sind. Diesbetrifft vor allem Stellen im Niedriglohnbe-reich und ist gerade angesichts der Flücht-lingsmigration von großer Bedeutung …
Schließlich sollte auch nicht übersehenwerden, dass ein Mindestlohn bestimmteGüter und Dienstleistungen verteuert, wasdie positiven Verteilungswirkungen kon-terkarieren kann, wie eine wissenschaftlicheStudie für die USA belegt …
Während verteilungspolitisch motiviertedirekte Eingriffe in Marktprozesse von vie-len Ökonomen kritisch gesehen werden,gehören Eingriffe aus Allokationsgründen
zum Standardrepertoire. Über Steuern oderSubventionen können Ressourcen in be-stimmte Verwendungen gelenkt werden.Wünschenswerte Aktivitäten können soverbilligt oder nicht wünschenswerte ver-teuert werden. Die Umweltpolitik ist einklassischer Bereich, in dem das Vorliegenvon Externalitäten in Form von Umwelt-schäden solche staatlichen Eingriffe recht-fertigt. Doch auch hier stellt sich die Frage,wie sich das wichtige Ziel der Erhaltungder Umwelt am besten erreichen lässt …
Eine technologiespezifische Steuerungläuft hingegen Gefahr, dass die „falschen",das heißt relativ ineffiziente, Technologiengefördert werden, was die Kosten der Ener-giewende unnötig erhöht. Dies kann auchaus verteilungspolitischen Gründen wenigwünschenswert sein. Gleichzeitig werdendie Anreize zur Entdeckung alternativerTechnologien gedämpft. Die Energiewendesollte daher stärker auf Marktprozesse set-zen, um die Umweltziele auf volkswirt-schaftlich effiziente Weise zu erzielen.Gleichzeitig müssen aus Umweltsicht un-gerechtfertigte Begünstigungen, wie diejahrelang besondere niedrige Besteuerungvon Diesel, aufgehoben werden.
Fazit: Den Märkten vertrauen, aber nicht blind
Können wir Märkten noch vertrauen? DieFinanzkrise hat deutlich vor Augen geführt,dass Märkte eklatant versagen können. Tat-sächlich sind alle Märkte in irgendeinerForm durch Marktversagen gekennzeich-net, wenn auch auf unterschiedliche Weiseund in unterschiedlichem Maße. Daherstellt sich nicht die Frage, ob Märkte regu-liert werden müssen, sondern nur in wel-cher Weise dies geschehen sollte. In vielenFällen reicht es, grundlegende Rahmenbe-dingungen zu setzen. In anderen, wie inden Finanzmärkten oder bei den Netzin-dustrien, sind umfangreiche Regulierungenunerlässlich.Die Finanzkrise hat aber auch gezeigt, dassstaatliche Eingriffe das Marktversagen ver-stärken können, wenn sie Marktmechanis-
Konsens_2017_final.qxp_Konsens 21.12.17 08:38 Seite 61
FORUM
62 KONSENS 2017
men an den falschen Stellen außer Kraft set-zen. Die wirtschaftspolitische Herausforde-rung besteht daher darin, in jedem konkre-ten Anwendungsfall eine angemessene Ba-lance zu finden zwischen der nötigen Kor-rektur von Marktversagen durch staatlicheEingriffe und der Nutzung von Marktpro-zessen zum Wohle der Volkswirtschaft. Beidieser Abwägung sind nicht nur die Kostendes Marktversagens, sondern auch diejeni-gen der staatlichen Eingriffe angemessen zuberücksichtigen. Und es gilt zu erkennen,in welchen Bereichen Märkte keine geeig-neten Allokationsmechanismen darstellen.Doch selbst in wohlregulierten Märktenkönnen Fehlentwicklungen nicht vollständigausgeschlossen werden. Daher sollten wirden Märkten nie blind vertrauen.
Die Preisträgerin Isabel Schnabel (9. August 1971) ist Wirt-schaftswissenschaftlerin, Professorin für Fi-nanzmarktökonomie an der RheinischenFriedrich-Wilhelms-Universität in Bonn undseit Juni 2014 Mitglied im Sachverständi-genrat zur Begutachtung der gesamtwirt-
schaftlichen Entwicklung („Wirtschaftswei-se“). Ihre Forschungsgebiete sind Finanz-krisen, Wirtschaftsgeschichte und das Ban-kenwesen.
Auslandsaufenthalte an der Sorbonne,und der University of California, Berkeley.1998 schloss sie als Jahrgangsbeste mit demDiplom ab. Nach der Dissertation (Macro -economic Risks and Financial Crises – AHistorical Perspective), arbeitete sie amLehrstuhl von Martin Hellwig, an der Har-vard University sowie am Max-Planck-In-stitut zur Erforschung von Gemeinschafts-gütern in Bonn.
Sie ist Research Affiliate am Max-Planck-Institut zur Erforschung von Gemeinschafts-gütern in Bonn sowie Research Fellow amCentre for Economic Policy Research inLondon.
Im April 2014 wurde Schnabel vom Bun-deskabinett für den Sachverständigenrat zurBegutachtung der gesamtwirtschaftlichenEntwicklung vorgeschlagen. Am 26. Juni2014 wurde sie als Mitglied des Rates biszum 28. Februar 2017 berufen.
Der Wirtschaftspolitische Club Deutschlande. V. lobt seit 2010 den Preis für eine Im-pulsrede zur sozialen Marktwirtschaft aus.Erstmalich erhält eine Wissenschaftlerin die-sen Preis (27. September 2017)
Prof. Dr. Isabel Schnabel vom Institut fürFinanzmarktökonomie und Statistik der Uni-versität Bonn hat von Bundeswirtschafts-ministerin Brigitte Zypries zudem ihre Be-rufungsurkunde als Mitglied des Sachver-ständigenrates erhalten. Die neue Amtszeitläuft bis Februar 2022.
■
v.l.n.r.: Laudatorin Brigitte Zypries (Bundeswirt-schaftsministerin), Preisträgerin Prof. Dr. IsabelSchnabel (Uni Bonn), Dr. Patricia Solaro Präsiden-tin WPCD), MP a.D. Dieter Althaus (Vize-PräsidentWPCD) Copyright Stefan Zeitz
Die Energiewende ist ein Friedensprojekt1
Von Claudia Kemfert
2017 ist ein wichtiges Jahr für dasKlima. Es ist ein Jahr der Entscheidun-
gen, für die amerikanische Klimapolitik, fürFrankreich, für den deutschen Bundestag,für uns alle. Wenn Europa zerfällt und derPopulismus um sich greift, wenn die fal-schen politischen Mächte das Rad in dieverkehrte Richtung drehen und wir demfossilen Kapitalismus freie Hand lassen, istdie Energiewende in großer Gefahr. Undmit ihr nicht nur die Weltwirtschaft, son-dern auch, so pathetisch das klingt, derWeltfrieden.
Die Energiewende macht unabhängig von geopolitischen Konflikten
Alles schien auf einem guten Weg. Die Ener-giewende schafft Wohlstand, macht un -abhängig von geopolitischen Konflikten,schützt das Klima und stärkt die Demokra-tie. Und sie ist erfolgreich. Zu erfolgreich.Die Energiewende führt zu einer dauerhaftnachhaltigen Energieversorgung. Dies senktdie Importabhängigkeit fossiler Energienund trägt zum Klimaschutz bei. Somit istdie Energiewende in Deutschland nicht nurein Mittel zur Verbesserung der wirtschaft-lichen Stärke, sondern auch zur Krisenprä-vention.
Durch den Umstieg auf erneuerbare Ener-gien wird die dezentrale Energieversorgunggestärkt, gleichzeitig erhöht sich der Anteilvon Bürgern in Energiewende-Projekten,
es ist eine Bürger-Energiewende. Dies stärktdie Demokratie. Zugleich bedeutet sie eineAbkehr von fossilen Energien, und machtsomit unabhängiger von geopolitischen Kon-flikten.
Auch in Ländern mit großen Konflikten inNordafrika oder im arabischen Raum kanndie Energiewende ein Friedensprojekt sein,da Solar- und Windenergie auch dort „um-sonst“ zur Verfügung stehen. Zudem führteine konsequente globale Energiewendezu einer Verminderung des Klimawandels.Mit einer Energiewende wird global dieDemokratie gestärkt, der Klimawandel auf-gehalten und so geopolitische Konflikte ver-mindert. Die Energiewende schafft nicht
Konsens_2017_final.qxp_Konsens 21.12.17 08:38 Seite 62
FORUM
KONSENS 2017 63
nur enorme wirtschaftliche Chancen, sieist auch ein Friedensprojekt.
Frontalangriff der Klimaskeptiker
Die „alten“ Energien und die Klimaskepti-ker gehen nicht kampflos vom Platz. An-stelle von Rückzugsgefechten schalten sieauf Frontalangriff. Sie nutzen keine Armee,sondern Propaganda und „Fake News“. Mitbislang unbekannter Aggressivität werdenBehauptungen, Mythen und Fehlinforma-tionen vorgetragen.
Doch welchen Einfluss werden die Ent-wicklungen in den USA auf den Rest derWelt haben? Wird es angesichts der ame-rikanischen Abkehr vom Klimaschutz auchin Deutschland eine umweltpolitischeKehrtwende geben? Oder werden wir inder deutschen Klimapolitik einen „Jetzt erstrecht!“-Ruck erleben?
Die Antwort fällt beunruhigend aus: Nachder dritten Legislaturperiode unserer eins-tigen „Klima-Kanzlerin“ sieht es im Bun-destagswahljahr 2017 eher düster aus inSachen Klimaschutz und Energiewende.Wenig überraschend zeigt sich die umstrit-tene AfD wenig zukunftsgewandt. Laut -stark wirbt die Partei damit, die Energie-wende stoppen und den Atomausstieg rück-gängig machen zu wollen. Und sie scheutsich nicht, den Klimawandel samt Erder-wärmung für Propaganda zu erklären.Trump macht Schule.
Halbherziger Klimaschutzführt zu Fehlinvestitionen
Doch der energiepolitische Rollback in Ber-lin startete schon lange vor der US-Wahl:Ein weichgespülter Klimaschutzmaßnah-menplan ohne konkrete Ziele, ohne kon-kretes Datum für einen Kohleausstieg warder Anfang. Die Folge: fatale Fehlinvesti-tionen und Verzögerungen in Sachen Kli-maschutz und Technologiefortschritt, dienicht mehr aufzuholen sind. So hat die Po-litik den längst beschlossenen Kohleausstiegverfehlt, das Erneuerbare-Energien-Gesetz
zu Tode novelliert und es versäumt, attrak-tive und verlässliche Regelungen für dieneue Wirtschaftswelt zu schaffen. Verhal-tensänderungen brauchen finanzielle An-reize, das gilt für Konsumenten wie für Un-ternehmen. Durch die Privatisierung undden Ausbau der Erneuerbaren Energien istder Energiemarkt zwar mehr als deutlichim Wandel begriffen, doch die grundlegen-den Strukturen haben sich bislang nichtwesentlich verändert. Noch immer gilt:Wer die Netze hat, hat die Macht.Dass wir im Rest der Welt auch weiterhinals Klimapioniere gelten, liegt daran, dasswir im internationalen Vergleich trotz allemsehr gut dastehen – unter den blinden Kli-marettern ist der Einäugige König. Miteinem winzigen Königreich allerdings, dasdarf nicht vergessen werden. Trotzdem:Wenn Deutschland nicht nur schmuckeKlimaziele formuliert, sondern auch tat-kräftig und entschlossen konkrete Maßnah-men ergreift, um diese Ziele zu erreichen,dann kann das im Weltmaßstab kleine Landin seiner Vorbildfunktion große Wirkunghaben. Nicht zuletzt als Friedensstifter.Denn die meisten aktuellen Kriege sindschon heute Konflikte um mangelnde Res-sourcen – Energie ist eine der wichtigstenRessourcen für die Wirtschaft aller Staaten.Wer hier innovative Ideen und zukunfts-weisende Impulse liefert, kann so manchenKonflikt aus der Welt schaffen. Wer sichnicht um Ölquellen streiten muss, weil So-larzellen auf den Häuserdächern die regio-nale Wirtschaft beflügeln, findet vielleichtauch friedliche Wege für ein fruchtbares so-ziales Mit einander.
Die deutsche Wirtschaft profitiert von der Energie-wendeErneuerbare Energien sind nicht nur Motorfür den wirtschaftlichen Aufschwung an-derer Länder, sondern auch eine wertvolleAntriebskraft für die deutsche Wirtschaft.Das Land der Erfinder und Ingenieure könn-te auf diese Weise Energie und Frieden inder Welt verbreiten.
Unerwartet befinden wir uns mitten imKrieg der Energiewelten. Besonders sichtbarin den USA. Doch auch in Deutschland undEuropa ist nicht alles rosig. Das fossile Im-perium schlägt zurück. Auch hierzulande.Es ist höchste Zeit zur Gegenwehr.
Wir alle sind aufgerufen, dem wiedersalonfähig gewordenen Populismus mitsachlichen Argumenten entgegenzutreten.Aus dem Kampf um Strom ist längst einKrieg um Energie geworden: Es geht umnicht weniger als um alles. Wir sollten unsvon den Ablenkungsmanövern der fossilenEnergiewelt nicht irritieren lassen.
Konsequente Investitionenin die Energiewelt der Zukunft
Meinungsfreiheit heißt auch, dass es in einerdemokratischen Gesellschaft nicht die eine,die absolute Wahrheit gibt, sondern wider-streitende Positionen, die um einen Konsensringen. Bislang waren Fakten die gemein-same Ausgangsposition für eine konstruk-tive Auseinandersetzung mit den Argumen-ten der Gegenseite. Wissenschaftliche Be-lege bildeten die Basis für eine kontroverseDiskussion. Daran haben wir uns orientiert,politische Entscheidungen dadurch begrün-det, uns auf dieser Grundlage eine eigeneMeinung gebildet und unsere Position daranfestgemacht.
Die Auseinandersetzung mit Fake Newsund Falschmeldungen ist nicht mit einerdemokratischen Debatte zu verwechseln.Wir sollten also nicht allzu viel Energiedamit verschwenden, immer wieder aufdie Ablenkungsmanöver der alten Energie-welt hereinzufallen. Wenn wir uns ständigvon all den Fehlinformationen und verdreh-ten Tatsachen aufhalten lassen, verschwen-den wir wertvolle Zeit.
Wer den Klimawandel leugnet, wird nichtüber Klimaschutz sprechen. Wer den Hand-lungsbedarf leugnet, wird nicht über dieZiele, Methoden und Maßnahmen einerEnergiewende verhandeln. Und wer sichablenken lässt, übersieht womöglich dasOffensichtliche: Gesetzesnovellen, die die
Konsens_2017_final.qxp_Konsens 21.12.17 08:38 Seite 63
FORUM
64 KONSENS 2017
Energiewende noch weiter hinauszögern,Steuergeschenke für die Kohleindustrie,Laufzeitverlängerungen für Atomkraftwer-ke. Oder sogar gefährliche geopolitischeKonflikte im Schatten der Gespenster -debatten.
Wir brauchen dringend eine Rückbe -sinnung auf die vernünftigen Argumenteeiner konsequenten Energiewende. Werdie Ablenkungsmanöver der fossilen Ener-giewirtschaft durchschaut, wer die Dinge
hinterfragt und sich informiert, wird einegut begründete Meinung vertreten können.Wer sich der Konsequenzen des eigenenTuns und Nichtstuns bewusst wird, wirdpolitisch aktiv werden und sich engagierenkönnen.
Unser aller Engagement ist dringendnötig: Wir sollten der globalen Verunsiche-rung nicht mit einem Rollback entgegen-treten. Anstatt den Problemen von heutemit Antworten von gestern zu begegnen,
wäre es sehr viel klüger, sich nicht beirrenzu lassen und konsequent in die Energie-welt der Zukunft zu investieren. Autorin: Prof. Dr. Claudia Kemfert ist Lei-terin der Abteilung Energie, Verkehr undUmwelt am Deutschen Institut für Wirt-schaftsforschung, Professorin für Energie-ökonomie und Mitglied des DAB.
1 Auszug aus: Das fossile Imperium schlägt zurückhttp://www.murmann-verlag.de/das-fossile-imperium-schlaegt-zurueck.html
■
Ein Jahr Center for the History of WomenPhilosophers and Scientists (HWPS)Von Nikolaus Corall und Julia Lerius
Erst ein knappes Jahr ist seit der feierlichen Eröffnung des Centers für die Geschichte der Frauen in der Philosophieund den Wissenschaften vergangen, in dem die Errungenschaften innerhalb eines Gesamtprojekts aufbereitetwerden. Wurden bereits im Vorfeld im Rahmen eines Lehr- und Forschungsbereichs die Inhalte von Philosophinnenund Wissenschaftlerinnen vermittelt, entwickelt sich das frisch etablierte Center zu einem Strahlungsphänomenund Gravitationszentrum internationaler Forschung.
Am 24. Oktober 2016 öffnete das Cen-ter for the History of Women Philoso-
phers and Scientists (HWPS) feierlich seineTüren für die Öffentlichkeit. Mit der Beglei -tung von Kultur- und Wissenschaftsminis-terin Svenja Schulze,Wegbegleiter_innenaus der Türkei, den USA und Prof. Dr. Eli-sabeth de Sotelo vom DAB startete das vonDirektorin Prof. Dr. Ruth Hagengruber lang-fristig erarbeitete Konzept des CentersHWPS unter Glückwünschen und mit gro-ßen Hoffnungen als vom Ministerium fürWissenschaft und Kultur Nordrhein-West-falen gefördertes Projekt.
Geschichte von Philoso-phinnen und Wissenschaft-lerinnen – bisher in der Forschung unterrepräsentiertSeit der Eröffnung arbeiten sechs For -scher_innen zu den ForschungsgebietenEmilie Du Châtelet, Maria Gaetana Agnesi,
Hildegard von Bingen, Hannah Arendt undden frühen Phänomenologinnen. Im Rah-men von Promotions- oder PostDoc-Stellenhaben sie die Möglichkeit, diese – an an-deren philosophischen Instituten unter -repräsentierten – Inhalte von Frauen derPhilosophie- und Wissenschaftsgeschichteumfassend zu erforschen, zu diskutierenund zu präsentieren. Dem fruchtbaren Aus-tausch innerhalb des Centers entspringenLehrveranstaltungen, Vortragsreihen, Kon-ferenzen und sowohl jährlich stattfindendeSummer und Autumn Schools, jeweils mitstarker internationaler Beteiligung und Re-sonanz. Erste Schritte für den Aufbau einerOnline-Plattform und eines Literaturarchivswurden geleistet sowie mit der Fertigstel-lung einer Homepage „hwps.de“ die Mög-lichkeit eines Einblicks in die Tätigkeitendes Centers gewährt.
Gemeinsam mit der Société de Philoso-phie de Langue Francaise en Allemagne riefdas Center im April 2017 die Époque Émili-
enne aus und veranstaltete einen dreispra-chigen Kongress über die Werke und Re-zeption der Philosophin Emilie Du Châtelet.Neben den zahlreichen Plenarvorträgen in-ternationaler Wissenschaftler_innen wur-den parallele Panels gehalten, die ebenfallsdem stetig wachsenden Kreis der Nach-wuchswissenschaftler_innen in der Erfor-schung der Frauen in der Geschichte derPhilosophie entsprechenden Raum zur Vor-stellung ihrer Arbeiten gab.
Summer School zum Libori-Fest
Gekrönt wurde das erste Jahr von der ers-ten, internationalen Libori Summer School.Diese wurde zum Ausklang des Semestersund während der traditionellen Libori-Fes-tivitäten der Stadt Paderborn ausgetragen.Etwa 40 internationale Studierende wähltengemäß ihren Forschungsinteressen ein ent-sprechendes Programm aus vier parallelen
Konsens_2017_final.qxp_Konsens 21.12.17 08:38 Seite 64
FORUM
KONSENS 2012 65
intensiven Kursen zu Frauen in der Philo-sophie des Mittelalters und der Renaissance,der Philosophie Du Châtelets, der Frauenin der frühen phänomenologischen Bewe-gung und des neuen Forschungsbereichsder „Misandrie“ – des Männerhasses – il-lustriert anhand der Schriften von Helenevon Druskowitz. Eingerahmt durch Abend-veranstaltungen im Fachwerkambiente desDeelenhauses und begleitet von Abendvor-trägen der Professor_innen aus Tel-Aviv,Harvard und der Leitung des Centers, Prof.
Dr. Ruth Hagengruber, wurde die Veran-staltung zu einem vollen Erfolg sowohl fürdie beteiligten Lehrkräfte, wie auch für dielokalen und internationalen Studierenden. Obgleich die Errungenschaften des erstenCenterjahres die Erwartungen weit über-troffen haben, wird darauf hingearbeitet,dieses erste Jahr nur als einen ersten Schrittin der fortschreitenden Etablierung der For-schungsthemen, einer Forschungsdaten-bank und eines internationalen Netzwerkes,einer Online-Plattform und eines beständi-
gen internationalen Austausches, kurz,eines institutionalisierten Centers für dieGeschichte der Frauen in Philosophie undWissenschaft zu verstehen.
Niklas Corall ist wissenschaftlicher Mitar-beiter am Lehrstuhl von Prof. Dr. Ruth Ha-gengruber an der Universität Paderborn. Julia Lerius ist seit Mai 2017 Projekt- undWissenschaftskoordinatorin am CenterHistory of Women Philosophers and Scien-tists. ■
Verena Tochtermann: Ausblick auf die indigene Architektur MittelamerikasBericht über eine Auslandsforschung
Die Architektur und Kultur Mittelame-rikas wie die zahlreicher kolonialisier-
ter Länder sieht sich gegenwärtig mit einerstarken Identitätssuche konfrontiert. Heut-zutage dominieren in deren Architekturgrößtenteils Werte und gestalterische Um-setzungen, die sich an dem westlichenKunstverständnis orientieren. Innerhalbdieser engen Sichtweise existiert eine ak-zentuierte Gleichgültigkeit und Gering-schätzung der indigenen Kulturen.
Interkultureller Austauschals Basis für neueErkenntnisseZeitgenössische Architekten und KünstlerMittelamerikas entgegnen dieser Diskre-panz gegenwärtig mit der Suche nach einerlateinamerikanischen kulturellen Identitätund betonen die Bedeutung des histori-schen Hintergrundes für die Weiterentwick-lung von Kultur. Diese neue Akzentuierungdes Vergleichs von Kultur und Architekturin Lateinamerika ist dabei nicht nur für daslokale Verständnis besonders wichtig, son-dern eröffnet darüber hinaus auch neueChancen für die disziplinübergreifende Er-forschung des Zusammenhangs zwischen
einer Gesellschaft und ihrer Kultur sowieerweiternde und kontrastierende Sichtwei-sen auf andere Kulturen.
Auf die Wichtigkeit eines interkulturellenVergleichs verbunden mit dem Streben nacheinem eigenen Architekturverständnis La-teinamerikas wurde ich erstmals währendmeines einjährigen Auslandsaufenthaltesan der Universidad de Costa Rica (Escuelade Arquitectura) zwischen 2013 und 2014im Zuge des Masterstudiums der Architek-tur aufmerksam. Der Zusammenhang zwi-schen Kultur, Weltverständnis und derenÜbersetzung in der Architektur in einemfür mich neuen Kontext im Spannungsfeldmit der europäischen Architektur war fürmeine Analyse von besonderer Bedeutung.
Meine Masterarbeit1 über die indigeneArchitektur Costa Ricas ging daher denWurzeln der Architektur in Zentralamerikanach und konnte spannende Erkenntnisseaus dem Vergleich der indigenen Weltvor-stellung und dem Übersetzen dieser Ideenin der Architektur ziehen. Während einigeindigene Ethnien verschiedenste Typolo-gien, symbolische Ausdrücke und Materia-lien für unterschiedliche Bauaufgaben ver-wenden, nutzen andere Ethnien einenGrundtyp mit verschiedensten Abwand-
lungen für die Gesamtheit ihrer Bauten.Trotz der bautypologischen Unterschiedelassen sich in der Umsetzung von konzep-tuellen Ideen in der Architektur allerdingszahlreiche Übereinstimmungen herausstrei-chen. Die Darstellung des Zentrums oderder Wichtigkeit eines Gebäudes zum Bei-spiel kann je Kultur variieren und durcheine Mittelstutze, ein Seil, die Helligkeit,die dreidimensionale Gestaltung eines Ge-bäudes oder durch andere gestalterischeUmsetzungen artikuliert werden. An dieFragen zum Verhältnis von architektoni-schem Ausdruck und kultureller Umgebungwird in der Ausarbeitung meiner Disserta-tion uber die Architektur der UreinwohnerMittelamerikas angeknupft. Die ersten For-schungsreisen nach Costa Rica und Mexikowurden dabei durch das Mentoring-Projektdes DAB begleitet und unterstutzt.
Forschung in einer neuenkulturellen Umgebung
Eine Forschungsfrage in einem neuen kul-turellen Kontext zu bewältigen, stellt nichtnur besondere Herausforderungen, sondernbereichert und erweitert die eigene wissen-schaftliche Arbeit durch den Austausch von
Konsens_2017_final.qxp_Konsens 21.12.17 08:38 Seite 65
LITERATUR
66 KONSENS 2017
unterschiedlich angewandtem Wissen. Derinterdisziplinäre Inhalt und interkulturelleKontakt eröffnete mir die Möglichkeit, dasFeld meiner Forschungstätigkeit auszudeh-nen und die Forschungsfrage mit neuen An-sätzen zu verbinden.
Neben dem akademischen Austausch wardie bisherige wissenschaftliche Arbeit auchstark durch den Kontakt mit unterschied-lichsten Nichtregierungsinstitutionen undPrivatpersonen geprägt, da die Forschendenin diesem Thema oft außerhalb der akade-mischen Organisationen agieren. Fur dieUntersuchung der indigenen Architekturwar es deshalb besonders wichtig, die For-schung an konventionellen Institutionendurch interdisziplinären Austausch undzahlreiche Exkursionen zu indigenen Dör-fern zu ergänzen. Bewohner, Forscher undAnsprechpersonen aus anderen Disziplinenwurden interviewt, wie zum Beispiel auchaus dem Bereich des Menschenrechts. Daspersönliche Engagement der einzelnen Be-teiligten und Betroffenen an dem Themawurde mit dem Kontakt zu Forschern aus
anderen Bereichen, wie zum Beispiel Eth-nologen oder Soziologen vervollständigt.Der Zugang zu Archiven, Museen oderstaatlichen Einrichtungen wurde von loka-len Universitäten unterstutzt.
Ausblick auf die zukunftigeForschungsarbeit
Mit dem Hintergrund des dargestelltenStrebens nach einer lokalen Identität in derlateinamerikanischen Architektur, ersuchtmein Dissertationsvorhaben diesen Fin-dungsprozess mit der Analyse der indigenenArchitektur zu bereichern. Die verschiede-nen indigenen mittelamerikanischen Bau -kunste sollen dabei detailliert erforscht undmiteinander verglichen werden. Der wis-senschaftliche Austausch mit den verschie-denen Institutionen verfolgt dabei auch dasZiel, einen verstärkten Kontakt unter deneinzelnen Beteiligten und Organisationenselbst zu bilden und dadurch die Identitäts-suche und den interkulturellen Vergleichzu unterstutzen. Mit dieser Arbeit soll ge-
meinsam mit mittelamerikanischen For-schern und anderen Beteiligten eine Basisan wertvollem Wissen uber die traditionelleArchitektur Mittelamerikas erarbeitet wer-den, welche als Grundlage und Ausgangs-punkt fur eine zukunftige Entwicklung die-nen könnte.
VerfasserangabenVerena Tochtermann, Ph.D. Kandidatin inArchitektur, Msc TU Wien (2016), Master-arbeit: Die Architektur der UreinwohnerCosta Ricas. Eine Gegenüberstellung derindigenen Bauformen und deren Kontext.Seit 2015 Wissenschaftliche Mitarbeiterinam Institut für Entwurf, Universidad deCosta Rica, San José. Forschungsaufent-halte: Argentinien, Costa Rica u.Mexiko.
Verena Tochtermann, MscAll rights reserved1 Tochtermann, Verena, 2016: Die Architektur der Ur-
einwohner Costa Ricas. Eine Gegenuberstellung derindigenen Bauformen und deren Kontext, TU Wien(Masterarbeit)
■
28. April 2018:women & work in Frankfurt am Main
21. bis 23.09.2018:Tagung des DAB zum Thema „Kultureller Wandel“
in Berlin
Konsens_2017_final.qxp_Konsens 21.12.17 08:38 Seite 66
LITERATUR
KONSENS 2017 67
Eigentlich sagt der Titel schon alles: DerIslamismus drückt sich in Symbolen
wie der Verschleierung von Frauen aus. DieSignale eines patriarchalischen und repres-siven Systems werden von uns nicht ver-
standen und deshalb verharmlost. Das is-lamische Gesellschaftssystem wird nichtnur von Männern getragen, sondern auchund in besonderem Maße von Frauen.Denn als Mütter können sie in der Familie
die Weichen stellen, wählen aber leidermeistens nicht den Weg der Freiheit, son-dern die Richtung, die die Tochter in die-selbe Unfreiheit und Gewalterfahrung führt,die sie selbst erleben. Und schließlich: Die
Zana Ramadani
Die verschleierte Gefahr: Die Macht der muslimischen Mütter und der Toleranzwahn der DeutschenEuropa Verlag, Berlin, 2017, 262 S., ISBN 978-3-95890-077-6, Gebunden 18,90 €
Rezension von Patricia Aden
Martina Haas ist Expertin für Networ-king und ein gefragter Speaker. Nach
ihrem Vortrag „Die Löwen-Strategie – WieSie in 4 Stunden mehr erreichen als andeream ganzen Tag“ beim DAB Berlin fasst dieerfolgreiche Autorin für KONSENS die Es-senz ihres neuen Buches zusammen:
„Löwen stehen für Mut und Stärke. Dochnur wenige wissen: • Löwen leben als einzige Großkatzen im
Rudel. Das macht diese großartigen Team-player und souveränen Leader zu einerInnovation im Rahmen der Evolution.
• Löwen sind nur 4 Stunden pro Tag aktiv,20 Stunden ruhen sie. Sie sind jedochkeineswegs faul: Wer in nur 4 Stundensein Tagwerk geregelt bekommt, hat einegeniale Strategie. Die Löwen-Strategie vermittelt, mit mehr
Fokus das Richtige mit den richtigen Mittelnzu tun, möglichst mit vollem Einsatz zumrichtigen Zeitpunkt. Effektivität und Effi-zienz sorgen für bessere und schnellere Er-gebnisse und Freiraum für neue Ideen, Auf-
gaben oder die schönen Dinge des Lebens.Die Löwen-Strategie setzt auf den strategi-schen Einsatz und das Zusammenspiel gro-ßer Erfolgshebel:− Kommunikations- und Selbstvermark-
tungskompetenzProfessionelles Auftreten und gute Selbst-vermarktung basieren auf versierter Kom-munikation als roten Faden durch alleKompetenzfelder. Unzureichende Kom-munikation führt zu Fehlern, Verzöge-rungen, Doppelarbeit und Frust. Das kos-tet die Wirtschaft Milliarden.
− Chancen-, Risiko- und Innovationskom-petenz Chancen- & Risikokompetenz sind zuwenig beachtete Innovationstreiber. IhrAusbau erhöht die Innovationskraft.
− Networking-Kompetenz, Teamfähigkeitund LeadershipStarke Netzwerke befördern Erfolg, dasie die Informationsbasis und den Akti-onsradius erweitern und den Bekannt-heitsgrad erhöhen.
Das Drehen aneiner Stellschraubeverbessert diegesamte Perfor-mance – ein gran-dioser Nebenef-fekt. Die Löwen-Strategie übertrifftZeitmanagement.“
Das Kapitel „Vorbild Löwinnen“ und In-terviews mit TOP-Führungsfrauen wie Dr.Alexandra Borchardt, vormals Chefin vomDienst der Süddeutschen Zeitung, Unter-nehmerin Prof. Ulrike Detmers und TOP100 Ökonomin Dr. Elke Holst bieten Frauenbesondere Inspiration. Die Kolleginnen inBerlin stimmen im Übrigen der DeutschenBahn (in: DB Kultur im Norden) zu: „Wirsind so begeistert, dass wir finden, möglichstviele KollegInnen und Weggefährten solltenvon den Anregungen und praxiserprobtenTipps der Autorin profitieren. Ein furioserRatgeber!“
■
Martina Haas
Die Löwenstrategie Effizienz und Effektivität im Fokus: Von Löwen und Löwinnen lernenBeck-Verlag Taschenbuch 19,80 € – ISBN 978 3 406 707278
Konsens_2017_final.qxp_Konsens 21.12.17 08:38 Seite 67
LITERATUR
68 KONSENS 2017
Toleranz mit den Intoleranten kann nichtgut gehen, am Ende wird die Toleranz ab-geschafft.
Ganz fremd werden diese Gedanken demLeser nicht sein. Für die Autorin sind sieaber mehr als Reflexionen, sie musste sichdiese Erkenntnisse in ihrem Leben erkämp-fen. Zana Ramadani ist in Skopje geborenund gehörte dort zu der albanischen undzugleich muslimischen Minderheit. Mit sie-ben Jahren kam sie nach Deutschland undwuchs in einem Dorf in der Nähe von Sie-gen in die deutsche Gesellschaft hinein. Be-
sonders die Jugendarbeit in der evangeli-schen Kirche vermittelte ihr das Gefühl, alsMädchen eben so viel wert zu sein wie dieJungen. Ihre Mutter aber wollte sie in dastraditionelle muslimische Frauenbild pres-sen. Sie flüchtete vor der Gewalt in ihremElternhaus in ein Frauenhaus. Von dort ge-lang ihr der Absprung in Studium und Beruf.
Die Beschreibung der Unterdrückungs -mechanismen in der muslimischen Gesell-schaft ist ernüchternd und befriedigt mög-licherweise den harmoniebedürftigen Leser
nicht. Aber soll man einer Migrantin nichtglauben, die einschlägige Blogs lesen kannund versteht, was in Moscheen gepredigtwird?
Trotz aller Kritik an Zwangsverheiratung,Gewalt gegen Frauen und den „steinzeitli-chen Weisungen des Koran“ entwirft dieAutorin ein Szenario der Zuversicht: Inte-gration kann gelingen. Voraussetzung dafürist, dass Migranten die Spielregeln der west-lichen Welt einhalten und dass wir für dieseSpielregeln eintreten. ■
Die Künstlerin des Titelbildes –
Cornelia Schleime,
geb. 4. Juli 1953 in Ost-Berlin, lebt undarbeitet in Berlin und Brandenburg.
1970 – 1980 Studium der Grafik und Ma-lerei, Hochschule für BildendeKunst Dresden.
Ab 1981 Ausstellungsverbot in der DDR.Bei ihrer Übersiedlung nach West-Berlin 1984 waren ihre bis dahingeschaffenen Werke spurlos ver-schwunden.
1989 PSI-Stipendium des DAAD für Ar-beitsaufenthalt in New York.
1992 – 1998 verschiedene Studienreisen:Kenia, Indonesien, Brasilien, Ha-waii.
2005 Professur an der KunstakademieMünster/Hochschule für BildendeKunst.Preisträgerin der Projektbörse„Mauer im Kopf“. Stiftung NeueKultur in Berlin.
2000 Mitglied der Sächsischen Akade-mie der Künste, Dresden
2003 Gabriele-Münter-Preis.2004 Fred-Thieler-Preis, der herausra-
gende Malerinnen und Maler aus-zeichnet.
2005 Award of excellent painting Natio-nal Art Museum of China.
2010 Ehrenstipendium im KünstlerhausLukas in Ahrenshoop/MVP
2016 Hannah-Höch-Preis des LandesBerlin.
Eigene Schriften
• Hawaii Reisetagebuch. Faksimileauflage 1999
• Weit fort. Roman. Hamburg: Hoffmannund Campe 2008
• Zungenschlag. Berlin: Jovis 2012• Das Paradies kann warten. Stories. Berlin:
Fuchs und Fuchs 2014• Wüstenmoos. Reisetagebuch Marokko.
Berlin: Fuchs und Fuchs 2015.
http://www.cornelia-schleime.de/
■
TERMINE 2018
12. bis 13.01. Klausurtagung des Vorstands in Berlin 12. bis 23.03. 62. Sitzung der Frauenrechtskommission (CSW62) der Vereinten Nationen in New York City 28.04. women&work in Frankfurt a.M. – der DAB AK-FNT wird mit einem Informations- stand (und möglicherweise einem Workshop) vertreten sein. 21. bis 25.06. UWE-Tagung in Rom 22. bis 24.06. Mitgliederversammlung des Deutschen Frauenrats in Berlin 21. bis 23.09. Tagung des DAB zum Thema „Kultureller Wandel“ in Berlin 04. bis 07.10. D-A-CH-Treffen 2018, wird vom VAÖ in Innsbruck ausgerichtet
Konsens_2017_final.qxp_Konsens 21.12.17 08:38 Seite 68
IMPRESSUM
KONSENS 2017 69
KONSENSInformation des DeutschenAkademikerinnenbundes e.V.
Herausgeber:DAB-Bundesvorsitzende Dr. Patricia Aden
Geschäftsstelle:Sigmaringer Straße 1, 10713 BerlinTel. 030 - 3101 [email protected] www.dab-ev.org
Redaktion: Dr. Patricia AdenRenate BröckingManuela B. Queitsch
Redaktionelle Mitarbeit:Prof. Dr. Elisabeth de Sotelo
Konto:Deutscher Akademikerinnenbund e.V.Sparkasse KölnBonnBIC: COLS DE 33XXX IBAN: DE19 3705 0198 0002 7923 15
Die Zeitschrift erscheint zum Einzelpreis von € 10,–
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Verbreitung,Vervielfältigung und Übersetzung, vorbehalten.
Auch auszugsweiser Nachdruck nur mit Genehmigungdes Herausgebers. Für unaufgefordert eingesandteManu skripte, Zeichnungen, Fotos und sons tiges Ma-terial wird keine Haftung übernommen. Beiträge, diemit Namen oder Initialen der Verfasserin/des Verfassersgekennzeichnet sind, geben nicht in jedem Fall dieMeinung des DAB wieder.
ISSN: 0930-6633
Layout u. Druck: Elfi Masuhr / Masuhr Druck- undVerlags GmbH · www.masuhr-druck.de
BE IT R ITT SERKL Ä R UNGHiermit erkläre ich meinen Beitritt zum DAB e.V.,
Bundesmitgliedsbeitrag € 85,– (ermäßigt: Studentinnen im Erststudium € 25,–)
❑ als Mitglied mit regionaler Gruppenbindung ❑ als Mitglied ohne in der folgenden DAB-Gruppe regionale Gruppenbindung (Bitte den zusätzlichen Beitrag in der Gruppe erfragen)
....................................................................................................
Name Vorname Geburtsdatum
Straße: PLZ/Ort:
Tel./Fax: E-Mail:
Studium: Hochschule:
Studienfächer:
Studienabschlüsse: Examensdatum
Semesterzahl bei Studentinnen:
Offizielle Berufsbezeichnung: Berufl. Tätigkeit:
❑ Ich bin damit einverstanden, dass mein Beruf und meine Kontaktdaten sowie E-Mail-Adresse zur internen Information und Kontaktpflege im Mitgliederverzeichnis aufgeführt werden
Ort / Datum / Unterschrift
Einsenden an: Deutscher Akademikerinnenbund e.V., Geschäftsstelle: Sigmaringer Straße 1, 10713 Berlin
Konto: Deutscher Akademikerinnenbund e.V.Sparkasse KölnBonn (BLZ 370 501 98), Konto-Nr. 2792315 BIC: COLS DE 33XXX – IBAN: DE19 3705 0198 0002 7923 15
Der Mitgliedsbeitrag ist bis zum 31.03. eines jeden Jahres zu zahlen.
IMPRESSUM
Der DAB-Vorstand wünschtallen Mitgliedern und Interessierteneinen gesunden Start ins neue Jahr.
Konsens_2017_final.qxp_Konsens 21.12.17 08:38 Seite 69
Ingrid JungwirthAndrea Wolffram (Hrsg.)Hochqualifizierte MigrantinnenTeilhabe an Arbeit und Gesellschaft
2017. 249 Seiten. Kart. 28,00 € (D), 28,80 € (A)ISBN 978-3-86649-456-5eISBN 978-3-86649-523-4
Die AutorInnen untersu-chen, wie sich hochqualifi-zierte Migrantinnen in den deutschen Arbeitsmarkt integrieren und unter wel-chen Bedingungen sie ihre Qualifikationen umsetzen und nutzen können. Ein zentrales Anliegen ist es, Geschlecht als analytische Dimension in die Untersu-chung hochqualifizierter Migration systematisch einzubeziehen. Über eineökonomische Perspektive hinausgehend, werden andere Lebensbereiche berücksichtigt und die Wechselwirkung von Arbeit, Migration, Familie und so-zialer Teilhabe im Rahmen der Soziologie des Lebens-laufs analysiert.
Andrea LötherBirgit Riegraf (Hrsg.)Gleichstellungspolitik und Geschlechter-forschungVeränderte Governance und Geschlechterarrangements in der Wissenschaftcews. Beiträge Frauen in Wissenschaft und Forschung, Band 8
2017. 206 Seiten. Kart. 33,00 € (D), 34,00 € (A)ISBN 978-3-8474-2055-2eISBN 978-3-8474-1053-9
Umstrukturierungen führen in den letzten Jahren zu veränderten Anforderungen an Wissenschaftsorganisati-onen und Gleichstellungs-politiken. Neue Reputa-tions- und Erfolgskriterien, veränderte Standards für wissenschaftliche Tätigkei-ten und Evaluationssysteme werden implementiert. Die Beiträge nehmen den Zusammenhang von veränderter Governance und Gleichstellung in der Wissenschaft aus unter-schiedlichen Perspektiven in den Blick.
Anke Karber | Jens Müller |Kerstin Nolte | Peter Schäfer Tilmann Wahne (Hrsg.)Zur Gerechtigkeitsfrage in sozialen (Frauen-)BerufenGelingensbedingungen und Verwirklichungschancen
2017. 279 Seiten. Kart. 36,00 € (D), 37,10 € (A)ISBN 978-3-8474-2023-1eISBN 978-3-8474-1055-3
Personenbezogene soziale Dienstleistungsberufe be-finden sich aktuell in einer kontroversen Lage: Auf der einen Seite erfahren sie eine erhebliche Expansion, begleitet von steigenden Qualitätsansprüchen an Erziehungs-, Bildungs-, Betreuungs- und Pflegetä-tigkeiten. Auf der anderen Seite entspricht die Anerkennung dieser Frauenberufe jedoch nach wie vor nicht ihrer tatsächlichen gesamtge-sellschaftlichen Bedeutung. Dieses Spannungsfeld erörtern die AutorInnen aus verschiedenen Perspekti-ven.
Tina KleikampAkademikerpaare werden ElternRollenfindung, Bewältigungsstrategien, BelastungsfaktorenFrauen- und Genderfor-schung in der Erziehungs-wissenschaft, Band 12
2017. 191 Seiten. Kart. 28,00 € (D), 28,80 € (A)ISBN 978-3-8474-2096-5eISBN 978-3-8474-1094-2
Welche Vorstellungen ha-ben werdende Eltern vom Leben mit Kind und wie erleben sie die Realität? Die Geburt des ersten Kindes gilt als entscheidender Wendepunkt der menschli-chen Biographie. Die vorliegende Studie begleitet Akademikerpaare im Übergang zum Familien-leben und zeigt auf, wie El-tern in einer individualisier-ten Gesellschaft ihre Rollen als Mütter und Väter selbst gestalten (müssen) und welche Bewältigungsstrate-gien sie entwickeln, um den Alltag zwischen Familie und Beruf zu meistern.
Bücher für Ihr besseres Wissen
Verlag Barbara BudrichBarbara Budrich PublishersStauffenbergstr. 751379 Leverkusen-Opladen
Tel +49 (0)2171.344.594Fax +49 (0)[email protected]
Bestellen Sie unsere aktuellenKataloge und unserenmonatlichen Newsletterbudrich intern:
E-Mail an [email protected],Betreff budrich intern oder„Kataloge“ genügt!
Jetzt in Ihrer Buchhandlung bestellen oder direkt bei:
www.shop.budrich-academic.de
konsens 2017 indd 1 14 09 2017 10:04:23
Konsens_2017_final.qxp_Konsens 21.12.17 08:38 Seite 70