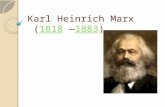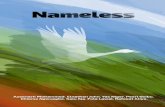Heinrich der Löwe in deutscher Literatur 1933 - 1945
-
Upload
uni-tuebingen -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Heinrich der Löwe in deutscher Literatur 1933 - 1945
Eberhardt Karls Universität TübingenPhilosophische FakultätSeminar für Mittelalterliche GeschichteProseminar: Heinrich der LöweSoSe 2013Dozent: Dr. Marco Veronesi
„Das Bild Heinrichs des Löwen in dereinschlägigen deutschen Literatur
zwischen 1933 und 1945“
Eine Untersuchung ausgewählter exemplarischer Werke dereinschlägigen Literatur über Heinrich den Löwen aus den Jahren1933 bis 1945 mit dem Ziel, herauszufinden, wodurch das Bild
dieser historischen Figur in jener Zeit bestimmt war und ob es,besonders in jenen Werken deutscher Autorenschaft, einePositionierung derselben im Sinne einer Überhöhung des
Deutschtums gab.
*
.
1
Fabian DaldrupRaichbergstraße 13
72072 Tü[email protected]
Hauptfach: Geschichte, Nebenfach: Spanisch4. Fachsemester (Geschichte)
2. Fachsemester (Spanisch)Inhaltsverzeichnis
- Deckblatt -
- Inhaltsverzeichnis -
I. Einleitung:
1) S. 1 – 2 Das NS-Regime und seine
Einflussnahme im
wissenschaftlichen Sektor
2) S. 2 – 3 Hinführung: Warum und auf welche
Weise könnte
Heinrich in die
Darstellungen zeitgenössischer Literatur
Eingang gefunden haben
II. Hauptteil:
1) S. 3 – 5 Kaiser Friedrich Barbarossa und
die Wende der
staufischen Zeit
2) S. 5 – 7 Kaiser Friedrich Barbarossa
2
3) S. 7 – 9 Friedrich Rotbart und Heinrich
der Löwe
4) S. 9 – 10 Der sächsische ‚Staat‘ Heinrichs
des Löwen
5) S. 10 – 12 Heinrich der Löwe – Seine Stellung
in der inneren und in
der äußeren Politik
Deutschlands
6) S. 12 – 14 Heinrich der Löwe – eine
politische Tragödie in
Deutschland
7) S. 14 – 15 Heinrich der Löwe – im Urteil der
deutschen
Geschichtsschreibung von
seinen Zeitgenossen bis zur
Aufklärung
III. Schluss:
1) S. 15 – 16 Lässt sich im Wandel der Zeit
eine Veränderung des
Bildes Heinrichs des Löwen
feststellen?
2) S. 16 – 17 Gab es eine Positionierung der
historischen Figur
Heinrichs des Löwen im
Sinne der NS-Ideologie?
3) S. 18 Literaturverzeichnis
4) S. 19 – 22 Anhang
Einleitung:3
Das NS-Regime und seine Einflussnahme im wissenschaftlichen Sektor
Am Marienaltar von 11881 sollte man nicht zum Gebet
niederknien, das Gebäude nicht in Demut vor dem Herrn betreten,
sondern in Ehrfurcht vor dem in ihm bestatteten Bauherrn des
St. Blasius – Domes zu Braunschweig (Anhang 1). Nach seinem
Tode im Jahr 1195 hatte sich Heinrich der Löwe hier neben
seiner zweiten, bereits verstorbenen Gattin Mathilde zu Grabe
(Anhang 2) legen lassen.2 Die aufwendigen Grabfiguren aus
Schaumkalk wurden im XIII. Jahrhundert von der Familie
hinzugefügt3, dem Grab selbst hingegen wurde zumindest in der
Sicht der damaligen Auftraggeber und politischen Machthaber
eine größere Ehre zuteil. Denn aus dem sakralen Ort wurde mit
der Verlegung in eine eigens dafür neu geschaffene Krypta im
zeitgenössischen Stil des Jahres 1936 unter der Herrschaft der
Nationalsozialisten eine „Nationale Weihestätte“.4 Die
sterblichen Überreste des früheren Herzogs von Sachsen und
Bayern wurden so von den Verantwortlichen in ihrem Sinne zu
einem Monument deutscher Geschichte des Hochmittelalters und in
überaus deutlicher Weise zu einem Symbol der Wertschätzung, die
in ihren Augen offenbar Heinrich dem Löwen gebührte und die so
in Stein verewigt wurde. Der Braunschweiger Dom war 1939 vom
Besitz der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche in1 Friedrich Berndt, Dom und Burgplatz zu Braunschweig. (Grosse Baudenkmäler, Heft 130) 1. Aufl. München/Berlin 1950.2 Joachim Ehlers, Heinrich der Löwe. Europäisches Fürstentum im Hochmittelalter. 1. Aufl. Göttingen 1997. 3 Friedrich Berndt, Dom und Burgplatz zu Braunschweig. (Grosse Baudenkmäler, Heft 130) 1. Aufl. München/Berlin 1950.4 Jochen Luckhardt, Franz Niehoff, Gerd Biegel (Hrsg.), Heinrich der Löwe und seine Zeit. Herrschaft und Repräsentation der Welfen 1125 – 1135. (Katalog der Ausstellung Braunschweig 1995, Band 3 Abteilung Nachleben) München 1995.Karl Arndt, Missbrauchte Geschichte: Der Braunschweiger Dom als Politisches Denkmal 1935/45. München 1995.
4
Staatseigentum verwandelt worden, in umfassenden baulichen
Veränderungen wurden im Folgenden sogar die Wandmalereien
zeitgenössisch erneuert. (Anhang 3)5
Derartige Objekte und Aktionen dienten den Nationalsozialisten
dazu, die Erinnerung, vornehmlich an in Deutschland allgemein
als glorreich anerkannte Zeiten wach zu halten, auch wenn sie
nicht zur generell stärker glorifizierten jüngeren Geschichte
gehörten. Im Sinne der Volkserziehung waren für die Machthaber
all jene Punkte der deutschen Geschichte von besonderem
Interesse, die sich zur Bestätigung der von ihnen propagierten
Ideologie auslegen ließen. Dazu gehörten logischerweise
individuelle Akteure, die Heldenstilisierung erlaubten, aber
auch Epochen und Geschehnisse, die sehr viel weiter zurück
lagen, und so vielleicht Basen deutscher Macht in sehr alten
Traditionen markierten. Nicht nur in architektonisch-musealen
Mahnmalen, die von den politischen Führern des dritten Reiches
allein geplant wurden, sollten diese Bestätigungen zu finden
sein, sondern grade in jenen Sektoren, über die der Staat bis
dato ein nicht so großes Verfügungsrecht besaß und deren
Distributionsfunktionen weitreichend und deshalb wertvoll
waren: Schulen, Universitäten und die freie Schriftstellerei,
die auf allen Bildungsebenen Anwendung zu finden hoffte. Gemäß
der neueren deutschen Gesetze konnten freie Schriftsteller
rasch und wirksam mit Publikationsverbot belegt werden, wie es
auch besonders im Falle von Juden und linksorientierten Autoren
geschah. Schon in den Volksschulen des so genannten Dritten
Reiches wurden die Grundsteine für eine in der Nachbetrachtung
verzogene Geschichtsdarstellung gelegt. Diese Arbeit soll sich5 ebd.
5
allerdings vornehmlich mit universitären Publikationen zu
Heinrich dem Löwen beschäftigen. Nach und nach wurden die
Lehren in den deutschen Hörsälen an die Vorstellungen der
Nationalsozialisten angepasst und leicht konnten Dozenten ihren
Posten verlieren, wenn sie nicht der Linie der Machthaber
folgten. Abgesehen von den Lehrplänen und den
Vorlesungsinhalten wurde natürlich auch der universitäre
Publikationssektor unter die indirekte Zensur der politischen
Führer gestellt und auch Professoren, die sich weigerten, ihre
Arbeit nach deren Zielen auszurichten, konnten mit
Publikationsverbot belegt werden. In erster Linie sollten so
die Lehrinhalte von Fächern wie Ethnologie nach und nach im
Sinne der Nationalsozialisten modifiziert werden, aber auch
Fachbereiche wie die Geschichtswissenschaft waren stark
betroffen. Über die Vergangenheit sollten die als richtig
angesehenen Inhalte aus einer gewissen Perspektive heraus
vermittelt werden. Dadurch, dass dies an allen Universitäten
und auch in der begleitenden Lektüre geschehen sollte, war der
Wirkungsradius enorm. In dieser Arbeit sollen Werke zu Heinrich
dem Löwen und seiner Zeit aus den Jahren 1933 bis 1945
untersucht werden, um herauszufinden, wie das Bild dieser
historischen Figur in jener Zeit war, ob und wie es der
Einflussnahme der Nationalsozialisten unterlag und ob mit
fortschreitenden Jahren und weiter reichender Einflussnahme der
Nationalsozialisten auf Publikationen zu Heinrich dem Löwen der
Duktus derselben entsprechend und signifikant verändert wurde.
Hinführung: Warum und auf welche Weise könnte Heinrich in die Darstellungen
zeitgenössischer Literatur Eingang gefunden haben?6
Vor allem wegen der unzureichenden Dokumentation bildungsferner
Bevölkerungsschichten ist es schwierig, über das Mittelalter
Forschungen im Sinne der Sozialgeschichte und ähnlicher
Disziplinen vorzugehen. Das soll nicht bedeuten, dass die
Arbeit des Historikers sich allein im Sinne von Rankes
Historismus erledigen ließe, dennoch sind wir, um Informationen
über das Leben und die politischen Bewegungen jener Epoche zu
erhalten, auf die Dokumentationen von Geistlichen und Adligen
angewiesen. Es trifft sich, dass ebenjene auch die bestimmenden
Schichten der Bevölkerung im Mittelalter waren, sodass wir
große Ereignisse und Vorkommnisse fast immer in Verbindung mit
großen Namen sehen. Heinrich der Löwe, aus einem der
bedeutendsten Adelsgeschlechter der deutschen Lande, gehört zu
diesen Namen. Als Herzog von Sachsen und Bayern, Heerführer,
Stadtgründer, Investiturreformer und Verbreiter des
Christentums in den ostelbischen Gebieten prägte er neben
seinem Vetter, dem Kaiser Friedrich Barbarossa, wie kaum ein
anderer zu dieser Zeit lebende Mann, die Bewegungen der
Menschen auf deutschen Böden.
In dieser Arbeit geht es um das Bild Heinrichs des Löwen zur
Zeit des Nationalsozialismus und um die Frage, inwiefern
besagtes Bild im Sinne der Ideologie nach hierhin oder dorthin
verrückt wurde. Ich gehe mit bestimmten Vermutungen über die
Betrachtung Heinrichs des Löwen an die Materie heran, denn ich
meine, dass es im Sinne der nationalsozialistischen Ideologie
nur zu einer Glorifizierung, oder aber zu einer strikten
Ablehnung Heinrichs gekommen sein kann. Die Gründe dafür wären
einfacher und logischer Natur. Man könnte dem Herzog im Sinne
einer Ausbreitung des Deutschtums die Expansionen im Osten, den7
Landesausbau in Sachsen und auch die vielmals erfolgreichen
Feldzüge auch an der Seite seines Vetters hoch anrechnen, wobei
besonders der erste Punkt von großer Bedeutung wäre. Auf der
anderen Seite wäre da die Möglichkeit, Heinrichs mehrfach
überlieferte Weigerung gegenüber dem Kaiser, ihm abermals
militärische Hilfe in Italien zu leisten, als einen Treuebruch
und eine Pflichtverweigerung gegenüber seinem Kaiser und seinem
Volk ansehen, was sich unter nationalsozialistischer Ideologie
mit ziemlicher Sicherheit in einer scharfen Verurteilung oder
sogar Herabwürdigung manifestieren würde. So meine ich, dass
sich die von mir untersuchten Werke, unter der Vorraussetzung,
dass sie im Sinne der Machthaber verfasst worden sind, einer
der beiden Bewertungskategorien zuordnen lassen müssten.
Hauptteil:
„Kaiser Friedrich Barbarossa und die Wende der staufischen Zeit“ (Strassburger
Universitätsreden Heft 5) – von Hermann Heimpel, Straßburg, 1942
Auch bei diesem Werk handelt es sich um die Abdruck einer
Universitätsrede, in diesem Fall um eine von Hermann Heimpel
aus Straßburg. Seinem Titel folgend behandelt der Autor in der
Tat in weiten Zügen die Person und die Politik des
Stauferkaisers Friedrich Barbarossas und erwähnt Heinrich den
Löwen tatsächlich so wenig, dass er weniger als eine Randfigur
zu sein scheint. Daraus resultiert, dass sich Hermann Heimpel
nicht in einer Polemik zugunsten eines der beiden Figuren in
einem direkten Vergleich verliert, wobei kein Zweifel bestehen
kann, dass er seine Arbeit unter dem Gesichtspunkt
nationalsozialistischer Überzeugung verfasste: „Wir feiern
[...] das Reich aller Deutschen, das Adolf Hitler schuf und für8
das auch in dieser Stunde unsere Freunde fechten.“ (S. 3).
Besonders deutlich wird diese wichtige Grundeinstellung im
Schlussteil des ersten Absatzes der Rede: „Im Bewusstsein der
Einheit unserer Geschichte aber erinnern wir uns des ersten
Reiches, in dem das deutsche Volk entstand, [...], in dem
adeliges Leben und erste Anspannung des Geistes das Bild des
Deutschen formte, das als Verpflichtung in uns lebt.“ (S. 3).
Jene Äußerungen bekräftigen zunächst die Annahme, dass von
Wissenschaftlern jener Ideologie auch wissenschaftliche Arbeit
im Sinne derselben zu erwarten ist.
Mit seinem Kollegen Dr. Wohltmann hat H. Heimpel gemein, dass
er zu einer Glorifizierung des Stauferkaisers neigt, auch wenn
diese, anders als im zuvor behandelten Werk, nicht durch eine
komparative Abwertung Heinrichs des Löwen geschieht: „Der
königliche, von den Zeitgenossen schon nach den eleganten
Forderungen des Rittertums empfundene Leib behauptet sich bis
ins hohe Alter zu Pferde und im Gedränge des Gefechts. [...]
Doch bemerkt der Fremde in unbewegter Miene nur das
unerschütterte Herz.“ (S. 4/5), „Friedrich griff die Probleme
an, die sein Vorgänger nicht bewältigt hatte. [...] Und doch
ist er am Ende seines Lebens der Herr der Welt, auf dem Wege
vom alten Recht zur neuen Politik.“ (S. 7/8).
Der Autor braucht letztendlich achtzehn Seiten, um auf Heinrich
den Löwen zu sprechen zu kommen. Er behandelt dort allerdings
nicht dessen Person, sondern die urkundlichen Umstände seiner
Aburteilung, bei der dennoch eine Art Wertung anfällt: „Liest
man die Urkunde genau, so ergibt sich doch nicht jener
Kompromiß zwischen der Demütigung Heinrichs des Löwen durch den
Kaiser [...]“ (S. 21). In der Folge bezeichnet Heimpel die9
Fürsten, die auf Heinrichs Aburteilung drängten als „die alten
Feinde des Löwen“ (S. 22). Schließlich kommt es doch noch zu
einer Analyse der Politik des Welfenherzogs, insbesondere im
Bezug auf den Rest des Reiches: „[...] dass die neue
Fürstenschaft dem Reich zu Barbarossas Zeit stärker verbunden
war als vorher, bis auf den einen Heinrich den Löwen [...]“ (S.
23), dessen Herrschaftsstil mit „kolonialer Einzigartigkeit“
und „von [...] seinen englischen Verbindungen her [...] eine
selbstständige internationale Politik [...]" (S. 23)
charakterisiert wird. Letztmalig findet Heinrich der Löwe im
Zusammenhang mit der Religionspolitik des Reiches Erwähnung, wo
positiv aufgeführt wird, dass die „innere Christianisierung des
Mittelalters“ durch (S. 27) „das Gesicht Heinrichs des Löwen am
deutlichsten“ (Vgl. S. 27) vertreten wird.
Trotz des generell deutlich spürbaren Nationalismus des Autors,
der besonders in die Beschreibung Barbarossas einfließt, sind
die spärlichen Ausführungen über Heinrich den Löwen eher
sachlich gehalten. Am Ende erhält man ein wenig deutliches und
durchwachsenes Bild des Herzogs, bei dem seine Religionspolitik
eher positiv bewertet wird, seine generelle Landespolitik aber
als dem Reich schadend.6
„Kaiser Friedrich Barbarossa – Eine Historie von Rudolf Wahl, Verlag F. Bruckmann,
München 1941“
Allein durch das Quantitative im Bezug auf Geschichtswerke zum
Mittelalter fällt deutlich auf, dass es weit mehr groß
angelegte Werke zum Stauferkaiser gibt, als zu Heinrich dem6 Hermann Heimpel, Kaiser Friedrich Barbarossa und die Wende in der staufischen Zeit. (Strassburger Universitätsreden, Heft 3), 1. Aufl. Straßburg 1942.
10
Löwen. Auch die vorliegende Arbeit ist extrem umfangreich,
präzise, mit großer Sorgfalt und über weite Strecken mit
relativer Sachlichkeit verfasst worden.
Um eine Historie handelt es sich in der Tat insofern, als dass
Rudolf Wahl in einem eine Einzelperson betreffenden Werk, bei
der Behandlung der Grundlagen bis in die Spätkarolingische Zeit
und die Gründung des alten Herzogtums Sachsen zurückkehrt.
Anders als andere bereits behandelte Historiker, die Friedrich
von Hohenstaufen in den Mittelpunkt ihrer Forschung stellten,
ist Heinrich dem Löwen in diesem Buch ein beachtlicher Teil
gewidmet.
Beim Nacherzählen der Vorgeschichte mit besonderem Hinblick auf
die Ereignisse um die Familien derer von Hohenstaufen, der
Welfen, der Billunger, der Süpplingenburger und insbesondere um
die Wahlen zum König, behandelt der Autor insbesondere die
Familiengeschichten der Welfen und der Staufer, zunächst noch
ohne den Anschein, direkte Partei für eine der beiden zu
ergreifen, zumal sie nicht immer in Kontraposition stehen. In
den Worten Wahls klingt eine Art Bedauern durch, als es um das
Aussterben der Welfen in der Manneslinie geht (Vgl. S. 18). Was
sich in der Tat ausmachen lässt, ist eine generelle Sympathie,
die der Text dem Leser gegenüber den Staufern vermittelt, deren
Aufstieg von ihrem frühesten Anbeginn erzählt und deren
Rückschläge, besonders als Gegner Lothars von Süpplingenburg,
der als Marionette des Papstes dargestellt wird, emotional
kommentiert werden: „...der Kaiser kämpfte nicht mehr für das
Reich, sondern für den Papst.“ (S. 28), „Schritt für Schritt
musste der Staufer zurückweichen, bis [...] das bittere Ende
kam.“ Eine generelle positive Sicht auf die Familie Friedrichs11
I. kennen wir im Zuge dieser Arbeit bereits aus ähnlichen
Werken. Allerdings geht selbige in diesem Zusammenhang noch
nicht auf Kosten eines negativen Vergleichs mit Heinrich dem
Löwen.
Dieser Umstand ändert sich, wenn auch nicht in aller
Deutlichkeit, aber doch spürbar, als Wahl über die Abmachungen
Friedrichs I. mit seinem Vetter über die Heerfahrt nach Italien
schreibt: „Der Sachse forderte nämlich die Lehensoberhoheit
über die Kirchen seines Herzogtums [...], so ungeheuerlich
diese Forderung auch war.“ (S. 95). Mit diesem Satz
kennzeichnet der Autor den Welfenherzog bereits früh als
maßlos. Das von Heinrich dem Löwen in diesem Buch tatsächlich
vermittelte Bild tritt aber erst zum Ende hin hervor, nämlich
in jenem Kapitel, das emblematisch mit „Die Zertrümmerung der
welfischen Macht“ (S. 411) betitelt wurde. Ohne dass sich Wahl
in polemischen Beschreibungen eines Verrats des Herzogs am
Kaiser erginge, liegt die negative Wertung eher in der
penetrant abschätzigen Kommentaren zu den Ereignissen um den
Prozess Heinrichs, sein Widerstand und sein Ende. Sein
Charakter behält den Anschein der Maßlosigkeit: „Trug auch der
Vetter die Krone: er, Heinrich der Löwe, war ihm an Macht und
Ansehen mindestens ebenbürtig, wenn nicht überlegen“ (S. 420)
und der Arroganz: „...vollendeter Missachtung vor der
kaiserlichen Autorität.“ (S. 424).
Je mehr sich in Wahls Darstellungen die Situation zwischen
Friedrich und Heinrich zuspitzt, desto stärker geraten beide
doch in direkten Vergleich, wobei das Ergebnis doch ein sehr
ebenmäßiges Bild mit klar verteilten Rollen des Bösen und des
Guten ergibt: „...unter Heinrichs persönlicher Führung [...]12
die [...] gelähmte Bevölkerung auszuplündern.“, „ging [...] mit
äußerster Schärfe vor.“ (S. 426), „stürzte sich auf Goslar
[...], überrannte [...], um in Thüringen einzubrechen.“ (S.
433). Sein Verhalten und seine Verteidigungsmaßnahmen gegen die
schlussendliche Vollstreckung des kaiserlichen Urteils gegen
ihn war laut Wahl „vollendeter Landesverrat“ (S. 434), und
seine Vorgehensweise in keinem Moment durchdacht noch
angemessen: „Es gab ja kaum einen Fehler, den Heinrich nicht
begangen hätte.“, „...bleib Heinrich oberflächlich und
übermütig.“, „Vielleicht wäre es [...] geglückt, diese
Aussprache [...] herbeizuführen, hätte er selbst nicht alles
verdorben.“ (S. 450). In der Interpretation des Umgangs mit dem
gefallenen Herzog auch nach dessen vollendeter Unterwerfung
fällt der Autor ins Spekulative: „Er hatte ja zur Genüge
bewiesen, dass er in Langmut und Milde nur Schwäche sah und
kein Organ für Dankbarkeit besaß.“ (S. 454).
Neben dieser extremen Abwertung jeglichen Handelns Heinrich des
Löwen wird deutlich, dass Rudolf Wahl offenbar Kaiser Friedrich
zentral thematisierte, weil er ihm als historische Figur lieber
war: „Es war eine seiner bezaubernden Liebenswürdigkeiten.“ (S.
448), „...die Überlegenheit des Geistes über die Gewalt hatten
diesen Krieg gewonnen. Solchen Waffen hatte der Welf nichts
entgegenzusetzen.“ (S. 449), „Eine bessere Regelung, die
Großmut und Staatsklugheit verband, konnte nicht gefunden
werden, [...].“ (S. 454).
Am Ende bleibt von Heinrich dem Löwen ein Bild, auf das von
Beginn an vorsätzlich hingearbeitet worden ist, dass unter der
Glorifizierung Barbarossas und der persönlichen Vorliebe des
Historikers leidet, und schließlich ohne gerecht abgewogen13
worden zu sein als schwarze Gestalt in der mittelalterlichen
Geschichte zurückbleibt. Auf der anderen Seite ist der Text
zwar eindeutig und unwissenschaftlich motiviert, allerdings
nicht auf jener Basis, die im Anfang dieser Arbeit vermutet
wurde, denn weder die Abwertung Heinrichs noch die Aufwertung
Friedrichs geschehen unter Bezug auf nationalsozialistische
Ideologie.7
„Friedrich Rotbart und Heinrich der Löwe – Ein Vortrag von Oberstudiendirektor Dr.
Hans Wohltmann, Stade“ 1939
Dieses im Allgemeinen nicht sehr umfassende Werk ist die
Abschrift eines Vortrages, den der Autor nach eigenen Angaben
„seit Herbst 1937 wiederholt gehalten“ (S. 45) hat. Die dieser
Arbeit zugrunde liegende Fassung wurde im Jahr 1939 in Stade
gedruckt und veröffentlicht. Bei dem Vortragenden handelte es
sich zweifellos um einen mehr als linientreuen Historiker, in
dessen Einleitung sich bereits stark nationalistische Tendenzen
zeigen. „Die beiden Männer [...] sind deutschen Herzen teuer“
(S. 25), „Wo in der Geschichte unseres Volkes das Streben nach
einem einigen deutschen Reich durchbricht, da klammert es sich
an Friedrichs I. ritterliche Persönlichkeit.“ (S. 25). Versucht
Dr. Wohltmann im ersten Satz seines Vortrages noch, eine
gleiche Ausgangsposition der beiden von ihm untersuchten Männer
darzustellen, so zeigt sich schon im zuletzt zitierten Satz und
in vielen noch folgenden, dass zumindest er von vornherein ein
Verehrer Friedrichs I. war. Noch bevor er seine
Vergleichsarbeit aufnimmt, kritisiert er „kleindeutsche
Geschichtsschreiber“ (S. 26), die behaupten, „die7 Rudolf Wahl, Kaiser Friedrich Barbarossa. 1. Aufl. München 1941.
14
Italienpolitik Barbarossas, sein Imperialismus sei
fehlgerichtet gewesen, habe nutzlose Verschwendung von teurem
deutschem Blut, mindestens eine Vernachlässigung des Reiches
[...] zur Folge gehabt. Sie machen wohl gar den Rotbart für die
deutsche Tragödie [...] verantwortlich.“ (S. 27). Diesen von im
abschätzig betrachteten Meinungen stellt er die „Größe“ und den
„opferbereiten Schwung“ (S. 27) des Kaisers gegenüber, „während
des Löwen Charakter doch etwas Düsteres behielt.“ (S. 27). So
beginnt der Autor seine Betrachtungen keineswegs von einem
neutralen Standpunkt aus, sondern von bereits fest
vorformulierten Meinungen, die im weitern Verlauf noch anders
untermauert werden sollten.
Die negative Darstellung Heinrichs des Löwen, die in diesem
Werk deutlich überwiegt, beginnt mit einer Betrachtung von
dessen Familie. Während besonders die gute Tradition nach Karl
dem Großen und die Heiratspolitik mit Königshäusern gelobt
werden, unterstellt Wohltmann den Welfen die Mischung mit
Ausländischem Blut, was ihnen einen „fremdartigen Charakter“
(S. 28) gegeben habe. Heinrichs Verwandtem, Welf VI.
bescheinigt er, nicht weiter fundiert, „ganz von Selbstsucht
geleitet zu sein“ (S. 28).
Bei der Betrachtung der Charaktere Friedrichs und Heinrichs
hebt der Historiker den Kaiser als „Blüte des Mannestums“
hervor und unterstreicht, „von seiner Persönlichkeit ging ein
gewisser Zauber aus“. Demgegenüber macht sich Heinrich in den
Worten Wohltmanns beinahe schäbig aus. Als „stolz, ohne Humor,
starr, verschlossen und nachtragend“ (S. 29) wird er hier
beschrieben.
Die Entwicklung des Reiches unter dem symbiotischen Pakt der15
Vettern betrachtet der Autor im Folgenden als durchaus positiv,
wenn er auch auf Heinrichs Seite Rücksichtslosigkeit
durchschimmern lässt.
Bei dem Ereignis, das schließlich den Wendepunkt markieren
sollte, der Hilfeverweigerung des Löwen und die Niederlage des
Kaisers „weil sein Vetter ihn im Stiche ließ“ (S. 30), fällt
der Autor ins Spekulative und leicht Melodramatische. Den
Kniefall von Chiavenna, den wir als alles andere als gut
dokumentiert werten, sieht er „durch gute Quellen“ (S. 31)
belegt. Schließlich meint Wohltmann in der Betrachtung der
Folgeereignisse, dass der Löwe allein die Schuld trage: „Diese
Treulosigkeit führte zum Sturz von stolzer Höhe, führte zur
Zerreißung seiner Länder, vor allem zu der unseres
Niedersachsen, führte also zu einer deutschen Tragödie...“ (S.
31)
Geradezu überraschend anerkennt Wohltmann, dass Heinrich der
Löwe seinem Kaiser zur Heerfolge „rechtlich nicht verpflichtet
war“ (S.34), dennoch hebt er kurz darauf in kaum
wissenschaftlicher Weise und reichlich emotional hervor, dass
Heinrich in Chiavenna „den Mann, der ihn groß gemacht hatte“
(S.34) verriet. Die Ursachen für dieses so erscheinende
Fehlverhalten Heinrichs sieht der Autor nicht zuletzt in der
Einflussnahme nichtdeutscher Mächte, präzise gesprochen, der
englischen Landsleute seiner Ehefrau Mathilde. Sie werden als
„skrupellos, zuchtlos, machtgierig, kaiserfeindlich“ (Vgl. S.
33) dargestellt.
Am Ende bleiben für Wohltmann zwei Aspekte für die endgültige
Bewertung der Figur Heinrichs des Löwen. Zunächst die expansive
Politik im Osten, die mit folgenden Worten gerühmt wird: „...in16
dem Wiedergewinn des einst verlorenen deutschen Ostens. So
führt des Löwen Werk in die Zukunft.“ (S. 43). Demgegenüber
steht aber die positive Bewertung der Politik Friedrichs I.:
„Das Kaisertum in deutscher Hand war ein Schutz gegen
romanische Überfremdung.“ (S. 43), sowie die Ablehnung eines
aus nicht ersichtlichen Quellen geschlossenen Charakter
Heinrichs: „...dass Heinrich sich nicht mehr einfügte in den
Bau des Reiches.“ (S. 45). Schlussendlich fällt die Bewertung
des einstigen Herzogs vor allem zu Gunsten einer starken
Glorifizierung Friedrichs I. äußerst negativ aus, auf der Seite
der positiven Gesichtspunkte steht beinahe ausschließlich die
Landgewinnung im Osten.8
„Der sächsische ‚Staat‘ Heinrichs des Löwen“, in ‚Historische Studien’, Heft 302, von
Dr. Ruth Hildebrand, Verlag Dr. Emil Ebering, Berlin 1937
Bei der Arbeit über die Politik und die Landesherrschaft
Heinrichs des Löwen in Sachsen handelt es sich um ein äußerst
umfangreiches Werk mit einem breiten Spektrum an
Sekundärliteratur. Die Sprache ist äußerst sachlich, frei von
Polemik und mit wenigen nationalistisch-ideologischen
Einschlägen. Dennoch ist es weit davon entfernt, ein neutral-
wissenschaftlicher Text zu sein, denn es gibt keinen
kritischen, nicht einmal einen abwägenden Forschungsansatz, und
ein großer Teil der bereits vorab zum Ausdruck gebrachten
Wertung des Herzogs von Sachsen ist bereits im Vorwort
dargelegt. Mit Rückgriffen und Analysen auf eine enorme Anzahl
von Primärquellen versucht Dr. Hildebrand in neuer
8 Hans Wohltmann, Friedrich Rotbart und Heinrich der Löwe. 1. Aufl. Stade 1939.
17
Interpretation, besonders in direkter Antwort auf den
Historiker Ludwig Weiland (1841 – 1895), der die Politik
Heinrichs in Sachsen als ungesund für das Reich und als
„verzweifeltes Ringen um die Oberherrschaft“ (S. 7) in der
Interpretation der Historikerin darstellte.
Das Bild, das Frau Dr. Hildebrand von Anfang an nicht nur im
Bezug auf das von ihr näher behandelte Thema vertritt, ist ein
aus sich selbst heraus gerechtfertigtes positives. Zum Ende
ihres Vorwortes erklärt die Autorin klar, dass keine Bewertung
Heinrichs nach Abwägung der Resultate ihrer wissenschaftlichen
Arbeit ihr Ziel sei, sondern „ein festumrissenes positives Bild
von den politischen Zielen des Herzogs zu geben, [...], das
heute wieder im deutschen Volk lebendig zu werden beginnt, das
Bild eines großen deutschen Staatsmanns des Mittelalters.“ (S.
8). Im Vorwort finden sich die deutlichsten Anwendungen
nationalistisch orientierter Sprache mit wiederholten
Rückbezügen auf das deutsche Volk.
Ingesamt geht es Frau Dr. Hildebrand darum, das im 19.
Jahrhundert vertretene Bild Heinrichs des Löwen zu
modifizieren. Im Anschluss an praktisch jede Analyse einer
Quelle folg eine Schlussfolgerung zugunsten Heinrichs und
dessen positiver Interpretation: „Damit sind die Argumente, die
Weiland für seine stammesherzogliche Gewalt Heinrichs des Löwen
innerhalb des westfälisch-sächsischen Gebiets bis zur Weser
anzuführen versucht, erschöpft.“ (S. 27). Grade der
allgegenwärtige und absolute Widerspruch in jeder untersuchten
Quelleninterpretation lässt eine ungewöhnlich willkürliche
Arbeitsweise und dubiose Resultate vermuten. Wie gesagt finden
sich die klarsten Worte über Heinrich den Löwen zu Beginn des18
Textes, wo auch Städtepolitik und Eroberungsbestreben gelobt
werden:
„Die Gestalt Heinrichs des Löwen, [...], beginnt heute endlich
wieder im deutschen Volke lebendiger Anteilnahme und
Bewunderung zu begegnen. Jetzt sieht man den Herzog nicht mehr
mit den Augen des Staufers als den ungetreuen Vasallen, der
seinen Lehnsherrn um seiner eigensüchtigen Ziele willen in der
Stunde der Gefahr im Stich ließ, sondern man verehrt ihn als
den ersten großen Vorkämpfer einer spezifisch deutschen
Staatsidee, [...]“ (S. 7). Im Hinblick auf Dr. Hildebrands
Arbeitsweise scheint sie selbst ganz persönlich auch eine
Anhängerin besagter Staatsidee zu sein, ohne dass dies explizit
genannt wird. Im letzten Zitat wird allerdings deutlich, dass
der Verrat am Kaiser, der in dieser Arbeit vorab als
Scheidepunkt der Interpretation zur Person Heinrichs vermutet
wird, in diesem Werk gar nicht erst zur Diskussion kommt,
sondern nicht einmal als möglich in Betracht gezogen wird. Wir
finden in Frau Dr. Hildebrands Text also ein extrem positives
Bild Heinrichs des Löwen, ohne dass es unter dem Einfluss
jeglicher Erörterung entstanden wäre. Allerdings wird es, im
Vergleich mit anderen Arbeiten, auch nur bedingt in direkte
Verbindung zum nationalsozialistischen Gedanken gesetzt.9
„Heinrich der Löwe – Seine Stellung in der inneren und in der äußeren Politik
Deutschlands, Richard Schmidt, Verlag R. Oldenbourg, München/Berlin 1936“
Richard Schmidt beginnt seine Ausführungen über den
Welfenherzog mit der Öffnung seines Grabes und der
9 Ruth Hildebrandt, Der sächsische „Staat“ Heinrichs des Löwen. (Historische Studien, Heft 302) 2. Aufl. Vaduz 1965.
19
Umbaumaßnahmen im Dom zu Braunschweig. Er gibt vor, eine seiner
Meinung nach wichtige Persönlichkeit der deutschen Geschichte
endlich zweifelsfrei definieren zu wollen, denn ein „...Urteil
steht noch nicht fest.“ (S. 2). Im Gegensatz zu dieser Aussage
hat die behandelte Figur bei Schmidt gleich von Beginn an den
Status einer unbestreitbaren Heroenfigur: „...die heldenhafte,
aber problematische Persönlichkeit des starken Welfen...“ (S.
2). Nicht einmal in Zweifel gezogen werden in Herrn Schmidts
Werk weder die Person Kaiser Friedrichs, noch seine Politik und
ein Urteil über Heinrich den Löwen soll letztendlich nur anhand
eines Abgleichs mit seinem Verhalten in Relation zu seinem
Vetter gewonnen werden. Dabei ist die Streitfrage für den Autor
keineswegs, wie man vermuten könnte, die, ob Heinrich nun als
Landesverräter auf die Teilnahme einer Heerfahrt in Italien
verzichtete, oder ob er dies aus Gründen der Konzentration auf
seine Aufgaben im eigenen Herzogtum geschah. Als Ausgangspunkt
seiner Erörterung stellt Schmidt die Position einiger
Historiker, die in Heinrich einen generellen Gegner der
expansiven Italienpolitik sahen, und in seiner Verweigerung der
Teilnahme einen Beweis für seinen Status als „Märtyrer seiner
Idee“ zu erkennen glaubten. Jene schätzen also eine
deutschnationale Interessenverfolgung für Heinrich nicht nur
für ihn selbst, sondern für das gesamte Reich ein. Dieser
Position widerspricht Schmidt von Anfang an, ohne dabei aber
Heinrich als Verräter am Kaiser zu deklarieren, was vielleicht
die zu erwartende Reaktion war. Im Gegenteil erklärt er, sein
Ziel sei lediglich, zu beweisen, dass Heinrich kein Gegner der
Italienpolitik war. Dass ein solches Ergebnis die Frage
aufwürfe, weshalb der Herzog dann nicht mit dem Kaiser zog,20
lässt er außer Acht, den „...ein nationaler Held bleibt er...“
(S. 3). So ist in keinem Moment dieses Werk eines, das die
Entscheidung über Heinrich im Schlechten oder im Guten sucht.
Die generelle Rühmung Heinrichs liegt in den wiederholt
angeführten Argumenten: „...offenkundige Großtaten wie die
Rückgewinnung großer Teile unserer ursprünglichen germanischen
Nationalsitze, [...], Germanisierung, [...]
Christianisierung...“ (S. 2). Die Kritik an Heinrich ist
allerdings ebenso bekannt wie präsent, ohne dass sie zu einer
negativen Beurteilung führte: „...Tatenlosigkeit da, wo es
nottat, zu handeln – vor allem [...] auf dem lombardischen
Kriegsschauplatz, als seine Verweigerung der Heeresfolge den
großen Stauferkaiser den Feinden preisgibt.“ (S. 2). Im Bezug
auf Friedrich I. werden beide als „Nebenbuhler“ (S. 3)
beschrieben, wobei es keine Kritik an Friedrich gibt:
„...Herrscher, der willensstark, weitblickend und von
persönlichem Reiz [...] ist...“ (S. 8) und das Verhältnis der
beiden bis zum Jahr 1167 als bestimmt durch „...gegenseitiges
Vertrauen im politischen Zusammenarbeiten.“ (S. 8)
interpretiert wird.
Einen positiven Aspekt der gesamten welfischen Familie gewinnt
Schmidt der Vermischung der Linie mit einer norditalienischen
Adelsfamilie ab, die von seinem Kollegen Wahl so abgewertet
wurde: „...ein schillernder, fremdartiger Zug haftet seitdem
auch der deutschen Linie an.“ (S. 6).
Die Entscheidung in der Streitfrage fällt letztendlich darauf,
dass eine mögliche Gegnerschaft Heinrichs zur Italienpolitik
Friedrichs rigoros von der Hand gewiesen wird. Der finale große
Kritikpunkt, der Heinrich dennoch nicht den Anspruch auf21
Verehrung kostet, liegt laut Schmidt im Einfluss besonders der
männlichen Mitglieder der Familie seiner zweiten Ehefrau
Mathilde von England, insbesondere im Charakter seines
Schwiegervaters. König Heinrich II. empfängt eine
Charakterisierung eines Mannes mit „Metzgergesicht“ (S. 24),
den „...zynische Machtpolitik, [...] ungehemmte Geldgier, [...]
Tatenhaftigkeit, [...] zügellose Sinnlichkeit“ (S. 24/25)
ausmachten. Als Verhängnis für Heinrichs, das ein
„instinktmäßiges Abrücken“ von „ernster Herrscherpflicht und
bedachter Regierungsweise des Staufers“ (S. 26) bedeutete,
stellt Schmidt diese Einflussnahme dar: „Dies also ist der
Geist des Hauses, das künftig in der Umwelt Heinrichs des Löwen
ganz naturgemäß eine Rolle spielt.“ (S. 26).
Trotz aller Kritik an Heinrich, sei sie ihm selbst angelastet
oder auf äußere Einflüsse zurückgeführt, bleibt der
Welfenherzog in den Augen Schmidts verehrungswürdig, auch im
Sinne deutschnationaler Ideologie, die in seiner Wertung zu
Tage tritt. Besagter Anspruch auf Verehrung wird vom Autor zu
keinem Zeitpunkt in Frage gestellt, allerdings ist es trotz
einer tatsächlichen Fixierung des Blickwinkels auf Heinrich den
Löwen erneut Kaiser Friedrich, der als makel- und fehlerlos
bewertet wird. 10
„Heinrich der Löwe – eine politische Tragödie in Deutschland, Hanns Martin Elster,
Hoffmann und Campe Verlag, Hamburg 1940“
Dieses Werk Elsters, das zu den umfangreichsten und am
häufigsten zitierten zählt, darf als auch wegen dieses Status’
10 Richard Schmidt, Heinrich der Löwe. Seine Stellung in der inneren und der auswärtigen Politik Deutschlands. 1. Aufl. München/Berlin 1936.
22
als Standardwerk nicht aus dieser Analyse ausgeklammert werden.
Trotz der offensichtlich minuziösen Arbeit Elsters, besitzt
sein Buch schlussendlich wenig wissenschaftlichen Wert. Es
enthält die stärkste und am Meisten durch mehr als zweifelhafte
Ideologie verzerrte Glorifizierung Heinrichs des Löwen unter
Einbezug nahezu polemischer Aussagen und Thesen über den
Welfenherzog, die jede wissenschaftliche Grundlage vermissen
lassen. Dabei äußert auch Elster zu Beginn seines Werkes den
Wunsch, eine Richtigstellung des Bildes Heinrichs des Löwen
versuchen zu wollen, wobei allerdings von Anbeginn an noch
deutlicher als bei manchen seiner Kollegen hervortritt, dass
dies nicht unter dem Blickwinkel wissenschaftlicher
Objektivität geschehen soll. Schon im Vorwort wird Heinrich ein
„großer deutscher Staatsmann“ (Vgl. S. 9) genannt, und auf den
nächsten Seiten folgen schon die direkten Vergleiche des Löwen
mit dem Kaiser, wonach Heinrich „für das Deutschtum zuletzt
mehr geleistet hat, als die Staufer mit ihrer Italienpolitik“
(S. 12). Obgleich im weiteren Verlauf auch der Kaiser durchaus
positive Wertung erfährt: „der Kaiser wie der Herzog, die sich
als politische Genies und menschliche Persönlichkeiten
gleichwertig sind [...]“ (S. 26), „die Gerechtigkeit des
Kaisers und die maßvolle Zurückhaltung des Löwen“ (S. 86/87),
so erscheint er auch in der Bewertung seiner Politik neben
Heinrich dem Löwen als die deutlich negative Figur.
Elster nimmt für sich und seine Generation in Anspruch, die
ersten zu sein, die eine tatsächliche Berechtigung zur
Bewertung Heinrichs hätten, da man erst jetzt „den endgültigen
Maßstab dafür habe“ (S. 19): „Deutsche Geschichte kann nur noch
um des deutschen Volkes Willen geschrieben werden“, „der23
Maßstab ist [...] das rassisch gesehene, also nordisch
bestimmte Volk!“ (S. 19). Auf welch simple Art also die noch
anstehende Untersuchung der Figur Heinrichs des Löwen
ideologische Verzerrung erwarten sollte, steht auf derselben
Seite kurz und endgültig: „Was dem deutschen Volke nützte hat
positive Bedeutung, was im schadete, negative Bedeutung“. Der
Autor kommt mehrfach in seinem Werk auf einen direkten
Vergleich mit Adolf Hitler und Heinrich dem Löwen, da „allein
die Führeridee unserm Blute entspricht“ (S. 20) und weil erst
„mit der Revolution von 1933“ (S. 373) eine korrekte
Betrachtung möglich sei: „Der Führer unserer Gegenwart stellte
den Führer aus dem Mittelalter neu vor uns hin“ (S. 373).
Elster kritisierte nahezu paradoxerweise die Subjektivität vor
ihm arbeitender Autoren, besonders diejenigen, die die Figur
des Kaisers der des Löwen vorzogen. In seinen Augen wies die
Italienpolitik des Staufers in die Vergangenheit, eine direkte
Gegenüberstellung beider Weltansichten kommt zu folgendem
Ergebnis: „der Blick des Löwen nach dem Norden war von
germanischer Art geführt, der Blick des Staufers [...],
jüdisch-christliche Weltanschauung“ (Vgl. S. 220), dazu kommt
die Einschätzung, dass „der Kaiser nicht den Weg der Einheit
ging“ (Vgl. S. 25) und „mit seiner Weltreichpolitik ins Maßlose
vorstieß“ (S. 167), während „der welfische Staat der deutsche
Staat hätte werden können“ (Vgl. S. 13) weshalb „Heinrich der
Löwe damit in die Riege der Schöpfer unseres großdeutschen
Reichs gehört“ (Vgl. S. 21).
Während also der Kaiser in der Analyse der Politikstile
deutlich negativ dasteht, gibt es erheblich positivere Worte in
der Beschreibung des Verhältnisses zwischen beiden Vettern:24
„Heinrich fügte sich stets willig dem Urteil des Kaisers“ (S.
99), „Heinrich der Löwe [...] hat niemals seine Kaiserspflicht
verletzt“ (S. 113), außerdem sei er „des neuen Königs [...]
erster Freund“ (S. 155) gewesen. Auch diese positiven
Gesichtspunkte werden eher Heinrich als Friedrich
gutgeschrieben. Dennoch wurde Elsters Ansicht nach „im Prozess
gegen Heinrich den Löwen nicht Recht gesprochen, sondern
Politik gemacht“ (S. 253), da Friedrich „den Löwen vernichten
wollte“ (Vgl. S. 263) und daher „einzig und allein [...]
schuldig zu sprechen ist“ (Vgl. S. 21), da er es war, „der
Deutschland verriet, indem er den Welfen niederschlug.“ (S.
21).
Gemäß der bereits zitierten von Anfang an in diesem Werk
geltenden Prämisse der Bejahung all dessen, was dem Deutschtum
förderlich gewesen sei, wird von Elster ein erheblich positives
Bild des Welfenherzogs gezeichnet. Jener, der so sehr zu starke
Subjektivität andere Autoren kritisiert hat, ist in der Tat
derjenige, dessen Arbeit am stärksten durch selbige
beeinträchtigt wurde und deshalb in weiten Teilen eher auf
ideologischer Polemik denn auf Tatsachen und Fakten beruht.
Elster ging sogar so weit, den mittelalterlichen Quellen
zugunsten der volkstümlichen Überlieferung und Mythenbildung
einen geringeren Informationswert zuzubilligen, da erstere
„urewige Wahrheiten, durch die ein Volk und ein Volkstum
bestehen“ (S. 21) beinhalteten. Für die Analyseziele dieser
Arbeit ist dieser Text sicher einer der ergiebigsten und
aufschlussreichsten, nicht nur für das primäre Ziel der
Extrahierung eines Personenbildes des Mittelalters, sondern
auch für die Aufdeckung der damaligen Herangehens- und25
Arbeitsweisen.11
„Heinrich der Löwe – im Urteil der deutschen Geschichtsschreibung von seinen
Zeitgenossen bis zur Aufklärung, Dr. Phil. Ursula Jentzsch, Verlag von Gustav Fischer
in Jena, 1942.“
Frau Dr. Jentzsch ging interessanterweise mit einem ganz
ähnlichen Vorsatz an die Bearbeitung ihrer Materialien, wie er
auch dieser Arbeit zugrunde liegt. Epochenspezifisch extrahiert
sie jeweils ein anderes Bild des Welfenherzogs aus den
jeweiligen Quellen, wobei Entsprechungen zwischen den einzelnen
Resultaten nicht überraschend sind. Das Vorwort für diese
Arbeit lieferte Prof. Dr. Friedrich Schneider, dessen eigenes
Werk „Neuere Anschauungen der deutschen Historiker zur
Beurteilung der deutschen Kaiserpolitik des Mittelalters“ von
1934 nur deshalb keinen Eingang in diese Arbeit fand, da es
lediglich eine Zusammenstellung verschiedener Arbeiten anderer
Historiker darstellt, und überdies Heinrich der Löwe trotz des
vielfachen Bezugs auf Friedrich Barbarossa nur sehr sporadisch
erwähnt wird.
Auf der Höhe ihrer Macht und zum Zeitpunkt, zu dem wir eine
maximale Kontrolle des Publikationssektors durch die
Nationalsozialisten voraussetzen können, präsentiert Frau Dr.
Jentzsch ein Werk von großer Objektivität und hohem
analytischem Wert. Die Synthetisierung mehrer in Kontrast
stehender Bilder Heinrichs des Löwen geschieht mit sehr
direktem Quellenbezug und beinahe ohne Stellungnahme der
Autorin. Die Motive der Historikerin sind bereits zu Anfang
11 Hanns Martin Elster, Heinrich der Löwe. Eine politische Tragödie in Deutschland. 1. Aufl. Hamburg 1940.
26
klar umrissen. In der Arbeit ging es darum, von Heinrich dem
Löwen „seine Größe festzuhalten, die Schattenseiten seines
Charakters und Handels nicht zu verbergen“ (S. 5) und man
positionierte sich klar und weitsichtig zu jener bewussten oder
unbewussten Herangehensweise anderer Autoren, entweder den
Staufer oder den Welfen positiver darzustellen. Laut Vorwort
ist es falsch „die Formel Barbarossa o d e r Heinrich
aufzustellen“ (S. 5). Bei der Beurteilung anderer Werke werden
die Autoren noch in der Einleitung präziser und geben mit der
Kritik Arthur Diederichs am hier bereits behandelten Buch Hanns
Martin Elsters ein Beispiel für eine von ihnen kategorisch
abgelehnte Arbeitsweise: „blinde Glorifizierung des
Welfengeschlechts auf Kosten des staufischen [...] drücken
jeder Seite des Elsterschen Buches seinen parteiisch gefärbten
Stempel auf“ (S. 6). Wir dürfen diese Formulierung in einem so
zeitnah verfassten Text als scharfe Aburteilung werten.
Die von Dr. Jentzsch entwickelten Bilder Heinrichs des Löwen
überzeugen durch nüchterne Klarheit. Seine Zeitgenossen
erkannten demnach seine große Macht an (Vgl. S. 15), im
Spätmittelalter diagnostiziert die Autorin Mythenbildungen und
ein dominantes Welfenbild aus nordischen Texten (Vgl. S.
16/17). Im Urteil der Gegenreformation sieht Jentzsch eine
positive Beurteilung des Löwen durch die Katholiken, eine eher
dem Kaiser zugeneigte auf Seiten der Protestanten (Vgl. S. 37).
In der landesherrlichen Geschichtsschreibung sieht die Autorin
Leibnitz’ positives Welfenbild als vorherrschend, in der
Aufklärung unter starkem Unverständnis über die Kaiserpolitik
in Italien steht er ihrer Meinung nach noch besser da (Vgl. S.
54). 27
Schlussendlich erfolg dann doch eine Bewertung des Löwen, oder
wenigstens eines Aspekts seiner Politik, ohne dass ihr eine
andere Quelle zugrunde gelegen zu haben scheint: „Er trug somit
dazu bei [...] andere Teile Deutschlands an sich zu ziehen und
aus seiner Kraft heraus, ein neues Deutsches Reich zu schaffen“
(S. 56).
Trotz dieses Ansatzes einer Positionierung formuliert die
Autorin zum Schluss eine Stellungnahme zur Bewertung Heinrichs
des Löwen, die dem hohen wissenschaftlichen Wert ihres Buches
entspricht: „Wir würden uns um einen guten Teil ärmer machen,
wollten wir einen von ihnen preisgeben, weil wir ihm mit
unseren heutigen Maßstäben messen.“ (S. 60). Dieses Wort geht
gegen die Parteiergreifung zugunsten des Staufers und des
Welfen und zeigt die Unmöglichkeit, Heinrich den Löwen (oder
Barbarossa) nach zeitgenössischer Prämisse zu beurteilen, sowie
es alle anderen Autoren schließlich tun.12
Schluss:
Lässt sich im Wandel der Zeit eine Veränderung des Bildes Heinrichs des Löwen
feststellen?
In den zuvor untersuchten Werken lässt sich kein besonderes, an
ihre Entstehungszeit gebundenes Darstellungsmuster erkennen.
Alle Werke entstanden in dem relativ knappen Zeitraum zwischen
1937 und 1942 und man kann keinerlei Bruch in den Intentionen
oder Arbeitszielen, noch in den Ergebnissen der Autoren
feststellen. Dieselben negativen wie positiven Aspekte fanden
12 Friedrich Schneider (Hrsg.), Beiträge zur mittelalterlichen, neueren und allgemeinen Geschichte. (Band 11) Jena 1942. Ursula Jentzsch, Heinrich der Löwe. Im Urteil der deutschen Geschichtsschreibungvon seinen Zeitgenossen bis zur Aufklärung. Jena 1942.
28
in den frühesten Werken wie auch noch im neuesten Einzug, sowie
das Abwerten seiner Familienverbindungen ins Ausland oder die
fast immer als positiv interpretierte Eroberungspolitik im
Osten. Das jeweilige Resultat scheint lediglich durch
persönliche Motivationen zugunsten des einen oder des anderen,
nüchterner oder radikaler, mit dem Schwerpunkt auf diesem oder
jenem Aspekt ausgefallen sein.
Sowie es keinen Bruch gab, bemerkt man auch keine schleichende
Veränderung. Keines der Werke ist eine direkte Antwort auf ein
anderes, obwohl Rückbezüge und Vergleiche durchaus vorkommen.
Wenn im Sinne oder gegen den Sinn eines anderen Werkes
gearbeitet wurde, so handelte es sich eher um eines aus einer
vergangenen Epoche der Geschichtsschreibung. Somit sind die
verschieden motivierten Bilder Heinrichs des Löwen nicht an die
politischen Bewegungen ihrer Entstehungszeit geknüpft. Gibt es
bemerkenswerte Differenzen, so könnten nur die Autoren selbst
erklären, was sie zu der einen oder anderen Interpretation
bewogen haben mag, allerdings geschieht das an keiner Stelle
und nie wird es in Zeitbezug gesetzt.
Gab es eine Positionierung der historischen Figur Heinrichs des Löwen im Sinne der
NS-Ideologie?
Auch bei der Antwortfindung auf diese Frage muss immer im
Hinterkopf behalten werden, dass es kein homogenes Bild aus den
behandelten Texten gibt. Die verschiedenen Bilder sind von den
individuellen Schwerpunkten der Autoren und ihrer Selektion von
Fakten und Deutungen abhängig. Natürlich kann man zu jeden Werk
nach eingehender Betrachtung sagen, ob seine Ergebnissuche im
Sinne nationalsozialistischer Ideologie verläuft oder nicht,29
und so ist das erste Ergebnis, dass es von beiden Typen
Exemplare gab, wobei die NS-Ideologie doch in der Mehrzahl der
Werke entscheidend hervortritt. Die sachlichsten und am
wenigsten polemischen Arbeiten sind die von Frau Dr. Jentzsch
und von Frau Dr. Hildebrandt, bei beiden gibt es
quellenorientierte Arbeit, allerdings tritt bei beiden auch der
positive Charakter der Konsolidierung Sachsens als eine Art
Kernland des Deutschen Reiches hervor und steht in diesem Sinne
doch in Verbindung mit der NS-Ideologie.
Ebenfalls von jener beeinflusst sind die scharfen Aburteilungen
der familiären Bande Heinrichs des Löwen nach England, die
besonders bei Schmidt und Wohltmann zum Tragen kommen.
Letzterer hebt besonders den von ihm als solchen
interpretierten Treuebruch des Herzogs gegen den Kaiser als
nicht mit der Ideologie vereinbar hervor. Bei allen Autoren
scheint das Bild Heinrichs des Löwen durch seine Eroberungen im
Osten deutlich an Positivem zu gewinnen.
Die besonders von Frau Dr. Jentzsch verurteilte Parteinahme für
den Staufer oder den Welfen geschieht in der Tat sehr häufig.
Beide Werke zum Stauferkaiser stellen ihn besser dar, und
obgleich Heinrich bei Richard Schmidt ein gutes Bild attestiert
bekommt, übertrifft ihn auch dort das seines Vetters. Friedrich
wird besonders wegen seiner Eigenschaften als Weltreichidealist
und Eroberer in Italien im Sinne nationalsozialistischen
Denkens glorifiziert. Im Bezug auf Heinrich den Löwen sind
insbesondere Hanns Martin Elster, der all das, was er zu seiner
eigenen Zeit als verehrungswürdig empfand, d.h. den gesamten
nationalsozialistischen Staat, bei Heinrich dem Löwen
wiederzufinden glaubt, und Dr. Wohltmann, der Heinrich dem30
Löwen einen auch im Sinne der Ideologie schlechten und
zerstörerischen Charakter als Gegner der Reichsidee zuschreibt,
hervorzuheben.
Es entsteht bei der Betrachtung aller Werke kein ebenmäßiges
Bild. Widersprüche, haltlose Behauptungen, emotionale und
ideologische Interpretationen, sachliche Analyse auf deutlicher
Quellengrundlage wechseln sich ab. Dennoch überwiegt der
Einfluss der nationalsozialistischen Ideologie in den
untersuchten Werken, sei es zu einer Überhöhung Heinrichs, wie
sie mehrmals vorkommt, zu einer Kaiser Friedrichs, wie sie
nicht minder oft geschieht, oder gar zu einer scharfen
Aburteilung des Welfenherzogs, die ebenfalls nicht wegzudenken
ist.
31
Literaturverzeichnis
Sekundärliteratur:
1. Arndt, Karl, Missbrauchte Geschichte: Der
Braunschweiger Dom als Politisches Denkmal 1935/45,
in: Jochen Luckhardt, Franz Niehoff, Gerd Biegel
(Hrsg.), Heinrich der Löwe und seine Zeit. Herrschaft
und Repräsentation der Welfen 1125 – 1135. (Katalog
der Ausstellung Braunschweig 1995, Band 3 Abteilung
Nachleben) München 1995.
2. Berndt, Friedrich, Dom und Burgplatz zu Braunschweig.
(Grosse Baudenkmäler, Heft 130) 1. Aufl.
München/Berlin 1950.
3. Ehlers, Joachim, Heinrich der Löwe. Europäisches
Fürstentum im Hochmittelalter. 1. Aufl. Göttingen
1997.
Quellen:
4. Elster, Hanns Martin, Heinrich der Löwe. Eine
politische Tragödie in Deutschland. 1. Aufl. Hamburg
1940.
5. Heimpel, Hermann, Kaiser Friedrich Barbarossa und die
Wende in der staufischen Zeit. (Strassburger
Universitätsreden, Heft 3), 1. Aufl. Straßburg 1942.
6. Hildebrandt, Ruth, Der sächsische „Staat“ Heinrichs 32
des Löwen. (Historische Studien, Heft 302) 2. Aufl.
Vaduz 1965.
7. Jentzsch, Ursula, Heinrich der Löwe. Im Urteil der
deutschen Geschichtsschreibung von seinen
Zeitgenossen bis zur Aufklärung, in: Friedrich
Schneider (Hrsg.), Beiträge zur mittelalterlichen,
neueren und allgemeinen Geschichte. (Band 11) Jena
1942.
8. Schmidt, Richard, Heinrich der Löwe. Seine Stellung
in der inneren und der auswärtigen Politik
Deutschlands. 1. Aufl. München/Berlin 1936.
9. Wahl, Rudolf, Kaiser Friedrich Barbarossa. 1. Aufl.
München 1941.
10. Wohltmann, Hans, Friedrich Rotbart und Heinrich
der Löwe. 1. Aufl. Stade 1939.
Anhang
1)
33
Anhang 1) und 2):
Friedrich Berndt, Dom und Burgplatz zu Braunschweig. (Grosse
Baudenkmäler, Heft 130) 1. Aufl. München/Berlin 1950.
Anhang 3) – 5):
Jochen Luckhardt, Franz Niehoff, Gerd Biegel (Hrsg.), Heinrich der Löwe
und seine Zeit. Herrschaft und Repräsentation der Welfen 1125 –
1135. (Katalog der Ausstellung Braunschweig 1995, Band 3
Abteilung Nachleben) München 1995.
36