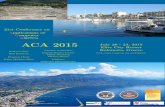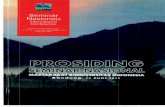Engelthaler Flurnamen. Engelthal, 2015
-
Upload
uni-marburg1 -
Category
Documents
-
view
4 -
download
0
Transcript of Engelthaler Flurnamen. Engelthal, 2015
Einführung
Zwei Engelthaler wollen sich zum Holzmachen treffen. Wie verabreden sie sich? „Da fährst du jetzt Richtung Sportplatz den Berg hinauf, aber vor dem Ortsschild links ab und auf die Schotterstraße, bis zum Wald, bei den großen Eichen rechts ab, vorbei am Parkplatz und am Verbotsschild, und da, wo rechts der große Wasserteich liegt, gehst du links in das Waldstück hinein“. So tun sie es gewiss nicht. Sondern sie sagen: „Wir treffen uns beim Resn“. Und egal, wo sonst ein Treffpunkt ist: Äilasdol zu sagen oder Hag, Haanghübbl oder Rainschlag, Ödes Schloss oder Aileh, das genügt meistens. Die Flurnamen sind entstanden, weil sie das Leben einfacher machen. Allerdings nur dann, wenn sie auch gepflegt werden. Sie zu pflegen, dazu will diese Liste einen Beitrag leisten.
Unbeabsichtigt erfüllen die Namen von Wiesen und Wäldern, von Wassern und Wegen einen zweiten Zweck: Sie erinnern daran, wie die Menschen einer Gegend in früheren Zeiten lebten. Im Fall unseres Beispiels hat man sich zunächst wohl so aus-gedrückt: „Wir treffen uns bei dem nassen Graben, in den man den Flachs zum Rösten legt (damit er schön rösch wird und wir einen feinen Stoff daraus weben können)“ – aber auch das ist umständlicher, als einfach „beim Rösten“ zu sagen, und in Dialekt-form: „beim Resn“. Irgendein lebenspraktisches Detail wurde zum Merkmal jedes Ortes, und wurde dann zum Namen. Manche Namen haben sich verändert, oder konnten sogar in Vergessenheit geraten. Solange aber ein Ort draußen immer noch bewirtschaftet wird, wird das kaum geschehen.
Ein dritter Wert stellt sich ein: Flurnamen verbinden uns mit unserer Heimat und ihren Bewohnern. Man hat sich mit Hilfe der Namen zum Spielen oder zum Arbeiten verab-redet, oder vielleicht mit seiner Liebsten… Manchmal können wir uns noch an den Menschen erinnern, der uns diesen oder jenen Namen das erste Mal gesagt hat, oder uns erklärt hat, wo wir diesen Ort finden.
Für mich selbst, und für manch anderen Liebhaber, haben diese Namen außerdem – viertens – einen Nebeneffekt: Sie machen Lust zu rätseln und sich auszumalen, was es mit den oft geheimnisvoll klingenden Namen auf sich hat. So soll diese Liste auch anderen Interessierten zu Gute kommen – so wie ich selbst oft von andern Listen profitierte
1. Die Begriffs-Suche der Internetsuchmaschinen hilft auch weiter und
macht uns vieles leichter als früheren Generationen, aber sie können nicht alles. Viele Einsichten kommen erst beim Blick in die Archive, etliche durch neugieriges Befragen der Bevölkerung, manche durch gesunde Skepsis gegenüber dem, was „geschrieben
1 Etliches hier verdankt sich den gründlichen Aufzeichnungen aus dem unveröffentlichten
Nachlass Herrn Heinrich Zillingers über die Flurnamen Pommelsbrunns, mit etlichen ähnlichen Flurnamen wie in Engelthal. In Wikipedia unter „Flurnamen“ finden sich nützliche Aufstellungen und Querverweise. Als allgemeine Wörterbücher dienten DRw, Grimme, Lexer und Kluge (s. Abkürzungsverzeichnis).
- 4 -
steht“. Denn das Aufschreiben eines Flurnamens hat im Lauf der Geschichte immer wieder zu seiner Veränderungen geführt.
Manchmal, gerade bei den Ortsnamen2, muss man sich außerdem eingestehen:
gewisse Dinge werden immer im Ungewissen bleiben. Sicher befinden sich noch Fehler in meinem Text. Ebenso Lücken: gerade die Namen von einzelnen Wiesen- und Feldstücken kennen meist nur deren Besitzer. Sie alle aufzunehmen, wäre zu viel geworden, wie beispielhaft auf der Karte III zum Maienfeld erkennbar wird. Anregungen und Ergänzungen sind jedoch willkommen!
Wer im Heft einen bestimmten Namen sucht, möge hinten im Namenregister nachsehen; dort erfährt man hinter dem Sternchen * das Kapitel, wo der Name besprochen wird. Der näheren Lagebestimmmung sollen die beigegebenen Karten dienen. Auf genaue Grenzziehung wurde aber verzichtet. Das würde eine zu große Herausforderung darstellen, zumal sich spätestens mit der Uraufnahme 1831 die Grenzen durch Vereinfachung immer wieder verschoben. Wer die Fluren einer bestimmten Gemarkung (Altgemeinde) sucht, findet sie mit Hilfe der Kürzel an den Seitenrändern (z. B. Se für Sendelbach oder Kr für Kruppach). Man kann aber auch einfach drauf los lesen, und dann im Register die Quellen nachprüfen.
In und um Engelthal habe ich auf meiner Suche nur wohlwollende und auskunft-bereite Menschen angetroffen. Ihnen sei für ihre geduldigen Mitteilungen ganz herzlich gedankt!
Engelthal, im Frühjahr 2015 Matthias Binder
Impressum
Matthias Binder, Engelthaler Flurnamen, Engelthal 2015, Eigenverlag.
Druck: GemeindebriefDruckerei, Groß Oesingen, auf umweltschonendem Papier.
Bilder: Titelfoto: vom Verfasser. Rückseite unter Verwendung von U (VAHb); Topografische Karte 25/6534 (LandesVA Bayern); Fa (StAN); Google Earth/GeoBasis DE/BKG; Fb (StAN). Ausschnitte S. 6: Stich von C. M. Roth, ca. 1760; Stich von A. Marx, ca. 1870.
Herzlich gedankt wird den Inserenten.
Der Reinerlös aus dem Verkauf dieses Hefts geht als Spende an den Förderverein zur Erhaltung der Klostermauer Engelthal e. V. Der Verfasser.
2 Ortsnamen werden nicht zu den Flurnamen gezählt, hängen aber mit ihnen zusammen und
werden daher in diesem Heft aufgenommen. Hierzu gibt es für unsere Region die Untersuchungen von Bacherler, Beck, Maas und v. Reitzenstein (hier nur Gemeindenamen); älter und auswärtig u. a. auch Bahlow, Gotthard und Schnetz (s. Abkürzungsverzeichnis).
- 5 -
Inhalt
1 Eine bunte Auswahl 7
a) Liers und Lüßäcker, b) Kaiser Karl, c) Aileh und Äilasdol, d) Stiegelwiesen und Point, e) Hirsch- und Aubächlein, f) Feller und Fennat, g) Boletten und Bienletten, h) Houastiedern, i) Bocksknoche
2 Namen, die auf Grenzen und Flurdenkmäler hinweisen 16
a) Rainschlag, b), Lachengräben, c) Todtenleite und Kreuzfleck, d) Auf der Marter
3 Namen aus Mittelalter und Klosterzeit 17
a) Mönchswiese, Frauental, Nonnenberg, Klosterau, Klosterberg und Hofwiesen, b) Lauterheffern, c) Geierstein und Ödes Schloss, d) Hammergasse, e) Schnobberlasdol, f ) Maienfeld, g) Vergessenes
4 Namen mit Bezug auf Wirtschaftsformen 22
a) Ochsen- und Hirstwiesen, Änger, Hut, Espan b) Egern oder Eggeten, c) Rösengraben und Wäschblei, Lehmgrube und Kohlenbuck, d) Wöhrwiesen und Pfarrersdümpfel, e) Brand, Schlag, Reuth und Ried, f) Weinleite, Kirschanger, Hanfacker, Hopfengraben, g) Krönweiher, Vogelherd und Tiergarten, h) Wolfsgarten und Schneckenvatter
5 Weitere Waldgebiete und Berge 30
a) Reschenberg und Hagenbuch, b) Fuchsloch, Zankholz und Gräibuers, c) Loh und Hag, d) Mühlschlag, e) Nonnenberg mit Brunnen und Platte, f) Glepflesberg, g) Hühnerschlag und Krönholz
6 Weitere Wiesen und Äcker 33
a) Sahrbühl, Soarbo, Lou und Schwemm; Kaltenbrunnen, Steinleite, Heckelgraben, b) Kessel, Hoch- und Langäcker, Kappenzipfel und Rögllöffel, Reswiese und Schottenanger c) Dammersdol und Balershoch, Boders- und Häberlashübbl, Schafferteichel und Lousn-Bergl d) Eckenbach, Reichelsbach und Brunnwiese, e) Sau-, Zau- oder Auwiese
7 Namen von Wegen 38
a) Kruppach, b) Prosberg, c) Engelthal, d) Peuerling, e) Sendelbach
8 Ortsnamen 40
a) Engelschalksdorf, b) Engelthal, c) Erdfallmühle, d) Hammerbachtal, e) Krönhof, f) Kruppach, g) Peuerling, h) Prosberg, i) Schweinach, j) Sendelbach
- 6 -
9 Beobachtungen zur Sprache 46
Flurnamenregister 51
zugängliche Namensformen durch die Jahrhunderte
Abkürzungen und Quellen 64
1. Urkunden, Salbücher, Karten; 2. Orte; 3. Archive; 4. Literatur
Karten Beilage
Blick auf Engelthal vom Hersbrucker Anger aus. Rechts hinten am Bildrand der Hagen-Hübbl. Stich von C. M. Roth, ca. 1760, Ausschnitt.
Blick auf das Engelthaler Untere oder Schmied-Tor von Westen. Vorn Vorrichtungen zur Wasserregulierung – Nachfolger eines einstigen Wehrs?
Stich von A. Marx, um 1870, Ausschnitt.
- 7 -
1 Eine bunte Auswahl
1a
E
Pr
Rätselhaft klingt der alte Name Liers3 - und was hat er mit den Lüßäckern zu
tun? Wer von der Engelthaler Hammerbachbrücke (Schafbrücke) in Richtung von Peuerling bergauf geht, hat zur Rechten den „Haang“, und ausdrucksstärker den „Haanghübbl“. Und man hat zur Linken die „Liers“, wie man früher noch öfter sagte. Dabei handelt es sich weder um ein Mädchen namens „Liese“, noch um ein Gelände, wo man sich mit „Lust“ aufhält
4, auch nicht um eine geologische
Bodenschicht, welche das Lias-Erdzeitalter vertritt5, und wohl auch nicht um
eine fruchtbare Bodenqualität namens „Löß“6. Sondern es handelt sich um
einen alten deutschen Namen für einen bestimmten Ort in vielen fränkischen Dörfern. „Liers“ meint einfach ein „Stück“ Grund für den allen offen stehenden Viehtrieb, wenn sie etwas abseits vom Dorf gelegen ist – schlicht „ein Anger“, wie die älteste Engelthaler Karte von 1565 unsere Liers nennt. Tatsächlich erzählen die Alten noch davon, wie das Vieh erst aus dem Dorf, dann durch den Bach und zuletzt beim Haang hier hinauf getrieben wurde. Erst nach dem Krieg wurde die „Liers“, die von einem beachtlichen Graben geteilt war, mit Schutt verfüllt, und es entstand hier die Adresse „Nonnenbergstraße“ mit neuen Anwesen. Woher kommt aber das Wort? Hier helfen uns die Prosberger Lüßäcker weiter, die östlich des Dorfs liegen. Vor Ort werden sie als „Liersäcker“ bezeichnet – also mit demselben Wort! Dass Lüß (hochdeutsch; auch „Liß“) und Liers (Dialekt) tatsächlich zusammengehören, dafür gibt es weitere Belege
7.
Letztlich kommt „Lüß“ von „Lose“ und meint aufgeteilte Flurstücke, welche, manchmal durch Losverfahren oder durch Versteigerung, zur Nutzung vergeben werden. Heute noch gibt es Holzlose, also Flächen, die man von der Gemeinde zum Holzmachen zugewiesen bekommt
8. Tatsächlich sind für unsere besproche-
3 Die Schreibweise mit „ers“ nicht nur in Liers (nach Zillinger), sondern auch (Grün)Buers, Stierl
und Waiern (s. u.) bedeutet nicht, dass hier jemals ein „r“ zu sprechen war, sondern meint den hellen und kurzen a-Laut nach Langvokal, sprich „Lias“ etc. 4 Weil neben „Lüß“ vereinzelt auch die Form „Lust“ auftaucht, hat man früher versucht, hier ein
Wortfeld „Lust, Liebe, Labung“ zu finden, und gemeint, „Liers“ bedeute „wo das Vieh sich labt“. Aber „Lust“ = „Lüß“ hat nichts mit „Lust“ = „Liebe“ zu tun. Alle veralteten Deutungen bei Zillinger. 5 Der veraltete geologische Begriff Lias wurde im 19. Jh. künstlich gebildet entweder aus dem
Französischen lie („Weinhefe“, nach Kluge, vielleicht weil auch sie sich in Schichten absetzt), oder dem Englischen layers („Schichten“, nach Wikipedia). Er bezeichnet ungenau die Schicht des Schwarzen Jura vor knapp 200 Millionen Jahren. Die Engelthaler Liers liegt zufällig etwa auf gleicher Höhe wie das geologische Lias, nicht aber die Liers anderer Dörfer. 6 „Löß“ als geologischer Begriff wurde erst im 19. Jh. geprägt (vgl. Wikipedia zum Stichwort).
7 Zillinger mit vielen Bsp. für „Lüß“ und Liers“, manchmal eindeutig für dieselbe Flur.
8 Zu „Los“/„Luß“ (Pl. „Lüß“) als altem deutschen Rechtsbegriff s. DRw.
- 8 -
E
nen Fluren auch die Formen „Loos“/„Loes“ überliefert. Es konnte sich entweder um Gemeindegrund handeln, welchen mehrere anteilig und zeitweise nutzen durften: so war es offenbar bei der Engelthaler Liers. Oder der Grund wurde endgültig in Stücke aufgeteilt: so die Prosberger Lüßäcker. Allerdings muss man sagen, dass sich bei Prosberg noch die Bedeutung „Lößboden“ hinzugesellt. Die eigentlichen Lößböden sind zwar im Süden Bayerns. Aber leichte Anflüge von Löß gibt es auch auf unseren Jurahöhen
9. Und in Prosberg weiß man, dass der
Boden gut ist. Zur „Nachbarin“ der Engelthaler Liers sei noch angefügt: Trotz der steilen Lage, die schon bei C. M. Roth um 1760 abgebildet ist (s. o. S. 6), meint Haang hier keinen Hang, sondern den Familiennamen Hagen, auf fränkisch ausgesprochen. Den Namen trug einer der seit dem 18. Jh. dort im „Fallhaus“ wohnhaften Engel-thaler „Faller“. Das sind die Abdecker, auch Schinder genannt, die „gefallene“ (tote) Tiere vollständig weiter verwerteten. Ihre Tätigkeit fand offenbar immer am Anger außerhalb des Dorfs statt. Tatsächlich wird aus dem 16. Jh. eine weitere Liers überliefert, die Schundtleiß als eine Flur beim Hagenbuch. Also wiederum von „schinden“
10! „Leiß“ (besonders, falls „Läiß“ gesprochen) klingt
eher fränkisch als „Liers“, was geradezu bairisch wirkt11
.
1b E
Kr
Der Name des Kaiser Karl ist an sich leicht verständlich. Warum heißt aber ein Wald so? Dies erklären sich viele dadurch, dass Kaiser Karl IV (damals eigentlich noch König Karl), nachdem er das Kloster Engelthal um 1350 besucht hatte, durch diesen Wald in Richtung Prosberg weitergereist sei. Das ist nicht unsinnig, denn man könnte sich vorstellen, dass er auf dem Weg von oder nach der Burg Reicheneck via Deckersberg war, oder der Hochstraße via Breitenbrunn. Man reiste gern auf der Höhe. Das ist aber Spekulation. Das Kuriose an diesem Namen ist vor allem, dass die alten Engelthaler und Kruppacher Unterlagen, die diesen Wald vermerken – und zwar seit dem 16. Jh. –, ihn meines Wissens nie „Kaiser Karl“, sondern immer Holz am Prosberg nennen. Nur die heutigen Grundbesitzer verwenden ganz selbstverständlich den adeligen Namen. Das bedeutet entweder, dass die Bevölkerung den königlichen Besuch dieses Waldes durch die Jahrhunderte hindurch mündlich überlieferte – oder aber, dass in der neueren Zeit ein romantischer Hobby-Forscher nachträglich die Idee hatte, den Wald so zu benennen, und dafür viele Nachahmer fand. Übrigens ist die Engelthaler Nonne Christina Ebner die einzige, von der wir etwas über den Besuch Karls erfahren (nichts über den Reiseweg). Die sieben Urkunden, die Karl
9 Freundliche Auskunft von Herrn Werner Wolf, Ottensoos.
10 Vgl. auch noch den „Schelmanger“ (s. den Kruppacher „Kessel“) und fast gleichlautend den
„Silmanger“ (Ochsenanger in Sendelbach) mit derselben Funktion. Vom letzterem ist bekannt, dass man Tierkadaver auch eingrub. 11
Vgl.: hochd. „Füße“ <> fränk. „Fäiß“ <> bair. „Fiaß“. Dazu s. u. den Abschnitt zur Sprache.
- 9 -
zu Gunsten von Engelthal ausgestellt hat, sind dagegen allesamt in Nürnberg verfasst worden: sie sind kein Beweis für seinen hiesigen Aufenthalt.
1c Se Kr
Se
„Aileh“ (Eilach) und „Äilasdol“ (Erlental) – das sind zwei Namen aus Sendelbach und aus Kruppach, die womöglich dasselbe bedeuten. Wer den Wanderweg von Engelthal nach Sendelbach geht, kommt durch das bezaubernde Wäldchen namens Aileh. Sein Name hat weder mit einem Ei noch mit einer Eule etwas zu tun. Und oberhalb Kruppachs, fast hinten im Talwinkel, liegt das nicht minder idyllische und stille Äilasdol. Und dieser Name hängt mit Erlen nur indirekt zusammen; „Erlental“ ist wohl ein nachträgliches Kunstwort. Am einfachsten beginnt man mit dem Ursprungswort, der „Aue“: Eine Aue ist eine feuchte Niederung, mit Bach und mit Auwaldgewächsen wie zum Beispiel tatsächlich der Erle. Zunächst zum Aileh: Im Jahre 1408 hielt eine Urkunde fest, dass der Besitz einer Flur „Ewllech“ von Henfenfeld nach Engelthal überging. Es dürfte sich um dieselbe Flur handeln. Denn was damals als „Ewll“ geschrieben wurde, würde heute hochdeutsch „Äuel“, im Dialekt „Ail“ ausgesprochen werden. Und das ist wiederum die einfache Form von „Äulein“
12, „Kleine Au“. Gab es wirklich eine
solche? Ja: eine Wiese „Clain aw“ ist schon 1312 im ersten Salbuch (Besitzbuch) Engelthals vermerkt; das Kloster erhielt jährlich Erlöse aus der Heuernte auf dieser Wiese
13. –Nun hat auch der zweite Teil des Wortes Ewllech ein
Bedeutung: –ech, hochdeutsch oft –ach14
, und im hiesigen Dialekt –eh, kommt in diesem Fall von –eich. Es bedeutet Gehölz im Sinne von Wäldchen, aber letzteres Wort kannte man früher gar nicht. Man kannte aber das neutralere Wort „Holz“, was an sich sinnvoll ist: denn ein „Eich“ kann ja ursprünglich nur ein Wald mit vorwiegend Eichen gewesen sein, so wie es andererseits auch ein „Tann“ aus Tannen gibt oder ein „Buch“ aus Buchen. Dass unser –ech so gemeint ist, lässt sich im Pfinzingatlas nachweisen. Paul Pfinzing zeichnete 1594 an der gefragten Stelle tatsächlich ein „Holz“ ein; er nannte es aber „Säulholz“. Wieso das? Weil er versuchte, es so niederzuschreiben, wie die Sendelbacher es aussprachen. Er hörte offensichtlich „’sAilech“ (aus „es Ailech“, „das Äuel-Eich“), und schrieb „Säul-Holz“ statt „Äul-Holz“ hin
15. Lange habe ich beim Betrachten
12
Die Verkleinerungsform -l ist sogar ursprünglicher als die Form -lein. Ein „Äule“ fand ich noch als Flur bei Vaduz, als Ortsnamen im Südschwarzwald, als Straßennamen in Ingolstadt („Erleulerstraße“) und Nürtingen („Im Äule“). 13
Über „clain aw“ (1312), „Ewllech“ (1408), „Aileh“ (heute) hat der Verfasser einige Jahre lang getrennt nachgedacht. Die Zusammenfindung der Wörter erfolgte in einem nächtlichen Traum. 14
Wenn also ein Flurname unserer Region auf -ach endet, ist damit oft nicht eine Ach im Sinne von Bach gemeint wie etwa bei Schweinach (s. u.). Beispiele für -ach (althochd. –ahi) bei Gotthard. 15
Fast genauso schrieb es dann Seutter in seiner Karte („Seulholtz“), die aber im Wesentlichen einfach die Pfinzigkarte kopiert.
- 10 -
Se
Kr
Pr
Kr
Kr
der Pfinzing-Karte nach dem Sinn eines Waldes mit Säulen oder auch kleinen Sauen gesucht. Aber weil Pfinzing mit seiner Schreibweise allein dasteht, dürfen wir unterstellen, dass ihm der Fehler unterlief, den Artikel mit dem Wort zu verschmelzen, und nicht dass alle anderen falsch lagen. Solchen Ver-schmelzungen werden wir noch öfter begegnen. Es wurde also aus dem „Holz bei der kleinen Aue“
16 ein Äuel-Eich, dann Ewllech,
Eulach oder Eilach, heute „Aileh“. Und gemeint ist immer das ganze Wäldchen, nicht der feuchte Bachgrund allein. – Ein langes –eh, also ursprünglich –eich, gibt es noch sehr oft in Sendelbach, in eigentlich widersprüchlichen Bezeichnungen: Birkeh, Irleh, Aschpeh und Soleh, also Birk-Eich/Birkach in Richtung Henfenfeld; Erl-Eich/Erlach bachabwärts; Esp-Eich/Espach in Richtung Engelthal
17; Salweiden-Eich/Sallach Richtung Rüblanden
18. Vergleiche auch das
Danneh nördlich von Kruppach. Letzteres wird heute Tannig geschrieben, früher aber Dornig und Dornych. Beides würde im Dialekt praktisch wie Tannig ausge-sprochen, und daher können beide Schreibweisen richtig sein. Damit ist unklar, ob früher viele Tannen oder – den älteren Formen nach – Dornen in diesem Wald wuchsen
19. Vergleiche auch das Prosberger Knocheh (s. u.). Gar doppelt
gemoppelt ist Aicha aus Aicheych (abgegangen bei Offenhausen). Nun kommen wir zum Kruppacher Äilasdol, welches in den modernen Karten „Erlental“ geschrieben wird. Erlen heißen aber im Dialekt „Irla“, nicht „Äila“. Auch in den alten Einträgen finden wir kein Erlental, sondern nur um 1700 einen Erlsteig und einen Erlacker, und noch früher eine Wiese „im Erlach“, aber ohne Lagebeschreibung. Heute wird der untere Abschnitt am Kruppacher Kaltenbrunnen als Irlgraben benannt. Wir wissen nicht, worauf sich die „Erlen“-Flurstücke von 1700 beziehen: auf den Kaltenbrunnen oder das Äilasdol. Egal nun, ob das Äilasdol einst auch Erlental hieß: die beiden Wörter gehören sprachlich nicht zusammen. Am einfachsten lässt sich „Äila“ wieder als „Äuelein“ erklären. In Sendelbach würde es „Aila“ heißen, aber in Kruppach hören wir statt „ai“ normalerweise „äi“ (bestes Beispiel: „fäi“ statt „fai“
20). Wir
haben ein „Äueleins-Tal“ vor uns. Da aber in einem solchen Tal Erlen typisch sind, ist auch die moderne Namensform „Erlental“ berechtigt.
16
Zwar ist „Kleine Aue“ eine Wiese, „Ewllech“ eine Gehölz; die Fluren unterschieden sich also. Aber beide bezogen ihren Namen gewiss aus demselben kleinen Augraben. 17
Hier kann aber auch „Eschba“ gesprochen werden. Es mischen sich Espach und Espan. 18
Das „Soleh“ ist heute reiner Acker. Es muss wenigstens teilweise Wald gewesen sein. Statt eines Salweidenbestands wäre auch „Sal“ als altes Besitz-Wort denkbar: „Eigentums-Wald“. 19
An die Existenz von dornenreichen Wäldern erinnert ein altes Lied: „Maria durch ein Dornwald ging...“! Übrigens könnte hier die Endung auch von dem gesonderten -icht stammen (vgl. Dickicht, Röhricht), was aber für die Bedeutung keinen Unterschied machen würde. 20
Vergleiche auch „Leiten“ <> „Lä(i)ddn“, „Kainsbach“ (Chevnspach 1312 Da 11a) <> „Käischba“.
- 11 -
1d Kr E
Kr
Pe E
Die Stiegelwiesen: Eine solche Wiese gibt es sowohl in Kruppach, talabwärts außerhalb des Dorfes, als auch in Engelthal, ebenso talabwärts in Richtung Henfenfeld, großflächig zwischen Hammerbach und Reschenberg gelegen. Um 1723 färbte der Name auch auf den Hammerbach ab: er hieß an dieser Stelle Stiegelbach. Etwa 250 Jahre später verstanden die Vermessungsbeamten den Namen „Stiegelwiese“ nicht mehr und trugen stattdessen das Wort „Striegelwiese“ für beide Fluren in die Karte ein – obwohl sie in den alten Urkunden nie so hießen, und obwohl auch nicht ganz zu ersehen ist, was für Striegel („Streifen“) es auf dieser Wiese geben soll. Es gibt zwei sinnvolle Erklärungen für „Stiegel“. Einerseits bedeuten „Stiegel“ im Volksmund harte Stängel, die als dicke Büschel auf feuchten Wiesen auftreten. Sie werden vom Vieh nicht gefressen, verdrängen das gute Gras, und sind daher unerwünscht. Eine ganze Wiese will man schon gar nicht voll solcher Stiegel haben. Entsprechend dürfte es eine solche Wiese gar nicht geben. Man mag nun selbst nachsehen, ob auf den Stiegelwiesen solche Stiegel wachsen oder wuchsen. Auf der feuchten Hangwiese „Reichelsbach“ östlich Kruppachs gibt es schöne Exemplare von solchen Stiegeln zur Anschauung. „Stiegel“ ist aber auch ein Wort für Steiglein, kleine Stiege, Treppchen. Von der Kruppacher Stiegelwiese erfahren wir indirekt sogar, warum sie vielleicht solch ein Stiegel hatte: Diese Wiese wurde nämlich, wie andere Wiesen auch, als eine „Erblucke“ bezeichnet. Das bedeutet einerseits, dass die Wiese erblich ist, und andererseits, dass sie „verschließbar“ ist. Wir kennen die „Luke“ als eine Öffnung, die verschließbar ist. Die „Lucke“ ist dagegen die ganze Wiese, die verschlossen wird. Solche Wiesen waren umzäunt (vgl. den Wiesennamen Umbzeun), etwa mit Hilfe von Fichtenstangen, und blieben bis zur Mahd für Tiere geschlossen. Danach, im Herbst, wurden die Zäune geöffnet, und die Wiesen als Weiden freigegeben. Ein Problem gab es, wenn ein öffentlicher Fußweg über solch eine Wiese verlief. Dann wurden in den „geschlossenen Zeiten“ die Zäune zum Hindernis. Hier kommt das Stiegel ins Spiel: man steigt damit über den Zaun. Sogleich wird sich jeder Bergwanderer daran erinnern, dass er das bei Almwiesen schon selbst so gemacht hat. Es gibt dafür, wie solch eine Stiegel gemacht sein musste (nämlich mit je einem Trittbrett oder einem Pflock auf beiden Seiten des Zauns), eine sehr schöne Definition
21: „daß ein
jeglicher man oder frau mit einem sack wol darüber steigen mag“. Der Wiesen-besitzer war offensichtlich verantwortlich, dass alle leicht über den Zaun gelangen konnten, ohne dafür beide Hände zu brauchen. Liegt ein umzäunter Platz im Dorf, wird er Point (bzw. Peunt, Paind, althoch-deutsch Biunte) genannt. So einst in Peuerling und in Engelthal, wo die Peunt 1642 als Bauhof diente
22. Das Wort wird von „binden“ abgeleitet, da ein Zaun
21
Bahlow, S. 501/Zillinger, S. 8, mit Beispielen aus Pommelsbrunn S. 285-89. 22
Seibold, S. 7: hier sollte 1642 Eisen und Glas zum Neubau des Schulhauses gesucht werden.
- 12 -
Kr die Fläche „einbindet“. Vielleicht war auch die Puntelwiese in Kruppach eine „kleine Point“, und die Paundzeil daselbst die Hecke daneben
23.
1e E
Das „Hirscherbächla“ (Hirschbächlein): Auf dem Fuhrweg vom Engelthaler „Klostergarten“ nach Hallershof überquert man erst den Hammerbach, dann den Mühlbach, der zur Erdfallmühle fließt. An dieser Stelle mündet auch der Hirschbach in den Mühlbach. Früher hieß er „Hinbach“ (so schon 1547), verkürzt aus „Hindbach“ (belegt fast zeitgleich). Aber weil immer weniger Menschen noch wussten, was eine Hinde ist – nämlich ein weiblicher Hirsch – fing man offenkundig im 18. Jh. an, Hirschbach zu sagen. Und das ist ja auch korrekt, wenn die Wild-unkundige Bevölkerung männliche und weibliche Tiere gleichermaßen „Hirschen“ nennen darf. Aber vor langer Zeit haben sich an dem Bach offenbar neben den Hinden auch die Wild-kundigen Jäger getummelt. Übrigens ändert dieser Bach in seinem Verlauf seinen Namen. Weiter oben, im Wald, ist bzw. war es das „Aubächlein“. Wir erkennen, dass hier die „große Aue“ zu suchen ist, von der die „kleine Aue“ unterschieden wurde (s. o. zum Aileh). Und noch weiter oben wird das Bächlein aus dem Höllgraben gespeist, dessen Schlucht da liegt, wo Nonnenberg und Buchenberg zusammenstoßen oder eigentlich, geologisch gesehen, auseinanderbrechen. Es ist nicht so, dass die Schlucht so heißt, weil es dort recht höllisch aussieht, sondern umgekehrt. Hölle war zuerst ein Wort für Schlucht (von „hohl“, ähnlich wie „Höhle“), und man gab der Totenwelt den Namen Hölle, weil man sie sich wie eine tiefe Schlucht vorstellte. – Gespeist wird das Aubächlein genauso vom Kaltenbrunnen an den östlichsten Hängen des Nonnenbergs, also dem Bach, der fast den Sportplatz erreicht und dann um den Peuerlinger Anger und den Feuerwehr-teich herum fließt, bevor er zum Aubächlein wird. Der häufige Quellenname „Kaltenbrunnen“ bezeichnet das frisch aus der Erde tretende, daher besonders kühle Wasser des Bachlaufs. Wahrscheinlich ist auch mit dem alten Namen Mittelbrunnen der Kaltenbrunnen gemeint, da es von ihm hieß, unterhalb von ihm stehe der Kreuzstein (s. u.).
1f Se Kh
Am Feller und Fennat: Mit beiden Namen ist der Bereich jenes geheimnisvollen und artenreichen Eichenangers nördlich des Krönhofs gemeint. „Feller“ wird eher umgangssprachlich benutzt; Fennat steht eher auf dem Papier. Bei „Am Feller“ kann man wieder demonstrieren, dass oft die Einheimischen die Bedeu-tung kannten, während die Schreiber aus der Stadt sich schwer taten und kreativ waren, als sie den Begriff niederschrieben. „Am Feller“ heißt einfach „an den Feldern“
24, und Felder gibt es hier auf fast allen Seiten. Wo nun ein m auf
ein f trifft, schmuggelt sich beim Aussprechen gern ein p dazwischen. Der erste,
23
Die von Puntelwiese alternative Form „Beutelwiese“ kann Lesefehler des Schreibers sein, aber auch auf eine andere Wortbedeutung hinführen. – „Zeile“ heißt Hecke (vgl. Wasserzeil). 24
So fühlen es die Einheimischen; identische Beispiele gibt es bis Oberbayern (s. Gotthard).
- 13 -
Kr Se
Se
der also das Wort zu schreiben versuchte (hier: „am Feld“), schrieb denn auch 1547 „Am Pfaldt“. Der Schreiber des Urkatasters 1831 verstand das gar nicht mehr und versuchte, aus „Pfaldt“ oder der Mehrzahl „Pfäldten“ einen neuen Sinn zu machen, und schrieb „An den Pfählen“. Wer von „Feller“ nichts weiß, wird mit „Pfählen“ nicht glücklich werden, da man solche in dieser Flur ver-gebens suchen wird (so wenig wie sich „Säulen“ im Eilach finden, s. o.). Aus Pfählen war zwar einst der römische Limes gebaut, weshalb es bis heute Orte und Fluren namens „Pfahl“ entlang des alten Grenzwalls von der bayerischen Altmühl bis zur hessischen Wetterau gibt. Aber nicht auf der Anhöhe zwischen Krönhof und Henfenfeld. Übrigens kennt auch die Kruppacher Überlieferung ein altes Am Fäla. Das Fennat dagegen wurde von 1547 bis heute immer in derselben Form überliefert. Ein Fenn oder Venn bedeutet im Oberdeutschen etwa „feuchter Berg“ (im Niederdeutschen eher „Sumpf“). Diese Eigenschaft trifft auf diesen Eichenanger teilweise zu. Die Wortform ist wohl als „fénnert“ (Dialekt für Fenn-ig) zu verstehen. Mit der Endung –et oder –at werden, ähnlich wie oben für die Endung –eich beschrieben, im Oberdeutschen Gehölze bezeichnet: so grenzen auch die Sendelbacher Bäumets-Äcker (Dialekt: Bamats-Äcker) an den „baumigen“ Gemeindeschlag unterhalb des Klöpfelbergs an.
1g E
Kr
Die Bienleite und der „Boléddn“ (Bienletten): Ein Neubürger, der erstmals diesem letzteren Namen in Engelthaler Aussprache begegnet, fragt sich vergeblich, ob er sich darunter nun die Paletten einer Transportfirma oder eine Berliner Bulette vorstellen soll. Auch der Blick in die Akten hilft nicht sofort, wenn sich da zum Beispiel das Wort „Pelet“ findet, zu Zeiten, wo es noch lange keine moderne Holzheizungstechnik gab. Anderswo liest man „Polet“ (so die älteste bezeugte Form um 1547), dann wieder „Binnletten“ und „Pinleiten“ – was ist da die ursprüngliche Bedeutung? Es geht um die Flur unterhalb des Kaiser Karl. Diese ist zudem laut Volksmund aufgeteilt in (östlich) Bíeleddn und (westlich) Boléddn. „Letten“ ist an sich eine Flur mit lehmigem Boden, aber oft meint man bei uns mit „Leddn“ eine „Leite“, also eine am Talrand sich befindliche Hanglage. Das dürfte daran liegen, dass ein ai-Laut (besonders in Kruppach) zum äi-Laut wird
25: von „Läiddn“ (Leiten) zu „Leddn“ (Letten) ist im
Dialekt fast kein Unterschied mehr zu hören. Auseinanderhalten kann man sie immerhin durch den Artikel „der“ und „die“. Wie gesehen, vermischen sich die Leite und der Letten auch in unserem historischen Befund. Aber es vermischt sich hier anscheinend noch mehr: denn man könnte zwar von „Biene“, fränkisch „Bie“, gerade noch auf Pe– kommen (Bieleitn <> Pelet), zumal das „harte P“
25
Vgl. oben zu Sendelbachisch Aileh und Kruppachisch Äilasdol. Im Übrigen können sich „Leite“ und „Letten“ auch sachlich vermischt haben, wo sich an der Hanglage Lehmboden befindet.
- 14 -
noch nie hart ausgesprochen wurde26
. Kaum aber kommt man auf Po–. Dagegen gibt es eine Wortgruppe „Bol“, „Bollen“, die etwas Kugeliges meint
27.
Unsere Flur ist auf der Vorderseite tatsächlich kein einfacher Hang; sie wird durch den Graben des Schießangers abgerundet. Also ist „Bolet“ wohl „das Hügelige“; zur Endung –et s. o. zum Fennat. Vermischt mit dem benachbarten „Bieleddn“ wurde aus „Bolet“ dann „Boléddn“ daraus. – An der Bieleite wurde offensichtlich Bienenzucht betrieben. Dafür war genauso der so genannte Pingarten reserviert; er befand sich in der Nordecke innerhalb der alten Engelthaler Klostermauern, wo jetzt der ehemalige Pickel-Laden steht, gegenüber dem großen Friedhofstor. Eine „Bieleite“ gibt es ferner auch bei Stallbaum
28.
1h E
Pe
Die „Hóuastiedern“ (Hohe Strützerin): So heißt eine Wiese, die es gar nicht mehr gibt, weil sie unter die Häuser und Straßen eines Engelthaler Neubau-gebiets geraten ist. Sie lag im Bereich links und rechts der Straße „Am Kaiser Karl“ (ohne die Querverbindungen zur Kruppacher Straße hin). Die „Hohe Strützerin“ auf der Karte von 1831 gab vielen heutigen Engelthalern Rätsel auf: Man glaubte nicht, so eine Wiese zu kennen. Und so dauerte es einige Zeit, bis die Flur, die ja seit einigen Jahren wirklich verschwunden ist, mit Hilfe von Ortskundigen wieder „ausgegraben“ werden konnte. „Ja, die Hóuastiedern, die kennen wir freilich!“ Warum hat diese Wiese ihren Namen so sehr verändert? Weil das ältere Wort keinen Sinn ergab und man sich den Sinn durch ein ähn-liches Wort zu erklären versuchte. Vielleicht hat schon der Kartograph 1831 den sinnlosen Namen nur mit leisem Zweifel aufgeschrieben. Zuvor schrieb man auch „Hohenstrutzen“, sogar „Herstrüzerin“, keiner der Schreiber wusste, wie sie wirklich heißen soll. Nur, auch eine „Hohenstädterin“ (das bedeutet Hóuastiedern“) war die Wiese früher nicht. Der älteste Beleg dazu, eine Urkunde von 1465, kennt eine „Wiese im Harstütz“. Und das ist erklärbar. „Stütz“ steht in keinem Wörterbuch, aber die alten Engelthaler kennen es fast gleichlautend als „Stutz“. Dazu hörte ich die schöne Definition: „Ein Stutz ist, wo man beim Pferdefuhrwerk, wenn es bergab ging, den Hemmschuh einlegen musste“, also bremsen musste. Tat man das nicht, konnte der Bauer, dem das Fuhrwerk gehörte, ganz schön sauer werden, weil es gefährlich für Tiere und Ausrüstung war. Der Hemmschuh (Bremse) war auf der alten Wegstrecke im Staatsforst von Entenberg herunter erforderlich, war also ein Stutz. Heute noch gibt es zwischen Sportplatz und Peuerling einen Stuuz, der aber durch den
26
Vgl. neben heutigem Dialekt auch das 14. Jh.: vertauschbar erscheinen u. A. pet (Bett), prünn (Brunnen); bobst (Papst); „normal“ u. A. schrieben, büchlin: Binder, Christina, S. 40, 49, 71. 27
Freundliche Auskunft von Dr. Ina Schönwald: vergleiche Flurnamen wie Bol-Äcker, Bol-Leite, Hetzenbohl, und tatsächlich Bollet. 28
Zillinger, S. 38.
- 15 -
Kr
E Pe Se
Ausbau der Staatsstraße kaum mehr spürbar ist (s. u. zum Stutzkreuz). „Haar“ als Flur meint hier nicht (wie sonst gelegentlich) ein „Flachs“-Feld, oder sogar einen „Haardt“ (d. h. Berg-Wald)
29. Sondern „haar“ bedeutet in diesem Fall
einfach „hoher“. Beides klingt im Dialekt gleich: „hóuer“. Und wirklich wird die erste Worthälfte unseres Flurnamens bis heute als „hohen“ (hoúer) aufgefasst. Genauso lag auch ein Haarweg beim Kruppacher Hohenacker im Bereich der heutigen Straße nach Prosberg
30. So war also auch die Hoúerstiedern eigentlich
eine „Hoher-Stutz“-Wiese, oder Wiese am „Hohen Steilweg“. Der Steilweg führt bis heute von Engelthal in Richtung des Steinbruchs zum Prosberg hinauf, wenn auch zum Teil stark verwildert. Dass eine Wiese als Dame angesprochen wird, gehört im Übrigen zur Etikette: vgl. den alten Wiesen-Namen Lauterheffern (s. u.), und die vergessenen Namen Krorin in Peuerling und Starlerin in Sendelbach.
1i Pr
Das bewaldete „Gnocheh“ (Bocksknoche; dazu der Bocksschlag als dortiger Ort der Holzernte) ragt südöstlich von Prosberg als sanfter Rücken aus der Umge-bung. Es hat nichts mit herumliegenden Tierknochen zu tun. Vielmehr liegen hier haufenweise Kalksteinbrocken herum, die von Menschenhand weiter aufgehäuft wurden. Ein Knoche (auch „Knock“) ist bei uns das, was im südlichen Bayern und Österreich als „Nock“ bekannt ist, und was auch in unserem Wort „Nacken“ (Dialekt „Gnack“) steckt: eine harte Erhebung
31. „Knöcke“ als einstige
Dolomit-Riffe gibt es in der Juralandschaft nicht wenige32
. Diese Riffe entstan-den, als hier noch der Meeresgrund des Jurameers war, nicht einfach durch Kalkablagerung, sondern durch Versteinerung von Unmengen abgestorbener Schalentiere. Deren Kalk war dem Menschen sehr nützlich, er wird abgebaut. Und westlich und südlich des Bocksknoche gab es Kalköfen, worin das Gestein zu weißem Kalkpulver gebrannt wurde
33. Damit wurden Mauern verfugt und
Wände geputzt, bevor moderne Zementmischungen erfunden wurden. Das Gnocheh ist also ein Gehölz auf einem Kalkrücken; zur Endung –eh für „Holz“ s. o. zum Aileh. Es wurde anscheinend durch die Rehböcke bekannt, die hier einst den Anwohnern auffielen.
29
Bsp. s. Zillinger; dazu Maas, S. 87. Am bekanntesten die U-Bahn-Station „Fürth-Hardthöhe“. 30
Vgl. den Henfenfelder Eichelberg bei der Schule, der auch „Haareichelberg“ heißt (im Dialekt dort Horáckelberg): das ist ein „hoher Eichelberg“ und kein „Bergwaldeichelberg“. 31
Auch ein Knöchel ragt natürlich „hart heraus“, so dass letztlich doch ein Zusammenhang zu Knochen besteht. 32
Vgl. Zillinger, Knöcke. 33
Schroth, Spuren, S. 107. Zu weiteren Steinbrüchen und Kalköfen s. u.
- 16 -
2 Namen, die auf Grenzen und Flurdenkmäler hinweisen
2a E
Se
Eine Grenze, egal ob Gebiets- oder Ackergrenze, hieß in früherer Sprache Rain (Dialekt „Raa“). Somit geben der Rainschlag („Grenzwald“) und die gegenüberliegenden Rainwiesen und Rainegerten (zu „Egert“ s. u.) einen Hinweis auf einen Grenzverlauf. Dieser stimmt mit dem Verlauf des Eckenbachs überein. Es ist die Gemeindegrenze zwischen Engelthal und Sendelbach/Krönhof gemeint, wie es schon die Nöttelein-Karte von 1565 andeutet. Solange Sendelbach vor der Klosterzeit zu Henfenfeld gehörte, war es sogar die verlängerte Grenze zwischen Schweinach und Henfenfeld. Wenn „Eck“ hier einen Winkel meint und nicht ein Schwert, beschreibt der Name des Bachs wohl die Lage des Bachs im Nebenwinkel des Hammerbachs. Der Steingraben ist wiederum dessen Nebengraben.
2b E
Auch die Hallershöfer Lachengräben können auf eine Grenze hinweisen. Denn eine „Lache“ kann, wo Wasser ist, zwar einfach „Pfütze“ bedeuten. Aber Pfützen sind wohl kein besonderes namengebendes Merkmal für einen Graben, wo Wasser etwas Normales ist. Es gibt jedoch ein zweites Wort „Lache“ (althochdeutsch „lakke“); es meinte eine Schnitt-Markierung an einer Baumrinde, die der Kennzeichnung einer Grenze diente
34. Es dürften also bei
den Gräben solche Mark-Bäume gestanden haben, wenn nicht einfach die Gäben selbst die Markierung darstellen. In der Tat ist nördlich der Gräben Engelthalisches, südlich Offenhausener Gebiet.
2c Se Kh Pe
Auf jeden Fall befinden sich die Todtenleite beim Krönhof und der Kreuzfleck am heutigen Sportplatz unfern von Grenzen. Sie haben die Gemeinsamkeit, dass dort früher das so genannte Totenstroh entsorgt wurde. Das sind die Strohbündel, auf welchen ein Verstorbener bzw. der Sarg gebettet war, der mit dem Fuhrwerk nach Engelthal zur Beerdigung gefahren wurde. Man mochte das Stroh nicht auf Engelthaler Grund lassen, aber auch nicht gern in der eigenen Gemeinde haben. Diese Praxis ist vor Ort noch in Erinnerung
35. Die Bedeutung
des Wortes Todtenleite ist also: „Hang, an dem das Sendelbacher Totenstroh gelassen wurde“. Und das Kreuz am Kreuzfleck beim heutigen Sportplatz ist damit, wie viele andere solcher Steinkreuze, in erster Linie ein Grenzkreuz. Die Grenze Engelthal-Peuerling kreuzt hier die Straße. Allerdings will die Legende es anders, wonach es, passend zum eingravierten Dolch, ein Schwedenkreuz sei. Es heißt nämlich, Schwedenkönig Gustav Adolf sei im 17. Jh. höchstpersönlich hier gewesen, weil ihm einige feindliche Kroaten bei Lauf die Pferde gestohlen
34
Bsp. s. Zillinger. 35
Insbesondere in Sendelbach; zu Peuerling vgl. außerdem Wittmann, S. 2.
- 17 -
hätten. Er habe die Gegner selbst hierher verfolgt und niedergemacht36
. – Ein zweites, vom ersten unweit entferntes Steinkreuz wird von den Peuerlingern Stutzkreuz genannt. Es befindet sich am Peuerlinger Stutz (s. o. bei „Hohe Strützerin“). Das Kreuz trägt die landwirtschaftlichen Motive Pflug und Spaten, was eher auf ein Grenzkreuz hinweist. Da es aber an keiner solchen steht, muss vielleicht doch ein anderer Grund gesucht werden, warum es aufgestellt wurde. Kam jemand bei einem „Sturz“ zu Tode, oder einem Totschlag? – Beide heutigen Kreuze sind an Stelle von zerfallenden älteren aufgestellt. Sie ahmen die Form der Vorgängerkreuze nach, deren Alter unbekannt ist.
2d E
Eine Flur, die mit hoher Sicherheit an einen Todesfall vor den Toren Engelthals erinnert, liegt inzwischen im Engelthaler Siedlungsgebiet zwischen Kruppacher Bach und Hersbrucker Anger: Die Flur Auf der Marter. Der Name ist erstmals 1723 auf einer Umgebunsgkarte belegt
37. Unterhalb der Flur muss irgendwann
ein reales Marterkreuz gestanden haben, aber es ist verloren. Es dürfte um einiges älter gewesen sein. Falls man sich in Engelthal sofort nach der Reformation vom Brauch der „Marterln“ abgewandt haben sollte, würde es sogar aus der Zeit vor 1525 stammen. Solche Kreuze dienten Passanten als Aufruf, innezuhalten und für den hier zu Tode gekommenen Menschen Fürbitte zu tun, insbesondere wenn es ein gewaltsamer Tod war. Das Wort „Marterl“ bedeutet an sich das durch das Kreuz versinnbildlichte Leiden („Marter“) Christi, und die Marterl unterscheiden sich von Steinkreuzen oder Kreuzsteinen mit landwirtschaftlichem Motiv.
3 Namen aus Mittelalter und Klosterzeit
3a E
E
Die Existenz der „Minxwiesen“ (Mönchswiesen) am Engelthaler Ortsausgang in Richtung Kruppach, links, zeigt, dass die wenigen Mönche des Frauenklosters Engelthal (Kapläne, Beichtväter, Verwalter) teilweise eine eigene Einnahmequelle hatten. Die Wiese Frauental, die sich oberhalb Engelthals zum Graben unter dem Rainschlag hin erstreckt und in Wahrheit kein Tal ist, weist dagegen wohl auf die Nonnen hin
38. Denn korrekt wurden sie Klosterfrauen oder
einfach Frauen genannt. Konrad von Laufamholz, Schaffer (Verwalter) des Klosters im 13. Jh., soll einmal darunter gelitten haben, dass man diese Frauen „Nonnen“ nannte. Daraus lernen wir, dass er das als herabwürdigende
36
Die Legende zuletzt bei Käppel, S. 61. Die ursprüngliche Quelle konnte ich nicht verfolgen. 37
Die Karte bei Voit, Bd. II. 38
Oder sollte es sich hier um die Fronwiese („Herrenwiese“) handeln, die dem Kloster 1260 vom Stiftererben geschenkt wurde? Das wäre dann „Wiese in herrschalftlichem Besitz“ (Fron = Herr; vgl. Fronleichnam = Leib des Herrn). Aber die Ländereien des Klosters wurden damals stark „flurbereinigt“, so dass m. E. alte Wiesenlagen verloren sein dürften. Vgl. Weber, S. 221-28.
- 18 -
Pe
E
E
Pe Kr
Bezeichnung empfand. Eine göttliche Eingebung tröstete ihn mit den Worten: „Nonnen, das sind Sonnen“
39. Und es ließ sich nicht verhindern, dass der ganze
Berg bei Peuerling Nonnenberg genannt wurde. Es ist naheliegend, dass dieser Name erst nach der Klostergründung 1243 eingeführt wurde. Dasselbe gilt für weitere Namen, so beim zugehörigen Dorf Nonnenberg
40. Es lag schon 1312 öd,
wie das damalige Salbuch vermerkt. Der Name Klosterau bezeichnete lange Zeit die ausgedehnten Wälder zum Buchen- und Nonnenberg hin, die heute Engelthaler Forst heißen. Die Namen der Teilgebiete werden unter Mühlschlag, Rösengraben und Hirschbächlein behandelt. Der Name Klosterberg bezeichnete abwechselnd den Buchenberg, den Westhang des Reschenbergs, und – bis heute – den Vogelherd bei Henfenfeld. Die Hofwiesen zwischen dem Kloster und dem Hammerbach sind relativ nichtssagend, da nicht gesagt wird, welcher Hof gemeint ist. Aber wenn man von „dem“ Hof sprach, könnte man vielleicht doch an den Engelschalkshof denken, der 1312 genannt wird und zum Grundbestand des Klosters gehörte
41.
Noch schwieriger wird es bei den Peuerlinger und den Kruppacher Hofwiesen, wo nicht mehr klar ist, zu welchem Hof sie gehörten.
3b E
Die „Lauterheffern“ (Lauterhöferin) erhielt ihren Namen in der Klosterzeit. Die so benannte Wiese liegt zwischen Hammer- und Mühlbach und kann nur über Brücken erreicht werden. Sie ist wirklich mit dem Städtchen Lauterhofen verbunden, und zwar über den Pfarrer Otto von Lauterhofen (13. Jh.), der das neu gegründete Kloster sehr unterstützte. Damit nach seinem Tod jährlich eine Messe für ihn gelesen werden konnte, stiftete er dem Kloster die Wiese. Die jährlichen Einnahmen aus der Heuernte dienten als Lohn für den Priester und für den Kauf von Kerzen und für ähnliche Dinge. Daher wurde die Wiese nach ihm benannt. Und der Mühlbach als Grenze der Wiese müsste mindestens ebenso alt sein!
3c Pe
Geierstein heißt ein Waldstück ganz oben auf dem Nonnenberg, nordwestlich vom dortigen Waldabschnitt „Platte“. Der Name klingt sehr nach einem Burg-namen. Dazu passt, dass sich direkt nördlich, auf Peuerling zu, der etwas tiefer liegende, aber sehr charakteristische Bergsporn namens Ödes Schloss anschließt. Dieser „Name“ bezeichnet die abgegangene Burg auf diesem Sporn, von der noch heute ein doppelter Halsgraben und mindestens ein Mauerstein sichtbar sind. Robert Giersch, der den Ort beschreibt, überlegt, ob hier ein Burgbau des unruhigen 13. Jh.s unvollendet blieb, nachdem man festgestellt
39
Schröder, S. 5. 40
Theoretisch gäbe es auch andere Erklärungen: So wird der Ort Nonnhof bei Alfeld entweder als „Neuenhof“ oder „Hof eines Bauern namens Nonno“ gedeutet: S. Bacherler zum Namen. Zum vorhergehenden Namen des Nonnenbergs s. u. unter Geierstein. 41
Ursprünglich drei Höfe. S. Voit, S. 92.
- 19 -
habe, dass eine Burg hier nicht mehr benötigt wurde42
. Es ist ziemlich nahe-liegend, dass dieses Öde Schloss einst Geierstein hieß, und dass entweder der Berg überhaupt danach benannt wurde oder wenigstens das gleichnamige Waldstück einst die Wirtschaftsflächen der Burg markierte. Wenn man nun bedenkt, dass der Name Nonnenberg (s. o.) erst nach 1243 sinnvoll ist, nachdem der Berg und auch der abgegangene Weiler „Nonnenberg“ dem Kloster gestiftet worden waren, dann kann man sich fragen, ob nicht auch dieser Dorfname nicht tatsächlich den alten Namen Geierstein ablöste. Dann könnte auch der Weiler Nonnenberg entweder in der Burg Geierstein zu lokalisieren sein, oder zumindest als deren Wirtschaftshof auf der Flur Geierstein zu identifizieren sein.
3d E
Die Hammergaß ist wohl der einzige Hinweis darauf, dass nicht nur irgendwo im Hammerbachtal ein Eisenhammer stand, sondern dass sich ein solcher unweit von Engelthal befand, in nördlicher Richtung. Diese „Gasse“ (fränkisch für jede Art von „Weg“), auf der man zum Hammer gelangte, erscheint heute beim Dorf als Fuhrweg
43, dann weiter außen als ein leicht eingesenkter Flurstreifen, der für
Kleingärten genutzt wird, schließlich als bloßer Grünstreifen mit kleinem Wassergraben, und kurz vor dem Hammerbach als eine sich stark ausweitende Mulde, die wie eine „Mündung“ dieselbe Tiefe von fast 3 m erreicht wie der Hammerbach selbst. Im 18. Jh. war diese Gasse durchgehend Straße mit ausge-bauter Trasse und führte links der jetzigen „Mündung“ über die damals hier gelegene Brücke über den Hammerbach. Das Brückenlager am rechten Ufer ist noch erhalten. Die heutige Straße nach Henfenfeld vom Schafstall aus war dagegen nicht ausgebaut, die heutige Brücke nicht vorhanden. Das „Untere Tor“ Engelthals war Haupttor, während das Schaftor, an dessen Stelle die heutige Hauptstraße gebaut wurde, nur Nebentor war. Die beschriebene Ausweitung zu einer Mulde scheint zu bezeugen, dass schon in früheren Jahrhunderten neben einer „Gasse“ auch ein Wasserlauf dorthin führte. Dieser Lauf muss sich wohl teilweise aus dem Schmiedbach gespeist haben, um ausreichend Wasser zu haben (s. u. zur Wöhrwiese und zur Frage eines Wehrs), und er muss eben den Hammer dort angetrieben haben. Mindestens ein Mühlrad muss sich hier im Mündungsbereich gedreht haben: Man brauchte es dazu, Hämmer zu heben, die dann durch ihr Eigengewicht auf das Eisenerz bzw. das Roheisen zurückfielen, um es zu zerkleinern. Ein weiteres Rad könnte einen riesigen Blasebalg betrieben haben, durch welchen der Schmelzofen wesentlich stärker erhitzt wurde als bei einem Rennofen. Das Erz kam von den Talhängen der Umgebung und wurde im Tagebau aus den Schichten des Eisensandsteins geholt. Die übrig gebliebenen Gräben und Schluchten sind immer noch vielerorts zu sehen.
42
Giersch, Burgen, S. 327. 43
Das ist nicht die heutige Straße „Hammergasse“, sondern sie verlief quer dazu an deren unterem Ende und heißt heute Henfenfelder Weg.
- 20 -
Die Hammergasse und auch eine Hammerbrücke sind bereits 1547 bezeugt; um 1560 führte Niklas Nöttelein aus Nürnberg den Namen darauf zurück, dass „vor jahren ein hammer daselbst gestanden“. Schriftliche Überlieferung und auch archäologische Reste vom Hammer selbst fehlen allerdings, so dass nicht klar ist, ob der Hammer zur Klosterzeit oder schon davor bestand und wem er gehörte. Doch es könnte ähnlich wie beim Dorf Schrotsdorf gewesen sein. Dieses wird 1245 zuerst genannt als Schenkung der Herren von Reicheneck ans Kloster Engelthal. Da es seinem Namen nach („Eisenerzschrotung“) ein mittelalterlicher Industrieort war, geht daraus zumindest hervor, dass die Reichenecker (bzw. zuvor Königsteiner) Ministerialen vor der Klosterzeit in der Eisenindustrie begü-tert waren. Vielleicht schenkten sie das Dorf dem Kloster am Ende, als die Eisenvorkommen schon ausgebeutet waren, und als man sich nach Osten hin neuen Erzvorkommen zuwendete. Für Egensbach wird bereits für das 12. Jh. Erzabbau angenommen; aber auch noch nach 1500 gab es für Breitenbrunn Bergbaukonzessionen
44. Immer wieder, zuletzt Anfang des 20. Jh.s, wurde die
Möglichkeit des Eisenbergbaus im Tal erkundet, so auch bei Kruppach45
. Nachdem die Reichenecker 2 bzw. 5 Jahre vor Schrotsdorf Schweinach und Engelschalksdorf dem Kloster schenkten, dürften sie auch die Besitzer des dortigen Hammers gewesen sein.
3e Pr
Pr
Auf dem Weg auf der Höhe von Prosberg nach Deckersberg gelangt man auf halber Strecke zu einer sanften Mulde, in welcher man nach rechts in Richtung Vorderhaslach abbiegen kann. Diese Mulde wird heute „Schnobberlasdol“ (Schnabelstal) genannt. Man kann hier auch nach links abbiegen und gelangt durch Wald und einen steilen Graben ins „Äilasdol“ hinab (s. o.). Das Schnabels-tal ist nach einem längst verschwundenen „Schnabelshof“ benannt, und dieser vermutlich nach seinem Besitzer, also wohl einem gewissen Schnabel. Der Hof wird 1312 und 1350 als an Engelthal abgabenpflichtig aufgeführt, und fehlt ab 1426. Es wird davon ausgegangen, dass der Besitz nach Kruppach integriert worden ist
46. Man darf dabei unter anderem an den Äilasbauernhof denken,
welcher bis heute mit dem Schnabelstal in Beziehung steht. Davon abgesehen, könnte der Name einst das ganze Tal bis hinunter durchs Äilasdol (s. o.) bis nach Kruppach bezeichnet haben, denn Pfinzing trägt den Namen östlich von Ober-kruppach ein und schreibt darunter (also südlicher): „In Greben“ („Gräben“), wozu außer dem Äilasdol auch das Dammersdol und der Hinterbach gehören dürften. Etwas näher an Prosberg, in der Senkung, die ins Dammersdol hinabführt, heißt eine Stelle im Volksmund „Kourashuf“ (Konradshof). Außerdem war noch vor
44
Giersch, Offenhausen, S. 104 und 240f (hier auch das Zitat Nöttelein). 45
S. Schroth, Eisenerz. 46
Giersch, Offenhausen, S. 121.
- 21 -
zwei Generationen der Name Friedhof lebendig für eine Terrassenlage weiter bergab, und man kann sich fragen, ob es sich dabei tatsächlich um einen ehemaligen Friedhof handelt. So stellt es aber der Offenhausener Pfarrer Karl Thiermann im Jahre 1932 fest. Natürlich lässt sich nicht mehr ergründen, ob die Annahme eines Friedhofs auf den Pfarrer oder auf ältere mündliche Über-lieferung zurückgeht. Robert Giersch weist darauf hin, dass ein Konradshof nur im Hirschbachtal schriftlich belegt ist
47. Sollte hier wirklich ein Hof mit Friedhof
gewesen sein, dann in ganz alter Zeit vor jeder Verschriftlichung.
3f Se
Der Name Maienfeld ist aus der Uraufnahme von 1831 bekannt und meint die gesamte Flur nördlich von Sendelbach zwischen Staatsstraße und den Waldungen auf der Höhe. Im Alltag der Bevölkerung spielt der Name keine Rolle. Stattdessen werden Namen von kleinteiligeren Fluren an dieser Stelle benutzt, worunter der „Marienacker“ (!) nur noch einer von vielen ist. Die Bergäcker entwickeln sich hier teilweise zu einem neuen Oberbegriff. Aus dem 16. Jh. ist aber ein Meierfeld (und auch eine Meirgaß) bei Sendelbach überliefert. Nach den älteren Forschungen von Jost Weber
48 wäre dies das ursprünglich zum
Sendelbacher Meierhof gehörige Land gewesen. „Meierhof“ heißt derjenige Hof eines Dorfs, welcher die Herrschaft des Dorfherrn vertritt, also dessen, der im Dorf den größten Besitz hat. Dorfherr war bis zur Klosterzeit die Herrschaft Henfenfeld, erst im 14. Jh. wurde vieles an Engelthal verkauft. Die Nach-forschung von Robert Giersch ergibt allerdings, dass der ehemalige Meierhof in der Sendelbacher Haus-Nr. 1 zu suchen sei, welche ihren Grund und Boden hauptsächlich im Süden hat
49. Soll ein Personenname
50 Pate für „Maienfeld“
gestanden haben? Oder soll man an Birken („Maien“51
) denken, nachdem ja auch das Birkach, also Birkenwäldchen (s. o.), daran angrenzt? Träfe eines von beidem zu, müsste der ältere Name „Meierfeld“ eine falsche Schreibung für Maienfeld gewesen sein. Im Dialekt ist das möglich, wo die Aussprache beider Wörter identisch ist. Aber auch der umgekehrte Fall ist dann möglich, und wirkt auch realistischer. Es ist daher noch nicht auszuschließen, dass das Maienfeld irgendwie einmal zum Meierhof gehört hat. Das kann lange vor dem 14. Jh. gewesen sein, als die Besitzaufteilung noch weniger kleinteilig gewesen sein muss.
47
Vgl. Thiermann mit Giersch, Offenhausen, S. 121. 48
Weber, S. 207-17. 49
Giersch, Sendelbach, S. 70-92, bes. S. 72f. 50
Herr Giersch teilte mir die Möglichkeit mit, den Namen eines Hiltebold zu Maiental heranzuziehen. Er war Vorbesitzer eines Hofs, der 1283 nach Engelthal verkauft wurde. 51
Ein Pfingstlied beginnt mit den Worten: „Schmückt das Fest mit Maien“. Birken wurden und werden gern verwendet, weil sie als früh (im „Mai“) ausschlagender Laubbaum geeignet ist.
- 22 -
3g E E
Pe Se Kr
Manche ungebräuchlich gewordenen Namen können gar nicht mehr sicher zugeordnet werden. Der Name Welleberg meint wohl einen Hang bei oder gegenüber Hallershof. Der ähnliche Name Wellebach bezeichnete eine Grenze der Hallershofer Viehhut im Bereich Klosterweg, so dass vielleicht der Hirschbach gemeint ist. Eine Welle konnte früher eine Quelle, ein Wallen, aber genauso (wegen der rollenden Form) ein Reisigbündel, ein Nudelholz oder ein Wellbaum sein. Die Bündel dienten dem Schüren, aber auch als Baumittel, und wurden sogar zum Fischfang in Bäche gestellt. Ein Wellebach fände also viele Erklärungen; ein Welleberg diente wohl als Gehölz der Gewinnung von Reisigbündeln. Die Gelß- oder Gelfswiese beispielsweise ist eine oft genannte, jetzt aber unbe-kannte Flur in Peuerling, der Gaitsacker eine solche in Sendelbach. Und was wurde in Kruppach aus dem Acker Paradeis, wohl einem echten Platz an der Sonne
52? Es heißt, dass der Ort noch nicht ganz vergessen sei…
4 Namen mit Bezug auf Wirtschaftsformen
4a E
Pr Kr Se
Kr Se
Kr E
Kr Se Kr E
Die Ochsenwiesen in sämtlichen Dörfern (in Kruppach „Ochsenkopf“) waren der abgesonderten Haltung der Sprungochsen vorbehalten, in Sendelbach zusätzlich der Ochsenanger mit dem Ochsengraben. Eine Wiese bei den Sendelbacher Schiedelhengstäckern diente entsprechend dem Schälhengst. Das Wort kommt von „Schel“, was den besamenden Hengst bezeichnet. Weil sich vor einem l-Laut gern ein d einschleicht
53, haben die Schreiber, als es noch keine Rechtschreib-
regeln gab, statt Schel mal Schüdel und mal Schüttel geschrieben. Der Hengst hatte nicht die ganzen Äcker für sich, sondern der Name wurde von seiner Wiese auf die große Fläche übertragen. Auch die „Hennerleitn“ (Hühnerleite) nördlich von Unterkruppach und der „Häierschloch“ (Hühnerschlag) südlich von Sendelbach sind denn doch nicht nur für Hühner verwendet worden. Welche Tiere auf einem Sauweg (östlich von Kruppach und auch westlich von Engelthal), auf den Schaf- und den Viehtrieb (östlich und westlich von Engelthal) und den Kühanger (nördlich von Unterkruppach) getrieben wurden, verrät ebenfalls der Name. Am Ende dieser Hütestrecke stand ein Sauplatz (Engelthal/Sendelbach) oder einfach Platz (beim Kruppacher Kühanger im Tannig), wo man blieb bis zur Heimkehr. Auch gab es Gänsänger; der von Engelthal liegt unterhalb des Pros-bergs, oberhalb des Schießangers. Ob dieser wohl einst Teil des benachbarten Tiergartens (s. u.) war, also als Ort der Jagd auf gehegtes Wild? Auf jeden Fall lag dieser Anger am späteren Schießhaus, wo die Schützen seit dem 18. Jh. für den
52
Es muss wirklich das Paradies gemeint sein. Tomaten waren hier im 16. Jh. noch nicht bekannt! 53
Für ein eingeschlichenes d vgl. auch fränk. „Kestl“ für „Kessel“ und allgemein Abschnitt 9.
- 23 -
E Pe
Kr
Pr Kr
Pr E
Pe
Kriegsfall übten. Das Haus gibt es nicht mehr, und die Übungen wurden später im Gästehaus des „Goldenen Engels“ fortgesetzt. Aber auch das ist Geschichte. Der Mühlanger und der Peuerlinger Anger waren natürlich auch fürs Vieh gedacht, haben aber ihre Namen von ihrer Nähe zur Erdfallmühle bzw. zu Peuerling. Ein Anger ist also ein für alle zugänglicher Weidegrund der Gemeinde. Weil man die Tiere dort hütet, heißt er auch „Hutanger“, oder einfach Hut, wie es unterhalb Kruppachs der Fall ist. Hatten zwei Gemeinden das Recht zu hüten, handelte es sich um eine Koppelweide (belegt für Kruppach/ Prosberg, auch Engelthal/Henfenfeld). Auch auf einem Espan (einen solchen gab es in Kruppach) können Tiere zurückgelassen werden, vielleicht weil sie „angespannt“ (angebunden) wurden, oder weil sie hier Essbares fanden
54. Nach einer anderen,
einheimischen, Erklärung unterscheidet sich ein Espan vom Anger nur durch die Bodenqualität: ein Espan ist zu feucht für Feldwirtschaft, ein Anger ist trocken und eher in Hanglage. Für Lämmer, die noch nicht so weit gehen konnten, gab es in Prosberger Ortsnähe die Lammwiese. In Engelthal blieben sie, zusammen mit kränkelnden Schafen, einst auf der Hinkwiese. Auf ihr wurde ab 1563 der jetzige Friedhof angelegt. Darf eine Wiese erst im Herbst beweidet werden, nachdem die Mahd geschehen ist, handelt es sich um eine „Hirstwiesn“ (Herbstwiese), wie es nicht nur in Peuerling eine gibt.
4b E
Kr
Pr
Die Saueggete unterhalb des „Ruhesteins“ am höchsten Punkt des Wegs von Engelthal nach Weiher und Hersbruck diente der Schweinehut. Sie heißt nicht Anger, wegen ihres anderen Ursprungs. Egärten, Egerten, oder kürzer Eggeten und Egern, sind Brachland, das eine Zeit lang nicht oder nur unregelmäßig bewirtschaftet wird
55. Wie der Name der Saueggete verrät, hat man diesen
Zwischenzustand früher noch gezielt genutzt, aber heute findet sich nur noch ein Wald mit Trimm-dich-Pfad an dieser Stelle. Vollends Wald wächst auch in der Egern, die sich als Höhenrücken hinter dem Reschenberg bis kurz vor der Edelweißhütte hinzieht, sowie im Echerl zwischen Kruppach und Prosberg. Zu diesem, noch urbar, gehört der Prosberger Egerleinsacker. Urbar ist auch die Fläche, die sich über den Bergsattel zwischen Engelthal und Entenberg – und zwischen Buchen- und Nonnenberg – erstreckt. Sie heißt „Kappéchern“ (Kopp-Egerten), und heißt wohl so, weil sie einem Besitzer namens Kopp gehörte (vielleicht auch, weil sie quasi auf der „Kuppe“ liegt). Sie verwilderte nicht,
54
Joseph Schnetz liest Espan als Eh-Spann. Das Wort „Eh“ („Herkommen, Sitte, Recht“ nach DRw unter „Ehe“) lebt im Hochdeutschen noch als „Ehe“ („rechtliches Bündnis“) fort, oder in „ehemals“ („damals, als die Sitte noch etwas galt“). Aber im Dialekt benutzen wir das Wort unbewusst weiterhin täglich: Wenn eine Sache „eh“ so ist, wie sie ist, dann gilt sie einfach, man braucht sich nicht wundern, man kann nicht drüber diskutieren oder herumfeilschen. – Heinrich Gotthard dagegen liest Espan als Ess-bann, also Bezirk („Bann“) zum Äsen/Essen. 55
Das Wort kann man damit erklären, dass es sich um nach Herkommen („Eh“: s. o. zu Espan) bestehende „Gärten“ handelt, oder dass es „ehemalige“ Gärten waren..
- 24 -
Se E
Kr
sondern wurde wieder gepflegt. Früher ging und fuhr man, wenn man von Engelthal nach Entenberg wollte, hier vorbei (s. u. „Wege“). Noch eine Egerte wird heute wieder voll bewirtschaftet, nämlich die Rainegert jenseits des Rain-schlags. Ein Eintrag von 1730 berichtet von der Fläche als einem „anno 1568 oed gelegenen nunmehro aber zu Feldern völlig ausgebauten Hof, auf der Rein-egerten genannt“
56. Der Besitz war an zwei Engelthaler Anwesen aufgeteilt
worden. Dazu musste er offensichtlich dem Kloster gehören, obwohl er auf Sendelbacher Gebiet liegt. Der Eintrag vermittelt den Eindruck, dass der öde Hof sich direkt auf der Rainegert befand, so dass der Name hier nicht nur „braches Feld“, sondern „aufgelassener Hof“ bedeuten würde. Ganz genau lässt er sich aber nicht deuten. Von der Egert wird die Acker-Maas unterschieden (so in Kruppach), ein als ehemaliger Acker noch erkennbar umrissenes Stück („Maß“) Land.
4c E
Se
Kr
Während Änger und Egerten weniger pflegeintensiv sind, verraten folgende Namen einigen Arbeitsaufwand: Der schon bekannte Rösengraben bezeichnet ein Waldstück um ein Gewässer herum, dass sich gut zur Flachsverarbeitung eignete. Dieser Vorgang wurde, obwohl „Rösen“ mit „rösch“ und „Röste“ zusammenhängt, nicht im Feuer sondern in brackigem Wasser ausgeführt. Andernorts wird solches Brackwasser als „faulig“ empfunden, und führt zu Flurnamen wie Fauläcker jenseits des Sendelbachs. Ähnlich benennt sich vielleicht auch der Feilgrobm (aus Fäulgraben?), der etwa bei der Gänsbrücke nach Rüblanden mündet
57.
Arbeit am Wasser wurde auch mit dem Wäschbläuel verrichtet. Das ist ein dickes Brettchen mit einem Stiel, womit man eingeseifte Wäsche im Zuber oder im Bach schlägt, um sie sauber zu bekommen. Das Wort kennt man kaum mehr, aber dass man jemandem durch Schläge etwas ein-bläuen kann, ist durchaus bekannt, und Automechaniker kennen die Pleuelstange eines Motors, welche auf die Kurbelwelle „schlägt“. Den Namen Wäschbläuel trug jedenfalls in früheren Jahrhunderten jene Wiese unterhalb Kruppachs, die unmittelbar an der Stelle der damaligen Furt durch den Bach liegt (eine Brücke gibt erst seit jüngerer Zeit; sie wurde weiter oben am Bach errichtet): Sicher wurde also dort im Bach Wäsche geschlagen, so dass oft Bläuel herumlagen, wenn nicht einfach die Form der Wiese wie ein Bläuel aussieht. Bitte hingehen und selbst nachsehen! 1831 wurde der Name der Wiese als „Wäschbleich“ niederge-schrieben, wie es das in etlichen anderen Orten gibt. Also auch ein Waschplatz, aber weil die Wäsche zum „Bleichen“ in der Sonne ausgelegt wird. Die Kruppacher sagen kürzer „Wäschblei“, was nur auf den ersten Blick beide
56
Salbuch Engelthal 1730 I (=NI). Voit überlegt, ob der Öde Hof der „Zulleinsperch“ war. 57
Da der „Haingraben“ des 17. Jh.s dieselbe Lagebeschreibung hat, dürfte er mit dem heutigen Feilgraben identisch sein. Ein Graben mit Hainbuchen oder einem Hag?
- 25 -
Se
Se
Se
E Pr Pe
E
Bedeutungen zulässt. Der Artikel (der Wäschblei) verrät, dass ursprünglich ein Bläuel gemeint war. Arbeit gab es auch in den Leimgruben; einen Leingrubenweg (heute „Hohweg“ genannt) gibt es südlich von Sendelbach. Hier konnte man Lehm („Leim“) holen gehen, um die Wände von Haus oder Herd auszubessern. Traditionelle Gebäude waren nur zum Teil aus Stein; im anderen Fall verwendete man Fachwerk. Die Zwischenräume wurden mit Weidengeflecht ausgefüllt, dieses wiederum mit Lehm. Tatsächlich gibt es unweit eine Flur, „Weiernäcker“ (Weidenäcker) genannt, die vielleicht damit zusammen hängt. Einige Weiden wurden niedrig gehalten, „auf Stock geschnitten“, damit sie ausschließlich neue Weidenruten produzierten. In Sendelbach gibt es auch den „Kuhlbuck“, den Hügel, wo der Schmied ehemals seinen Kohlemeiler stehen hatte. Einen solchen Meiler gab es auch in Engelthal am Ausgangspunkt der Hammergasse. Ein Holzstoß wurde hier mit einer Erd-hülle übermantelt, die nur ein paar Lüftungslöcher hatte, und kokelte darin, bis Holzkohle aus dem Holz wurde. Man brauchte Holzkohle spätestens als die Eisenverhüttung aufkam, da nur so ausreichende Temperaturen für die Erzschmelze zu erreichen waren
58.
Steinbrüche, Kalkberge oder Kalköfen gibt es in der Umgebung fast auf jedem der Berge, wo sich kalkhaltige Lagen des Weißen Jura befinden. Kloster Engelthal erwähnte regelmäßig seinen Steinbruch auf dem Nonnenberg, aber etwa auch am Prosberg und am Buchenberg gab es einen solchen. Bis vor nicht langer Zeit wurden dort Kalksteine gewonnen und auch Kalk zu Kalkstaub gebrannt. Damit weißelte man Wände und verfugte Mauern, vor der Erfindung des modernen Zements 1824
59.
Zuletzt sei es erlaubt, neben Hammergasse (s. o.) und Hammerbach (s. u.) noch zwei „auswärtige“ Flurnamen zu erwähnen, an denen erkennbar ist, wie bedeutend Erzgewinnung und –verarbeitung in der Region waren. Dazu gehört der Arzberg bei Leutenbach, eigentlich schlicht ein „Erzberg“. Ferner hat die Ehrenbrünst, ein Waldhang bei Egensbach, ihren Namen nicht nur von der Brandrodung (s. o.), sondern auch vom alten Wort „êr“ für Eisen und Erz (vgl. „ehern“ = „eisern“).
4d E
Die Wöhrwiesen nördlich von Engelthal erinnern an Wasserwirtschaft. Sie dürften ihren Namen von einem Wehr haben. Man darf nach Meinung von Robert Giersch davon ausgehen, dass einst Kruppacher Bach Wasser in die Hammergasse (s. o.) abgegeben haben muss, um den weiter unten liegenden Eisenhammer betreiben zu können. Dann müsste ein Wehr etwa im Bereich der
58
Der Engelthaler Meiler ist 1706 in einer Karte eingezeichnet. Näheres zur mittelalterlichen Meilertechnik bei Schroth, Spuren, S. 10. 59
Zu r Methode des Kalkbrennens s. Schroth, Spuren, S. 11f.
- 26 -
E
Brücke bestanden haben, über welche die Reschenbergstraße führt. Heute ist diese Stelle weit entfernt von den Wöhrwiesen, aber bis vor gut hundert Jahren war hier kein einziges Haus, und die Wiesen reichten bis zum Wehr heran – es war die „Wehrseite“ vom Dorf aus gesehen. Auch ist der Schmiedbach oberhalb besagter Brücke in alten Darstellungen (Uraufnahme 1831 und Stich um 1870, s. o. S. 6) noch als künstlich verbreitertes Gewässer (oder Überschwemmungs-gebiet) dargestellt, was ein Wehr voraussetzt. Alternativ könnte man an das Wehr der Erdfallmühle denken, am oberen Ende der „Lauterheffern“: denn der Abschnitt des Hammerbachs von hier ab flußabwärts wurde 1831 „Wöhrbach“ genannt. Aber die Wöhrwiesen liegen weitab von jedem Wehr. – Ein Schreiber des 16. Jh.s wollte übrigens nicht an ein Wehr denken, er schrieb stattdessen „der werdt“. Dabei dachte er sicher an „Wöhrd“, was „Land zwischen zwei Wassern“ bedeutet. Das war auch nicht falsch, denn die Wöhrwiesen füllen die gesamte Fläche zwischen Schmiedbach und Hammerbach aus. Die Deutung dieses kritischen Mannes hat sich aber nicht durchgesetzt
60. Wenn die vorgetra-
genen Schlussfolgerungen richtig sind, dann hat das Wehr wohl im 16. Jh. schon keinen Bestand mehr gehabt. Der Pfarrersdümpfel ist eine Gumpe im Bach bei den Wöhrwiesen unterhalb der jetzigen Kläranlage. Der Volksmund erinnert mit dieser Bezeichnung daran, dass hier mindestens ein Pfarrer von Engelthal regelmäßig gebadet hat. Erst in jüngster Zeit fand sich die Bestätigung dafür in den überlieferten Aufzeichnungen der Familie Kalb. Friedrich Wilhelm Louis Kalb war Pfarrer im Dorf von 1843 bis 1872. Er war nicht nur erster Bewohner des heutigen Pfarrhauses, und er war nicht nur derjenige, der dafür sorgte, dass die Willibaldskapelle in den Besitz der Kirchengemeinde zurückkam, sondern er war eben auch der erste bezeugte badende Pfarrer Engelthals. – Als vor dem zweiten Weltkrieg ein Engelthaler Bursche im Dorf Bretter sammeln ging, um jenen Badeort zu einem richtigen Schwimmbad auszubauen, geriet er gleich an den falschen Bauern, der ihm sagte: „Ich bade das ganze Jahr nicht, da braucht ihr das auch nicht“. Jener Bursche hat sein Projekt dann, soweit wir wissen, wieder aufgegeben; gebadet wurde dort aber noch lange.
4e
Auch Formen der Waldwirtschaft und Feldgewinnung schlagen sich in unseren Flurnamen nieder. Mühsam ist das Entwurzeln von Bäumen – dies bedeutet „roden“ im eigentlichen Sinn. Man versuchte, den Baum so über einen bereits liegenden Baum zu ziehen, dass er beim Fallen durch Hebelkraft sich selbst vollständig entwurzelte. Danach war der Boden entweder urbar und frei für den Pflug, oder er diente erneut der Aufforstung. Man ließ dann einen „Sambaum“ stehen: seine sich ausstreuenden Samen fanden bei dieser Art der Rodung
60
Immerhin wird auch aus Kruppach noch ein „Bach im Wöhrt genannt“ überliefert; damit könnte der Kruppacher Bach gemeint sein, insofern er letztlich an den Wöhrwiesen vorbeifließt.
- 27 -
Pr
Kr Kr E
E
Se Pe Kr E
Kr
Se E
Pr Pe
besonders guten Möglichkeit, aufzugehen. Wörter wie „Ried“ (bairisch)61
und „Roth“, „Röthe“, dann „Reuth“, „Gereuth“, mit den alternativen Schreibweisen „Kreuth, Krait“ (fränkisch) bedeuten alle „gerodeter Ort“. Das „Riad“ (Ried) zwischen Prosberg und Hag stellt also eine sehr früh durch Rodung gewonnene Fläche dar. Das Erbkreuth im Kruppacher Kessel war offenbar zusätzlich in Erbpacht vergeben. Ein Rotweg nebst Rotleite führt von Unterkruppach nach Prosberg hinauf. Ein weiterer Rothenweg führte als Hohlweg zwischen den beiden „Tiefen Gräben“ zum Reschenberg steil hinauf. Diese Wege erschlossen Rodungsplätze, also nicht im Sinne von Urbarmachung, sondern von Holz-wirtschaft. Womöglich erinnert auch der vergessene Hausname Rothenberg/Rotperg, der sich auf Nötteleins ältester Karte von Engelthal (1565) und in manchen Urkunden findet, daran, dass auf der geologischen Schotterterrasse zwischen Schafstall und Schmiede einst gerodet wurde. Der Name „Brand“ weist manchmal auf einen ungewollten Waldbrand hin, nicht selten aber auf gezielte Brandrodung. In Sendelbach, wohl nördlich am Bach, gab es ein heute vergessenes Am Prandt; auf dem Nonnenberg eine Hohe Brand. Nördlich von Kruppach, südlich des Arzbergs, befinden sich die Brändten. Im Engelthaler Wohngebiet links der Kruppacher Straße oberhalb der Ziegelei lagen im 16. Jh. drei Beete „uffm Brand“; spätestens seither war hier also kein Wald. In diesem Fall könnte der Name vielleicht alternativ auf die Ziegelbrenne-rei hinweisen. – Der vergessene Sengelberg (vielleicht der nördliche Sporn des Reschenbergs) erinnert wohl an dieselbe Methode des Brennens. An den meisten der genannten Orte sind die Bäume nachgewachsen. Wo Bäume mit der Axt gefällt werden, entsteht ein Schlag, also entweder ein ausgedünnter Wald oder eine Lichtung. Immer stehen dann „Stöcke“ herum, d. h. Baumstümpfe. Das G’stockeh, wie es rechts am Weg von Kruppach nach Deckersberg liegt, wird einmal so ein Schlag gewesen sein, ist jetzt aber Wiese geworden
62. Wird eine solche Fläche später zu Äckern umgebrochen, werden es
„Stuckäcker“63
, wie es sie nördlich von Sendelbach gibt. Meist aber wächst sie nach und bleibt ein Schlag, wie etwa der Rainschlag, Bocksschlag, Mühlschlag und andere in unserer Gegend. Rätselhaft ist der frühere Name „Brennschlag“ bei Peuerling, in welchem zwei verschiedene Rodungsarten zusammenfallen. Es gab übrigens noch eine letzte Form der Feldgewinnung, das Schwindroden. Hier wurden durch Schälen die Bäume zum Absterben gebracht. Diese Form
61
Die „bairische“ Form „Riad“ hat sich in der Oberpfalz in einem bis zur Naab reichenden begrenzten Gebiet zu „Richt“ weiterentwickelt. Als westlichster Ort dieses Gebiets trägt Dippersricht zwischen Kucha und Traunfeld einen solchen Namen. 62
Dass es zuerst ein Schlag blieb, und dann erst Wiese war, ist aus der Endung –eh zu schließen, die normalerweise „Gehölz“ bedeutet (s. o. zum Aileh). 63
Allerdings könnten die Stuckäcker auch nach dem Stuckweg benannt sein. Das wäre aber dann genauso ein Weg, der einst an einer Rodungsfläche vorbeiführte.
- 28 -
Se
fehlt in unseren Flurnamen; man muss bis in die Rüblandener Gemarkung gehen, wo sich eine Schwand finden lässt. Und natürlich gab es Neuaufforstungen. Das Kloster Engelthal muss einst das Gebiet südlich von Gersberg neu bepflanzt haben, da es „des Klosters Jungholz“ genannt wurde. Obwohl dort nun ein mindestens 500 Jahre alter Wald steht, heißt er immer noch Jungholz. Im Dialekt wird eine Neuanpflanzung „Broud“ (Brut) genannt, und auch hier noch dann, wenn die Bäume längst groß sind. So die Faalbroud bei den Sendelbacher Fauläckern, und die Vogelbrut, einst ein Vogelacker und zuvor ein Vogelherd (s. u.).
4f E
Se Kr
Pr E
Die Weinleite im Bereich der heutigen Frankenalbklinik64
und der Bienletten auf der anderen Talseite gegenüber (s. o.) erinnern an wichtige Wirtschaftsformen des Klosters. Wein wurde für die Messe benötigt, der Honig für die Speisen, das Wachs für die Kerzen im Gottesdienst. Weinberge bestanden schon zur Gründungszeit des Klosters, wie die päpstliche Urkunde zu Engelthal von 1248 belegt
65. – Hopfenanbau fürs Bier wurde im Dorf von vielen als Nebenerwerb
betrieben; in alten Engelthaler Karten sind viele Hopfengärtlein verzeichnet. In Sendelbach nennt sich hiernach der ganze Hopfengraben
66. Hanf baute man
evtl. am Kruppacher Haftacker an, falls damit der alte „Hanfacker“ aus den Urkunden gemeint ist. Auch Henfenfeld hat seinen Namen bekanntlich vom Hanfanbau. Zwei Kirschänger auf dem Prosberg dienten neben dem Viehtrieb auch dem Obstanbau. Den Schwarzbeerhübbl erreicht man vom Wanderpark-platz zwischen Engelthal und Sportplatz aus, indem man dem Weg zum Buchen-berg hinauf folgt. Dort am Hohlweg sammelt man die Beeren. Keine Einrichtung von Menschenhand, aber ebenfalls ein Faktor einheimischen Wirtschaftens.
4g E
Kh
Nun zum nicht-vegetarischen Speiseplan: Der Fröschweiher links am Engelthaler Ortsausgang in Richtung Offenhausen, die Schäfweiher links am Weg vom Schäfbauern zur katholischen Kirche, sowie die Krönweiher links und rechts der Brücke über den Eckenbach unterhalb des Krönhofs, sind alles Wiesen, keine Weiher. Aber sie waren es, wie die Dämme der Krönweiher und die Feuchtigkeit der Schäfweiher es noch beweisen. Der Fröschweiher und der kleine Schäf-weiher sind längst zu Bauland gemacht worden. Diese Namen erinnern an die Klosterzeit, da damals (und noch lange danach) Fisch fest zum Fastenspeiseplan gehörte: denn zur Fischzucht dienten natürlich die Gewässer. Und am Ort des ältesten Wohnhauses beim Schäfweiher an der Nonnenbergstraße stand spätestens 1565 ein Fischbehälter. Daran, dass Vögel genauso zum Speiseplan gehörten wie Fische, und das nicht
64
Der Klinikbau 1899 als Lungenheilanstalt führte zur ersten großen Veränderung der Flurform (Wege, Baumbestand) seit Jahrhunderten. Vorher wurde hier trotz Steillage noch geackert. 65
Abgedruckt bei Martini, S. 17-20; die Weinberge (vineas) S. 18. 66
Dazu der Hausname „Hopf“: Hof und Anbauflächen im Hopfengraben gehören zusammen.
- 29 -
Se Kr Pe Pr
E
E
nur im Mittelmeerraum, erinnern vielerorts die Vogelherde67
. Hier wurden mit unternehmerischem Engagement Lockvögel aufgestellt und Leimruten ge-schmiert, an welchen die angelockten Vögel hängen blieben. Diese endeten entweder als singende Käfigvögel – Vorläufer des Radios – oder oftmals in der „Vuglsubbm“ (Vogelsuppe). Die Vogeljagd war ein beliebter Sport aller Bevölkerungsschichten. Sie ist 1806, als wir bayerisch wurden, und nochmals 1888 verboten worden, und für die Vogelsuppe gibt es seither andere Zutaten. „Herd“ meint hier einfach einen „Grund“; er wurde aber speziell mit Ringgraben, Aufschüttung und Planierung präpariert. „Unsere“ Vogelherde befanden sich zwischen Sendelbach und Krönhof in den Bergäckern (Vogelwiese, Vogelbrut), bei Peuerling am Ockerbach, und zweimal westlich von Prosberg, wo sich der Name Vogelherd für ein ganzes Waldgebiet erhalten hat. Zwei weitere liegen auf Henfenfelder Gemeindegrund: Der „Hohe Vogelherd“ auf dem Berg links des Wegs von Engelthal nach Weiher, bzw. oberhalb von Schloss Henfenfeld, der auf den Karten „Klosterberg“
68 heißt, und der „Niedere Vogelherd“ nordöstlich
davon etwas bergab. Ob auch die Vogeläcker, die im 18. Jh. aus dem Wald der Klosterau umgebrochen wurden und zunächst dem Pfleger gehörten, ein einstiger Vogelherd waren oder einfach ein vogelreicher Ort, sei dahingestellt. Schließlich gab es auch für die Bedarfsdeckung an Wildfleisch schon lange andere Methoden als nur die reine Jagd in freier Wildbahn. Diesem Zweck diente einst der Thiergarten, eine große Flur bei der heutigen Siedlung „Am Kaiser Karl“, die teils Wiesen, aber auch Wald umfasst. Es handelt sich um ein früheres Wildgehege mit Jagdhütte, welches Philipp Jacob Tetzel im 17. Jh. anlegen ließ. Er war Amtspfleger von Engelthal, also der aus Nürnberg entsandte Verwalter, von 1660-69. Sein Ansinnen scheiterte tragisch; Johann Christoph Martini berichtet über 100 Jahre später von folgendem Unglück
69: „Dieser
Pfleger spazierte öfters aus Lust in dem zu Engelthal damals befindlich gewese-nen Thiergarten, mitten unter das daselbst gehegte Wild. Unter andern ging er mit einem Hirsch, den er zahm gemacht hatte, wenn ich so sagen darf, ganz vertraulich um, es traf ihn (den Pfleger) aber das Unglück, von demselben (dem Hirschen) in der Brunst-Zeit todt gestoßen zu werden. Das Skelett von dem Tier wird in der Anatomie-Kammer des Kollegiengebäudes der Universität Altdorf aufbewahret, und ist noch allda zu besehen.“ Der Tiergarten als solcher wurde wieder aufgelöst. Der Name ist geblieben.
67
Zum Ganzen s. Rusam, zu den Vogelherden bei uns s. Schroth, Spuren S. 15f und 37f. 68
„Klosterberg“ stimmt nur aus der Sicht der Bewohner Hersbrucks, die ein Kloster hinter diesem Berg wussten. Engelthaler Klosterbesitz ist er nicht gewesen. 69
Martini (1798), S. 119f.
- 30 -
4h
E
Pr Kh
Manche Tiere fängt man, weil man sie will, andere, weil man sie nicht will. So die Wölfe, die einst in unserem Land gefürchtet oder zumindest unbeliebt waren. Der bekannteste Wolf, mit dem Engelthal zu tun hatte, war vielleicht derjenige, der die verbotene Liebschaft einer Engelthaler Nonne auffliegen ließ. Er konnte allerdings nicht wissen, dass die Frau, die er bei einer Furt bei Lauf überraschte, als Botin einen Liebesbrief dieser Nonne bei sich trug. Vor Schreck ließ die Botin jedenfalls ihre Brieftasche ins Wasser fallen und lief davon. Als wiederum die Nonne von dem Verlust erfuhr, verhielt sie sich in ihrer Aufregung so auffällig, dass es Verdacht erregte und schließlich alles heraus kam. Die Unglückliche wurde in ein anderes Kloster versetzt, ihr Geliebter ebenfalls
70.
Wölfen versuchte man mit Wolfsgruben beizukommen71
. Die 3 m tiefen Gruben hatten Fallklappen, die mit Grünzeug verdeckt waren, und auf denen Fleisch ausgestellt war. Sie gaben nach, wenn ein Tier darauf trat, und so stürzte manchmal ein Wolf und manchmal ein anderes Tier hinein. Den Namen des Wolfsgartens im Engelthaler Forst führt Günther Schroth auf eine solche Wolfsgrube zurück. Das Waldgebiet liegt südlich des Sportplatzes zwischen Kaltenbrunnen und Höllgraben. Eine weitere Wolfsgrube gab es bei Prosberg in der Flur „Vogelherd“. Auch Schnecken können unbeliebt sein. Der Schneckenvatter gibt ein Beispiel, wie immer noch neue Flurnamen entstehen können, auch wenn sich dieser Name erst noch durchsetzen muss. Es handelt sich um ein Feld unterhalb des Krönhofs, dessen Besitzer von Sendelbächer Kindern auf ihrem Schulweg dabei beobachtet wurde, wie er Schnecken von seinem Roggen klaubte. Sie „tauften“ den Acker nach jenem fleißigen Mann.
5 Weitere Namen von Waldgebieten und Bergen
5a E
Kr
Der Reschenberg und das Hagenbuch bezeichnen einen Berg und einen Wald, die ungefähr deckungsgleich sind. Allerdings scheint heute eher der Bergname zu interessieren, während aus dem 16. Jh. nur der Waldname überliefert ist. Hagenbuch kann einfach „Hainbuchen-Wald“ bedeuten, wenn es nicht einst ein Hag, ein eingehegtes Stück Walds (aus Buchen) war (s. u. zum Hag von Prosberg). Der Wald hatte auch Unterabteilungen, etwa das Bachschläglein und die Försterwiese, die auch den schönen Namen Hasenhöpflein trug. Im Ganzen nannte man das Hagenbuch auch Klosterholz und sogar Klosterberg; diesen Namen trägt heute allerdings nur der Henfenfelder Vogelherd. Für den Reschenberg gibt es wohl zwei Deutungsmöglichkeiten. Mit „räs, ress, resch“ bezeichnete man früher die rasante Qualität eines Abhangs oder eines
70
Voit, Bd. I, S. 49f. 71
Folgendes aus Schroth, Spuren, S. 17 und 38.
- 31 -
Wassergrabens. Das passt gut dazu, dass die Westseite des Berges seine typische Gestalt von den so genannten Vorderen und hinteren tiefen Gräben
72
erhält, die sich eindrücklich von den obersten Schichten bis zum Bergfuß durchziehen. Dies dürfte die wahrscheinlichere Erklärung für den Namen sein, obwohl manche auch hier, wie beim Rösengraben (s. o.) an einen Ort der Flachsröste denken
73. In beiden Fällen wäre irgendwann der ganze Berg nach
einem seiner Teile benannt worden. Auffällig ist noch, dass die östliche „Rückseite“ des Bergs, und zwar auf der Kruppacher und der Leutenbacher Gemarkung, auf den Karten seit 1831 als „Eschenberg“ verzeichnet steht. Dies, obwohl vom 16. Jh. auch auf der Kruppacher Seite ein „veld auf dem Reschenperg gen Kruppach gehörend“ überliefert ist – das Feld ist heute verwaldet –, und obwohl die Einheimischen ausschließlich Reschenberg sagen. Früher sprach man ein r zwischen zwei Wörtern noch aus. Wer „Dereschenberg“ hörte, konnte verstehen „der Eschenberg“ oder „der Reschenberg“. Der ursprüngliche Name dürfte entweder nur „Reschenberg“ oder nur „Eschenberg“ gelautet haben. So könnte also drittens der Reschenberg seinen Namen von dort wachsenden Eschen haben. Aber nachdem der Kartograph von 1831 allein dasteht, wird er sich einfach verhört haben.
5b Kr
Kr
Kr
Kr
Der ganze bewaldete Südhang zwischen Reschenberg und Kruppach heißt Am Fuchsloch, und das ist wörtlich zu nehmen. Der oft sandige Boden wurde schon immer und bis heute gern von den Füchsen für ihre Baue genutzt. Oder wohnten sie aus dem Grund gern hier, dass unweit die Hühnerleite liegt? – Das Zankholz befindet sich auf der anderen Talseite; es wird durch die neue Straße nach Prosberg durchschnitten. Im 18. Jh. heißt es „Gemeinholz, das Streitholz genannt“ auf. Die Aufteilung der Flur in viele sehr schmale Streifen weist wohl darauf hin, dass um den früheren Gemeindewald so lange gestritten wurde, bis man ihn sehr genau an alle aufteilte. „Streithölzer“ gibt es immerhin auch anderswo
74. Die Flur heißt im Volksmund „Sagholz“, und vielleicht ist dies ein
ursprünglicher Name. Sagholz ist für die Sägerei bestimmt, es muss also gerade wachsen und darf nicht zu alt werden. – Östlich des Zankholzes ist der Buch-graben nach dem dortigen Buchenwald benannt. Der „Gräibuers“ (Grünbusch) befindet sich noch weiter östlich auf der Höhe, südlich von Oberkruppach. Grünbusch klingt einfach, ist es aber nicht. Man schrieb ihn in alter Zeit Grippuß, später Grinpus, Grimmbuß, Grimbunß, Grünbueß und sogar Brunen Burß
75. Heute sagt man „Gräibuers“. Das in der
72
So auch die heutige Bezeichnung der dortigen Waldabschnitte. 73
Die Wortform „Röschenberg“ (18. Jh.) ist unbedeutend: „e“ und „ö“ sind austauschbar. 74
Bsp. s. Zillinger. Allerdings kann „Streit“ auch zu „Struth“ (d. h. Gebüsch) gehören. 75
„Brunnen Burß“ stammt (wenn nicht Schreibfehler) von einer Quelle, die hier entspringt.
- 32 -
Schrift eingefügte r soll ebenso wie das e und das n in den alten Belegen einen leichten a–Klang andeuten, wie er im Dialekt weiterlebt. Das moderne Wort „Busch“ beruht offensichtlich auf einer selbst gemachten Etymologie des Karto-graphen: Er veränderte das Wort so, dass es einen ihm verständlichen Sinn erhielt. Das alte Wort „Bus“ hieß aber nicht „Busch“, sondern „Berg“, und stammt von mittelhochdeutsch „bûzen“ („herausragen“)
76. Falls das Bestim-
mungswort „grün“ heißt, würde das alte „Grippuß“ wie fränkisch „gräi“ eine Form mit entfallenem n sein. Tatsächlich ist der „Grünbusch“ eine grüne, bewal-dete Anhöhe oberhalb des Reichelsbachs zwischen Dammersdol und Hinten-bach. Man könnte aber auch darüber nachdenken, ob Grippuß sprachlich zu „Kruppach“ gehören sollte, so, wie es zu Kainsbach ein Keinsbühl und zu Sendelbach einen Sendelberg gibt. Die Vokale i und u wechseln manchmal, wie man es im Tal bei „ummer“ <> „immer“ hört.
5c Pr Kr Pr
Pr
Nahe bei Prosberg liegt, in Richtung des Vogelherds, das Waldstück Am Loh mit seinen Wochenendhäuschen. Hier gehört „Lohe“ zu „leuchten“; es war ursprünglich ein lichter Wald gemeint. Ein Acker bei einem „Löhlein“ (Lehel) gehörte ins angrenzende Kruppach. Vergleiche auch das Prosberger „Korzalou“ (Kurzenlohe, s. u.) und das Gersberger Kirchlohe. – Ganz im Südwesten von Prosberg, jenseits des Offenhausener Wegs, stoßen wir auf das Hag (Dialekt: „Balers-Hoch“, zum Paulusbauern gehörig), die höchste Erhebung auf Gemeindegebiet (598 m). Darauf soll einst eine Burg gestanden haben. Seine Kegelform würde sich für eine Burg eignen. Im Dorf Prosberg haben denn auch manche den zugehörigen Wirtschaftshof vermutet. Allerdings ist unklar, ob die „Herren von Hag“, die es tatsächlich gab, hier oder bei Oberkucha hausten, und es ist auch unklar, was der Münzschatz, der hier 1760 gefunden wurde, damit zu tun hat
77. Vieles bleibt also Spekulation. Leichter ist es, den Namen zu deuten:
Hag kommt wie Hecke von „(ein)hegen“; wir haben es mit einem ursprünglich umhegten Stück Wald zu tun. Dichte Hecken sind mindestens so wirksam wie Zäune. Aus einer anderen Form („Hagen“) ist in norddeutschen Dialekten „Hain“ entstanden.
5d E
Wenn man nun nach Westen übers Hammerbachtal geht, stößt man auf den Mühlschlag, also ein Gehölz, das nach der nahen Erdfallmühle benannt ist. Unter diesem Namen finden wir es aber erst seit 1720, als ein Teil des Waldes in die Wiesen umgebrochen wurde, die ebenfalls Mühlschlag heißen. Mindestens bis dahin hieß der ganze Wald Klosterau, oder Closterau, einschließlich der Waldabschnitte Lachengräben, Rösen- und Höllgraben und Wolfsgarten. Der eigentliche Auwald befindet sich nur im Bachnähe (s. o. zu Hirschbächlein und Eilach); es wurde aber der ganze große Waldbesitz des Klosters Engelthal in
76
S. Schnetz, S. 31, nach Zillinger, S. 60. Einen „Bus“ gibt es noch bei Hunas. 77
Giersch, Offenhausen, S. 121.
- 33 -
diesem Bereich so genannt. 1725 taucht für die Klosterau auch die Bezeichnung Herrenholz auf, womit man offenbar ausdrückte, dass der Wald von den Herren aus Nürnberg verwaltet wurde. Heute ist es der Engelthaler Forst.
5e Pe
Der Nonnenberg (zum Namen s. o. bei Geierstein) hat einige Waldabschnitte, die nach „Brunnen“ benannt sind – das ist immer eine Quelle mit dem daraus entspringenden Bach. So der Stierlbrunnen: „Stierl“/ “Sterl“ gibt recht schön die Aussprache vom fränkischen „Stiedel“ (kleiner Stadel, nicht Stier) wieder, der hier einmal gewesen sein muss. Unterhalb dieses Waldstücks ist die Sterlwiese; beide Orte sind tatsächlich auch als Stadelprunnen und Stadelwiß belegt. Zum Kaltenbrunnen s. o.; der Jägerbrunnen dürfte sich von selbst verstehen; der Teufelsbrunnen benannte sich nach einem Gersberg Bürger. Steigt in einem Küchenschlag Rauch und Nebel auf wie in einer Küche? Oder ist hier Holz für den Küchenherd? Berg- und Waldnamen mit „Küche“ sind weit verbreitet, ihre Deutung aber umstritten. Ein keltischer Ursprung (cuc = Fels) kommt kaum in Frage, eher schon ein germanischer (kuok = Hügel). Die Flur oben auf dem Berg heißt Platte, was sich als Bergplateau von selbst erklärt.
5f Pe
Nördlich des Nonnenbergs, zwischen Peuerling und Gersberg, befindet sich das Waldstück Glepflesberg (in Buchform „Klöpfelsberg“, in Urkunden auch Gletzlesberg). Ein eigentlicher Berg ist es nicht, sondern eher ein bewaldeter Rücken, der oben von der Straße nach Gersberg, links und rechts von Gräben begrenzt ist. Und der Name? Vielleicht kann man an die Knöpfchen, Klötzchen und Knubbel denken, die man sieht, wenn ein Wald frisch eingeschlagen wurde. Dann hätten wir es mit phantasievollen Beschreibungen von Baumstümpfen zu tun.
6 Weitere Namen von Wiesen und Äckern
6a Kr
Se
Se
Fluren können nach Bodeneigenschaften benannt sein. Auf einen feuchten Boden, etwa mit Seggengräsern, weist anscheinend das Sahrbühl bei Kruppach hin. Es handelt sich hier um guten Boden, aber selbst mit Drainage wird der untere Bereich des Bühls („Bügel“, d. h. „Hügel“) oft nass. „Sahr“ kann entweder ein dialektales „sauer“ nachahmen, oder vom alten Wort „saher“ (Sumpfgras) stammen. Ähnlich das Soarboch (früher „Sauerlenden“, d. h. „saure Länder“
78)
bei Sendelbach: darauf wuchs eine auf Feuchtwiesen spezialisierte Distel, und ihr „Seegras“, so wird berichtet, wurde zum Füllen von Matratzen benutzt. Auch der Name der dortigen Pinzewiesen (Binswiesen, jetzt Äcker), wohl von
78
Soarboch würde aber eher zu „Saherbach“ als zu „Sauerbach“ passen.
- 34 -
E
Se
Se
E
Kr
Kr Se Pe
Kr
Binsengras, geht in diese Richtung79
; ebenso vielleicht die Engelthaler Samper-wiesen zwischen Hammergasse und Kruppacher Bach: wenn sie wirklich mit den Ampferwiesen gleichzusetzen sind. Das f aus „Ampfer“ müsste dann weg-gefallen, das S dagegen nachträglich dazugekommen sein
80. Der Name ging
verloren, die Flur heißt jetzt „In den Gärten“. Sodann gab es einst ein Wort „Logen“ für „Sumpfwiese“. Viele solche Wiesen heißen heute Lohe, so auch die direkt nördlich an Sendelbach grenzende „Lou“. Sie wurde einst von dem Graben, der aus dem Aileh kommt, befeuchtet, aber der Graben ist heute verrohrt, die Wiese drainiert
81. Noch viel nasser war die Schwemm links des
Wegs, der in Sendelbach zum Bach hinunterführt. Es handelt sich um ein Schwemmland, welches den alten Bachverlauf noch erkennen lässt, meterhoch über dem jetzigen Bachbett. Eine künstliche Schwemme (Fachausdruck: Weth) gab es dagegen seit Klosterzeit bis ins 19. Jh. am Engelthaler „Pfarrhof“: Eine Weth (von „Wasser“) ist eine flache Grube, worin Pferde abgespritzt wurden. Der Kruppacher Kaltenbrunnen bezeichnet zunächst Quelle und Graben mit frischem („kalten“) Wasser, die im „Kaiser Karl“ entspringen und die Kruppacher Straße kreuzen. Unterhalb der Straße ist die ganze Flur danach benannt. Die Steinäcker am selben Weg, ebenso zwischen Sendelbach und Gersberg, sprechen für sich. Der Heckelgraben, der aus dem Buchenberg durch Peuerling und bis Sendelbach führt (dort Hopfengraben, s. o.), hieß auch Heckengraben und dürfte den Namen durch seinen Bewuchs erhalten haben. Ein altes Wort für Hecke ist auch „Zeile“. Das verlorene Kruppacher Wort Wasserzeil bezieht sich wohl auf eine Hecke an einem Bach oder Graben.
6b Kr E
Auch Form und Lage geben manchmal Namen. Kessel heißt der Talboden und Talhang rechts des Kruppacher Bachs, unterhalb der Stelle, wo der Bach sich besonders tief ins Tal gräbt. „Kessel“ wird hier die Talform beschreiben. Der Bereich ist zwar nicht rund, liegt aber wie eine lang gezogene Mulde deutlich tiefer als die Fluren am linken Ufer, oberhalb des Steilhangs. Der Kessel heißt im Volksmund auch „Kestl“. Das t dürfte sich nachträglich eingeschlichen haben, wie es im Dialekt auch sonst geschieht
82. – Am Kessel heißt auch das
79
Binsengras ist das, was oben unter „Stiegelwiese“ besprochen wurde. Das –e bei Pinzewiesen ist evtl. wie die Endung von „Aileh“ zu verstehen (s. o.) Vgl. dazu das Egensbacher Pinzig. 80
Ähnlich einmal bei „Aileh“ (s. o.). „Ampfer“ bedeutet übrigens auch „sauer“; „Sauerampfer“ ist also ein „Weißer Schimmel“. – Ganz anders könnte man auch an „s’Hammerwiesn“ denken. 81
Die „Lohe“ bezeichnet auch ein Extrakt, das fürs Gerben von Leder umständlich aus Eichenrinde gewonnen werden muss. Die Lou – so ganz ohne Eichen – scheint aber kein Ort der Gerberloheproduktion gewesen zu sein. Einen solchen Ort gab es aber im Gemeindeschlag auf der Peuerlinger Seite. Zu „Das Lohe“ (neutrum statt femininum) mit der Bedeutung „lichter Wald“ s. o. Auch „unsere“ Lóu wird im 17. Jh. einmal „das Lohe“ genannt, was aber angesichts der ältesten Form und der Dialektform falsch sein dürfte. 82
Vgl. „Lust“ zu „Lüß“ oder, mit d, „Schiedl“ zu „Schäl“ (s. o.).
- 35 -
Pr Pe Se Se Kr Pe Kh Se Pe Se Pe Pe Pe Se
angrenzende Stück Staatswalds, das zwischen Engelthaler und Kruppacher Flur bis an den Bach herunter reicht. Der Wald war ursprünglich ein Hutanger für Schweine. Das erkennt man nicht nur an den wenigen übrigen alten Eichen, sowie aus der Erzählung der Dorfbewohner, sondern weil er auch in der alten schriftlichen Überlieferung „Kesselanger“ heißt. In alter Zeit nannte man ihn auch Schelmanger. „Schelm“ bedeutet hier „Kadaver“; solche entsorgte man also auch hier (s. o. zur Liers). Nach der Landschaftsform sind auch die Grubäcker benannt, im Westen Prosbergs, wo es in Richtung Schrotsdorf abwärts geht. Das Peuerlinger „Deich“ im Bereich der Großwiesen benennt sich nicht nach einem ehemaligen Teich. Vielmehr bezeichnet das Wort im Fränkischen eine etwas abgesenkte Flurlage
83.
Der Name Klingenbühl, einer Flur westlich von Sendelbach, direkt auf der andern Seite das Bachs, lässt einen Hügel („Bühl“) erwarten, der von einer auffälligen Schlucht („Klinge“) geprägt ist, wie es von Klingenhof (Offenhausen) bekannt ist. Das ist bei unserem sanften Hügel zwar nicht der Fall, aber es gibt an seinem unteren Rand einen gewissen Abbruch. Noch besser könnte man die Stelle gegenüber, in welche sich der Sandbach gräbt, eine Klinge nennen. Ebenso nach Form und Lage gehen natürlich: alle Ranger/Ranken (d. h. Hangstücke am Bach); alle Leiten (d. h. Hanglagen am Talrand), auch als „Letten“ ausgesprochen, so die (!) Lettn am Sauweg östlich Kruppachs, gelegentlich „Leuten“ geschrieben
84; alle Hochäcker (in Kruppach statt
„Houäcker“ auch „Rouäcker“), und alle Bergäcker. Letztere gibt es zusammen mit den Stirnäckern nördlich von Sendelbach. Dies beschreibt, wenn es nicht doch von „Stier“ kommt
85, die Lage an der Kante vor den Bergäckern. Schließlich
gibt es bei Peuerling die „Großwiesen“ und „Langäcker“, dazu den „Langen Striegel“ (eine Flur in Streifenform), und wegen ihrer dreieckigen Form auch die Wiese mit dem schönen Namen „Kappenzipfel“. Ebenso der Form dürfte sich der Sendelbacher Acker „Röhllöffel“ (Rogllöffel = Rührlöffel
86), sowie die
Riegeläcker von Hallershof verdanken. Auf den Peuerlinger Langabwanden sind die Streifen so lang, dass sich das An- und Abwenden beim Pflügen richtig lohnt. Für eine „Reswiesn“ in Peuerling (früher auch Röß-, kaum Roßwiese) sind dieselben beiden Deutungen wie für Rösen oder Reschenberg (s. o.) denkbar. Die Mittelwiese verdankt sich der Lage am Mittelbrunnen (s. o.). Am „Schott-Nanger“ (Schottenanger) oberhalb Sendelbachs beiderseits des Bachs wird es keine Schotten gegeben haben, eher schon eine schattige Lage. Früher hieß der Ort Schattenkorb – wie es auch einen Haselkorb bei Happurg gibt.
83
Bsp. s. Zillinger. 84
Leutenberg, Leutenbach: da eu genauso wie ei fränk. ai gesprochen wird. 85
Vgl. den Sendelbacher „Stieracker“ des 18. Jh.s. 86
Ist das der Rühracker (jetzt Ruhacker) im Maienfeld? – Einst hieß „rugeln“ „schnell rühren“.
- 36 -
6c Kr
Pr Se Pe Kh
E
Se Pr
Manche Fluren heißen eindeutig nach ihren Besitzern, insbesondere in Kruppach: die Binnerleitn gehört zum Hausnamen Binner („Büttner“), die Hauswiesen (laut Karte aber „Großwiesen“) zum Hausbauer, der Mühlranger zur früher in Kruppach bestehenden Mühle
87, das Dammersdol zum Dammer-
hof (wohl nach der Kruppacher Aussprache von Thomas). Auch der Steffler, ein Feld beim Burweg, die Pfirsingwiese und der Schallersbühl klingen nach Perso-nennamen. Prosberg hat sein Balers-Hoch (Paulus-Hag, s. o.), Sendelbach sein Lousn-Bergl und seinen Hopfengraben (zu den Hausnamen Loos und Hopf), und Peuerling hatte das Schafferdeich und das Hafnerteichel (zu „Deich“ s. o; wer deren Besitzer waren, ist nicht klar
88). Zwischen Krönhof und Engelthal gibt es
das Bodersbrückla und den Bodershübbl, welche auf das Engelthaler Baderhaus verweisen. Der Häberlas-Hübbl östlich des Hersbrucker Wegs, die Schmied-wiese gegenüber dem unteren Tor und die Fallknechtswiese rechts und die Schmiedäcker links von der Liers beziehen sich auf ein Anwesen am Oberen Tor („Häberl“), auf die Schmiede und auf die ehemalige Abdeckerei. An der alten Klosterau liegen die zur Erdfallmühle gehörigen Mühläcker; dort lag früher auch die Überreither-Wiese, die zum Einkommen des Überreuthers, d. h. Land-polizisten, gehörte. Für Sendelbach kann man ferner das Mühlfeld (zur Henfenfelder Mühle) anführen, sowie hier und in Prosberg die Hirtenwiesen.
6d Pe
Pr Kr
Kr
Die Peuerlinger Wiese Im Ockerbach (Volksmund: „Eckerbó“) ist von ihrer Nachbarschaft her benannt. Der Name bezeichnet die Wiese in der Mulde zwischen Sportplatz und Rainschlag, und er leitet sich vom „Eckenbach“ her, der in der Fortsetzung der Mulde weiter unten im Graben am Rainschlag entlang fließt. Erst auf neueren Karten wird dieser Graben „Steingraben“ genannt; der Krönhof lag aber nach einer alten Angabe „auf dem Ekenpach“, was also der alte Name ist. Der Steingraben ist eigentlich nur der kleinere Nebengraben, der vom Weg zwischen Peuerling und Krönhof herab auf den Eckenbach stößt. Aufgrund von Nachbarschaft haben auch südlich von Prosberg die Fluren Am Kirchsteig und Gäßeläcker ihre Namen: sie liegen am Weg nach Offenhausen. Und nachdem es bei Oberkruppach die Wiese Am Reichelsbach gibt, muss wohl der Bach an dieser Stelle einmal Reichels- oder Reichensbach (so im 16. Jh.) geheißen haben, wohl nach einem Personennamen
89. Der Lagebeschreibung
nach scheint die Wiese, die unterhalb des Grünbuers liegt, früher Breiten- und Stockleite geheißen haben. Auch hier, westlich des „Hinterbachs“, gibt es einen Gaßacker.
87
Genannt bereits im Engelthaler Salbuch 1312. 88
„Schaffer“ nannte man zur Klosterzeit die Verwalter; man könnte aber auch an einen Schäfer oder einfach einen Personennamen denken. Genauso kann „Hafner“ Beruf oder Name sein. 89
Vgl. Reichenschwand aus Reichels-Wang.
- 37 -
Kh
E
E
E Pr
Die Brunnwiese, und auch das Brunnholz des Krönhofs weisen auf das kleine Wasser hin, das hinter dem Hof auf den Eckenbach zufließt; die Brunnäcker Engelthals (längst Wohngebiet) auf das Wasser, das vom Schießanger herkommt (wohl auch einst Bienletten-Brunnen genannt). Die versteckten Weiherwiesen östlich oberhalb Engelthals liegen zwischen dem Kruppacher Bach und dem Mühlbach der Pfistermühle; auch hier gab es einst einen Fischweiher. Die Kruppacher Wiese hier liegt an der Straße nach Kruppach. Das Prosberger Kurzenlohe ist Ackerland, der Name weist aber auf ein lichtes Wäldlein hin, das es dort gibt oder gab (s. o. zu „Am Loh“). Auf Breitenbrunner Seite schreibt man „Kotzenlohe“, was genau die Dialektform desselben Namens ist.
6e E
Pe
Pe E
Eine Kuriosität stellt zuletzt die Sauwiese am Sauweg dar. Letzterer ist der Weg, der längst zur Peuerlinger Straße ausgebaut ist, aber auch die umliegenden Äcker heißen „Am Sauweg“. Eine Kuriosität deshalb, weil die Wiese (und ähnlich der Weg) seit ihrer frühesten Überlieferung im 16. Jh. immer parallel Sau-, Zau- und Au-Wiese hieß. Man konnte sich einfach nicht entscheiden. Wurden hier entlang die Säue getrieben, vielleicht bis hin zum Sauplatz zwischen Peuerling und Krönhof? Gab es hier einen Zaun (fränkisch ungefähr „Zau“; einmal ist tatsächlich „Zaunwiese“ überliefert)? Vielleicht ist dies auch die Stelle, die in Peuerling „unten an den zeunen“ hieß. Und überhaupt: es war doch einfach die Wiese, die eben neben der Kloster-Au lag (s. o.)! Sagte man „I gäi z’Auwiesn“ („Ich gehe zur Auwiese“), bis unversehens „z’Au“ zu „Zau“ wurde?
90 Oder „I gäi
in d’Sauwiesn“ („Ich gehe in die Sauwiese“), so dass aus „d’Sau“ „Zau“ ent-stand? Oder hat man „Zau“ gesagt und fälschlich als „d’Sau“ verstanden?
91 Aber
alle drei Namen scheinen auf ihre Art „korrekt“ zu sein, also die Realität wieder-zugeben. Offensichtlich wussten das die Menschen über die Jahrhunderte hin und benutzten immer alle drei Namen. Nur wir heutigen Engelthaler, die keine Kloster-Au mehr kennen, und hier auch keine Zäune mehr aufstellen, aber auch keine Säue mehr hüten, haben uns aus irgendeinem Grund für „Sauwiese“ entschieden. Die Peuerlinger Seite jedoch hat die Namen auf Auäcker beschränkt. Das „Saudrecksängerlein“ hingegen, das erst bei den jüngsten Rodungen im 18. Jh. zwischen Sauwiesen und Auwald zur Wiese wurde, ist vom Namen her eindeutig. Hierher können nur Säue getrieben worden sein.
90
Die Präposition „zu“, verkürzt zu „z“, wird in der Region für Ortsangaben benutzt. Bekanntes Beispiel in Kruppach ist die Wendung: „Ort mit Z? Zgrubba!“. Vielleicht ist so auch das uralte Zulleinsperch zu verstehen: „zum Berg des Ullein“ (s. o. zur Rainegert). 91
Von der Schwierigkeit, z und s zu unterscheiden, zeugt auch der Schreiber des Zetterbergs (16. Jh.), der einmal Z schrieb, dann durchstrich, dann Sattenberg schrieb.
- 38 -
7 Namen von Wegen
Bei den Verbindungswegen zwischen Engelthal und den Nachbarorten gibt es oft zwei Varianten. Dann existiert ein Sauweg oder Viehtrieb auf der einen, und ein Kirchweg auf der anderen Seite. Es legt sich nahe, dass manche Wege für „sauberere“ Fahrten reserviert blieben. Die Kirchwege von Sendelbach und Peuerling trafen sich – nach Erzählungen – bei der Rainegerten und führten zur Brücke bei der heutigen Kläranlage; sie folgten also dem heutigen Wanderweg „Blaukreuz“. Sowohl der Sauweg von Peuerling über die Liers als auch der weitere Kühesteig von Sendelbach her sind heute zur Straße geworden, wo-gegen die Kirchwege fast verloren sind. Von Kruppach nach Engelthal wurde ab 1863 (vorher war der Ort nach Offenhausen gepfarrt) der „Untere Weg“ als Kirchweg genutzt; der Kirchweg überquerte aber vor dem Kesselanger den Bach. Dies sicher deshalb, weil der Anger als Schweinehut genutzt wurde.
7a Kr
In Kruppach heißt die heutige Fahrstraße in Richtung Engelthal Hintergaß (1561 auch als „Sintergaß“ überliefert, also „‘s Hintergaß“). Der Weg, der durch den Kessel führt, und später Kirchweg nach Engelthal war, heißt dagegen Unterweg. Die Hirtengaß, die als Anwandweg zum Zugang zu höherliegenden Feldern diente, hat ihren Namen vom hier befindlichen ehemaligen Hirtenhaus. Die Straße nach Deckersberg hieß Sauweg und erinnert natürlich an den Sautrieb. Der Fuhrweg von Unterkruppach über den Berg nach Leutenbach und letztlich Hersbruck heißt Burweg. Der Weg nach Hersbruck wird in der Kruppacher Gemeindeordnung von 1561 sinnvoller Weise als „Puhelweg“ bezeichnet. Somit wird „Bühlweg“, „Weg über den Berg“, auch der Namensursprung sein. Über späteres „Pürweg“ entwickelte sich die heutige Form. Vielleicht entfiel das l von Bühl wie beim Wäschblei, und schlich sich ein a ein wie bei der Liers. Sowohl von Unter- als auch von Oberkruppach aus führte bis 1862 ein Kirchweg über Prosberg nach Offenhausen. Ersterer Weg heißt auch Schlaichla; nach dem gleichnamigen Waldstück oben am Weg, was gern die Deutung als Schleichweg hervorruft. Laut Karte heißt das Wäldchen dagegen „Schläglein“, was vielleicht den ursprünglichen Sinn wiedergibt. Der zweite Weg, von Oberkruppach aus, ist ein Hohlweg und wird auch so genannt; er war für Gespanne befahrbar. Später gab es dann den „neuen“ Prosberger Weg durch den Buchgraben hinauf, der aber als einfacherer Rotweg (s. o.) schon vorher existierte. Die neueste Variante ist jedoch die asphaltierte Straße nach Prosberg durchs Zankholz.
7b Pr
Von Prosberg führt schon immer der Kirchsteig weiter in Richtung Offenhausen. Der Engelthaler Weg führte nicht den heutigen Wanderweg entlang durch den Kaiser Karl hindurch („Grüne 7“), sondern auf der Höhe entlang und erst dann bergab am Engelthaler Steinbruch vorbei, von dort schräg rechts abwärts – steil und heute stark verwachsen – und ab der großen Wegkreuzung am Rand des
- 39 -
Gänsangers (daher auch: „Prosberger Anger“) entlang. Der Prosberger Fußweg dagegen verlief auf der anderen Seite desselben Angers, am Rand des Tier-gartens entlang.
7c E
Von Engelthal wurde die Hammergasse schon besprochen, die ursprüngliche Straße nach Henfenfeld. Außerdem gab es auch in jede Ortschaft, anders als heute, einen eigenen möglichst direkten Weg. Der Entenberger Weg führte über die Schafbrücke und die Liers hinauf und auf dem Gemeinde-Viehtrieb (Schmiedgasse) zum heute so genannten Mühlanger, dann das Aubächlein entlang – hier auf dem damals so genannten Closterweg, heute Forststraße –, sodann links des Höllgrabens weiter hinauf. An der Stelle, wo heute der Weg nicht weiter ansteigt, sondern auf eine T-Kreuzung stößt, schloss sich ein Hohl-weg an, der direkt zur Kappéchern (s. o.) hinauf führte, aber jetzt ziemlich zugewachsen ist. Insgesamt weiter links verlief der Altdorfer Fußweg, der wenigstens noch 1831 von der Erdfallmühle aus zu einer heute recht versteck-ten Brücke über den Hirschbach führte, um auf direktem Weg in den Mühl-schlag und an die Lachengräben zu gelangen; dann bergauf durch den „Schwarz-beerhübbl“ und in einem jetzt zugewachsenen Hohlweg den steilen Grat hinauf; schließlich ab der Steinernen Rinne auf dem Buchenberg südwärts. Neben dem Sauweg und dem Kirchweg nach Peuerling gab es dorthin auch den Peuerlinger Fußweg. Er führte von der Brücke an der jetzigen Kläranlage aus über die Hochwiesen und etwa zum Stutzkreuz (s. o. zum Kreuzfleck). Der Hers-brucker Weg, der in Engelthal als Asphaltstraße existiert, verläuft bis heute ab dem „Hersbrucker Hutanger“ als Forststraße über den „Ruhestein“ als höchsten Punkt und über Weiher nach Hersbruck. Unterbrochen wurde der Weg erst durch den Bau der Engelthaler Volksschule. Schließlich sagen die Alten zu der vom Oberen Tor aus nach Kruppach führenden Straße bis heute Webersgaß; seit dem 17. Jh. können in den Häusern am Oberen Tor die hier wohnenden Weber nachgewiesen werden
92. Sie war früher ein tiefer liegender Hohlweg.
Natürlich gab es auch kleinere Erschließungswege. Der Heuweg führte in die Sauwiesen. Als seine Fortsetzung, in der Nähe des heutigen Feuerwehrteichs, gab es dazu eine Lederne Brücke über das Aubächlein bzw. in den Peuerlinger Anger; dem Material nach war die Brücke eher für Fußgänger gedacht. Der Viehtrieb in Richtung Mühlanger hieß auch Schmiedgasse, weil die nächst-liegende Wiese dem Engelthaler Schmied gehörte. Im „Frauental“ gab es den Schleifweg, der in den Graben hinunter führt. Damit ist eigentlich kein befestig-ter Weg gemeint: Auf Schleifwegen wurden allerorten entweder Hölzer aus dem Wald gezogen, was bei der Lage „Frauental“ denkbar ist. Oder man meinte den Bereich am Feldrand, wo der Pflug zum Wenden herumgezogen wurde, so dass auf dieser Spur der Boden fester statt lockerer wurde und die Saat später nicht
92
S. Binder, Leinweberei.
- 40 -
gut aufging. Oder zog der Abdecker hier Tierkadaver herbei? Das Wort kommt jedenfalls von „schleifen“ im Sinne von „schlüpfen“ (nicht „schärfen“).
7d Pe
Peuerling kennt außer den genannten Wegen nach Engelthal auch einen Sendelbacher Weg, der vor dem Ortseingang nach Krönhof abzweigt. Ein Nebenweg dazu ist der Hohlweg. Interessant ist auch der alte Gersdorfer Weg. Von ihm ist oberhalb der Gersberger Straße, kurz nach Ortsausgang, im Wald noch ein verwachsenes Hohlwegbündel sichtbar, das vom Heckelgraben aus zunächst in einer Kurve bergauf führt und später einer Rinne im Gelände folgt und so den Nonnenberg umgeht.
7e Se
In Sendelbach gibt es in Richtung Krönhof den Kirchsteig durch die Lohe (auch Lohweg), und etwas weiter rechts den Kühesteig, auch Espan-Weg und Engel-thaler Weg, der inzwischen geteert ist genauso wie der Henfenfelder Weg. Der Stuck-Weg ist der Weg an den Stuckäckern vorbei; er verband den Krönhof mit dem Gänsbrücklein (beim Gänsanger) nach Rüblanden. Die direkte Verbindung Sendelbach-Rüblanden gewährleistet der Closterweg. Zwei alte Einträge berichten von einer Meiergaß, die offensichtlich zum „Maienfeld“ gehört und außerdem an das Krönholz stößt. Sie muss mit dem Stuckweg oder mit dem Fuhrweg vom Krönhof zum „Sässer Graben“ nach Henfenfeld identisch sein. Der Großenweg, der parallel zwischen Stuckweg und Lohweg verläuft, ist nicht groß. Ursprünglicher wird der alte Name des 16. Jh.s, „grasiger Weg“, sein. In der Tat handelt es sich nicht um einen ausgebauten Weg, sondern eher um einen Streifen aus Raingras am Ackerrand. Die Hirtengaß nach Gersberg ist jetzt ebenfalls Straße. Sie hat ihren Ausgangspunkt am Sendelbacher Hirtenhaus.
8 Ortsnamen
8a E
Engelschalksdorf, ein Ort mit drei Höfen, deren genaue Lage wir nicht kennen, die aber irgendwie im Kloster Engelthal aufgingen, ist nach seinem Erstbesitzer benannt, der den Personennamen Engelschalk trug (vergleiche den Ortsnamen Englschalking). Zwei bekannte Träger des Namens, der „Knecht aus dem Volk der Angeln“ bedeutet, waren im 9. Jh. Markgrafen in Pannonien (Niederösterreich). Ortsnamen mit -dorf sind oft weniger alt als solche, die auf -hausen oder gar -heim enden.
8b E
Engelthal ist ursprünglich nur der Name des neu gegründeten Klosters; ein Name, den die Nonnen laut der ersten Gründungsurkunde von 1240 verwenden wollten
93. Er hat sich als Dorfname neben „Schweinach“ erst in den späteren
93
StAN Urkunden RSt Nürnberg 3 (28.7.1240). Gegen Voit halte ich diese eine Urkunde bzw. ihr Datum nicht für gefälscht, da es dafür keinen echten Grund gibt.
- 41 -
Jahrzehnten durchgesetzt. Das religiöse Motiv steht im Vordergrund und ist typisch für Klostergründungen jener Zeit
94. Jedoch dürfte auch der Name von
Engelschalksdorf inspirierend gewesen sein. Engelthal brachte es, so kann man augenzwinkernd sagen, zu einem eigenen Vorort mit Namen. Er entwickelte sich am Oberen Tor bei der damaligen Ziegelei seit dem 17. Jh. außerhalb der Klostermauern. Er trug in der Bevölke-rung bis vor ein, zwei Generationen den eher kurzlebigen Namen Vorstadt.
8c E
Die Erdfallmühle ist womöglich mit einer Zollstation zusammenzubringen. Für das Wort „Fall“ finden sich nur problematische Deutungen, aber diese scheint mir die passendste zu sein. Es wurde zwar an das „fallende“ Wasser der ober-schlächtigen Mühle gedacht (im Gegensatz zu anderen Mühlen, deren Rad auf fließendem Wasser sitzt). Gustav Voit suchte gar einen „Wall“
95. Zu beidem
passt aber nicht die älteste Überlieferung des Namens als „Mül im Erdfall“ (Ende des 16. Jh.s). Was bedeutet das? Am hier befindlichen sanften Abhang ist ja kaum an herabgefallene Erde, einen Erdrutsch, zu denken!
Dagegen war mit
manchen Orten ein „Fall“ im Sinne von „Zollstation“ verbundenen. Ein solcher Ort ist die an der alten Grenze bei Weigenhofen im Högenbachtal im 13. Jh. bezeugte „Mühle auffm Vall“
96 (auch im 16. Jh. erinnerte man sich noch, dass
bei dieser Mühle einst „ein vall gestanden“). Der Name Fallmühle existiert dort bis heute. Eine solche besteht auch bei Pfronten im Allgäu
97. „Fall“ erklärt sich in
diesem Zusammenhang dadurch, dass man hier eine Abgabe leistete, ein so genanntes „Gefälle“ (daher der Ausdruck „es wird eine Zahlung fällig“). An Fallgatter oder Fallbäume, womit die Passage verwehrt werden kann, braucht man gar nicht zu denken. Die Erdfallmühle (so bezeugt im 16. Jh., ohne Namen schon im 13. Jh.) liegt nicht direkt an einer Grenze. Aber das kann in früherer Zeit anders gewesen sein, z. B. als sich Peuerling noch burggräflicher Besitz befand. In dem Bereich endete damals die westliche Ausdehnung der Reichen-ecker Herrschaft. Auch mussten bereits mittelalterliche Eisenindustrie und Handel des Tales ein System der Verzollung haben. Es gab also eine sinnvolle Verwendungsmöglichkeit für eine Zollstation am Standort. Dagegen bleibt der Namensteil „Erd-“ unerklärlich. Voit schlägt vor, dass es ursprünglich „Erbfall“ hieß. Das ist aber unbefriedigend, da vor einem f eher d zu b wird als umgekehrt. Ob man an „Erz“ oder „Ort“ denken soll?
94
Vgl. die Klöster Engelberg, Gnadenberg, Frauenthal, Gnadenthal usw. Die „typische“ Schreib-weise mit th ist erst aus späterer Zeit, und findet sich nicht in den mittelalterlichen Urkunden. 95
Dann wäre „Wall“ erst „Vall“ geschrieben worden, und das wiederum als „Fall“ gelesen worden. 96
Quellen bei Zillinger, S. 90. 97
Laut Homepage dieser Mühle mit Gaststätte (erbaut wohl im 18. Jh.), hatte das Anwesen mindestens seit 1827 eine integrierte Zollstation; in der Tat geht es hier zur Grenze nach Tirol hin.
- 42 -
8d E
„Hammerbachtal“ ist wohl eine relativ neue Bezeichnung, da der Bach zunächst je nach Ort anders hieß: etwa „Offenhausener Bach“, „Wöhrbach“, „Mühlbach“, weiter unten „Stiegelbach“. „Hammerbach“ (belegbar seit etwa 1550) galt zunächst nur dem Bereich der Hammerbrücke, wo sich an dieser Stelle einst der Eisenhammer befunden haben muss (s. o. zur Hammergasse). Erst später übertrug man den Namen aufs Ganze.
8e Kh
Der Krönhof wurde 1350 Crunnhof, 1538 Cranhof, 1547 Krönhof, 1594 Kronhof geschrieben, heute „Gräihuf“ gesprochen. C, k und g waren austauschbare Buchstaben für denselben Laut. 1565 taucht der Personenname „Creeinherff“ (Krähenhof?) auf, der sich vom Krönhof ableiten könnte
98. Man könnte, je nach
Beleg, den Ort von „Wacholderhof“ oder „Krähenhof“ herleiten, von „Grünhof“ oder gar „Kronenhof“. Wacholder hieß althochdeutsch „cran“ (auch Kranewit), Krähe hieß krâja, und grün hieß „grouni“. Letzteres passt zum Vokal von 1350 und zum heutigen Mundartnamen. In einem Eintrag des 16. Jh.s mischt sich „Brunnfleck“ (Quell-Wieslein, beim Krönhof) mit „Grunfleck“ (Krön-Wieslein), was vermuten lässt, dass man „Krön“ bereits damals als „grün“ verstand.
8f Kr
Bei Kruppach ist auf den Gebrauch und auf die Aussprache des Namens zu achten. Gebraucht wird der Name heute nur für das Dorf. Wie so oft heißt der Bach einfach „Bach“, und nur wer auswärts wohnt, sagt „Kruppacher Bach“. Unklar ist, ob Nöttelein 1565 mit „Kruppach fl[uss]“ „der Bach aus Kruppach“ oder „der Bach Kruppach“ meinte. Derselbe Bach hieß in Engelthal auch Schmiedbach oder Wilbaldsbach, da er am Schmiedtor und hinter der Willi-baldskapelle vorbeifließt. Zur Aussprache: Das Dorf heißt bei den Einheimischen „Grubba“ mit kurzem a, also anders als „Sendlbo“ (Sendelbach), „Eckerbo“ (Eckenbach) oder „Ellerbo“ (Ellenbach) mit langem o. Kurzes a haben auch „Käischba“ (Kainsbach), „Grum-ba“ (Ober- /Unterkrumbach), sowie „Hosla“ (Haslach). Es gibt zwei alte Wörter für „fließendes Wasser“: der Bach und die Ach. Wegen des kurzen a liegt es nahe, dass Kruppach von Krupp-Ach kommt, wie es eindeutig bei Schweinach am selben Bach (s. u.) und bei Haslach der Fall ist. Weil aber „Käischba“ nach Auskunft der Ortsnamenforscher „Kunos Bach“ heißt, wäre auch ein ursprüng-liches Krupp-Bach möglich. Vielleicht kann man dann schließen, dass „-Bach“ direkt nach betonter Silbe zu -ba wird, aber nach einer Zwischensilbe zu -bo. Aber was heißt der erste Wortteil? Die Schriftform mit Kr- und die dialektale Aussprache mit Gr- verraten natürlich nicht, welchen Wortanfang man sich denken soll, weil Kr und Gr in unserer Region schlicht dasselbe sind. Entscheidend ist wohl die erste Nennung 1312 als „Chrupach“. Ein Ch entstand
98
Cuntz Creeinherff (?) erwirbt 1565 das Engelthaler Schafgut erblich: Also „Konrad Krönhofer“?
- 43 -
aus K, nicht aus G99
. Interessant ist auch das kurze u von „Grubba“. So gesehen, kommen wir damit wirklich auf einen Namen mit „Krupp“. Aber was ist das? Es folgen vier Erklärungsvorschläge, in Reihenfolge ihrer Wahrscheinlichkeit
100:
Man kann entweder hinter „Krupp“ ein „krumb“ suchen, und Kruppach an Orte wie Krumbach anlehnen, die Herbert Maas als Flussnamen, also „krumm fließende Ach“, interpretiert. Tatsächlich fließt der Bach in drei großen Bögen und vielen kleinen wunderschönen Windungen. Voraussetzung: dass aus mb wirklich pp wird
101. Oder man kommt, wie zweitens Christoph Beck es tut, mit
einem ähnlichen Grundwort („gekrümmt“), auf ein Gehölz mit „verkrüppelten“ Bäumen. Die ersten Siedler hätten ein solches an diesem Wasser gefunden: „Krüppelgehölz-Ach“
102. Problem: Gab es wirklich so ein Wort?
103 Drittens
schlägt Michael Bacherler „Grub-Ach“ vor104
. Das könnte man zwar passend mit den einstigen Erzgruben verbinden, die es teilweise noch gibt. Großes Problem: das schon erwähnte Ch von 1312. Das kurze u in Grubba könnte man trotz des langen u von „Grube“ (Dialekt: „Groum“) noch so erklären, dass es vor dem Doppel-b in „Grub-Bach“ verkürzt sein könnte. Die vierte Deutung ist die älteste: Paul Pfinzing schrieb fast 300 Jahre nach der Erstnennung „Unter-Grundbach“ für Unterkruppach in seinen Atlas. Diese Deutung hat das größte Problem: ihr widerspricht das Ch und das nd.
8g Pe
Von Peuerling lässt sich dagegen ziemlich eindeutig sagen, dass ein schlichtes „Häuslein“ den Namen gab. Althochdeutsch hieß ein Haus oder Gebäude „bûr“
105, ein Häuslein „buwerlin“. Die älteste schriftliche Form des Orts von
1312 hieß passend „peuwerlingen“. Ganz regulär wurde hier aus altem langen û ein au, und hieraus bei Umlaut, d. h. wenn ein i folgte, ein äu, früher auch eu oder ew geschrieben. Man kann gut vergleichen: althochd. „bur, buwerlin“ <> neuhochdeutsch „Vogelbauer, -bäuerlein“ wie „hus, husir“ <> „Haus, Häuser“. Allerdings war aus der Endung –lin ein –ling geworden, sicher aus dem Grund,
99
Die Dialekte im Alpenland beweisen, dass aus k ch entstand, während g unverändert blieb. Vgl. österreichisch „(k)chloa“ aus „klein“, aber „glei“ aus „gleich“. So war es im Mittelalter auch in unserer Region, aber dann gab es eine Rückentwicklung von ch zu k und sogar von kl zu gl. 100
Dass weder die Kruppe (Kreuz beim Pferd), noch die Krupp-Krankheit (abgeleitet aus Schottisch „croup“) gemeint sind, dürfte sich von selbst verstehen. 101
Immerhin ist von 1504 die Namensform „Krumpach“ überliefert. Auch halten Germanisten „krumb=krumm“ für verwandt mit urgermanisch „krupp“; aber es entstand nicht direkt daraus. 102
Vergleichbar ist vielleicht der lokale Ausdruck „Grimberla“ für Äste und Zweige zum Heizen. 103
Immerhin könnte man „Gletzlesberg“ (s. o.) vergleichen, ein Gehölz mit Klötzen, Knubbeln o. Ä. 104
Es gibt viele Ort und Fluren „Grub“, „Grubäcker“ usw., wo auch wirklich Mulden vorhanden sind (Zillinger S. 122). Bei Grubach bei Pollanden/Berching ist das „u“ lang, in den Urkunden heißt es hier 1183 von einem Ort in der Grube, 1604 von der dortigen „Grueb“ (lang!) (s. Bacherler). 105
Das Wort steckt noch im heutigen „Vogelbauer“ („Vogelkäfig“).
- 44 -
dass es andere Ortsnamen mit –ing gibt wie etwa Pötzling106
. Die „echten“ –ing-Namen stammen oft aus der Zeit der frühesten bajuwarischen Besiedlung. Zu diesen Orten gehört Peuerling also nicht, obwohl man das manchmal noch liest.
8h Pr
Prosberg trägt diesen Namen eindeutig bei seinen eigenen Bewohnern (sprich: „Bråsberch“, neuerdings auch „Monte Prossi“), während die Engelthaler gern auch „Drosberg“ (und zwar heute wie bereits 1443!) und die Offenhausener gern „Groußberg“ sagen. Der Wettstreit kann aber entschieden werden: In den Urkunden, und zwar schon 1312, wurde der Ort als Prosberg verzeichnet, und nochmals 30 Jahre früher trat hier ein Herr Berthold von „Brachsberg“ auf. Im Dialekt kann „Brachs“ leicht zu „Brås“ werden. Wegen des Genitiv–s kommt das wohl von einem Personennamen her, jedenfalls nicht von „Brache“. Damit wäre das Dorf als „Brachs Siedlung auf dem Berg“ entstanden. „Brechtsberg“ könnten wir dazu sagen
107. Es ist anzunehmen, dass der Berg nach dem Dorf benannt
wurde und nicht umgekehrt. Für den Berg (oder nur einen Teil davon?) ist denn auch ein älterer Name „Flohensberg“ aus dem 18. Jh. überliefert. 1525 taucht auch die Form „Probstberg“ auf
108, 1725 „Probsberg“. Ein Propst ist
ein Verwalter von kirchlichen oder klösterlichen Gütern. Auf der Hersbrucker Seite des Reschenbergs liegt tatsächlich ein „Propsteiholz“, welches auf die alte „Probstei Hersbruck“ zurückgeht, als Hersbruck noch den Besitz von Kloster Bergen verwaltete. Dass aber Prosberg einst Teil der Probstei gewesen wäre, ist nicht bekannt, und nach 1500 war das ganz sicher nicht der Fall. Man wird mit „Probstberg“ eher versucht haben, den Namen Prosberg nachträglich, und in Anlehnung an „Klosterberg“ und „Nonnenberg“, als kirchlichen Namen zu deuten. Moderne nachträgliche Deutungen wie „Krachberg“ (mittelhd. „braht“ kann „Lärm“ heißen) oder „Sproßberg“ („Brosholz“ bezeichnet junge Zweige von Laubbäumen) ergeben erst recht keinen echten Sinn
109.
8i E
Schweinach würde heute unsere Gemeinde wohl heißen, wenn der Ort nicht im 13. Jh. in „Engelthal“ umbenannt worden wäre. An Stelle der jetzigen Willibaldskapelle stand seit vor 1060 die Kirche von „Swinahe“ (so die überlieferte mittelhochdeutsche Form, lateinisch Swina). Es befanden sich am hiesigen Wasser (also jener „Ach“, die von Kruppach her fließt) also einst wilde oder domestizierte Schweine. Dieser Ortsname ist nicht selten; es gibt ihn noch
106
Pötzling aus „Siedlung der Sippe des Pozzo“. S. Bacherler und Beck. 107
Brecht, in manchen Dialekten Brachs/Prax, ist Kurzform von Berthold. Vgl. auch das schweizerische Geschlecht der Zähringer, die meist Berthold hießen und eine Burg Brachsberg errichteten. 108
Hier gab es ein Bergwerk: Giersch, Offenhausen, S. 104, nach StAN, RStN, Ämterrechungen Engelthal VII 840. 109
So Bacherler, S. 38, und Beck, S, 126.
- 45 -
in Neustadt/Aisch, als Schweina bei Gunzenhausen und als Schweinau, ehemals Schweinach, in Nürnberg
110.
8j Se
Für Sendelbach hat es sich eingebürgert, zwei Deutungsvorschläge zu machen, und sie unentschieden zu lassen. Aber es ist komplizierter. Die Autoren denken entweder an Sand, den der Bach führt, oder an eine Fischart „Sandel“. Dies ist angeblich ein alternativer Name entweder für die Elritze oder für den Zander
111.
Man fragt sich im ersten Fall, ob so ein kleiner Fisch (max. 10 cm) namengebend für einen Bach sein kann. Und man fragt sich im zweiten Fall, ob ein großer Raubfisch, der dem Hecht Konkurrenz macht und sehr tiefes Wasser braucht, in unserem Bach je vorkam. Eine Fischart als möglicher Namensgeber dürfte wohl ausscheiden. Sendelbach trägt den ältesten überlieferten Namen in unserer Gemeinde, und zwar aus dem Jahr 903, in der Form „Sentilapah“. Verglichen wird gern ein nördlich von Bamberg gelegenes und erstmals 802 genanntes Dorf namens „Sentinabach“, was gut als „sandener Bach“ verstanden werden könnte. Wenn unser Dorf denselben Namen getragen haben sollte, dann wäre ein Wechsel von n zu l vorauszusetzen
112. Einen solchen Wechsel finden wir
auch in einem Peuerlinger (Heckengraben/Heckelgraben) und einem Kruppacher Flurnamen (Reichenspach/Reichelsbach)
113. Wäre dagegen das l in
„sentila“ ursprünglich, müsste man es als „Sändlein“ übersetzen. Für unseren Bach hat sich der Buchname „Sandbach“ durchgesetzt, der als moderne Nachbenennung anzusehen ist. Immerhin fallen im nördlichen Bachlauf bis zur Bahnlinie Ablagerungen ausgeschwemmten Sands auf; diese Ausschwemmung beginnt beim sandhaltigen Soleh. Auch ragt hinter dem Dorf wenige Meter über dem Bach ein Sandsteinfels aus dem Steilufer. In der bisherigen Diskussion wurde vielleicht eine Quelle übersehen. Und zwar hat Paul Pfinzing im 16. Jh. die nördlich des Dorfs gelegene Anhöhe zwischen Rüblanden und Henfenfeld, das heutige Herrenholz, Sendelberg genannt
114.
Demnach könnte „Sendel“ auf eine Eigenschaft hinweisen, die mit dem Bach zunächst nichts zu tun hatte. Es können zwei bis drei neue Vorschläge ins Spiel gebracht werden: Ein germanisches Wort für Weg hieß „senta“. Davon leitet sich sowohl althochdeutsch „sind“ (Weg) als auch „(ge)sinde“ (Weggefährte, nicht Diener!) ab. „Sendel“ könnte dann Verkleinerungsform dieser Wörter sein. Es wären dann entweder ein Bach und Berg, wo ein Weg eine Rolle spielte (vgl. Ortsnamen wie Wegbach, Straßbach, Gassbach). Es gab etwa den einstigen Weg
110
Bacherler, zum Namen. Schweinach für Schweinau findet sich 1264. 111
Vgl. Art. „Zander“ und „Elritze“ bei www.wikipedia.de. Einen Beleg, dass „Sandel“ einst wirklich „Elritze“ bedeutete, konnte ich nicht finden. 112
Bacherler, S. 699, und Beck, S. 138. Vgl. den Ort Büchelberg von „Buchinperg“ (buchiger Berg). 113
Allerdings auch umgekehrt: Reichenschwand aus Reichelswang. 114
Das ist die Karte des Pfinzing-Atlas, die die Pegnitz zwischen Lauf und Hersbruck darstellt.
- 46 -
von Rüblanden nach Henfenfeld. Jener Weg ist bis heute in Karten verzeichnet, obwohl von einer Brücke keine Spur mehr existiert. Nicht auszudenken, wenn ein unschuldiger Autofahrer von seinem GPS hierher geleitet wird… Oder es wären Bach und Berg nach dem Gefolge benannt, welche ein damaliger Herr dort sitzen hatte. Ähnlich ist wohl der unweite Sässer Graben zu deuten: „zu den Siedlern gehörender Graben“
115. – Zu guter Letzt ist auch ein
Personenname nicht ausgeschlossen: So wird der Münchner Stadtteil Sendling meist als „Gründung des Sentilo“ gedeutet. Allerdings müsste ein solcher Personenname erst belegt werden, und eigentlich passt hier auch der Fugenvokal –a–nicht gut.
9 Beobachtungen zur Sprache
Der so genannte ostfränkische Dialekt Bayerns, wie er ungefähr in den drei fränki-schen Regierungsbezirken gesprochen wird, oder im Einzugsgebiet des Mains bis Wertheim, wird zu den oberdeutschen Dialekten gezählt, und steht insofern dem Oberpfälzischen, Bairischen und Schwäbischen näher als dem West- oder Rhein-fränkischen, welches bereits als mitteldeutsch gilt. Der ganze Nürnberger Raum liegt in der Übergangszone zwischen ostfränkischem und bairisch-nordgauischem Sied-lungsgebiet. Sprachliche Einflüsse aus beiden Richtungen gab es hier sicher zu jeder Zeit
116. Vergleiche:
hochdeutsch fränkisch Nürnberg Oberpfalz bairisch Mittelhochd.
Mutter Mudder Mouder Muatta muoter
klein glaa gloi kloa clain
Baum Bam Baum baum
Bruder, Brüder/Brieder
Brouder, Bräider
Bruader, Briader
bruoder, brüeder
die dai, däi dia diu
Es gibt also in Nürnberg einerseits sprachliche Gemeinsamkeiten mit dem „Rest“ Frankens, andererseits auch einige Gemeinsamkeiten mit der Oberpfalz und gegen den Rest Frankens. Es muss eigentlich für jedes Wort die Sprachgrenze anderswo
115
Der Sässer Graben (auch Sessengraben) liegt auf dem Fuhrweg zwischen Krönhof und Henfenfeld. Sassen sind „Sitzende“ im Sinne von Siedlern, Mitbewohnern; Hintersassen sind das Gefolge eines Herrn. Heute ist bei dem Graben zumindest eine Gruppe von Pferden „angesiedelt“. 116
Für die Durchsicht besonders dieses Kapitels danke ich herzlich Dr. Karin Rädle, FAU Erlangen.
- 47 -
gezogen werden. Quer durchs Hammerbachtal verläuft z. B. die Grenze für folgende Wörter:
hochdeutsch fränkisch Engelthal Offenhausen Oberpfalz Mittelhochd.
Mädchen Maadla Moi(d)la maid
klein glaa gloi clain117
Die politische Grenze zur Oberpfalz liegt zwar im Süden außerhalb des Hammer-bachtals, aber die ganze Bevölkerung ist sich bewusst, dass in sprachlicher Sicht der Übergang im Tal stufenweise von Nord nach Süd zu beobachten ist. Dem entspricht sicher auch eine zeitliche Abstufung in der Art, dass das Gebiet nach und nach von Norden bzw. vom Pegnitzraum her „frankisiert“ wurde. Bis 1504 gehörte unsere Region politisch zur wittelsbachischen Oberpfalz und wurde erst dann „Nürnberger Land“. Wenngleich unser Tal schon immer im Nürnberger Interessengebiet lag
118 und
damit dessen Sprache ausgesetzt war, konnte hier erst jetzt ein „fränkisches“ Selbstverständnis entstehen.
Dass es vorher anders war, kann man zum Beispiel an dem altbairischen Namen „Erchtag“ für „Dienstag“ zeigen. „Erchtag“ ist in Kruppach und Offenhausen noch vorhanden (als „Irda“), im heutigen Engelthal nicht mehr, in den Texten des Klosters Engelthal (14. Jh.) aber sehr wohl. Die bairischen Wochentage gehen teilweise noch auf griechische Bezeichnungen zurück: „Erch“ kommt von „Ares“, dem griechischen Kriegsgott. Im großen altfränkischen Raum wurden dagegen die Wochentage „über-setzt“, man setzte also germanische und romanische Götternamen ein (teils „Tiu“, teils „Dingis“ im Ostfrankenreich, sowie „Mars“ im Westfrankenreich)
119, so dass sich
bei uns letztlich „Dienstag“ durchsetzte und spätestens seit Martin Luther von Nürn-berg aus in unser Tal gelangte. Ein anderes Beispiel: Als der kürzlich verstorbene Orts- und Flurnamenforscher Herbert Maas fränkische Wörter sammelte, schlug Gewährsmann Hans Frauenknecht das Offenhausener und Engelthaler Wort „Stutz“ vor; es wurde aber nicht in die Liste aufgenommen, weil es als bairisch empfunden wurde. Auch klingen die Engelthaler Minxwiesen (aus „Münchswiesen“ statt „Mönchs-wiesen“) verdächtig ähnlich dem oberbairischen „Minga“ (München); vgl. auch Münchhofen bei Teublitz und Münchsaurach bei Herzogenaurach. Hier liegt die Wortgrenze also viel weiter westlich; Mönchsondheim bei Kitzingen und Mönchsroth bei Ansbach drücken ein entfernteres Sprachgefühl aus.
117
Üblicher war das Wort „lützel“; aber belegt bereits im 14. Jh. in Engelthal auch: „clain aw“. 118
Vgl. allein die Herkunft der Nonnen in Engelthal seit dem 13. Jh., und mancherlei Besitzungen Nürnberger Unternehmer der Region bereits im 12. Jh. 119
Vgl. engl. Tuesday von Tiu; dt. Dienstag von Dingis; vom römischen Kriegsgott Mars leitet sich franz. Mardi, ital. Martedi ab.
- 48 -
Nach der oben erwähnten Wortgleichung „die“ <> „dai, däi“ <> „dia“ aus „diu“ richtet sich ähnlich auch „Ried“ <> „Raid“ <> „Riad“ aus „riute“. Bei diesem Wort erfolgt im Tal aber keine Abstufung, sondern es mischen sich von Henfenfeld bis Offenhausen fränkische und offenbar bairische Wortformen nebeneinander. Ähnlich scheint es bei „Lüß“ (sprich „Liß“) <> „(Schund)leis“ (sprich „Lais“ oder „Läis“?) <> „Liers“ (sprich „Lias“) zu sein. Und womöglich geht auch „Buz“ <> „(Gräi)Buers“ nach demselben Verhältnis wie „Mutter“ <> „Muatta“.
Wieso können sich Namen in so alten Formen erhalten, obwohl die übrige Sprache von neuen Dialektentwicklungen längst überformt worden ist? Wohl weil Namen für Außenstehende als etwas Fremdes betrachtet werden, das sie nur so aussprechen können, wie sie es hören. Eine Nürnbergerin, die sich in Kruppach eine Wohnung nimmt, wird ihre neuen Nachbarn „fäi wiagli“ sagen hören, aber sie wird selbst weiterhin „fai wergli“ sagen, weil sie den Ausspruch wiedererkennt. Hört sie aber „Äilasdol“, einen Namen, den sie bisher nie benutzt hat und daher nicht wieder-erkennt, sagt sie auch „Äilasdol“, obwohl sie in ihrem mitgebrachten Dialekt „Ailasdol“ sagen würde, wenn sie wüsste, was es bedeutet. Übertragen auf das „Ried“ heißt das: Diejenigen, die den Wald damals rodeten, wo jetzt das Prosberger „Riad“ ist, sprachen also tendenziell noch allgemein-bairisch, und die, die das Kruppacher „Erb-kreut“ schufen, sprachen bereits tendenziell fränkisch, aber auch sie haben die Prosberger Flur weiterhin „Riad“ genannt, weil sie es nicht als „Krait“ wiedererkannten. Wenn diese Überlegungen korrekt sind, müssen Riad, Liers und Buers ziemlich alt sein.
Nach den oben erwähnten Gleichungen „klein“ <> „glaa“ und „Baum“ <> „Bam“ ergibt sich passend, dass neben die alten Schriftformen „Steinleite, Rainschlag, Fauläcker“ die Dialektformen „Staaleitn, Raaschloch, Faaläcker“ treten. Hier wurde entweder früher „weniger“ fränkisch gesprochen, oder (wahrscheinlicher) man bediente sich damals beim Schreiben bewusst einer hochdeutschen Form.
Dass „hoher“/ „hohen“ in hiesigen Flurnamen früher „haar“/ „han“ heißen konnte, ist eine Besonderheit: Haarweg <> Hoher Weg, Am Hangraben <> Am hohen Graben. Im Alt-, Mittel- und Neuhochdeutschen erklingt bei „hoher“ immer langes o, und im Dialekt heute auch (genauer: ou). Woher kam dann die Schreibweise mit langem a in „haar“/„han“? In Wahrheit besteht im Dialekt gar kein Unterschied zwischen a und o: vgl. hochd. „Haar“ (auf dem Kopf) <> fränk. „Hóuer“ und hochd. „hoher“ <> fränk. „hóuer“. Es ist daher zu vermuten, dass ein Name wie „Haarstütz“ schon immer „Hoúer Stutz“ ausgesprochen wurde, und dass „Haarstütz“ nur eine übergenaue Schreibweise war, denn: man sagte ja auch „Hoúer am Kuubf“ und schrieb „Haar auf dem Kopf“. Solche Übergenauigkeit kann immer geschehen. Ein Sendelbacher erzählt, dass er als Kind an einem Festtag zu Tisch nach der „Soße“ verlangen wollte, aber glaubte, das sei ein Dialektwort, und daher höflich und vermeintlich auf Hochdeutsch nach der „Saße“ fragte. Das brachte ihm Lacher ein, aber es war eine große sprach-liche Leistung! – Wo hochd. a meist fränk. o entspricht (Haslach <> Hosla; Hag <>
- 49 -
Hooch; Grasiger Weg <> Großenweg120
), wird es vor r jedoch fränk. óu: gar <> góuer. Ein schönes weiteres Beispiel gibt es, wo noch einmal ou für a und für o stehen kann: a bóuer <> ein paar gegenüber die Bóuer <> die Empore
121.
Nun zu einigen Erscheinungen bei Konsonanten im hiesigen Dialekt. Auffällig ist ein „mobiles“ d (oder t) neben l oder n, und zwar mit Vorliebe, wenn noch ein s voran-geht. So sind austauschbar (die wohl ursprüngliche Form jeweils zuerst): Kessel <> Kestl; Röstn <> Resn; Stiedl <> Stierl; Weiden <> Weiern
122; Schäl- <>
Schiedlhengst; Büttner- <> Biennerleiten; Egerten <> Egern; Felder <> Feller. Vielleicht gehört hierher auch das Possessivpronomen „unser“, das in Engelthal „under“ lauten kann. So begegnet es öfters in den Texten der Christina Ebner (14. Jh.), und so ver-nimmt man es bei genauem Hinhören noch heute. „Mobil“ heißt also, dass ein d ent-weder hineinschlüpft oder wegfällt, so dass man mitunter nicht mehr genau weiß, ob es ursprünglich dahin „gehört“.
Ferner scheint es eine Austauschbarkeit von n und l in der Wortendung zu geben: Reichensbach <> Reichelsbach, Heckengraben <> Heckelgraben, Klingenbühl <> Klingelbühl, evtl. sentinapah <> sentilapah. Meist scheint das n ursprünglich zu sein; bei Reichensbach ist es vielleicht umgekehrt. Ebenso wechseln hier r und n: Maienfeld <> Meierfeld; Eckenbach <> Ockerbach.
Auch ein S am Wortanfang ist bei manchen Namen mobil (dies ist nichts Regional-typisches und kommt auch anderswo vor): Vergleiche Säulholz <> Eilach; Sintergass <> Hintergass; Samperwiesen <> Ampferwiesen <> evtl. Hammerwiesen; bedingt auch Sauwiese <> Auwiese (hier liegen wohl auch zwei unabhängige Namengebungen vor). Dies hängt mit dem dialektalen Artikel „es“ (hochd. „das“) zusammen. Das s des Artikels kann auf ein Wort mit beginnendem Vokal (und sogar h) übertragen werden. Das heißt, dass umgekehrt ein Wort sein beginnendes S verlieren könnte, wo es fälschlich als Artikel interpretiert wird. Diese Interpretation setzt voraus, dass das grammatische Geschlecht eines Flurnamens häufig als sächlich aufgefasst wird, und als Singular. Vergleiche belegbares „es Deich“ statt „der Deich“ für die Flur „Teich“; und auch „es Feller, am Feller“ statt „die Feller, an den Fellern“. Wenn ein R am Wortanfang mobil ist (Reschenberg <> Eschenberg, vielleicht auch Hoúäcker <> Roúäcker in Kruppach), und das ebenfalls mit dem Artikel („der“) erklär-bar ist, dann bedeutet das, dass man zur Zeit der Aufzeichnung Anfang des 19. Jh. ein Schluss–r noch ausgesprochen hat: „der“ <> „dea“.
120
Hierher würde auch Soarbo gehören, wenn das Wort von Sahrbach kommen sollte. 121
Dass in Engelthal „Por“ statt „Empore“ gesagt wird, kann bereits im 14. Jh. bei Adelheid Langmann belegt werden: Strauch, S. 60. 122
Stierl und Weiern (sprich: Stial, Weian) folgen demselben Muster: entfällt d nach langem Vokal, wird ein a-Laut eingefügt (hier mit r dargestellt).
- 50 -
Auf weitere Merkmale sei, obwohl sie im Fränkischen nicht immer Auffälligkeiten darstellen, dennoch hingewiesen, weil sie auch in unserer Liste erscheinen.
Vokale: eu <> ai/äi Ewllech <> Aileh/Äilasdol; Cheunspach <> Kainsbach/Käischba;
Leutenbach <> Leitenberg; evtl. Fäul- <> Feilgraben ö <> e Löhlein <> Lehel; Wöhr <> Wehr; Rösten <> Resn; Lauterhöferin <>
Latterheffern e <> o Eckenbach <> Ockerbach
Konsonanten: t <> d Teichel <> Deich; Tümpel <> Dümpfel g <> ch Schläglein <> Schlaichla; Egerlein <> Echerl; Rainschlag <> Raaschloch ch <> – Ewllech <> Aileh g <> – Bügel (Buckel) <> Bühl; Bügel- <> Burweg; Rogl- <> Röhllöffel; Logen <>
Lou kr <> gr Kruppach <> Grubba mf <> mpf Am Feller <> Am Pfahl mp <> mpf Samperwiesen <> Ampferwiesen; Tümpel <> Dümpfel
Gibt es bei uns Namen aus viel älterer Zeit – slawische, römische, keltische, alteuro-päische? Manchmal besteht die Versuchung, so einen Ursprung zu suchen, wenn ein Wort ganz unverständlich ist (etwa bei Grippuß/Gräibuers, oder bei Küchenschlag). Aber am Ende muss man sich damit zufrieden gaben, dass sich in unseren Flurnamen ausschließlich germanische (karolingische/bajuwarische/ostfränkische) Besiedelung niederschlägt. Die Namen lassen sich letztendlich doch als germanisch erklären. Nur ein Name mit überregionaler Bedeutung wie ihn die Pegnitz trägt, ist wohl aus uralter Zeit erhalten. In ältester Nennung von 889 heißt sie Paginza, was vielleicht aus schon vorkeltischem *bhogintia, „die Fließende“ abzuleiten ist (vgl. die Flüsse Bug und Bogen). Als Keltisch werden etwa die schon weiter entfernt liegenden Orts- und Flußnamen Kallmünz, Pfünz, Cham, Regen, Rednitz, Laaber, Altmühl angesehen. Slawische Namen scheinen nur am oberen Main und der unteren Regnitz verbreitet zu sein. Die Slawengrenze Karls des Großen lag etwa auf der Linie Forchheim – Lauter-hofen – Premberg bei Regensburg. Und die Römer – obwohl von ihnen Spuren einer Kriegsbefestigung bei Marktbreit vorhanden sind, sowie einige Münzen und Perlen auch in Mittelfranken – sind im Wesentlichen südlich ihrer Limesgrenze entlang der Donau und der Altmühl geblieben. Sie haben den fränkischen Fluren sicher keine Namen gegeben.
- 51 -
Das Flurnamenregister
Abgedruckt sind auf den folgenden Seiten alle mir zugänglichen schriftlichen oder mündlichen Namensformen durch die Jahrhunderte. Unter einem Leitnamen (fett gedruckt) werden abweichende Namen dann zusammengefasst, wenn zu vermuten ist, dass es sich um dieselbe Flur handelt. Solche Zuordnungen beruhen natürlich gelegentlich auf Interpretation.
Hinter den Leitnamen ist angegeben:
kursiv die Altgemeinde/Gemarkung der Flur: E = Engelthal; Kr = Kruppach; Kh = Krönhof; Pe = Peuerling; Pr =Prosberg; Se = Sendelbach; StW = Staatswald
danach eine oder mehrere Quellen: Karten, Urkunden, Salbücher, mündliche Auskünfte
dann evtl. weitere Namensformen und deren Quellen
zuletzt nach Stern* ein Verweis auf die Beschreibungen in den Kapiteln 1-8.
Bei den zugeordneten Namen erfolgt Querverweis auf den Leitnamen. Wo ein Name nur vor 1800 bekannt ist, bedeutet „Altgemeinde“, dass die Flur einem Bewohner jener Altgemeinde gehörte. Sie kann durchaus in einer anderen Gemarkung liegen, was ich aber nicht nachprüfen konnte.
Ein Beispiel:
Eintrag:
Sterlwiß Pe: E2 732; E3 181; Z–; Stadelwiß: E2 732; Stadelwysen im Eckenpach: Ea 29; Z– *5e
Zu lesen:
Die Sterlwiese (Peuerlinger Gemarkung =Pe) ist im Engelthaler Salbuch Nr. 42 (=E2) auf Folioseite 732 und im Salbuch Nr. 43 (=E3) auf Folioseite 181 eingetragen (auffindbar in Staatsarchiv Nürnberg unter Reichstadt Nürnberg = StAN Rst N). Der Name wird heute nicht verwendet (=Z–). Als „Stadelwiese“ findet sich die Wiese wiederum im Salbuch 42 (=E2), fol. 732, sowie Salbuch 44 (=Ea), fol. 29; wiederum heute nicht verwendet (=Z–). In Kapitel 5e (oben S. 33) findet sich die Namenserklärung, insbesondere wieso „Stadelwiese“ zum Leitnamen „Sterlwiese“ gezogen wurde.
- 52 -
Ackermaas – Brunnwiese
Ackermaas Kr: Na *4b Aderacker: s. Otter-Acker Das Aichen Se beim Kronhof: E 319;
Krönanger: Zb Aichstock: s. Stuckäcker Aileh: s. Eilach Altdorfer Fußweg E U *7c Altes Schloß: s. Oedenschloß Ampferwiese: s. In den Gärten Am Anger Kr U Aspan Kr: E2 292 *4a Auäcker Pe U; E2 732; E3 181;
Awecker: E2 738 [zu Closterau] *6e
Aubächlein E U [s. Hirschenbächlein] *1e
Auholz: s. Klosterau Auweg: s. Sauweg Auwiesen: s. Sauwiesen Auwinkel: s. Awwinkel Awwinckl E: E 292; L 58; Auwinckel:
Hb; Mc; N; Z– [nicht genau zuzuordnen; wohl Nähe Kreuzstein]
Vor den Aychen Kr: E2 294 Aygen Leitlein Kr: E2 291 In den Bächen: s. Weiherwiesen Bachschlag E: L 58; Bachschlägl: K
[Teil des Hagenbuchs nahe Engelthal] *5a
Bäumets-Äcker Se U; Baumets-Acker: NIII 348; Bamatsäcker: Zb *1g
Becker Acker? Kr : E2 289 Beer Äckerlein Kr: Na Berg-Acker Kr: Na *6b Bergacker Pe: Perg Acker E3 194; E1
178 [=Bergäcker, Se?] Bergäcker Se U; Zb *6b Beutelwiese: s. Pundelwiese Biengarten E: E; „oder Fröschau“: N
*1f Am Bienletten E U; N; Na (unterm
Kruppacher Gemeinholz); Md;
sand ranngen (vgl. auch 2) und polet: E 291; Binnletten: L 67; Pinnletten: H 13; J; Md; Pinletten: Hb; Mc; Peletten (Poletten?): E2 290; Pinleiten: Hb; Boléddn: Zb *1g
Bienletten-Brunnen E, der oben am … Prosperger Holz entspringet… Wasser-Rissel herunter: Md [zum Brunnäcker-Brunnen?]
Binswiesen Se: Zb; Pinzewiesen U *6a
Birkach Se U; Am Prickach: E1 125; am Pirckig: H 51; Pirchach-Acker: NIII 358; Birkeh: Zb (Gemeindeanger) *1c
Birkeleitn Se: Zb (vor dem Birkach) Bocksknoche: s. Bocksschlag Bocksschlag Pr U; Mb; (unter dem
Knochig) Md; Bocksschläglein: Na; Knochig: Md *1i
Bodersbrückl E: Zb (zwischen Krönweihern) *4g
Boletten: s. Bienletten Ufm Brand E „hinter der Ziegelhütte, die
3 Beete“: L 48; 3. Bett (am Prosberger Anger) NI 92v; (hinter Ziegelhütte) P1 25 *4e
Brand Se: s. Am prandt Breiten- und Stockleithen Kr neben
Torweeg: Na; Stockanger (unter grinpus): Ha; Am Praidtenanger: E2 273; Praidtwißen: E2 276 *6d
Breitweise Se: s. Praitwiese Brennschlag St.W.: L 58; = Breut-
schlag: Ot südl. Peuerling? *4e Breutschlag: s. Brennschlag Broheleiten Se: Zb Brückl-Acker: s. Prikel-Acker Brunnacker E U; (zwischen Webers-
Gaß und Prosberger Weg): L 47; P2 X; Brunnen-Acker: P1 15; Prunn-Acker NI 97; ~ (Straße): Zb *6d
Brunnholz Kh: Am Prunnholz: E1 124; H 50 *6d
Brunnwiese Kh U; Prunnenwisen: E1 104; prunflecken (Wiese links der
- 53 -
Buchenberg- Fallknechtswiese Sendelbacher Maiergasse Richtung prunholtz): H 50 = Im Grunfleck: E1 107? *
Buchenberg St.W. U; der Kloster-berg: Os *5d
Am Buchgraben Kr U *5b Buchgraben Kr: U; Na; In der rothen
Leithen (im Buchgraben genannt): Na; Rodtleitungen (am Praidten-anger): E2 273; am Rottenweg (auf Offenhausen zu): Ha; rout Leitn: Zb *7a, 5b, 4e
Buchhölzlein Kr: Na *5b Buchwiesen Kr und –anger: Na;
Wiese am puch graben: E2 275 Burweg: Am puhel weg genanth Kr
(auf Hersbruck zu): Ha; Pürweg [s. Steffler]; Buerweg: Zb *7a
Büttner-Schlag E U [beim Hagen-buch]
Closter-Acker Kr (vor Kalten-brunnen): Na
Closterau: s. Klosterau Closterweg Se: s. Klosterweg Creuzfleck: s. Im Kreuzstein Crönhofswiesen Kh Fa (beim
Rainholz) Crunnhof: s. Krönhof Dammersdol Kr: Zb *6c Deich: s. Hafner Teihel, Schafferteich Dornig: s. Tannig Dreieichen: s. Espach Eckenbach: s. Am Ockerbach Egenberg: s. Egenbeth? Egenbeth Kr (mit Bach und
Schleifweg): Na; Aufm Egenperg: E2 275
Egerleinsacker Pr: Mb; Na (Am Kirchweg); Egerleinsanger: Md *4b
Die Egern Kr U; Auf der Höh: Fb; Hannß Wagners Wiese?: Mb; Auff den Egartten: E2 292 *4b
Auf den Egertten Pe: E3 184 Eilach Se U; Eulach: E1 104; in den
Ewllech (Acker): A 1408/7/20; bißen klein awe: AI 3v; clain av: Da
16a; Saülholtz: Fb; Aileh: Zb (Gemeinde) *1c
Eilach-Weg Se U Am Engelthaler Weg Pr U *7b Engelthaler Weg Se U; An der
Kuetraib: E1 111; Kiasteig: Zb; Viechtraib gegen Krönhof: E1 116; Espan-Gaß gen Engelthal NIII 358 [s. auch Espach] *7e
Entenberger Weg E U; = wohl der Closterweg durch die Au, dem westwärts das Brücklein und die gemein Viehtraib folgt: Hb *7c
Erbkreut Kr U *4e Erdfallmühle E: Za; Mül im Erdfall:
E2 611; Erdfallmühl NI 159 *8c Wiese im Erlach Kr: E2 275 Erlach Se U; am undern Erlach: E1
110; Irleh: Zb *1c Erl-Acker Kr: Na [zum Irlgraben Kr?
zum Erlental Kr?] Erlagraben: s. Hintere tiefe Gräben
sowie Irlgraben. Erlawiesn Se: Zb [s. Erlach Se] Erlenthal Kr U; Äilasdol Zb *1c Erlsteig Kr: Na [zum Irlgraben Kr?
zum Erlental Kr?] Eschenberg Kr U; veld auf dem
Reschenperg gen. gen Kruppach gehörend: E 298; E2 571; Röschenberg: Na; Md; Reschenberg: Zb *5a
Espach Se: Aufm obern Eschpach: E2 735; E1 104; ober Espach: E3 184, Mittel Eschpach: E1 105; Mittl. Espan: NIII 348; Eschpe: Zb; Dreieichen: Za *1c
Espan Se: s. Engelthaler Weg und Espach
Espan: s. auch Aspan Kr Fälla: s. Feller Fallknechtswiese E: L 49; Im
Fallhaus: M3 258; Z– *6c
- 54 -
Feilgraben – Hafnerperg
Feilgraben Se: Zb (Graben zw. Mühlfeld und Erlach) [= Haingraben?] *4c
Feller Kh: Zb; als Kuhanger für Sendelbach und Schäfbauer: Za; Henfenfeld: Auf den Pfählen U; am pfaldt: E 293 *1f
Feller Kr: s. Pundelwiese Felsbrunnen Kr: Na; velsprünnen: E2
289 Fennat E: E 301; L 67; Mc (zwischen
Crönhof und Henfenfeld) [s. auch Feller] *1f
Aufm Fleck Kr: E2 290 Flohensberg: s. Prosberg Försterwiese: s. Vorsters Wiesen Frauenthal E U; E 292 *3a Fronwiese: Voit I, S. 77 (Urk. 1260)
*3a Fröschau: s. Biengarten Froschweiher E U; Fa; E xxi (Weiher)
*4g Frösch-Weyer E (Wiese): P1 29
[Weiher noch 1830] *4g Am Fuchsloch Kr *5b Furthacker? Kr: E2 290 Gaits-Acker Se: NIII 348 In den Gärten E U; hamer wissen: E 290;
Samper wißen H 32; NI 72v („die er zu einem Garten gebrauchen mag“); „zwischen der weerwißen und der hamergassen“: E 292; Eb 22; Fa; Ampfferwißen: H 14; Hb; Mc *6a
Gaßacker Kr: Zb (westl. von Hinterbach) *6d
Gaßacker Pe: E3 194; E1 178 Gäßeläcker Pr U *6d Geierstein St.W. U; Geyerstein: Hb;
Mb; Mc; E 319; Zb *3c Gelßwiß Pe: E2 732; Gölswisen: E3
181; Gelßwisen: E3 194; Gelswyßen: Ea 18; Gelfswiese: A 1516; Z– *3g
Gemeindeschlag Se U *1g Gemeindschlag Kr U; Gemein-
Schlag: Md; Na [Waldgebiet um das Erlental]
Gemeiner Viehtrieb: s. Schmied-gasse.
Gerstenacker Pe: E3 184 Gesträuß Kr: Na Im Graben E U [Steingraben bzw.
Eckenbach] *3a, 7c Grasiger Weg Se: s. Großer Weg In Greben: Fb [wohl zusammen mit
Dammerdol, Äilasdol] Grißleite: s. Prosberg Der große Acker Kr: Na große Leithen Kr (neben Zankholz):
Na; Großen Leuten: E2 579 *6b Großenweg Se: Zb (zw. Lohweg und
Stuckweg); Am grasigen Weg: E1 125; Raingras (Acker): Zb. *7e
Großwiese Kr U *6b Großwiesen Pe U; E3 185; Zb; an der
großen wiß: E2 733; Große wysen: E1 182 *6b
Grubacker Kr (am Dorf): E2 281 Grubäcker Pr U *6b Grünbüsch Kr U; Grimmbuß: Fb;
Grimbuß / Brunen Burß / Grimbunß: Na; (Wiesen/ Rangen) Grünbueß: Md; grinpus: Ha; Grippuß: E2 290; Gräibuers: Zb *
Grundäcker Pe U; grundacker: E2 734
Grundwiß Pe: E2 738; grunndtwisen: E3 182
Grunfleck: s. Brunnwiese Kh G’stockig: s. Stöckach Haang: s. Hagen / Liers Haarweeg Kr (bei Hochacker): Na;
ein gemein Furweg Auß dem Am harenweg gegen den prosberg hinaus: Ha *1h, 7a
Hafner Teihel Pe: E3 198; Haffner Techel: E1 182; = Deich: Zb? *6b
Auf der Hafnerin Pe: E2 735; Hafenbühl / Hafnersbühel: E3 183; E3 197; Z–
Hafnerperg Pe: E3 197; Z– *
- 55 -
Haftacker – Hinterbach Haftacker: s. Hanfacker Im Hag Pr U; Fb Auffm Hag; Mb Haag;
Hooch: Zb *5c Hagen E: Zb; Abb. ohne Name: R [s.
Liers] *1a Am Hagenbuch E U *5a Hagenbuch St.W.: L 58; Mc; K; Fb; E
319; Hagenpuch: Fa; ~ „des closters holtz“: E 290; E 298; Hegenbuch Hb; *5a
Haidenacker Kr: E2 274; An der Haid: E2 280
Haingraben Se bei dem Weg der von Krönhof und Sendelbach über den Seldenbach (!?) gen Rüblanden geht: H 50 [vgl. Faulgraben]
Hallershöfer Gräben: s. Lachen-graben
Hammer-Äckerlein E: M5 332; Zb [jenseits des Hammerbachs]
Hammerbach E; der Bach: Hb; hamerpach (nur ab Hammer-brücke): E 292; Offenhausener Bach: Y; Engelthaler Bach: ?; Bach von der Erdfallmühle: L; Wöhrbach: U; Stiegelbach (bei Stiegelwiese): Mc; Pfarrersdümpfel: Za (Stelle unterhalb Kläranlage) *8d
Hammerbachbrücke: s. Schaaf-brucken
Hammerbrücke E U; hamer prucken: E 290, H 126 (1565), Hc (um 1560) *3d
An der Hammergasse E U *3d Hammergasse E U; E 293; Fa;
Hammergaß als „Gemein Straß“: NI 75v *3d
Hammerwiese: s. In den Gärten Hanf-Acker Kr unter der Breiten
Leiten: Na; Haftacker: Zb *4f Auf der Häng Kr des Röschenbergs östl.
des herrschaftl. Holzes im Kessel: Na
Haang, Haanghübbl: s. Liers Im harstütz: s. Hohe Strützerin Hasenhöpflein: s. Vorsters Wiesen
Haßenackerlein Pe: E1 189 Aufm Heckacker Kr: E2 280 Heckacker Se: Zb (Teil von Hoher
Wiese) Heckelgraben St.W. U; E3 198;
Heckengraben: E 301; Fb; L 58; Hegengraben: E2 733; E3 181; Hegelgraben: E3 195; Heglgraben: E1 179; Zb; – X; = Heuchelgraben: Ot nördl. Peuerling? *6b
Henfenfelder Weg Se U *7e Herbstbühel unterm Dorf Pe: E2 737
[vgl. Herbstiese?] Herbstwiese Kr des Hannß Meyer:
Mb; Mc; Na *4a Herbstwiß oberm Dorf Pe: E2 736;
Hirstwiesn (jetzt Wald): Zb *4a Herrnholz: s. Klosterau Hersbrucker Anger E U; K; Mc;
Viechtraib „gen Hersbruck wärts“: E xviii; Treib, die von Schmidwießlein ins Hegenbuch zugehet: Hb *7c
Hersbrucker Weg E: R; Zb [s. auch Hb. Anger, sowie auch Wasser-graben oder Furchen…]
Herstrüzerin: s. Hohe Strützerin hertlwisen Kr: Ha; Hertl wysen: E2
292 Heuchelgraben: s. Heckelgraben Heuweg E U; Z–; Sauweg: P1 10 *7c Heuweg: s. Schmiedäcker E Hinbach: s. Hirschenbächlein * Hinckgarten E, davon 1563 abgeteilt
Gottesacker und spitziges Gärtlein: L 54; NI 144; H 100; Hinkwiese: O; Za *4a
Hinter den Eichen Se U Hinter der Starlerin? Se: E1 118 *3g Hinterbach Kr U; Hintenbach-Acker
(Nähe Offenhauser Weg): Na; Hintenpach: Ha; E2 291; (m. Erblucke) Md *1e
- 56 -
Hintere Tiefe Gräben – Irlgraben
Hintere Tiefe Gräben St.W. U; der tiefe Graben: K; der Graben: Hb; Erlagraben: K; Erlgraben: Hb; Mc *5a
Hintergaß (Richtung Engelthal): Zb; Sintergaß auf Engelthal zu: Ha *7a
Hirschenbächlein E U; Oh; Zb; Hinpach: E xviii; H 13; Hb; hinpechle: E 292; wysen heißt Hinpach zu der Aw: Ea 29; Hint-pach zu der Aw: Eb 7; hinpach und mytel hinpach: Eb 22; Hinpach in der Aw: E 319; Hinbach: Mc; Hümbach: P2 19 *1e
Hirschenwiesen E U; Oh; Hirschen- oder Hümpachwiesen P1 12 [seit 18. Jh.; vgl. Hirschbächlein]
Hirten- und Haaräckerlein Kr: Na *1h
Hirtenbergl Se: Zb *6c Hirtengaß-Weg Se U; Hirtengaß: Zb
(nach Gersberg) *7e Hirtenwiese und –zipfel Se: NIII 348;
Hinterm Hirten: Zb (zw. Hirtengaß und Hopfengraben) *6c
Hirtenwiesen Pr: Mb *6c Hirttenwisen Pe: E3 182; E1 118 Höchacker: s. auch Sauplatz Hochwies-Acker E U *6b Hochwiesen E U; E 292; Eb 22; hohe
wißen: H 14; Hb; A 1559/1/8 *6b Hochwiesen Kr: Na; Ha; E2 290;
Hohe Wiesen (m. Erblucke): Md *6b
Hof-Äcker Kr (unter Dornig; m. Erblucke): Md; Hoffwyssen: E2 292 *3a
Hofäcker Pe U; Hufacker: Zb; Hoffwysen: E1 179 [oder Hof-wiesen E?] *3a
Hofwiesen E U; P1 1; L 49; Fa; H; E xx; E 291; Hoffwiesen: Mc; Hb; Hof wiß: E2 733; Hof wysen: Eb 22; Schlosswiese [diente nach 1565
dem Pfleger und Gerichtsschreiber (Hb) und wurde erst im 19. Jh. privatisiert] *3a
Hohe Brand St.W.: L 58; Ot; Hohenbrand: Mb; Mc *4e
Hohe Leithe Kh U *6b Hohe Strützerin E U; Z–;
Hóuastiedan (vor Bebauung die zu den Brunnäckern parallele Fläche): Za; Die Hohe Strützin: Fa; (unter der) Hohenstrutzen: E xxi; hersstrutzerin: E 291; herstrüzerin: Eb 22; wys Im harstütz: A 1465/7/4 *1h
Hohe Wiese Se: Zb (Teil von Maienfeld zw. Lohweg und Großem Weg) *6b
Höhenäcker Kr U *6b Hohengraben Se: s. Hopfengraben Hohenstädterin: s. Hohe Strützerin Hoher Weg Se: s. Leingruben-Weg Hohlgaß Kr: Md; Hohlweg von
Oberkruppach nach Prosberg: Za *7a
Hohlweg Pe U; Zb; Am Holweg: E3 194 *7d
Holacker Pe: E3 181 [wohl zu Hohlweg Pe]
Höllgraben St.W. U; Zb; Ot; Mc *5d Am Hopfengraben Se (zw. Hopfen-
graben und Leimgrubenweg): Zb; Im Hangraben: E1 125; hongraben: E1 126 [wenn „im hohen Graben“; vgl. Leimgrubenweg = Houweg] *4f
Hóuastiedan: s. Hohe Strützerin Hühnergarten Pe: Hunergertlein E2
735; Hünergartten: E3 183; Z– Hühnerschlag Se; Hühnerschläglein
NIII 348 (beim Baumets-Acker); Häiaschlach: Zb
Hunerprunen Kr: E2 272 In der Huth Kr: Na; Hut (als unterer Teil des
Sahrbühl): Zb *4a Irleh: s. Erlach Irlgraben Kr: Zb (Teil des Kalten-
brunnens Kr) *1c
- 57 -
Jagdstein – Kruppacher Kirchenweg Bei dem Jagdstein Kr (Röschenberg): Na; Md Jägerbrunnen St.W. U *5e Am Kaiser Karl E: Zb (Straßenname,
Wald, Wiese in Kruppach); X; fehlt in allen Urkunden. *1b
Am Kaiser Karl Kr: Zb (Wiese unterhalb Prosberg oberhalb Kaltenbrunnen) *1b
Kaltebrunnen St.W. U; Zb [Nonnenberg, nicht Kr] *5e
Kalten Brunnen Kr U; Mb; Mc; Md; E2; Zb („unterm Kaiser Karl“); Kaltenbrunner: Na. *6a
Kappenzipfel Pe: E2 734; Zb *6b Kessel E/Kr St.W. U; Kessel: E 290; E
298 (Wald); Kesselanger (für Schweine): Za; Na; (Schweine von Kr und E) Md; Kestl: Zb *6b
Am Kessel Kr U; der von Kruppach Kesselwißen: E 290 *6b
Im Kessel Kr U; E2 571; Md; Kessl oder Kestl: Zb *6b
Kesselanger: s. Kessel Kestl: s. Kessel Am Kirchenweg Pr U *7b Kirchsteig Se: s. Lohweg * Kleine Aue: Clain awe: D5r; C II 127
1313 [zu Eilach] *1c Kleinleite: s. Steinleithe Klingenbühl Se U; Aufm Klingelbühl:
NIII 348 *6b Klosterau E: Closterau L 58; Ot;
Kloster Aw: Fb; Closteraw: B 1559/1/8; E 299 (herrschaftl. Wald bis Entenberger Weg); An der Closteraw E3 186; awholtz: E 292 (17 bis 33 umfassend?); Aw: E3 199; Au, Auholtz: Hb; Mc; Z–; Herrnholtz: Mc (mit Engelthaler Huth) *3a
Klosterberg St.W. U; Fb; Ot; Closterholtz Hagenbuch: K; Hoher Vogelherd Mc *5a
Klosterberg: s. auch Buchenberg und Vogelherd
Klosterweg Se U (von Rüblanden, durchs Sallach); Zb *7e
Klosterweg E s. Entenberger Weg Knochig: s. Bocksschlag Kohlenbuck Se: s. Kuhlbuck Am Kohlenmeiler E: Za; jetzt „An der
Hammergasse“ *4c Koppel-Waid Kr (bei Grünbues): Md
*4a Koppelweide: s. auch Im Loch Kr Kraut Äckerlein Kr: Na; Kreut-
gertlein: E2 282 Krautacker Se: Zb Kreutgärtlein: s. Kraut Äckerlein Kreuzfleck: s. Im Kreuzstein Im Kreuzstein E U; beim ~: L 48 „unter
dem Mittelbrunnen“ [seit 1707]; Mc; Feld am ~: P1 13; (zum) steinern creutz „im weg steend“: E 292; nur 1 Kreuz abgebildet: Fa;Os; Creutzfleck: E3 181; E1 183 *2c
Kronäcker E U *6c Krönhof U; Kronhof K; Gräihuf Zb;
Crunnhof Db 6; Creeinherff(?): E 17r *8e
Krönweiher E U; W 1801/12/18 (verfallene Weiher); Fa (Weiher und „An den Krönweyern“); E xxi (Weiher); E 292; beede grünen Weyher ohnweit des Krön-Hoffs: OfXIII *4g
Di Krorin Pe: Wysen~ Ea 18; [wohl besser] Krotin: AI 4r.
Krumen Acker Pe: E2 734; Krumb Acker: E1 183; Z–
Kruppach: Chrupach: Da 10a; krupach: AI 1r; Krumpach: AII 66; Unter Grundbach: Fb; Grubba: Zb *8f
Kruppacher Bach: Zb; Schmidbach: L 48; NI 107 [s. Schmiedwiesen]; Samperbach: NI 144 [s. In den Gärten]; Wilbaldsbach: Seibold; Kruppach fl[uss]: Fa *8f
Kruppacher Kirchenweg E: Weg durch Garten der Ziegelhütte NI
- 58 -
Kruppacher Wiese – Maienfeld
117; Za „verlief zw. Kruppach u. Webers-Gaß“ *7c
Kruppacher Wiese E U; Fa; H; Kruppachwießen: Hb; Krupach wysen: Eb 22; *6f
Küchenschlag St.W. U; Zb; Kuchenholz: Ot *5e
Kuchenwiesen Pe: E3 199; Kuchenwysen: E1 183 [s. Küchenschlag, St. W.]
Kühesteig/Kühetreib Se: s. Engelthaler Weg
Kuhlbuck Se: Zb *4c Kurzleitl Kr Zb; Kurze Leithen
(unterm Röschenberg): Na; Kurzen Leuten: E2 579 *6b
Lachengraben St.W. U; Lachergraben: X; Hallershofer Gräben: L 58; Ot; Hallers Höferlachen: Hb; Mc *2b
Lammwiesen Pr: Zb *4a Landmanin Pe: E2 734; Landmänin:
E3 195; Landtmannin: E1 179; Z– *3g
Langäcker Pe U; Zb *6b Langabwanden Pe U; Zb *6b Lange Leuten E des Hannß Seybold:
Mc [„Leite“] *6b Lange Wiesen Kr Zb; lange Wiesen
oberhalb des Ochsenfelds: Na *6b Langen Leytten Kr: E2 293; Langen
Letten: E2 289 *6b Im langen Striegel Pe: E2 733; Zb; Am
Strigel: E3 181; der Strigl: E1 179 *6b
Lauterhoferin E U; Zb; H 13; Fa; E xx; E 291f; Eb 22; Hb; Lauterhöferin: Mc; Lauterheffern: Zb [Pfarrer Otto von Lauterhofen gest. 1283; seine Jahrtagsmesse wurde aus der Wiese finanziert: C II 264] *3b
Lederne Prucken E: Hb; Mc [evtl. über das Aubächlein von Auwiese zu Neuäckern] *7c
Lehel Acker Kr: E2 293 (zu Lohe) *5c Leimgrube Kr: E2 289 Leingruben-Weg Se U; Am Hohen
Weg: E1 104; Houe Weg: Zb; Leimgrube am Hohlsteeg NIII 348 *4c
Leithe E „am Anger und am Bach“: E xviii [entweder Weinleithe/Herbrucker Anger, oder Liers] *6b
Die Leithe Kr genannt (vor Bienletten): Na *6b
Leithen Pr U *6b Leitn Kr: Zb (westl. des Erbkreuts)
*6b Letten Acker Kr (zwischen Deckers-
berger Weg und Dornig): Na; E2 293; Lettn: Zb *6b
Lettenäcker Pe U; Zb *6b Lettenpett Se: E1 118 Lettenwiese Pe: Zb *6b Leuerlein: s. Leyrers Acker Leyrers Acker Kr: Na; Im Leuerlein
(an der Huth): E2 275 Liers E: Za; Looß-Anger: P1 19; Lis
Acker: P2 Xib; „Auf der Loeß“: NI 113v (als Besitz d. Mezgerguts); „Ein Anger“: Fa; Hagen, Haanghübbl: Zb *1a
Im Loch Kr (zwischen Kruppacher Gemein und Weg): Na; (eine Koppel-Wayd, unterhalb dem Dorff Prosberg) uf dem Lohe, Lohe-Anger: Md [zum Lohe Pr]
Loeß: s. Liers Am Loh Pr U [= Loch Kr] *5c In der Lohe Se: E1 105; Aufm Loe: NIII 358;
Lou: Zb (am Lohweg) *6a Lohweg Se U: Y; Am Kirchsteich: E1
111; Am Kersteig: E1 124; Kirchsteigacker: Zb *7e
Looß-Anger: s. Liers Lüß Pr U; Loeß: M3 191 *1a Lüßäcker Pr U; Mb Loos: Md *1a Maienfeld Se U; Meierfeld: E1 125;
maierfeldt H 50; an der Meirgaß: E1 124; Z– ; Marienfeld Za *3f
- 59 -
Maiergasse – Paradeis Maiergasse Se: s. Maienfeld u.
Brunnwiese Kh Auf der Marter E U; NI ; Zb; „Marter“ selbst:
Za *2d Bei der Marter Kr: Ha [zu Engelthal?] Minxwiesen: s. Mönchswiesen Meier~: s. Maier~ Mittelbrunnen St.W. (bei Peuerling
oberhalb „beim Kreuzstein“): L 48; Z– *5e
Mittlwiß Pe: E2 735; Zb [unter Mittelbrunnen?] *6d
Mönchswiesen E U; Münchswiese: P1 3; L 49; Mc; Fa; Md; der Münche Wiesen: Hb; Münchwiesen: E 290; münch wysen: Eb 22; munchswißen: H; Minxwiesn: Zb *3a
Mühlbach aus Offenhausen kommend: s. Hammerbach
Mühläcker E U; M3 131 *6c Mühlanger E: NIII 348 *4a Mühlanger Kr: Na *6d Mühlbach E; Becken-Mühl-Bach: P2
IV [zur Pfistermühle] Mühlbüchl Kr Mülpüel/Mulpuhel:
Ha; Mülpühel: E2 291; Mühlpühl *6d
Mühlfeld Se U; Vorm Mülholz: E1 107 [Henfenfelder Mühlholz]
Mühlgasse E: B57; „neuer Fußsteig“ P2 II; Mühlweg von Mühle nord- u. aufwärts: P2 XIb; Fuhrweg Mühl P1 19 [Auf Erdfallmühle bezogen, nicht mehr offen]
Am Mühlschlag E U [seit Rodung 1720; vorher Klosterau, s. d.]; kleiner Mühlschlag: L 47; Mühlschlag genannt: Oh *5d
Mühlschlag St.W. U; L 58; Mühl-schlag: Ot *5d
Neuäcker E U; Pflegamt Engelthal’s Sauwiesen: P1 11 [und Neuwiesen, seit 18. Jh.: P2; V] *
Neuwen wysen Kr: E2 294 Nonnenberg St.W. U; Mc;
Nunnenperg: Os; Ot; Fb; E 300
(unterschieden von Closteraw 18 und Heckengraben 41); wysen auf dem Nunenperg Ea 31; Nunnenperch: Db 4; Da 5b *3a
Oberawacker Pe: E3 194; NI [vgl. Auäcker Pe]
Im obern Grund Se: E1 107, inn oberm grunndten: E1 122
Ochsenäcker Se U;Z– [nach Ochsenwiese; heute fälschlich für Peuerlinger Langäcker] *4a
Ochsenanger Se: Zb (Gemeinde) *4a Ochsenfleck Kr: Na Ochsengraben Se: NIII 353; Zb;
Schelmanger: E1 123 (hier? am Ochsengraben wurden früher Kadaver vergraben: Za); Silmanger: NIII 358 *4a
Ochsenkopf Kr: Zb (hinter Grünbüsch)
Ochsenwiese E und Ochsenäckerlein E: L 48; P2 VIIb; Zb *4a
Ochsenwiese Pe (oberhalb Großwiese): P49; Zb *4a
Ochsenwiese Pr: Zb *4a Ochsenwiese Se: L 49; Zb *4a Ochsen-Wiesen Kr (m. Erblucke):
Md *4a Am Ockerbach Pe U; Zb; im Eckenpach:
E 292; Eb 22; Die wissen am Eckenpach: Fa; Eckenbach: Mc; Eckaboch: Zb Crunnhof auf dem ekenpach: Db 6; eker zu ekenpach: AI 2v *6d
Oedenschloß St.W. U; L 58; X; Zb; Oed Schloß: Ot; Altes Schloß: Hb; Mc *3c
Otter-Acker Kr mit Schleifweeg nach Engelthal: Na; Aderacker / Adereckerlein: E2 273
Panfgraben? Kr: E2 273 Im Paradeis Kr (im langen Brunnen
genannt); E2 282; Za *3g
- 60 -
Paundzeil – Sagholz
Paundzeil? Kr: E2 273 *1d Peuerlinger Anger Pe U; Zb; Anger
Oe11 *4a Peuerlinger Fußweg E U *7c In der Peundt Pe: E3 199: E1 183 *4a In der Peundt E: Seibold, S. 7 *4a Pfarrersdümpfel E: Zb *4d Pfirsing gerthlein Kr (über Ochsen-
Wiesen auf den Mulpuel hinauß): Ha; Pfirsings Wiß: E2 272; Pfirsching-Gärtlein (m. Erblucke auf Mühlpühl hinaus): Md *6c
Pinletten: s. Bienletten Pintzacker Pe: E3 194;
pintzenäckerlein: E1 178 [zu Binswiese Se?]
Pinzenwiese: s. Binswiese Platte St.W. U; Zb *5e Platz Kr: Blooz: Za *4a Point: s. Peunt Pe /Pundelwiese Kr Praitwisen Se: E1 107 [zu Gersberg?] Am prandt Se ghen thal hinab gegen den
pach: H 50 *4e Prikel-Acker Kr: Na; Prückl-Acker
(beim Hirtenhauß): E2 272 Prosberg U; Prosperch: Da 14b;
prosperg: E 291; E 303; L 67; Fb; Brosberg: Os; Prosberger Wald Flohensberg genannt: Oth; Dorff Prosperg – Herrschafftl. Holz Propsperg genannt: Md; (Teil) Grißleite. Drosberg: AII 66; Za; trosperk(g): AI 1v, 4r; Großberg: Za *8h
Prosberger Egerten Pr: Mb *4 Prosberger Fußweg Pr U; E 291 *7b Aufm Prünlein Kr: E2 280 Prunn~: s. Brunn~ * Prunwisen Kr: Ha [zum Krönhof?] Puhel weg: s. Burweg Pundelwiese Kr: Beim Fälla Auf
pundelwisen hinaus: Ha; Wiese aufm pöndel: E2 275; Fäla (m.
Erblucke auf Peutelwiese hinaus): Md *1d
Gemein Raiffgerten Kr: Ha Am Rainschlag E U; Am Rainholtz: Fa;
wissen hinter dem raynn: Db 6; Am Rain: E 319 *2a
Rainschlag St.W. U; Mc; Zb; rainschlägen: H 14; Rainholtz: E 292; E 302; beide Bez. (samt Henfenfelder Weeg): L 67; Holtz im Reinschlag: Fb *2a
Ranger Kr: Zb (Teil des Kalten-brunnens Kr); Md (hier?) *6b
Ranken Se U; Ranger: Zb *6b Reichelsbach Kr U; Na; Zb;
Reychenspach: E2 292 *6d Rein etc: s. Rain etc. rein wysen Kr: Ea 103 [besser zu Se!] Reineggert Se U; Rainegerte: Fa; E2
736; E3 184 *2a, 4b Reinwiesen Se U; Rainwiesen: Mc;
NIII 353; wissen hinter dem raynn: Db 6; reyn wysen: Eb 21 *2a
Reschenberg Kr: s. auch Eschenberg Reschenberg St.W. U; L 58; K; Mc;
Zb; Rescheberg: Ot *5a Auf dem Ried Pr U; Riad: Zb *4e Riegeläcker Hallershof U; Hb *6b Rogllöffel-Acker Se; Röhllöffel (nach
Peuerling): NIII 353 [vgl. Rühr-Äckerlein?] *6b
Rösengraben St.W. U; Resn: Zb *5d Rößwiß Pe: E2 732; Roßwisen: E3
181; Rößwisen: E3 185; Reswiesn: Zb *6b
Beim Rotenweg E (zwischen Reschenberg und Bürgerschlag): K *4e
Rothe Leite: s. Buchgraben Rotleite, Rotenweg Kr: s. Buch-
graben Rottenpaumb Kr (in die Sintergaß):
Ha Rübeckerlein Kr: E2 273; Rübacker:
E2 290 Uberm Ruck Se: E1 118 Rügelholz St.W.: L 58
- 61 -
Rühräckerlein – Schmiedäcker Rühräckerlein Se: Y; Rouäckerl: Zb
[zum Röhllöffel?] Sagholz: s. Zankholz Sahrbühl Kr U; Zb U [auch
Sandbühl?] *6a Sallach Se U; NIII 348; aufm Salach:
E1 110; am Sellich: H 51; Soleh: Zb*1c
Samperbach: s. Kruppacher Bach Samperwiese: s. In den Gärten Sandbühl Kr (zwischen Bach und
Schleifweg Richtung Huth / unterm Reschenberg): Na [=Sahrbühl?]
Säuanger Se: Zb (Gemeinde) Saudrecksängerlein E U; Au-Anger: L
49; Sauanger P1 10 [seit 18. Jh. teilweise als Wiese, aber nach Za immer noch zur Schweinehut] *6e
Sauegert E U; Saueggeten: X; Seu Egerten: Hb; K; Mc; Saugart: Ot; Seuger.: Fb; Saw egerten: H 14; Sew egerten: E 298; L 58 *4b
Sauerlenden: s. Soarboch Saugart: s. Sauegert Sauplatz Pe U; Sauplatz der
Hochacker gen.: NIII 348; Höchacker: E2 734; E1 105 (neben Gemeinde); Auf der Höh: E1 106 (hier?) (Mc und noch Za zur Schweinehut bezeugt) *6e, 4a
Am Sauweg E U; Zb *6e Sauweg U; M3 191; Zauweg,
Zausteg: NI ; Auweeg: Mc; Awweg (Richtung Felder des Klosters, Auwinkel): H; Auweg Hb (gegenüber Closters Felder nahe dem Auwinckel); Leimburger Weg: R *7c, 6e
Sauwiesen E U; Zb; Zauwiese (mit Weiher): L 49; Zawwisen: B 1559/1/8; Auwiesen: Hb; Mc; Die Aw wissen: Fa; Awwiß: H; E2 737; bißen hinter der awe: AI 3v saw wysen: Eb 22; Zau-/ Sauwiese identifiziert, sowie Zaunwiese: NI 88 *6e
Schaaf-brucken E: M3 258; Schafprucken über Hammerbach: H 126 [Nähe zum Schaftor, s. In den Weihern] *7c
Schafferacker Pe: E2 736; Z– *6b Schafferteich Pe: E2 737 = Deich:
Zb? *6b Schafkoppe Se: Zb Schäfweiher: s. In den Weihern Schallerspühl Kr der Nußbaumacker
genannt: Na; Schallerpühel: E2 281 *6c
Schattenkorb: s. Schottenanger Scheibelwiesen Kr (zwischen
Kruppach und Deckersberg): Na; Md; Ha; Scheubel wyßen: E2 294
Schelmanger E: E 290; Fa; Zb –; mit Kesselanger identifiziert NI 85v *6b
Schelmanger Se: s. Ochsengraben Schiedelhengst-Äcker Se: Schüdel-
hengst: U; Schüttelhengst: V; (urspr. nur Teil von Hoher Wiese): Za *4a
Schießanger E U; Prosperger Anger uff welchem das Schießhaus stehet: Md; beide Namen identifizierend: N; Schußanger: Md; Prosberger Anger: B 1559/1/8; Weg nach Prosberg: Hb *4a
Schläglein Kr U *7a Schlaifweeg E NI 88 („in das
Frauental“) *7c Im schlechten Holz genannt Kr
(Röschenberg): Na; E2 275 Schleiffweg Pe: E1 181 [zu E?] *7c Schleifweg Kr: s. auch Otter-Acker Schleifweg: s. Schlaifweeg Schloßweiher: s. Inden Weihern Schmidbach: s. Kruppacher Bach Schmiedäcker E U; L 47. Schmi(d)t-
Acker: P1 17; P2 IX; ~(Straße): Zb; wohl = Pflegeräckerlein: Fa; H 55;
- 62 -
Schmiedgasse – Stigelschlag
dabei Heuweeg: L 48; P2 VIIb [s. o.] *6c
Schmiedgasse E U; NI 85v; Awer vichtrayb: E 292; Viehtraib: B 1559/1/8; gemein ~: Hb; Gemeiner Trieb: Za *7c
Schmiedwiesen E U; Schmid-wießlein; Mc; Schmidt wisle: B 1559/1/8 (Wiese am Schmiedstor, dem Tor bei der Schmiede) *6c
Schnabelthal Kr U; Na; Im Schnabelsthal: Fb; E2 291; Md; Snabelshof: Db 12; Snabelshove: Da 9; Schnabergzthal (?): Dd 591; Schobberlasdol: Zb [nach Geiger/Voit, Hersbrucker Urbare (1965), S. 68 Anm. 315 „Schnabels-hove“ bleibender Name eines Kruppacher Hofs; StAn, Rep 208 d, n. 952, aber Dd591 weist auf zu Kruppach gehörige Flur hin] *3e
Schölmanger Kr, Schölmhäußlein: Na; s. Schelmanger E *6b
Auf der Schoß Kr (vor dem Pyrckach): E2 293 [zu Birkach Henfenfeld?]
Schottenanger Se: Zb (am Sendel-bach bei der Schwemm); Im Schattenkorb: E1 105 [Gem. Rüblanden]
Schundtleiß (Ausgangspunkt einer Viehtreibe in Richtung Hagenbuch, von Sendelbach aus): H 14 *1a
Schwemmleitn Se: Zb; Tännlein auf der Schwemm: NIII 348; Schwemm (zw. Hirtengaß und Sendelbach): Zb *6a
Sendelbach: sentilapah: Ludwig d. Kind Urk. 903; sentelpach: AI1v; Da 16a; Senndelpach: AII 66
Im Sendelbach Se: E3 184; aufm Sendelbach: E1 106
Sendelbacher Weg Pe U *7d Sendelberg Henfenfeld: K *8j
Am Sengelperg beim Hagenbuch: E 298 [zu Konrad Sengelberger: C II 235 1378? Oder zu Sendelberg?] *4e
Settelbrunnen L 58; Z– Sew Egert: s. Sauegert Silmanger Se: s. Ochsengraben Soaboch Se: Zb; Saar-Wiesen (am
Bach): NIII 348; Sauerlenden: E1 106; NIII 353 *6a
Spitzwiß Pe: E2 736; Z– Stadelbrunnen: s. Stierlbrunnen Stadelwiese: s. Sterlwiese Steffler Kr: Zb (westl des Erbkreuts);
Steffel-Feld (m. Erblucke, am Pürweg): Md *6c
Steinbruch St.W.: E 300; E3 198; Hb; Mc; Kalchperg: E 308; L 81 (beides); Kalgschlag: E3 200; neuerer u. alter Steinbruch: Zb *4c
Beim Steingraben Pe U; Auf dem Steingraben: Fa; Im Steingraben: E2 733; Stein-Acker: NIII 348 *6d
Steingraben Pe U; E 302 (zum Rainholz); L 67; Mc *
Steinleithe Kr U; Zb; (verlesen?) cleinleithen: E 291 *6b
Steinwießen E: E 291 *6a An der Stel Kr: E2 289; Stel Acker: E2 293
[zu Platz Kr?] Sterlwiß Pe: E2 732; E3 181; Z–;
Stadelwiß: E2 732; Stadelwysen im Eckenpach: Ea 29; Z– *5e
Stiegelwiese Kr U; E2 275; Na; Zb; (m. Erblucke) Md; auch Striegelwiese: Zb; dazu Stiegel-Äckerlein: Na *1d
Stiegelwiesen E U; Stigelwiese: A 1402/10/12; Mc; stigl wissen: E 290; Stigel wissen: Fa; K; stygel wysen: Ea 118; Eb 22; Stigglwiesn: Zb; Striegelwiese: Y *1d
Stierlbrunnen Pe U; Sterlpronnen: E2 732; E3 181; Zb; Stedelpronnen: E2 738; Stadelpronnen: E3 194; Stadelprunnen: E1 178 *5e
Stigelschlag E: L 58; K; Fb *1d
- 63 -
Stirnacker – Weihern Stirnacker Se: E1 121; Zb; Stier-
Acker: NIII 359 (hierher?) *6b Stöckach Kr / Gstockach: Na,
Stöckig: Zb; Gestockach: Ha; Stockauw: E2 289 *4e, 1c
Stockleite, Stockanger Kr: s. Breitenleite
Streitholz: s. Zankholz Strick-Acker Kr: Md Striegel: s. auch Im langen Striegel Striegelwiese: s. Stiegelwiese Stück Acker Pe: E1 185 [zu
Stuckäcker, Se?] Stuckäcker Se: Zb (zw. Henfenfelder
Straße und Mühlfeld); Am Aichstock: E1 125? [s. Stuckweg] *6a
Stuckweg Se: Zb (trennt Hohe Wiese von Birkenleite) *7e
Stutzkreuz Pe Nähe Hohlweg: Zb *2c Tannenwiese E U; P2 10 [seit 18. Jh.] Teich: s. Deich Teig-Äckerlein Kr (zwischen Bach
und Engelthaler Weg): Na Thalheng E (vom Prosberg herab
zum Offenhausener Weg): Mc; Hb *
Tannig Kr U; Dannig: Zb; Dornig: Na; Md; Dornych: E2 289; Dornach: E2 291 *1c
Theilfeld Kr (vor Kaltbrunnen): Na Thiergarten E U; Zb; Hb; L 57; L 68;
Mc; Oth *4g Thungweeg E: L 49 Tiefe Gräben: s. Hintere tiefe Gräben Todtenleithe Se U; Zb *2c Torweg Kr: s. Breitenleite Ubereitter wißen E „biß an die Awer
vichtrayb“: E 292 *6c Die Umzäun Kr (zwischen Bach und
Paradeis): Na; die Umbzeun: E2 282 *1d
Untern Aw Pe: E3 194 [vgl. Auäcker Pe]
Vogeläcker E U; N [seit 1780] *6c Vogelherd Pr U *5c Vogelherth Kr: E2 289 [zu Pr]
Vogelwiese und –Äcker Se: Zb (zw. Bergäcker und Krönhof)
Vordere tiefe Gräben St.W. U [vgl. Hintere ~] *5a
Vorstadt: s. Webersgass Des Vorsters wißen E (als Teil des
Hagenbuchs): E 290; Forsters zum Weyer Wießen, identifiziert als Hasenhöpflein: Hb *5a
Walprünn Kr (Unterkruppach): E2 289
Wäschblei Kr Zb; (der) Wöschbley „am Closterweeg“ / (der) Wasch-bläul „vor dem Kaltbrunnen“: Na; Weschbleiche: U; Weschplewl: E2 290 *4c
Wassergraben E oder Furchen, welche von … Weinleithen sich herunter ziehet und… vor dem … Weyer-Wießlein … und nechst an des Pfister-Müllers GüßBech… in den Bach fället: Md; Hb [wohl Graben am Hersbrucker Weg]
Wasserzeil Pe: E2 733; Wasserzell: E3 194; wasserzel: E1 178; Z– *6a
Webers-Gaß E: L 47; Md; Mc; NI ; Za „bis Prosberger Zweig“; Kruppacher Fuhrweg: P2 VIIa; Kruppacher Str.: Zb; „Vorstadt“: Za (Vorkriegszeit) *7c
Am Weg Acker Pe: E1 178 Wehrbach E: U *4d Wehr: s. auch Wöhr Wiese im Weiden Kr: E2 275; Am Wayd
Acker (am Kirchsteig gen Offenhausen): E2 290
Die Weiden Se: E1 105; Weiden-Wiesen: NIII 353; Waian: Zb (hinter Leimgrube) *4f
In den Weihern E U; Schaf- u. Hirtenweiher: L 57; großer u. kleiner Sch.: Fa; Schaf- u. Schlotzweyer: E 304; 2 Schafsweiher: E xxi; P2 XII (mit 2 Fischbehältern) *4g
- 64 -
Weiherwiesen – Zulleinsperch
Weiherwiesen E U; Weiherwieslein: L 50; Weyerwießlein: Mc als ehem. Hopfengarten des Pflegamts; mit Kruppacher Weyer; P1 8; Wiese in den Pächen: Fa; Mühlwiese „am Kruppach“ und Wiese in den Bächen: E xx; des Klosters zum Weiher Wißen: H 14 [hier lag der „Kruppacher Weiher“] *6d
Weinleite E U; E 290; B 1559/1/8; Hb; Mc; Md; N; Weinleitte: Fa; H *4f
Wellenpach E: E 319; Mc; Hallershof hütet „uber den wellenbach gegen den Closter weres [weges?!] nicht“: H 13; „… über den Wellenbach gegen dem Closterweeg auch nit“: Hb *3g
Welleperg E (wißen am~): E 291 *3g Wilbadsbach: s. Kruppacher Bach Am Wöhr E U; im Wher: E xx; Wehr n.:
Mc; N; Wehr m. (zwischen den Bächen): Hb; Wehr wissen: Fa; weres: H 13; uff dem Wehr: H 14; der werdt: Eb 22 *4d
Bach im Wöhrt genannt Kr: Na [s. Wöhr-wiese E] *4d
Wolfsgarten St.W. Zb [= bißen in bolfßgrvben AI 4r?] *5e
Zankholz Kr U: Na; Zb; Kruppacher Gemeinholz, das Streitholz: Mb; Md; Sagholz: Zb *5b
Zauweg: s. Sauweg Zauwiesen: s. Sauwiesen Zetterperg? Kr: E2 289; ZSattenperg:
E2 294 [zu Setterbrunnen St.W.?] Unten an den Zeunen Pe: E1 182 [zu
Sauwiesen, E?] Zulleinsperch: Voit I S. 96 (Urk.
1260) *4b, 6e
Abkürzungen
1. Sigeln für verwendete Quellen
im Register folgen nach dem Sigel noch Seite, folio oder Datum)
bis 16. Jh. A Urkunde 14.-16. Jh.: StAN E Urk AI Archivregister Engelthal 1443: StAN N
Salb 45 a (= Thali, S. 319-29). AII Nürnberg Spionagebericht 1504
(=Schnelbögl) B Urkunde 16. Jh.: StadtAN CI-CII G. Voit, Kloster Engelthal, Bd. I-II Da-Dd Engelthal Salbücher 1312/1350/1426:
StAN RSt N Salb Rep 59 Nr. 36-39
16. Jh. E Engelthal Salbuch 1547ff: StAN RSt N
Salb Rep 59 Nr. 40 E1-E3 Engelthal Salbücher Ende 16. Jh.: StAN
RSt N Salb Rep 59 Nr. 41-43 Ea-Ee Engelthal Salbücher 1535ff: StAN RSt
N Salb Rep 59 Nr. 44-44d Fa Karte Nöttelein 1565 (sehr genau):
StAN RSt N Karten Rep 58 Fb Karte Pfinzing AHb 1594 (teilw.
unzuverlässig); StadtAN H Hanndlung-Buecher Engelthal
1558-98: StAN NAr 19 Ha Gemeindeordnung Kruppach 1561:
privat Kruppach Hb Viehtrieb 1707, meist auf 1558
zurückgehend, GA Engelthal Hc StAN FT AN Bez. zu Benachb. Nbg.
Bücher 83
17. Jh. J Urkunde 17. Jh. StAN E Urk K Karte „Closterberg“ 1645: StAN RSt N
Karten Rep 58 Nr.
- 65 -
18. Jh. L Beschreibung Engelthals ca. 1723
(Hölzer 1709) Mb Schafhut Engelthal 1707 privat E Mc Kuhhut Engelthal 1707 GA E Md Hutbrief Kruppach 1725 privat Kr M3-M6b Augenschein- u. Markbuch
Engelthal 3 (1671ff), 4 (1715ff), 5 (1750ff), 6a (1777ff), 6b (1793ff): StAN NAr 18, 16, 20, 21, 24
NI-NIII Salbuch Engelthal 1730: StAN RA HEB 952 I-III
Na Salbuch Kruppach ca. 1700: privat Kruppach
O Karte Engelthal 1706: StadtAN [=Voit Bd. 2 letzte S.]
Oh Karte „Hirschenwiese“ 1765: StAN RSt N Karten Rep 58 Nr.
Os Karte Seutter AHb 1740 (von Pfinzig abhängig): StadtAN
Ot Karte Teufel R StAN RSt N PfA Engelthal S. I L 1743/48
Oth Karte „Thiergarten“ 1765: StAN RSt N Karten Rep 58 Nr.
P1 Engelthal Übersicht 1786: StAN Nbg. KPl 544
P2 Engelthal Übersicht 1793: StAN Nbg. KPl 545
R C. M. Roth, Stich „Engelthal“, 1760
19. Jh. U Uraufnahme 1831 VA Hb V „Renoviertes“ Grundkataster
20./21. Jh. X Forsttafel im Wald 2008 Y Vermessungsamt 2008 Za aus der Erinnerung heute Zb mündlicher Gebrauch heute Z– heute ausdrücklich unbekannt
2. Abkürzungen der Ortsnamen E = Engelthal/Hb = Hersbruck/Kr = Kruppach Kh = Krönhof/N= Nürnberg/Pe = Peuerling Pr = Prosberg/Se = Sendelbach
3. Archivalische Abkürzungen
AHb = Amt Hersbruck FT AN = Fürstentum Ansbach GA = Gemeindearchiv Jh. = Jahrhundert KPl = Karten und Pläne NAr = Nürnberg Archivalien PfA = Pflegamt Rep = Repertorium RA = Rentamt RSt = Reichstadt StadtAN = Stadtarchiv Nürnberg StAN = Staatsarchiv Nürnberg VA = Vermessungsamt
4. Literatur
und deren Abkürzungen Bacherler = Michael Bacherler, Siedlungs-
namen des Bistums Eichstätt (1924) Bahlow = Hans Bahlow, Deutschlands
geographische Namenwelt - Etymologisches Lexikon der Fluß- und Ortsnamen alteuropäischer Herkunft (1965und 1985)
Beck = Christoph Beck, Die Ortsnamen des Pegnitztales und des Gräfenberg-Erlanger Landes (1909)
Binder, Christina = Matthias Binder, Christina Ebner in ihren Schriften, in: Robert Giersch u. a. (hg.), Christina Ebner (1277-1356). Beiträge zum 650. Todesjahr der Engelthaler Dominikanerin und Mystikerin. Mitteilungen der Altnürnberger Landschaft e.V., Nr. 51 (Sonderheft 2007), S. 17-80
Binder, Leinweberei = Matthias Binder, Leinweberei im Amt Engelthal des 17. Jahrhunderts, in: Mitteilungen der Al-tnürnberger Landschaft e.V., Nr. 59/2 (2010)
- 66 -
DRw = Deutsches Rechtswörterbuch, online 2015: drw-www.adw.uni-heidelberg.de/drw/
Giersch, Burgen = Robert Giersch u. a., Burgen und Herrensitze in der Nürnberger Landschaft (2006)
Giersch, Offenhausen = Robert Giersch, Offenhausen. Geschichte einer Gemeinde im Nürnberger Land (2008)
Giersch, Sendelbach = Robert Giersch, Sendelbach. Eine fast authentisch erhaltene Dorfstruktur im Nürnberger Land, in: Mitteilungen der Altnürnberger Landschaft e.V., Nr. 60 (2011)
Gotthard = Heinrich Gotthard, Über die Ortsnamen in Oberbayern (1884)
Grimm = Jacob und Wilhelm Grimm, Wörterbuch der deutschen Sprache, online 2015: woerterbuchnetz.de/DWB/
Käppel = Hanshelmut Käppel, Nürnberger Land in Not. Der 30jährige Krieg (2005)
Kluge = Friedrich Kluge, Elmar Seebold, Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache (
231995)
Lexer = Matthias Lexer, Mittelhoch-deutsches Handwörterbuch, online 2015: woerterbuchnetz.de/Lexer/
Maas = Herbert Maas, Mausgesees und Ochsenschenkel. Kleine Nordbayerische Namenskunde (1969)
Martini = Johann Chr. Martini, Historisch-geographische Beschreibung des ehemaligen berühmten Frauenklosters Engelthal in dem Nürnbergischen Gebiethe (1798)
v. Reitzenstein = Wolf-Armin Frhr. von Reitzenstein, Lexikon fränkischer Ortsnamen (2013)
Rusam = Hermann Rusam, Die Vogelfänger rund um Nürnberg, in: Heimat (Hersbrucker Zeitung) Nr. 2, April 2009
Schnelbögl = Fritz Schnelbögl, Hanns Hofmann (hg.), Gelegenhait der land-schaft mitsampt den furten und hellten
darinnen. Schriftenreihe der Altnürn-berger Landschaft e.V., Nr. 1 (1952)
Schnetz = Joseph Schnetz, Flurnamenkunde (1952 und 1963)
Schröder = Karl Schröder (Hg.), Der Nonne von Engelthal Büchlein von der genaden uberlast (1871)
Schroth, Eisenerz = Günther Schroth, Eisenerz im Nürnberger Land (1999)
Schroth, Spuren = Günther Schroth, Verwehte Spuren. Von mittelalterlichen Vogelherden, Wolfsgruben, Kalk- und Pechöfen, Grubenmeilern und Bergbau aus der Vergangenheit des Landkreises Lauf (2005)
Seibold = Hans Seibold, Das „Grab der Königlich Schottischen Prinzessin“. Mitteilungen der Altnürnberger Landschaft e.V., Nr. 11/1 (1962), S. 1-17
Strauch = Philipp Strauch, Die Offenbarungen der Adelheid Langmann, Klosterfrau zu Engelthal (1878)
Thiermann = Karl Thiermann, Adel und Adelssitze im Mittelalter, namentlich im und am Hammerbachtale, in: Heimatbeilage (Hersbrucker Zeitung) Nr. 3 (März 1932)
Thali = Johanna Thali, Beten – Schreiben – Lesen. Literarisches Leben und Marienspiritualität im Kloster Engelthal (2003)
Voit = Gustav Voit, Geschichte des Klosters Engelthal, Bd. I (1977)/Bd. II (1978)
Weber = Jost Weber, Siedlungen im Albvorland von Nürnberg (1965)
Wittmann = L. Wittmann, Die Flurdenkmäler im Bezirksamt Lauf, in: Die Fundgrube (Pegnitz-Zeitung) Nr. 9 (Sept. 1932)
Zillinger = Heinrich Zillinger, Flurnamen der Gemeinde Pommelsbrunn (unveröffentlicht)
Zillinger, Knöcke = Heinrich Zillinger, Die Knöcke-Fluren unserer Hersbrucker Alb, Hersbrucker Zeitung (19.2.1989)