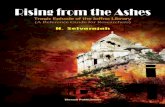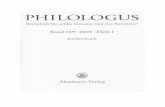0 Student Killed in Tragic Road Accident - The Courier Archive
Duerrenmatt's Tragic Minotaurs
Transcript of Duerrenmatt's Tragic Minotaurs
Theodore Ziolkowski
Der Minotaurus als tragische Gestalt bei Dürrenmatt
I
Friedrich Dürrenmatt hat die Zentralität von Labyrinth und Minotau-rus in seinem Leben und Werk immer wieder betont. Im Winterkrieg in Tibet bezeichnet er das Bild vom Weltlabyrinth als »Urmotiv« (WA 28, 69)1 in seinem Denken. Der Band, in dem der Winterkrieg erscheint, ursprünglich Stoffe (1981), heißt in der zweiten Ausgabe (1990) einfach Labyrinth. Seine als Buch veröffentlichten Gespräche mit Franz Kreuzer tragen den Titel Die Welt als Labyrinth2 – eine Wendung, die in seinen Schriften wiederholt vorkommt. Und »ir-gendwo im Inneren« dieses metaphorischen Labyrinths, lesen wir in Winterkrieg in Tibet, »lauert der Minotaurus, eine Ungestalt mit dem Kopf eines Stiers und dem Leib eines Menschen« (WA 28, 71). Die Kritiker haben schon lange auf die Funktion des Labyrinths in seinem Werk hingewiesen.3 Aber die volle Bedeutung des Motivs vom Minotaurus für Dürrenmatt und die Einzigartigkeit seiner Behand-lung desselben können wir erst dann richtig einschätzen, wenn wir es im breiteren Kontext der Zeit und der Zeitgenossen betrachten.
Zwischen Antike und Moderne kommt dieses Ungeheuer aus dem kretischen Labyrinth in der Dichtung und Kunst auffallend selten vor. Die kretischen Mythen gelangten eigentlich erst nach 1900 zur allgemein-populären Geltung, als Sir Arthur Evans mit der Entde-
1 Mit der Sigle WA, Band- und Seitenzahl wird hier und im Folgenden zitiert nach Friedrich Dürrenmatt: Werkausgabe in siebenunddreißig Bänden. Zürich 1998.
2 Friedrich Dürrenmatt: Die Welt als Labyrinth. Die Unsicherheit unserer Wirk-lichkeit. Franz Kreuzer im Gespräch mit Friedrich Dürrenmatt. Wien 1982.
3 Sydney G. Donald: Of Mazes, Men and Minotaurs: Friedrich Dürrenmatt and the Myth of the Labyrinth. In: New German Studies 14/3 (1986/87), S. 187-231. Neuerdings auch Peter Rüedi: »Exkurs: Das Labyrinth«, in: ders.: Dürrenmatt oder Die Ahnung vom Ganzen. Zürich 2011, S. 226-243.
242 Theodore Ziolkowski
ckung von Knossos weltweite Erregung verursachte und zum ersten Mal ein Schlaglicht auf die minoische Kultur warf.4
Der kretische Mythos von Europa und dem Stier ergriff fast sofort und weltweit die künstlerische und literarische Imagination als Bild für sexuelles Erwachen (etwa in Heinrich Vogelers Radierung Eu-ropa, 1912; Lovis Corinths Lithographie Europa auf dem Stier, 1919, und Georg Kaisers Drama Europa, 1920) und etwas später als Symbol für das neue Gefühl der europäischen Einheit (in vielen Gemälden, Skulpturen und Denkmälern der zwanziger Jahre) oder für das durch den Nationalsozialismus vergewaltigte Europa (etwa in Max Beck-manns Gemälde Der Raub der Europa, 1933).5 Daedalus und Ikarus wurden auch häufig herangezogen: der Vater als Prototyp des moder-nen technischen Erfindungsgeists (z. B. 1923 in dem berühmten Streit zwischen J. B. S. Haldane und Bertrand Russell über die Rolle der Wissenschaften in der modernen Gesellschaft)6 und der Sohn als Bild des neuen Phänomens des Flugs (bei Gabriele D›Annunzio, Her-mann Hesse, Georg Heym und Albert Verwey), aber auch der menschlichen Hybris.
Unter den minoischen Mythen gelangt der Minotaurus erst spä-ter, nämlich in den 1930er-Jahren, zu einer gewissen Popularität und zwar aus zwei verschiedenen Blickwinkeln. Einerseits galt er als Sym-bol für gewalttätige politische und ökonomische Unterdrückung, wie aus dem Titel der Anthologie ersichtlich ist, die Alfred Döblin 1953 herausgegeben hat: Minotaurus. Dichtung unter den Hufen von Staat und Industrie.7 Im unveröffentlichten Fragment Minotauros von Ro-bert Walser aus den späten 1920er-Jahren lesen wir, dass ihm der Minotaurus »weiter nichts als die zottige Schwierigkeit darzustellen scheint, aus dem Nationenproblem klug zu werden« und dass die Na-tion »vielleicht mit einer Art von Minotauros Ähnlichkeit aufweist,
4 Theodore Ziolkowski: Minos and the Moderns. Cretan Myth in Twentieth-Cen-tury Literature and Art. New York 2008, insbes. S. 10-14.
5 Siehe die vielen Reproduktionen in: Mythos Europa. Europa und der Stier im Zeitalter der industriellen Zivilisation. Hg. v. Siegfried Salzmann. Bonn 1988, hier S. 237, S. 242 und S. 253.
6 Vgl. J. B. S. Haldane: Daedalus; or, Science and the Future. New York 1924; Bertrand Russell: Icarus; or, the Future of Science. New York 1924.
7 Döblins Band (Minotaurus. Dichtung unter den Hufen von Staat und Industrie. Hg. v. Alfred Döblin, Wiesbaden 1953) hat außer dem Titel überhaupt nichts mit dem Minotaurus zu tun, der in den einzelnen Beiträgen nicht vorkommt. Der (übrigens sehr geeignete) Titel scheint als nachträglicher Einfall dem ursprüngli-chen Projekt über »Die deutsche Literatur im Industriezeitalter« hinzugefügt worden zu sein.
243Der Minotaurus als tragische Gestalt
den ich gewissermaßen meide«.8 Als W. H. Auden 1940 in seinem melancholischen New Year Letter auf das vorhergehende Jahrzehnt zurückblickte, das neben dem »asiatischen Schmerzensschrei« (»the Asiatic cry of pain«) auch noch die Grausamkeiten des spanischen Bürgerkriegs, die Aggression Italiens in Abessinien, die Verzweiflung an der Donau (»die Danubian despair«) und ein zur Hölle gefro-renes Polen (»Poland frozen into hell«) erlebt hatte, fragte er sich, ob nicht die blinde Wut die Gedanken eines jeden zum Minotaurus hinzieht (»will not feel blind anger draw / His thought towards the Minotaur«).9 In denselben Jahren unternahm Marguerite Yourcenar mit zwei Freunden das Projekt, den Mythos vom Minotaurus aus den jeweiligen Perspektiven von Ariadne, Theseus und dem Minotaurus zu gestalten. Aber »der Herbst 1939 war kaum der günstige Augen-blick, eine literarische Fantasie über die Untaten des Minotaurs zu veröffentlichen; die Wirklichkeit bot mehr und Schlimmeres.«10
Andererseits exemplifizierte der Minotaurus die ethischen und politischen Überzeugungen der Surrealisten: unbeschränkte Freiheit, totale Revolution, Überwindung der herkömmlichen Ordnung11 und letzten Endes tierische Brutalität und Grausamkeit.12 Angesichts die-ser Popularität betitelten Georges Bataille und André Masson die von ihnen zwischen 1933 und 1939 in Paris herausgegebene Kulturzeit-schrift Minotaure, auf deren Titelseite Darstellungen des Minotau-rus von jeweils wechselnden Künstlern prangten. Der Kunstkritiker Marcel Jean erinnerte sich später, dass bei den Mitarbeitern Theseus und der Minotaurus das Bewusstsein und das Unbewusste verkör-perten und dass die Überwindung des Minotaurus gelegentlich sogar den Triumph der rassischen Reinheit über den Mischling symboli-sierte13 – eine unheilvolle Interpretation im Lichte des damals weit verbreiteten Rassismus.
Beide Hauptauffassungen – Gewalttätigkeit und Eros – lassen sich im Titelbild herauslesen, das Pablo Picasso für die erste Nummer der Zeitschrift schuf. Es handelt sich um eine Collage, in der der sitzende Minotaurus einen großen Dolch in seiner rechten Hand hält, während
8 Robert Walser: Das Gesamtwerk. Hg. v. Jochen Greven, 12 Bände. Frank-furt a. M. 1978, Bd. 11, S. 193.
9 W. H. Auden: The Collected Poetry. New York 1966, S. 273. (Übers. T. Z.)10 Marguerite Yourcenar: Aspects d’une légende et histoire d’une pièce. In: dies:
Théâtre II. Paris 1971, S. 165-79, hier S. 177. (Übers. T. Z.)11 Vgl. Marie-Laure Bernadac: Picasso e il Mediterraneo. Rome 1983, S. 154.12 Vgl. André Siganos: Le Minotaure et son mythe. Paris 1993.13 Vgl. Marcel Jean: The History of Surrealist Painting. Übers. v. Simon Watson
Taylor. London 1960, S. 231.
244 Theodore Ziolkowski
er uns gelassen anblickt (vgl. Abb. 1). Der Dolch weist zwar einer-seits auf die Gewalttätigkeit, aber andererseits suggerieren andere Einzelheiten – bunte Bänder, Blätter sowie die laszive Haltung – die sexuelle Vitalität, die der Minotaurus für Picasso symbolisierte. Denn der fünfzigjährige Picasso ging damals gerade eine neue und leiden-schaftliche Liebesaffäre mit der viel jüngeren Marie-Thérèse Walter ein, und der Minotaurus bot das geeignete Symbol für seine verjüng-ten sexuellen Energien. Er begann fast sofort eine Reihe von Zeich-nungen zu schaffen, wo der Minotaurus zunächst ein Weib brutal vergewaltigt, dann aber allmählich seiner Geliebten mit einer weniger aggressiven Sexualität sich nähert: er streichelt sie sanft, bietet ihr mit einem Glas Wein einen Toast und schläft friedevoll neben ihr (vgl. Abb. 2 und 3). Sechzehn von diesen Darstellungen erschienen dann unter den hundert Gravuren seiner berühmten Suite Vollard, wo wir zum Schluss einen blinden Minotaurus sehen, der von einem Mäd-chen geführt wird. Dutzende von Zeichnungen aus den Jahren 1933-34 bilden die Vorarbeit zum Werk, das oft als die großartigste Gra-phik des 20. Jahrhunderts gelobt wird: Picassos Minotauromachie (1935, vgl. Abb. 4), auf welcher der Minotaurus keineswegs als das jovial-brutale Biest der früheren Darstellungen auftritt, sondern als eine eher pathetische Gestalt, die mit ausgestrecktem Arm vor der Kerze eines kleinen Mädchens defensiv zurückweicht.14
Das sind also die beiden Hauptauffassungen des Minotaurus in den 1930er-Jahren, die künstlerisch und literarisch häufig zum Ausdruck kommen: einerseits brutale politische Gewalt und andererseits eine tierische Sexualität, die sich zugleich gewalttätig und sanft ausdrü-cken kann. Im ersten Fall repräsentiert das Labyrinth die totalitäre Welt, worin der Einzelne so gut wie ein Gefangener ist, der dem Mi-notaurus als Herrscher des Orts zum Opfer fällt. Im anderen Fall, namentlich bei Picasso aber auch bei anderen Malern der Zeitschrift Minotaure, fehlt das Labyrinth fast völlig: Der Minotaurus ist ein Wesen, das sich unabhängig von seinem Mythos in der Welt frei be-wegt. (In den gleichzeitigen Werken, in denen Theseus als Held und Überwinder des Labyrinths dargestellt wird – etwa in Andre Gides Thésée (1946) oder dem Ballett The Minotaur (1947) von Elliot Carter und George Balanchine –, hat der Minotaurus meistens keine symbo-lische Bedeutung oder eigene Persönlichkeit: Er ist nur der Gegner, den Theseus erledigen muss.)
14 Vgl. Sebastian Goeppert und Herma C. Goeppert-Frank: Die Minotauromachie von Pablo Picasso. Genf 1987.
249Der Minotaurus als tragische Gestalt
Selbstverständlich verschwindet der Minotaurus nach den 1930er- und 1940er-Jahren keineswegs völlig aus Kunst und Dichtung. Unter mehreren Beispielen finden wir etwa zehn Gedichte von Miroslaw Holub unter dem Sammeltitel »Minotaur« (in dem Band Notes of a Clay Pigeon, 1977), das lange Titelgedicht einer Sammlung Anthony Cronins (The Minotaur and other Poems, 1999), und den Roman von Mary Renault (The King Must Die, 1958). Abgesehen von solchen vereinzelten Beispielen kommt der Minotaurus immer häufiger in Computer-Spielen, Science Fiction und Kinderbüchern als gesunke-nes Kulturgut vor. Aber nur bei Dürrenmatt bildet das mythische Tier ein lebenslanges Hauptmotiv.
II
Dürrenmatt kann weder zur einen noch zur anderen Partei gerechnet werden – am ehesten wohl zur ambivalenten Haltung Picassos. Wie wir aus dem Winterkrieg in Tibet erfahren, hörte er schon als Kind von seinem Vater die Geschichte vom Labyrinth des Minos und vom ungefügen Minotaurus (vgl. WA 28, 21). Als die Familie 1935 nach Bern umzog, wurde das Labyrinth zur alltäglichen Wirklichkeit. »Es ist eine Stadt, in der man sich immer in Gängen bewegt und nicht im Freien«,15 erzählte er 1982 Franz Kreuzer. Und im Winterkrieg heißt es ferner: »Ich kam mit der Stadt nie zurecht, wir stießen einander ab, ich tappte in ihr herum wie Minotaurus in den ersten Jahren im Labyrinth.« (WA 28, 51) Bereits hier spüren wir den Unterschied gegenüber den zeitgenössischen Darstellungen. Anders als die meis-ten – aber ähnlich wie sein Zeitgenosse, der polnische Schriftsteller Zbigniew Herbert in seinem Griechischen Tagebuch (1973)16 – identi-fizierte er sich von Kindheit an immer mit dem Minotaurus, anstatt in ihm die brutale Verkörperung des Totalitarismus zu erblicken. Aber anders auch als bei Picasso ist der Minotaurus, mit dem er sich gleich-setzt, nicht frei und mächtig, sondern immer noch ein Gefangener in einem erdrückenden Labyrinth.
Seit jener Zeit wurden Labyrinth und Minotaurus zu zentralen Bildern in Dürrenmatts Œuvre. »Indem ich die Welt, in die ich mich ausgesetzt sehe, als Labyrinth darstelle, versuche ich, Distanz zu ihr
15 Friedrich Dürrenmatt: Gespräche 1961-1990, Hg. von Heinz Ludwig Arnold, Zürich 1996, Bd. 3, S. 148.
16 Zbigniew Herbert: Im Vaterland der Mythen. Griechisches Tagebuch. Hg. v. Karl Dedecius. Frankfurt a. M. 1973, S. 188.
250 Theodore Ziolkowski
zu gewinnen.« (WA 28, 69) Diese Bilder und diese ambivalente Hal-tung erblicken wir in den frühesten Werken, auch wenn Labyrinth und Minotaurus nicht ausdrücklich als solche bezeichnet werden. Denn seine Erfahrungen als Schweizer Bürger und Soldat während des Zweiten Weltkriegs – das Erlebnis des Eingeschlossenseins bzw. der Ausgeschlossenheit von der sonstigen europäischen Welt – haben aus seinem privaten Labyrinth ein Weltlabyrinth erschaffen (vgl. WA 28, 69). In der Erzählung Die Stadt (1947) lesen wir den Bericht eines Menschen, der nicht weiß, ob er in den dunklen Gängen des Gefäng-nisses, wo er haust, ein Wärter oder ein Gefangener sei oder ob der Mensch, den er dort erblickt, vielleicht einfach sein eigenes Spiegel-bild sei. Der futuristische Winterkrieg in Tibet stellt sich als die ent-zifferte Inschrift heraus, die ein verstorbener Söldner in den Stollen eines Berges auf 150 Meter Länge in die Wände geritzt hat. In beiden Fällen, wie in anderen Erzählungen, erkennen wir leicht wieder das Labyrinth und seinen minotaurischen Insassen.
Dürrenmatts Auffassung vom Minotaurus bzw. dessen Labyrinth hängt mit seiner realistisch-humoristischen Vorstellung von dessen Herkunft, Geburt und genetischer Veranlagung zusammen – einer komischen Darstellung, die an seine witzige Bearbeitung des Ödipus-Mythos in der Erzählung Das Sterben der Pythia (1976) erinnert. Der Vater des Minotaurus war bekanntlich ein Stier, dem seine Mutter Pasiphaë aus geiler Lust verfallen war und mit dem sie mittels einer von Dädalus verfertigten künstlichen Kuh kopulierte. Aber anders als die Quellen stellt sich Dürrenmatt dann die weitere Entwicklung vor (vgl. WA 28, 69-83): zunächst die Geburt, die aus anatomischen Gründen schwierig gewesen sein müsse, denn »der Wurf hatte einen viel zu großen Kopf« (WA 28, 70). (Diese schwierige Geburt hat er auch in einer drastisch-realistischen Zeichnung dargestellt.) König Minos habe, meint er, die »erotische Verirrung seiner Gattin« (WA 28, 71) aus Mitgefühl geduldet, weil er selber Sohn eines Stiers war – Zeus hatte in der Gestalt eines weißen Stiers seine Mutter Europa geraubt und vergewaltigt – oder weil er vielleicht sogar selber der Vater war – was den Mendelschen Gesetzen nicht widersprechen würde – und die Geschichte vom Stier erfunden habe, um die Missge-burt zu erklären. Dürrenmatt meint sogar, dass Ariadne dem gelieb-ten Theseus zur Überwältigung des Minotaurus verholfen habe, weil sie auf ihren Halbbruder neidisch war, den ihr Vater mehr liebte als sie.
Als Dädalus beauftragt wurde, eine geeignete Unterkunft zu bauen, verfiel er auf ein Labyrinth, weil der Minotaurus eine wilde Kraft
251Der Minotaurus als tragische Gestalt
besaß, der keine normale Käfigtür hätte widerstehen können. Er musste auch die Tatsache in Betracht ziehen, dass der Minotaurus mit seinem Stierkopf »kein Raubtiergebiß« (WA 28, 72) besaß und des-wegen vegetarisch leben musste. Außerdem konnte er weder spre-chen noch denken und besaß nichts als tierische Instinkte, aber ins-tinktiv wird er gefühlt haben, »daß er etwas Einzigartiges war, weder ganz Tier noch ganz Mensch« (WA 28, 75). Ferner müssen wir uns das Labyrinth als einen weiten Park mit Baumgruppen und einem Teich vorstellen, »wo der Minotaurus äsen, zur Tränke gehen und in den Bäumen herumklettern konnte« (WA 28, 72). Diese Grünfläche wurde dann mit mehreren ineinandergeschachtelten Gebäudekom-plexen mit unzähligen Gängen umschlossen – eine Erinnerung an Bern mit seinen Arkaden. Was die sieben Jünglinge und sieben Jung-frauen betrifft, die alle neun Jahre als Opfer aus Athen geschickt wur-den: Als Vegetarier hatte der Minotaurus keinen Appetit auf sie. Wenn er sie aber trotzdem durchbohrte, ihr Blut leckte und ihr Fleisch herunterwürgte, so war es, weil er unbewusst und instinktiv ein Mensch werden wollte (vgl. WA 28, 75).
Jahrzehntelang, gesteht Dürrenmatt, sah er nur das Unglück des Minotaurus in seinem Labyrinth (vgl. WA 28, 78) – eine Auffassung, die 1958/62 in einem Gemälde zum Ausdruck kommt, in dem The-seus hoch auf einer Mauer steht und auf den Minotaurus uriniert (vgl. Abb. 5) In seinen ersten Stoffen identifizierte er sich unbewusst mit dem Minotaurus, »denn die Welt, in die ich hineingeboren wurde, war mein Labyrinth, der Ausdruck einer rätselhaften mythischen Welt, die ich nicht verstand« (WA 28, 79). Später spürte er auch eine gewisse Identität mit dem Erfinder des Labyrinths, Dädalus, »denn jeder Versuch, die Welt, in der man lebt, zu gestalten, stellt einen Ver-such dar, eine Gegenwelt zu erschaffen« (WA 28, 79) – genau wie der Dichter, der in seinem Werk eine eigene Wirklichkeit entwirft. Schließlich ist ihm eingefallen, dass Theseus selber der Minotaurus sei, weil, »jeder Versuch, diese Welt denkend zu bewältigen – und sei es nur mit dem Gleichnis der Schriftsteller –, ein Kampf ist, den man mit sich selber führt« (WA 28, 83).
Aus dem Vorhergehenden geht deutlich hervor, dass Dürrenmatt sich viel länger und intensiver als alle Zeitgenossen Gedanken über die Bedeutung des damals weitverbreiteten Bilds des Minotaurus ge-macht hat und dass seine Auffassung viel komplizierter ist und über die einfache Zuteilung des Minotaurus zum Symbol der politischen Gewalttätigkeit oder zur Verkörperung der animalischen Triebe weit hinausgeht, wenn auch dieser Aspekt in einer Picasso-ähnlichen
Abb. 5: Friedrich Dürrenmatt: Der entwürdigte Minotaurus, 1962, Gouache,
72 × 51 cm, Centre Dürrenmatt, Signatur A-Bi-1-205.
253Der Minotaurus als tragische Gestalt
Zeichnung aus dem Jahr 1976 vorkommt, wo der Minotaurus eine Frau vergewaltigt (vgl. Abb. 6). Am Ende kommt er sogar zum Schluss – wie übrigens Jorge Luis Borges in seiner Erzählung Das Haus des Asterion (1949) –, dass der Minotaurus in seinem Labyrinth eigentlich glücklich sei und dass Ariadne nicht durch Eifersucht son-dern durch Neid motiviert sei. Endlich begegnet der Minotaurus The-seus, der ihn tötet – laut der Sage als Strafe. Aber wo eine Strafe statt-findet, räsoniert Dürrenmatt, müsse es Schuld und ein Gericht geben, das die Schuld identifiziert und die Strafe bestimmt. Wenn aber der Minotaurus als Halbtier unfähig ist, den Begriff der Schuld zu begrei-fen, könne es seinerseits keine Schuld geben. Er wird für eine Schuld bestraft, die schon vor seiner Geburt stattgefunden hat: eine Schuld, die darin besteht, »Minotaurus zu sein, eine Ungestalt, ein schuldig Unschuldiger« (WA 28, 78).
Als sich Dürrenmatt gegen Ende des Kriegs das Weltlabyrinth vor-stellte, identifizierte er sich unbewusst mit dem Minotaurus, der ge-gen die eigene Geburt protestiert: Denn die Welt, in die er geboren wurde, war sein Labyrinth, der Ausdruck einer verwirrenden mythi-schen Welt, die er nicht begriff – eine kafkaeske Welt, in der die Un-schuldigen schuldig heißen und deren Gesetze unbekannt sind. Er setzte sich einerseits mit den Opfern gleich, die ins Labyrinth gewor-fen wurden, und andererseits mit Dädalus, der das Labyrinth schuf. Jeder Versuch, die Welt, in der man lebt, zu gestalten, sei der Versuch, eine Gegenwelt zu schaffen. Aber »Realisieren ist etwas anderes als Konzipieren« (WA 28, 82). Später versuchte er immer wieder, dieses Weltlabyrinth zu gestalten: in seinen Schriften und in vielen Zeich-nungen, Aquarellen und Gemälden. 1972 wollte er in einer Drama-turgie des Labyrinths seine Ideen synthetisieren und formulieren – in einem Versuch, den er später dem Winterkrieg in Tibet einverleibte. Aber um diese Zeit wurde ihm auch klar, dass er nicht nur der Mino-taurus sei, sondern auch Theseus, denn er allein betritt freiwillig das Labyrinth.
An Ariadnes Faden seines Denkens beginnt er, nach dem Minotau-rus zu suchen, in den verschlungenen Gängen beginnt er zu fragen, zuerst, wer denn Minotaurus überhaupt sei, später, ob es ihn über-haupt gebe, und endlich beginnt er zu überlegen – wenn er ihn immer noch nicht gefunden hat –, warum denn, wenn es den Mino-taurus nicht gebe, das Labyrinth überhaupt sei. Vielleicht deshalb, weil Theseus selber der Minotaurus ist. (WA 28, 83)
Abb. 6: Friedrich Dürrenmatt: Minotaurus, Frau vergewaltigend, 1976, Tusche
(Feder) auf Papier, 36 cm × 51 cm, Centre Dürrenmatt, Signatur A-Bi-1-345.
255Der Minotaurus als tragische Gestalt
III
In diesem Sinn und in diesem Geist verfasste Dürrenmatt nach einem halben Jahrhundert des Nachdenkens seine »Ballade« Minotaurus (1985), deren neun Hauptszenen mit ganzseitigen schwarz-weißen Zeichnungen illustriert sind, die der Künstler zu diesem Zweck aus-führte.17 Im Gegensatz zu den früheren Erzählungen wird hier nicht in der ersten Person des Betreffenden bzw. des Betroffenen erzählt: die Geschichte des Minotaurus wird durch die narrative dritte Per-son objektiviert, obwohl die Ballade aus der ergreifenden Perspektive und dem beschränkten Bewusstsein des Minotaurus erzählt wird. Es handelt sich nicht mehr um eine Theseus-Gestalt, die sich freiwil-lig ins Labyrinth begibt oder um einen Dädalus, der es entworfen und gebaut hat, sondern ausschließlich um den Minotaurus, der darin lebt.
Nachdem er unter Kühen in der Wärme der Ställe aufgewachsen ist, erwacht er eines Tages und findet sich in einem Labyrinth mit Spiegelwänden. Wo immer er hinblickt, sieht er sich von Wesen um-geben, die mit ihm völlig identisch sind, und so verbringt er seine Tage glücklich mit ekstatischem Tanz im »Weltall seiner Spiegelbil-der« (Minotaurus, S. 12, vgl. Abb. 7). Eines Tages sieht er unvermit-telt ein anderes Wesen, das nicht zu den gewohnten Spiegelbildern gehört. Er tanzt mit dem Wesen, jagt es durch die Gänge, ergreift es im Akt der Liebe – und tötet es dabei, denn der Minotaurus hat kei-nen Begriff vom Unterschied zwischen Leben und Tod. Er leckt den nackten weißen Körper, bewegt ihn sanft mit seinen Hörnern, hebt den Körper dem Himmel entgegen und schreit seine Klage, aber das Mädchen bleibt bewegungslos, bis die großen schwarzen Raubvögel herunterkommen und seinen Leib zerreißen. Der Minotaurus schreit vor Wut, denn er begreift unbewusst, dass ihn der Himmel für den Frevel von Pasiphae strafen will, weil sie ein Unwesen geboren hat, das »verdammt war, weder Gott noch Mensch noch Tier zu sein, sondern nur Minotaurus zu sein, schuldlos und schuldig zugleich« (Minotaurus, S. 23).
In diesem Augenblick tritt ein weiteres Wesen ein, diesmal mit Mantel und Schwert: ein deutlicher Hinweis auf den Stierkampf, der bei Picassos Vorstellungen vom Minotaurus eine so zentrale Rolle
17 Friedrich Dürrenmatt: Minotaurus. Eine Ballade mit Zeichnungen des Autors. Zürich 1985. Zitiert wird nach dieser (Erst-)Ausgabe; im Wiederabdruck in der Werkausgabe (WA 26, 9-32) fehlen die Bilder.
Abb. 7: Friedrich Dürrenmatt: Illustration zur Ballade Minotaurus, 1984,
Tusche laviert, 30 × 40 cm, Centre Dürrenmatt, Signatur A-Bi-1-376-1.
Abb. 8: Friedrich Dürrenmatt: Illustration zur Ballade Minotaurus, 1985,
Tusche laviert, 40 × 30 cm, Centre Dürrenmatt, Signatur A-Bi-1-376-3.
258 Theodore Ziolkowski
spielt. Da der Minotaurus von seinen Erfahrungen mit dem toten Mädchen Vorsicht gelernt hat, nähert er sich behutsam diesem neuen Wesen und umtanzt es aus Freude darüber, dass er nicht mehr allein ist. Während der Minotaurus tanzt, springt das neue Wesen hin und her, schwenkt sein Tuch, und tritt dann zurück zur Wand. Der Mino-taurus erblickt das Schwert in seiner Brust, ist verwirrt über den un-gewohnten Schmerz und über das Blut. Neue Wesen erscheinen – es sind die sieben Jünglinge und sechs verbleibenden Jungfrauen aus der Opfergruppe –, die ihn umtanzen und immer näher kommen, bis der Minotaurus, wütend darüber, dass verhasste Nicht-Minotauren ge-wagt haben, sein Labyrinth zu betreten, ein rasendes Gemetzel an-richtet, wobei er sie alle tötet, mit seinen Hörnern zerfleischt und im Mondlicht das Blut von ihren Bäuchen und Schößen aufschlürft, während die Raubvögel wieder herunterstürzen (vgl. Abb. 9). Vom Mondlicht verblendet beginnt er, die eigenen Spiegelbilder anzugrei-fen. Die Spiegel zerbrechen und schneiden seine Haut, bis er endlich begreift, dass es nur einen einzigen Minotaurus gibt, und bis er in seinem dunklen Bewusstsein ahnt, dass er mit den eigenen Spiegelbil-dern in ein Labyrinth eingeschlossen ist, das seinetwillen gebaut wer-den musste, weil die Weltordnung keinen Platz hatte für ein solches Wesen zwischen Tier und Mensch, zwischen Mensch und Gott. Er muss im Labyrinth bleiben, damit die ganze Welt nicht ins Chaos eines Weltlabyrinths zerfalle.
Mit dieser Einsicht und infolge seiner neuen Erfahrungen bricht er zusammen, fällt in einen tiefen Schlaf und träumt, er sei ein Mensch: er träumt von der Sprache, von Brüderlichkeit und Freundschaft, von Liebe und Geborgenheit. Und er weiß zugleich, dass ihm diese Eigen-schaften nie zuteil werden sollen. Während er schläft, kommt Ariadne herein, knüpft einen roten Faden um seine Hörner und tanzt damit wieder hinaus (vgl Abb. 10). Als der Minotaurus am folgenden Mor-gen erwacht, kommt ihm ein anderes Wesen entgegen: ein zweiter Minotaurus! Dieser Minotaurus spiegelt seine Gesten wider, aber mit einer gewissen holprigen Unsicherheit. Glücklich, dass er nicht mehr allein ist, dass es für sein Ich ein neues Du gibt, beginnt der Minotau-rus einen Tanz der Brüderlichkeit der Freundschaft, der Sicherheit. Er umtanzt den anderen Minotaurus, der einen Dolch aus der Scheide zieht und im Augenblick, als der Minotaurus ihn umarmen will, zu-stößt. Der Minotaurus ist schon tot, als er zu Boden fällt. Dann nimmt Theseus die Stiermaske vom Kopf, wickelt den roten Faden auf und verschwindet aus dem Labyrinth, wo jetzt nichts mehr als der dunkle Körper des Minotaurus zurückbleibt. Die Ballade endet mit den
Abb. 9: Friedrich Dürrenmatt: Illustration zur Ballade Minotaurus, 1984,
Tusche laviert, 40 × 30 cm, Centre Dürrenmatt, Signatur A-Bi-1-376-5.
Abb. 10: Friedrich Dürrenmatt: Illustration zur Ballade Minotaurus, 1984,
Tusche laviert, 40 × 30 cm, Centre Dürrenmatt, Signatur A-Bi-1-376-6.
Abb. 11: Friedrich Dürrenmatt: Illustration zur Ballade Minotaurus, 1985,
Tusche laviert, 40 × 30 cm, Centre Dürrenmatt, Signatur A-Bi-1-376-8.
262 Theodore Ziolkowski
nüchternen Worten: »Dann, bevor die Sonne kam, kamen die Vögel.« (Minotaurus, 51, vgl. Abb. 11)
Dürrenmatts streng-schöne Prosa-Ballade, die ein Vierteljahrhun-dert später den Ausgangspunkt einer Oper von Harrison Birtwistle bildete (Covent Garden, Mai 2008),18 ist eigentlich die meisterhafte psychologische Analyse eines primitiven Bewusstseins, das sich be-strebt, die Welt außerhalb des eigenen Erlebnisbereichs zu verstehen. Zu gleicher Zeit lässt sich das Werk mit seiner Darstellung der Welt als Gefängnis als Parabel über den Zweiten Weltkrieg, den National-sozialismus und den Holocaust lesen.19 In seiner lebenslangen Beses-senheit vom Bild des Minotaurus und dessen Labyrinth lässt sich Dürrenmatt in seiner Intensität nur noch mit Picasso vergleichen, dessen Darstellungen er aus Bildbänden kannte, die er in seiner Haus-bibliothek besaß.20 In seiner sprachlosen Mitteilung durch Tanz – Tänze der Freude, der Liebe, der Wut, der Freundschaft – zeigt Dürrenmatts Minotaurus auch seine Abstammung von den antiken kretischen Kulten des Labyrinths mit ihren Tänzen. In seinem pro-funden Kommentar über Verfremdung und Verrat in der modernen Welt und über die erfolglose Suche des Ichs nach Verständnis, Sicher-heit, Freundschaft und Liebe entpuppt sich Dürrenmatts Minotaurus letzten Endes als eine wahrhaft tragische Gestalt.
18 Siehe die Rezension von Andrew Porter in: Times Literary Supplement, 2. Mai 2008.
19 Vgl. Ioana Cr ̆aciun: Die Politisierung des antiken Mythos in der deutschsprachi-gen Gegenwartsliteratur. Tübingen 2000. Das Kapitel über Dürrenmatts Ballade (S. 261-324) ist überschrieben: »Politisierung durch Metaphorisierung«.
20 Vgl. den Katalog der Bibliothek in der Datenbank HelveticArchives: https://www.helveticarchives.ch/ unter SLA / Personennnachlässe / Dürrenmatt / D-Samm lungen.