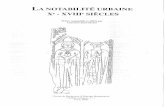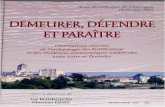Die Entwicklung des frühmittelalterlichen Burgenbaus in Süddeutschland bis zur Errichtung von...
Transcript of Die Entwicklung des frühmittelalterlichen Burgenbaus in Süddeutschland bis zur Errichtung von...
Château Gaillard 25, Publications du CRAHM, 2012, p. 139-157
1. EINLEITUNG
Im 5. BIS 10. JahrhUnDErt, nach den Siegen der Frankenüber die alamannen 496 und die thüringer 531 erschloss
der frühmittelalterliche landesausbau östlich des rheins ineinem mehrphasig fortschreitenden Prozess auch die GebieteSüddeutschlands. Der begleitende frühmittelalterlicheBurgenbau (abb. 1) ist vielfältig, vielschichtig und belegteindrücklich, dass er keinem starren Schema unterliegt, sondernjeweils auf die Einzelburg bezogen individuell zu sehen ist.Darüber hinaus lassen sich jedoch einige Entwicklungslinienaufzeigen, die den frühmittelalterlichen Burgenbau inSüddeutschland prägen und kennzeichnen.
Die Betrachtung einzelner Burgen macht deutlich, dass eineBurg ständigen Veränderungen unterworfen war, sei es militä-rischer natur, befestigungstechnisch, z. B. als reaktion auf diebeweglichen reiterscharen der Ungarn. aber auch die politisch-sozialen, herrschaftlichen Veränderungen im Burgenbaumüssen hier genannt sein, seien es Burgen in königlicher, kirch-licher oder adeliger hand. Die machtpolitischen Strukturen,die den Burgenbau trugen und förderten, waren zunächst inerster linie vom Königtum geprägt, dem dann bald die Kirchemit Burgen in bischöflicher hand bzw. später auch in klöster-lichem Besitz zur Seite trat. Königtum und Kirche bildeten bis
zum Investiturstreit in salischer Zeit eine Einheit bei derlandmäßigen, strukturellen, administrativen, politischen undkirchlichen Erschließung und Festigung des ostfränkischenreiches.
In den schriftlichen Quellen werden im süddeutschen raumfür die frühmittelalterliche Zeit, d. h. für die Zeit etwa um 700bis 1000 nach christus, nur etwa 40 (abb. 2) der annähernd400 archäologisch bekannten Burgen genannt (abb. 1)1. BeiVerwendung der unterschiedlichen termini, sei es castellum,castrum, urbs und civitas stellt sich für die frühe Karolingerzeitheraus, dass urbs und civitas meist für größere anlagen wieehemalige römerstädte und z. t. Bistumsorte, so regensburg739, benutzt wurden, castellum und curtis dagegen eher füranlagen ohne städtische Züge. Urbs und civitas fehlenvielleicht bezeichnenderweise in der frühen Zeit. Bereits 807wird Würzburg dann aber als urbs genannt, die Bezeichnungencastellum und castrum dagegen sind mehrmalig belegt. Für diejüngere Zeit ergibt sich ein uneinheitliches Bild, eine zeitspe-zifische nutzung der Begriffe ist nicht zu erkennen, ihrGebrauch ist vielfältig, ungenau, teilweise synonym und vorallem bei den erzählenden Quellen von den jeweiligen autoren
* Bereich für Ur- und Frühgeschichte, Friedrich-Schiller-Universität Jena
1. Brachmann 1993; EttEl 2001, 13 ff.; EttEl 1999, 51 ff. Der vorlie-gende Beitrag stellt eine Zusammenfassung der Ergebnisse aus oben genannterarbeit dar, ergänzt um neue literatur und neue Forschungsergebnisse sowieinsbesondere auch verbreitungsmäßig um westliche und südliche regionen inBaden-Württemberg (n. Brachmann 1993).
Peter ETTEL*
DIE ENTWICKLUNG DES FRÜHMITTELALTERLICHEN BURGENBAUS
IN SÜDDEUTSCHLAND BIS ZUR ERRICHTUNG VON UNGARNBURGEN
UND HERRSCHAFTSZENTREN IM 10. JAHRHUNDERT
© Pub
licati
ons d
u CRAHM
subjektiv geprägt, so dass sich von der terminologie her keineaussagen auf Größe, Bedeutung oder Funktion der Burgengewinnen lässt2.
Die historischen Quellenbelege ermöglichen einerseitsaussagen zum Zeitpunkt ihrer nennung, andererseits aus demKontext in gewissem Umfang auch zu ihren machthabern, ihrenaufgabenbereichen und damit zu ihrer Funktion. Dies gilt aller-dings kaum für die einzelne Burg, die meist nur in einer zufälligüberlieferten nennung erscheint, sondern nur für dieGesamtheit der frühmittelalterlichen Burgen in Süddeutschlandund darüber hinaus3.
Frühmittelalterliche Befestigungen sind im Geländezunächst durch topographische und vor allem befestigungs-technische merkmale charakterisiert. Sie heben sich von denvorhergehenden, vorgeschichtlichen Befestigungen und dennachfolgenden der hoch- und spätmittelalterlichen Zeit ab,
erlauben jedoch in den seltensten Fällen eine genauereDatierung als frühmittelalterlich, also im Wesentlichen 8.-10. Jahrhundert4.
Kennzeichnend ist eine verkehrsgünstige lage an Wasser-läufen und Wegen. Die Bewehrung setzt sich in der regel auseinem umlaufenden Befestigungssystem zusammen, das auchdie an sich bereits durch die natur gut geschützten Seiten miteinbezieht, so dass Gräben teilweise mit vorgelagertem Wallauch bei steilen hängen auftreten. Gräben und Staffelung derBefestigungssysteme sind charakteristisch, dazu könnenVorburgen gehören, genauso annäherungshindernisse imVorfeld.
In Süddeutschland finden sich drei Burgentypen, die in derregel allesamt auf der höhe angelegt wurden, also höhen-burgen darstellen: Dies sind erstens ringwallanlagen (abb. 7)und zweitens abschnittsbefestigungen (abb. 5). Für den dritten
PETER ETTEL140
4. Übergreifend behandelt von V. USlar 1964, zusammenfassend aBElS
1979, 36 ff.; EttEl 2001, 202 ff.2. röDEl 2001.3. EttEl 2001; zur Funktion: EttEl 2008.
Abb. 1: Verbreitung frühmittelalterlicher Burgen in Süddeutschland östlich des Rheins. Punkt: aufgrund topographischer Kriterien als frühmittelalterlich erschlossen, Quadrate: gegrabene Burgen. (P. Ettel).
© Pub
licati
ons d
u CRAHM
Grundtyp – „geometrische Burgen“ – ist charakteristisch, dassder Verlauf nicht mehr in dem maße der natürlichen Gelände-gestaltung angepasst ist, wie noch bei vorgeschichtlichenBurgen. So kann die mauerführung Sporn- oder Plateauvor-sprünge abschneiden und insgesamt geradlinig verlaufen(abb. 6.2). Viele Burgen sind so mit rechteckigem, halbkreis-förmigem oder ovalem Grundriss geometrisch angelegt.
Die Befestigung setzt sich in der regel aus einer mauer undeinem vorgelagertem Graben zusammen, der als Spitz- oderauch als Sohlgraben ausgeführt sein kann. Zuweilen ist eineBerme belegt. Die tore können als einfache Durchlässegestaltet oder zangenförmig bis hin zum Kammertor ausge-führt sein. In Bezug auf die meist nur durch Grabungenerschließbare Befestigungskonstruktion sind drei Grundtypenzu unterscheiden: trockenmauern, mörtelmauern undgeschüttete Wälle (hierzu siehe unten):
trockenmauern (abb. 7.2a oder 9.3b) konnten dabei teilsfreistehend errichtet sein oder teils mit holz-Erde-Konstruktion dahinter. auch mörtelmauern konntenfreistehend errichtet sein oder teils einer Konstruktion vorge-blendet (abb. 7.2b). trocken- wie mörtelmauern waren im
gesamten ostfränkischen Gebiet östlich des rheins seitfrühester Zeit im Burgenbau geläufig5. hier ist wohl eineEntwicklung, aber keine feste abfolge oder gar ein Schema inder abfolge der Befestigungsarten zu erkennen. mörtelmauern,in hessen auf der Büraburg oder dem christenberg mögli-cherweise seit dem ausgehenden 7. Jahrhundert belegt6, sindin nordbayern auf der Karlburg spätestens in der 2. hälfte des8. Jahrhunderts anzunehmen (abb. 5.1a). Im 10. Jahrhundertfand die mörteltechnik dann allgemein anwendung, als Front-verstärkung oder auch freistehend, einhergehend mit derErrichtung nicht nur einzelner, sondern mehrerer türme aufder außenfront (abb. 7.2b oder 9.3b). Im 11. Jahrhundertschließlich hat sich die mörtelbauweise in Süddeutschlandfest durchgesetzt.
nimmt man allein die Größe der Burgen als maßstab, die perse auch art und Weise der Innenbebauung mitbestimmt, solassen sich die frühmittelalterlichen Burgen in drei
Die Entwicklung des frühmittelalterlichen Burgenbaus in Süddeutschland bis zur Errichtung 141
5. V. USlar 1964; Brachmann 1988 und EttEl 2001, 204 f.6. WanD 1974, 90 ff.; GEnSEn 1975b; SonnEmann 2010.
Abb. 2: Verbreitung frühmittelalterlicher Burgen in Süddeutschland östlich des Rheins. Dreieck: historisch genannte Burgen mit jeweiliger Jahreszahl der Nennung. (P. Ettel).
© Pub
licati
ons d
u CRAHM
Größenordnungen7 untergliedern: Zu den Burgen mit über 3 haUmfang und oft mehrteiligen Befestigungssystemen gehörenPfalzen, auch große Burgen mit handwerkerarealen wie roßtal(abb. 7), die sicherlich eine mittelpunktsfunktion einnahmen.Die größte Gruppe bilden Burgen zwischen 1-3 ha, wozuKarlburg (abb. 5) oder auch die Schweinfurter Burgen (abb. 8und 9) gehören. als dritte Gruppe sind kleine Befestigungenvon 0,1 bis maximal 1 ha anzuführen (abb. 6.2b). nebenabschnitts- und ringwallanlagen althergebrachter Form sindfür diese sehr kleinen Burgen oftmals hanglage und einegeometrische Grundform kennzeichnend, die halbkreis förmig,annähernd oval oder trapezförmig sein kann. Während Burgender ersten beiden Gruppen vom 7.-10. Jahrhundert errichtet
und ausgebaut werden, treten kleine und sehr kleine Burgender dritten Gruppe mit weniger als 1 ha Gesamtfläche erst abBeginn des 9. Jahrhunderts auf.
2. BURGENBAU IM 4. UND 5. JAHRHUNDERT
auf den frühesten Befestigungsbau im süddeutschen raum infrühgeschichtlicher Zeit, den Burgenhorizont des 4. und 5. Jahr -hunderts, soll hier nur kurz eingegangen werden. Die erstmalsvon J. Werner8 herausgestellten Burgen wurden vonh. Brachmann9 und h. Steuer10 auf neuer Basis zusammenfassend
PETER ETTEL142
8. WErnEr 1965, 439 ff.; WEIDEmann 1975b; FEhrInG 1972.9. Brachmann 1993, 31 ff. mit liste 1 und Verbreitungskarte abb. 9.10. StEUEr 1990; ID. 1997, 149 ff.; zuletzt ID. 2005, 26 ff.; hoEPEr 1995.7. EttEl 2001, 208 ff.
Abb. 3: Höhensiedlungen des 4./5. Jahrhunderts in Süddeutschland. Punkte: Höhensiedlungen, Quadrate: Kastelle des spätrömischen Limes (nach StEUER 2005, 33).
© Pub
licati
ons d
u CRAHM
behandelt. Insgesamt sind über 60 vor allem in Baden-Württemberg verbreitete höhensiedlungen mit teilweisenachgewiese ner Befestigung dieser Zeitstellung bekannt(abb. 3). In Baden-Württemberg gehören dazu die sehr guterforschten höhensiedlungen runder Berg oder ZähringerBurgberg, in Bayern Kreuzwertheim bei Urphar11, Grainberg,houbirg, Würzburg, Ehrenbürg, Schwanberg, hammelburg,Goldberg, turmberg, reißberg, die Gelbe Bürg oder dermichelberg bei Kipfenberg. Ihre Verbreitung und Entstehungerklärt sich, wie die spätrömischen Kastelle zeigen, aus derKonfrontation mit den römern. Die höhensiedlungen sindherrschaftszentren, mittelpunkte von germanischen Verbändenoder Siedlungsgebieten, eventuell Gauburgen gewesen, aufdenen die Führer der alemannischen, im Fall von Urphar ostger-manischen, wohl burgundischen Einheiten, Gefolgschafts– oderStammesgruppen, die reges oder reguli, gelebt haben. Bei denPlätzen handelte es sich in der regel vielleicht weniger umBefestigungsanlagen oder militärisch gesicherte Plätze wie derGeißkopf12, denn um geschützte, repräsentative herrensitzemit bemerkenswerten, handwerklichen Einrichtungen, wozuWerkstätten für Grobschmiede, Zimmerleute, aber auch fürBunt- und Edelmetallschmiede gehörten. Waffen, Schmuckund kostbares trinkgeschirr spiegeln den rang dieserFundplätze wider. Diese höhensiedlungen wurden um 500 nachder niederlage der alemannen gegen die Franken weitgehendaufgegeben, im darauffolgenden 6. Jahrhundert, in der älterenmerowingerzeit, scheinen sie keine rolle mehr zu spielen13.nach dem Burgenhorizont des 4./5. Jahrhunderts gibt es im6. Jahrhundert in Süddeutschland keine anzeichen für einenBurgenbau.
3. SPÄTMEROWINGISCHER BURGENBAU IN DER 2. HÄLFTEDES 7. UND ZU BEGINN DES 8. JAHRHUNDERTS
Eine neue Befestigungsphase wird erst wieder in spätmero-wingischer Zeit, im 7. Jahrhun dert, vor allem in dessen 2. hälftefassbar. V. Uslar14, Fehring15 mildenberger16, Weidemann17 undBrach mann18 haben diesen frühesten Befestigungsbau, der seineWurzeln in den Zentren des fränkischen reiches besitzt, überre-gional behandelt. Wamser19 hat die frühesten Belege für dasmainfränkische Gebiet zusammengestellt. Im süddeutschenraum sind für das 7. Jahrhundert etwa 30 anlagen zumeistanhand von lesefunden der jünger- bis spätmerowin gischenZeit bekannt (abb. 4.1). Bei diesen Fundorten handelt es sichfast immer um mehrphasige, bereits in vorgeschichtlicher Zeit
errichtete anlagen unterschiedlicher Größe von kaum 1 ha bisüber 10 ha. Diese befanden sich an strategisch wichtigenPunkten, wie der Bullenheimer Berg, der Staffelberg, der Juden-hügel, der Iphöfer Knuck auf dem Schwanberg, die beidenGleichberge, Kreuz wertheim oder der michelsberg in münner-stadt. Südlich lassen sich diesen Burgen die Gelbe Bürg, derGoldberg und vielleicht auch die Stöckenburg sowie der rundeBerg bei Urach anschließen. Die meisten dieser anlagengehörten bereits zu den im 4./5. Jahrhundert genutzten höhen-burgen, was ihre stra tegische Bedeutung und oftmaligeBegehung und nutzung bezeugt. Die Einzelfunde setzen sichaus Waffen- und reitzubehör sowie Bestandteilen männlicheraber auch weiblicher tracht zumeist hoher, teilweise exzep-tioneller Qualität zusammen. Diese haben ihre Parallelen infränkischen und alamannischen Gräbern wie den Gräberg-ruppen des frühen 7. Jahrhunderts zu Füssen derSchwedenschanze von Wechters winkel und des Judenhügelsin Kleinbardorf und lassen auf einen adeligen Besitzerkreisschließen lassen. Wamser deutete diese anlagen in mainfrankenals befestigte Bergstationen20. Festzuhalten bleibt, dass für dieseanlagen eine Begehung belegt ist, die vielleicht einezeitweilige, stützpunktartige nutzung ein schließt, der archäo-logische nachweis einer in dieser Zeit errichteten Befestigungbislang aber noch aussteht.
an gesicherten Befestigungen des 7. Jahrhunderts kenntman bisher die mit 25 x 25 m sehr kleine anlage aus miltenbergin Unterfranken, die vermutlich zur Überwachung undKontrolle der land- und Wasserwege diente. In miltenberghatte man in der Ecke des ehemaligen römischen Kastells einekleine Befestigung von 25 x 25 m mit 0,06 ha Umfang errichtet,die vielleicht schon in frühkarolingi scher Zeit wieder aufge-lassen wurde. Die Befestigung setzte sich aus einerzweischaligen mörtelmauer von etwa 1,50 m Dicke auf einemtrockenmauerfundament zusammen21. Ebenfalls auf römischeGrundlagen zu rückgehend ist die Befestigung in regensburg ander Donau, dem hauptsitz der agilolfinger22. Vergleichbareanlagen zeigen die Sondersi tuation der ehemals römischenGebiete an, wie wir sie aus dem rheinland in vielfältigenBeispielen kennen. möglicherweise gehört auch der IphöferKnuck auf dem Schwanberg oder der Schloßbuck bei Gunzen-hausen23 bereits in das 7. Jahrhundert. Ungewiss bleibt die716 historisch genannte Befestigung von hammelburg, ebensodie des öfteren in der literatur24 für das 7. Jahrhundert inanspruch genommene Karlburg, von der es bislang keinengesicherten Beleg für eine Existenz der Befestigung in spätme-rowingi scher Zeit gibt. Einzig in Würzburg (abb. 4.2)
Die Entwicklung des frühmittelalterlichen Burgenbaus in Süddeutschland bis zur Errichtung 143
11. nEUBaUEr 2007.12. StEUEr 1990, 139 ff.; ID. 1997, 149 ff.; hoEPPEr 1995, 263 ff.13. Besiedlungsphasen oder gar Befestigungen, wie z. B. auf der Gelben
Bürg (EttEl 2001, 392 nr. 48) an genommen, sind höchst unsicher zu bewerten.14. V. USlar 1964.15. FEhrInG 1972, 38 ff.16. mIlDEnBErGEr 1978, 132 ff.17. WEIDEmann 1975a, 95 ff.18. Brachmann 1993, 62 ff.19. WamSEr 1984, 136 ff.
20. WamSEr 1984, 140: „besonders geschützte aufenthaltsorte relativmobiler adelsfami lien und ihres Ge folges“.
21. miltenberg: EttEl 2001, 394 nr. 137.22. regensburg: BooS et al. 1995; EttEl 2001, 395 nr. 170.23. Gunzenhausen, Schloßbuck (EttEl 2001, 393 nr. 83) Grabung von
1898, bei der zwei Scherben der reduzierend gebrannten, geglät teten, rädchen-ver zierten Ware und die tülle einer röhrenausguss kanne im nordwest bereichdes Walles gefunden wurden.
24. z. B. WEIDEmann 1975a, 104 abb. 4.
© Pub
licati
ons d
u CRAHM
PETER ETTEL144
Abb. 4: 1 Befestigungen der spätmerowingischen und frühkarolingischen Zeit in Süddeutschland östlich des Rheins. – 2 a Würzburg und dieBurg Marienberg. Holzschnitt aus Hartmann Schedels Weltchronik von 1493 (Ausschnitt) . – 2 b Historische topographie von Würzburg:
1 Frühmittelalterliche Höhenbefestigung auf dem Marienberg, 2 befestigte talsiedlung mit Kirchen St. Andreas/St. Burkard. (EttEL 1999, 75).
© Pub
licati
ons d
u CRAHM
erschließt sich mit der zweiteiligen anlage, einer höhen burgvon 0,9 und unten liegender, befestigter talsiedlung von ca.5,2 ha, also mit über 6 ha eine insgesamt sehr große Befes-tigung, die nach den archäologischen Funden bereits inspät merowingischer Zeit und auch nach der Kilianslegendewohl schon 686 bestand25. Bei dem augenblicklichenForschungsstand scheint es verfrüht, von einem umfassendenund ausgrei fenden Befestigungsbau des 7. Jahrhunderts inSüddeutschland26 ausgehen zu können, gesi cherte Burgenwerden erst um 700 fassbar, insbesondere mit den 686 bzw.704 und 716 histo risch genannten Befestigungen Würzburgund hammelburg des herzogs heden.
4. FRÜHKAROLINGISCHER BURGENBAU BIS ENDEDES 8. JAHRHUNDERTS
In deutlich größerem Umfang tritt uns der Burgenbau dann ab741/42 und in der 2. hälfte des 8. Jahrhunderts entgegen. FürFreising und Passau werden anlässlich der Bistumsgründungen739 Befestigungen genannt. Das 741/42 neugegründete BistumWürzburg erhielt als ausstattung die Burgen Eltmann,Stöckenburg und homburg sowie zehn Jahre später von KönigPip pin die Karlburg, die somit in dieser Zeit gesichert bestand27.hier tritt der König als Burgenbauer deutlich in Erscheinung.Der marienberg in Würzburg wird als Bischofssitz eingerichtet,in der markbeschreibung von hammelburg 777 wird fernereine hiltifridesburg genannt, die auf dem Sodenberg zu lokali-sieren sein wird28. Schließlich können für diesen Zeitraum nocheine reihe weiterer Burgen archäologisch erschlossen wer den:Dazu gehören Unterregenbach, ladenburg, Großeichholzheim,Salzburg, Donzdorf und vielleicht auch hürnheim29.
Karlburg gehörte demnach bereits zur Erstausstattung desvon Bonifatius 741/42 neugegründeten Bistums Würzburg, indessen Gründungskontext von zwei Schenkungsakten berichtetwird30. In einer ersten Schenkung übergab der karolingischehausmeier Karlmann dem Bistum ein marienkloster in einer
villa Karloburgo. 751/53 übereignete dann König Pippin demersten Bischof Burkard, vielleicht für seine Verdienste imZusammenhang mit der Krönung Pippins, Burg und Königshofcastellum cum fisco regali in Karlburg. nach der schriftlichenÜberlieferung bestand in Karlburg also spätestens zwischen741/42 und 750/51 eine Burg in königlicher hand, die KönigPippin dann 751/53 an Würzburg schenkte. Die historischenwie archäologischen Quellen schweigen darüber, ob die Burgerst in karolingischer Zeit, vielleicht unter Karl martell oderbereits in spätmerowingischer Zeit, vielleicht unter obhut derhedene errichtet wurde.
Über die karolingische anlage, Phase a, der frühenWürzburger Bistumszeit auf der Karlburg wissen wir dankluftbildbeobachtungen und eines kleinen Sondageschnitts von1994 einigermaßen Bescheid (abb. 5.1a und 5.2a). Im rahmender geophysikalischen Prospektion der Karlburg wurde 2008auch der karolingische Grabenverlauf untersucht, dessenVerlauf im Plan nun bestens sichtbar wird (abb. 5,3).Wenngleich der äußere ottonische Wallgraben nicht ganzparallel dazu verläuft, scheint er dennoch auf den karolingi-schen Graben Bezug genommen zu haben. Im Innenbereichfanden sich neben weiteren Siedlungshinweisen bisher nichteindeutig interpretierbare Spuren eines vergleichsweise kleinenGräbchens, möglicherweise der hinweis auf eine Palisaden-befestigung bislang unbekannter Zeitstellung31. Die Innenflächeder karolingischen Burg betrug 125 x 120 m, etwa 1,3 ha, siewar mit einem 5,30 m breiten und 1,90 m tiefen Grabenumwehrt, der den Sporn bogenförmig abschloss. In dem späterverfüllten und eingeebneten Graben fand sich über einerEinschwemmschicht, die für eine längere Bestandszeit desGrabens spricht, dichter, der inneren Grabenböschung auflie-gender Steinver sturz mit mörtel- und holzkohleresten sowieeinzelnen, darin eingeschlossenen Scher ben ein er hauptsächlichin karolingischer Zeit gebräuchlichen Warenart. Der Gesamt -befund lässt damit indirekt auf das einstige Vorhandensein einerkarolingischen mörtelmauer schließen, die ursprünglich hinterder inneren Grabenkante verlief (abb. 5.1a). Damit gehört dieKarlburg zu den frühesten Burgen mit mörtelmauerwerk inmainfranken und darüber hinaus in Süd deutsch land. alsVergleich sei auf die Büraburg in hessen verwiesen, eine derbestbekann testen Burgen mit mörtelmauer aus dem 8.Jahrhundert32. Im Innenraum der Karlburg fanden sich in demkleinen Sondageschnitt Pfostenstellungen und Siedlungsgruben,die auf eine in ten sive Bebauung und nutzung der Burghinweisen. Der Fund eines vielleicht frühmittel alterlichen,verzierten Beinplättchens, wohl von einem Kästchen, bezeugtdie anwesenheit einer sozial gehobenen Personenschicht aufder Burg.
Die Entwicklung des frühmittelalterlichen Burgenbaus in Süddeutschland bis zur Errichtung 145
25. nach den angaben der älteren Kilianslegende, die in der mitte des8. Jahr hunderts entstan den ist, war der aus Irland stammende heilige um dasJahr 686 in das Gebiet des östlichen Frankens zum «castellum, quod nominatur
Wirciburg» ge wandert, um hier seine missionstätigkeit zu beginnen. 689mussten Ki lian und seine Begleiter Kolonat und totnan hier wegen seinesEinspruchs gegen die unkanonische Ehe des her zogs Gozbert mit dessenSchwägerin Geilana das leben lassen. Zum Befund: WamSEr 1992, 39 ff.;roSEnStocK 2001, 51 ff.
26. So WEIDEmann 1975a; Brachmann 1993, 62 ff.; l. Wamser hat diesin sei nem aufsatz 1984 auch nicht expressis verbis gesagt (und ausdrückenwollen).
27. Eltmann: röDEl 2001, 287; Stöckenburg: röDEl 2001, 287 homburg:röDEl 2001, 287.
28. hammelburg-morlesau, Sodenberg (EttEl 2001, 393 nr. 86) = hilti-fridesburg: röDEl 2001, 287.
29. langenburg-Unterregenbach: EttEl, 2001, 394, nr. 126; Seckach-Großeichholzheim: EttEl 2001, 396 nr. 191; Bad-neu stadt- Salz, Salzburg:EttEl 2001, 391 nr. 14,; Donzdorf: nEUFFEr 1972, 55 f.; Ehingen, hes -selberg-Ehinger Berg (EttEl 2001, 392 nr. 62). ob die Befestigung auf demEhinger Berg bereits im 8. Jahr hundert bestand, mag dahingestellt bleiben.
30. EttEl 2001, 41 ff.; ID. 2011.
31. lInK & oBSt 200832. Büraburg: WanD 1974, 90 ff., dazu neuerdings SonnEmann 2010,
331 ff. zu den Befestigungsperioden auch im Vergleich zu n. Wand auf derBüraburg SonnEmann 2010, 340 ff. mit abb. 140 u. 142 und die abschließendeWertung ebd. 346.
© Pub
licati
ons d
u CRAHM
5. KAROLINGISCHER BURGENBAU IM 9. JAHRHUNDERT
am Übergang zum 9. Jahrhundert und in dessen erster hälfte(abb. 6.1) kann schließlich eine große Zahl von Burgennamhaft gemacht werden. Unterregenbach bestand weiter,ebenso die Karlburg und etwa um 800 wird man die Errichtungder Burgen von roßtal und oberammerthal ansetzen können.Im gleichen Zeitraum werden die Burgen von Bam berg,
Burgkunstadt, cham entstanden sein. Der michelsberg beineustadt am main, der haderstadl bei cham, Weißenburg undauch der Kappelrangen auf dem Schwan berg wurden wohlebenfalls spätestens zu dieser Zeit befestigt33. nach den
PETER ETTEL146
33. Bamberg: EttEl 2001, 391, nr. 17; Burgkunstadt: EttEl 2001, 392,nr. 37; cham: EttEl 2001, 392, nr. 41; neustadt a. main, michelsberg: EttEl
2001, 394, nr. 147; chammünster-ha derstadl, lamberg: EttEl 2001, 392,
Abb. 5: Karlburg. 1 Rekonstruktion der karolingischen (a, R. Obst unpubliziert) und ottonischen (b, EttEL 1999, 79) Zeit. – 2 Entwicklungsphasen der Karlburg: A karolingisch, B ottonisch (EttEL 2001, Abb. 22,A-B). – 3 Luftbild der Karlburg mit
Magnetogramm (LiNK & OBSt 2008, Abb. 166). – 4 Die Karlburg von Osten gesehen (EttEL 2001, taf. 246,2). Foto: S. Gerlach.
© Pub
licati
ons d
u CRAHM
Die Entwicklung des frühmittelalterlichen Burgenbaus in Süddeutschland bis zur Errichtung 147
Abb. 6: 1 Befestigungen des 9. Jahrhunderts in Süddeutschland östlich des Rheins (P. Ettel). – 2 Eiringsburg bei Arnhausen: a topographie Burg und Siedlung, b topographischer Plan (EttEL 1999, 106 links, 107 unten links u. unten rechts),
c Rekonstruktion der zweischaligen trockenmauer.
© Pub
licati
ons d
u CRAHM
historischen Quel len ist die Grabfeldburg für 812 belegt undauch den Bestand der erst gegen Ende des 9. Jahr hunderts histo-risch überlieferten Vogelsburg wird man in dieser Zeitannehmen dürfen34. In das Jahr 816 fällt die Erwähnung derEkkilunpurc (Vordereggelburg) des mächtigen Ge schlechts derEbersberger, die Vorgängerbefestigung der 739 gegründetenBurg Ebersberg35.
Die frühesten spätmerowingischen Burgen liegen weitgestreut in den durch die merowingischen Gräberfelderumschriebenen altsiedellandschaften (abb. 4.1). auch die ausder frühkarolingischen Zeit und der 2. hälfte des 8. Jahr -hunderts bekannten Burgen halten sich an die Gebiete deraltsiedellandschaften (abb. 4.1). Eine Grenzbefestigungsliniegegen äußere Gefahren, insbesondere die Slawen, wird nichterkennbar, eher wird man bei der Funktion der Burgen darandenken, dass sie ne ben der militärischen absicherung vor allemzum aufbau einer organisatorischen und verwal tungsmäßigenStrukturierung des fränkischen altsiedellandes beitragensollten. Dies gilt gleichermaßen für die karolingischen ausbau-gebiete, wo der landesausbau in der anfangsphase nicht mitgleichzeitig errichteten Burgen einherging, sondern derBurgenbau erst in einer fortgeschrittenen Phase des landes-ausbaus, etwa um 800 und danach einsetzte, als diepolitisch-räumliche Erschließung der neuen Gebiete bereitsweit gehend erfolgt und abgeschlossen war. Vergleichbar denaltsiedellandschaf ten haben die Burgen auch in den ausbau-gebieten neben militärischen aufgaben vor allemadministrative, organisatorische und strukturelle mittel-punktsfunktionen überörtlicher Be deutung wahrgenommen.
Die fast 6 ha große Burg von roßtal (abb. 7) ist aufgrundihrer Größe durchaus Pfalzen vergleich bar36. In den histori-schen Quellen wird sie erst 954 im Zusammenhang mit einerSchlacht am 17. Juni genannt, als die Burg in luidolfingischerhand der Belagerung ottos I. widerstand. nach den archäolo-gischen Quellen bestand die Burg aber bereits in karolingischerZeit und dürfte um 800 errichtet worden sein. Die Bewehrungder karolingischen Burg bildete eine holz-Erde-Stein-Konstruktion mit vorgeblendeter trockenmauer und Bermesowie einem vorgelagertem Spitzgraben. In der 1. hälfte des 10.Jahrhunderts wurde die Befesti gung verstärkt, indem man deralten trockenmauerfront eine ca. 1 m breite mörtelmauervorbaute, im besonders gefährdeten Bereich zur hochflächehin einen turm errichtete und einen weiteren Graben aushob(abb. 7.2).
Der Innenraum der Burg (abb. 7.1,3) war bereits in karolin-gischer Zeit großräumig genutzt und strukturell gegliedert. In
großflächig aufgedeckten Grabungsarealen zeigt sich einefunktionale und plan mäßig angelegte Gliederung des Innen-raums mit vor allem handwerklich genutzten Bereichen -Grubenhäusern und arbeitsgruben sowie arealen mit ebener-diger Pfostenbebauung. radial von der rückfront der mauerwegführende Zaungräbchen gliederten das Flächenareal imSüdwesten in drei funktionale Bebauungseinheiten mitheuspeichern oder Wohnbauten, Speichern und vielleichtStällen/Scheunen, die man die gesamte nutzungszeit mit einermindestens dreiphasigen Bebauung bis zur aufgabe in der2. hälfte des 10. Jahrhunderts beibehielt. Im Zentrum der Burgwird eine später bezeugte Kirche gestanden haben, einGräberfeld fand sich außerhalb der Befestigung.
neben Befestigungen meist mittelgroßer bis großer bzw.sehr großer art werden ab Beginn des 9. Jahrhunderts verstärktauch kleine und sehr kleine Burgen mit weni ger als 1 ha bzw.0,5 ha Gesamtfläche errichtet37. Unter diesen kleinen Burgenfallen besonders die annähernd geometrischen Burgenformen,teils in hanglage auf. Dazu gehört die Eiringsburg an derFränkischen Saale38 mit typischen Zangentoren und leichttrapezförmiger Form von 120 x 65 m, die vermutlich einemfreien Franken namens Iring gehörte (abb. 6.2). In den histo-rischen Quellen ist ein Iring bekannt, der im Südteil der 801genannten mark Kissingen unterhalb der Eiringsburg Besitzhatte, den er 822 an Fulda schenkte. Dabei dürfte es sich sehrwahrscheinlich um das abgegangene lullebach und das950 belegte Iringshausen gehandelt haben.
Burgen dieser Größe finden sich vor allem in zuvor vomBurgenbau kaum bis überhaupt nicht erfassten und zudemoftmals neu erschlossenen Siedlungsregionen. Das Beispiel derEiringsburg gibt den hinweis, dass offensichtlich spätestenszu anfang des 9. Jahrhunderts das königliche Befestigungs-recht teilweise delegiert wurde. Das königlicheBefestigungsregal wurde gelockert und der adel, als tragendeKraft vor ort in der landessicherung err ichtete zunehmendselbst Burgen. Frühe ansätze werden bei der Eiringsburg bereitszu Beginn des 9. Jahrhunderts fassbar, die zu den wenigenorten in Franken und dar über hinaus gehört, wo früher adel alsBurgenbauer historisch und archäologisch in Erscheinung tritt.Die Verhält nisse in castell und Ebersberg mögen ebenfallsdarauf hin weisen39. ansonsten fehlt uns eine schriftlicheÜberlieferung, in hessen und im rheinland kennen wir aberdurchaus weitere Beispiele40. auffallend ist der her ausgestellteBurgentyp, der vielleicht mit dieser politischen Veränderungeinhergeht, spricht doch die Größe dieser Burgen dafür, dass sienicht übergeordneten landespolitischen aufga ben dienten,sondern auf das Schutzbedürfnis einer adeligen Familie,
PETER ETTEL148
37. In hessen scheinen sehr kleine Burgen bereits früher (im 8. Jh.) belegtzu sein. GEnSEn 1975a, 331 ff. mit abb. 15: z. B. rickelskopf, Burg beicaldern; GEnSEn 1975c, 361 ff.
38. SchWarZ 1975, 338 ff. u. 389 f.39. EttEl 1998; SaGE 1980, 214 ff.40. mayr & StörmEr 1996, 166: Schäftlarn-mühltal, ältere Babenberger.
JanSSEn 1983, 299 ff.
nr. 42; Weißenburg: EttEl 2001, 397, nr. 233; rödelsee, Schwan berg-Kappelrangen: EttEl 2001, 395, nr. 177.
34. Grabfeldburg: münnerstadt, Windsburg: EttEl 2001, 394, nr. 139 odermünnerstadt-Burghausen, mi chelsberg: EttEl 2001, 394, nr. 140; Vol kach-Escherndorf, Vogelsburg: EttEl 2001, 397, nr. 229. - auch die civitasaschaf fenburg (EttEl 2001, 391, nr. 9) soll spätestens um die mitte des9. Jahrhunderts bewehrt gewesen sein.
35. Brachmann 1993, 180 ff.; SaGE 1980, 214 ff.36. SchWarZ 1975, 338 ff.; EttEl 2001, 100 ff.
© Pub
licati
ons d
u CRAHM
Die Entwicklung des frühmittelalterlichen Burgenbaus in Süddeutschland bis zur Errichtung 149
Abb. 7: Roßtal. 1 Plan der karolingischen Burg (a) und ottonischen Burg (b) mit Pfostenbebauung (schwarz), handwerklich genutzter Bereich (schraffiert). – 2 Rekonstruktion der karolingischen (a) und ottonischen (b) Befestigungsphase.
– 3 Plan der Südostecke mit Befestigungsphasen, innenbebauung. Pfostenhäuser: hell gerastert, unbeziffert; Grubenhäuser: dunkel gerastert, beziffert. (1-2: EttEL 1999, 94 links, 96 links; 3: EttEL 2001, Beil. 2).
© Pub
licati
ons d
u CRAHM
vielleicht mit der dazu gehörigen talsiedlung und dem umlie-genden Besitz ausgelegt waren41.
Dieser Burgentyp stellt sicherlich neben dem Burgentyp vonSulzbach-rosenberg (siehe unten) eine weitere frühmittelal-terliche Wurzel zur Entstehung der klassischen adelsburg dar,die dann in hoch- und spätmittelalterlicher Zeit in entwickelter,verschiedener Gestalt, sei es als höhen- oder als nieder-ungsburg, zahlreich in Erscheinung tritt und sowohl innere alsauch äußere landesausbauvorgänge in Süddeutschland wieanderswo kennzeichnet. Burgen der art von Eiringsburg oderSulzbach-rosenberg zeigen, dass die Entstehung der hochmit-telalterlichen adelsburg weiter zurückreicht und vielschichtigerist als bisher angenommen und nicht nur auf die kleinen höhen-wie niederungsburgen, vor allem turmburgen, des ausge-henden 10. Jahrhunderts wie Weißenstein bei marburg-Wehrda,marburg und vor allem des 11. Jahrhunderts wie arnsburg oderSchlössel bei Klingenmünster zu beschränken ist42.
Burgen in adeliger hand spielen mehr und mehr einewichtige rolle, zumal in der Schwä cheperiode des Königsgegen Ende des 9. Jahrhunderts. Dies wird erstmals mit derBabenber ger Fehde deutlich, in deren Verlauf die beiden Burgenvon theres und Bamberg in die hand der Babenberger geraten.Bamberg, das sich zuvor sicherlich in königlicher hand befand,wird als ihr Sitz bezeichnet, nach theres haben sie sich vordem königlichen aufgebot zurückgezo gen.
6. BURGENBAU IM 10. JAHRHUNDERT
Im 10. Jahrhundert (abb. 8) bestanden zahlreiche Burgenweiter, darunter Burgkunstadt, neustadt a. main, Unterre-genbach, Banz, Bamberg43, die jetzt teilweise, wie in roßtalbeschrieben, eine Verstärkung mit einer vor die alte Front derholz-Erde-Stein-mauer gesetzten mörtelmauer erfuhren. Inregensburg errichtete man die arnulf-mauer44. 908 erhältBischof Erchambold für Eichstätt von König ludwig dem Kinddie Erlaubnis, bei seinem Kloster einen befestigten ort herzu-stellen. Unter Bischof Udalrich (923-973) wird auch derBistumsort augsburg wegen der Ungarngefahr befestigt. 910soll es nach aller dings nicht sehr zuverlässigen Quellen beiBad abbach, das heinrich II. 1007 an das neuge gründeteBistum Bamberg gibt, zu einem treffen zwischen Ungarn undFranken gekommen sein. Donaustauf wird unter dem regens-burger Bischof tuto (894-930) genannt, 929 stellte heinrich I.,von einem Feldzug zurückkommend, in nabburg eine Urkundeaus. Für 954 berichtet Widukind von corvey in seiner Sachsen-chronik im rahmen des luidolfingischen aufstandes über dieBelagerung von roßtal bei Fürth. Bischof Ulrich zog sich 954
während des luidolfingischen aufstandes in seine BurgSchwabmünchen zurück, weil augsburg von den aufständi-schen besetzt worden war45.
Es kommt damit zu einem nochmals verstärkten Befesti-gungsbau, die Burgendichte erhöht sich und auch im östlichenausbaugebiet werden zahlreiche Burgen un terschiedlicherGröße fassbar. Gründe für die Errichtung von Burgen im 10.Jahrhundert bildeten einerseits Ungarneinfälle, die sich in dengeschütteten Erdwällen dokumentieren, andererseits erstarkteadelsgeschlechter, deren macht sich sowohl auf eigensgegründete als auch usurpierte, vormals in königli cher handbefindliche Burgen begründete. Die Babenberger Fehde gibt einberedtes Zeugnis davon. Das Königtum trat in der Schwäche-periode gegen Ende des 9. Jahrhunderts und in der 1. hälfte des10. Jahr hunderts als Burgenbauer wohl weniger in Erscheinung,seine macht erstarkte erst wieder mit den sich konsolidierendenottonen. Einerseits entstanden große anlagen wie laineck mit6 ha, die nab burg mit 7 ha oder die Gelbe Bürg mit über 16 ha,andererseits mittelgroße Burgen wie der turmberg mit 1,2 haund kleine wie sehr kleine Burgen unter 1 bzw. 0,5 ha wietreuchtlingen oder christgarten46.
Eine Gruppe von Burgen einheitlicher Befestigungsart trittuns in der 1. hälfte des 10. Jahrhunderts mit den geschüt tetenWällen (abb. 8) entgegen. Solche Wälle werden mit hinweisauf St. Gallen, wo man 926 nach dem Bericht von Ekkehart IV.im Zuge der Ungarngefahr einen Wall − die Wallburg beihäggenschwil − aufschüttete, meist als Ungarnrefugienbezeichnet47. Geschüttete Erdwälle sind topographisch als auchdurch Gra bungen belegt, charakteristisch sind heute nochzwischen 4-6 m hoch erhaltene Wälle wie auf dem Schwanbergoder der Birg bei Schäftlarn48. Das material dieser Wällebestand aus Erde und Steinen und wurde wohl meist alsaushubmaterial aus den Gräben direkt hinter diesen aufge-schüttet. Die Gräben sind mit einer durchschnittlichen Breitevon 10-12 m sehr groß dimensioniert. Kennzeichnend sindferner dem abschnittswall vorgelagerte annäherungshinder-nisse in Form einfacher Gräben mit dahinter liegendem Wall.Die meisten Burgen mit geschütteten Wällen weisen Innen-flächen von mehr als 1,5 ha bis zu 17 ha auf; Burgen unter 1 hascheinen in dieser Gruppe bislang nicht vorzukommen. Fernerbilden mehrteilige Befestigungsanlagen wie auf demSchwanberg mit über 100 ha Umfang die ausnahme.
Die Datierung dieser Wallanlagen ist oft schwierig, meistwerden sie im analogieschluss zu St. Gallen in die Ungarnzeitgesetzt, in Karlburg belegt dies neben der relativen abfolgeder Bewehrungen auch das Fundmaterial. auch in Bad neustadt
PETER ETTEL150
45. EttEl 1999, 51 ff.46. EttEl 2001, 208 ff. (laineck: EttEl 2001, 391, nr. 19; nabburg:
EttEl 2001, 394, nr. 141; Dittenheim, Gelbe Bürg: EttEl 2001, 392, nr. 48;Kasendorf, turmberg: EttEl 2001, 394, nr. 109; treuchtlingen: EttEl 2001,396, nr. 219; christgarten: EttEl 2001, 392, nr. 55 und 57).
47. V. USlar 1964, 161 ff. - Zur historischen Bedeutung der Ungarnkriege:StörmEr 1991, 55 ff.
48. SchWarZ 1972; SchWarZ 1975, S. 402 ff.; rödelsee, Schwanberg:aBElS 1979, 111 f.
41. EttEl 2006; zusammenfassend BöhmE 2006.42. BöhmE & FrIEDrIch 2008.43. Burgkunstadt: EttEl 2001, 392, nr. 37; neustadt a. main, michelsberg:
EttEl 2001, 394, nr. 147; langenburg-Unterre genbach: EttEl 2001, 392,nr. 126; Staffelstein-Banzer Wald, Banzer Berg: EttEl 2001, 396, nr. 201;Bam berg: EttEl 2001, 391, nr. 17; Ebersberg (SaGE 1980, 214 ff.).
44. EttEl 2001, 395, nr. 170. BooS et al. 1995.
© Pub
licati
ons d
u CRAHM
a. d . Saale wird es sich bei dem Erdwall mit Graben um eineungarnzeitliche Befestigung gehandelt haben49. letztlich sprichtfür die Errichtung in die Zeit der Ungarneinfälle auch die artder Befestigung, die schnell und ohne große Vor kenntnisseerrichtet werden konnte und mit ihren mehrfachen, hohenWällen und Gräben vor allem gegen die abwehr von reiter-scharen geeignet ist. Dies entspricht der historischen Situationmit den überlieferten Ungarneinfällen der Jahre 908 bis 955, dieviele regionen in ganz mitteleuropa in unterschiedlicher Inten-sität erfassten50.
oftmals wurden mit diesen Erdwällen aber nicht neue Befes-tigungen angelegt, sondern meist ältere, schon bestehendeBe festigungen offensichtlich wirkungsvoller geschützt. Einer-seits kam es zu einer Vergrößerung des Innenraumes wie inKarlburg, oder Verringerung des Innenraumes, andererseitsauch zum Überschütten älterer Bewehrungen wie auf der Birg
bei Schäftlarn. Wie lange diese Erdwälle Bestand hatten, wirdvon Burg zu Burg unterschiedlich zu bewerten sein. teilswurden sie bald wieder aufgegeben, teils aber in jüngerer Zeitverstärkt. In vielen Fällen stellen geschüttete Wälle also nureine zeitspezifische Befestigungsphase der jeweiligen Burgdar. Dies trifft auch auf die Karlburg zu (abb. 5.1,2), die frühka-rolingische Befestigung setzte sich aus Graben undmörtelmauer zusammen, in ottonischer Zeit vergrößerte mandas Burgareal und errichtete eine Befestigung aus einemgeschütteten Stein-Erde-Wall von 9-10 m Breite undursprünglich mehreren metern höhe, dem ein Graben ohneBerme vorgelagert war51.
Welche rolle Burgen im 10. Jahrhundert spielten, zeigtbeispielhaft die Burgengruppe der Schweinfurter Grafen innordbayern, die 1003 in der chronik thietmars von merseburganlässlich der auf lehnung und des Untergangs der Schwein-furter genannt werden (abb. 8). In der 2. hälfte des
Die Entwicklung des frühmittelalterlichen Burgenbaus in Süddeutschland bis zur Errichtung 151
49. EttEl & WErthEr 2010, 12. neustadt wie Karlburg sind in einemvom rGZm initiierten Projekt „reiterkrieger, Ungarnburgen“ eingebunden.
50. SchUlZE-Dörrlamm 2006. 51. EttEl 2001, 41 ff.; EttEl 2011.
Abb. 8: Befestigungen des 10. Jahrhunderts in Süddeutschland östlich des Rheins (P. Ettel).
© Pub
licati
ons d
u CRAHM
PETER ETTEL152
Abb. 9: 1 Oberammerthal: 1 a Plan der karolingischen Burg, b ottonischen Burg mit Haupt-, Vorburg und Kirche (Ettel 1999, 88). – 2 Liebfrauenkirche: a Bauphase 1 aus dem 10. Jahrhundert, b Rekonstruktion aus dem 11. Jahrhundert. – 3 Rekonstruktion derBewehrung: a Mauer 1 der Vorburg, b Mauer 4 mit turm 2 der Vorburg (EttEL 2001, Abb. 69,A-B, Abb. 69,A1). – 4 Sulzbach:
Rekonstruktionsvorschlag (a) und Rekonstruktion (b) zum Bebauungsschema des nördlichen teils der Sulzbacher Kernburg am Ausgang des 10. Jahrhunderts (Siedlungsperiode iii); die hellgrauen Flächen zeigen keine gesicherten Grundrisse,
sondern lediglich bebaute Areale an (HENScH 2005, taf. 27).
© Pub
licati
ons d
u CRAHM
10. Jahrhunderts bauten die Schweinfurter Grafen, seit 939 mitder markgraf schaft über den vormals herzoglich-bayerischennordgau belehnt und damit das gesamte nordöstliche Bayernin ihrer hand vereinigend, ihr Burgennetz (abb. 8) aus, dasihre weitläufigen Be sitzungen sicherte. hierzu zählen dieStammburg Schweinfurt sowie die Burgen Kronach, creußen,Banz, Burgkunstadt und oberammerthal, vielleicht auchSulzbach-rosenberg sowie nabburg, cham und nürnberg52.Der militärische, machtpolitische Faktor der Burgen tritt dabeideutlich zutage: Die Burgen bildeten als militärische, adminis-trative, ökonomische und kirchlich-politi sche mittelpunkte dasrückgrat der aufstrebenden, frühterritorialen landesherrschaftder Schweinfurter markgrafen, deren macht mit diesen Burgenstand und fiel. Entsprechend werden die großen Burgen derottonischen Zeit als landesburgen bezeichnet, weil sie nicht nurBefestigungen darstellten, sondern stadtähnliche Strukturenvorwegnahmen, ohne selbst zu Städten im späteren rechtssinnzu werden. Im Jahre 1003, nach der Erhebung des markgrafen,zerstörte König heinrich II. sämtliche Schweinfurter Burgen,die damit Großteils ihr Ende fanden.
Bei den Schweinfurter Burgen handelt es sich vielfach nichtum neu errichtete anlagen, sondern um bereits länger beste-hende Burgen, die unter den Schweinfurtern im10. Jahrhundert ausgebaut, auf den modernsten Stand derBefestigungstechnik gebracht und entsprechend den Vorstel-lungen der Zeit umgebaut wurden. Dazu gehört die Burgoberammerthal in der oberpfalz (abb. 9.1) mit 2 ha Umfangund einer holz-Erde-Stein-Konstruktion als Befestigung inkarolingischer Zeit (abb. 9.1a,3a). Im 10. Jahrhundert, nun inSchweinfurter Besitz, wurde die anlage in eine haupt- undVorburg geteilt, die beide jeweils mit einer mörtelmauergeschützt wurden. Die Vorburg wurde zu sätzlich mit türmenbewehrt (abb. 9.1b,2b). In der hauptburg standen eine Kirche(abb. 9.2) und wohl weitere repräsentative Gebäude derSchweinfurter53.
Die Burg Sulzbach-rosenberg in der oberpfalz (abb. 9.4)vermittelt neuerdings am besten, wie man sich die zentralen,verwaltungsmäßigen Einrichtungen einer bedeutenden frühmit-telalterlichen Burg mit entsprechenden repräsentationsgebäudenvorstellen darf54. In der Burg (abb. 9.4) konnten in Periode I(8. Jahrhundert) holzbauspuren und in Periode II (9. bis frühes10. Jahrhundert) neben einem etwa 15 m langen und 7,5 mbreiten Saalbau aus Bruchsteinen mit relativ stark eingezo-gener, halbrunder apsis im osten − der karolingischenBurgkirche − auch ein 21,5 m langes und ca. 8 m breites Saalge -bäude mit zweischaligem mauerwerk und einer zentral in Steingefassten Feuerstelle aufgedeckt werden. Dazu fanden sichFragmente von Fensterglas, teils mit Bemalung in Gestalt vonBuchstaben, die ein Bild von der ausstattung mit adeligerWohnkultur geben. In diesen rahmen gehören ab Periode III
(10. Jahrhundert) auch ein beheizbares Wohngebäude und einweiterer Steinbau. Die nennung urbs in der Schilderung beithietmar von mer se burg könnte sich auf Sulzbach-rosenbergbeziehen und hensch kommt so aufgrund der ausstattung derBurg, unter anderem Bestattungen mit aufwändigen Grabkon-struktionen im außenbereich der Burgkirche sowie dermutmaßlichen Größe und Gliederung von 4,2 ha mit haupt-und Vorburg zu dem Schluss, dass es sich um den amtssitz dernordgaugrafen gehandelt haben könn te und die Grafen vonSchweinfurt als königliche Statthalter hier residierten.
Bei den Schweinfurter Burgen kommen sowohl eine relativgute historische als auch archäologische Quellenüberlieferungzusammen. Der runde Berg in Baden-Württemberg zeigt, dassder Kreis der frühen adelsburgen in Süddeutschland sicherlichgrößer zu ziehen ist. Die Burg des 9./10. Jahrhunderts auf demrunden Berg weist mit Steinmauer, türmen bzw. Wohnbauten,Sakralbau mit Glasfenster, 3-4 periodiger Innenbebauung,darunter Wirtschaftsgebäude und Kachelofen, eventuell reticil-laglasfunden eine durchaus komfortable ausstattung auf, wasebenfalls für eine frühe adelsburg sprechen könnte55. Die Burgerscheint jedoch in keiner schriftlichen Quelle und zeigt einmalmehr, dass die historischen Quellen nur einen Bruchteil destatsächlich vorhandenen Burgenbestandes widerspiegeln.
7. AUSBLICK - BURGENBAU IM 11. JAHRHUNDERT
Sieht man die zeitliche Entwicklung des frühmittelalterlichenBurgenbaues unter räumlichen aspekten, so wird z.B. im raumnördlich der Donau deutlich, dass der fränkische Burgenbauder spätmerowingischen Zeit (abb. 4.1) vor allem in den west -lichen regionen, insbesondere Unterfranken und südlichesmittelfranken bis und entlang der Donau fassbar wird miteinzelnem ausgreifen entlang des mains in die Gebiete östlichdes Steigerwaldes insbesondere in die region im obermain-gebiet um den 742 belegten Königshof hall stadt bei Bamberg56.Dies ändert sich auch in der frühkarolingischen Zeit, d.h. inder 2. hälfte des 8. Jahrhunderts nicht wesentlich, auch wennsich das Bild verdichtet und gerade in der südwestlichen regionneue Burgen hinzukommen (abb. 4.1). Inwieweit der wichtigeVerbin dungs-Verkehrsweg − die regnitz-linie − mit roßtalschon gesichert wurde, muss offen bleiben. Eine entscheidendeausweitung des Burgenbaus nach osten in die Gebiete ober -frankens und der oberpfalz tritt dann sicherlich um 800,vielleicht mit Karl dem Großen ein. roßtal und oberammerthalzeugen genauso wie wohl wenig später Bamberg, nabburg undcham davon. Diese Burgen überziehen, wenn auch vielleichtzahlenmäßig bislang nicht größer fassbar, doch weiträumig undstrategisch die neuen regionen (abb. 6.1). Sie stecken dabeigebietsmäßig einen rahmen ab, der im ausgehenden9. Jahrhun dert sowie auch noch im 10. Jahrhundert (abb. 8)weitgehend gleich bleibt, d. h. der Burgen bau weitete sich nicht
Die Entwicklung des frühmittelalterlichen Burgenbaus in Süddeutschland bis zur Errichtung 153
52. EttEl 2007; EmmErIch 1957, 67 ff. rechnet auch nabburg und chamzum Einflussbe reich der Schweinfurter markgra fen, hersbruck ist fraglich.
53. EttEl 2001, 154 ff.54. hEnSch 2005, 59 ff., 400 ff.; hEnSch 2010.
55. Koch 1991, 116 ff.; KUrZ 2009.56. EttEl 2001, 220. Für Bamberg wird eine frühe Bewehrung vor 800
zumindest vermutet: SaGE 1986, 180. 207 ff.; ZEUnE 1993, 43 ff.
© Pub
licati
ons d
u CRAHM
PETER ETTEL154
weiter nach osten aus und hielt sich an die vorgegebenenGrenzen. Freilich verdichtete sich das Bild der Burgen im10. Jahrhundert stark, was sich insbesondere in den östlichenlandesteilen deutlich zeigt, wo mit kleineren und sehr kleinenBurgen unter 0,5 ha auch Freiräume zwischen den größerenund großen Burgen aufgefüllt wurden. Damit zeichnen sichvermutlich innere landesausbauvorgänge ab - Vorgänge, diedann im 11. und 12. Jahrhundert weit deutlicher zutage treten.
Im 11. Jahrhundert bekommen Burgen einen anderencharakter. Befestigte Städte, mehrfach die ehemaligenSuburbien von Burgen und oftmals administrative aufgabenvon Burgen übernehmend, gewinnen nach 1000 mehr und mehran Bedeutung. Burgen kleineren ausmaßes werdenbestimmend, sei es als ministerialansitz oder als militärischerStützpunkt der territorialherrschaft und später als Sitz einesamtes im rahmen der landesverwaltung. neue Burgentypenkommen auf, seien es kleine höhenburgen mit herkunftsnamenoder turmhügel und ebenerdige an sitze. Dabei zeigt sich z. B.für nordbayern, dass sie einerseits in zuvor vom frühmittelal-terlichen Burgenbau wenig erschlossenen regionen wie demwestlichen mittelfranken und östlich der regnitz erscheinen,andererseits aber nun auch in vom frühmittelalterlichenBurgenbau überhaupt noch nicht erfasste Gegenden wie Eger,Saale, obermaingebiet in Frankenwald, Fichtelgebirge und
oberpfälzer Wald vorstoßen und ferner das obere naabtal sowiedas obere Vilstal und das Pegnitztal erschließen57. EinenGroßteil dieser Burgen wird man mit recht den sogenanntenrodungsburgen zuweisen dürfen, wie sie von W. meyer fürdie Schweiz herausgestellt wurden58. Burgen diesen typskennzeichnen in Süddeutschland wie auch anderswo eineweitere Phase im Burgenbau, zugleich eine neue Phase in derkultur- und landesgeschichtlichen Entwicklung, erschloss dereinhergehende hoch- und spätmittelalterliche landesausbaudoch einerseits in den altsiedelgebieten neue, auch wenigersiedlungsgünstige regionen wie höhen- und tiefenlagen undnahm andererseits im osten, dabei weit über die zu vorigeSiedlungsgrenze ausgreifend, die Gebiete der östlichenoberpfalz und des östlichen wie nördlichen oberfrankens inBesitz. Im 11. Jahrhundert spielten große Burgen kaum einerolle mehr, die meisten gab man auf wie roßtal, nur wenigeexistierten weiter wie die Karlburg und wurden dann in neueaufga ben als Verwaltungs- bzw. amtssitz der territorialmächteeingebunden.
57. EmmErIch 1957, 93 ff.; EnDrES 1976, 303 ff.; EttEl 2001, 220 f. mitabb. 85. – Zum landesausbau allgemein: hInZ, 1972, abb. 7; 8c u. 8d (Befes-tigungen in oberfranken abb. 7); DErS. 1981.
58. mEyEr 1977, 43 ff.; ID. 1985, 571 ff. 585 ff.
© Pub
licati
ons d
u CRAHM
aBElS B.-U.1979, Die vor- u. frühgeschichtlichen Gelän-
dedenkmäler Unterfrankens, materialh.Bayer. Vorgesch. 6, Kallmünz.
BöhmE h.-W.2006, Burgen der Salierzeit. Von den anfängen
adligen Burgenbaus bis ins11./12. Jahrhundert. In: JarnUt J. &WEmhoFF m. (ed.): Vom Umbruch zurErneuerung? Das 11. und beginnende12. Jahrhundert – Positionen der Forschung,mittelalter Studien 13, münchen 379-401.
BöhmE h.-W. & FrIEDrIch r.2008, Zum Stand der hochmittelalterlichen
Burgenforschung in West- undSüddeutschland. In: château Gaillard 23,45-60.
BooS a. et al.
1995, regensburg zwischen antike undmittelalter. In: anGErEr m. &WanDErWItZ h. (ed.): regensburg immittelalter. regensburg, 31-44.
Brachmann h.1988, Zur herkunft und Verbreitung von
trocken- und mörtelmauerwerk imfrühmittelalterlichen Befestigungsbaumitteleuropas. In: Studia nad etnogenezaSlowian i kultura Europy wczesnosredni-bowiecznej 1, 199-215.
1993, Der frühmittelalterliche Befesti-gungsbau in mitteleuropa. Untersuchungenzu seiner Entwicklung und Funktion imgermanisch-deutschen Bereich. Schriftenzur Ur- u. Frühgesch. 45, Berlin.
EmmErIch W.1957, landesburgen in ottonischer Zeit. In:
archiv Gesch. u. altertumskundeoberfranken 37, 50-97.
EnDrES r.1976, Zur Burgenverfassung in Franken. In:
PatZE h. (ed.): Die Burgen im deutschenSprachraum II, Sigmaringen 293-330.
EttEl P.1998, Die Burgen zu castell und ihre
Bewertung im rahmen des früh -mittelalterlichen Burgenbaus in Franken.In: WEnDEhorSt a. (ed.): Das landzwischen main und Steigerwald immittelalter. Erlanger Forschungen reihea 79, 1998, 99-147.
1999, Frühmittelalter. In: lEIDorF K. &EttEl P.: Burgen in Bayern. 7000 JahreBurgengeschichte im luftbild, Stuttgart,51-65.
2001, Karlburg – roßtal – oberammerthal.Studien zum frühmittelalterlichenBurgenbau in nordbayern. Frühge sch. u.provinzialrömische archäologie.materialien und Forschungen 5,rahden/Westf.
2006, Frühmittelalterlicher Burgenbau innordbayern und die Entwicklung deradelsburg. In: neue Forschungen zumfrühen Burgenbau. Forschungen zuBurgen u. Schlössern 9, münchen 33-48.
2007, Karlburg on main (Bavaria) and itsfunctions as a local centre from latemerovingian through ottonian times. In:hEnnInG J. (ed): Post-roman towns.trade and Settlement in Europe andByzantium. millenium Studies 5/1,Berlin/new york 319-340.
2008, Frühmittelalterlicher Burgenbau inDeutschland. Zum Stand der Forschung.In: château Gaillard 23, 161-188.
2011, Der frühmittelalterliche ZentralortKarlburg am main mit Königshof,marienkloster und zwei Burgen inkarolingisch-ottonischer Zeit. In:macháčEK J. & UnGErmann Š. (ed.):Frühgeschichtliche Zentralorte in mittel-europa. Studien zur arch. Europas 14,Bonn 459-478.
EttEl P. & WErthEr l.2010, Ungarnburgen und herrschaftszentren
des 10. Jahrhunderts in Bayern. In:Burgen und Schlösser 3, 144-161.
FEhrInG G. P.1972, Frühmittelalterliche Wehranlagen in
Südwestdeutschland. In: château Gaillard 5,37-54.
GEnSEn r.1975a, Frühmittelalterliche Burgen und
Siedlungen in nordhessen. In: ausgra-bungen in Deutschland. monogr.rGZm 1,2, mainz 313-337.
1975b, christenberg, Burgwald und amöne-burger Becken in der merowinger- undKarolingerzeit. In: SchlESInGEr W. (ed):althes sen im Frankenreich. nationes 2,Sigmaringen 121-172.
1975c, Eine archäologische Studie zurfrühmittelalterlichen Besiedlung des
marburger landes. In: Fundberichtehessen 15, 361-386.
hEnSch m.2005, Burg Sulzbach in der oberpfalz:
archäologisch-historische Forschungenzur Entwicklung eines herrschafts-zentrums des 8. bis 14. Jahrhunderts innordbayern, Büchenbach.
2010, Urbs Sulcpah – archäologischeGrabungen im Zuge der neustadt-Sanierung. Zur genese des früh- undhochmittelalterlichen BurgzentrumsSulzbach. In: Das neustadt-Viertel.Festschrift zur Sanierung der Sulzbacher”neustadt” 2010, amberg 13-38.
hInZ h.1972, Bur genlandschaften und Siedlungs-
kunde. In: château Gaillard 5, 65-84.1981, motte und Donjon. Zur Frühgeschichte
der mittelalterlichen adelsburg. Zeitschriftfür archäologie des mittelalters Beiheft1, Köln.
hoEPEr m.1995, Der Geißkopf bei Berghaupten,
ortenaukreis - völkerwanderungszeitlichehöhensiedlung, militärlager oder Kult -platz? In: archäologische ausgrabungenBaden-Württemberg, 263-267.
JanSSEn W.1983, Die Bedeutung der mittelalterlichen
Burg für die Wirtschafts- und Sozialge-schichte. In: JanKUhn h. (ed.): Dashandwerk in vor- und frühgeschichtlicherZeit, teil II, 1977-1980, Göttingen 261-316.
Koch U.1991, Die frühgeschichtlichen Perioden auf
dem runden Berg. In: BErnharD et al.
(ed): Der runde Berg bei Urach. Führerzu archäologischen Denkmälern inBaden-Württemberg 14, Stuttgart, 83-127.
KUrZ S.2009, Die Baubefunde vom runden Berg bei
Urach. materialhefte archäologie Baden-Württemberg 89, Stuttgart.
lInK th. & oBSt r.2008, Geophysikalische Prospektion im
castellum Karloburg. In: archäologischesJahr in Bayern 2008, 115-117.
Die Entwicklung des frühmittelalterlichen Burgenbaus in Süddeutschland bis zur Errichtung 155
LITERATUR
© Pub
licati
ons d
u CRAHM
mayr G. & StörmEr W.1996, Kleinlangheim und seine Umgebung
im Frühmittelalter - Eine personen- undbesitzge schichtliche Untersu chung. In:PESchEcK ch.: Das fränkische reihen-gräberfeld von Klein langheim, lkr.Kitzingen/nordbayern. Ger manischeDenkmäler Völkerwanderungszeit a 17,mainz, 159-171.
mEyEr W.1977, rodung, Burg und herrschaft. In:
Burgen aus holz und Stein. Burgenkund-liches Kolloquium Basel 1977. SchweizerBeiträge Kulturgesch. u. archäologiemittelalter 5, olten/Freiburg i. Br., 43-80.
mEyEr W.1985, Frühe adelsburgen zwischen alpen
und rhein. In: FlEcKEnStEIn J. (ed): Dasritterli che turnier im mit telalter,Göttingen 571-587.
mIlDEnBErGEr G.1978, Germanische Burgen. Veröffentli-
chungen altertumskommissionWestfälische landes- u. Volksforsch. 6,münster.
nEUBaUEr D.2007, Die Wettenburg in der mainschleife
bei Urphar, main-tauber-Kreis.Frühgesch. u. Provinzialröm. arch. 8,rahden/Westf.
nEUFFEr E. m.1972, Der reihengräberfriedhof von
Donzdorf, Kr. Göppingen, Stuttgart.
röDEl D.2001, analyse der historischen Quellen. In:
EttEl 2001, 279-300.
roSEnStocK D.2001, Siedlungsgeschichte im Frühmittel-
alter. In: WaGnEr U. (ed): Geschichte derStadt Würzburg Bd. 1. Von den anfängenbis zum ausbruch des Bauernkrieges,Stuttgart, 51-61.
SaGE W.1980, ausgrabungen in der ehemaligen
Grafenburg zu Ebersberg, oberbayern imJahre 1978. Jahresbericht BayerischeBodendenkmalpflege 21, 1980, 214-228.
1986, Frühgeschichte und Frühmittelalter. In:aBElS B.-U. et al. (ed): oberfran ken invor- und frühge schichtlicher Zeit,Bamberg 145-252.
SchUlZE-Dörrlamm m.2006, Spuren der Ungarneinfälle des
10. Jahrhunderts. In: DaIm F. (ed):heldengrab im niemandsland. Einfrühungarischer reiter aus niederöster-reich. mosaiksteine. Forschungen desrömisch Germanischen Zentralmuseummainz 2, mainz, 43-62.
SchWarZ K.1972, Die Birg bei Schäftlarn. In: Führer zu
vor- u. frühgeschichtlichen Denkmälern18, mainz, 222-238.
1975, Der frühmittelalterliche landesausbauin nordost-Bayern archäologisch gesehen.In: ausgrabungen in Deutschland.monogr. römisch-Germanisches Zentral-museum mainz 1/2, mainz, 338-409.
SonnEmann t.2010, Die Büraburg und das Fritzlar-
Waberner Becken im frühen mittelalter,mittelalterarchäologie in hessen 1, Bonn.
StEUEr h.1990, höhensiedlungen des 4. und 5. Jh. in
Südwestdeutschland. Einordnung desZähringer Burgberges, Gem. Gundel-fingen, Kr.Breisgau-hochschwarzwald.archäologie und Geschichte des erstenJahrtausends in Südwestdeutschland.Freiburger Forsch. 1, Sigmaringen, 139-206.
1997, herrschaft von der höhe. In: archäo-loGISchES lanDESmUSEUm BaDEn-WÜrttEmBErG (ed): Die alamannen,Stuttgart 149-162.
2005, Die alamannia und die alamannischeBesiedlung des rechtsrheinischen hinter-landes. In: BaDISchES lanDESmUSEUm
KarlSrUhE (ed): Imperium romanum.römer, christen, alamannen – DieSpätantike am oberrhein, Stuttgart 26-41.
StörmEr W.1991, ostfränkische herrschaftskrise und
heraus forderung durch die Ungarn. In:KatZInGEr W. & marcKGott G. (ed):Baiern, Ungarn und Slawen im Donau -raum. Forsch. Gesch. Städte u. märkteösterreichs 4, linz/Donau. 55-77.
V. USlar r.1964, Studien zu frühgeschichtlichen Befes-
tigungen zwischen nordsee und alpen,Köln.
WamSEr l.1984, merowingerzeitliche Bergstationen in
mainfranken - Stützpunkte der macht-ausübung gentiler Gruppen. In:archäologisches Jahr Bayern 1984, 136-140.
1992, Die Würzburger Siedlungslandschaftim frühen mittelalter. Spiegelbild dernaturgegebenen engen Verknüpfung vonStadt- und Bistumsgeschichte. In:lEnSSEn J. et al. (ed): 1250 Jahre BistumWürzburg, Würzburg 39-47.
WanD n.1974, Die Büraburg bei Fritzlar. Burg -
„oppidum“ - Bischofssitz in karolingi-scher Zeit, marburg.
WErnEr J.1965, Zu den alamannischen Burgen des 4.
und 5. Jahrhunderts. In: BaUEr c. et al.
(ed): Speculum historiale: Geschichte imSpiegel von Geschichtsschreibung u.Geschichtsdeutung. Fest schrift J. Spörl,münchen, 439-453.
WEIDEmann K.1975a, archäologische Zeugnisse zur
Eingliederung hessens und mainfrankensin das Franken reich vom 7. bis9. Jahrhundert. In: SchlESInGEr W. (ed):althes sen im Frankenreich. nationes 2,Sigmaringen 95-120.
1975b, Germanische Burgen rechts desrheins im 5. Jahrhundert. In: ausgra-bungen in Deutschland. teil 3:Frühmittelalter II, archäologie und natur-wissenschaften, Katalog, Karten undmodelle. monographien rGZm 1,3,mainz 362-363.
ZEUnE J.1993, Die Babenburg des 9./10. Jahrhunderts.
In: hEnnIG l. (ed): Geschichte ausGruben und Scherben. archäologischeausgrabungen auf dem Domberg inBamberg. Schriften des historischenmuseums Bamberg 26, Bamberg 43-58.
PETER ETTEL156
© Pub
licati
ons d
u CRAHM
Die Entwicklung des frühmittelalterlichen Burgenbaus in Süddeutschland bis zur Errichtung 157
L’évolution des châteaux en Allemagne du Sud au haut Moyen Âge, jusqu’à la construction de châteaux contre les Hongrois et comme centres seigneuriaux au Xe siècle
Vers 500, après la victoire des Francs sur les alamans, les fortifications des IVe et Ve siècles sont généralement abandonnées.au VIe siècle, rien n’indique qu’on en ait bâti d’autres. Une nouvelle phase de fortification ne devient perceptible qu’à l’époquemérovingienne tardive, surtout dans la seconde moitié du VIIe siècle et, dans des proportions nettement supérieures, au début del’époque carolingienne. Enfin, autour de 800 et dans la première moitié du Ixe siècle, on connaît un grand nombre de châteaux,y compris plus loin vers l’est qu’auparavant. au xe siècle, période de grands bouleversements politiques, la construction dechâteaux atteint son apogée pour le haut moyen Âge, mais aussi une césure. D’une part, le danger hongrois, qui ne menace passeulement l’allemagne du Sud, mais toute l’Europe centrale, conduit à l’érection de fortifications spécifiques. D’autre partapparaissent les premiers châteaux forts de la noblesse, qui ont leurs caractéristiques propres ; car de plus en plus, ce sont deschâteaux qui forment les centres de pouvoir de dignitaires locaux en expansion et de principautés en voie de formation.
The evolution of castles in southern Germany in the early Middle Ages, up until the building of castles against the Hungarians and as seignorial centres in the tenth century
In circa 500, following the Franks’ victory over the alemanni, the fourth and fifth century fortifications were generallyabandoned. In the sixth century, there is nothing to indicate that others were built. there was no observable new fortification phaseuntil the late merovingian period, notably during the second half of the seventh century and, in considerably larger proportions,at the start of the carolingian period. lastly, in around 800 and the first half of the ninth century, we know of a great many castles,including further east than before. In the tenth century, a period of great political upheaval, castle building reached its high pointfor the late middle ages, but also saw a break. on the one hand, the danger from hungary threatening not just southern Germanybut the whole of central Europe, led to the building of special fortifications. on the other, the first forts of the nobility appeared,with their own characteristics; for castles came increasingly to form the expanding power bases of local dignitaries and newlyforming principalities.
Die Entwicklung des frühmittelalterlichen Burgenbaus in Süddeutschland bis zur Errichtung von Ungarnburgen und Herrschaftszentren im 10. Jahrhundert
Die Befestigungen des 4. und 5. Jhs. wurden um 500 nach der niederlage der alemannen gegen die Franken weitgehendaufgegeben. Im 6. Jh. gibt es in Süddeutschland keine anzeichen für einen Burgenbau. Eine neue Befestigungsphase wird erstwieder in spätmerowingischer Zeit, vor allem in der 2. hälfte des 7. Jhs. und in deutlich größerem Umfang dann in frühkarolin-gischer Zeit fassbar. am Übergang zum 9. Jh. und in dessen 1. hälfte ist schließlich eine große Zahl von Burgen namhaft zu machenund zudem eine räumliche ausweitung des Burgenbaus nach osten festzustellen. Im 10. Jh., einer Zeit dramatischer, politischerVeränderungen, erreicht die Entwicklung des frühmittelalterlichen Burgenbaus einerseits einen höhepunkt, andererseits einegewisse Zäsur. Zum einen werden in Folge der Ungarngefahr, die nicht nur Süddeutschland sondern ganz mitteleuropa bedrohte,sogenannte Ungarnburgen errichtet. Zum anderen kommt es zur Entstehung und zum Bau früher adelsburgen mit entsprechenderausstattung; denn Burgen bildeten zunehmend den machtpolitischen mittelpunkt und das rückgrat erstarkender, lokaler amtsträgerund früher landesherrschaftlicher Strukturen.
RÉSUMÉ, ABSTRACT, ZUSAMMENFASSUNG
© Pub
licati
ons d
u CRAHM