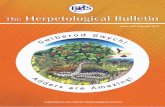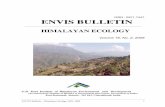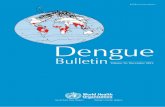Amtliches Bulletin der Bundesversammlung ... - bj.admin.ch
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of Amtliches Bulletin der Bundesversammlung ... - bj.admin.ch
S t ä n d e r a t
C o n s e i l d e s E t a t s
C o n s i g l i o d e g l i S t a t i
C u s s e g l d a l s s t a d i s
Separatdruck
Tiré à par t
Ristampa a parte
Amt l i ches Bu l le t in der Bundesversammlun g
Bul le t in o f f i c i e lde l ’Assemblée fédéra l e
Bo l le t t in o u f f i c i a l ed e l l ’ A s s e m b l e a f e d e r a l e
1998
R e f o r m d e r B u n d e s v e r f a s s u n g
R é f o r m e d e l a C o n s t i t u t i o n f é d é r a l e
R i f o r m a d e l l a C o s t i t u z i o n e f e d e r a l e
1
230
Ü b e r b l i c k
S o m m a i r e
Artikelverzeichnis I–VI
Rednerliste VII–VIII
Verhandlungen des Ständerates 1–229
Impressum 230
Abkürzungen 3. Umschlagseite
Liste des articles I–VI
Liste des orateurs VII–VIII
Délibérations du Conseil des Etats 1–229
Impressum 230
Abréviations 3e de couverture
A b k ü r z u n g e n
A b r é v i a t i o n s
FraktionenC Christlichdemokratische FraktionL Liberale FraktionR Freisinnig-demokratische FraktionS Sozialdemokratische FraktionV Fraktion der Schweizerischen Volkspartei
Ständige KommissionenAPK Aussenpolitische KommissionFK FinanzkommissionGPK GeschäftsprüfungskommissionKöB Kommission für öffentliche BautenKVF Kommission für Verkehr
und FernmeldewesenRK Kommission für RechtsfragenSGK Kommission für soziale Sicherheit
und GesundheitSiK Sicherheitspolitische KommissionSPK Staatspolitische KommissionUREK Kommission für Umwelt,
Raumplanung und EnergieWAK Kommission für Wirtschaft
und AbgabenWBK Kommission für Wissenschaft,
Bildung und Kultur
-NR des Nationalrates-SR des Ständerates
* Berichterstatterin/Berichterstatter
PublikationenAB Amtliches BulletinAS Amtliche Sammlung des BundesrechtsBBI BundesblattSR Systematische Sammlung des Bundesrechts
GroupesC Groupe démocrate-chrétienL Groupe libéralR Groupe radical-démocratiqueS Groupe socialisteV Groupe de l’Union démocratique du centre
Commissions permanentesCAJ Commission des affaires juridiquesCCP Commission des constructions publiquesCdF Commission des financesCdG Commission de gestionCEATE Commission de l’environnement,
de l’aménagement du territoireet de l’énergie
CER Commission de l’économie et des redevancesCIP Commission des institutions politiquesCPE Commission de politique extérieureCPS Commission de la politique de sécuritéCSEC Commission de la science,
de l’éducation et de la cultureCSSS Commission de la sécurité sociale
et de la santé publiqueCTT Commission des transports
et des télécommunications
-CN du Conseil national-CE du Conseil des Etats
* Rapporteur
PublicationsBO Bulletin officielFF Feuille fédéraleRO Recueil officiel du droit fédéralRS Recueil systématique du droit fédéral
Artikelverzeichnis Liste des articles
Reform der Bundesverfassung 1998 III S Artikelverzeichnis
Präambel/Préambule23, 148, 203, 225
Art. 1 (Entwurf SR/Projet CE: Art. 1)24, 149
Art. 2 (Entwurf SR/Projet CE: Art. 2)24, 149, 203, 225
Art. 3 (Entwurf SR/Projet CE: Art. 3)25, 152
Art. 4 (Entwurf SR/Projet CE: Art. 3a, 5)25, 29
Art. 5 (Entwurf SR/Projet CE: Art. 4)28, 155, 204
Art. 6 (Entwurf NR/Projet CN: Art. 3b)25, 152
Art. 7 (Entwurf SR/Projet CE: Art. 6)32
Art. 8 (Entwurf SR/Projet CE: Art. 7)33, 155, 205, 225
Art. 9 (Entwurf SR/Projet CE: Art. 8)40
Art. 10 (Entwurf SR/Projet CE: Art. 9)40, 156, 206
Art. 11 (Entwurf NR/Projet CN: Art. 11a)156, 206
Art. 12 (Entwurf SR/Projet CE: Art. 10)40
Art. 13 (Entwurf SR/Projet CE: Art. 11)41
Art. 14 (Entwurf SR/Projet CE: Art. 12)41, 157, 209, 225
Art. 15 (Entwurf SR/Projet CE: Art. 13)41
Art. 16 (Entwurf SR/Projet CE: Art. 14)42
Art. 17 (Entwurf SR/Projet CE: Art. 14a)43, 157
Art. 18 (Entwurf SR/Projet CE: Art. 15)43
Art. 19 (Entwurf SR/Projet CE: Art. 57a)72, 170
Art. 20 (Entwurf SR/Projet CE: Art. 17)43
Art. 21 (Entwurf SR/Projet CE: Art. 16)43, 157
Art. 22 (Entwurf SR/Projet CE: Art. 18)43, 158, 209
Art. 23 (Entwurf SR/Projet CE: Art. 19)43
Art. 24 (Entwurf SR/Projet CE: Art. 20)43
Art. 25 (Entwurf SR/Projet CE: Art. 21)44
Art. 26 (Entwurf SR/Projet CE: Art. 22)44, 158
Art. 27 (Entwurf SR/Projet CE: Art. 23)45
Art. 28 (Entwurf SR/Projet CE: Art. 24)45, 158, 209
Art. 29 (Entwurf SR/Projet CE: Art. 25)50
Art. 30 (Entwurf SR/Projet CE: Art. 26)50
Art. 31 (Entwurf SR/Projet CE: Art. 27)50, 164
Art. 32 (Entwurf SR/Projet CE: Art. 28)50
Art. 33 (Entwurf SR/Projet CE: Art. 29)51
Art. 34 (Entwurf SR/Projet CE: Art. 30)52
Art. 35 (Entwurf SR/Projet CE: Art. 31)52
Art. 36 (Entwurf SR/Projet CE: Art. 32)53
Art. 37 (Entwurf SR/Projet CE: Art. 32a, 45)55, 66, 164, 168, 210, 225
Art. 38 (Entwurf SR/Projet CE: Art. 32b, 46)55, 66, 165, 168
Art. 39 (Entwurf SR/Projet CE: Art. 32c, 47)55, 66, 165, 168, 210
Art. 40 (Entwurf SR/Projet CE: Art. 32d, 48)55, 66, 165, 168, 210
Art. 41 (Entwurf SR/Projet CE: Art. 33)59, 165, 210, 222
Art. 42 (Entwurf SR/Projet CE: Art. 34a)62, 166, 211, 225
Art. 43 (Entwurf SR/Projet CE: Art. 35)62
Art. 44 (Entwurf SR/Projet CE: Art. 34, 35a)61, 62, 166
Art. 45 (Entwurf SR/Projet CE: Art. 36)62
Art. 46 (Entwurf SR/Projet CE: Art. 37)62, 167, 211
Art. 47 (Entwurf SR/Projet CE: Art. 38)62
Liste des articles E IV Réforme de la Constitution fédérale 1998
Art. 48 (Entwurf SR/Projet CE: Art. 39)62
Art. 49 (Entwurf SR/Projet CE: Art. 40)62
Art. 50 (Entwurf SR/Projet CE: Art. 41)62, 69, 167, 211
Art. 51 (Entwurf SR/Projet CE: Art. 42)66
Art. 52 (Entwurf SR/Projet CE: Art. 43)66, 168
Art. 53 (Entwurf SR/Projet CE: Art. 44)66, 168
Art. 54 (Entwurf SR/Projet CE: Art. 49)66, 169
Art. 55 (Entwurf SR/Projet CE: Art. 50)67, 169
Art. 56 (Entwurf SR/Projet CE: Art. 51)68, 169
Art. 57 (Entwurf SR/Projet CE: Art. 53)70
Art. 58 (Entwurf SR/Projet CE: Art. 54)70, 169
Art. 59 (Entwurf SR/Projet CE: Art. 55)72
Art. 60 (Entwurf SR/Projet CE: Art. 56)72
Art. 61 (Entwurf SR/Projet CE: Art. 57)72
Art. 62 (Entwurf SR/Projet CE: Art. 57a, 78)72, 82, 170, 179
Art. 63 (Entwurf SR/Projet CE: Art. 57a, 78)72, 82, 170, 179
Art. 64 (Entwurf SR/Projet CE: Art. 57b, 79)72, 82, 171, 179
Art. 65 (Entwurf SR/Projet CE: Art. 57c)72, 171
Art. 66 (Entwurf SR/Projet CE: Art. 57d, 80)73, 82, 171, 179
Art. 67 (Entwurf SR/Projet CE: Art. 57e, 81)73, 82, 171, 179
Art. 68 (Entwurf SR/Projet CE: Art. 57f, 82)73, 82, 171, 179
Art. 69 (Entwurf SR/Projet CE: Art. 57g, 83)74, 82, 171, 179
Art. 70 (Entwurf SR/Projet CE: Art. 57h, 83, 136)75, 82, 124, 173, 179, 215, 225
Art. 71 (Entwurf SR/Projet CE: Art. 57i, 77)75, 82, 174, 179
Art. 72 (Entwurf SR/Projet CE: Art. 84)84, 179
Art. 73 (Entwurf SR/Projet CE: Art. 57k)76, 175, 215
Art. 74 (Entwurf SR/Projet CE: Art. 57l, 59)77, 78, 175
Art. 75 (Entwurf SR/Projet CE: Art. 58)77
Art. 76 (Entwurf SR/Projet CE: Art. 60)78, 83, 176
Art. 77 (Entwurf SR/Projet CE: Art. 61)80
Art. 78 (Entwurf SR/Projet CE: Art. 62)80
Art. 79 (Entwurf SR/Projet CE: Art. 63)80, 176
Art. 80 (Entwurf SR/Projet CE: Art. 64)80
Art. 81 (Entwurf SR/Projet CE: Art. 65)80
Art. 82 (Entwurf SR/Projet CE: Art. 66)80
Art. 83 (Entwurf SR/Projet CE: Art. 67)80
Art. 84 (Entwurf SR/Projet CE: Art. 68)81
Art. 85 (Entwurf SR/Projet CE: Art. 69)81
Art. 86 (Entwurf SR/Projet CE: Art. 70)81
Art. 87 (Entwurf SR/Projet CE: Art. 71)81, 177, 215
Art. 88 (Entwurf SR/Projet CE: Art. 72)81, 177, 216
Art. 89 (Entwurf SR/Projet CE: Art. 73)82
Art. 90 (Entwurf SR/Projet CE: Art. 74)82
Art. 91 (Entwurf SR/Projet CE: Art. 74a)82
Art. 92 (Entwurf SR/Projet CE: Art. 75)82, 216
Art. 93 (Entwurf SR/Projet CE: Art. 76)82, 178, 183
Art. 94 (Entwurf SR/Projet CE: Art. 85)86, 181, 216, 224, 225
Art. 95 (Entwurf SR/Projet CE: Art. 86)89
Art. 96 (Entwurf SR/Projet CE: Art. 87)89
Art. 97 (Entwurf SR/Projet CE: Art. 88)90
Reform der Bundesverfassung 1998 V S Artikelverzeichnis
Art. 98 (Entwurf SR/Projet CE: Art. 88a, 90)90, 91, 181
Art. 99 (Entwurf SR/Projet CE: Art. 89)90
Art. 100 (Entwurf SR/Projet CE: Art. 91)91
Art. 101 (Entwurf SR/Projet CE: Art. 93)92, 182
Art. 102 (Entwurf SR/Projet CE: Art. 94)92
Art. 103 (Entwurf SR/Projet CE: Art. 92, 94a)91, 92, 182
Art. 104 (Entwurf SR/Projet CE: Art. 95)92, 182, 216
Art. 105 (Entwurf SR/Projet CE: Art. 96)92
Art. 106 (Entwurf SR/Projet CE: Art. 97)92, 183
Art. 107 (Entwurf SR/Projet CE: Art. 98)92
Art. 108 (Entwurf SR/Projet CE: Art. 99)93, 184
Art. 109 (Entwurf SR/Projet CE: Art. 100)93, 184, 216, 225
Art. 110 (Entwurf SR/Projet CE: Art. 101)93, 184, 216, 225
Art. 111 (Entwurf SR/Projet CE: Art. 102)94
Art. 112 (Entwurf SR/Projet CE: Art. 103)94
Art. 113 (Entwurf SR/Projet CE: Art. 104)94, 186
Art. 114 (Entwurf SR/Projet CE: Art. 105)94
Art. 115 (Entwurf SR/Projet CE: Art. 106)94, 186
Art. 116 (Entwurf SR/Projet CE: Art. 107)95
Art. 117 (Entwurf SR/Projet CE: Art. 108)95
Art. 118 (Entwurf SR/Projet CE: Art. 109)95, 186
Art. 119 (Entwurf SR/Projet CE: Art. 111)95
Art. 120 (Entwurf SR/Projet CE: Art. 110, 111a)95, 186
Art. 121 (Entwurf SR/Projet CE: Art. 112)95
Art. 122 (Entwurf SR/Projet CE: Art. 113)95
Art. 123 (Entwurf SR/Projet CE: Art. 114)96
Art. 124 (Entwurf SR/Projet CE: Art. 115)96
Art. 125 (Entwurf SR/Projet CE: Art. 116)96
Art. 126 (Entwurf SR/Projet CE: Art. 117)97, 187
Art. 127 (Entwurf SR/Projet CE: Art. 118)97, 187, 219
Art. 128 (Entwurf SR/Projet CE: Art. 119)97
Art. 129 (Entwurf SR/Projet CE: Art. 120)97
Art. 130 (Entwurf SR/Projet CE: Art. 121)97
Art. 131 (Entwurf SR/Projet CE: Art. 121a, 123)97, 98
Art. 132 (Entwurf SR/Projet CE: Art. 122)98
Art. 133 (Entwurf SR/Projet CE: Art. 124)98
Art. 134 (Entwurf SR/Projet CE: Art. 125)98
Art. 135 (Entwurf SR/Projet CE: Art. 126)98
Art. 136 (Entwurf SR/Projet CE: Art. 127)119, 189
Art. 137 (Entwurf NR/Projet CN: Art. 127a)119
Art. 138 (Entwurf SR/Projet CE: Art. 128)120
Art. 139 (Entwurf SR/Projet CE: Art. 129)120
Art. 140 (Entwurf SR/Projet CE: Art. 130)121, 131
Art. 141 (Entwurf SR/Projet CE: Art. 131)121, 131
Art. 142 (Entwurf SR/Projet CE: Art. 132)121
Art. 143 (Entwurf SR/Projet CE: Art. 133)121
Art. 144 (Entwurf SR/Projet CE: Art. 134)123
Art. 145 (Entwurf SR/Projet CE: Art. 135)123
Art. 146 (Entwurf SR/Projet CE: Art. 137)124
Art. 147 (Entwurf SR/Projet CE: Art. 138)124
Liste des articles E VI Réforme de la Constitution fédérale 1998
Art. 148 (Entwurf SR/Projet CE: Art. 139)124
Art. 149 (Entwurf SR/Projet CE: Art. 140)124
Art. 150 (Entwurf SR/Projet CE: Art. 141)124
Art. 151 (Entwurf SR/Projet CE: Art. 142)124
Art. 152 (Entwurf SR/Projet CE: Art. 143)124
Art. 153 (Entwurf SR/Projet CE: Art. 144)124, 189
Art. 154 (Entwurf SR/Projet CE: Art. 145)127
Art. 155 (Entwurf SR/Projet CE: Art. 146)127, 191
Art. 156 (Entwurf SR/Projet CE: Art. 147)127
Art. 157 (Entwurf SR/Projet CE: Art. 148)127
Art. 158 (Entwurf SR/Projet CE: Art. 149)127
Art. 159 (Entwurf SR/Projet CE: Art. 150)127, 131
Art. 160 (Entwurf SR/Projet CE: Art. 151)127
Art. 161 (Entwurf SR/Projet CE: Art. 152)127
Art. 162 (Entwurf SR/Projet CE: Art. 153)128
Art. 163 (Entwurf SR/Projet CE: Art. 153a)129, 191
Art. 164 (Entwurf SR/Projet CE: Art. 154)131, 191, 220, 225
Art. 165 (Entwurf SR/Projet CE: Art. 155)132
Art. 166 (Entwurf SR/Projet CE: Art. 156)132
Art. 167 (Entwurf SR/Projet CE: Art. 157)134
Art. 168 (Entwurf SR/Projet CE: Art. 158)134
Art. 169 (Entwurf SR/Projet CE: Art. 159)124, 191, 220, 225
Art. 170 (Entwurf SR/Projet CE: Art. 159a)134
Art. 171 (Entwurf SR/Projet CE: Art. 161)134, 194
Art. 172 (Entwurf SR/Projet CE: Art. 160)134
Art. 173 (Entwurf SR/Projet CE: Art. 161)134, 194
Art. 174 (Entwurf SR/Projet CE: Art. 162)136
Art. 175 (Entwurf SR/Projet CE: Art. 163)136
Art. 176 (Entwurf SR/Projet CE: Art. 164)143
Art. 177 (Entwurf SR/Projet CE: Art. 165)143
Art. 178 (Entwurf SR/Projet CE: Art. 166)144, 194
Art. 179 (Entwurf SR/Projet CE: Art. 167)144
Art. 180 (Entwurf SR/Projet CE: Art. 168)144
Art. 181 (Entwurf SR/Projet CE: Art. 169)144
Art. 182 (Entwurf SR/Projet CE: Art. 170)144
Art. 183 (Entwurf SR/Projet CE: Art. 171)144
Art. 184 (Entwurf SR/Projet CE: Art. 172)132, 144, 194
Art. 185 (Entwurf SR/Projet CE: Art. 173)144, 194
Art. 186 (Entwurf SR/Projet CE: Art. 174)145, 195
Art. 187 (Entwurf SR/Projet CE: Art. 175)145
Art. 188 (Entwurf SR/Projet CE: Art. 176)145
Art. 189 (Entwurf SR/Projet CE: Art. 177)146
Art. 190 (Entwurf SR/Projet CE: Art. 178)146
Art. 191 (Entwurf SR/Projet CE: Art. 180)146
Art. 192 (Entwurf SR/Projet CE: Art. 181)121
Art. 193 (Entwurf SR/Projet CE: Art. 182)121
Art. 194 (Entwurf SR/Projet CE: Art. 183)121
Art. 195 (Entwurf SR/Projet CE: Art. 184)121
Art. 196 (Entwurf SR/Projet CE: Art. 185)101, 187
Rednerliste Liste des orateurs
Reform der Bundesverfassung 1998 VII S Rednerliste
Aeby Pierre (S, FR)*14, 25, 27, 31, 39, 40, 44, 55, 56, 59, 61, 62, 64, 66, 67, 68,
69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 116, 141, 143, 150, 151, 152, 153, 154, 162, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 174, 175, 176, 177, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 198, 205, 208, 212, 213, 215, 216, 217, 218, 219
Beerli Christine (R, BE)31, 33, 37, 130
Bieri Peter (C, ZG)85, 125, 126, 190, 221
Bisig Hans (R, SZ)28
Bloetzer Peter (C, VS)12, 65, 100, 109, 192
Brändli Christoffel (V, GR)34, 38, 39, 156
Brunner Christiane (S, GE)29, 31, 37, 47, 60, 145, 159, 163, 206
Büttiker Rolf (R, SO)11, 44, 51, 73, 128, 137, 138, 143, 185, 210, 218
Cavadini Jean (L, NE)7, 30, 31, 49, 75, 109, 154, 207, 208, 229
Cotti Flavio, président de la Confédération1
Cottier Anton (C, FR)*45, 47, 180
Danioth Hans (C, UR)15, 47, 56, 57, 65, 140, 143, 171, 208, 217
Forster Erika (R, SG)8, 46, 132, 135, 161, 192, 217
Frick Bruno (C, SZ)*10, 23, 24, 27, 47, 108, 112, 119, 120, 121, 122, 123, 124,
126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 143, 144, 145, 146, 148, 149, 150, 151, 152, 189, 191, 192, 194, 195, 198, 200, 203, 220, 221, 222, 223, 225
Gemperli Paul (C, SG)87, 112
Gentil Pierre-Alain (S, JU)12, 42, 46, 51, 149, 204, 206, 223
Inderkum Hansheiri (C, UR)*28, 32, 33, 39, 40, 41, 42, 43, 84, 133, 152, 153, 154, 155,
156, 157, 158, 160, 180, 198, 204, 205, 206, 209
Iten Andreas (R, ZG)16, 109
Koller Arnold, Bundesrat18, 23, 24, 25, 28, 29, 84, 86, 89, 91, 93, 94, 95, 98, 101, 104,
106, 114, 117, 118, 120, 123, 124, 126, 127, 131, 132, 133, 136, 141, 144, 145, 146, 149, 150, 151, 154, 155, 156, 157, 158, 161, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 181, 182, 183, 185, 186, 190, 193, 195, 196, 197, 201, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 213, 214, 218, 220, 221, 222, 223, 226
Leuenberger Moritz, Bundesrat31, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 50, 52, 54, 55, 57, 60, 62, 68, 69,
71, 73, 75, 76, 77, 81
Leumann Helen (R, LU)34, 93, 184, 207, 208, 217
Loretan Willy (R, AG)64, 100, 167, 212
Maissen Theo (C, GR)35, 77, 79, 87, 89, 99
Marty Dick (R, TI)*43, 44, 45, 50, 51, 52, 53, 154, 158, 160, 164, 196
Merz Hans-Rudolf (R, AR)148
Onken Thomas (S, TG)26, 35, 177
Paupe Pierre (C, JU)87, 174
Plattner Gian-Reto (S, BS)24, 69, 142, 179, 183, 185, 187
Liste des orateurs E VIII Réforme de la Constitution fédérale 1998
Reimann Maximilian (V, AG)9, 47, 71, 142, 160, 208
Respini Renzo (C, TI)13
Rhinow René (R, BL), Präsident*3, 17, 22, 23, 26, 28, 29, 32, 36, 49, 52, 54, 57, 60, 61, 64,
66, 68, 70, 71, 73, 77, 79, 80, 81, 88, 95, 100, 102, 113, 119, 121, 126, 130, 133, 143, 147, 148, 154, 159, 162, 173, 176, 178, 179, 182, 187, 193, 199, 201, 203, 207, 208, 209, 210, 211, 214, 228
Rhyner Kaspar (R, GL)78, 79, 83, 84
Rochat Eric (L, VD)23, 36, 59, 63, 64, 75, 76
Schallberger Peter-Josef (C, NW)217
Schiesser Fritz (R, GL)111, 112, 142, 200
Schmid Carlo (C, AI)14, 27, 31, 36, 39, 44, 51, 53, 54, 68, 110, 119, 150, 175, 176,
199, 212
Seiler Bernhard (V, SH)25, 28, 56
Simmen Rosemarie (C, SO)35, 69, 74, 76, 179
Spoerry Vreni (R, ZH)13, 34, 38, 70, 71, 90, 98, 100, 138
Uhlmann Hans (V, TG)63, 65, 66, 69, 168
Weber Monika (U, ZH)15, 70
Wicki Franz (C, LU)*8, 27, 35, 56, 85, 96, 99, 100, 103, 105, 106, 107, 114, 116,
117, 118, 170, 184, 185, 186, 196, 197, 200, 202, 208
Zimmerli Ulrich (V, BE), Präsident194
Amtliches Bulletin der BundesversammlungBulletin officiel de l’Assemblée fédérale
Vereinigte BundesversammlungAssemblée fédérale (Chambres réunies)
Vierzehnte Sitzung – Quatorzième séance
Montag, 19. Januar 1998Lundi 19 janvier 1998
14.30 h
Vorsitz – Présidence: Leuenberger Ernst (S, SO)
___________________________________________________________
Präsident: Ich erkläre die Sitzung der Vereinigten Bundes-versammlung für eröffnet. Wie Sie der Einladung entnehmenkönnen, hat diese kurze Sitzung der Vereinigten Bundesver-sammlung den Zweck, das Jubiläumsjahr 1998 einzuleiten.Sie hat auch den Zweck, uns auf die kommenden Debattenüber die Reform der Bundesverfassung vorzubereiten.Innerhalb dieser Sondersession findet sodann vor dem Hin-tergrund aktueller Ereignisse auch eine ausserordentlicheSondersession mit den Schwerpunkten Wirtschafts-, Be-schäftigungs- und Steuerfragen statt.Das Jubiläums- und Gedenkjahr ist Anfang Januar in derHauptstadt des Kantons Jura, unseres jüngsten Gliedstaa-tes, in Delémont, mit einer Ausstellung in Anwesenheit vonVertreterinnen und Vertretern beider Kammern und des Bun-desrates eröffnet worden. Sodann ist am vergangenenSamstag in Aarau das Gedenkjahr «200 Jahre moderneSchweiz» in Anwesenheit vieler Parlamentsmitglieder undaller Mitglieder des Bundesrates eröffnet worden.Auf Wunsch der Verfassungskommissionen haben die zu-ständigen Büros der beiden Räte beschlossen, dieses Ge-denkjahr hier in der Vereinigten Bundesversammlung durcheine Erklärung des Bundesrates einzuleiten, vorgetragendurch Herrn Bundespräsident Cotti.
Jubiläum 1998und Reform der Bundesverfassung.Erklärung des BundespräsidentenJubilé 1998et réforme de la Constitution fédérale.Déclaration du président de la Confédération
___________________________________________________________
Cotti Flavio, président de la Confédération: Les cérémoniesdignes, unitaires et émouvantes de Delémont et d’Aarau ontinauguré, il y a quelques jours, cette année qui commémoredes faits que je définirais simplement comme fondamentauxpour notre patrie. Et voilà aujourd’hui l’Assemblée fédéraleréunie pour symboliser la valeur des événements historiquesque nous célébrons, et pour marquer le début d’une semaineparlementaire que je définirais comme très importante. Pourcette session spéciale, je vous souhaite beaucoup de succèset beaucoup de substance.Cette année, notre première constitution fête son 150e anni-versaire. A juste titre, nous sommes fiers de la loi fondamen-tale que la Constituante a élaborée en peu de temps et quiest finalement entrée en vigueur en novembre 1848, soitmoins d’un an après le début des travaux préliminaires.Comment expliquer le succès extraordinaire de cette consti-tution qui non seulement, comme nous l’avons dit à Aarau, apeu à peu réconcilié un peuple profondément divisé, mais quia en même temps créé des principes fondamentaux restantaujourd’hui encore une composante essentielle de notreidentité nationale?Je crois que la Constitution de 1848 témoignait de deux cho-ses: d’une part, d’un esprit novateur et visionnaire; d’autrepart, d’une volonté de laisser une large place à l’évolution ul-térieure, historique, de notre communauté nationale. Noussongeons bien sûr en premier lieu à la création de l’Etat fé-déral suisse qui, malgré son caractère indubitablement révo-lutionnaire, a réussi le tour de force de ménager aux cantonsun statut conforme à leur tradition et à leur prestige.Renforcés sur le plan extérieur par la suppression des doua-nes internes et par le transfert de certains droits de souverai-neté à une instance plus élevée, nous avons alors établi àl’intérieur, grâce au fédéralisme, une structure permettant,dans un pays parlant quatre langues, non seulement unecoexistence harmonieuse, mais encore l’émergence d’uneculture politique certainement spécifique et tout à fait origi-nale. Marqués par l’expérience douloureuse du profond dé-chirement qu’ils venaient de vivre, nos ancêtres croyaient enune nation qui ne se bornerait pas à respecter les différencesentre les régions de notre pays, mais ils cherchaient aussi à
1998 14. Sitzung der 45. Amtsdauer14e séance de la 45e législature
Assemblée fédérale (Chambres réunies) 2 19 janvier 1998
Bulletin officiel de l’Assemblée fédérale / Tiré à part
en faire une composante fondamentale de notre identité na-tionale.Certes, il reste encore bien du chemin à parcourir pour attein-dre l’idéal, c’est-à-dire une véritable nation pluriculturelle etmultilingue. Mais en tant que représentant d’une petite mino-rité, je puis affirmer que ce que nous avons réalisé en Suisseà cet égard est très important. Je répète: notre structure fé-déraliste et une solidarité nationale au-delà des barrières cul-turelles et linguistiques – songez notamment à l’exemple dela SSR et à sa péréquation financière généreuse, sans la-quelle on pourrait à peine imaginer une radio et une télévisionde qualité dans nos régions minoritaires –, voilà deux exem-ples parmi beaucoup d’acquis qui prouvent que la diversitéconstitue une force, et non une faiblesse, pour notre pays.Nella Costituzione del 1848 ritroviamo pure le basi stessedella forma attuale della nostra democrazia diretta. L’idea –rivoluzionaria – del referendum obbligatorio in materia costi-tuzionale si è rivelata la pietra miliare di una sempre più raffi-nata ed elaborata forma di democrazia che consente al po-polo svizzero – per le donne purtroppo soltanto dal 1971 – dipartecipare attivamente alle decisioni dello stato.La vitalità della democrazia svizzera va però ricondotta nonsolo al fatto che il popolo ha da noi l’ultima parola, ma ancheal fatto che questo stesso popolo ha sempre la possibilità disollevare di propria iniziativa e di far porre in votazione que-stioni che altrimenti non troverebbero posto nell’agenda poli-tica del paese.Nel processo di avvicinamento all’Unione europea, al di là deinegoziati bilaterali, sarà quindi di fondamentale importanzadeterminare come si potranno salvaguardare anche in futurol’essenza e la sostanza della democrazia diretta. L’idea cen-trale della democrazia diretta che affonda le radici nella no-stra storia ben prima del 1848, costituisce infatti indubbia-mente un punto chiave del nostro modo di intendere il rap-porto fra individuo e stato.E occorre infine ricordare che i padri della nostra costituzionenon introdussero in Svizzera soltanto il principio della sepa-razione dei poteri, così come oggi lo conosciamo, ma sanci-rono anche il bicameralismo: l’assoluta parità tra la Cameradel popolo e la Camera dei cantoni che rappresenta un ulte-riore pilastro della nostra cultura politica.Oltre ai contenuti della nostra costituzione, quest’anno cele-briamo pertanto anche l’avvedutezza, l’anticipazione ed il co-raggio di coloro che la concepirono. Animati da una risolu-tezza lungimirante, essi cercarono e trovarono soluzioni nonconvenzionali, dando corpo a valori che ancora oggi sono es-senziali per noi. Proprio come allora, anche oggi siamo chia-mati a ricercare approcci equilibrati ma anche coraggiosi perforgiare il nostro futuro.Dobbiamo chiederci che cosa vogliamo e che cosa possiamomantenere di ciò che è stato raggiunto. Dobbiamo chiederci,per non citare che un paio di esempi, cosa possiamo fare permantenere e consolidare la coesione fra le diverse parti delpaese e fra i diversi ceti sociali della nostra società. Dob-biamo chiederci quali rapporti desideriamo intrattenere conun mondo che è sempre più villaggio globale, e non da ultimoquale importanza intendiamo attribuire in questo contestoglobalizzato a concetti quali economia, finanze – certamente–, ma soprattutto anche politica sociale, protezione della na-tura e dell’ambiente.In diesem Sinne bildet das Jubiläumsjahr 1998 einen ausge-zeichneten Rahmen für die nun anstehende Reform der Bun-desverfassung. Nachdem seit 1874 keinem Anlauf zur Total-revision unserer Bundesverfassung Erfolg beschieden war,scheint der Weg einer schrittweisen Reform, beginnend miteiner umsichtigen und die einzelnen Inhalte genau bewerten-den Nachführung, besonders sinnvoll und geeignet. Ichmöchte deshalb die Gelegenheit wahrnehmen, um Bundes-rat Arnold Koller und den Verfassungskommissionen desParlamentes den Dank für ihre umfangreichen und kompe-tenten Vorarbeiten auszusprechen. Es handelt sich beim vor-liegenden Reformprojekt um das erste dieser Art seit mehrals hundert Jahren, das im Parlament diskutiert wird. Des-halb ist es in meinen Augen für das ganze Land von eminen-ter Bedeutung, dass dieses breit angelegte und bedeutende
Unterfangen im nun angelaufenen und symbolträchtigen Ju-biläumsjahr den ersten parlamentarischen und gesellschaft-lichen Durchbruch erfährt.Gleichzeitig wissen wir, dass Verfassung und Gesetz alleinebei weitem nicht ausreichen, um die Zukunft zu gestalten.In einer Welt, in der zu Recht beklagt wird, dass immer mehran die Zinsen und Zinseszinsen und immer weniger an dieKinder und Kindeskinder gedacht wird, gehören zur verant-wortungsbewussten Mitgestaltung die Bereitschaft und dieVerpflichtung, sich am Geschehen dieses Landes zu beteili-gen, mitzuwirken und einzugreifen, wo es notwendig er-scheint. Wenn die rechtliche Norm nicht täglich von mensch-lichem Einsatz, von menschlicher Verantwortung undmenschlicher Zielgerichtetheit begleitet und ergänzt wird,dann verkommt sie letztlich zu einem wertlosen Papiertigerund zur Bedeutungslosigkeit, welche den Glauben an die Po-litik und allgemein an die Gesellschaft wesentlich gefährdenkann.Gottfried Keller verfasste in der Mitte des letzten Jahrhun-derts einen Aufsatz über die Verfassungskämpfe derSchweiz und schloss den – im übrigen recht kritischen – Ar-tikel «Über das ewige Politisieren über Ideen, von denen nie-mand gegessen hat» mit folgender Bemerkung ab: «Nicht inder Geläufigkeit, mit der man ein Gesetz entwirft und an-nimmt, sondern in der Ehrlichkeit, Ernsthaftigkeit und Ent-schlossenheit, mit welcher man es zu handhaben besonnenist, zeigt sich die wahre politische Bildung. Dass diese denSchweizern grösstenteils eigen ist, haben sie bewiesen.»Das sagte Gottfried Keller über die Schweizerinnen undSchweizer von damals.Diesen Tatbeweis zu erbringen ist nicht eine einmalige Auf-gabe. Sämtliche Generationen sind dazu verpflichtet. Heutestellt sich diese Herausforderung uns allen, Bundesrätin undBundesräten, Nationalrätinnen und Nationalräten, Ständerä-tinnen und Ständeräten, aber auch den Vertreterinnen undVertretern der Kantone und der Gemeindebehörden sowienatürlich auch dem Schweizervolk, dem die letzten Entschei-dungen und schliesslich auch die letzte Verantwortung fürdieses Land zukommen.Das angebrochene Jahr gibt uns wahrhaftig Gelegenheit, indiesem Sinne ehrlich und entschlossen zu wirken, damit nundie überdachten und immer wieder zu überdenkenden In-halte der Verfassung unseren Grundwerten, Absichten undStrategien entsprechen und den Absichten auch Taten fol-gen. Dies ist ganz einfach unsere gemeinsame Verpflich-tung, der wir nachgehen wollen. (Beifall)
Präsident: Ich danke dem Herrn Bundespräsidenten für dieErklärung des Bundesrates zum Jubiläums- und Gedenkjahr1998 und zur Reform der Bundesverfassung. Soweit Diskus-sion als nötig erachtet wird, wird sie in beiden Räten getrenntzu dem dafür bestimmten Zeitpunkt stattfinden.Ich stelle fest, dass die Vereinigte Bundesversammlung vonder Erklärung des Bundesrates Kenntnis genommen hat.
Schluss der Sitzung um 14.50 UhrLa séance est levée à 14 h 50
Amtliches Bulletin der BundesversammlungBulletin officiel de l’Assemblée fédérale
Ständerat – Conseil des Etats
Erste Sitzung – Première séance
Montag, 19. Januar 1998Lundi 19 janvier 1998
15.00 h
Vorsitz – Présidence: Zimmerli Ulrich (V, BE)
___________________________________________________________
96.091
Bundesverfassung.ReformConstitution fédérale.Réforme
Botschaft und Beschlussentwürfe des Bundesratesvom 20. November 1996 (BBl 1997 I 1)Message et projets d’arrêté du Conseil fédéraldu 20 novembre 1996 (FF 1997 I 1)
Zusatzbericht und Anträge der SPK-NR/SRvom 6. März 1997 (BBl 1997 III 245)Rapport complémentaire et propositions des CIP-CN/CEdu 6 mars 1997 (FF 1997 III 243)
Stellungnahme des Bundesrates vom 9. Juni 1997(BBl 1997 III 1484)Avis du Conseil fédéral du 9 juin 1997(FF 1997 III 1312)
Anträge der Verfassungskommission-NRvom 21. November 1997 (BBl 1998 364)Propositions de la Commission de la révision constitutionnelle-CNdu 21 novembre 1997 (FF 1998 286)
Anträge der Verfassungskommission-SRvom 27. November 1997 (BBl 1998 439)Propositions de la Commission de la révision constitutionnelle-CEdu 27 novembre 1997 (FF 1998 365)
___________________________________________________________
Eintretensdebatte – Débat d’entrée en matière
Rhinow René (R, BL), Berichterstatter: Der heutige Tag istein besonderer Tag. Zum ersten Mal in der 150jährigenGeschichte des Bundesstaates nimmt die Bundesversamm-lung eine vollumfängliche Revision unserer Verfassung inAngriff. Zum ersten Mal seit 1848 haben der Bundesrat unddie vorberatenden Kommissionen beider Räte einen neuenVerfassungstext entworfen, beraten und damit die Voraus-
setzungen dafür geschaffen, dass wir uns als oberste Be-hörde dieses Landes mit den Grundlagen, dem rechtlichenFundament, den obersten Werten und Prinzipien derSchweizerischen Eidgenossenschaft auseinandersetzenkönnen.Wohl wurde unsere Verfassung im Jahre 1874 bereits einmaltotal revidiert, doch waren es damals nur einzelne, allerdingswichtige Themen, die davon betroffen waren. Die Revisionbetraf vor allem die Ausweitung der Bundeskompetenzen inden Bereichen des Militärwesens und des Privatrechtes, dieAufnahme neuer Freiheitsrechte wie die Glaubens- und Ge-wissensfreiheit und die Handels- und Gewerbefreiheit, dieEinrichtung eines ständigen Bundesgerichtes und die Ein-führung des fakultativen Gesetzesreferendums. Der Textblieb im übrigen aber auf weite Strecken praktisch unverän-dert.Lang war der Weg, der zu diesem Tag geführt hat; lang,wenn man in Erinnerung ruft – ich tue das als Vertreter desStandes Basel-Landschaft besonders gern –, dass dermodernen Schweiz fast auf den Tag genau vor 200 Jahren,am 17. Januar 1798, mit dem ersten Freiheitsbaum in Liestalund anschliessend mit der Entlassung der Basler Land-schaft in die Freiheit, am 20. Januar 1798, der Weg geöffnetwurde.Lang war der Weg auch, wenn man den raschen Rhythmusder Verfassungsumwälzungen von 1798 bis 1848 bedenkt.Lang war er zudem, wenn man die Jahre zählt, die unter-schiedlichen Phasen und Stadien auch, die seit der Einrei-chung der parlamentarischen Vorstösse des SolothurnerStänderates Obrecht und des Basler Nationalrates Dürren-matt im Jahre 1965 verstrichen sind: die umfangreichen Ab-klärungen der Arbeitsgruppe Wahlen von 1967 bis 1973; dieAusarbeitung eines Verfassungsentwurfes durch eine Exper-tenkommission unter der Leitung von alt Bundesrat Furglervon 1974 bis 1977; das anschliessende, ausgedehnte Ver-nehmlassungsverfahren, das zu einem mit Varianten überar-beiteten Entwurf der Verwaltung sowie 1985 zum Antrag desBundesrates an die Räte führte, die Totalrevision einzuleiten.Schliesslich sind auch der positive Beschluss der Bundes-versammlung von 1987, die Totalrevision im Sinne einerNachführung vorzunehmen, und die Überweisung – 1993durch den Ständerat und 1994 durch den Nationalrat – derMotion unserer früheren Ratskollegin und RatspräsidentinJosi Meier (93.3218) zu erwähnen, die verlangte, die Arbei-ten an der Reform so voranzutreiben, dass die Bundesver-sammlung eine entsprechende Vorlage im Jubiläumsjahr1998 verabschieden könne. Nach 33 Jahren liegt es nun anuns – an uns und an Volk und Ständen –, dafür zu sorgen,dass endlich gut werde, was lange währte. Nun gilt es ernst.Der Bundesrat unterbreitet uns drei Vorlagen: einenBundesbeschluss A über eine nachgeführte Bundesverfas-sung, die von der Präambel bis zu den Schlussbestimmun-
1998 Januarsession – 11. Tagung der 45. AmtsdauerSession de janvier – 11e session de la 45e législature
Constitution fédérale. Réforme 4 E 19 janvier 1998
Bulletin officiel de l’Assemblée fédérale / Tiré à part
gen neu gegliedert und mit wenigen Ausnahmen neu formu-liert worden ist; einen Bundesbeschluss B über die Reformder Volksrechte sowie einen Bundesbeschluss C über dieReform der Justiz, welche sich beide auf die nachgeführteVerfassung abstützen und für sich allein neue Totalrevisio-nen im juristisch-formellen Sinne darstellen.Damit ist auch das der Verfassungsreform zugrunde lie-gende Konzept umschrieben: Die zuerst zu beschliessendenachgeführte Verfassung soll gleichsam das erneuerte, aus-gebesserte Fundament darstellen, auf dem eigentliche Re-formen in sachlich umschriebenen, ausgewählten Verfas-sungsbereichen verwirklicht werden.So sind Nachführung und Reformbereiche miteinander ver-knüpft und doch nicht verknüpft. Die Verknüpfung besteht po-litisch darin, dass mit der Nachführung einerseits der Bodenfür echte Reformen bereitet werden soll, quasi die Vorausset-zungen für diese zu schaffen sind. Anderseits soll aber auchzum Ausdruck gebracht werden, dass die Nachführung alleinnicht genügt, um den wachsenden Reformbedarf dieses Lan-des im staatlichen, institutionellen Bereich zu decken. Sie istgleichsam notwendige, aber nicht hinreichende Bedingungzur Staatsreform.Nachführung und Reformblöcke sind aber insofern nicht mit-einander verbunden, als es sich um rechtlich selbständigeRevisionen handelt, zu denen auch differenziert Stellung ge-nommen werden kann. Diese wechselseitige Unabhängigkeitmuss deutlich hervorgehoben werden, weil sich die Öffent-lichkeit bislang der verschiedenen Elemente des ProjektsVerfassungsreform zuweilen zu wenig bewusst geworden ist.Wir behandeln und beschliessen jetzt deshalb in unseremRat zu Recht ausschliesslich das Eintreten auf die Vorlage A,während die entsprechenden Debatten für die Vorlagen Bund C später geführt werden.Ihre vorberatende Kommission hat sich dem Konzept desBundesrates angeschlossen. Sie bejahte einstimmig dasEintreten auf die drei Vorlagen, und sie legt dem Rat ihre An-träge zu den Vorlagen A1 und C vor, während die Beratun-gen zur komplexen Vorlage B, zu den Volksrechten, nochnicht abgeschlossen sind. Die definitiven Anträge zur Vor-lage A2, welche die Artikel 127ff. betrifft, sowie zur Vor-lage B, bei denen der Nationalrat Erstrat ist, werden Ihnenspäter unterbreitet.Immerhin sei ergänzend angemerkt, dass der Bundesrat be-reits die Vorlage eines weiteren Reformpaketes unter demverheissungsvollen Titel «Staatsleitungsreform» angekün-digt und uns eine entsprechende Botschaft noch in diesemJahr versprochen hat. Auch die gegenwärtig laufenden Ar-beiten an der Reform der Aufgabenverteilung und des Fi-nanzausgleiches zwischen Bund und Kantonen werden allerWahrscheinlichkeit nach zu einem weiteren – vierten – Re-formbereich führen. Es wird einer späteren Beurteilung über-lassen bleiben müssen, ob die vier Reformblöcke insgesamtin der skizzierten Reihenfolge beraten und dem Volk vorzule-gen sind oder ob allenfalls diesbezüglich Änderungen vorge-nommen, also z. B. Reformblöcke wie die Staatsleitungsre-form und/oder die Aufgabenreform vorgezogen werden soll-ten. Hier bleibt unsere Handlungsfreiheit auch mit der Zu-stimmung zum bundesrätlichen Konzept gewahrt.Im Zentrum dieses dargestellten Konzeptes steht der Begriffder Nachführung. Es waren – wie erwähnt – die eidgenössi-schen Räte, welche 1987 dem Bundesrat den Auftrag erteilthatten, der Verfassungsentwurf solle – ich zitiere aus demBundesbeschluss – «das geltende geschriebene und unge-schriebene Verfassungsrecht nachführen, es verständlichdarstellen, systematisch ordnen sowie Dichte und Sprachevereinheitlichen» (Botschaft S. 27).Der Bundesrat interpretiert diesen parlamentarischen Auftragin seiner Botschaft (S. 45) wie folgt: «Das geltende Verfas-sungsrecht nachführen heisst, den genannten Normenkom-plex gegenwarts- und wirklichkeitsnah aufbereiten, das Ver-fassungsrecht als solches identifizieren, festhalten und neuverfasst ’vermitteln’. Konkret können damit im wesentlichenfolgende Mängel der gegenwärtigen Verfassung behobenwerden: Gegenstandslose Normen können aufgehoben undveraltete Bestimmungen zeitgemässer formuliert, auf Geset-
zesebene herabgestuft oder gestrichen werden; Lücken kön-nen geschlossen, Fehlendes kann ergänzt, Bestehendes an-gereichert werden; Verfassungsrecht und Verfassungswirk-lichkeit können einander angenähert, Bundesstaatlichkeit,Rechtsstaatlichkeit und Sozialstaatlichkeit in einer dem heu-tigen Verständnis entsprechenden Weise dargestellt wer-den.»An anderer Stelle der Botschaft heisst es, das geltende Ver-fassungsrecht solle entschlackt, vervollständigt und über-sichtlich dargestellt werden. Damit könne eine klare Aus-gangslage für die Verfassungsreform geschaffen, aber auchTransparenz für die Bürgerinnen und Bürger hergestellt wer-den. Letztlich werde auf diese Weise ein Beitrag dazu gelei-stet, dass sich Bürgerinnen und Bürger wieder stärker mit derVerfassung identifizierten.Der Bundesrat verschweigt dabei keineswegs, dass die so-genannte Nachführung kein problemloses Unterfangen dar-stellt. In der Tat: Jede Veränderung des Verfassungstextes,jede sogenannte Herauf- oder Herabstufung von Rechtssät-zen, d. h. die Umwandlung von bisherigem Gesetzesrecht inVerfassungsrecht oder umgekehrt, von Verfassungsrecht inGesetzesrecht, jedes Füllen von Lücken, jede textliche Fas-sung von bislang ungeschriebenem Recht oder sonstwierichterlich geprägtem Recht, jede Streichung sogenanntüberholten Rechtes, jede Neugliederung des Verfassungs-stoffes stellt einen Akt der politischen Wertung dar. Damitsind Verfassungsmodifikationen zwangsläufig verbunden,oder es werden dadurch Spielräume möglicher neuer Deu-tungen und Konkretisierungen der Verfassung eröffnet.Nachführung ist deshalb immer mehr als blosse Nachfüh-rung.Vielleicht ist sogar der Begriff der Nachführung der grössteNachteil der Idee der Nachführung, weil er Missverständ-nisse aufkommen lässt und den Anschein einer buchhalteri-schen Aufgabe, eines blossen Nachvollzugs fern jeglichermaterieller Tragweite vermittelt. Nachführung ist aber mehrals Nachvollzug. Der französische Ausdruck «mise à jour»bringt das Anliegen bedeutend besser zum Ausdruck; ichpersönlich würde es denn auch vorziehen, statt von einerNachführung von einer Aktualisierung der Verfassung zusprechen.Die Kommission hat sich wiederholt und vertieft mit den offe-nen Rändern dieses Nachführungsbegriffs auseinanderge-setzt. Sie hat den Schluss gezogen, dass in diesem Konzeptauch Reformen von begrenzter Reichweite ihren Platz fin-den; Reformen, die zwar vom geltenden Recht abweichen,aber auf einen breiten Konsens zählen können, bei denen esdarum geht, alte Zöpfe abzuschneiden, oder Reformen, fürdie sich der Weg einer gesonderten Teilrevision der Verfas-sung kaum rechtfertigen dürfte. Auf der anderen Seite habenwir uns bei kürzlich beschlossenen Verfassungsartikeln be-sonders eng an den bisherigen Wortlaut angelehnt oder die-sen sogar wörtlich übernommen.Gesamthaft haben wir den bundesrätlichen Entwurf mit rund20 punktuellen Änderungen angereichert, auf die ich späterkurz eingehen werde. Deshalb sprechen wir im Titel des vor-liegenden Bundesbeschlusses über die Bundesverfassungehrlicherweise auch von einer neuen Verfassung und nichtvon einer – Missverständnisse geradezu provozierenden –nachgeführten Verfassung.Wir werden uns wohl auch im Rat immer wieder die Fragestellen, was an Änderungen in diesem NachführungskonzeptPlatz hat und was nicht. Für uns war letztlich wegleitend,dass in diese Verfassung grundsätzlich nichts Neues aufzu-nehmen ist, das nicht von einer breiten Mehrheit in den Rätenund – soweit wir es beurteilen können – in der Öffentlichkeitgetragen werden kann. Sollte sich erweisen, dass einzelneunserer Vorschläge diesen Rahmen überschreiten, müsstenwohl Korrekturen angebracht werden.Das Projekt Nachführung stellt ein bescheidenes und an-spruchsvolles Unterfangen zugleich dar. Bescheiden ist es inseinem Reformgehalt, in seinem Vermögen oder auch Un-vermögen, neue Antworten auf strukturelle Mängel undSchwierigkeiten unseres Staatswesens zu finden. Als be-scheiden erweist sich die Nachführung zudem überall dort,
19. Januar 1998 S 5 Bundesverfassung. Reform
Amtliches Bulletin der Bundesversammlung / Separatdruck
wo die geltende Verfassung bereits à jour ist, wo sie dank dervielen Teiländerungen der letzten Jahre und Jahrzehnte denAnforderungen der Zeit entspricht. So ist denn auch festzu-halten, dass unsere Verfassung keineswegs in globo als ver-altet dargestellt werden darf: Abgesehen von den nach wievor gültigen Grundwerten lebt sie vor allem im Kompetenz-und Aufgabenbereich. Dort ist sie à jour, ja in Teilbereichensogar ausgesprochen fortschrittlich.Anspruchsvoll ist das Projekt Nachführung demgegenüberz. B. dort, wo es darum geht, bei diffuser, umstrittenerRechtslage klärende Entscheidungen zu fällen und Transpa-renz herzustellen, trotz Sprachmodernisierung den Inhaltmöglichst nicht zu verändern, das ungeschriebene Recht inVerfassungstexte umzugiessen, zu werten, was in dieser Zeitneu oder nicht mehr verfassungswürdig sei, und, vor allem,die Grenzen zwischen konsensfähigen Neuerungen und kon-zeptsprengenden Reformen zu ziehen.Gerade die Herstellung von Verständlichkeit und Transpa-renz stellt in einer Zeit der zunehmenden Unübersichtlichkeitfür den Rechtsstaat und die Demokratie eine vorrangige Auf-gabe dar. Ich darf dies am Beispiel von Artikel 4 der gelten-den Bundesverfassung erläutern, der in Absatz 1 lapidar denGrundsatz der Rechtsgleichheit enthält, aus dem Lehre undRechtsprechung aber wichtige Pfeiler der Rechtsstaatlichkeitabgeleitet haben. Diese Prinzipien nimmt der Verfassungs-entwurf auf und legt sie in acht verschiedenen Artikeln undinsgesamt 15 Absätzen nieder. So finden die Grundsätze derGesetzmässigkeit, des öffentlichen Interesses, der Verhält-nismässigkeit und des Handelns nach Treu und Glauben Ein-gang in Artikel 4 des Verfassungsentwurfes, während dieRechtsgleichheit, das Willkürverbot, der Vertrauensschutzund elementare Verfassungsgarantien im Grundrechtsteilund die Grundsätze der Abgabenerhebung in Artikel 188 zufinden sind.Anspruchsvoll ist das Projekt auch deshalb, weil wir in150 Jahren eine – wie ich sie nennen möchte – Verfassungs-kultur der Teilrevision entwickelt und gepflegt haben, eineMethode der partiellen, schrittweisen und parzellierten politi-schen Reformen auf Verfassungsebene. Ursächlich für dieseKultur der Teilrevisionen ist einerseits das Erfordernis derVerfassungsänderung zur Begründung neuer Bundesauf-gaben nach dem bundesstaatlichen Prinzip von Artikel 3 dergeltenden Verfassung. Andererseits hat die Volksinitiative aufTeilrevision der Verfassung mit dazu beigetragen, dass un-sere Verfassung, anders als in anderen Staaten, zum Gefässder politischen Auseinandersetzungen, manchmal sogar zumGefäss von tagespolitischen Auseinandersetzungen wurde.Auf diese Weise konnte die Verfassung – wie erwähnt – je-denfalls in Teilbereichen im Bewusstsein des Volkes lebendigund modern bleiben bzw. werden.Aber unser Verfassungsdenken wurde gleichzeitig immermehr zum materienbezogenen, themenbezogenen Denken.Der Überblick über das Ganze, über die inneren Zusammen-hänge der Verfassung, über ihre Kohärenz, aber auch überihre Ambivalenzen, ja vielleicht sogar über gewisse Wider-sprüche, ging zunehmend verloren. Nun steht sie zum erstenMal als Ganzes zur Diskussion. Hierin liegt eine grosseChance, aber auch eine Gefahr: die Gefahr des Ungewohn-ten, die Gefahr des noch nie Dagewesenen. Die Verfassungverlangt von uns allen das Überwinden des Einheit-der-Ma-terie-Denkens und vor allem eine Gesamtwertung, eine Bi-lanz, die nicht die Einzelteile in den Vordergrund rückt, dienicht allfällige Vorbehalte gegenüber bestimmten Artikelnoder Passagen übergewichtet, sondern das Hauptziel in ei-ner – auf der Basis tradierter, neu belebter staatstragenderWerte – neu oder wieder verfassten Gemeinschaft erblickt.Damit bin ich bei der eigentlichen Herausforderung dieserReform angelangt. Anspruchsvoll ist sie nämlich vor allem,weil wir vor der einmaligen Gelegenheit stehen, uns derGrundwerte unseres Staates bewusst zu werden, ihren aktu-ellen und künftigen Sinn zu reflektieren, den Essentialien un-serer Rechtsgemeinschaft nachzugehen, unsere Identität zuüberprüfen und zu festigen. In dieser Optik steht der Prozessdieses Projektes im Vordergrund: Der Dialog in einer Zeit, inder sogenannt Unbestrittenes, Selbstverständliches wieder
zum Thema geworden ist, wo die Auffassungen über dieStrukturprinzipien unseres Staates teilweise und – wenn iches recht sehe – zunehmend auseinandergehen.Wir sprechen oft und zu Recht voller Sorgen über das gewal-tige Haushaltsdefizit, über die fehlenden finanziellen Mittel.Aber haben wir denn in diesem Land nicht ein noch viel grös-seres staatspolitisches Defizit? Haben wir nicht vor lauterWohlstandsmehrung die «idée directrice» unseres Landes,der Schweiz, etwas aus den Augen verloren? Was machtdenn die Schweiz aus? Was hält uns zusammen? Was be-deuten uns Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte, kultu-relle Vielfalt, Föderalismus, kantonale Autonomie, Sozial-staatlichkeit? Wo sind sie zu verstärken, wo sind Grenzen zuziehen? Wir sind in der Kommission immer wieder auf derar-tige Fragen gestossen, etwa beim Diskriminierungsartikel,beim Streikrecht, bei den Sozialzielen, bei der Wahrung derRessourcen der Kantone, beim Gemeinde- und Städteartikel,bei der Wahrung von Kinder- und Jugendanliegen, beim Bis-tumsartikel und anderen mehr.Die Verfassung eines Staates ist das Gefäss des Grundkon-senses einer Gesellschaft. In ihr finden sich die Klammernder Gemeinschaft. Diese Klammern sind nicht ein für allemalgeregelt, quasi eingebracht, «am Schärme». Sie bedürfender Erneuerung, der Festigung, der Belebung. Deshalb istauch das Prozesshafte so wichtig, und der genaue Wortlaut,in den diese Grundwerte gekleidet werden, vielleicht etwasweniger. Die Verfassungsreform stellt so eine grosse Chancedar, eine Einladung, in einer Zeit der Verunsicherung und derrasanten Veränderungen das eigene Fundament auf seineFestigkeit hin zu überprüfen und notfalls neu zu stärken.Denjenigen in unserem Lande, die sich Veränderungen eherentgegensetzen wollen, ist zu sagen: Ist es denn nicht um sowichtiger, wenigstens das eigene Haus in Ordnung zu haltenoder in Ordnung zu bringen? Denjenigen aber, die weiterge-hende Veränderungen wünschen, dringend wünschen – ichzähle mich auch zu ihnen –, ist in Erinnerung zu rufen: Nurwer seiner Ausrüstung sicher ist, begibt sich mit Erfolgschan-cen in schwieriges Gelände; dies gilt für das Gebirge wie fürdie Politik.Wer diesen Prozess der Selbstbefragung hastig überspringenund gleich zur eigentlichen Reform greifen möchte, läuft –gerade in unserer Demokratie – Gefahr, am Ende nichts zuerreichen. Insofern sollten alle, denen Reformen in diesemStaat am Herzen liegen, gut überlegen, ob es sich lohnt, ge-gen diese Aktualisierung anzutreten oder damit zu drohen,etwa aus Enttäuschung über deren beschränkte Reichweiteoder weil sie unliebsame Einzelpunkte darin erblicken. Esgeht hier zum ersten Mal in unserer Geschichte nicht um ein-zelnes, sondern es geht um das Ganze.Zusammenfassend sprechen also folgende Gründe für dieAktualisierung der Verfassung:1. die Schaffung bürgernaher Verständlichkeit und Transpa-renz, vor allem bei den Menschenrechten und der ausge-messenen Staatsverantwortung;2. die Vornahme punktueller Änderungen in wenig umstritte-nen Bereichen, die keine besondere Teilrevision der Verfas-sung rechtfertigen;3. die Gewinnung einer Gesamtsicht der staatlichen Struktu-ren und Grundsätze in ihren Zusammenhängen über die tra-dierte Optik der Einheit der Materie hinaus;4. der Diskurs über die uns verbindenden Grundwerte, derenWiederbelebung im Interesse der Erneuerung der Willensna-tion Schweiz – einer Nation oder besser vielleicht eines Na-tionenbündels, welches dieses stets zu erneuernden Willensbedarf. Willen zur Nation heisst auch Willen zur Verfassung,zu einer Verfassung für unsere Zeit.Zuweilen wird der Vorwurf erhoben, es sei doch heute, in die-ser von einem wachsenden Reformstau geprägten Zeit,Nützlicheres, Dringlicheres zu tun. Auch wird behauptet, dasVolk interessiere sich nicht für dieses Vorhaben, es habe an-dere Sorgen.Beide Einwände treffen nicht oder nur teilweise zu. Gerade ineiner Phase unserer Geschichte, in der der Konsens zumknappen Gut geworden ist, erscheint die Auseinanderset-zung über unsere gemeinsamen Grundwerte so wichtig.
Constitution fédérale. Réforme 6 E 19 janvier 1998
Bulletin officiel de l’Assemblée fédérale / Tiré à part
Könnte es nicht sein, dass unsere vordergründigen Schwie-rigkeiten, unsere Mühe mit der Problemlösung, mit unausge-sprochenen, tiefer liegenden Spaltungen und Unsicherheitenzu tun haben? Der vermeintliche Umweg führt manchmalschneller zum Ziel; und Wichtiges geht dem Dringlichen vor.Dies ist eine Weisheit, die wir in der Politikhektik unserer Zeitmanchmal vergessen haben. Es scheint sich zu rächen, dasswir die Staatspolitik so lange stiefmütterlich behandelt habenund dass ihr in der Tat in den letzten Jahrzehnten viele Bür-ger und Bürgerinnen in Politik und Wirtschaft verständnislos,ja auch ablehnend gegenüberstanden.Dass die Verfassungsreform beim Volk nicht zuoberst auf derHitparade steht, trifft zweifellos zu. Aber wenn nicht allestäuscht, nimmt nun das Interesse an staatspolitischen Fra-gen laufend zu. Denn es ist vielen Schweizerinnen undSchweizern nicht gleichgültig, wie es um unser Land steht,wie seine Identität zu begründen ist. Neue oder überkom-mene Menschenrechte, die Zukunft des Sozialstaates, desBundesstaates und der Demokratie berühren die Menschen,und es zeugt von einer eigenartigen Geringschätzung desVolkes, wenn man ihm seine staatsbürgerlichen Interessen,die gerade heute wieder ein grösseres Gewicht erhalten, ab-spricht. Wir sind – ich möchte das unterstreichen – nicht nurein Volk von Konsumierenden und Produzierenden, von Ar-beitnehmern und Arbeitgebern, Mietern, Vermietern und Ei-gentümern, sondern auch und in erster Linie ein Volk vonStaatsbürgerinnen und Staatsbürgern im tiefsten Sinne die-ses Wortes.Nun bricht die neue Bundesverfassung nicht mit der schwei-zerischen Verfassungstradition – ich betone das –, denn siemacht das bisherige Schrifttum, die bisherige Praxis von Be-hörden und Gerichten, die Interpretationen der geltendenVerfassungsbestimmungen nicht zu Makulatur. Sie stelltkeine Zäsur dar, sondern eine sanfte Weiterentwicklung imSinne der skizzierten Aktualisierung. Sie soll auch nicht zureigentlichen Kodifikation werden, die künftigen Weiterent-wicklungen in der tradierten schweizerischen Methodik derVerfassungskonkretisierung, etwa der Anerkennung unge-schriebener Verfassungsgehalte, den Weg versperrt.Was hat nun die Kommission vor allem beschäftigt? Wo hatsie kleinere, aber deshalb nicht unwichtige Weichenstellun-gen vorgenommen? Ich hebe vorerst aus den Änderungenzum bundesrätlichen Entwurf folgende zentrale Anliegen her-vor:1. Das Ringen um Subsidiarität in Staat und Gesellschaft, dieBestimmung der Rolle des Staates im Verhältnis zum Indivi-duum einerseits und des Bundes im Verhältnis zu den Kan-tonen andererseits; z. B. etwa beim Recht auf Existenzsiche-rung – das wir als Recht auf Hilfe in Notlagen für diejenigengewährleisten wollen, die nicht in der Lage sind, für sichselbst zu sorgen –, bei den Sozialzielen, die unter dem Vor-behalt privater Verantwortung stehen, bei der Wahrung kan-tonaler Autonomie, insbesondere auch des kantonalen Steu-ersubstrates.2. Die Verankerung eines modernen sowie gelebten Födera-lismus, der die Kooperation zwischen Bund und Kantonenund nicht nur die Teilung der Kompetenzen hervorhebt, derdem Bund die Rücksichtnahme auf die besondere Situationvon Gemeinden, Städten und Agglomerationen gebietet undder Gebietsveränderungen zwischen den Kantonen erleich-tert, indem nur noch das fakultative statt das obligatorischeReferendum verlangt wird.3. Das Bekenntnis zur wettbewerbsorientierten und sozialenMarktwirtschaft, wie es der Bundesrat bereits vorgeschlagenhat, allerdings mit einer Akzentsetzung zugunsten des Wett-bewerbs bei Abweichungen vom Grundsatz der Wirtschafts-freiheit.4. Die Verankerung des Nachhaltigkeitsprinzips zu Beginndes Abschnittes über Umwelt und Raumplanung.5. Eine bewusste Verstärkung der Stellung von Kindern undJugendlichen, indem die Einbürgerung staatenloser Kindererleichtert werden soll, indem ein Anspruch auf Grundschul-unterricht für alle Kinder statuiert wird und indem der Bundverpflichtet wird, den Förderungs- und Schutzbedürfnissender Kinder Rechnung zu tragen.
6. Eine Aktualisierung des Verhältnisses von Bundesver-sammlung und Bundesrat, indem wir die von den beidenStaatspolitischen Kommissionen entworfenen Massnahmenweitgehend übernommen haben, allerdings mit drei wichti-gen Ausnahmen. Ich komme auf diesen Bereich der Verfas-sung anlässlich unserer Beratungen als Zweitrat zurück undwerde dann näher auf sie eingehen.Neben Subsidiarität, modernem Föderalismus, wettbewerbs-orientierter und sozialer Marktwirtschaft, Nachhaltigkeitsprin-zip, Stärkung von Jugendanliegen und der Aktualisierungdes Verhältnisses von Bundesversammlung und Bundesrathaben wir gegenüber dem bundesrätlichen Entwurf weitereÄnderungen angebracht. Ich nehme die wichtigsten heraus:– die Streichung des Streikrechtes und des Redaktionsge-heimnisses als Garantien auf Verfassungsebene;– die Streichung der verfassungsrechtlichen Pflicht der Be-hörden, von Petitionen Kenntnis zu nehmen;– eine verständlichere Fassung des allgemeinen Verhältnis-ses von Bund und Kantonen;– eine Verdeutlichung des Territorialitätsprinzips im Spra-chenrecht und dessen neue Aufteilung auf verschiedene Ar-tikel;– die Streichung des Ordensverbotes;– die Einführung eines Statistikartikels;– die Verankerung der Raumfahrt als Bundesaufgabe;– die Streichung des Bistumsartikels;– die Abschaffung der Bedürfnisklausel im Gastgewerbe, al-lerdings mit einer zehnjährigen Übergangsfrist;– die Streichung der Pflicht von Post und Telecom, ihre Ge-winne dem Bund abzuliefern, und– die Streichung der sogenannten Retorsionssteuer.Auf die Änderungen im Organisationsbereich gehe ich wieerwähnt erst bei der Vorlage A2 näher ein.Damit möchte ich Ihnen abschliessend noch einige ergän-zende Angaben über die Kommissionsarbeiten nachliefern:Wir haben im letzten Jahr acht Plenarsitzungen mit insge-samt 18 Sitzungstagen durchgeführt. Dazu kamen 19 Sit-zungen der drei Subkommissionen mit insgesamt 27 Sit-zungstagen, d. h. im Mittel neun Sitzungstage pro Mitglied.Das ergibt oder ergäbe, volle Präsenz vorausgesetzt, proKommissionsmitglied ein Total von 27 Sitzungstagen.So oder so kann anhand dieser Statistik der grosse Arbeits-aufwand ermessen werden, der von allen Kommissionsmit-gliedern zusätzlich und neben der Normalität des parlamen-tarischen Alltages erbracht wurde. Ich möchte mich an dieserStelle bei allen Mitgliedern für diesen grossen Einsatz bedan-ken, aber auch bei den Parlamentsdiensten für die muster-gültige Unterstützung.Die Kommission oder ihre Subkommissionen haben fernerverschiedene gesellschaftliche Gruppierungen angehört, wiedie Jugendverbände, den Gemeinde- und den Städtever-band. Sie haben einen intensiven Dialog mit den Kantonen,d. h. mit der Konferenz der Kantonsregierungen, gepflegt undsich von Vertretern der Arbeitsgruppe für den neuen Finanz-ausgleich über den aktuellen Stand der Reformarbeiten infor-mieren lassen. Als Experte wirkte neben den Fachleuten desBundesamtes für Justiz und des Dienstes für die Totalrevisionder Bundesverfassung Professor Kälin für die Belange desVerhältnisses von Völkerrecht und Landesrecht mit. Auch ih-nen allen sei mein verbindlicher Dank ausgesprochen.Ferner hat ein reger Austausch mit der nationalrätlichenKommission stattgefunden. Die Tätigkeit beider Kommissio-nen wurde gegenseitig befruchtet. Trotzdem sind rund20 Unterschiede in den Textfassungen beider Kommissionenentstanden, so dass uns das Differenzbereinigungsverfahrenwohl noch einige Arbeit bescheren wird.Ein beträchtlicher Unterschied zwischen den beiden Textent-würfen besteht auch darin, dass im Nationalrat 128 Minder-heitsanträge eingebracht wurden, während es bei uns nur 13sind. In der Schlussabstimmung stimmten bei uns 17 Rats-mitglieder der Vorlage zu, ohne Gegenstimme und bei einerEnthaltung.Die Vorstellung der Kommissionsanträge wurde wie folgt auf-geteilt: Ich werde als Präsident den Abschnitten der Verfas-sung jeweils einige grundsätzliche Bemerkungen voraus-
19. Januar 1998 S 7 Bundesverfassung. Reform
Amtliches Bulletin der Bundesversammlung / Separatdruck
schicken. Die einzelnen Artikel werden von den Präsidentender Subkommissionen vorgestellt, also von den Herren Frickund Aeby, wobei Herr Zimmerli, unser Ratspräsident, als drit-ter Subkommissionspräsident seine Aufgaben an die HerrenInderkum, Marty Dick und Wicki – sie alle sind Mitglieder derentsprechenden Subkommission – delegiert hat.Herr Cavadini Jean wird sich unmittelbar anschliessend zuden Beschlüssen der Kommission über die sprachlicheGleichstellung der Geschlechter in der französischen Spra-che äussern.Die Reform unserer Bundesverfassung ist eine echte, einegrosse Herausforderung. Die vorliegende Aktualisierungstellt den ersten wichtigen Schritt dar. Die Auseinanderset-zung mit den rechtlichen und staatspolitischen Existenz-grundlagen unserer Schweiz, mit unserer Identität, mit unse-rem Grundkonsens kommt gerade zur rechten Zeit. Nehmenwir diese Herausforderung an!Ich beantrage Ihnen namens der einhelligen KommissionEintreten auf die Vorlage.
Cavadini Jean (L, NE): Vous venez de l’entendre, cette inter-vention n’est justifiée, à cet endroit, que par une question delangue et je vous remercie de bien vouloir l’accepter. Je feraiquelques remarques personnelles pour ne plus reprendre laparole dans le débat d’entrée en matière, mais je centreraimon intervention sur la question de la transposition en fran-çais de ce texte.Nous voici donc à pied d’oeuvre. Plus de trente ans après lespremières formulations, nous tentons une remise à jour denotre charte fondamentale, et tout aussitôt une premièrequestion se pose: mise à jour de la constitution – c’était l’in-tention du Conseil fédéral – ou nouvelle Constitution fédé-rale, comme la Commission de la révision constitutionnellede notre Conseil l’a souhaitée? La question n’est pas acadé-mique. Nous nous déclarons prêts à entrer en matière pourune mise à jour. Nous craindrions qu’une nouvelle constitu-tion ne prenne le chemin du cimetière qu’ont tristementconnu ses illustres devancières. Au reste, la mise à jour n’arien de honteux. Bien au contraire, il s’agit de mettre de l’or-dre dans un texte amendé plus de 140 fois. On souhaite re-trouver l’identité suisse contemporaine, et nous souscrivonsà cet objectif. On sait bien qu’une nouvelle constitution seraitsuscitée par des événements calamiteux ou violents, par unerupture avec un passé dont on ne saurait plus se réclamer,par une crise profonde qu’on ne saurait de bonne foi recon-naître aujourd’hui dans notre pays. On a même connu unenouvelle constitution sous le diktat d’une puissance étran-gère; c’était en 1798 et la France l’avait dictée, mais nousn’en sommes pas là.On pourra se mettre d’accord sur une mise à jour qui éviterales affrontements, que ce soit par la nature des innovationsou par celle des suppressions. Si l’on veut réussir, et nous lesouhaitons, c’est le prix à payer. Certains diront que c’estmanquer d’ambition: ils ne savent peut-être pas que lesgrands enthousiasmes suscitent des réticences plus vivesencore.Le travail effectué manque-t-il de relief? Cette mise à jour est-elle trop grise, trop terne? Nous ne le disons pas. Elle est enmesure de réunir une majorité de bonne foi que n’animeaucune arrière-pensée majeure. On a parlé, c’est vrai, tout àl’heure, des grands anciens au souffle puissant, à l’inspira-tion généreuse et vivifiante. Le rappel ne me paraît pas déci-sivement opportun: nous ne sortons pas du Sonderbund,nous n’entrons pas dans le Kulturkampf. Nous entendonstout de même commémorer un anniversaire, mais le 150e, dela première Constitution suisse et républicaine. Nous lais-sons le soin aux cantons, qui s’en portent bien, de célébrer ledeuxième centenaire de la République helvétique, commetant d’autres, mais il ne nous concerne que peu.Aucune réécriture n’est innocente, nous l’admettons volon-tiers. La nouvelle formulation de la constitution n’échappepas à cette fatalité. Avons-nous affaire à une simple évolutionou discernons-nous les germes d’une révolution? Souvent lavérité est intermédiaire. Certaines nouveautés sont fortes, et
nous saluons la protection accrue des enfants, dont les can-tons avaient inauguré le droit général à l’instruction, mêmepour les enfants des travailleurs clandestins. Nous sommes,dans ce même chapitre, favorables à un processus de natu-ralisation plus aisé en leur faveur. Nous acceptons l’inscrip-tion d’une notion de développement durable, même si noussavons qu’une telle disposition peut générer des interpréta-tions diverses, voire contradictoires. La nouvelle approchedes responsabilités en matière de politique étrangère n’em-porte pas notre adhésion sans restriction: nous croyons à lacompétence primordiale et décisive du Gouvernement.Mais d’autres dispositions ne sauraient nous convaincre dubien-fondé de leur apparition. Nous évoquons d’abord lagrande question qui réside, assurément, dans l’inscription ounon des buts sociaux de la constitution. Mettre en doute lebien-fondé d’une telle démarche suscite aussitôt des criti-ques violentes, des attaques vigoureuses. Comment laSuisse pourrait-elle se dispenser d’inscrire des droits sociauxdans sa charte fondamentale? Et voilà, aussitôt toute l’équi-voque apparaît. On voulait parler de buts, mais on évoque lesdroits. La confusion naît immédiatement. Entre des objectifset des réalisations, on n’imagine que le temps de passer àl’acte. On promeut au rang constitutionnel le devoir d’étendrel’Etat social. Nous ne nous trouvons plus dans le cadre d’unemise à jour, mais nous nous engageons dans une révisionfondamentale. Il ne sera guère possible d’expliquer que cesgrands principes représentent un simple catalogue dontaucun droit subjectif ne saurait être tiré. Cette inscription auniveau constitutionnel général créera plus d’équivoque etd’amertume par les espérances déçues que de motivation etd’engagement dans son éventuelle concrétisation. Nous con-naissons les droits sociaux dont nous disposons. Travaillonsà leur consolidation plus qu’à l’affaiblissement de ce quenous connaissons dans un ensemble social dont nousn’avons pas les moyens de reconnaître la totale existence. Ilfaut, ici, que «le songeur soit plus fort que le songe».La proposition de créer un droit fondamental de grève n’a pasnon plus notre assentiment pour des raisons que nous re-prendrons et qui sont essentiellement d’ordre juridique et po-litique, car nous ne sommes plus ici non plus dans une miseà jour, mais bien dans une révision fondamentale et, d’ail-leurs, inopportune.Nous devons, en revanche, aborder le problème de la langueet, singulièrement, celui de la traduction de l’égalité dessexes dans la constitution. Cette question est délicate parcequ’elle froisse des sensibilités, et nous les comprenons, maiscette question n’est pas insoluble. Chacun de nous a reçudes dizaines de lettres, d’ailleurs parfois répétitives, pour exi-ger – je le cite, parce que c’est tout à fait révélateur – «la fé-minisation du texte français de la nouvelle constitution».C’est presque freudien. L’équivoque est complète. De quois’agit-il? D’affirmer, de souligner et d’illustrer le principe del’égalité entre les femmes et les hommes. Or, nous le savonsou nous devrions le savoir: chaque langue a son génie. L’al-lemand peut assez facilement – je reprends l’expression – fé-miniser un titre ou une fonction. Le français ne le peut passystématiquement, et l’italien connaît des difficultés plus in-surmontables encore. Pour nous limiter au français, rappe-lons que cette langue ne connaît pas le genre neutre. Cen’est ni un appauvrissement ni un enrichissement; elle neconnaît pas le genre neutre qui existe en allemand, parexemple. Le français se limite à la connaissance de deuxgenres: le masculin, le féminin. Les règles fondamentales dela langue nous rappellent que le masculin est le genre exten-sif. Au moment où il s’est agi de déterminer une catégorie ouune fonction, c’est au masculin que le français a confié cettemission, si j’ose dire. C’est le masculin qui a eu la capacité dereprésenter à lui seul les éléments relevant de l’un et l’autregenre. Il n’y a nul débat sexiste; il n’y a qu’une insurmontabledifficulté linguistique.Première remarque: votre Commission de la révision consti-tutionnelle a consulté sa Commission de rédaction de languefrançaise. Celle-ci a proposé d’introduire une note en bas depage pour expliciter ce principe du masculin générique quiest jusqu’ici implicite. Nous passons donc de la notion d’im-
Constitution fédérale. Réforme 8 E 19 janvier 1998
Bulletin officiel de l’Assemblée fédérale / Tiré à part
plicite à la notion d’explicite. Cet implicite était connu des tex-tes de loi et même de la constitution.Deuxième remarque: la même commission proposait de rem-placer le mot «homme» par les mots «être humain», à l’ex-ception de la référence aux droits de l’homme. Décidément,en faire une «déclaration des êtres humains» par oppositionà une «déclaration des chameaux ou des grenouilles», çaparaissait peu heureux! Nous proposons donc là de conser-ver cette notion dans la disposition. Et, pour compliquer laquestion, rappelons que le terme de «personne», auquel onsonge parfois, recouvre également, dans les articles 26 et 27du nouveau projet, les personnes morales, ce qui n’est pasfait pour simplifier les choses.Nous vous proposons de nous en tenir à la note générique,de discuter éventuellement la question de substituer à«homme» le vocable d’«être humain», mais de reconnaîtreque toute langue a son esprit, son poids, son histoire. On nela force pas impunément, le ridicule peut encore blesser – ily a longtemps qu’il ne tue plus –, même s’il est vrai que lesépidermes se sont singulièrement épaissis. Nous laisserons,s’ils le souhaitent, à nos collègues tessinois la démonstra-tion qu’une féminisation systématique des textes en italienest incohérente, voire impossible, avec des mots masculinsen «-a» ou en «-e», qui seraient l’apanage normal d’un sin-gulier ou d’un pluriel féminin.La guerre des sexes n’aura pas lieu ici, Monsieur le Prési-dent, et nous vous remercions d’accepter que l’usage se dé-veloppe normalement, que le renouvellement s’opère avec letemps, là où il est possible. Nous donnons l’assurance que,chaque fois que nous pouvons, sans excès et sans artifice,créer un néologisme qui donne satisfaction à celles que pré-occupe cette question, nous le ferons. Car, comme chacun –allons! – et chacune, nous sommes attachés à la parfaite re-connaissance de l’égalité et à sa traduction dans les droitspolitiques, économiques, culturels et sociaux. Que cette miseà jour de la constitution nous unisse et que la langue fran-çaise ne succombe pas, tel est notre voeu!
Wicki Franz (C, LU): Die Verfassungsvorlage, die wir in die-ser Session – und wohl auch in weiteren Sessionen – mitein-ander beraten, ist die Umsetzung des Auftrages, den Stände-rat und Nationalrat in den Jahren 1993/94 aufgrund der Mo-tion der Luzerner Ständerätin Josi Meier (93.3218) dem Bun-desrat erteilt haben.Ich danke vorerst dem Bundesrat, insbesondere Herrn Bun-desrat Koller, und den Damen und Herren des Eidgenössi-schen Justiz- und Polizeidepartementes für die speditive Er-füllung dieses Auftrages. Dank einem klaren Konzept, einerstraffen Projektorganisation und dem bestimmten Willen, dieRevision tatsächlich zu verwirklichen, können wir heute mitden Beratungen beginnen.Dieser Wille, den Auftrag des Parlamentes zügig in die Tatumzusetzen, hat sich auch in der Verfassungskommissiondes Ständerates gezeigt. Als Mitglied der vorberatendenKommission kann ich bestätigen: Die Reform der Verfassungwar und ist weit mehr als eine blosse Pflichtübung. Wir habenin der Kommission das Reformprojekt nicht nur als eine Um-schreibe- oder eine Schönschreibeübung verstanden. DieVerfassungsreform forderte ein Nachdenken über den StaatSchweiz und ein Überprüfen der Frage, welche Stellung dieBürgerinnen und Bürger darin haben oder haben sollen. DieVerfassungsrevision soll mehr als nur die Überarbeitung ver-alteter Vereinsstatuten sein.Für mich hat die Beratung der Verfassung nur dann einenSinn, wenn wir gleichzeitig über die Grundwerte unseresStaates nachdenken, unsere demokratischen Spielregelnhinterfragen, uns mit dem Föderalismus auseinandersetzenund die Stellung der Schweiz in der Staatengemeinschaftauch überprüfen. So verstanden ist die Neuformulierung dergesamten Verfassung nicht nur Kosmetik, sondern auch einestaatspolitische Chance.Ich bin überzeugt, dass wir mit der nachgeführten Verfas-sung die wichtigen Grundlagen dafür schaffen können, umdie dringenden Reformvorhaben an die Hand zu nehmen.Die heutige Vorlage kann daher nicht den Endpunkt der Re-
vision darstellen. Es stehen unbestritten dringend notwen-dige Reformen an. Die Versuchung war deshalb in der Kom-mission gross – dies wird wohl auch in den Räten der Fallsein –, im Rahmen der Nachführung dringende Reformeneinfliessen zu lassen. Wir mussten uns aber bewusst wer-den: Wenn wir mit der Bundesverfassungsrevision Erfolg ha-ben und die Ernte tatsächlich in die Scheune einfahren wol-len, dürfen wir das Fuder nicht überladen. Es blieb und bleibtuns wohl nichts anderes übrig, als uns an das durchdachteKonzept des Bundesrates zu halten. Im Rahmen der Nach-führung können wir nur selektive Veränderungen des gelten-den Verfassungsrechtes vornehmen.Doch wenn wir uns im gesamten bloss auf die Nachführungbeschränken, machen wir nur Denkmalschutz. Dies kann je-doch nicht der Sinn des grossen Aufwandes sein, den Kom-missionen und Parlament hier betreiben. Unsere Aufgabekann es nicht sein, nur das Alte zu erhalten. Wir müssen auchdie Zukunft unserer Schweiz im Auge haben.In diesem Sinne kann und muss die Nachführung die Grund-lage für weitergehende Reformen sein. Ich habe daher in derKommission stets die Auffassung vertreten, dass wir uns par-allel zur Nachführung auch fragen müssen, wo ein dringen-der Reformbedarf gegeben ist. Wir müssen die Reform-punkte aufnehmen und diesen Reformbedarf in einer oder inmehreren separaten Vorlagen weiterverfolgen. Der Bundes-rat hat die Verfassungsnachführung durch die separaten Re-formprojekte «Reform der Justiz» und «Reform der Volks-rechte» ergänzt.Ein drittes – meines Erachtens ebenso dringendes und wich-tiges – Reformpaket ist jedoch die Staatsleitungsreform.Denn wir sehen heute: Unser politisches System kann mitdem Tempo, welches uns heute vor allem die Wirtschaft vor-gibt, nicht mithalten. Die aktive Rolle der Politik ist überall zu-rückgedrängt. Sie kann nur noch versuchen, Auswüchse zuverhindern und Finanzlöcher zu stopfen. Ich bin überzeugt:Auch in der Politik und in unseren Institutionen wird es nichtohne Umbau gehen. Ein Hauptanliegen der gesamten Ver-fassungsreform muss daher das Fortbestehen unserer de-mokratischen Schweiz auch im nächsten Jahrhundert sein.Wir müssen den Mut haben, nicht nur zurück-, sondern auchin die Zukunft zu schauen, sonst geht es uns wie dem vonProfessor Peter von Matt am letzten Samstag beim Gedenk-akt in Aarau so treffend geschilderten «Stiefelreiter», derdurch die Nacht rast, seinen Kopf nicht mehr nach vorne dre-hen kann, nur seine Vergangenheit sieht und nicht begreift,was er damit anfangen soll.Noch ein Letztes: Ich bin mir bewusst, dass eine Verfas-sungsrevision nicht zuoberst auf der Prioritätenliste derStammtischgespräche steht. Der Ruf nach der Volkswahldes Bundesrates oder der verfehlte erste Platz beim Parla-mentarier-Skirennen liefern eher Schlagzeilen. Daher istauch der Einwand verständlich, dass wir in der Schweiz Ge-scheiteres zu tun und dringendere Aufgaben zu erledigenhätten, als die Verfassung zu revidieren.Es ist unbestritten: Die Schweiz steht heute vor grossen po-litischen Herausforderungen, wie die Bekämpfung der Ar-beitslosigkeit, die Sanierung der Bundesfinanzen, die Siche-rung der Sozialwerke usw. Macht es da Sinn, gleichzeitigeine Verfassungsreform anzugehen? Auf diese Frage dürfenwir unseren Bürgerinnen und Bürgern klar antworten: Keinesder genannten brennenden Probleme würde schneller undbesser gelöst werden, wenn wir auf die Verfassungsrevisionverzichten würden. Im Gegenteil: Die Realisierung der Ver-fassungsreform verbessert die rechtlichen und politischenVoraussetzungen für die Lösung dieser Fragen. Der StaatSchweiz braucht Institutionen und Strukturen, die ihm auch inZukunft erlauben, die ihm übertragenen Aufgaben sachge-recht zu erfüllen. Wenn es uns mit der Verfassungsreform ge-lingt, den Staat handlungsfähiger zu machen und damitneues Vertrauen in unseren Staat zu wecken, helfen wirauch, die zentralen politischen Sachfragen zu lösen.In diesem Sinne bin ich für Eintreten.
Forster Erika (R, SG): Wir stehen heute vor dem Resultat ei-nes langdauernden Prozesses. Gemessen an den vor Jah-
19. Januar 1998 S 9 Bundesverfassung. Reform
Amtliches Bulletin der Bundesversammlung / Separatdruck
ren gehegten Erwartungen ist die heute zur Diskussion ste-hende Totalrevision für viele Bürgerinnen und Bürger enttäu-schend. Die Zeit der grossen Würfe sei vorbei, hören wir seitmehr als zehn Jahren. Ob diese Erkenntnis resignativ oderweise ist, werden nicht zuletzt die Nachführung der Verfas-sung und die Behandlung der beiden bereitliegenden Re-formpakete zeigen.Dass wir heute, im Jubiläumsjahr 1998, überhaupt eine nach-geführte Verfassung beraten können – wir haben es schonmehrmals gehört –, verdanken wir der ehemaligen Stände-ratspräsidentin Josi Meier. Sie hat mit ihrer Motion 1993Druck gemacht, damit die ob der EWR-Arbeiten ruhendeVerfassungsnachführung rechtzeitig für das Jubiläum vorlie-gen würde. Der darin liegende Symbolgehalt sollte nicht un-beachtet bleiben. Die Referenz zu 1848 sollte zeigen, dasswir uns vom Mut jener Jahre wieder anstecken lassen sollten.Die 1987 beschlossene Nachführung, die heute vor uns liegt,fällt in ein völlig verändertes Umfeld: Damals herrschte nochHochkonjunktur und die weitverbreitete überhebliche Ein-schätzung, man müsse nur europakompatibel werden, umnicht beitreten zu müssen. Heute stehen wir nach siebenJahren Rezession mit einer Arbeitslosigkeit da, die weit überdas hinausgeht, was wir uns je ausdenken mochten. Mehrnoch: Wir müssen nüchtern erkennen, dass ein Staat, der indieser Form allein bleiben will, eben auch einsam ist und da-mit zu kämpfen hat, dass das Verständnis für seine Problemeund Sorgen abnimmt.Wie soll es in und mit diesem Land weitergehen? Die konse-quente Liberalisierung der Märkte, die nötigen Reformen imSteuerrecht und bei den Sozialversicherungen, die Finanzie-rung der Sozialversicherungen, die aussenwirtschaftlicheund aussenpolitische Positionierung – das sind die Fragen,die uns Parlamentarierinnen und Parlamentarier umtreibenund umtreiben müssen. Unsere Bürgerinnen und Bürger le-ben 1998 – 150 Jahre nach der Gründung des Verfassungs-staates – in einer grossen Verunsicherung. Neben der sehrdirekten Frage, wann und ob die vielen Stellensuchendenwieder eine Erwerbsarbeit finden werden, stellt sich dieFrage nach der Identität der Schweiz.Auf viele der Fragen, auf die drängenden Fragen – da gebeich den Kritikern recht – gibt die Nachführung keine direkteAntwort. Weil wir uns seit dem Beginn der achtziger Jahre nurnoch zaghafte Würfe zutrauen, stehen wir vor einem eigent-lichen Reformstau, vor der Notwendigkeit einer Erneuerungunseres Staates – ich möchte sagen – an «Haupt und Glie-dern». Die Politik der kleinen Schritte war zwar erfolgreich, inder heutigen Zeit reicht sie aber nicht mehr und hat meinesErachtens ausgedient.Die Bevölkerung hat also andere Sorgen. Deswegen auf dieNachführung zu verzichten, wie mancherorts gefordert wird,wäre aber grundfalsch. Ich gehe mit Herrn Bundesrat Kollereinig: Wir dürfen nicht dem Druck der Strasse – oder in unse-rem Falle wohl eher der Wirtschaft und vieler Wirtschaftsfüh-rer – erliegen und das eine gegen das andere auszuspielen.Wir müssen beides tun, und entsprechend sind wir – Bundes-rat, Parlament und Bevölkerung – auch gefordert.Durch die Realisierung der Verfassungsreform erhalten wirwieder klare Spielregeln, die es erlauben, unser Zusammen-leben, unser gesellschaftliches Miteinander klar zu definie-ren. Beides in Angriff nehmen heisst aber auch, sich nicht nurhier und jetzt – gewissermassen im Spiegel der Öffentlich-keit – für das Unterfangen einzusetzen, sondern auch dann,wenn es um die Knochenarbeit an der Front geht, denn sonstleisten wir der Sache einen Bärendienst. Insgesamt bietetdiese Verfassungsnachführung also Gelegenheit, in vielenPunkten Transparenz zu schaffen und sich durch die inten-sive Auseinandersetzung mit den Grundwerten dieses Staa-tes wieder einmal bewusst zu machen, welches die wirkli-chen Staatsziele sind. Manchmal habe ich den Eindruck,dass wir diese ob der alltäglichen Detaildiskussion und dernagenden Sorgen um unseren Finanzhaushalt vergessen.Dies bewusst werden zu lassen gehört zu den besonderenQualitäten der Nachführung.Eines noch ist mir aber ein immenses Anliegen – da gehe ichmit meinem Vorredner einig –: dass wir nun mit Hochdruck
hinter die Reformpakete gehen. Dringend und zwingend istdie Volksdiskussion um unsere Volksrechte sowie die Staats-leitungsreform. Unser staatliches Instrumentarium und un-sere staatlichen Strukturen sind veraltet und überfordert. DieStellung des Bundespräsidenten, die Anzahl der Bundesräte,das Zusammenspiel von Exekutive und Legislative und vieleandere Diskussionsthemen müssten endlich ausdiskutiertwerden. Wir sind dringend gefordert, uns darüber Gedankenzu machen, welche Strukturen unsere Landesführungbraucht, um den Anforderungen unserer Zeit gerecht werdenzu können.In diesem Sinn bin ich für Eintreten.
Reimann Maximilian (V, AG): Auch aus meiner Sicht – sie istmit der meiner Fraktion und Partei weitgehend identisch – istes richtig, dass man die Bundesverfassung einer aktuellenPrüfung unterzieht und nach Verbesserungen sucht. Es istrichtig, dass man die Verfassung nachführt, sie in eine Form,Systematik und Sprache überträgt, die der heutigen Zeit an-gepasst sind, so dass sie von der Bevölkerung wieder gele-sen und verstanden wird. Es ist richtig, dass man das Systemunserer Volksrechte auf seine Tauglichkeit in einer moder-nen Gesellschaft hin grundsätzlich überprüft. Ebenfalls rich-tig ist es, dass man nach Mitteln und Wegen sucht, um diechronisch überlastete und stets aufwendigere Gerichtsbar-keit auf Bundesebene zu straffen, zu modernisieren und, fallszweckmässig, noch vermehrt zu zentralisieren.In diesem Sinne treten meine Fraktion und ich auf das Ge-samtpaket der Reform grundsätzlich ein.Erstaunt bin ich höchstens über jene von gewissen Kreisenimmer wieder geschürte Meinung, die SVP als Partei derkonservativen Werterhaltung könne an einer neuen Verfas-sung doch kein Interesse haben, «Rückständige» wolltendoch bewahren und nicht erneuern. Wenn die SVP in unse-rem Land gelegentlich nein sagt und damit häufig auch dieMehrheit des Souveräns hinter sich weiss, ist das doch nichtmit einer Verweigerung des Modernen gleichzusetzen. JedesFortbewegungsmittel ist schliesslich mit einer Bremse verse-hen, und diese soll und muss dann gezogen werden, wenndem Fahrer und seinen Begleitern Unheil droht. Oder mussich an das nun wieder überall aufgetauchte Bild der Titanicerinnern? Dort wären ein Produkt der Supermoderne und mitihm 1500 Passagiere nicht dem Untergang geweiht gewe-sen, hätten die Verantwortlichen auf der Brücke bewährteKurse nicht verlassen und Warnrufe nicht förmlich in denWind geschlagen.Damit wieder zurück zu unserem Modernisierungsprodukt,der Verfassungsreform. Ich habe gesagt, wir seien für Eintre-ten, wir seien für zeitgemässe und notwendige Verbesserun-gen, aber – ich sage dies ohne jegliches Pathos – ohne futu-ristische Euphorie, sondern in moderater Sachlichkeit.Warum diese Zurückhaltung? Nüchterne Sachlichkeit ist des-halb am Platz, weil diese Verfassungsreform an sich keindringliches Geschäft darstellt; abgesehen vom Entwurf C,den man aber geradesogut in Form einer Partialreform hätteanpacken können. Wir haben derzeit in unserem Staat an-dere, viel wichtigere Probleme zu lösen, als die Verfassungnachzuführen. Der Hinweis, wir befänden uns in einem Jubi-läumsjahr, ist kein zwingender Grund, um dem Schweizer-volk quasi mit dem Brecheisen heuer noch eine Verfassungzur Abstimmung vorzulegen!Die Mitglieder der Verfassungskommission waren letztesJahr – Sie haben es eben von unserem Kommissionspräsi-denten gehört – zu rund 30 Sitzungstagen aufgerufen. In un-serem Rat gehörte fast die Hälfte des Plenums zu dieserKommission.Hätten wir uns doch nur mit gleichem Elan und mit einer ähn-lich geballten Ladung an Sitzungsaufwand an die Sanierungder Bundesfinanzen gemacht! Dort orte ich den grösstenHandlungsbedarf für unser Parlament. Die Defizitwirtschaftund die Überschuldung unseres Staates sind zur schwerstenHypothek unseres Landes geworden. Was wir den künftigenGenerationen an Schuldenbergen hinterlassen – beim or-dentlichen Haushalt, bei den Bundesbahnen, bei den Sozial-versicherungen, bei der Pensionskasse des Bundes usw. –,
Constitution fédérale. Réforme 10 E 19 janvier 1998
Bulletin officiel de l’Assemblée fédérale / Tiré à part
ist meines Erachtens schlicht und einfach unverantwortlich!Hier haben wir förmlich vergessen – um unseren Bundesprä-sidenten zu zitieren –, an unsere Kinder und Kindeskinder zudenken. Aber wir hatten ja keine Zeit für eine vertiefte Sanie-rungsarbeit. Wir waren mit anderem beschäftigt.Das zweite dominierende Problem und ebenfalls eineschwere Hypothek für unser Land und seine Bewohner ist dieArbeitslosigkeit. Mit einer konsequenten Reform der wirt-schaftspolitischen Rahmenbedingungen hätten wir es in derHand gehabt, auf parlamentarischer Ebene wirksam Gegen-steuer zu geben. Der Erfolg wäre natürlich nicht sofort einge-treten; Wirtschaftsprogramme zeitigen bekanntlich erst mit-telfristig Wirkung, dafür nachhaltig und auf Dauer. Aber wirhatten keine Zeit dazu. Wir waren ja von der Verfassungsre-form absorbiert.Die Liste der dringlich anzupackenden Probleme liesse sichnoch um einiges verlängern. Ich denke an die organisierteKriminalität, an den markanten Aufschwung des Kriminaltou-rismus, an die unheilvolle Wende im Asylwesen, an die unge-lösten Fragen im öffentlichen Verkehr, im Transitverkehrusw. Wenn schon Sondersessionen, dann – meine ich – hät-ten wir uns vielmehr dieser Probleme annehmen sollen. DieVerfassungsreform hätte ruhig noch etwas hintanstehen kön-nen. Wenn zu den 33 Jahren, während denen dieses Themamehr oder weniger häufig auf der Traktandenliste der eidge-nössischen Räte figurierte, noch fünf Jahre hinzugekommenwären, wäre das wohl problemlos zu verkraften gewesen.Haben Sie Verständnis dafür, dass ich mit meinem Eintre-tensvotum nicht in das Hohelied der modernen und postmo-dernen Verfassungsreformatoren eingestimmt habe! DieseWorte der sachlichen Nüchternheit waren nötig. Es darf nichtsein, dass mit dieser Reform unserem zunehmend verunsi-cherten Volk Sand in die Augen gestreut wird. Mit der Nach-führung der Verfassung, in die wir bereits enorm viel Zeit undAufwand investiert haben, haben wir kein einziges der anste-henden dringlichen Gegenwartsprobleme gelöst.Ich zitiere noch einmal Herrn Bundespräsident Cotti, der zu-vor im Nationalratssaal vor der Bundesversammlung seinerMeinung Ausdruck gegeben hat, mit einer neuen Verfassungsolle dem Schweizervolk der Glaube an die Politik zurückge-geben werden. Ich meine, dass das Schweizervolk nur dannseinen Glauben an die Politik zurückgewinnt, wenn Bundes-rat und Parlament den Beweis erbringen, dass sie in derLage und auch gewillt sind, die erwähnten fundamentalenGegenwartsprobleme zu lösen.Erledigen wir also diese Verfassungsreform, bringen wir sieschlank und effizient über die Bühne, aber machen wir unsebenso tatkräftig daran, auch für die echten Probleme unse-res Landes die richtigen Lösungen zu finden!
Frick Bruno (C, SZ): Mit drei Stichworten, die ich alle mit ei-nem Fragezeichen versehe, möchte ich mich zum Eintretenäussern: Begeisterung? Notwendigkeit? Richtiges Mass derReformen?Zur ersten Frage, zur Begeisterung: In der Tat löst diese To-talrevision wenig Begeisterungsstürme aus; das muss sieauch nicht. Wir stehen nicht am Anfang des Aufbruchs, der1965 stattgefunden hat, sondern am Ende eines Reifungs-prozesses. Wir brachen auf und begannen Anfang der sieb-ziger Jahre – viele mit der Begeisterungskraft der Pioniere –,unsere Bundesverfassung neu zu denken, sie inhaltlich neuzu fassen, viele mit dem Willen, unser Grundgesetz wesent-lich umzugestalten. Doch bald setzte der Reifungsprozessund damit auch der Ernüchterungsprozess ein; er führte1987 – vor zehn Jahren – zur Erkenntnis, dass in der Zeit derpolitischen Stabilität keine grossen inhaltlichen Verfassungs-reformen möglich sind. Allen grossen Verfassungsrevisioneninhaltlicher Art ging eine Revolution voraus. Diese findet nichtstatt.Darum hat die Bundesversammlung 1987 selber das Projektauf die inhaltliche Aufarbeitung des bisherigen Verfassungs-rechtes beschränkt. Eine derartige Totalrevision ohne inhalt-liche Umgestaltung ist beileibe kein Sensationsstoff, sie istgründliche Knochenarbeit abseits der Schlagzeilen, abseits
der Karawanen der Medien. Entsprechend ist die Totalrevi-sion kein Reisser im öffentlichen Bewusstsein, aber sie istvon grossem sachlichem Interesse vieler verantwortungsbe-wusster Bürger und Journalisten begleitet. Wir haben diesesInteresse an einer Reihe von Veranstaltungen und auch inReferaten und im Gespräch mit vielen Bürgerinnen und Bür-gern festgestellt.Die Antwort auf die Frage der Begeisterung heisst also: DieRevision ist nicht von der Hochstimmung einer Begeisterungbegleitet, aber sie hat bei uns im Parlament inzwischen dienötige Seelenwärme gefunden. Ich bin überzeugt, dass sichdiese Seelenwärme auch auf unsere Bürgerinnen und Bür-ger übertragen wird, wenn wir unsere Arbeit in gleichemSinne weiter tun. Totalrevisionen waren in der Schweizschon immer von nüchternem, nicht von begeistertem Inter-esse begleitet; das war 1848 so, das war 1874 so. Auch da-mals waren das Echo in der Öffentlichkeit und die Stimmbe-teiligung verhältnismässig bescheiden.Zur zweiten Frage der Notwendigkeit der Totalrevision: Si-cher würde die Schweiz auch ohne revidierte Verfassungweiterexistieren. Dennoch ist die Überarbeitung nötig; ichsage bewusst – auch als Antwort an Herrn Reimann –: nötig,und nicht bloss wünschbar! Die heutige Verfassung spiegelt150 Jahre gelebte Demokratie und aktives Initiativrecht wi-der. Sie spiegelt die politischen Probleme jeder Epoche wi-der, so die Nöte der Auswanderer vor hundert Jahren, so diegesellschaftliche Last des Alkoholismus in den dreissigerJahren, so auch die Sorgen um unsere Energieversorgungvon den achtziger Jahren bis heute.Entsprechend geht es bei der Totalrevision 1998/99 um vierZiele:1. Es geht darum, Klarheit zu schaffen mit Bezug darauf, wasüberhaupt Inhalt unserer Bundesverfassung ist. Ein grosserTeil des Verfassungsrechtes ist ungeschriebenes Recht odernur sinngemäss durch Auslegung festzustellen.2. Wir wollen unsere Verfassung wieder einfach und lesbargestalten; lesbar und verständlich für jede interessierte Bür-gerin, jeden interessierten Bürger und jeden interessiertenJugendlichen. Vollständig und schwer verständlich zu schrei-ben, ist die Kunst vieler Juristen. Die Regeln aber vollständigund einfach zu fassen, ist die Kunst des sorgfältigen Parla-mentes; diese wollen wir pflegen.3. Es ist zu entscheiden, welche Bestimmungen überhauptverfassungswürdig sind und welche auf Stufe Gesetz gehö-ren. Viele Bestimmungen verdienen es in der heutigen Zeit,auf Stufe Gesetz eingestuft zu werden, andere verdienen es,auf Stufe Verfassung eingestuft zu werden. Das Absinthver-bot oder die Schneeräumungsbeiträge an den Kanton Uriverdienen beispielsweise nicht mehr Verfassungsrang. Ver-fassungsrang gebührt aber dem Diskriminierungsverbot inArtikel 7 und dem Datenschutz. Solche Beispiele gibt esmehrere.4. Der entscheidende Grund für eine Totalrevision ist für michder folgende: Die neue Verfassung soll Grundlage für künftigeReformen sein. Der Bedarf an Reformen ist ausgewiesen.Der Kommissionspräsident, Herr Rhinow, hat Beispiele ge-nannt. Ich unterstreiche: Die neue Verfassung als Basis fürkünftige Reformen ist einer der Hauptgründe, die Totalrevi-sion überhaupt herbeizuführen. Denn bevor wir weitere Teil-revisionen vornehmen – sei es betreffend die Volksrechte,betreffend die Justiz oder betreffend andere Bereiche – müs-sen wir unseren «geistigen Schreibtisch» wieder aufräumen,à jour bringen.Da steht meine Meinung im Widerspruch zur Auffassung vonHerrn Reimann. Er hat gesagt, dass die Revision nicht priori-tär sei, aber er hat – dafür danke ich ihm – auch in unsererSubkommission sehr engagiert mitgearbeitet. Ich glaube,dass diese Revision als Basis für die künftigen Revisionen,für die künftigen Reformen, als Basis unseres Selbstver-ständnisses und unserer Identität absolut notwendig ist.Wohl haben wir verschiedene wichtige Aufgaben anzupak-ken, aber wir haben auch zu beweisen, dass wir fähig sind,einzelne wichtige Geschäfte parallel zu behandeln, so, wiewir es heute mit dieser Revision neben der Behandlung derüblichen Geschäfte tun wollen. Ich glaube, dass die Totalre-
19. Januar 1998 S 11 Bundesverfassung. Reform
Amtliches Bulletin der Bundesversammlung / Separatdruck
vision notwendig ist. Sie ist sogar eines der strategischen Ge-schäfte, welche die Eidgenossenschaft bewältigen muss.Zur dritten Frage, zum Mass der Revision: 1987 ist die Total-revision der Bundesverfassung auf die Aufarbeitung redu-ziert worden. Es geht um die Darstellung des heutigen Ver-fassungsrechtes in zeitgemässer, klarer Sprache; das be-deutet auch Verzicht auf inhaltliche Revisionen. Dass mandas mit dem Begriff «Nachführung» zu erklären versucht, be-dauere ich. «Nachführung» ist für mich ein unglücklicherAusdruck. Er erinnert an Buchhaltung, an kleinliche Additionund Subtraktion. Es geht aber – der Ausdruck gefällt mir bes-ser – um eine Aufarbeitung unseres Verfassungsrechtesoder um die «mise à jour».Die Verfassungskommission des Ständerates hat sich klu-gerweise recht streng an diesen Grundsatz gehalten. Wir ha-ben bei dieser Aufarbeitung auf inhaltliche Reformen verzich-tet. Aber schon die Aufgabe der Aufarbeitung ist schwieriggenug. Wenn plötzlich als Verfassungstext geschriebensteht, was alles bisher ungeschriebenes Verfassungsrechtwar, staunt man bisweilen. Es ist auch unserer Kommissionso ergangen. Die Diskussion um das Streikrecht wird nochzeigen, dass bereits die Feststellung dessen, was Verfas-sungsrecht ist, Streit und Erstaunen auslöst. Da ist eben be-reits die Kraft des bisher ungeschriebenen Verfassungsrech-tes bisweilen Revolution genug.Ich bin überzeugt, dass die Haltung, die wir in der Kommis-sion eingenommen haben, zum Erfolg führt. Die Verfas-sungskommission unseres Rates ist dem Grundsatz der in-haltlichen Aufarbeitung durchwegs treu geblieben – mit einerAusnahme: der Streichung des Bistumsartikels. Darübermüssen wir aber nochmals reden. Denn jede grössere mate-rielle Änderung vergrössert auch den Neinstimmenanteil. Esist Erfolg genug, wenn es National- und Ständerat gelingt,Volk und Ständen die Totalrevision im Sinne der Aufarbei-tung überzeugend darlegen zu können. Diese Arbeit ist auf-wendig genug.Gestatten Sie mir ein letztes Wort zum Aufwand: Kommissi-onspräsident Rhinow hat im Durchschnitt 29 Sitzungstage fürjedes Mitglied errechnet. Fast die Hälfte der Ratsmitgliederhat in der Verfassungskommission mitgearbeitet. Die Revi-sion hat in der Tat sehr viele Kräfte gebunden. Viele befürch-teten zu Beginn, es würde zuviel Energie absorbiert, die fürandere, ebenfalls notwendige Arbeiten fehlen würde. Wir ha-ben beides gemeistert, das Tagesgeschäft und die Totalrevi-sion. Aber wir haben – so stelle ich fest – die Limite unsererLeistungsfähigkeit als Milizparlament überschritten. LetztesJahr haben wir an 120 Sitzungstagen für Kommission undParlament gearbeitet – das sind meine Zahlen –; das warenzu viele Sitzungstage. Für einmal ist das im Sinne eines be-sonderen Efforts machbar, aber es kann und darf für ein Mi-lizparlament nicht die Regel sein.Wir müssen daher auch unsere Arbeit überprüfen. Die Arbeitan der Verfassungsrevision soll Anlass dazu sein.Als einmalige Parforceleistung habe ich das gerne getan, zu-mal es ja ein Jahrhundertereignis ist und ich die nächste To-talrevision kaum mehr erleben werde – jedenfalls nicht mehrin meiner Eigenschaft als Ratsmitglied.In diesem Sinne bitte ich Sie, die Revision der Bundesverfas-sung mitzutragen. Sie verdient unsere nüchterne, aber enga-gierte Unterstützung. Es ist eine unspektakuläre, aber nötigeAufgabe unseres Parlamentes, der hohe Priorität zukommt.Bleiben wir aber um jeden Preis bei der inhaltlichen Aufarbei-tung, so wie es unsere Kommission fast durchwegs getan hat.
Büttiker Rolf (R, SO): Die liberale Bundesverfassung von1848 muss erneuert werden und auch für das nächste Jahr-tausend Geltung haben. Diese zentrale Aufgabe müssen dieliberalen Kräfte in unserem Lande im Zusammenhang mit derRevision der Bundesverfassung im Jubiläumsjahr 1998 of-fensiv wahrnehmen.1. Es geht darum, die liberale Erfolgsgeschichte von 1848fortzusetzen, und es stellt sich dabei für mich die erste Frage:von der liberalen Verfassung von 1848 zur liberalen Verfas-sung von 1998? Es bestehen kaum ernsthafte Zweifel dar-über, dass die Bundesverfassung von 1848 inhaltlich sehr
eng mit dem Liberalismus verknüpft war. Die Schweiz setztesich damals mit der Verfassung in die Pole-position der libe-ralen Bewegung. Die Bundesverfassung von 1848/1874 warund ist eine überaus liberale Verfassung. Deshalb bestehtallseits Verständnis dafür, wenn die liberalen Kräfte vonheute mit Argusaugen auf die liberale Substanz der neuenBundesverfassung von 1998 achten. Eigentlich können beidieser Ausgangslage die liberalen Kräfte nur verlieren; einegewisse Angst und Besorgnis ist in unseren Kreisen nicht vonder Hand zu weisen, denn die Verfassungsreform von 1998könnte im direkten Vergleich zur Verfassung von 1848 einspürbares Minus an Liberalität aufweisen.Für mich muss deshalb die heute vorliegende Verfassungs-reform eine hohe Liberalitätsverträglichkeit aufweisen. DieMesslatte kann in bezug auf heutige moderne liberale Posi-tionen nicht hoch genug angesetzt werden, besonders wennwir die gegenwärtigen und zukünftigen Herausforderungenunseres Landes nüchtern analysieren: Sanierung der Staats-finanzen, Erhaltung und Schaffung von Arbeitsplätzen, Si-cherung des Sozialstaates, Fähigkeit der Politik, rechtzeitigangepasst und effektiv auf neue Problemsituationen zu rea-gieren, und innen- sowie vor allem aussenpolitische Hand-lungsfähigkeit der Regierung. Deshalb müssen wir mit Über-zeugung und Nachdruck fordern, dass auch die Verfassungvon 1998 liberal geprägt sein muss, wobei ohne abschlies-sende Beurteilung der Volksrechte eine Benotung aus libera-ler Sicht noch schwerfällt.Ich bitte um Entschuldigung für diese liberale Bergpredigt,Herr Bundesrat; Sie verstehen sicher, dass es uns eigentlichum den Besitzstand geht, wobei ich mir bewusst bin, dasszwischen liberalen Freisinnigen manchmal auch Unter-schiede vorhanden sind. Herrn Reimann muss ich in diesemZusammenhang sagen, dass eben der liberale Mensch auchbereit ist, sich mit den Problemen, die sich uns heute und inZukunft stellen, auseinanderzusetzen, in den Meinungswett-bewerb einzutreten und Probleme anzupacken und zu lösen.Das gilt natürlich auch für die vorliegende Verfassungsrevi-sion, wo wir meinen, dass nach 150 Jahren durchaus derZeitpunkt gekommen sei, uns mit dieser Sache auseinander-zusetzen und uns dieser Aufgabe zu stellen.2. Der Bundesstaat und die Bundesverfassung von 1848 wa-ren vor allem auch durch die Wirtschaft bestimmt. Die Grün-dung des Bundesstaates ging nicht zuletzt auf wirtschaftlicheEinsichten zurück und war eine eindrückliche Deregulie-rungsaktion, galt es doch, jahrhundertealten Zunftzwang ab-zuschaffen, 600 Münzsorten zu vereinheitlichen – der Eurolässt grüssen –, die sozialpolitisch relevante Reallastenablö-sung zu bestehen, die Post zu vereinheitlichen und Zollmau-ern abzubauen.Es war kein geringerer als der Oltener Josef Munzinger, der1847/48 im Zuge der Bundesrevision die Zolleinheitskommis-sion als Präsident massgeblich mitbestimmte und später dieEinführung der Einheitswährung Schweizerfranken federfüh-rend realisierte. In diesem Sinn und Geist begründete einermeiner Vorvorgänger, Ständerat Karl Obrecht, 1966 im Stän-derat seine Motion, die eine Totalrevision der Bundesverfas-sung verlangte. Ich frage mich heute: Warum sollte uns dies150 Jahre später in derselben Aufbruchstimmung nicht end-lich gelingen?3. Zwang zur Modernisierung des Föderalismus: Die Kirch-turmpolitik hat im Zeitalter der Globalisierung wohl endgültigausgedient. Angesichts der desolaten helvetischen Finanz-lage und der europäischen Integrationsentwicklung drängtsich aber, ob wir das wollen oder nicht, die Föderalismusdis-kussion geradezu auf. Ob wir dabei mit einer blossen Status-quo-Politik über die Runden kommen, muss heute ernsthaftbezweifelt werden. Es ist eine Tatsache, dass föderative Im-pulse auch von der EU auf die doch eher zentral organisier-ten Staaten einwirken. Kann sich die Schweiz als Nicht-EU-Mitglied, aber doch im Herzen von Europa gelegen, dieserneuen Föderalismusentwicklung in Europa entziehen?Ein Europa der Regionen gibt es in Form zahlreicher regio-naler und ungezählter kommunaler, grenzüberschreitenderPartnerschaften, die heute auch unser Land tangieren. Vorallem aber mobilisieren die Mittel des Europäischen Struktur-
Constitution fédérale. Réforme 12 E 19 janvier 1998
Bulletin officiel de l’Assemblée fédérale / Tiré à part
fonds, die in konkrete Projekte und nicht einfach in die Zen-tralkasse der Mitgliedstaaten fliessen, lokale und regionaleStellen, führen zu Kontakten Brüssels in die Regionen hineinoder aus ihnen heraus. Dies stärkt die Regionen und Kom-munen gegenüber ihren Zentralregierungen.Diese neuen Entwicklungen in Europa führen zum parado-xen Resultat, dass die Zentralisierung enumerativer Kompe-tenzen in den Organen der EU nicht nur Kompetenzen ausden regionalen Gliedern föderaler Mitgliedstaaten abzieht,sondern bis zu einem gewissen Grad auch dezentrale oderföderale Strukturen und zentrifugale Kräfte in den Mitglied-staaten fördern bzw. freisetzen kann. Es stellt sich somit füruns die zentrale Frage: Kann sich die Schweiz als Kleinstaatim Zentrum Europas der modernen Föderalismusentwick-lung innerhalb der EU entziehen? Vor allem die Kantonemüssen sehr aufpassen, dass hier in Zukunft nicht eine Ent-wicklung abläuft, die uns später vor grosse Probleme stellenkönnte. Ich meine, dass angesichts der realen Entwicklunginnerhalb der EU die Föderalismusfrage in der Verfassungvon 1998 noch eindeutig zu kurz gekommen ist.4. Nachführung gleich Zementierung heutiger Zustände.Diese vereinfachte Formel kann auch mit noch so gut ge-meinten Gegenargumenten nicht aus der Welt geschaffenwerden. Was 1998 neu wieder in die Bundesverfassung ge-schrieben wird, unterliegt automatisch einer gewissen politi-schen «Anstands-Karenzfrist». Dies wirkt vor allem dort stos-send, wo man heute schon genau ausmachen kann, dassHandlungsbedarf besteht.So ist z. B. für viele Bürgerinnen und Bürger dieses Landesnicht einsehbar, warum in Zusammenhang mit Bundesrats-wahlen partout nichts geändert wird, obwohl vor, währendund nach jeder der letzten Bundesratswahlen politischerHandlungsbedarf unbestritten angebracht war und einigeVorstösse eingereicht wurden – passiert ist indessen nichts.Bei jeder passenden und unpassenden Gelegenheit wird unsvorgehalten, dass eine Selektion von Führungskräften à laBundesratswahl einem Vergleich mit der Privatwirtschaftqualitativ nicht standhalte. Aber getreu dem Motto «Aus denAugen, aus dem Sinn» verschiebt man dieses prioritäre Pro-blem auf die kommende Staatsleitungsreform. Aber dienächste Bundesratswahl mit den gleichen Problemen kommtbestimmt vorher – sie ist bereits gekommen, und eine Volks-initiative in dieser Sache dazu. Diejenigen Kräfte, die für einekonstruktive Lösung sorgen wollen, sind bereits in die Defen-sive geraten.Zusammenfassend kann aus liberaler Sicht der nachgeführ-ten Verfassung zugestimmt werden, obwohl da und dort ei-nige Sündenfälle und Erneuerungsdefizite auszumachensind, die mit etwas mehr Mut und Zukunftsglauben noch be-hoben werden können. Allerdings ist ein abschliessendes Ur-teil insofern schwierig, als die in einer direkten Demokratiezentralen Volksrechte noch nicht zur Beschlussfassung vor-liegen, denn das Paket der Volksrechte wird am meisten Dis-kussionen und Emotionen auslösen.
Gentil Pierre-Alain (S, JU): M. Rhinow, président de la com-mission, a rappelé tout à l’heure l’origine du débat constitu-tionnel que nous ouvrons aujourd’hui: c’est le Parlement quiavait confié ce mandat de mise à jour au Conseil fédéral et àl’administration fédérale.Nous pouvons donc comprendre que le Conseil fédéral etl’administration fédérale, peut-être échaudés par d’ambitieuxprojets antérieurs, aient rempli ce mandat parlementaire demise à jour avec une certaine prudence et même une pru-dence certaine. Ainsi, cette notion de mise à jour recèle uneambiguïté que l’on ressent au travers des propos qui sont te-nus dans ce débat d’entrée en matière.En effet, pour nous parlementaires, le problème se pose entermes différents des problèmes posés au Conseil fédéral età l’administration. Depuis le dépôt de la motion qui se trouveà l’origine du débat de ce jour, beaucoup choses se sont pas-sées. Notre pays traverse actuellement une période difficile:les relations avec l’Europe, l’analyse de notre passé récent,la persistance de la récession économique, les difficultéséprouvées par le Conseil fédéral et le Parlement à conduire
efficacement la politique du pays .... Tous ces éléments fontqu’il n’est pas pensable que nos débats se déroulent sansprendre en compte cette réalité. Il n’est pas possible non plusque les deux Conseils ignorent les appels, les invitations oules injonctions de diverse nature qui nous parviennent denombreux milieux qui s’intéressent au processus de révisionconstitutionnelle.De nombreux juristes et d’éminents professeurs de droit – ily en avait au moins quatre dans notre commission, peut-êtrecinq si l’on peut prendre en compte M. Koller, conseiller fédé-ral, dans sa profession antérieure – nous ont aidés à préparercette révision et cette mise à jour. Mais, maintenant, nous ar-rivons en phase parlementaire et il importe que nos débatsprennent ou reprennent un cours politique. Que voulons-nous pour notre pays et son avenir? Quels sont les idéaux quinous animent? Quels moyens allons-nous nous donner pournous rapprocher de ces idéaux? Voilà les problèmes quinous sont posés!Car si, dans cette salle, nous menons un débat de techniquejuridique, si notre aspiration se limite à un effort rédactionnel,nous n’irons pas très loin et nous aurons au surplus beau-coup de mal à convaincre, en votation populaire, nos conci-toyennes et nos concitoyens de la nécessité de l’exercice.Une nouvelle constitution, c’est un nouveau souffle, une nou-velle manière de respirer pour le peuple qui l’adopte. Et leplus grand risque que nous prenons en ouvrant ces débatsest donc de manquer de ce souffle, de manquer de cette am-bition dont nous avons besoin pour répondre aux problèmesréels que connaît aujourd’hui notre pays.
Bloetzer Peter (C, VS): Dass die eidgenössischen Räte das150-Jahr-Jubiläum unserer Verfassung mit einer Sonderses-sion zur Reform der Bundesverfassung einleiten, scheint mirsehr wohl sinnvoll, auch wenn dies mancherorts bezweifeltwird. Freilich gibt es im Zeitalter der Globalisierung dringen-dere Probleme zu lösen als die Nachführung unserer Bun-desverfassung. Was den Bürger und die Verantwortungsträ-ger in Staat, Wirtschaft und Gesellschaft bewegt, sind etwaFragen wie diejenige der Erhaltung und Förderung des Wirt-schafts-, Forschungs- und Bildungsstandortes Schweiz, dieFrage der Sicherung unserer Sozialwerke, die Frage nachder Stärkung der staatlichen Handlungsfähigkeit (welche ge-rade in der Aussenpolitik und für einen Exportstaat wie dieSchweiz von existentieller Bedeutung ist). Dies sind einigeder Probleme, welche den Bürger und die Verantwortlichenin Staat, Wirtschaft und Gesellschaft bewegen und deren er-folgreiche Lösung für die Zukunft unseres Landes von exi-stentieller Bedeutung ist.Die Lösung dieser Probleme kann nur im Konsens und durcheine Politik erfolgen, welche im Volk abgestützt ist. DerSchlüssel zur Akzeptanz ist die Glaubwürdigkeit politischenHandelns. Glaubwürdigkeit setzt eine kohärente Politik derSolidarität voraus: weltweite Anteilnahme und Mitgestaltungnach aussen, Stärkung des Wirtschaftsstandortes Schweiz –dies ohne den regionalen Ausgleich, die Sozialpartnerschaftund die Erhaltung der Umwelt zu vernachlässigen; also einePolitik, die im Einklang mit den strukturbestimmenden unddie Identität bildenden Grundinhalten unserer Verfassungs-wirklichkeit ist: der Rechtsstaatlichkeit, der Sozialstaatlichkeitund dem Grundsatz des Föderalismus. Wir sind deshalb gutberaten, wenn wir uns bei der Lösung der politischen Aufga-ben, welche die Zukunft unseres Landes entscheidend mit-gestalten, auf die zentralen und identitätsbildenden Inhalteunserer Verfassungswirklichkeit besinnen und diese in derNachführung für uns und unsere Mitbürgerinnen und Mitbür-ger in eine verständliche, zeitgemässe Form bringen.Diese Nachführung soll dabei selber noch keine Reform sein,sondern sich an die heute gültige Verfassungswirklichkeithalten. Sie soll aber gleichzeitig Grundlage für eine schritt-weise Reform sein mit dem Ziel, unsere Verfassung mit jenenAnpassungen zu versehen, welche unser Bundesstaat ander Schwelle zum neuen Jahrhundert braucht.Für mich persönlich gilt dabei als feste Randbedingung, dassdie Volksrechte wohl verwesentlicht, nicht aber abgebautwerden dürfen und dass der Grundsatz der Bundesstaatlich-
19. Januar 1998 S 13 Bundesverfassung. Reform
Amtliches Bulletin der Bundesversammlung / Separatdruck
keit, des Föderalismus, hochzuhalten ist, wonach die Stärkeeines Landes nicht nur auf der Einigkeit, sondern auch aufder Stärke und der Eigenheit der Teile dieses Landes beruht.Zusammenfassend stelle ich fest, dass es sinnvoll ist, wennwir uns angesichts der Herausforderungen, welche sich unsan der Schwelle zum neuen Jahrhundert stellen, auf das We-sen, die Grundwerte und die Identität unseres Bundesstaatesbesinnen und dabei in diesen Akt der Besinnung unsere Mit-bürgerinnen und Mitbürger einbeziehen. Die Vorlage der Re-form der Bundesverfassung – und insbesondere die Nach-führung – bietet uns hierzu eine sehr gute Grundlage undVorarbeit, für die ich dem Bundesrat und seinen Mitarbeiterndie Anerkennung ausspreche. Dass diese Nachführungsar-beit mit dem 150-Jahr-Jubiläum der ersten Verfassung unse-res Bundesstaates zusammenfällt, finde ich eine besondersschöne Fügung.Auch ich beantrage Eintreten auf diese Vorlage.
Spoerry Vreni (R, ZH): Um ehrlich zu sein: Ich bin angesichtsder vielen aktuellen und brennenden Probleme in unseremLand recht skeptisch in die Beratungen über die neue Verfas-sung eingestiegen. Diese Aufgabe hat mich dann aber zu-nehmend fasziniert.Ich habe mich überzeugen lassen, dass eine Generalrevisionunserer Verfassung fast 125 Jahre nach der letzten Totalre-vision überflüssig (Heiterkeit) – nein, überfällig ist. Die inten-sive Diskussion um die Werte unserer Demokratie, um dasunverändert Gültige und auch um das, was revisionsbedürf-tig ist, kann im Jubiläumsjahr für unser Land ein Gewinn sein.Ich habe auch eingesehen, dass das vorgelegte Tempo rich-tig ist, obwohl damit, wie Kollege Frick das schon dargelegthat, die Belastbarkeit des Milizparlamentes an Grenzen ge-stossen ist. Aber: Ein solcher Wurf kann wohl nur gelingen,wenn man mit einem klaren Ziel vor Augen konzentriert andie Arbeit geht.Das heisst aber nicht, dass man die Bürgerinnen und Bürgermit dieser komplexen Materie überfahren darf. Die Summie-rung von Neuerungen in sensiblen Bereichen in diesem Ge-samtpaket dürfte die Mehrheitsfähigkeit dieses ohnehin nichteinfachen Vorhabens gefährden. Deshalb finde ich das Bau-kastensystem, das jetzt gewählt worden ist, gut, auch wennes bedeutet, dass das erste Paket, die sogenannte Nachfüh-rung, nicht alle Erwartungen erfüllen kann.Aber: Eine erfolgreiche Nachführung ist die notwendige Ba-sis für die weiteren wichtigen Pakete, bei denen über echteNeuerungen in den verschiedenen Bereichen eingehend dis-kutiert werden kann. Die Justizreform und die Reform derVolksrechte, aber auch die Staatsleitungsreform sind geeig-net und nötig, um unser grundsätzlich bewährtes System fürdie Herausforderungen des nächsten Jahrhunderts zu rü-sten. Wie das Endresultat in diesen einzelnen Paketen aus-sehen wird, ist zurzeit offen. Erst wenn dieses Endresultatbekannt ist, wird man entscheiden können, ob es die eigenenAnforderungen an eine neue Verfassung erfüllt oder nicht.Für mich ist klar, dass die neue Verfassung verständlicherund transparenter werden muss; sie muss die Reaktionszei-ten unseres Systems verkürzen und eine bessere Überein-stimmung zwischen unseren international eingegangenenVerpflichtungen und unseren internen Volksentscheidenbringen.Die Nachführung allein – das ist hier mehrfach ausgeführtworden – kann diese Zielsetzung noch nicht erreichen, abersie legt wie gesagt die Basis dafür. Wir streichen überholteBestimmungen aus der geltenden Verfassung. Sowohl derVerfassungsartikel über den Geschäftsbetrieb von Auswan-derungsagenturen als auch das Verbot der Erhebung vonBrauteinzugsgebühren haben in der heutigen Zeit in unsererVerfassung keinen Platz mehr. Das alles steht aber nochdarin, obwohl es von den wenigsten Menschen in unseremLand überhaupt zur Kenntnis genommen wird.Wir entlasten auch bereits im Nachführungspaket den Ab-stimmungskalender von Vorlagen, bei denen die meisten Bür-gerinnen und Bürger wohl der Ansicht sind, dass sie dazu ihreStimme nicht zwingend abgeben müssen, Stichwort Kantons-wechsel von Vellerat. Bei umstrittenen Bestimmungen müs-
sen wir uns aber an die Nachführung halten oder dann allen-falls dem Souverän das Neue als eine Variante unterbreiten.Zusammenfassend nochmals: Ich wünsche und hoffe, dassder Prozess der Erneuerung unserer Verfassung für unserdoch recht durchgeschütteltes Land zum Gewinn wird. In die-sem Sinne bin auch ich für Eintreten.
Respini Renzo (C, TI): La situation politique actuelle, la pres-sion, l’attente et les espoirs de l’opinion publique à l’égard dunouveau texte constitutionnel sont loin d’être comparables àla situation tout à fait exceptionnelle de 1848 où une vigou-reuse force populaire a engendré la constitution qui a jeté lesbases d’une Suisse en tant que véritable Etat fédéral. Cetteconstitution a donné à l’Etat fédéral les attributs de la souve-raineté et a laissé subsister la souveraineté des cantons enleur donnant une autonomie qui s’inscrit dans le cadre de laConstitution fédérale.Depuis 1848, la constitution en vigueur a permis et favorisédans notre pays la naissance et le développement progressifde la liberté, des droits démocratiques des citoyens, des pou-voirs de l’Etat qui ont été définis aussi bien aux niveaux légis-latif qu’exécutif et judiciaire, du système social et de l’espritde tolérance, vertu intrinsèque à notre système politique.Une telle situation exceptionnelle n’existe pas aujourd’hui. Ilfaut dire aussi qu’il n’existe pas une irrésistible pression po-pulaire postulant une nouvelle constitution. Nous devons te-nir compte de cet état de fait. En particulier, ceux qui criti-quent le projet du Conseil fédéral et de la commission en leconsidérant comme trop timide et trop peu innovateur doiventtenir compte du fait que, pour des propositions constitution-nelles plus marquantes, la forte et irrésistible demande dupeuple manque, la pression du peuple manque. Ceux quiprennent de telles positions critiques doivent tenir compteque, pour des réformes plus précises et plus ponctuelles, cene sont pas les idées qui manquent, mais le consensus; legrand et important consensus dont on ne peut se passerquand on parle de la «magna charta» d’un pays.Pour nous, ce qui est déterminant pour l’adhésion au projetdu Conseil fédéral et aux propositions des commissions, cesont les facteurs suivants:1. Notre constitution actuelle ne contient pas tout notre droitconstitutionnel. Il y a des principes de droit constitutionnel quirésultent de la jurisprudence, notamment de celle du Tribunalfédéral.2. Le texte actuel de la constitution représente aujourd’hui unensemble disparate de normes difficilement compréhensi-bles. La mise à jour a été conçue et écrite pour corriger cettesituation, pour créer un texte complet, clair, organique, logi-que; un texte susceptible de représenter la base pour deschangements futurs. On ne peut écrire une constitution avecune main tremblante. Le Conseil fédéral et la commissionn’ont pas écrit ce projet d’une main tremblante parce quel’objectif est clair, précis et atteignable. Le projet qui nous estsoumis a le courage de renoncer aux desseins dangereuse-ment ambitieux. La main qui a écrit ce texte n’est pas trem-blante: elle sait simplement ce qu’elle veut.Il ne faut pas croire que ce souci d’élaborer un texte organi-que et logique ne soit pas partagé, et qu’une telle exigencene soit pas considérée avec attention par notre population.Samedi passé, j’ai rencontré dans le Val Lavizzara, au norddu Val Maggia, un paysan qui a voulu être renseigné au su-jet de la nouvelle Constitution fédérale. Il m’a dit – ce qui estdéjà remarquable: «Le texte actuel de la constitution est illisi-ble et confus. Pour moi, il est nécessaire de le réécrire.» Il aajouté – ce qui est encore plus remarquable: «Si on veutfaire des réformes plus importantes, on ne peut s’inspirer dutexte actuel. Il faut un texte plus moderne.» Ce vieux paysan,même s’il habite dans une vallée où la tradition voulait qu’ilfallait apprendre par coeur les articles de loi pour être en me-sure de défendre ses propres droits, n’a certainement pas lules 600 pages du message du Conseil fédéral. S’il en a saisila synthèse, c’est tout simplement parce qu’il s’est donné lapeine de lire la constitution actuelle ou, probablement, quel-ques articles, et d’en tirer la seule conclusion logique possi-ble. Avec la sagesse populaire – qu’il ne faut pas toujours
Constitution fédérale. Réforme 14 E 19 janvier 1998
Bulletin officiel de l’Assemblée fédérale / Tiré à part
chercher chez les juristes –, il a compris qu’il faut d’autreschangements pour notre pays, qui impliquent de nouvellesnormes constitutionnelles.C’est aussi la raison de notre adhésion à ce projet. C’est unpas en direction d’un texte plus complet, plus clair, politique-ment et juridiquement plus sûr. C’est une étape indispensa-ble pour un futur projet plus ambitieux que nous devons abor-der le plus tôt possible: la réforme du Gouvernement men-tionnée plusieurs fois, les nouvelles formes de solidarité àl’intérieur de nos frontières, les rapports avec l’extérieur, l’in-dépendance de l’Etat, l’homme et la société du XXIe siècle.
Aeby Pierre (S, FR): Dans ce débat d’entrée en matière dehaute tenue, je ne peux laisser passer les propos deM. Cavadini sans apporter à tout le moins quelques nuancesà ce qu’il a dit tout en admettant, en ce qui concerne la languefrançaise, que les principes qu’il a évoqués sont en trèsgrande partie tout à fait justes. Mais il ne s’agit pas ici qued’une question de rédaction! Il s’agit d’un débat de fond surla façon dont la langue constitutionnelle française traite lesfemmes. Au-delà de l’expression, il s’agit de la place desfemmes dans la société, dans nos lois et, a fortiori, dans no-tre constitution.Il n’y aura pas de guerre des sexes dans notre Conseil. Ceserait faire preuve d’aveuglement de ne pas voir qu’une ma-jorité de femmes de langue française se sentent aujourd’huiblessées qu’en 1998, on ne trouve pas une solution accepta-ble, d’un point de vue linguistique, qui puisse leur donner – àtout le moins en partie – satisfaction.Il est trop tôt aujourd’hui pour entrer dans ce débat, mais ilaura lieu. Il devra avoir lieu avant la fin de nos délibérations.Je suis convaincu que nous trouverons une solution accepta-ble, évitant à la fois tout féminisme exacerbé et aussi un cer-tain formalisme, parfois sexiste, inspiré des membres, ou deleur majorité en tout cas, de l’Académie française.La discussion n’est pas épuisée. Les femmes suisses méri-tent mieux dans notre constitution qu’un astérisque en bas depage. Le terme de «personne» nous aide aujourd’hui déjàdans la formulation des articles tels qu’ils ressortent des tra-vaux de la Commission de la révision constitutionnelle. Quel-ques répétitions ne nuisent pas non plus à l’élégance. «Ci-toyennes et citoyens», il s’agit là d’une expression qui fleurebon la république, ce qui n’est pas pour déplaire à plusieursd’entre nous, etc. Ce n’est pas le lieu de faire un débat lin-guistique maintenant.Examinons ces articles, adoptons-les, mais gardons uneplace avant la fin de cette année et de nos débats pour quela femme soit traitée de la manière qu’elle mérite dans la lan-gue française, dans la charte fondamentale de notre Etat.
Schmid Carlo (C, AI): Ich möchte dem Bundesrat und dervorberatenden Kommission die Anerkennung dafür ausspre-chen, mit diesem Verfassungsentwurf uns ziemlich sicherdas heute Durchsetzbare, das politisch Machbare vorgelegtzu haben. Insoweit scheint mir diese Arbeit eine verdienst-volle zu sein – und trotzdem kommt bei mir keine Freude auf.Ich werde selbstverständlich, namentlich auch deswegen,weil der federführende Departementschef aus meinem Kan-ton kommt, keinen Nichteintretensantrag stellen. Dies viel-leicht auch, um die auf der Tribüne anwesende Motionärin,unsere alt Ständeratspräsidentin Josi Meier, die ja die Nach-führung Anfang der neunziger Jahre mit einer Motion ver-langt hat, nicht zu erzürnen und zu vergrämen.Aber ich will kurz sagen, warum ich nicht begeistert bin. Voneiner Nachführung bin ich nicht begeistert, das darf ich nach-her noch ein wenig ausführlicher erörtern. Dort, wo es ummaterielle Änderungen geht – also bei den Varianten –, gehtmir diese Verfassungsrevision zum Teil zu weit, nämlichbeim Verfassungsgericht, und zum Teil zu wenig weit, näm-lich bei den Volksrechten. Aber ich möchte Ihnen die Gründesagen, warum mich diese Nachführung nicht überzeugt. ImRahmen der Vernehmlassung ist den kantonalen Regierun-gen die Frage gestellt worden: «Erachten Sie grundsätzlicheine Verfassungsreform als notwendig?» Ich bin überzeugt,dass die Bundesverfassung dem Souverän immer wieder re-
visionsbedürftig erscheint. Die grosse Zahl von Partialrevisio-nen macht dies ja deutlich. Das bedeutet nach meiner Auffas-sung indessen nicht, dass die Bundesverfassung im gegen-wärtigen Zeitpunkt materiell oder formell totalrevisionsbe-dürftig wäre.Es wird vom Bundesrat und auch von der Kommission darge-legt, die Bundesverfassung sei 136 mal geändert worden,das habe sie zu einem verschlüsselten, unlesbaren Flickwerkund zu einem Dickicht von wichtigen und unwichtigen Vor-schriften werden lassen. Dagegen kann eingewendet wer-den, dass in unserem schweizerischen Verfassungssystemjede Verfassung innert kurzer Zeit wieder Flickwerk wird. Siewird auch nach dieser formellen Revision bald wieder einFlickwerk sein, wenn man die Volksrechte nicht vollständigumgestaltet und das Initiativrecht dem Volk vollständig weg-nimmt. Denn die Verfassung ist in der Schweiz kein in Steingehauenes, auf Ewigkeit angelegtes und zur allgemeinenVerehrung errichtetes Monument, wie die Verfassung derUSA oder das deutsche Grundgesetz. Sondern, Herr Rhinowhat es erwähnt, es ist der politische Fechtboden par ex-cellence. Wer etwas in diesem Staat ändern will, der ergreifteine Initiative, und das ist vorderhand und wird mindestenszum Teil auch in Zukunft die Verfassungsinitiative sein.Wenn das Parlament mit der Initiative nicht einverstanden ist,schlägt es oftmals eine Verfassungsänderung als Gegenvor-schlag vor. Dieser politische Kampf, diese Form der direktenDemokratie wird um die Verfassung ausgetragen. Die Ver-fassung ist somit das jeweils aktuelle Spiegelbild der politi-schen Entscheidlage in unserem Land. Das macht sie un-schön, unübersichtlich, zu einem Flickwerk; das macht sieuneinheitlich, zu einem Normendickicht von unterschiedli-cher Dichte; das macht sie aber auch wahr. Das macht sie zueiner realen Verfassung, im Gegensatz zu einer bloss se-mantischen Verfassung.Die formelle Totalrevision, mit welcher statt eines Patch-works eine schöne, einheitliche Webbahn erzeugt wird, mitwelcher das unterschiedlich dichte Normendickicht ausge-holzt und ein schöner, einheitlicher Kunstwald angelegt wird,wird nicht lange die sterile Ordentlichkeit einer neugeschaffe-nen Verfassung erhalten können, weil die Volksrechte dieseVerfassung eben innert Kürze wieder zu einem Flickwerkmachen werden.Es wird dargelegt, dass die geltende Verfassung das gel-tende Verfassungsrecht lückenhaft wiedergebe. Damitschneiden wir einen heiklen Punkt an. Es mag sich rechtfer-tigen, die Frage zu stellen, warum denn die geltende Verfas-sung das geltende Verfassungsrecht nur lückenhaft wieder-geben soll. Denn nach der geschriebenen Verfassung gibt esnur eine Instanz in diesem Lande, die befugt wäre, Verfas-sungsrecht zu geben: der Souverän, d. h. Volk und Stände.Ob es ungeschriebenes Verfassungsrecht tatsächlich gibt,wird von den Illuminaten bejaht; das Volk weiss davon rechtwenig. Immerhin scheint es auch für den Bundesrat eine An-omalie zu sein, dass es nicht demokratisch legitimiertesRichterrecht mit Verfassungsrang geben soll. Aus dem Um-stand, dass bisher ungeschriebenes nun zu geschriebenemVerfassungsrecht werden soll, ergibt sich nämlich unge-säumt die Frage, warum das passieren soll. Offenbar will derBundesrat die Anomalie normalisieren.Es erhebt sich aber auch die Frage, was denn geschieht,wenn die sogenannt nachgeführte Verfassung in der Abstim-mung abgelehnt werden sollte. Alles bislang ungeschriebeneVerfassungsrecht, das auf die Stufe des geschriebenen Ver-fassungsrechtes gehoben werden soll und abgelehnt wird:Gilt es oder gilt es nicht? Darüber äussert sich der Bundesratnicht.Es wird auch dargelegt, die Verfassung sei verschlüsselt undunlesbar geworden und müsse aus diesem Grund nachge-führt werden; Herr Respini ist darauf eingegangen. Die Ver-fassung soll in der Sprache unserer Zeit abgefasst werden,was sie nach der Auffassung des Gewährsmannes von Kol-lege Respini noch nicht ist.Es ist mehr als fraglich, ob man mit der Ausmerzung anti-quierter Formulierungen erreichen kann, dass die Verfas-sung wieder verständlicher wird und dem Volk nähergebracht
19. Januar 1998 S 15 Bundesverfassung. Reform
Amtliches Bulletin der Bundesversammlung / Separatdruck
werden kann. Diese Nachführung ist also im wesentlichennicht das Ziel. Sie wird innerhalb kurzer Zeit nach einerneuen Nachführung rufen, wenn wir nicht die Initiativrechtedes Volkes und das Recht des Bundesgerichtes, ausArtikel 4 die Schuhgrösse der Gefängniswärter abzulesen,radikal beschneiden – Meister, die Arbeit ist fertig, ich be-ginne mit Flicken.Diese Nachführungsverfassung ist aber auch hinsichtlich ih-rer Notwendigkeit zu hinterfragen. Dieser Punkt ist in derheutigen Debatte mehrmals angetönt worden.Lohnt sich eine grosse Nachführung angesichts der Pro-bleme, die wir hier und heute haben? Ich meine an sich: Nein.Aber ein Argument von Herrn Rhinow ist bedenkenswert. DieMeinung, man müsse die Grundlagen klären, um die tägli-chen politischen Probleme – Finanzprobleme, Probleme desSozialversicherungswesens, der Verkehrspolitik, der Aus-senpolitik – lösen zu können. Er hat gesagt, Umwege führtenoftmals schneller zum Ziel als der direkte Weg.Aber ich will Ihnen sagen: Wir leben mit ungeklärten Verhält-nissen in diesem Land. Eine Verfassungsdiskussion wirddiese Verhältnisse nicht klären. Eine Verfassungsdiskussionwird uns in bezug auf die Frage unseres Verhältnisses zu Eu-ropa keinen Schritt weiterbringen. Sie werden alte Frontenbestätigt sehen. Eine Verfassungsdiskussion wird uns im Be-reich des Sozialversicherungswesens überhaupt nicht wei-terhelfen. Da müssen wir in den tatsächlichen Diskussionenin den einzelnen Fragen sehr konkret um Lösungen ringen.Ich meine mit anderen Worten: So schön die Idee wäre, miteiner Verfassungsdiskussion unsere Probleme, die uns indiesem Land zum Teil zutiefst trennen, lösen zu können, sowenig glaube ich daran.Ich habe es bereits angetönt: Ich halte eine Nachführungs-verfassung für fast unmöglich. Ich meine, wir sind da in einerintellektuellen Aporie.Ich darf Ihnen das nochmals an einem praktischen Beispielerklären: Es ist fast nicht möglich, dass man nur nachführenkann. Nehmen Sie Artikel 24 Absatz 3, das Recht auf Streik.Wenn wir meinen, es bestehe heute schon ein ungeschriebe-nes Recht auf Streik – ich gehe davon aus, der Bundesratmeint das –, sind wir, wenn wir als Parlament dazu nein sa-gen und Artikel 24 Absatz 3 streichen, nicht mehr auf der Li-nie der Nachführung, sondern wir ändern geltendes, aber un-geschriebenes Verfassungsrecht. Haben aber jene recht, diebehaupten, ein solches Streikrecht gebe es noch gar nicht,dann machen Sie keine Nachführung, sondern Sie änderndie Verfassung materiell, wenn Sie dem Bundesrat recht ge-ben und Artikel 24 Absatz 3 annehmen.Die Aporie besteht darin, dass Ihnen niemand sagen kann,ob es dieses Recht gibt oder nicht. Die einen würden es be-jahen, die anderen würden es verneinen. Was wollen Sienachführen?Das sind die Bedenken, die ich Ihnen gerne vorgelegt habe,ohne sie mit einem Nichteintretensantrag abzuschliessen.
Weber Monika (U, ZH): Die Totalrevision der Bundesverfas-sung ist, so kann man es sagen, ein Zwischending zwischeneiner Reform und einem Gedenkakt zum 150. Geburtstagdes Bundesstaates. Das merkt man. Die Revision soll ja vorallem eine Nachführung sein, und die beiden Reformpaketesind deshalb bezüglich Innovation oder gar einer Vision be-scheiden. Sie nehmen aber auch kaum die zentralen Pro-bleme unserer Gesellschaft und unseres Staates auf.Nun, 150 Jahre ununterbrochene Verfassungsgeschichtesind ein Grund zum Feiern. Das soll hier nicht bestritten wer-den. Runde Geburtstage sind auch eine Gelegenheit zurück-zublicken, sich Rechenschaft zu geben, welchen Weg mangegangen ist und welchen Weg man weitergehen möchte.Dabei ist es im privaten Leben oft gar nicht einfach, die Ver-änderungen festzustellen, und im Leben der Völker ist esnicht anders. Der Wandel verläuft so kontinuierlich, dass manihn gar nicht oder nur wenig bemerkt. Ich erlaube mir des-halb, auf zwei Beispiele, die uns den Wandel quasi plastischvor Augen führen, hinzuweisen:Als sich 1847 die Krise in der Schweiz zuspitzte, meldete derbritische Gesandte in Bern nach London, der Krieg zwischen
der Tagsatzungsmehrheit und dem Sonderbund sei wohlunvermeidlich. Der britische Aussenminister Palmerstonschrieb zurück, das sei bedauerlich, da eine Intervention derGrossmächte damit wahrscheinlich werde. Es sei aber viel-leicht gar nicht schlecht, wenn sie, die Tagsatzungsmehrheit,Freiburg besetze, damit man bei den internationalen Ver-handlungen ein Faustpfand habe. Als dieser Brief wieder inBern eintraf, war der Sonderbundskrieg schon beendet. Gut,es war ein kurzer Krieg, aber es sagt auch etwas über die Ge-schwindigkeit der damaligen Kommunikation aus. Temporamutantur, würde Herr Schmid Carlo sagen!Damals war Hongkong nicht britisch, sondern es war eine un-bedeutende Insel vor der chinesischen Küste. Heute infor-miert die Schweizer Tagesschau über den aktuellen Standder Börse in Hongkong, weil das die Schweizer interessiert,die um ihre Arbeitsplätze bangen. In der Epoche der letztenTotalrevision, derjenigen von 1874, suchte der BundesratKontakt zu Japan. Das fanden die Schwyzer so komisch,dass sie daraus ein Fasnachtsspiel machten, das Japane-senspiel. Heute erfahren wir in der Tagesschau den letztenStand der Tokioter Börse, weil das die Leute hier interessiertund betrifft. Wiederum: Tempora mutantur!Nach diesen beiden Beispielen des Wandels möchte ich fol-gendes festhalten: Ja, wir haben es mit einer «Nachführung»zu tun, und trotzdem wage ich, die Frage in den Raum zustellen, ob es nicht weitblickend gewesen wäre, über eine Än-derung über ein Neuverständnis z. B. der Wirtschaftsartikelzu diskutieren. Die jetzige Revisionsvorlage ist keine Antwortauf die Entwicklung der letzten Jahrzehnte, auf das, was manGlobalisierung nennt.Wir haben ein echtes Problem. Wir sind ein sehr kleines Landmit einem entsprechend kleinen Binnenmarkt. Wir sind aberauch ein Land, das extrem stark mit der Weltwirtschaft ver-flochten ist und nur so existieren kann. Das ist ein Wider-spruch, für den Lösungen zu finden sind, innovative Lösun-gen. Was in der Nachkriegszeit auf Verfassungsebene zudiesem Bereich festgelegt wurde, nämlich die Wirtschaftsar-tikel, ist auf eine relativ abgeschlossene, relativ autarke Wirt-schaft ausgerichtet. Es ist gesammelte Weisheit der Kriegs-jahre.Wenn es ein Problem gibt, das uns heute beschäftigen muss,so ist es die Wirtschaft und damit die Arbeitsplatzfrage, undes sind die Finanzen. Hier beschränken wir uns auf die Fort-schreibung. Das ist keine adäquate Antwort auf die Heraus-forderungen, denen wir gegenüberstehen.Nun hat aber Herr Bundesrat Koller gesagt, dass diese«Nachführung» den Auftakt zu einer Reihe von materiellenReformen bilden soll. Wir ordnen das Bestehende übersicht-lich, um dann die nötigen Veränderungen besser planen zukönnen. Das bringt mich dazu, für Eintreten auf die «Nach-führung» zu votieren und auch zu stimmen, obwohl ich dieseÜbung als nicht unbedingt nötig empfinde. Aber nachdem be-reits soviel Zeit und Energie investiert worden ist – wovor ichübrigens eine grosse Achtung habe –, lohnt es sich, dieseSache sauber abzuschliessen. Wir sollten dabei nicht ver-gessen, dass wir nicht daran gemessen werden, wie wir dieVerfassung sprachlich schön gestalten, sondern daran, dasswir die Probleme unseres Landes lösen.
Danioth Hans (C, UR): Ich bejahe und begrüsse das Reform-vorhaben in der Zielrichtung und Ausgestaltung, wie es vomBundesrat konzipiert und von der Kommission mit noch kla-reren Konturen versehen worden ist. Das möchte ich unter-streichen; ich habe diesen Eindruck. Es wurde zwar dieFrage aufgeworfen, ob die Schweiz angesichts der grossenwirtschaftlichen und gesellschaftlichen Umwälzungen undder damit verbundenen Verunsicherung nicht mit einer völligneuen Verfassungsstruktur ins nächste Jahrtausend schrei-ten sollte. Professor von Matt – heute bereits von Herrn Wickierwähnt –, hat am letzten Samstag in seiner beeindrucken-den historischen Lektion für ein gerechtes Geschichtsver-ständnis darauf hingewiesen, dass vor 200 Jahren ein ei-gentlicher Ruck mit zahlreichen positiven, aber auch negati-ven Entwicklungsschüben durch das Land ging. Erst
Constitution fédérale. Réforme 16 E 19 janvier 1998
Bulletin officiel de l’Assemblée fédérale / Tiré à part
50 Jahre später, 1848, kam es dann zur neuen Verfassungund zur Gründung des Bundesstaates.Wenn wir die heutige Verfassungsrevision nicht als blutleereJuristenoperation ansehen, sondern als Klärung der aktuel-len Grundlagen unseres staatlichen Zusammenlebens, dannbedeutet das viel mehr als bloss formale Arbeit. Wir wollendas Schweizerhaus einer Totalreinigung und -überholung un-terziehen, damit die Räume wieder bewohnbarer und über-sichtlicher werden und die Fenster wieder eine klare Sichtnach draussen ermöglichen.Insofern kann ich der Skepsis meines geschätzten KollegenCarlo Schmid nicht zustimmen. Ich glaube, die reale Verfas-sung ist nicht die klinisch reine, die semantische Verfassung.Nur die gelebte Verfassung ist die wahre Verfassung, und le-ben kann man etwas nur, wenn man das abgestorbene Bei-werk beseitigt. Nach 125 Jahren ist es nicht mehr verfrüht,eine Reinigung vorzunehmen.Im grundsätzlichen Punkt kann ich indessen Carlo Schmidzustimmen: Wir haben beispielsweise verglichen mit denUSA ein völlig anderes System. Ich verweise auf den Beitragvon Professor Wolf Linder in der «NZZ» vom vorletzten Wo-chenende unter dem Titel «Ein Vergleich zwischen den USAund der Schweiz». Er schrieb, es lasse sich sagen, dasschweizerische System sei von einer maximalen formalenOffenheit geprägt, das amerikanische System von einerüberdurchschnittlichen formalen Geschlossenheit. Währenddie amerikanische Verfassung seit ihrem Bestehen nur26 Amendements erhalten hat, sind es bei uns weit über hun-dert.In der Schweiz ist die Verfassung das Gefäss geronnener po-litischer Entscheidung. Politik ist zu einem erheblichen TeilVerfassungspolitik. Ich glaube, wenn wir dieses Verfassungs-verständnis weiterführen wollen – hier treffen wir uns –, dannmüssen wir für die Beseitigung alter und überholter Relikteeintreten, wobei ich gleich Herrn Frick antworten muss: Ichhabe kein Bedürfnis, die Schneeräumungsbeiträge an denKanton Uri zu beseitigen, diese sind nämlich bereits früherherausgenommen worden. Jetzt erhalten alle Kantone mit Al-penstrassen, also alle Alpenkantone, einen zusätzlichen Bei-trag für den gewaltigen Aufwand im Strassenunterhalt. Mankann sich durchaus fragen, ob diese Bestimmung noch ge-rechtfertigt ist. Ich meine, dass die Leistung als solche aberin einem gerechten Lasten- und Vorteilsausgleich zwischenden Kantonen – unter Einbezug der Steuergewinne attrakti-ver Kantone – Eingang finden sollte.Der geleisteten Arbeit der Kommission kommt also ein hoher,ein anregender Stellenwert zu. Nur mit einer ehrlichen Stand-ortbestimmung können wir neue Schritte vorbereiten unddann auch wagen. Im Gegensatz zu den doch etwas polemi-schen Ausführungen von Herrn Kollege Reimann an dieAdresse des Bundesrates und des Bundespräsidenten binich der Meinung, dass sich die aktuellen Fragen mit der Ver-fassungsrevision nicht lösen lassen. Die Rückbesinnung aufdie Grundsatzfragen des Zusammenlebens in diesem StaatEidgenossenschaft gibt uns aber vielleicht doch auch eineAnregung, eine Hilfe, wie wir unser Verhältnis regeln sollen.Die neue Verfassung wird nicht zum Zauberstab für die Lö-sung aktueller Fragen, aber sie wird zu einer hilfreichenRichtschnur dafür, wie wir diese Aufgaben angehen sollen.Noch etwas Zweites, auf das bisher noch nicht hingewiesenworden ist: Ich durfte an der ersten Sitzung der ständerätli-chen Kommission als Stellvertreter teilnehmen. Ich war be-eindruckt. In den Eintretensreferaten wurde schon damalsimmer wieder die Integrationsfunktion der Verfassung undder Verfassungsüberarbeitung hervorgehoben. Also: DerWeg ist das Ziel. Gerade aus diesem Grund hätte ich einestärkere Betonung der Einheit des Landes begrüsst; nicht zu-letzt auch in der Präambel. Ich habe Anregungen gemacht,die dann nicht aufgenommen worden sind. Ich meine: DieVielfalt unseres Landes kann sich nur dann entfalten, wennsie sich der Einheit unterordnet.Noch etwas: Wenn das angebrochene Jubiläumsjahr 1998unser Zusammengehörigkeitsbewusstsein stärken soll,muss dies auch und gerade in der Verfassungsrevision zumAusdruck kommen. Auffallend ist – es ist jedenfalls mir auf-
gefallen –, dass der Verfassungsentwurf eine rekordverdäch-tige Auflistung von Grundrechten, Bürgerrechten und Sozial-zielen enthält. Die Verfassung darf aber nicht zum Auswahl-katalog verkommen, woraus jeder und jede das bestellenkann, was er bzw. sie will – wenn möglich zum Nulltarif.Gerade die beeindruckende Liste derartiger Rechte machtdas Fehlen eines Äquivalentes in Form einer Verpflichtungder Bürger gegenüber diesem Staat deutlich. Gibt es in unse-rem Versorgungsstaat keine Grundpflichten? Eine Eidgenos-senschaft ist auf die Dauer nur überlebensfähig, wenn das In-dividuelle, wenn das Separierende, wenn das Fordernde,wenn – um es neudeutsch zu sagen – die Selbstverwirkli-chung einen gerechten Ausgleich und eine Begrenzung fin-den, und zwar darin, dass jeder und jede einen Beitrag andiese Gemeinschaft leistet, der nicht einfach aus Geld beste-hen soll und kann.In einer Zeit, da sich jeder das Maximum an Rechten heraus-nimmt und sich mit einem Minimum von Leistungen an denStaat begnügt, müssen wieder vermehrt das gemeinsamVerpflichtende und die Eigenverantwortung hervorgehobenund muss der Bürgersinn eines Gottfried Kellers und andererDenker und Staatsmänner vergangener Tage zum Tragenkommen.Aus diesem Grund habe ich einen entsprechenden Antragbezüglich Bürgerpflichten eingereicht, dessen wohlwollendeAufnahme ich Ihnen bereits heute empfehle.
Iten Andreas (R, ZG): Ich kann mit meinem Votum nahtlos andie Ausführungen von Herrn Danioth anschliessen und diesenoch etwas weiterführen.Mich beschäftigt bei dieser Verfassungsdiskussion dasSpannungsfeld zwischen Politik und Gesellschaft, zwischenStaat und Wirtschaft. Ich stelle fest, dass die Kommissioneine grosse und gute Arbeit geleistet hat, die aber bereits Ge-genstand kleinlicher Kritik ist. Das ist ein Zeichen dafür, dasses in unserer Gesellschaft an einem Konsens bezüglich dergrundlegenden Werte fehlt und dieser nur schwer zu errei-chen sein wird. Ein gewisser Grundkonsens, was die Werteeiner Gesellschaft anbelangt, müsste vorhanden sein, damitein solches Reformprojekt gelingen könnte. Die Hoffnung,dieser Konsens werde durch die Verfassungsdiskussion imVolk zustande kommen, ist trügerisch. Die auseinanderstre-benden gesellschaftlichen Kräfte haben zu viele Akteure undInteressenvertreter, die sich in der Rolle, Dissens zu stiften,gefallen. Das wird eine à jour gebrachte Verfassung nicht än-dern. Ein Dialog kommt kaum zustande.Man liest ja schon jetzt, die Vorlage sei weder notwendignoch dringlich; das wurde heute einige Male in diesem Saalgesagt. Die voreilige Kritik demonstriert das sinkende Ver-trauen in die Politik. Dieses Vertrauen wird auch von Politi-kern selbst systematisch untergraben, indem sie die «classepolitique» abqualifizieren. Eine auf die Spielregeln des Miss-trauens geschrumpfte Gesellschaft büsst zwangsläufig ihreVitalität ein und verliert ihre Handlungsfähigkeit.Wenn nur schon das Auftauchen des Begriffs der Nachhaltig-keit in der Verfassung die Kritiker in helle Aufregung versetzt,dann ist das kein gutes Omen. Es sei ein Modewort, das nichtin die Verfassung gehöre, der Begriff sei schwammig undlasse Schlimmes befürchten. Dabei ist dieser Begriff geklärt:Die wirtschaftliche, soziale und ökologische Nachhaltigkeitzählt zu den grossen Herausforderungen unserer Zeit.Der Vorwurf, die Nachhaltigkeit sei ein Modebegriff, demon-striert, wie sehr kurzfristige, vom Markt diktierte Interessendie politische Diskussion beherrschen oder zu beherrschenversuchen. Eine Verfassung hat sich nicht am kurzatmigenMarkt- und Kapitalinteresse zu orientieren, sie strebt einenlangfristigen Ausgleich zwischen wirtschaftlichen, sozialenund ökologischen Zielen an. Sie muss eine Wertordnung eta-blieren, mit der sich die meisten Bürgerinnen und Bürgeridentifizieren können, nicht nur diejenigen, die aus der Frei-heit Profit ziehen.Es ist ja nicht so, dass es in allen Bereichen der Gesellschaftan Persönlichkeiten fehlt, die sich an übergeordneten, ge-meinschaftsbildenden Wertvorstellungen orientieren, anWerten, die nicht vom Markt diktiert sind, die vielmehr die
19. Januar 1998 S 17 Bundesverfassung. Reform
Amtliches Bulletin der Bundesversammlung / Separatdruck
menschliche Freiheit und Solidarität zum Ausdruck bringen.Genau hier setzt die echte politische Debatte ein. Diese vor-ausschauenden Persönlichkeiten erkennen, dass eine Frag-mentierung der Gesellschaft und ein Zurückdrängen des Wil-lens zur politischen Zukunftsgestaltung verheerend wären.Die zentrale Frage beim Übergang in ein neues Jahrtausendbetrifft die Sicherstellung einer nachhaltigen Entwicklung undden Auftrag an die Politik, die geeignete Austarierung desSpannungsverhältnisses zwischen Wirtschaft, sozialen An-forderungen und Umwelt zu schaffen. In der Herstellung ei-ner Gleichgewichtslage besteht der wesentliche Auftrag derPolitik.Im Augenblick aber befinden wir uns in einer gegenläufigenBewegung. Die Spannungen nehmen zu, es sind völlig neue,unerwartete Kämpfe ausgebrochen. Auch die westliche Weltzerfällt zusehends in Reiche und Arme. Es etabliert sich einNebeneinander von hochkompetitiven Kernberufen und ei-nem immer grösser werdenden Segment von Randjobs undArbeitslosigkeit. Der globale Kapitalismus führt zu einerMachtasymmetrie zwischen Markt und Staat, Wirtschaft undPolitik. Darum stellt sich die Frage, wie diese Asymmetrieüberwunden werden kann und ob diese Verfassungsvorlagedazu einen Beitrag leistet. Es wäre interessant zu hören, wiedas Herr Bundesrat Arnold Koller beantwortet.Ich möchte vor der Illusion warnen, dass die nun in Angriff ge-nommene Verfassungsrevision am Zustand der Politik vieländert. Der liberale Staat beruht auf Werten und lebt von Vor-aussetzungen, die er nicht selber garantieren kann. Die Ver-fassung bietet also nur einen Rahmen von Wertvorstellungenund Ordnungen, ohne die ein Zusammenleben in grösserenGemeinschaften nicht möglich ist. Jedes Mitglied des Staa-tes muss aber die übergeordneten Werte der Gemeinschaftakzeptieren, auch wenn dies mit Opfern verbunden ist. DiePolitik schafft mit dieser revidierten Verfassung zwar einenerneuerten Wertekodex, der aber der Gemeinschaft nurdient, wenn er von den Individuen freiwillig angenommenwird.Nun erfährt die Vorlage schon im Vorfeld der Behandlungharsche Kritik: So wendet man sich etwa gegen Formulierun-gen der nationalrätlichen Kommission, wie z. B. Artikel 3bdes Entwurfes: «Neben der Verantwortung für sich selbstträgt jede Person im Rahmen ihrer Fähigkeiten Verantwor-tung gegenüber Mitmenschen und der Gesellschaft sowieMitverantwortung dafür, dass die Wohlfahrt gefördert werdenkann.» Solche rasch geäusserte Vorverurteilungen stimmenmich nachdenklich, hörten wir doch jahrelang – ich klopfejetzt an meine eigene Brust – einen Slogan, mit dem zwarweniger Staat, aber mehr Freiheit und Selbstverantwortungverlangt wurden.Der Appell an die Selbstverantwortung ist zumindest im gros-sen Raster des Grundgesetzes diskussionswürdig. Ich kannnicht verstehen, warum dieser moralische Appell jemandenärgert. Er kostet nichts, trifft aber genau den zentralen Punkteiner Gesellschaft, die sich in Gutsituierte und Schlechtsitu-ierte zu teilen beginnt und in der ein Appell an alle Verantwor-tungsträger dringend nötig ist. Ich will damit nur auf dieSchwierigkeiten aufmerksam machen, die der auf hohem Ni-veau diskutierten Verfassung in der Volksabstimmung entge-genstehen werden.Die Verfassungsdiskussion, das ist die Überzeugung unse-res Justizministers, dient der Identitätsbildung der Schweizund deren Zusammenhalt. Sie soll ein Fundament für die Zu-kunftgestaltung sein. Diese Hoffnungen kann ich nicht ohneweiteres teilen. Denn gerade jene Werte gehören zu den Vor-aussetzungen, die der Staat und damit auch die Verfassungnicht garantieren können. Ein Konsens über die Grundwertedes Staates muss sich in gesellschaftlichem Dialog heraus-bilden. Er hängt vom Willen der Staatsbürgerinnen undStaatsbürger ab. Carl Spitteler hat zu Beginn dieses Jahr-hunderts, als die Schweiz bedroht und in einer Krise war, dasWort von der «Willensnation» geprägt. Auf diesen Willenkommt es an. Ob die Verfassungsdiskussion diesen Willenstärkt, bleibt abzuwarten. Jedenfalls gelingt das Unterfangennicht, wenn jetzt schon überall kleinlich am Entwurf herumge-nörgelt wird.
Sorge bereiten muss uns der Zynismus in bezug auf Politikund Staat, der in den vergangenen Jahren sehr stark zuge-nommen hat. Wie – so frage ich Bundesrat und Parlament –soll es gelingen, den die neue Verfassung tragenden gutenWillen auf eine Mehrheit des Volkes zu übertragen, wenn dieNotwendigkeit und Dringlichkeit des grossen Werkes jetztschon öffentlich in Abrede gestellt werden? Es ist zu hoffen,dass die Medien diese Arbeit positiv begleiten und den Bür-gerinnen und Bürgern erklären, was auf dem Spiele steht.Es ist zwar in der Tat so, dass die Bürger dieses Landes vonanderen Sorgen als von derjenigen einer Verfassungsreformerfüllt sind. Die zunehmende Arbeitslosigkeit, der sich unge-niert ausbreitende Aktionärskapitalismus, der auf die arbei-tenden Menschen keine Rücksicht nimmt, und die sich aus-breitende Kriminalität machen ihnen mehr zu schaffen.Viele Bürger fragen sich zu Recht, was passiert, wenn derStaat immer mehr in die Defensive gedrängt wird, wenn es zueiner schleichenden Entdemokratisierung durch den Exportvon Kapital und Arbeit kommt. Dann wird das neoliberale Eu-ropa mit seinen Gewinnern, Verlierern und Überflüssigen zueinem zunehmenden Kampffeld. Das Ausmass der Illegalitätwird zunehmen. Viele Verlierende glauben, dass Staatennicht mehr fähig sind, eine gerechte und solidarische Zukunftzu gestalten. Ohne den Staat geht es aber nicht besser. DieMenschen sind auf Rechtssicherheit in allen Bereichen ihrerTätigkeit angewiesen. Private Unternehmen sind kein Staats-ersatz. Ich frage mit Eberhard Moths: «Werden sich Coca-Cola für Rechtsextremismus oder McDonald’s für die globaleFleischkontrolle zuständig fühlen?» Ich füge die Frage bei,ob sich der Aktionärskapitalismus langfristig wohlfühlenkann, wenn er sich eine private Schutztruppe gegen Krimi-nelle schaffen muss.Aufgrund der aktuellen Lage, in der sich auch die Schweizbefindet, könnte man der Behandlung der Verfassungsvor-lage die Priorität absprechen. Dennoch ist das Jubiläumsjahrder modernen Schweiz dafür geeignet, den Versuch zu un-ternehmen, die kleinliche, nörgelnde Haltung mit einer gross-angelegten Verfassungsdiskussion zu überwinden. Sie kannmindestens einen Beitrag dazu leisten.Wir stehen vor einer intellektuellen Herausforderung. Diesermüssen wir uns stellen, auch wenn übereifrige Verbands-funktionäre daran sind, die Verfassungsreform zu bagatelli-sieren und das Bemühen, den Wertekodex à jour zu bringen,mit süffisanten Bemerkungen wie «Nur weil es so nett undsozial tönt» lächerlich zu machen. Auch diese Leute sollteneinmal über ihren Schatten springen. Bis anhin hat uns «Mc-World» noch nicht gezeigt, wie man die Probleme lösenkann. Er steckt auch zunehmend im Paradox, indem er aufdiejenigen Bedingungen angewiesen ist, die er zu zerstörentrachtet: nämlich auf eine zivile und demokratische Kontrollevon Macht und Interessen. Die Basis dafür ist immer nocheine demokratische Verfassung.Ich bitte Sie, auf die Verfassungsvorlage einzutreten.
Rhinow René (R, BL), Berichterstatter: Ich danke Ihnen allenfür die engagierten Voten, vor allem auch denjenigen, dienicht in der Kommission waren und jetzt das erste Mal dieGelegenheit hatten, sich zu diesem Unterfangen zu äussern.Ich danke vor allem denjenigen beiden Kollegen, die entwe-der die Vorlage kritisch begleitet haben oder, wie jetzt zuletztHerr Vizepräsident Iten, mit viel Engagement für das Vorha-ben eingestanden sind. Ich beschränke mein Schlusswort indieser Eintretensdebatte auf einige wenige Punkte undwende mich zuerst an Herrn Schmid.1. Herr Schmid sagt, die Verfassung werde so oder so baldwieder ein Flickwerk sein. Daran ist zweifellos richtig, dassdie Verfassung auch künftig leben will, leben wird und lebensoll. Die Verfassung ist kein Ewigkeitswerk, und wir wollen,dass sie mit Volksinitiativen, dass sie mit Teilrevisionen wie-der à jour gebracht wird, und zwar laufend.Von daher gesehen ist das kein Einwand, denn niemand beiuns oder in der Kommission dachte daran, nun für 10 oder15 Jahre einen Rechtsstillstand einschalten zu wollen. DieVerfassung – wenn ich Ihr geliebtes Wort gebrauchen darf –,
Constitution fédérale. Réforme 18 E 19 janvier 1998
Bulletin officiel de l’Assemblée fédérale / Tiré à part
Herr Schmid, ist keine logische «Veranstaltung», keine Ewig-keitsveranstaltung.Aber ich meine, dass eine neue Verfassung in weiten Berei-chen nicht sofort wieder systembrechenden Einzelfallände-rungen zum Opfer fallen wird. Der neue Menschenrechtska-talog wird beispielsweise sicher nicht in einigen Jahren völligumgestellt und unkenntlich gemacht werden. Das aktuali-sierte Verhältnis von Bundesversammlung und Bundesratwird sicher nicht in jedem Jahr durch Revisionen wieder un-verständlich gemacht. Die neuen Aufgabenbestimmungen,die wir kürzlich angenommen und jetzt übernommen haben,werden uns weiterhin Richtschnur sein. Was transparent ge-macht wurde, wird nicht wieder rückgängig gemacht. Inso-fern trifft der Vorwurf des Flickwerkes eigentlich nicht zu.2. Dass Sie, Herr Schmid, ein kritisches Verhältnis zu den un-geschriebenen Grundrechten und zum Verfassungsrechtganz allgemein haben, ist uns nicht ganz unbekannt. Aber Ih-rer These, diese ungeschriebenen Verfassungsrechte fän-den in unserem Staat keine Legitimation, ist zu widerspre-chen. Im Gegenteil, sie sind von einem allgemeinen Konsensgetragen, und das seit vielen Jahrzehnten. Es ist auch Auf-gabe des Verfassungsgerichtes, die Verfassung weiterzuent-wickeln, gerade wenn sie solche Lücken wie die unsere hat,gerade wenn sie so alt ist und teilweise keine Antworten gibt,wo Antworten gegeben werden müssen.Ohne die Anerkennung ungeschriebener Grundrechte gäbees keine persönliche Freiheit, keine Meinungsfreiheit, keineVersammlungsfreiheit, kein Recht auf Vertrauensschutz,keine grundlegenden Verfahrensrechte, keine Sprachenfrei-heit. Es sind Weiterentwicklungen, die, gestützt auf die Wert-grundlagen unseres Staates, notwendig waren und die innormalen politischen Prozessen nicht aufgenommen wordensind.Ich verstehe, dass man prima vista gewisse Bedenken habenkann. Aber: Je mehr Lücken wir in der Verfassung auf Daueroffen lassen, desto eher wird der Spielraum des Gerichtesausgeweitet, sicher aber nicht eingeschränkt.3. Was geschieht, wenn die Vorlage abgelehnt wird? DieseFrage kann man rechtlich klar beantworten: Dann bleibt allesbeim Status quo. Rechtlich gesehen ändert sich dann nichts,weder positiv noch negativ – es bleibt alles so, wie es heutegilt. Politisch allerdings gäbe es darüber einiges zu sagen.Ich möchte das hier nicht tun, sondern nur wiederholen: Dienachgeführte, aktualisierte Verfassung ist der Beginn einesProzesses; so hat es der Bundesrat verstanden, und so hates auch die Kommission verstanden. Und wenn dieserSchritt nicht gelingt, hat das für den Gesamtprozess wahr-scheinlich gravierende Konsequenzen. Aber wir sind frei,Volk und Stände sind frei, welcher Entscheid zu fällen ist.Zum Schluss nehme ich Bezug auf Herrn Iten und stimmeihm sehr zu: Die Kommission hat auch immer wieder dar-über diskutiert und festgestellt, dass die Verfassungsrevi-sion allein im Ergebnis am Zustand unserer Politik wahr-scheinlich nicht viel ändern wird. Aber wir haben auch be-tont, dass es um das Prozesshafte geht, dass wir etwas ein-leiten wollen.Ich möchte hier nochmals betonen, dass es hier um eineChance geht: Ob wir sie ergreifen, ob das Volk sie ergreift,können wir nicht garantieren; das stimmt. Aber nur deshalbdie Chance gar nicht sehen zu wollen, wäre sicher falsch.Ich möchte nochmals eindringlich bitten, bei diesem Ge-schäft nicht nur die Wenn und Aber, die Zweifel und die Be-denken, die möglichen unklaren Folgen in den Vordergrundzu stellen, sondern dass wir etwas erreichen wollen: Wir wol-len von einer Verhandlungsdemokratie wieder zu einerHandlungsdemokratie kommen.
Koller Arnold, Bundesrat: Zunächst möchte ich Ihnen für diegute Aufnahme dieses grossen Reformprojektes ganz herz-lich danken. Ich danke vor allem auch dem Präsidenten dergrossen Verfassungskommission, aber auch den Vorsitzen-den der Subkommissionen, die zweifellos eine ausserordent-liche Anstrengung erbracht haben, welche sie an die Gren-zen des Milizsystems geführt hat. Ich glaube, dass das aber
auf der anderen Seite auch ein Beweis für die Leistungsfä-higkeit dieses Milizsystems ist.Als uns Frau Ständeratspräsidentin Josi Meier im Jahre 1993in einer Motion (93.3218) dazu aufgefordert hat, diese grosseVerfassungsreform auf das Jubiläumsjahr hin entschei-dungsreif zu machen, haben ja noch wenige daran geglaubt,dass das möglich wäre. Dass wir dieses Ziel heute erreichthaben, ist vor allem auch Ihr Verdienst.Was das Konzept anbelangt, bin ich durchaus damit einver-standen, dass man den Einstieg über die Nachführung, derja einem Parlamentsauftrag aus dem Jahre 1987 entspricht,als – wie soll ich sagen? – einen realpolitischen qualifiziert.Er ist kein Höhenflug, wie man ihn gern von grossen Verfas-sungen erwartet, aber er ist – da bin ich vollständig mit FrauForster einverstanden – in keiner Weise resignativ. Im Ge-genteil, er ist zusammen mit der zweiten Komponente, mitdieser Folge von systematischen, materiellen Reformpake-ten – vorab der Justizreform und der Volksrechtsreform – einnach vorn offener, ja ich würde sogar sagen: ein dynami-scher Prozess.Ich fand sehr schön, was uns Herr Respini geschildert hat,nämlich die Aussage eines Bauern aus dem Maggiatal –wenn ich es richtig verstanden habe –, der über dieses ganzeKonzept mit dem «bon sens» eines Bauernverstandes selbernachgedacht und gesagt hat: «Wir müssen diese 125 Jahrealte Verfassung zuerst wieder lesbar machen, wenn wir dar-auf aufbauend wirklich materiell wichtige Reformschritte er-zielen wollen.» Daraus ersehen Sie auch, dass diesem Kon-zept ein organisches Verfassungsverständnis zugrunde liegtund in keiner Weise ein revolutionäres.Wir wollen diese langsam gewachsene Verfassung jetzt überdie Nachführung und dann über die systematischen Reform-teile organisch weiterentwickeln, wie das auch dem tief emp-fundenen Denken unseres Volkes in der heutigen Zeit ent-spricht – davon bin ich zutiefst überzeugt.Unser Land hat in den letzten 30 Jahren, seitdem die eidge-nössischen Räte die Motionen Dürrenmatt und Obrecht an-genommen haben, der Bundesrat die Kommission Wahleneingesetzt und Herr Bundesrat Furgler den Verfassungsent-wurf von 1977 präsentiert hatte, eine eindrückliche und breitgefächerte Verfassungsdiskussion geführt. Deren Bedeu-tung für die Fortentwicklung des Verfassungsrechtes in unse-rem Land auf Bundes- wie auf kantonaler Ebene, aber auchderen Ausstrahlung sogar auf Verfassungsrevisionen desAuslands sollten wir nicht in allzu grosser Bescheidenheit un-terschätzen.Es wird immer wieder behauptet – und solche Diskussionenhat man früher schon in anderen Ländern geführt –, unsereZeit sei für eine Verfassungsreform nicht geeignet. Nüchternbetrachtet stellt der aufmerksame Beobachter aber fest, dasswir in unserem eigenen Land und im Ausland in einer eigent-lichen Periode der Verfassungsrevisionen leben: Seit densechziger Jahren haben von den 26 Kantonen deren elf eineTotalrevision ihrer Verfassung zu Ende geführt. Die letztenwaren bekanntlich die Kantone Bern, Appenzell Ausserrho-den und Tessin. In sechs Kantonen sind die Arbeiten an einerTotalrevision im Gange, und fünf Kantone sind im Begriff, dasVerfahren einzuleiten.Auch in Europa hat der Fall der Berliner Mauer zu einer ein-drücklichen Bewegung der Verfassungsreformen geführt.Die geschriebene Verfassung als konstituierendes Grundge-setz des Staates hat also weder innerhalb der Eidgenossen-schaft noch im Ausland an Faszination und Bedeutung ein-gebüsst, im Gegenteil: Auch wenn es heute nicht mehrdarum geht, den Staat als solchen zu konstituieren, ist dieVerfassungsidee lebendig geblieben.Die Pflege der Verfassung ist daher alles andere als eine ne-bensächliche Aufgabe der Behörden. Die Bundesversamm-lung hat mit ihrem Beschluss von 1987 diese Verantwortungselber wahrgenommen und die Notwendigkeit einer Neue-rung der Bundesverfassung anerkannt. Die Bundesver-sammlung hat damals dem Bundesrat den Auftrag erteilt, ihreinen Verfassungsentwurf zu unterbreiten. Ich zitiere IhrenAuftrag aus dem Jahre 1987 noch einmal (Botschaft S. 27):«Der Entwurf wird das geltende geschriebene und unge-
19. Januar 1998 S 19 Bundesverfassung. Reform
Amtliches Bulletin der Bundesversammlung / Separatdruck
schriebene Verfassungsrecht nachführen, es verständlichdarstellen, systematisch ordnen sowie Dichte und Sprachevereinheitlichen.»Diese Grundidee war im übrigen nicht neu, schon Max Imbo-den, der in den sechziger Jahre den geistigen Anstoss für dieReform der Bundesverfassung gegeben hat, verstand dieVerfassungsreform nicht als vollständige Neugestaltung.Vielmehr berief auch er sich auf den berühmten Satz desFreiherrn von Stein, der 1816 folgendes geschrieben hat:«Verfassungen bilden heisst bei einem alten Volke nicht, sieaus dem Nichts zu schaffen, sondern den vorhandenen Zu-stand der Dinge untersuchen, um eine Regel aufzufinden, dieihn ordnet, und allein dadurch, dass man Gegenwärtiges ausdem Vergangenen entwickelt, kann man ihm Dauer für dieZukunft versichern.»Für den sogenannten Nachführungsbeschluss aus demJahre 1987 braucht sich die Bundesversammlung nach Mei-nung des Bundesrates also auch heute in keiner Weise zuschämen, denn Pflege der Verfassung heisst nicht, das Hausabzureissen und neu zu bauen. Die Grundfesten dieser Eid-genossenschaft – insbesondere der liberale Rechtsstaat, diehalbdirekte Demokratie und der föderalistische Aufbau, aberauch der moderne Sozialstaat – sind im Kern nach wie vorgesund.Wir dürfen stolz darauf sein, eine der ältesten Verfassungender Welt zu haben. Aber wer wollte ernsthaft bestreiten, dasses sich nach 124 Jahren und 140 Teilrenovationen auf-drängt, das Verfassungshaus nun einmal gesamthaft zu re-novieren und es den Bedürfnissen unserer Zeit anzupassen?Was wir heute zu diskutieren beginnen, ist somit naturge-mäss keine revolutionäre Verfassung wie jene der Helvetik.Dafür fehlt die Notwendigkeit, und dafür fehlt natürlich auchder politische Wille. Vielmehr geht es zunächst einmaldarum, den erreichten Stand in der Entwicklung des Verfas-sungsrechtes zu klären und festzuhalten, die geschriebeneVerfassung in diesem Sinne à jour zu bringen.Der Bundesrat seinerseits hat es allerdings nicht bei der Er-füllung dieses parlamentarischen Nachführungsauftragesbewenden lassen. Aus eigener Initiative hat er dem Parla-ment gleichzeitig mit der verlangten nachgeführten Verfas-sung auch zwei systematische Reformpakete betreffend dieVolksrechte und die Justiz unterbreitet, weil er bei der Beur-teilung der Lage zur Einsicht gekommen ist, dass heute vor-ausschauend vor allem im Bereich der Institutionen eminen-ter Reformbedarf besteht.Der Bundesrat versteht diese Verfassungsreform daher alsoffenen, dynamischen Prozess. Dieser fusst zwar auf derNachführung des geltenden Verfassungsrechtes, der aberrasch systematisch geschlossene Teilreformen der à jour ge-brachten Verfassung folgen sollen. Viel spricht dafür, dasswir auf diesem etappierten Weg eher zum Ziel einer erneuer-ten, den Anforderungen der Zukunft gerecht werdenden Ver-fassung gelangen, als wenn wir im Sinne einer klassischenTotalrevision versuchten, alle anstehenden staatspolitischenProbleme gleichsam in einem einzigen Aufwisch zu lösen.Als Leitspruch für die kommenden Arbeiten schlage ich Ihnendeshalb vor: Öffnung für die Zukunft aufgrund einer demokra-tisch gesicherten, klaren Ausgangslage in der Gegenwartund im Bewusstsein unserer geschichtlichen Verankerung.Um den Stellenwert dieses Reformvorhabens zu erkennen,müssen wir uns die Bedeutung vor Augen führen, die derBundesverfassung zukommt. Die Verfassung hat in allen mo-dernen westlichen Verfassungsstaaten eine Reihe vongleichbleibenden Aufgaben zu erfüllen: Sie legt die Grund-züge der staatlichen Ordnung fest, sie nennt die wesentli-chen Ziele, weist Aufgaben zu, regelt die Organisation derStaatsorgane und bestimmt vor allem die Rechtsstellung derMenschen im Staat und begrenzt damit und durch die rechts-staatlichen Prinzipien die staatliche Macht.Gerade unsere Bundesverfassung – das ist in dieser wertvol-len Eintretensdebatte untermauert worden – ist allerdingsnicht nur ein juristischer Text, sondern auch ein politisches,geschichtliches und kulturelles Dokument. Sie ist Spiegelbildvergangener verfassungspolitischer Auseinandersetzungen;Herr Schmid hat darauf hingewiesen. Die in der Bundesver-
fassung angelegte Wertordnung soll im gesamten politischenProzess zum Tragen kommen und die in der Verfassung ent-haltenen Grundentscheidungen sollen durch das Parlament,die Regierung und die Gerichte umgesetzt werden.Durch diese Bindungswirkung gegenüber allen Staatsorga-nen hat die Verfassung eine erhöhte Steuerungsfunktion fürdie Politik inne. Weiter kommt der Verfassung eine wichtigeOrientierungsfunktion zu, indem sie kenntlich macht, was derStaat eigentlich ist und sein will. Die Verfassung soll helfen,die nationale Identität zu klären, und sie soll einen wesentli-chen Beitrag zur Verständigung und zu unserem staatlichenSelbstverständnis leisten. Sie hat die nationale Rechtsord-nung auch in die internationale einzubetten. Bedeutsam istsodann vor allem auch die Integrationsfunktion der Verfas-sung. Sie soll uns zusammenführen und das Einigende in un-serem Land klar markieren.Selbstverständlich – da bin ich vor allem mit Herrn Iten ein-verstanden – darf das reale Leistungsvermögen der Verfas-sung und ihre lenkende Kraft im politischen Prozess nichtüberschätzt werden. Die Verfassung als rechtliche Grundord-nung allein kann das gute Funktionieren von Staat und Ge-sellschaft nicht garantieren. Sie ist nur ein, allerdings wichti-ger Einflussfaktor im Kräftefeld von Gesellschaft, Wirtschaftund Politik. Sie kann Veränderungen der Wertordnung in un-serer pluralistischen Gesellschaft und Veränderungen imVerhältnis zwischen Staat und Wirtschaft nur sehr bedingtsteuern. Dennoch: Gerade in unserer immer pluralistischerwerdenden Gesellschaft trägt die Verfassung durch die Ver-pflichtung aller Staatsorgane auf oberste gemeinsameGrundwerte und durch die verbindliche Festlegung der Spiel-regeln des politischen Prozesses entscheidend dazu bei,dass ein Mindestmass an praktischer Übereinstimmung undpolitischer Homogenität in unserem Land besteht. All das istja die Voraussetzung, damit ein freiheitliches Zusammenle-ben eines Volkes überhaupt möglich ist.Eine Verfassung, die wegen ihrer inhaltlichen und formellenMängel diese ihr zugedachten Steuerungs-, Orientierungs-und Integrationsfunktionen nur noch teilweise und immer we-niger zu erfüllen vermag, verliert auch im politischen Be-wusstsein eines Volkes ständig an Bedeutung. Das trifft fürunsere Bundesverfassung je länger, je mehr zu. Ich will ihreMängel hier nicht weiter im Detail erläutern, denn sie sind, vorallem in der Botschaft, ausführlich dargelegt worden.Auffallend ist dagegen, dass sich das Schwergewicht derBegründungen für die Notwendigkeit der Reform seit densiebziger Jahren etwas verlagert hat. Es ist heute noch weitmehr als in den sechziger und siebziger Jahren so, dassdiese Verfassung schwere formelle Mängel und Risse auf-weist. Unsere Verfassung atmet in bezug auf Sprache, Stilund teilweise auch Inhalt den Geist des letzten Jahrhun-derts, aus dem sie ja stammt. So stehen das Verbot derKinderarbeit in den Fabriken neben der Fortpflanzungsme-dizin und der Gentechnologie und die Abschaffung derBrauteinzugsgebühren neben der neu eingeführten Mehr-wertsteuer.Die Verfassung ist auch aus dem Gleichgewicht geraten.Zum einen gehören mehrere Verfassungsbestimmungen,wie das Absinthverbot, auf die Gesetzes- oder sogar auf dieVerordnungsstufe. Andere Bestimmungen, etwa die Rege-lung der Auswanderungsagenturen, sind veraltet und obsoletgeworden oder, wie die meisten der den Alkohol betreffen-den Normen, übermässig detailliert.Die nachgeführte Verfassung enthält beispielsweise erstmalseinen vollständigen Grundrechtskatalog; etwa die Hälfte die-ser Grundrechte und Verfahrensgarantien sind gegenüberder heute geschriebenen Verfassung neu; wir haben einigegrundlegende neue Prinzipien wie das Datenschutzprinzipauf Verfassungsstufe gehoben. Trotzdem ist die nachge-führte Verfassung um rund ein Drittel kürzer als die heute gel-tende Verfassung. Das ist ein weiterer Vorteil der nachge-führten Verfassung.Zum anderen fehlen wichtige Elemente des materiellen Ver-fassungsrechtes in unserer formellen Verfassung. Unsereformelle Verfassung weist heute allzuviele und sogar schwer-wiegende Lücken auf. Der Grundrechtsteil ist geradezu frag-
Constitution fédérale. Réforme 20 E 19 janvier 1998
Bulletin officiel de l’Assemblée fédérale / Tiré à part
mentarisch. Die für das staatliche Handeln massgebendenRechtsgrundsätze werden nur zum Teil genannt. Der ganzevölkerrechtliche Ausbau des Menschenrechtsschutzes, vorallem durch die Europäische Menschenrechtskonvention, fin-det keinerlei Ausdruck in unserer Verfassung. Die grossen Li-nien der Aufgabenverteilung zwischen dem Bund und denKantonen und der sogenannte kooperative Föderalismussind kaum erkennbar.Dieses ständig grösser werdende Ungleichgewicht zwischengeschriebenem und ungeschriebenem Verfassungsrecht willich bewusst besonders hervorheben. Das ungeschriebeneVerfassungsrecht hat heute in Umfang und Bedeutung einAusmass erreicht, das in einem demokratischen Rechts-staat, der bezüglich der Rechte und Pflichten der Bürger undder Kompetenzen der Behörden eminent auf Transparenzangewiesen ist, unbedingt der Korrektur bedarf. Wir müssensogar eigentliche Widersprüche zwischen geschriebenemund ungeschriebenem Verfassungsrecht eingestehen. Soverbietet Artikel 113 Absatz 3 der Bundesverfassung be-kanntlich die Verfassungsgerichtsbarkeit. Sie ist indes fak-tisch eingeführt worden, indem die Schweiz die EuropäischeMenschenrechtskonvention ratifiziert hat.Die Lücken unserer geschriebenen Verfassung haben zurFolge, dass wesentliche Grundrechte wie die persönlicheFreiheit, die Versammlungsfreiheit und die Meinungsäusse-rungsfreiheit sowie grundlegende Verfassungsprinzipien wiedas Willkürverbot und das Verhältnismässigkeitsprinzip nichtvom Verfassunggeber, sondern durch die Praxis der Behör-den entwickelt worden sind. Dies ist aber zweifellos ab einemgewissen Grad eine gefährliche Entwicklung, die kein Verfas-sunggeber auf die leichte Schulter nehmen darf, am wenig-sten in einer direkten Demokratie, wo Volk und Stände in Ver-fassungsfragen das letzte Wort haben müssen.Neben all diesen Gründen gibt es einen weiteren, noch wich-tigeren Grund für die Verfassungsreform. Die Staatsidee derSchweiz und die tragenden Grundwerte der Eidgenossen-schaft kommen in der heutigen Verfassung kaum mehr zumVorschein. Der Grundkonsens ist verdeckt, wenn nicht garverschüttet. Ein verschütteter Grundkonsens entfremdetaber Staat und Verfassung vom Bürger. Unsere Verfassung,so, wie sie heute geschrieben steht, ist der Öffentlichkeit, undinsbesondere unserer Jugend, kaum mehr vermittelbar. Sieist ein Buch mit sieben oder noch mehr Siegeln geworden.Eine veraltete Verfassung wird leicht eine belanglose Verfas-sung. Das darf niemandem gleichgültig sein.Wir haben heute glücklicherweise zwar keine Verfassungs-krise. Das Rad der Zeit bleibt aber nicht stehen. Ungeschrie-benes Recht und Verfassungswirklichkeit ändern laufend.Wenn wir jetzt nichts tun, vergrössert sich die Kluft zwischenungeschriebenem und geschriebenem Verfassungsrecht im-mer mehr. Es darf nicht sein, dass wir vor lauter Trägheit inder Gegenwart dereinst eine «Verfassungsfeuerwehr» ein-setzen müssen.Das sind wesentliche Gründe, warum die Bundesverfassunghier und heute einer gründlichen Erneuerung bedarf. Sie sollihre ordnende, begrenzende, legitimierende und identitätstif-tende Kraft zurückgewinnen. Dies setzt voraus, dass wir dasungeschriebene Verfassungsrecht in die geschriebene Ver-fassung integrieren, den verfassungsunwürdigen Wildwuchsbeseitigen, das Verhältnis des Landesrechtes zum Völker-recht klären, nicht zuletzt aber jene vier Säulen wieder freile-gen, auf denen unser Bundesstaat nach wie vor ruht: den li-beralen Rechtsstaat, den Sozialstaat, die direkte Demokratieund den Föderalismus.Gleichzeitig bietet dieses Unternehmen Gelegenheit, denGrundkonsens über die wesentlichen rechtlichen Grundla-gen unseres Gemeinwesens zu erneuern, denn gerade inunseren Zeiten der inneren Verunsicherung, der kritischenAnfragen von aussen und der Vergegenwärtigung und Be-wältigung unserer eigenen Geschichte, wie sie unser Landzurzeit erlebt, bedarf unsere Verfassung neuer Integrations-kraft. Ich bin überzeugt, dass unser Land in seinem gegen-wärtigen Befinden gerade diese Besinnung auf sich selbst,diese Klärung der eigenen Identität unbedingt braucht. DieVerfassungsdiskussion ist wie kaum ein anderer Rahmen ge-
eignet, diese staatspolitische Diskussion und Klärung voran-zubringen und in die richtigen Bahnen zu lenken.Es dürfte klar geworden sein, warum der Bundesrat das par-lamentarische Mandat aus dem Jahre 1987 nach wie vor alssinnvoll erachtet. Wie erwähnt sollten wir uns aber damitnicht begnügen. So bedeutungsvoll die «mise à jour» ist, derEndpunkt der Reformbemühungen kann sie nicht sein. Esbesteht klar auch materieller Reform- und somit Handlungs-bedarf.Um der Bundesverfassung neue Steuerungskraft zu geben,müssen wir insbesondere die Handlungsfähigkeit der Institu-tionen wiederherstellen und stärken. Die Internationalisie-rung von Wirtschaft und Politik verlangt heute höhere Rhyth-men der Entscheidfindung. Es ist daher unabdingbar, die In-stitutionen rechtzeitig für die wachsenden Herausforderun-gen zu rüsten.Wenn heute und gerade auch in dieser Session so oft vomVerlust an politischer Steuerungs- und Gestaltungskraft dieRede ist, so muss die Verfassungsreform ein bedeutenderSchritt sein, um diese Kraft möglichst zurückzugewinnen.Den grössten Reformbedarf auf Verfassungsstufe ortet derBundesrat bei den Volksrechten und der Justiz. Die dringli-che Justizreform ist in den Kommissionen bereits zu Endeberaten. Die Reform der Volksrechte, welche am meistenNeuerungen enthält, werden die Verfassungskommissionendemnächst bereinigen. Andere Reformvorhaben wie die Re-form des Finanzausgleichs und die Staatsleitungsreform sindweit fortgeschritten oder eingeleitet.Die nachgeführte Verfassung schafft eine klare und transpa-rente Ausgangslage und dient als Initialzündung für einennach vorne offenen Reformprozess, dessen Ende wedersachlich noch zeitlich bestimmbar ist.Im Sinne dieses bundesrätlichen Reformkonzeptes hat sichdas Parlament mit drei separaten Vorlagen zu befassen,nämlich mit dem Bundesbeschluss über eine nachgeführteBundesverfassung – Vorlage A – und den Vorlagen B und Czu den Reformbereichen Volksrechte und Justiz. Diese Tren-nung zwischen Nachführung und materiellen Reformpaketenist durchaus ein politisches Konzept. Sie wirkt politisch entla-stend und trägt dazu bei, die Erfolgschancen der Verfas-sungsreform in der Volksabstimmung zu steigern. Ich bindeshalb froh, dass die beiden Kommissionen dieses Konzeptgrundsätzlich übernommen haben.Für den Erfolg des Gesamtunternehmens erachtet es derBundesrat als entscheidend, dass das Reformkonzept nunauch in den eidgenössischen Räten beibehalten wird. DieNachführung soll sich nach dem Kriterium der gelebten Ver-fassungswirklichkeit auf die Normierung des geltenden Ver-fassungsrechtes beschränken. Ein beliebiges Aufpfropfenvon allerlei Wünschbarem und vielleicht sogar Spektakulä-rem in allen Bereichen würde das Projekt inhaltlich und imHinblick auf die Volksabstimmung aufs höchste gefährden,indem sich nämlich eine von Zufälligkeiten geprägte, inkonsi-stente materielle Totalrevision ergäbe, die politisch die viel-fältigsten Abwehrreflexe wecken würde.Die Klärung von verfassungspolitischen Wertungsfragen, dieauch im Rahmen der Nachführung unausweichlich ist, birgt –wir werden das morgen sehen – genügend heiklen Diskus-sionsstoff. Es ist mir deshalb ein echtes Anliegen, dass sichdas Parlament bei der Behandlung der Nachführung in einergewissen Selbstbescheidung übt, die – ich verstehe das –den Politikern nicht angeboren, hier für den Gesamterfolgdes Unternehmens aber unbedingt nötig ist. Umgekehrt darfmit der Nachführung nicht versucht werden, Errungenschaf-ten unserer Rechtsordnung auf kaltem Wege abzubauen.Eine Nachführung, die zu einem Rückschritt hinter das gel-tende Verfassungsrecht führen würde, könnte der Bundesratnicht unterstützen.Damit komme ich noch zu ein paar kritischen Einwänden:Herr Büttiker, Sie haben die Liberalität unserer geltendenVerfassung zu Recht gerühmt. Ich gebe gerne zu, dass auchdie heute gelebte Verfassungswirklichkeit noch auf der Ver-fassung von 1848 und 1874 fusst. Auf der anderen Seitemüssen wir jetzt im Rahmen der «mise à jour» auch all dasaufnehmen und in den formellen Verfassungstext integrieren,
19. Januar 1998 S 21 Bundesverfassung. Reform
Amtliches Bulletin der Bundesversammlung / Separatdruck
was wir in den letzten 125 Jahren gemeinsam, miteinandererrungen haben. Dazu gehört ein ganz grosser Ausbau unse-rer direkten Demokratie, dazu gehört auch die Entwicklungunseres modernen Sozialstaates. Dazu gehören Entwicklungund Festigung des kooperativen Föderalismus.Mit der nachgeführten Verfassung wollen wir den Acquissuisse festschreiben. Wir haben im Rahmen der Europadis-kussion immer wieder vom Acquis communautaire gespro-chen. Aber hier geht es nun darum, den Acquis suisse, aufden wir und das ganze Volk zu Recht stolz sein können, fest-zuschreiben. Nicht in dem Sinne, dass weitere Fortschrittevereitelt, sondern in dem Sinne, dass Rückschritte verhindertwerden sollen.Herrn Reimann möchte ich sagen: Es ist falsch, wenn mandiese naturgemäss mittel- und langfristig angelegte Verfas-sungsreform ständig gegen kurzfristige politische Anliegenausspielt. Herr Respini hat zu Recht gesagt, was uns bei derLösung dieser kurzfristigen Probleme – Bekämpfung der Ar-beitslosigkeit, Sanierung der Bundesfinanzen, Sicherung un-serer Sozialversicherungen – fehle, seien nicht die Ideen,sondern der Konsens. Die Arbeit, die wir in bezug auf die Ver-fassung leisten, behindert in keiner Weise die Arbeit an die-sen aktuellen Problemen. Persönlich bin ich davon über-zeugt, dass wir sogar bessere Voraussetzungen zur Lösungdieser aktuellen politischen Probleme schaffen, wenn unsdieses einigende Werk der Verfassungsreform gelingt.Zum Votum von Herrn Schmid hat Herr Rhinow schon Stel-lung genommen. Die Hauptfrage war, was passiere, wenndiese nachgeschriebene Verfassung abgelehnt werde. Dannbleibt das ungeschriebene Verfassungsrecht in Kraft. Diesesungeschriebene Verfassungsrecht ist verfassungsgemässentwickelt worden, einerseits durch das Bundesgericht, an-dererseits nach den verfassungsrechtlichen Normen, auchdurch internationale Verträge. Aber ich gebe gerne zu, HerrSchmid: Ich sehe es durchaus als erwünscht und richtig an,dass uns diese Nachführung die Gelegenheit gibt, beispiels-weise eine Europäische Menschenrechtskonvention, die un-seren Staat ja nachhaltig geprägt hat, nachträglich auchdurch eine Volksabstimmung zu legitimieren. Das ist ein sehrerwünschter Nebeneffekt dieser Nachführung der Verfas-sung.Im übrigen möchte ich gegenüber Herrn Iten betonen, dassman die Verfassung auch nie überschätzen darf. Weil Ver-fassungen gewöhnlich in revolutionären Situationen gege-ben werden, neigen wir dazu, die Kraft von Verfassungeneher zu überschätzen. Verfassungen sind naturgemäss auchSpiegelbild der gesellschaftlichen Kräfte. Einerseits sollensie Grundkonsens stiften, aber zugleich setzen sie den Rah-men dafür, wie wir mit dem Dissens fertig werden sollen. Ei-nerseits begründet eine Verfassung politische Stabilität, aberanderseits legt die Verfassung auch die Spielregeln für denunbedingt notwendigen, öffentlichen politischen Prozessfest.Frau Weber, über die Prioritäten der Reformpakete kannman trefflich streiten. Der Bundesrat – das ist der Unter-schied gegenüber Entwürfen aus den siebziger Jahren – istzum Schluss gekommen, dass die institutionellen Reformenam dringlichsten seien. Denn Sie wissen: Wenn uns bei-spielsweise jetzt im Justizbereich diese strukturelle Reformnicht gelingt, steht uns nur noch die Alternative offen, ständigmehr Bundesrichter zu wählen. Das wird das Bundesgerichtzu einer Fabrik machen, was mit einem höchsten Gericht,das ja vor allem für die Rechtseinheit sorgen und die Rechts-fortbildung gewährleisten soll, nicht vereinbar ist.Wir sind auch im Bundesrat, Frau Weber, durchaus der Mei-nung, dass wir – nachdem die Vorlage über die Einführungvon Staatssekretären abgelehnt worden ist – auch die Re-form des Bundesrates und des Verhältnisses von Bundesratund Parlament vorantreiben müssen. Wir werden demnächstim Bundesrat aufgrund eines Expertenberichts darüber dis-kutieren.Was die Wirtschaftsverfassung anbelangt: Natürlich wäre ichpersönlich – Sie kennen meine Einstellung – gerne auch ei-nen Schritt weiter gegangen und hätte mich ganz klar zu ei-ner Marktwirtschaft, zu einer Wettbewerbswirtschaft bekannt,
aber das wäre innerhalb der Nachführung konzeptwidrig ge-wesen. Ich musste mir – also nicht nur Sie, sondern auch derBundesrat –diesbezüglich Selbstdisziplin auferlegen. Aberunseres Erachtens wird irgendwann auch ein solches Re-formpaket reif werden.Der Bundesrat ist der Auffassung, dass die Zeit reif ist, umdie Verfassungsreform nun energisch voranzutreiben. Er be-trachtet es als Gebot verantwortungsbewusster Staatsfüh-rung, die Grundordnung unseres Staates den Bürgerinnenund Bürgern wieder transparent zu machen und die notwen-digen institutionellen Reformen unseres Gemeinwesens an-zupacken und einer Lösung zuzuführen. Ohne Transparenz,vor allem in bezug auf die Grundordnung des Staates, gibt eskeine echte Demokratie. Das ist doch eine der grossen Er-rungenschaften der letzten Jahrhunderte. Deshalb müssenwir auf dem Gebiet der Verfassung diese heute nicht mehrbestehende Transparenz wiederherstellen, damit die Bürge-rinnen und Bürger ihre Rechte und Pflichten kennen und da-mit wir auch die Kompetenzen der staatlichen Behörden wie-der kennen. Ohne rechtzeitige institutionelle Reformen set-zen wir die Handlungsfähigkeit unseres Staates aufs Spiel.Ich möchte Ihnen daher noch einmal meine Anerkennungund meinen Dank aussprechen für die Arbeit, die Sie gelei-stet haben. Der Bundesrat hat mit Genugtuung und Freudefestgestellt, dass die Räte die Verfassungsreform nach demAuftrag aus dem Jahre 1987 erneut zu ihrem eigenen Anlie-gen gemacht haben. Es ist für den inneren Zusammenhaltdes Landes entscheidend, dass es gelingt, mit dieser grund-legenden staatspolitischen Reformvorlage ein einigendes Er-eignis zu schaffen, eine Erneuerung unseres 150 Jahre altenGesellschaftsvertrages.Natürlich kann der notwendige Aufbruch nicht allein mit derVerfassungsreform erreicht werden, aber die Verfassungsre-form bietet eine einmalige staatspolitische Chance dafür. Siewird uns weiterbringen, ganz im Sinne von Benjamin Con-stant, dem französischen Staatstheoretiker schweizerischerAbstammung, der einmal treffend formuliert hat:«Les constitutions doivent suivre les idées pour poser der-rière les peuples des barrières qui les empêchent de reculer,mais elles ne doivent point en poser devant eux, qui les em-pêchent d’aller en avant.»Wir feiern dieses Jahr ein Jubiläum. Es sind 150 Jahre her,dass die moderne Schweiz als Bundesstaat begründet wor-den ist. Nach heftigen und schmerzlichen Konflikten ist es da-mals gelungen – übrigens, das muss ich als Appenzeller an-erkennen, in weiser Zurückhaltung der Sieger –, ein Staats-gebilde zu begründen, das sich im Verlaufe von 150 Jahrenals fähig erwiesen hat, Vielfalt und Einheit in einem gesundenGleichgewicht zu verbinden. Etwas vom Weitblick dieserGründerväter ist uns dringend zu wünschen, wenn wir nach150 Jahren daran gehen, diesem Land erneut eine tragfä-hige, zeitgemässe und entwicklungsfähige Grundlage zu ge-ben.Packen wir also diese Aufgabe an – mit Offenheit, mit Mutund vor allem im Bewusstsein, dass es in diesem Land trotzaller Divergenzen nach wie vor einen breiten Fundus anstaatsbürgerlicher Gesinnung und Verantwortung gibt, deruns eint – ich bin davon überzeugt – und der uns zur Bewäl-tigung der Zukunft befähigt!
Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossenL’entrée en matière est décidée sans opposition
Die Beratung dieses Geschäftes wird unterbrochenLe débat sur cet objet est interrompu
Constitution fédérale. Réforme 22 E 20 janvier 1998
Bulletin officiel de l’Assemblée fédérale / Tiré à part
Zweite Sitzung – Deuxième séance
Dienstag, 20. Januar 1998Mardi 20 janvier 1998
08.00 h
Vorsitz – Présidence:Zimmerli Ulrich (V, BE)/Iten Andreas (R, ZG)
__________________________________________________________
96.091
Bundesverfassung.ReformConstitution fédérale.Réforme
Fortsetzung – Suite
__________________________________________________________
A1. Bundesbeschluss über eine nachgeführte Bundes-verfassung (Titel, Art. 1–126, 185)A1. Arrêté fédéral relatif à une mise à jour de la Consti-tution fédérale (titre, art. 1–126, 185)
Detailberatung – Examen de détail
Titel – TitreAnträge der Kommissionen: BBlPropositions des commissions: FF
Antrag RochatZustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Proposition RochatAdhérer au projet du Conseil fédéral
Rhinow René (R, BL), Berichterstatter: Wie ich in meinemeinleitenden Votum in der Eintretensdebatte ausgeführthabe, werde ich zu Beginn jedes grösseren Abschnittes derVerfassung einige Hinweise zum Stellenwert der betreffen-den Artikel im Gesamtkontext der Verfassung und zu den we-sentlichen Kommissionsbeschlüssen geben. Die Erläuterungder einzelnen Artikel selbst obliegt dann den Präsidenten derSubkommissionen bzw. deren Stellvertretern.Die neue Verfassung wird in sechs Hauptabschnitte geglie-dert, die jeweils mit «Titel» überschrieben werden, voransteht – wie im geltenden Recht – eine Präambel. Anschlies-send folgen im 1. Titel einleitende, grundsätzliche Bestim-mungen zur Schweizerischen Eidgenossenschaft, gefolgtvon einem 2. Titel über Grundrechte und Sozialziele, ergänztvon uns durch die Bürgerrechte. Dann kommen der 3. Titelüber Bund und Kantone, der vierte Titel über Volk undStände, der fünfte Titel über die Bundesbehörden und amEnde der sechste Titel mit den Revisions- und Übergangsbe-stimmungen.Was nun den Titel des Bundesbeschlusses angeht, schlägtIhnen die Kommission vor, von einer «neuen» Bundesverfas-sung und nicht von einer «nachgeführten» Bundesverfas-sung zu sprechen. Ich habe bereits ausgeführt, dass sich dieKommission von einem weiten Verständnis der Nachführungleiten liess, dass es uns nicht nur um Nachvollzug ging, son-dern eigentlich um eine Aktualisierung, und dass wir aucheinzelne punktuelle, konsensfähige Neuerungen beschlos-sen haben. Es schien uns ehrlicher, dies auch mit dem Titelzum Ausdruck zu bringen: Es ist eine neue Verfassung, auch
wenn es im Inhalt nicht eine vollständig umgeänderte neueVerfassung ist. Dies ist der Grund für den neuen Titel.Nun liegt Ihnen ein Antrag Rochat vor. Er wird ihn selbstbegründen. Er bezieht sich aber eigentlich auf den franzö-sischen Text. Ich bin davon überzeugt – die Kommission hatdarüber nicht gesprochen –, dass uns der Begriff «mise àjour» nicht zu einer Änderung des Titels veranlasst hätte.Aber «mise à jour» ist nicht dasselbe wie «Nachführung».«Nachführung» klebt eher an der Buchhaltung, während«mise à jour» eigentlich das «Erneuerte» zum Ausdruckbringt. Insofern ist der Beschluss der Kommission auf dendeutschen und nicht auf den französischen Titel bezogen.Bei der Präambel haben wir – im Gegensatz zur nationalrät-lichen Kommission – im wesentlichen die Fassung des Bun-desrates übernommen.Dem 1. Titel der Verfassung haben wir mit «Allgemeine Be-stimmungen» eine andere Überschrift gegeben. AuchArtikel 1 erhält in unserer Verfassung eine neue Überschrift,«Eidgenossenschaft». Wir haben diese Überschrift als sach-gerechter empfunden als den ebenfalls buchhalterisch trok-kenen Titel «Bestand», der mich immer etwas an einen mili-tärischen Etat erinnert. Wir haben den 1. Titel auch deshalbgeändert, weil in den Artikeln 1 bis 5 des Vorentwurfes teilsder Bund allein, teils aber auch Bund und Kantone angespro-chen werden. In diesem Sinne handelt es sich eigentlich um«allgemeine Bestimmungen».Die Kommission ist hier im wesentlichen dem Bundesrat ge-folgt. So haben wir alle konstitutiven Elemente dieses Ab-schnittes übernommen: Artikel 1 und 3 als Grundlage undAusweis des bundesstaatlichen Staatsaufbaus; Artikel 2 alsaktualisierten Zweckartikel; Artikel 5, der die grosse Bedeu-tung der Sprachgemeinschaften für unser Land zum Aus-druck bringt und den wir als Artikel 3a aufgenommen haben;schliesslich auch die in Artikel 4 neu festgehaltenen rechts-staatlichen Grundsätze.Allerdings hat die Kommission im 1. Titel auch gewisse Än-derungen vorgenommen. In Artikel 1 wird das «SchweizerVolk» bewusst neben die «Kantone» gesetzt, dies als Aus-fluss der modernen Volkssouveränität. In Artikel 3 wird nurder erste Absatz übernommen, allerdings angereichert mitder geltenden Fassung von Artikel 3, um die grosse Bedeu-tung des historisch gewachsenen Bundesstaates und derkantonalen Autonomie besser zum Ausdruck zu bringen. DieAbsätze 2 und 3 des bundesrätlichen Entwurfes werden im3. Titel «Bund und Kantone» wiederaufgenommen. Ichschlage vor, dass wir dort die eigentliche Diskussion über dasVerhältnis Bund/Kantone führen.Die Kommission hat darauf verzichtet, einen eigentlichen«Wesensartikel» über unser Land aufzunehmen, etwa desInhaltes: «Die Eidgenossenschaft ist ein freiheitlicher, demo-kratischer und sozialer Bundesstaat ....» Ein solcher We-sensartikel, wie er in anderen Verfassungen zu finden ist,hätte neben den Artikeln 1 bis 5, die diese Strukturprinzipienbereits zum Ausdruck bringen, kaum sinnvoll Platz gefunden.Ebenso wurde ein Pflichtenartikel abgelehnt, der in allgemei-ner Form die von den Individuen zu erfüllenden Rechts-pflichten enthalten hätte. Wir werden darauf zurückkommen,weil uns jetzt ein Antrag eines Ratsmitgliedes vorliegt, einensolchen Pflichtenartikel einzuführen. Die Kommission warder Ansicht, dass Individualpflichten im Rechtsstaat konkretumschrieben sein sollten, wie wir das etwa bei der Militär-dienstpflicht, der Steuerpflicht oder der Schulpflicht kennen.Ein allgemein gehaltener Pflichtenartikel hätte nicht mehrRegelungsgehalt, als diese konkreten Artikel schon haben,würde aber darüber hinaus etliche Interpretationsfragen auf-werfen.Schliesslich orientiere ich Sie darüber, dass die nationalrätli-che Kommission unter diesem Titel zwei zusätzliche Bestim-mungen beschlossen hat, nämlich die Verankerung desNachhaltigkeitsprinzips – das wir zu Beginn des Abschnittesüber Raumplanung und Umwelt aufgenommen haben – undeine Bestimmung über die Verantwortung jedes Menschenfür sich selbst und gegenüber Mitmenschen und Gesell-schaft. Hier liegt uns ebenfalls ein Antrag vor, auf den wir zu-rückkommen werden.
20. Januar 1998 S 23 Bundesverfassung. Reform
Amtliches Bulletin der Bundesversammlung / Separatdruck
Rochat Eric (L, VD): Je me permets de vous demander debien vouloir conserver à l’arrêté fédéral, en français, le titredonné par le Conseil fédéral.En effet, en parlant d’une «mise à jour» de la Constitution fé-dérale, le Conseil fédéral décrit fort exactement ce qui a étéson intention claire dans tous les documents antérieurs quenous avons reçus. Le travail que nous effectuons vise essen-tiellement à mettre à jour la constitution, et non à rédiger unenouvelle constitution. Je ne conteste pas le fait que certainesnouveautés puissent s’y glisser, mais le but premier de nostravaux n’est pas vraiment là. C’est à un tout autre exerciceque nous aurions dû nous livrer si nous avions envisagé,comme la commission du Conseil des Etats nous le propose,de rédiger une «nouvelle» Constitution fédérale. De la mêmemanière, c’est bien plus à une révision qu’à une réforme dela constitution que nous allons procéder, la révision mettantl’accent sur l’amélioration du passé, la réforme sur l’évolutionprospective.Je vous propose donc de garder le titre original «Arrêté fédé-ral relatif à une mise à jour de la Constitution fédérale». Cetitre sera probablement mieux perçu lors des votations etcontribuera à une discussion plus sereine. Nous aurons quel-ques innovations à défendre dans un contexte connu, in-changé sur le fond. Au contraire, en parlant de «nouvelle»constitution, nous donnons l’impression que les axes et lesconcepts constitutionnels ont été changés, et nous nous ex-posons à des débats qui ont débouché par le passé surl’échec prématuré des projets. Il y a certes de la modestie àparler de «mise à jour»; il y aurait de la prétention à parler de«nouvelle» constitution.Je vous recommande de bien vouloir accepter cet amende-ment pour le titre français.
Rhinow René (R, BL), Berichterstatter: Man kann diesemAntrag, wenn er sich auf die französische Fassung bezieht,zustimmen. Die Kommission hat sich ausschliesslich amdeutschen Text orientiert und den deutschen Begriff «Nach-führung» abgelehnt. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wirden französischen Text ändern, wie es Herr Rochat vor-schlägt, und den deutschen Text stehen lassen, weil das«neu» in der deutschen Sprache auch den Sinn von «mise àjour» haben kann. Schliesslich ist die Verfassung von A bis Zneu formuliert. Sie ist neu; es ist nicht die alte.
Koller Arnold, Bundesrat: Das scheint mir kein schlechterKompromiss zu sein. Es bestand tatsächlich von Anfang aneine Diskrepanz zwischen dem deutschen Ausdruck «Nach-führung» und dem französischen «mise à jour». Wir habenden Begriff «Nachführung» vom parlamentarischen Auftragaus dem Jahre 1987 übernommen. Ihm haftet indessen et-was Buchhalterisches an. Daher habe ich den französischenAusdruck «mise à jour» immer vorgezogen.Es ist klar: Wir halten uns an den Auftrag, das geltende ge-schriebene und ungeschriebene Verfassungsrecht nachzu-führen. Wir wissen aber auch, dass die Nachführung mit Wer-tungen verbunden ist, weil wir verschiedene Verfassungsbe-stimmungen auf Gesetzesebene herab- und umgekehrt Ge-setzesbestimmungen auf Verfassungsebene heraufstufen.Wir nehmen beispielsweise im Bereich der Alkoholbestim-mungen viele Herabstufungen vor, so beim Absinthverbot.Jetzt gibt es in der Verfassung etwa drei Seiten zum Alkohol.Neu wird es nur noch ein einziger Artikel sein.Andererseits machen wir auch gewisse Heraufstufungen, in-dem wir beispielsweise das Prinzip des Datenschutzes vonder Gesetzesstufe bewusst als verfassungswürdiges Prinzipneu in die Verfassung aufnehmen. Insofern ist natürlich derfranzösische Ausdruck «mise à jour» auf jeden Fall der bes-sere als der nicht ganz glückliche deutsche Ausdruck «Nach-führung». Insofern ist der Kompromissvorschlag Ihres Kom-missionspräsidenten wohl ein guter.
Präsident: Herr Rochat beantragt, für den französischen Ti-tel bei der bisherigen Formulierung zu bleiben («mise àjour»), und Herr Bundesrat Koller und Herr Rhinow beantra-gen, die deutsche Fassung stehenzulassen.
Angenommen gemäss Antrag RochatAdopté selon la proposition Rochat
Ingress – PréambuleAnträge der Kommissionen: BBlPropositions des commissions: FF
Angenommen – Adopté
Präsident: Den Antrag Brunner Christiane verschieben wirbis nach der Behandlung von Artikel 5.
Präambel – PréambuleAnträge der Kommissionen: BBlPropositions des commissions: FF
Frick Bruno (C, SZ), Berichterstatter: Ich werde im folgendenzur Präambel und zu den Artikeln 1 bis 2 lediglich ausführen,was in Ergänzung oder Abweichung zu den Ausführungen inder Botschaft des Bundesrates zu sagen ist; dies im Inter-esse einer zügigen, ökonomischen Beratung.Zur Präambel: Traditionsgemäss löst eine Präambel eingrosses Echo aus. Sie hat es auch in der Vernehmlassungund in der öffentlichen Diskussion unserer neuen Bundesver-fassung getan. Formell ist die Präambel bloss eine Einleitungzur Verfassung, inhaltlich aber ist sie weit mehr. Sie ist eineArt Grundsatzprogramm. In gedrängter, sprachlich ausgefeil-ter Form nennt sie den Geist und die Ziele der Verfassung.Sie ist eine philosophische Grundlage und auch das staats-politische Bekenntnis, wie wir die Schweiz mit dieser Verfas-sung gestalten wollen. Kurz: Sie ist ein feierlicher, literari-scher Beginn, ein sprachlich schöner, auch erbaulicher Auf-takt.Unsere Verfassungskommission hat die Präambel des Bun-desrates übernommen, während jene des Nationalrates aufder Formel aufbauen will, wie sie Adolf Muschg für den Vor-entwurf von 1977 präsentiert hat. Die Präambel hat keinenRechtsatzcharakter; also lassen sich keine konkreten Rechteund Pflichten, keine Rechtsansprüche daraus ableiten.Unsere Kommission hat sich einstimmig für die AnrufungGottes des Allmächtigen ausgesprochen. Damit wollen wirganz klar keine unserer Religionen bevorzugen, aber allenamhaften Religionen der Welt können sich hinter diese An-rufung stellen. Sie ist ein Akt und ein Zeichen der Beschei-denheit, dass Menschenwerk und Menschenhand nicht allesaus eigener Kraft können, sondern dass wir auf die Hilfe undden Schutz einer höheren Macht angewiesen sind. Nach derAnrufung folgt dann in drei Punkten die Darstellung, in wel-chem Geist, in welchem Selbstverständnis wir die Verfas-sung schreiben werden.Die Absätze in Klammern am Rande, darauf möchte ich hin-weisen, sind rein provisorischer Art und sollen die Beratungerleichtern. Im definitiven Text werden sie fehlen.In der Aufzählung ab Absatz 3 hat die Kommission in deut-scher Sprache drei, in französischer Sprache vier Änderun-gen eingeführt.Zuerst zu Absatz 3. Wir wollen den Bund nicht nur erneuern,sondern auch seinen Zusammenhalt stärken. Wir wollen dieBotschaft vermitteln, die zentripetalen Kräfte unsererSchweiz vermehrt zu stärken, weil heute die zentrifugalenKräfte immer stärker werden. Dies genau im Sinne des Vo-tums, das Herr Danioth gestern gehalten hat.In Absatz 4 haben wir lediglich in französischer Sprache eineVerbesserung angebracht; sie bringt keine inhaltliche Ände-rung.Absatz 5 hingegen beinhaltet eine Neuerung. In der Vorlagedes Bundesrates steht lediglich «im Bewusstsein der Verant-wortung gegenüber den künftigen Generationen». Wir habenihn erweitert. Es geht nicht nur um die Verantwortung gegen-über den künftigen Generationen. Auch eine gewisse Verant-wortung und eine Dankbarkeit gegenüber unseren Eltern undden früheren Generationen ist unsere Pflicht. Wir haben dieAufgabe, das Erbe, das wir erhalten haben, verantwortungs-bewusst weiterzugeben. Wir wollen also die Brücke nicht nurvon der Gegenwart in die Zukunft schlagen, sondern vom
Constitution fédérale. Réforme 24 E 20 janvier 1998
Bulletin officiel de l’Assemblée fédérale / Tiré à part
Erbe unserer Eltern bis zu den künftigen Generationen; eineBrücke mit zwei Bogen also, nicht eine Brücke mit nur einemBogen.In Absatz 6 haben wir die Gegenwartsform gewählt. Wir wol-len damit sagen: Wir stehen am Anfang der Verfassungge-bung, nicht am Schluss. Die Präambel steht am Anfang, da-her: «geben sich folgende Verfassung».Die Kommission hat diesen Änderungen jeweils mit klarenMehrheiten zugestimmt. Ich bitte Sie, unseren Anträgen zufolgen.
Koller Arnold, Bundesrat: Ich bin Ihnen dankbar, dass Siedieser Präambel zustimmen. Wir haben sie ja nachgeliefert,weil wir nüchterne Juristen diese Umschreibung der VisionSchweiz gerne berufenen Schriftstellern überlassen. Es wa-ren zwei Journalisten, welche die Präambel formuliert haben.Das Vernehmlassungsverfahren hat ganz klar gezeigt, dassunserem Volk sehr viel an der Präambel liegt. Wir haben zukaum einer anderen Bestimmung so viele Eingaben erhalten.Deshalb sind wir Ihnen auch dankbar, dass Sie an der Invo-catio Dei, also der Anrufung Gottes des Allmächtigen, fest-halten. Dies ist der Wunsch der weit überwiegenden Zahl derVernehmlasser. Damit soll daran erinnert werden, dass ne-ben den Menschen und dem Staat eine höhere Macht exi-stiert. Die Formel erinnert an die Relativität der Dinge auf die-ser Welt und lehrt uns Bescheidenheit. Der Gott, der angeru-fen wird, ist nicht in jedermanns Vorstellung derselbe; jedePerson kann gemäss ihrer eigenen Religion und Weltan-schauung Gott dem Allmächtigen einen persönlichen Sinngeben.Zur «Erzählung», d. h. zum inhaltlichen Teil, hat Ihre Kom-mission zwei, drei Ergänzungen eingebracht. Der Ergänzungder Betonung des inneren Zusammenhaltes und jener desBewusstseins der gemeinsamen Errungenschaften kann derBundesrat zustimmen.
Angenommen – Adopté
Art. 1Anträge der Kommissionen: BBlPropositions des commissions: FF
Frick Bruno (C, SZ), Berichterstatter: Ich habe vier ergän-zende Bemerkungen zum Entwurf des Bundesrates zu ma-chen.1. Der Bundesrat möchte die Eidgenossenschaft als Summeoder als Produkt der Faktoren der Kantone erklären. Die Ver-fassungskommission hat sich mit 9 zu 6 Stimmen für die Fas-sung «Das Schweizervolk und die Kantone» ausgesprochen.Wir wollen damit zum Ausdruck bringen, dass das Schwei-zervolk das andere Element neben den Kantonen ist. Wir ha-ben das Verständnis, dass wir mehr sind als bloss eineSumme von Kantonen, so wie wir das in bedeutenden Fra-gen in der Verfassung auch zum Ausdruck bringen. DieVolkssouveränität ist in der Gesetzgebung die entschei-dende Instanz; in anderen wichtigen Verfassungsfragen ent-scheiden Volk und Stände.Diese Formulierung soll auch Ausdruck dessen sein, dass inden letzten 150 Jahren die Schweiz mehr geworden ist alsbloss eine Summe von Kantonen, dass sich das Schweizer-volk nämlich als eigenständiges Volk, als entscheidendes,tragendes Element der Eidgenossenschaft zusammen mitden Kantonen empfindet.2. Entsprechend haben wir den Titel von Artikel 1 angepasst.Er heisst nun «Die Schweizerische Eidgenossenschaft», wieKommissionspräsident Rhinow bereits erläutert hat.3. In der Reihenfolge der Kantone haben wir uns für die tra-ditionelle Aufzählung, also für die Fassung des Bundesrates,entschieden: Die drei Vororte gemäss Bundesvertrag von1815 zuerst, und die übrigen Kantone in der Reihenfolge desEintrittes. Wir haben den Antrag, einzelne Kantone (Ob- undNidwalden) aus traditionellen Gründen umzustellen, abge-lehnt, weil nämlich ein einmaliger Einbruch in die Reihenfolgedie grundsätzliche Diskussion auslöst, welches die richtige
Reihenfolge ist, obwohl es sachliche Gründe gäbe, Ob- undNidwalden in der Reihenfolge auch anders anzuführen.4. Eine Bemerkung betreffend die Halbkantone: Wir habenuns dafür entschieden, die Halbkantone mit dem Zusatz«und» untereinander zu verbinden. Wir sind uns bewusst,dass die sogenannten Halbkantone vollwertige Kantone undGlieder der Eidgenossenschaft sind und dass lediglich nochzwei Einschränkungen bestehen: Erstens haben sie nur ei-nen Sitz im Ständerat, und zweitens zählt für das Stände-mehr bei Verfassungsänderungen ihre Stimme nur als einehalbe Einheit.
Plattner Gian-Reto (S, BS): Erlauben Sie mir gerade zu die-sen letzten Ausführungen des Berichterstatters eine kurzeBemerkung.Wenn Sie auf den Markt gehen und Äpfel, Birnen, Zwetsch-gen und Pflaumen, Pfirsiche und Aprikosen kaufen, dannsind alle gleichwertig. Sie machen mit diesem «und» stattdem Komma keinen Unterschied zwischen den verschiede-nen Früchten. Wenn hier «Zürich, Bern, Luzern .... Basel-Stadt und Basel-Landschaft .... Genf und Jura» steht, dannhaben Sie hier zwei «und» eingeführt, die ganz verschie-dene Gewichte haben. Das eine «und» soll, wie der Spre-cher es ausgeführt hat, den entsprechenden Kantonen einehalbe Standesstimme und einen Ständeratssitz wegneh-men. Das andere «und» ist dann einfach das abschlies-sende «und» in einer Aufzählung und hat diese Bedeutungnicht. Die Halbkantone sind sozusagen nur noch um einKomma vom vollen Status als Kantone entfernt. Sie wissen,dass zumindest die beiden Halbkantone der Nordwest-schweiz – Basel-Landschaft hat es in der Verfassung, in Ba-sel-Stadt wird es wohl von einer Bevölkerungsmehrheit ge-tragen – eigentlich diesen Wunsch schon lange hätten. Dieanderthalb Standesstimmen, die man dazu bräuchte, wer-den in Zukunft, wenn wir einmal die Gesetzesinitiative ein-führen, wohl weniger Bedeutung haben als in der Vergan-genheit. Das grössere Problem sind sicher die drei Stühle indiesem Saal, die man noch irgendwo plazieren müsste. Aberauch das liesse sich lösen.Ich habe mich schon gefragt, ob bei einer Nachführung derBundesverfassung im Hinblick auf die heutigen Gegebenhei-ten nicht endlich dem Selbstwertgefühl der Halbkantone,mindestens jener, die es so empfinden, Rechnung getragenwerden sollte. Ich verzichte selbstverständlich auf einen An-trag, denn ich will diesem Projekt keine Schwierigkeiten be-reiten. Aber ich möchte Ihnen klar sagen, dass aus Sicht derbeiden Nordwestschweizer Halbkantone das Problem offenbleibt und bald einmal gelöst werden sollte. Es ist im Grundegenommen ein Anachronismus, dass faktisch vollwertigeKantone immer noch in dieser wesentlichen, wenn auch nichtentscheidenden Weise behindert werden.
Koller Arnold, Bundesrat: Artikel 1 ist die konstituierende Be-stimmung der Schweizerischen Eidgenossenschaft. Die heu-tige Formulierung, an die sich der Bundesrat gehalten hat, istdie entstehungsgeschichtliche. Ihre Kommission schlägt vor,neben den Kantonen auch das «Schweizervolk» zu nennen.Es ist tatsächlich so, dass die Eidgenossenschaft heute jaauf zwei grossen Säulen ruht: der Volkssouveränität unddem Föderalismus. Deshalb kann ich dieser Formulierung,die zeitgemässer ist, zustimmen.Zu den Halbkantonen: Wir haben dieses «und» auf aus-drücklichen Wunsch der Konferenz der Kantonsregierungeneingeführt. Dadurch soll auf die historische Einheit der Halb-kantone hingewiesen werden.
Angenommen – Adopté
Art. 2Anträge der Kommissionen: BBlPropositions des commissions: FF
Frick Bruno (C, SZ), Berichterstatter: In Artikel 2 stimmt dieKommission inhaltlich und im Gehalt vollständig dem Bun-desrat zu. Wir haben lediglich eine Änderung in Absatz 3 vor-
20. Januar 1998 S 25 Bundesverfassung. Reform
Amtliches Bulletin der Bundesversammlung / Separatdruck
genommen. Der Bundesrat hat zwei Verben gebraucht: «sicheinsetzen» für die dauerhafte Erhaltung der Lebensgrundla-gen und «beitragen» zu einer friedlichen und gerechten inter-nationalen Ordnung.In der Kommission haben wir eingehend diskutiert, welchesder Gehalt der Wörter ist, welches für die Eidgenossenschaftverpflichtender ist; unser Bestreben war, beide Zwecke inAbsatz 3 gleichwertig zu normieren. Daher haben wir uns aufein Verb beschränkt, nämlich, dass wir uns für die Erhaltungder natürlichen Lebensgrundlagen und für eine friedliche undgerechte internationale Ordnung «einsetzen». Beide Ele-mente sollen gleich stark gewichtet sein.
Angenommen – Adopté
Art. 3Anträge der Kommissionen: BBlPropositions des commissions: FF
Aeby Pierre (S, FR), rapporteur: Nous sommes ici au centrede ce titre premier très fort, qui s’articule autour de cinq pointsqu’il n’est peut-être pas inutile de rappeler très brièvement.A l’article 1er, nous trouvons la structure du fédéralisme; àl’article 2, le but de la Confédération; à l’article 3, c’est le fé-déralisme fondé sur la souveraineté des cantons; ensuite,nous avons à l’article 3a nos quatre langues nationales, etenfin à l’article 4 l’Etat de droit. La commission a considéréqu’il s’agissait là des cinq éléments fondamentaux de notreEtat. C’est la raison pour laquelle la structure de ce titre pre-mier notamment a été modifiée.Pour l’article 3, le seul commentaire que je tiens à faire pourl’instant est le suivant: les alinéas 2 et 3 de la version du Con-seil fédéral n’ont pas disparu. Ces alinéas 2 et 3, vous les re-trouvez à l’article 34a alinéa 1er proposé par la commissionainsi qu’aux articles 36 et 37. Nous avons considéré que cesont des concrétisations du fédéralisme, mais que c’était as-sez éloigné du principe même de ce fédéralisme qui seul doitsubsister dans ce titre premier.La commission du Conseil national n’a pas eu le temps de sepencher sur la systématique du titre premier proposée par lacommission de notre Conseil, mais le Conseil national aural’occasion de le faire dans le courant de cette année. La com-mission ne s’est prononcée ni pour ni contre.Sans aucune opposition, la commission considère qu’aveccette structure, et avec le fédéralisme mentionné au centre,le titre devenant «Cantons» par opposition au titre del’article 1er «Confédération», c’est là une entrée en matièrequi se limite à l’essentiel, sans plus ni moins, de cette consti-tution.En l’occurrence, je vous encourage à voter la proposition dela commission.
Koller Arnold, Bundesrat: Ich möchte nur anmerken: In derSystematik haben wir eine gewichtige Differenz zwischendem Vorschlag des Bundesrates, dem die Nationalratskom-mission gefolgt ist, und dem Vorschlag des Ständerates. Wirwerden wahrscheinlich im Rahmen der Differenzbereinigungauf die unterschiedliche Systematik zurückkommen müssen.
Abstimmung – VoteFür den Antrag der Kommission 34 Stimmen
(Einstimmigkeit)
Art. 3aAnträge der Kommissionen: BBlPropositions des commissions: FF
Aeby Pierre (S, FR), rapporteur: Il suffit de rappeler, àl’article 3a, que le projet énumère ici un des fondements,comme je l’ai dit avant, de notre structure étatique. Les lan-gues officielles quant à elles, qui ne sont au nombre que detrois, sont énumérées à l’article 57h.
Angenommen – Adopté
Art. 3bAntrag Seiler BernhardTitelIndividuelle und gesellschaftliche VerantwortungWortlautIm Rahmen ihrer Fähigkeiten trägt jede Person Verantwor-tung für sich selbst sowie Mitverantwortung gegenüber Mit-menschen und Gesellschaft.
Antrag OnkenTitelIndividuelle und gesellschaftliche VerantwortungAbs. 1Jede Person soll ihre Fähigkeiten nach ihren Neigungen ent-falten und entwickeln können.Abs. 2Neben der Verantwortung für sich selbst trägt jede Person imRahmen ihrer Fähigkeiten Verantwortung gegenüber Mit-menschen und der Gesellschaft sowie Mitverantwortung da-für, dass die Wohlfahrt gefördert werden kann.Abs. 3Jede Person trägt dazu bei, dass das, was sie für sich bean-sprucht, auch den anderen möglich wird.
Proposition Seiler BernhardTitreResponsabilités individuelle et socialeTexteDans la mesure de ses possibilités, chacun est responsablede lui-même, et il est coresponsable des autres et de la so-ciété.
Proposition OnkenTitreResponsabilité individuelle et socialeAl. 1Toute personne doit pouvoir mettre en oeuvre ses capacitésselon ses aspirations.Al. 2Responsable d’elle-même, toute personne a en outre, dansles limites de ses capacités, une responsabilité envers autruiet la société ainsi qu’une coresponsabilité à l’égard des pos-sibilités de promouvoir la prospérité.Al. 3Toute personne contribue à permettre d’offrir aux autres cequ’elle exige pour elle-même.
Seiler Bernhard (V, SH): Die Totalrevision unserer Verfas-sung findet zu einem Zeitpunkt statt, da die schweizerischenSozialwerke schwer gefährdet sind, weil ihre mittel- und lang-fristige Finanzierung alles andere als gesichert ist. NachJahrzehnten beispielloser Hochkonjunktur, vorher nie erleb-ten Wohlstandes haben von Jahr zu Jahr steigende Begehr-lichkeiten, die in normierte, automatisierte Zahlungsverpflich-tungen umgesetzt wurden, das Fundament der Sozialwerkeangenagt, teilweise ausgehöhlt.Auch wenn wir uns zur Nachführung der Bundesverfassungbekennen, so ist ein Marschhalt, ein gründliches Überdenkender eingetretenen Situation, des überhaupt noch möglichenSozialstaates in einem wirtschaftlich angespannten Umfeld,unumgänglich und unausweichlich. Stellen wir uns anlässlichder Nachführung der Verfassung dieser Lagebeurteilung mitdem Ziel, die eingetretene Überforderung des Sozialstaatesauf ein tragbares, finanzierbares Mass zurückzuführen, dannist – sollen die Sozialwerke nicht vollends zum Einsturz ge-bracht werden – eine Rückbesinnung auf die Selbstverant-wortung eines jeden einzelnen für sich und seine Angehöri-gen notwendig und unausweichlich.Nur durch eine Erneuerung des Bekenntnisses zur Selbst-verantwortung, das an zentraler Stelle in der Bundesverfas-sung zu verankern ist, ist das verlorene, für die Zukunft derSozialwerke aber dringend erforderliche Gleichgewicht be-züglich Leistungsfähigkeit von Wirtschaft und Gewerbe undLeistungsbezug im Sozialstaat wieder herstellbar.
Constitution fédérale. Réforme 26 E 20 janvier 1998
Bulletin officiel de l’Assemblée fédérale / Tiré à part
Auf welchen Säulen wurden denn die schweizerischen So-zialwerke seinerzeit aufgebaut? Sie wurden ins Leben geru-fen aus dem Bekenntnis, dass der in Not Geratene, dass derNotleidende im Staat Hilfe erfahren sollte; nicht die allge-meine Umverteilung grosser Mittel war das Ziel. Die Hilfe anden in Not Geratenen, vor allem an den unverschuldet in NotGeratenen war Richtschnur bei der Schaffung der Sozial-werke.Solange das Bekenntnis zur Selbstverantwortung – unver-zichtbarer Teil menschlicher Freiheit überhaupt – solangedieses Prinzip beachtet und gelebt wurde, solange war dasGleichgewicht als Fundament der Sozialwerke gewährleistet;solange war die schweizerische Volkswirtschaft in der Lage,jene Mittel zu erarbeiten und bereitzustellen, die für dieschweizerischen Sozialwerke benötigt wurden. In der Hoch-konjunktur, als sich der Glaube durchsetzte, alles sei finan-zierbar, wurden zunehmend Begehrlichkeiten, die – wie sichheute zeigt – die Leistungskraft der Wirtschaft zu überfordernbegannen, in staatliche Zahlungsverpflichtungen umgewan-delt, welche das Fundament der Sozialwerke anzugreifen be-gannen.Doch Tatsache bleibt: Selbstverantwortung ist unverzichtba-rer Teil der persönlichen Freiheit. Wer nicht bereit ist, die Mit-tel zur Gestaltung seines nach selbstverantwortlich eigenenWertvorstellungen gestalteten Lebens zu erarbeiten, der ver-liert bald auch seine Freiheit. Zur Freiheit, wie sie schweize-rischen Wertvorstellungen entspricht, gehören der Föderalis-mus, die Dezentralisierung der politischen Macht zugunstengelebter Selbstverantwortung.Der Föderalismus, herausgewachsen aus dem schweizeri-schen Ideal der Freiheit, lebt von der Überzeugung, dass Be-hörden, denen innerhalb genau fixierter Grenzen Verantwor-tung übertragen worden ist, diese Verantwortung aus eigenerKraft zu erfüllen haben, auch bezüglich des Finanzhaushaltsmittels Abstimmung der Ausgaben auf die erhältlich zu ma-chenden Einnahmen. Dies ist die Ordnung, die der Souveränin diesem Land geschaffen hat, mit dem Ziel, Verschuldungzu vermeiden. Durchbrechen wir das Prinzip, dann fällt derFöderalismus, dann erniedrigt sich der Bund zur Futter-krippe, wo sich jeder zu bedienen sucht, der mit der ihm lokal,regional oder kantonal übertragenen Verantwortung nicht zu-rechtkommt. Nicht nur der Föderalismus fällt, sollte sich die-ses Ansinnen durchsetzen, sondern auch die direkte Demo-kratie, wie sie sich in unserem Land einzigartig in dieser Weltentwickeln konnte, wird im Rahmen der dann erforderlichen,sich durchsetzenden Zentralisierung entscheidende Einbrü-che hinzunehmen haben.Gelingt es nicht, in unserer Verfassung die gelebte Traditiondes echten, untrennbar mit Selbstverantwortung verbunde-nen Föderalismus neu zu erwecken, hätten die Schöpfer derTotalrevision versagt; dann dürfte eigentlich das neue Ge-bilde nicht verabschiedet werden.Ich bitte Sie daher: Stimmen Sie meinem Antrag zu Artikel 3bzu.
Onken Thomas (S, TG): Ich möchte zunächst einmal offenbekennen, dass mein Antrag nicht eigener Reflexion ent-springt, sondern dass ich ihn aus den nationalrätlichen Vor-arbeiten übernommen habe, genauso wie Kollege SeilerBernhard den seinen, den er ebenfalls von dort bezogen undnun in unseren Rat hineingetragen hat. Es ist nämlich so,dass sich unsere Kommission mit dieser Thematik der indivi-duellen und gesellschaftlichen Verantwortung nicht in einervertieften und grundsätzlichen Weise auseinandergesetzthat. Dies ganz einfach deshalb, weil dieses Thema dort nichtin Form von konkreten Anträgen eingebracht worden ist,ganz im Gegensatz zur nationalrätlichen Kommission. Diesehat darüber ausgiebig nachgedacht und auch wortschöpfe-risch versucht, Grundsätzliches zu dieser Frage in ihre Fas-sung des Grundgesetzes einzubringen.Ich finde – das muss ich hier vorweg sagen –, dass wir es zu-nächst dem Nationalrat überlassen sollten, diesen Problem-bereich auszuleuchten und darüber Beschluss zu fassen; wirsollten uns erst in der Differenzbereinigung damit auseinan-dersetzen. Denn in der Tat ist dieses Thema sehr viel kom-
plexer und weitläufiger, als es vielleicht aufgrund des Antra-ges Seiler Bernhard den Anschein macht.Um Ihnen diese Dimension aufzuzeigen, habe ich meinenAntrag eingebracht, der noch andere Aspekte einbezieht undzur Diskussion stellt.Sie sehen, dass Artikel 3b gemäss meinem Antrag aus dreiAbsätzen besteht. Die beiden ersten Absätze entsprechender Mehrheitsfassung der nationalrätlichen Kommission. Derdritte ist sozusagen die Grundlage zu einem neuen Gesell-schaftsvertrag, wenn Sie so wollen.Aber gerade auch der erste Absatz, den Kollege Seiler weg-lässt, entspricht dem liberalen Credo. Die Voraussetzung fürSelbstverantwortung ist zunächst, dass jeder Mensch auchdie Möglichkeit erhält, seine Talente, seine Stärken, seineBegabungen zu entfalten. Erst wenn er dadurch zu einer be-fähigten, mündigen und selbstbewussten Person herange-wachsen ist, ist er auch in der Lage, für sich Verantwortungzu übernehmen – für sich selbst und für die Gesellschaft, dieMitmenschen. Ich ergänze diesen Aspekt in Absatz 2 nochum eine Mitverantwortung auch dafür, dass Wohlfahrt für allegefördert werden kann.In Absatz 3 schlage ich vor – aber darüber hat der Nationalratnoch nicht gesprochen; es ist dort der Antrag der Minder-heit IV –, dass jede Person dazu beitragen soll, dass das,was sie für sich selbst beansprucht, auch anderen ermöglichtwird, dass sie eine Leistung also nicht nur als Privileg für sichwill, sondern bereit ist, Strukturen, Voraussetzungen weiter-zuentwickeln, um Chancengerechtigkeit herzustellen undauch anderen den Zugang dazu zu verschaffen.Dies nur ganz kurz, um aufzuzeigen, wie weitläufig, wie kom-plex diese Thematik ist. Ich halte dafür, dass wir diese Dis-kussion nun nicht im Plenum weiterführen; ich bin persönlichbereit, meinen Antrag sofort zurückzuziehen, wenn sich Kol-lege Seiler Bernhard zu dem gleichen Vorgehen bereit erklä-ren kann. Ich möchte ihn meinerseits dazu einladen.Wir werden zweifelsohne bei der Differenzbereinigung mitdieser Frage wieder konfrontiert werden. Aber was wollen wirhier im Plenum einen Antrag oder zwei Anträge ausdiskutie-ren, die in der Kommission nicht durch die entsprechendeVorbereitung für eine Plenumsdebatte reif gemacht wordensind?Ich ersuche Kollege Seiler, hier einzulenken, damit diese Dis-kussion seriös geführt werden kann, sobald der Nationalratbeschlossen hat und wir in der Differenzbereinigung mit demErgebnis dieser Debatte konfrontiert sein werden.
Rhinow René (R, BL), Berichterstatter: In der Tat hat dieKommission über einen gesonderten Artikel, welcher die in-dividuelle und gesellschaftliche Verantwortung zum Gegen-stand hat, nicht diskutiert. Aber sie hat trotzdem die Frage derindividuellen Verantwortung und namentlich die Frage derSubsidiarität an mehreren Stellen immer wieder berührt undauch Debatten darüber geführt. Es ist also nicht ganz zutref-fend, dass wir uns quasi um diese Thematik herumgeschlän-gelt hätten. Wir haben namentlich das Prinzip der Subsidiari-tät – sowohl was das Verhältnis des einzelnen zur Gesell-schaft als auch was das Verhältnis der Kantone zum Bundangeht – behandelt.Was die Verantwortung des einzelnen betrifft, verweise ichSie auf Artikel 10 – das Recht auf Existenzsicherung –, wodie Kommission eingefügt hat: «Wer in Not gerät und nicht inder Lage ist, für sich zu sorgen ....» – gegen den Widerstandeiner Kommissionsminderheit.Bei den Sozialzielen in Artikel 33 haben wir die Formulierun-gen in der Kommission ebenfalls ergänzt. Es heisst dort näm-lich: «Bund und Kantone setzen sich in Ergänzung zu priva-ter Initiative und persönlicher Verantwortung dafür ein ....»Wir haben also dieses Moment, dass man gerade im Sozial-bereich eine persönliche Verantwortung trägt, nicht überse-hen, sondern in mehreren Bestimmungen verankert. Wir wer-den beim Verhältnis von Bund und Kantonen ebenfalls aufeine Bestimmung stossen – ich habe sie beim Eintreten kurzerwähnt –, wo die Subsidiarität der Bundesaufgaben aus-drücklich festgehalten worden ist.
20. Januar 1998 S 27 Bundesverfassung. Reform
Amtliches Bulletin der Bundesversammlung / Separatdruck
Ich kann Ihnen also nicht im Namen der Kommission eine Ab-lehnung beantragen, ich kann nur dem widersprechen, dasswir das Problem nicht behandelt hätten. Aber gestatten Siemir noch eine persönliche Bemerkung zu dieser grundsätzli-chen Frage: Es handelt sich hier um eine Frage des Verfas-sungsverständnisses. Etwas zugespitzt gesagt: Die Verfas-sung möchte Freiheiten schützen, sie möchte den Staatsauf-bau regeln, sie möchte das Verhältnis der Bundesgewaltenordnen; sie möchte also Freiheit und Verantwortung in demSinne regeln, dass die Freiheit der Menschen und die Verant-wortung des Staates zum Thema gemacht werden. Siemöchte aber nicht, dass die gesamte Verantwortung des ein-zelnen Menschen auch verfassungsrechtlich vorgeschriebenwird. Die Verfassung soll nicht den Menschen «regeln»; siesoll die öffentliche Gewalt einbinden, die Kompetenzen undVerantwortungen der Bundesbehörden aufnehmen.Wenn wir eine solche Bestimmung über die individuelle Ver-antwortung in die Verfassung schreiben würden, könnte sichletztlich das Gutgemeinte ins Gegenteil verkehren, wäre esdann eine Verfassungspflicht, Verantwortung zu überneh-men, und nicht eine persönliche Pflicht, die sich auf andereWertgrundlagen abstützt.Zudem: Was machen denn die Verfassungsorgane mit einersolchen Bestimmung? Könnten sie – etwa das Bundesge-richt – einmal feststellen, jemand habe in einem bestimmtenLebensabschnitt seine Verantwortung nicht genügend wahr-genommen, man kürze ihm jetzt Leistungen oder schränkeseine Rechte ein, weil er sie verwirkt habe? Wer entscheidetdenn darüber, ob jemand die persönliche Verantwortung ge-nügend wahrgenommen hat? Soll der Staat entscheiden, obich mich verantwortlich verhalten habe? Das ist meines Er-achtens nur dann tragbar, wenn in der Rechtsordnung, imStrassenverkehr, beim Missbrauch von Leistungen usw. kon-kret gesagt wird, wo das der Fall ist. Aber nicht bei einem all-gemeinen Artikel, der gerade auch dem Richter Tür und Toröffnet – gegen und nicht für die Freiheit des einzelnen Men-schen.Darum möchte ich persönlich davon abraten, solche Bestim-mungen in die Verfassung aufzunehmen.
Aeby Pierre (S, FR): Nous sommes ici en présence de deuxpropositions, Seiler Bernhard et Onken, qui posent quelquesquestions quant à l’organisation de nos débats. Il convient derappeler qu’une constitution, dans le fond, ne peut se mettresur pied dans un Parlement aussi facilement qu’une loi ouqu’un arrêté et que chaque disposition est extrêmement im-portante et qu’elle doit faire l’objet d’une réflexion de basefondamentale. Ce n’est pas pour rien qu’on a parlé de pres-que 30 séances de commission hier pour montrer l’engage-ment du Parlement dans cette révision ou cette mise à jour.A l’heure actuelle, il y a une vingtaine de propositions indivi-duelles qui ont été déposées, en plus des 10 à 12 proposi-tions de minorité. La plupart des propositions individuellestouchent à des questions qui ont été débattues de façon trèsexhaustive en commission. Ici, en revanche, nous avonsdeux propositions qui font partie d’un paquet de six variantes,desquelles va discuter le Conseil national. Les six variantesdu Conseil national sont: le projet du Conseil fédéral, uneproposition de majorité et quatre propositions de minorité.Voilà la situation au Conseil national en ce qui concernel’article 3b. De notre côté, si nous avons évoqué la questionde la responsabilité personnelle en commission, nous l’avonsassez vite écartée pour les raisons que M. Rhinow, présidentde la commission, vient d’expliquer.Il me semble donc extrêmement important de faire preuve deprudence et de sagesse, alors que nous entamons nos déli-bérations, et de rejeter aussi bien la proposition Onken quela proposition Seiler Bernhard. Si, d’aventure, le Conseil na-tional retient une des quatre propositions de minorité ou laproposition de la majorité de sa commission, nous auronstout loisir, dans le courant de cette année et lors de la procé-dure d’élimination des divergences, de nous pencher de fa-çon beaucoup plus approfondie que ce que nous avons faiten commission sur les propositions Onken et Seiler Bern-hard.
Je vous encourage donc vivement à rejeter ces propositionset à adopter la version de la commission, c’est-à-dire pasd’article 3b, et notamment pas dans le titre premier où j’ai dittout à l’heure qu’il s’agissait vraiment de se limiter aux cinqfondements essentiels de notre Etat démocratique, libéral etsocial.
Frick Bruno (C, SZ): Einige persönliche Gedanken, nicht inmeiner Eigenschaft als Präsident der Subkommission 1:Die Anregungen – sowohl jene von Herrn Seiler Bernhard alsauch jene von Herrn Onken – finde ich sehr interessant.Herr Rhinow hat das traditionelle Verfassungsverständnis er-wähnt, das davon ausging, den Bürger vor dem Staat zuschützen und seine Freiheiten und Rechte zu gewährleisten.Man kann sich aber durchaus fragen, ob nicht auch der Bür-ger selber gegenüber dem Staat Pflichten hat, die grundle-gend für das Verfassungsverständnis sind. Also geht es umein Verfassungsverständnis, das nicht bloss den Schutz desBürgers, sondern auch dessen Mitwirkung zum Gegenstandhat. Das ist eine Weiterentwicklung des traditionellen undheute aktuellen Verfassungsverständnisses.Ich habe aber grosse Probleme, wenn wir diese Fragen heutedirekt aus dem Stand heraus diskutieren. Anregungen, die imNationalrat gemacht werden, sollen dort behandelt werdenund können dann, wenn der Nationalrat entschieden hat, inder Kommission unseres Rates gründlich vorberaten werden.Ich kann mich mit der Anregung von Herrn Onken sehr gutbefreunden. Nun glaube ich aber, dass eine Bestimmung,wie sie die Herren Onken und Seiler anregen – wenn wir sietatsächlich in die Verfassung aufnehmen wollten –, bei denArtikeln 1 bis 5, die das Wesen des Staates definieren, sicheram falschen Platz wäre. Wenn wir sie aufnehmen wollten,müssten wir sie bei den Grundrechten und den Grundpflich-ten unterbringen.Ich bitte daher, dass wir diese Diskussion in der Kommissionaufnehmen, sie aber hier zurückstellen. Wir haben in derKommission noch Zeit, uns mit dieser Sache zu befassen,nämlich dann, wenn der Nationalrat über seine Kommis-sionsanträge beschlossen hat.
Wicki Franz (C, LU): Die Beratung, die wir jetzt haben, erin-nert mich an die Beratung in unserer Subkommission. In un-serer Subkommission habe ich seinerzeit die Idee einge-bracht, man solle sich doch bewusst sein, dass die Bürgerin-nen und Bürger gegenüber dem Staat auch Pflichten, nichtnur Rechte haben, dass der Staat eigentlich aus der Arbeit,aus dem Mitwirken des einzelnen Bürgers lebt. Wir habendann verschiedene Lösungen gesucht, die in die Richtungdes Antrages Seiler Bernhard gingen. Wir haben die Überle-gungen, die uns Herr Seiler heute mit seinem Antrag vorträgt,ebenfalls gemacht. Wir haben den Standort gesucht, wo wireine solche Bestimmung unterbringen wollen. Uns ist esnicht gelungen, eine Lösung zu finden.Es ist an sich auch mein Anliegen, in der Richtung des Antra-ges Seiler Bernhard vorzugehen. Ich glaube aber aufgrundall dieser Diskussionen, die wir gehabt haben, nicht, dass wireine entsprechende Lösung finden können, denn die Beden-ken, die uns Herr Rhinow vorhin vorgetragen hat, bestehentatsächlich. Ich widersetze mich also nicht dem Begehren,das Anliegen in die Kommission zurückzunehmen, aber ma-chen Sie sich keine falschen Hoffnungen.
Schmid Carlo (C, AI): Ich erinnere mich sehr gerne an dasVotum unseres Kommissionspräsidenten zu Beginn dieserDebatte, als er uns erklärt hat, dass es hier, auch wenn manden Titel des Bundesbeschlusses A nun ändert, eben dochim wesentlichen um eine Nachführung geht. Die Kommissionhat sich darauf beschränkt zu schreiben, was nicht geschrie-ben ist, und Ergänzungen wirklich nur dort zu machen, wo siein weitesten Kreisen unbestritten sind.Hier haben wir eine materielle Differenz, die nicht ausdisku-tiert ist, eine materielle Differenz über das Verfassungsver-ständnis insgesamt. Ist der Bund überhaupt in der Lage, ge-genüber seinen Bürgern allgemeine Verhaltensvorschriftenaufzustellen? Mit unserem Präsidenten verneine ich das.
Constitution fédérale. Réforme 28 E 20 janvier 1998
Bulletin officiel de l’Assemblée fédérale / Tiré à part
Herr Wicki ist offenbar anderer Auffassung. Das allein zeigt,dass hier noch kein ausdiskutierter Grundkonsens da ist.Das führt für mich dazu, diese beiden Anträge ohne weiteresabzulehnen.
Bisig Hans (R, SZ): Ich habe herausgehört, dass die Kom-mission bereit ist, diese Problematik zurückzunehmen, damitwir hier nicht eine Kommissionssitzung veranstalten müssen.Ich persönlich würde das unterstützen.Ich mache in diesem Zusammenhang lediglich einen Hin-weis. Unter zwei Titeln, die wortwörtlich gleich lauten, sindzwei völlig unterschiedliche Anliegen formuliert worden: Ei-nerseits der Antrag Seiler Bernhard, den ich vom Sinne hervollumfänglich unterstützen kann. Aus meiner Sicht macht esSinn, dass in der Verfassung die Selbstverantwortung nichtversteckt in Nebensätzen, sondern klar und deutlich veran-kert ist. Auf der anderen Seite liegt aber unter dem gleichenTitel der Antrag Onken vor, der etwas ganz anderes will. Ersagt das im Absatz 1 mit aller Deutlichkeit: Er will Rechte de-finieren, nicht Pflichten. Herr Seiler Bernhard will Pflichtenformulieren, Kollega Onken Rechte. Er will, dass die Fähig-keiten nach ihren Neigungen entfaltet werden können, werauch immer das besorgen oder bezahlen muss. Das sind fürmich zwei völlig unterschiedliche Sachen.Wenn man sich in eine der beiden Richtungen bewegt – fürmich zwei völlig unterschiedliche Richtungen –, dann sollman auch die entsprechenden Titel dazu wählen und nichtmit dem Titel Pflichten vorgeben und nachher im Text Rechteverlangen.
Seiler Bernhard (V, SH): Mein Antrag ist ebenfalls in der na-tionalrätlichen Kommission ein Minderheitsantrag, wie esHerr Onken gesagt hat. Nun stelle ich fest, dass verschie-dene Kolleginnen und Kollegen der Meinung sind, dass dieseSelbstverantwortung des Bürgers vielleicht doch irgendwo anzentraler Stelle verankert sein müsste. Es ist vom Präsiden-ten der Kommission ausgeführt worden, dass da und dort, inArtikel 10 und anderen, diese Selbstverantwortung im Zu-sammenhang mit den Sozialwerken erwähnt werde. Das istrichtig, das verstehe ich.Ich meine aber, das ist ein so zentrales, wichtiges Anliegen,dass man es noch speziell in einem Artikel aufführen sollte.Ich verstehe auch, wenn die Kommission findet, man solltedarüber nochmals sprechen können. Wenn mir die Kommis-sion verspricht, dass sie das nochmals tut, nochmals darüberredet und vielleicht einen Antrag macht oder eine Minderheiteinen Antrag bringt, dann würde ich jetzt sagen, ich verzichteheute darauf, dass darüber abgestimmt wird. Aber ich weissnatürlich: Wenn es im Nationalrat hinausfällt, also nicht mehrdrin ist, wird unsere Kommission wahrscheinlich sagen, dieSache sei jetzt erledigt, wir bräuchten jetzt auch nicht mehrdarüber zu reden. Für diesem Fall würde ich natürlich jetztdie Abstimmung verlangen.Wenn die Kommission mir heute erklärt, dass sie das Anlie-gen tatsächlich nochmals aufnimmt, unabhängig davon, wasim Nationalrat passiert, verzichte ich heute auf eine Abstim-mung.
Rhinow René (R, BL), Berichterstatter: Wir werden hier aufjeden Fall eine Differenz haben, wenn im Nationalrat ein ent-sprechender Artikel beschlossen wird. Wenn es Ihr Wunschist, werde ich dieses Anliegen gerne traktandieren. Denn dieKommission wird in diesem Jahr mehrere Sitzungen abhal-ten, und wir werden eine Differenzbereinigung durchführenmüssen. Zudem ist beim Teil A2 der Nationalrat Erstrat, sodass die Kommission in diesem Bereich ihre Anträge noch-mals überprüfen muss. Als Kommissionspräsident sichereich Ihnen also gerne zu, dass wir dieses Anliegen in der Ple-narkommission traktandieren werden. Ich kann nur kein Er-gebnis garantieren.
Koller Arnold, Bundesrat: Es geht bei diesen Anträgen Sei-ler Bernhard und Onken um eine Frage des Verfassungsver-ständnisses. Wir haben diese Fragen auch im Bundesratdiskutiert: Für den Bundesrat muss die Verfassung, mit Aus-
nahme der Präambel – wo wir, wie gesagt, Platz für Visio-nen und ethische Appelle haben –, Teil der Rechtsordnungsein. Sie legt die Kompetenzen der staatlichen Organe fest,begründet Rechte und – durchaus überlegenswert, HerrWicki – auch Pflichten; die Wehrpflicht ist schon drin, dieSteuerpflicht ergibt sich indirekt aus der Verfassung. Immergeht es aber um rechtlich durchsetzbare Normen.Was nun hier vorgeschlagen wird, ist eigentlich ein ethischerAppell. Dieser ist zwar zweifellos berechtigt, doch wir müs-sen uns fragen, ob wir der Verfassung einen Dienst erweisen,wenn wir rein ethische Appelle, die rechtlich nicht durchsetz-bar sind, in die Verfassung aufnehmen. Diese Grundfragehaben wir zu entscheiden.Der Bundesrat ist der Meinung, wir sollten wirklich nur Nor-men in unsere Verfassung aufnehmen. Radikale ethischeAnsprüche, die zweifellos völlig berechtigt sind, lassen sich ineinem liberalen Rechtsstaat nicht durchsetzen, wenn die ein-zelnen Bürgerinnen und Bürger diese Appelle nicht erhören.Das ist der Grund, weshalb wir derartigen Vorschriften, die ei-gentlich keine normative Substanz haben, sehr skeptisch ge-genüberstehen.Die Verfassung soll, wie gesagt mit Ausnahme der Präambel,keine gesellschaftspolitische Utopie werden, sondern Be-standteil der obersten rechtlichen Grundordnung bleiben.Deshalb sollten wir nach Auffassung des Bundesrates wirk-lich nur Vorschriften aufnehmen, die wir rechtlich durchset-zen können. Das sind die Gründe, weshalb wir solchen Vor-schlägen gegenüber sehr skeptisch eingestellt sind.Die andere Frage hingegen kann man ruhig nochmals auf-nehmen: Rechtlich durchsetzbare Pflichten haben durchausauch ihre Berechtigung; da ist vielleicht das liberale Ver-ständnis, gemäss dem wir uns auf einen reinen Grundrechts-katalog beschränken, noch nicht das Optimum. Überall dort,wo wir diesen ethischen Appellen normative Substanz gebenkönnen – Herr Rhinow hat es beim Recht auf Existenzsiche-rung, bei den Sozialzielen erwähnt, wo wir auf das Subsidia-ritätsprinzip verweisen –, können die rechtsanwendendenBehörden die rechtliche Umsetzung vornehmen.Der Bundesrat möchte lieber von diesem Verfassungsbildausgehen und ist gegenüber solchen Vorschlägen aus dengenannten Gründen skeptisch. In der nationalrätlichen Kom-mission gab es eine relativ starke Mehrheit; also werden Siein der Differenzbereinigung nochmals die Möglichkeit haben,sich mit diesem Problem auseinanderzusetzen.
Abstimmung – Vote
Eventuell – A titre préliminaireFür den Antrag Seiler Bernhard 29 StimmenFür den Antrag Onken 4 Stimmen
Definitiv – DéfinitivementFür den Antrag Seiler Bernhard 11 StimmenDagegen 21 Stimmen
Art. 4Anträge der Kommissionen: BBlPropositions des commissions: FF
Inderkum Hansheiri (C, UR), Berichterstatter: Der Antragder Kommission bezüglich dieses Artikels 4 enthält gegen-über dem Antrag des Bundesrates zwei Abweichungen,nämlich im Titel und in Absatz 3. Herr KommissionspräsidentRhinow hat bereits darauf hingewiesen, dass die «Grund-sätze staatlichen Handelns» gemäss Entwurf des Bundesra-tes durch die Kommission als «Grundsätze rechtsstaatlichenHandelns» bezeichnet werden. Damit soll verdeutlicht wer-den, dass in den Artikeln 1 bis 4 die Wesensmerkmale desschweizerischen Staatswesens sichtbar gemacht werden.Und eines dieser Wesensmerkmale besteht eben in derRechtsstaatlichkeit.Artikel 4 enthält also die wichtigsten Grundsätze unseresRechtsstaates: das Legalitätsprinzip in Absatz 1, weiter dasPrinzip, wonach alles staatliche Handeln im öffentlichen In-teresse liegen und verhältnismässig sein muss (Abs. 2), und
20. Januar 1998 S 29 Bundesverfassung. Reform
Amtliches Bulletin der Bundesversammlung / Separatdruck
schliesslich das Prinzip von Treu und Glauben (Abs. 3).Diese Grundsätze gelten heute als anerkannt.Bei Absatz 1 drehte sich eine lange und teilweise hochste-hende Diskussion um die Frage, ob nicht – nebst den Grund-sätzen des Rechtes – auch Grundsätze anderer Ordnungs-prinzipien, insbesondere solche der Ethik, zu verankernseien. Wir mussten aber feststellen, dass wir in eine rechts-philosophische Dimension eingedrungen waren, so dass wirmit Blick auf die grundsätzlichen Schwierigkeiten, dieses An-liegen gesetzgeberisch zu verankern, von dem durchauswünschenswerten Vorhaben – um so mehr, als es im Rah-men einer Nachführung geschieht – absehen mussten. Eserscheint mir aber in diesem Zusammenhang der Hinweisausserordentlich wichtig, dass natürlich der Begriff Recht im-mer auch einen Bezug zum Gerechten hat und insofern nichtnur eine formale, sondern vor allem eine materielle Kompo-nente aufweist.In Absatz 3 beantragt die Kommission, die staatlichen Or-gane durch die «Behörden» zu ergänzen. Der Grund bestehtdarin, dass nicht alle Behörden staatliche Organe sind. DerBegriff der staatlichen Organe ist im Rahmen von Artikel 4,der eben das Merkmal der Rechtsstaatlichkeit unseres Staa-tes zum Ausdruck bringen will, zu eng; es dürfte nämlich un-bestritten sein, dass vor allem auch staatliche Behördennach Treu und Glauben zu handeln haben.Bleibt schliesslich Absatz 4, wonach Bund und Kantone dasVölkerrecht zu beachten haben. Zur Kennzeichnung desRechtsstaates Schweiz gehört auch die Beachtung des Völ-kerrechtes. Ich möchte aber betonen, dass wir mit Absatz 4von Artikel 4 gegenüber der heutigen Praxis in der RelationVölkerrecht/Landesrecht nicht etwas Neues einführen; esgeht insbesondere nicht etwa um einen generellen Vorrangdes Völkerrechtes. Vielmehr soll das festgeschrieben wer-den, was bereits heute gilt; wir befinden uns also strikte imRahmen der Nachführung.Heute gilt ja, wenn ich das pro memoria festhalten darf, imVerhältnis völkerrechtlicher Vertrag/Bundesverfassung, dassein völkerrechtlicher Vertrag einer allenfalls widersprechen-den Norm der Bundesverfassung vorgeht – ich verweisedazu auf Artikel 113 Absatz 3. Im Verhältnis völkerrechtlicherVertrag/Bundesgesetz gilt die sogenannte «Schubert-Pra-xis», wonach ein Bundesgesetz, das einem völkerrechtlichenVertrag widerspricht, diesem ausnahmsweise dann vorgeht,wenn der Bundesgesetzgeber beim Erlass des Gesetzes be-wusst vom entsprechenden Staatsvertrag abweichen wollte.Durch den abgeschwächten Begriff «beachten» soll deutlichzum Ausdruck gebracht werden, dass die «Schubert-Praxis»weiterhin verfassungsmässig abgedeckt ist. Ich verweise indiesem Zusammenhang auch auf den inhaltlich deckungs-gleichen Artikel 180.
Rhinow René (R, BL): Ich möchte – persönlich, nicht alsKommissionspräsident, aber vielleicht beruflich etwas vorbe-lastet – hier eine kleine Fussnote zuhanden der Materialienanbringen. Es findet sich nämlich in diesem Artikel 4 einhochinteressanter Versuch, die rechtsstaatlichen Grund-sätze allgemein zu verankern, ein Versuch, der rechts- oderstaatstheoretisch nicht ganz unbedenklich erscheint, na-mentlich was die Begriffe «öffentliches Interesse» und «ver-hältnismässig» in Absatz 2 betrifft.Dieselben Begriffe erscheinen ja in Artikel 32 noch einmal,dort aber bei der Einschränkung von Grundrechten. Dort sindsie auch entwickelt worden, und dort haben sie in der bishe-rigen Praxis und in der Literatur eine gefestigte Bedeutungerhalten. Ähnliches gilt im übrigen für die Begriffe «Treu undGlauben», die hier erwähnt werden, aber in Artikel 8 noch-mals erscheinen und dort als verfassungsmässiges Rechtaufgefasst werden.Hier in Artikel 4 sind diese Begriffe auf die gesamte Staatstä-tigkeit bezogen, und es ist eigentlich offen, was sie wirklichbedeuten. Ich wende mich nicht gegen die Verankerung die-ser Begriffe. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass es einVersuch ist, eine solche allgemeine Bestimmung gleichsamzu Beginn der Verfassung festzuschreiben. Denn hier, nicht
bei der Grundrechtseinschränkung, ist das öffentliche Inter-esse – oder vielleicht wäre es besser, zu sagen: sind die öf-fentlichen Interessen – in erster Linie vom Gesetzgeber zubestimmen und zu entfalten. Es wird an uns sein zu sagen,was «öffentliches Interesse» bedeutet. Insofern ist es mehrein Fensterbegriff, der auf das Staatsverständnis verweist,aber kaum positive Steuerungskraft für die konkretisierendePolitik enthalten dürfte.
Koller Arnold, Bundesrat: Mit der Ergänzung der Rechts-staatlichkeit schliesse ich mich dem Antrag der Kommissionan.
Angenommen – Adopté
Art. 5Anträge der Kommissionen: BBlPropositions des commissions: FF
Präsident: Artikel 5 wird wegen Artikel 3a gestrichen.Ich kann mich von Herrn Bundesrat Koller verabschieden,der uns verlassen und sich in den Nationalratssaal zur Eintre-tensdebatte begeben wird.Wir werden die Detailberatung mit Herrn Bundesrat Leuen-berger fortsetzen, dem stellvertretenden Vorsteher des Ju-stiz- und Polizeidepartementes.
Angenommen – Adopté
Antrag Brunner Christiane(die Änderung betrifft nur den französischen Text)
Proposition Brunner ChristianeModification de la formulation du texte français de la consti-tution selon les quatre principes suivants:1. Remplacer le vocable «homme» par «être humain» (ex.:«Tous les hommes sont égaux devant la loi» devient «Tousles êtres humains ....» à l’art. 7).2. Utiliser, chaque fois que cela est possible, une formuleneutre, qui ne nécessite pas l’emploi du masculin et du fémi-nin (ex.: «Le droit de vote s’exerce au lieu de leur domicile»au lieu de «Les citoyens exercent leur droit de vote au lieu deleur domicile» à l’art. 47).3. Mentionner le masculin et le féminin à chaque définition degroupe de personnes (ex. «Les citoyennes et citoyens ....»au lieu de «Les citoyens ....» à l’art. 2).4. Mettre tous les titres et fonctions au féminin comme aumasculin (ex.: «La présidente ou le président de la Confédé-ration» au lieu de «le président» à l’art. 164).
Brunner Christiane (S, GE): Au début du développement dema proposition, j’aimerais dire tout d’abord que ce débat etcette proposition ne concernent pas seulement nos collè-gues de Suisse romande ou de Suisse italienne, mais égale-ment nos collègues de Suisse alémanique. Nous parlonsaujourd’hui de la Constitution fédérale. Celle-ci est rédigéeen trois langues, nos trois langues nationales. Nous n’avonspas un débat et nous ne nous déterminons pas sur la puretéde la langue française, mais nous nous déterminons, en tantque Parlement, sur le texte de notre Constitution fédérale.Or, je sais bien qu’il est difficile pour les collègues suissesalémaniques de suivre ma proposition dans la mesure où letexte allemand, le texte français et le texte italien, respective-ment, ne correspondent pas et que vous n’avez pas sur le dé-pliant en allemand la même formulation que ce qui figuredans le texte en français.En français, à l’article 7, il y a un astérisque qui précise que,«dans la constitution, les termes génériques tels que’homme’, ’personne’ ou ’Suisse’, ainsi que les fonctions tellesque juge, officier ou député s’appliquent indistinctement auxpersonnes des deux sexes», alors qu’en allemand il n’a pasété nécessaire de mettre un tel astérisque puisque le pro-blème est réglé directement dans le texte, tel qu’il est formuléen langue allemande.
Constitution fédérale. Réforme 30 E 20 janvier 1998
Bulletin officiel de l’Assemblée fédérale / Tiré à part
Je peux vous dire cependant que les femmes de Suisse ro-mande ne sont pas d’accord avec le fait de leur ancrage dansla Constitution fédérale ou de leur reconnaissance dans lasociété simplement sous forme d’un astérisque à un articleoù l’on dit: «Voilà, vous êtes comprises dans toutes les for-mulations masculines que nous avons, par ailleurs, utiliséesdans le texte de la Constitution fédérale.»Un certain nombre de nos collègues, qui se sont aussi expri-més dans le débat d’entrée en matière, pensent que la formu-lation, telle que je la propose pour l’ensemble de la Constitu-tion fédérale en français, serait incorrecte, impure par rapportaux avis donnés notamment par l’Académie française. En re-fusant de suivre les conseils ou les prescriptions de l’Acadé-mie française, nous irions à l’encontre de la pureté de la lan-gue française.A cet égard, j’aimerais dire que l’Académie française a étéinstituée au XVIIe siècle, que depuis le XVIIe siècle trois fem-mes ont été élues au sein de l’Académie française et que lapureté de la langue française, telle qu’elle est déterminée parl’académie, est en fait déterminée exclusivement par deshommes qui ont, bien sûr, décrété sans problème que lemasculin comprend aussi le féminin.Les tâches de l’Académie française ont été fixées en 1637 etelles ont extrêmement peu évolué depuis lors. Ces tâchesétaient les suivantes: l’académie devait nettoyer la languedes ordures qu’elle avait contractées dans la bouche du peu-ple ou dans la foule du palais et sa fonction principale était detravailler avec tout le soin et toute la diligence possibles àdonner des règles certaines à notre langue française, à larendre pure, éloquente et capable de traiter des arts et dessciences. Par là même, il s’agissait essentiellement de privi-légier la langue parisienne d’où toute tournure provinciale ourégionale devait être bannie.Par rapport à l’Académie française, en Suisse romande,nous sommes une province. Nous sommes plus qu’une pro-vince, nous sommes un pays, un pays indépendant avec nosrègles propres, y compris en matière linguistique. On admet,par exemple, sans problème en Suisse romande de dire«huitante» ou «nonante», et on ne dit pas «quatre-vingt-dix».Pourquoi alors ne pas admettre aussi de parler d’«être hu-main» et non pas de parler seulement d’«homme»? Pourquoine pas dire «les citoyennes et les citoyens» au lieu de parlerseulement de «citoyens»? En général, dans notre pays, noussommes fiers de nos particularités par rapport à nos grandsvoisins. C’est à juste titre que nous sommes fiers de nos par-ticularités, mais à ce moment-là nous devons aussi être fiersde nos particularités linguistiques. Je suis frappée de voir queles puristes de la langue française se comportent comme sile français ne nous appartenait pas en propre, mais commes’il nous avait été prêté par la France et pratiquement prêtésous un régime de haute surveillance puisque c’est depuis laFrance que l’on contrôle la pureté de la langue française. Ence sens, je crois que celles et ceux qui défendent la pureté dela langue française dans les textes de la Constitution fédéraleou dans les textes législatifs, par rapport à des critères lin-guistiques fixés par l’Académie française, se soumettent à unrégime qui n’est pas celui que nous souhaitons avoir dansnotre pays.L’autre élément que je voudrais ajouter, c’est que je ne trouvepas acceptable que la Constitution fédérale, notre loi fonda-mentale, soit écrite en trois versions différentes, en trois ver-sions qui ne correspondent pas, notamment en allemand, enfrançais et en italien. Lorsqu’en allemand on dit «Bürger undBürgerinnen», il est, il me semble, évident que l’on dise aussien français «les citoyennes et les citoyens». Ce n’est pas unproblème de traduction, ce n’est pas un problème d’incompa-tibilité avec la langue française, c’est simplement une ques-tion de volonté politique. Je suis persuadée que, notammentdans la Constitution fédérale, nos trois versions de la Consti-tution fédérale doivent être identiques, sinon le but même dela révision de la Constitution fédérale ne serait pas atteint.Toute personne doit être concernée par cette révision, elledoit se retrouver dans le texte de notre constitution et cetteconstitution révisée doit être un instrument moderne, adaptéà l’évolution de la société. Il serait à tout le moins dommage
de dépoussiérer la Constitution fédérale et de laisser les fem-mes romandes et suisses italiennes avec ce sentiment d’êtremises à l’écart.Je sais bien – il n’y a qu’à voir l’intérêt que cela suscite danscette salle – que les hommes ne peuvent pas se sentir con-cernés par ce débat. Je le comprends d’ailleurs, car per-sonne ne leur a jamais dit «Monsieur la Députée» ou «Mon-sieur la Présidente». Donc, je comprends que les hommes nepartagent pas la sensibilité que les femmes peuvent avoir àcet égard; je leur demande simplement d’y être attentifs et dela comprendre.Les choses ont évolué, on ne dit plus «Madame le Président»ou «Madame le Député». Les femmes suisses alémaniquesont pu transformer la langue et faire admettre que l’on écrivetoutes les dénominations au féminin ou au masculin ou bienqu’on trouve d’autres formulations qui ne sont pas des formu-lations sexistes. De toute façon, je crois que les femmes deSuisse romande et du Tessin gagneront une fois cette ba-taille. Ce que je vous demande instamment, c’est de montrerdans le texte de notre constitution que cette volonté existe etqu’il serait dommage que notre nouvelle Constitution fédé-rale soit à la traîne d’une évolution de la société qui, manifes-tement, est en marche et qui aboutira de toute façon.Encore une fois, je ne souhaite évidemment pas déposer despropositions de changement à chaque article. Je propose lesquelques principes de rédaction suivants: remplacer des vo-cables tels que «homme» par «être humain»; utiliser chaquefois que cela est possible une formule neutre qui ne nécessitepas l’emploi du masculin ou du féminin, par exemple dire «lapersonne étrangère» au lieu de dire «les étrangers», «le droitde vote s’exerce au lieu du domicile» au lieu de dire «les ci-toyens exercent leur droit de vote au lieu de leur domicile»;dans les autres cas, lorsqu’il s’agit de définitions de groupesou de fonctions, de faire exactement comme en allemand etd’utiliser «les citoyennes et les citoyens» et pas seulement«les citoyens», d’utiliser «le président ou la présidente de laConfédération» et pas seulement le terme au masculin. Ils’agit peut-être d’un détail, mais celui-ci a une importancefondamentale pour la reconnaissance des femmes dans leurancrage constitutionnel.Si vous suivez ma proposition, y compris en intervenant de lapart des Suisses alémaniques ou en votant de la part desSuisses alémaniques dans ce sens, je pense que l’on aurafait oeuvre utile en matière de loi fondamentale.
Cavadini Jean (L, NE): Nous avons hier, de façon nous sem-blait-il substantielle et approfondie, donné l’explication querequiert la proposition Brunner Christiane. J’aimerais redirece que M. Aeby avait demandé. Il souhaitait que cette ques-tion puisse être définitivement élucidée à la fin des travauxque nous conduisons dans les deux Chambres. C’est le pre-mier point; il relève du calendrier. Personnellement, je sou-haite que nous ne tranchions pas aujourd’hui sur la proposi-tion Brunner Christiane.Quant au fond, nous n’allons pas rouvrir le dossier. Nousavons donné les arguments qui ont été, premièrement, ceuxde la Commission de rédaction de langue française et,deuxièmement, ceux de la Commission de la révision consti-tutionnelle pour ne pas entrer en matière de façon systéma-tique sur la proposition Brunner Christiane, mais pour mettreles accents qui s’imposent là où ils peuvent être mis norma-lement, sans forcer la langue, tout en étant parfaitement res-pectueux du principe de l’égalité. Nous avons démontré quel-ques impossibilités, mais partout où cela est possible, noussommes bien entendu disposé à partager le point de vue deMme Brunner pour que ce sentiment d’égalité puisse trouversa traduction constitutionnelle. Mais il ne nous paraît pas bonaujourd’hui et maintenant, dans la forme proposée, de pren-dre la décision souhaitée.
Präsident: Wenn ich Herrn Cavadini richtig verstehe, stellt ereigentlich einen Ordnungsantrag: Abwarten, bis die Redakti-onskommission den französischen Text bereinigt hat und an-schliessend über den Antrag Brunner Christiane entschei-den. Habe ich das richtig verstanden?
20. Januar 1998 S 31 Bundesverfassung. Reform
Amtliches Bulletin der Bundesversammlung / Separatdruck
Cavadini Jean (L, NE): Vous avez bien sûr parfaitement com-pris, Monsieur le Président, à cette nuance près que nous neferons pas l’économie d’une décision du plénum de notreConseil à la fin de nos travaux, parce qu’on ne va pas com-mencer à se battre pour savoir si l’on va parler d’«être hu-main», de «personne», de «personne humaine», d’«homme»au sens restreint ou au sens large. Mais nous allons tenter devoir quelle forme prend le texte que nous étudions en ce mo-ment dans les deux Chambres. A la fin de ces travaux, nousaurons, nous vous le proposons, une dernière décision àprendre sur la formulation en langue française des disposi-tions retenues, mais il est sage de reporter cela à la fin de nostravaux, comme l’a préconisé M. Aeby hier. Il est inutile deprendre une décision de principe aujourd’hui qui serait cons-tamment mise à mal par nos délibérations, par des amende-ments et par des modifications.
Aeby Pierre (S, FR): Je partage le point de vue de M. Cava-dini. Cela me semble toutefois aller dans le sens de la propo-sition Brunner Christiane, en ce sens que, si vous prenezcette proposition, vous voyez qu’elle est un mandat rédac-tionnel qui pose quelques principes. Je crois que ces princi-pes sont ceux que nous avons tout de même essayé, bon anmal an, d’appliquer dans le texte français. En ce qui concerneles chiffres 2, 3 et 4 – si on veut laisser en suspens lechiffre 1, parce qu’il y a cette question d’«homme» et d’«êtrehumain» dont on peut discuter –, je recommanderai, commerapporteur pour cette partie et comme personne de languematernelle française, d’accepter tout de même la propositionBrunner Christiane.Sur la notion des droits de «l’homme», le débat risque decontinuer, voire d’être tranché dans cette salle d’ici la fin del’année. Mais je crois qu’il faut un mandat clair. C’est aussi unsigne à donner à toutes les femmes de langue française dela Suisse qu’au Conseil des Etats, on se préoccupe un tantsoit peu du sort que leur réserve la constitution.Il faut donc entrer en matière maintenant sur la propositionBrunner Christiane. Il faut accepter en tout cas ses chiffres 2,3 et 4, pour que l’on puisse vraiment faire le travail souhaitépar M. Cavadini d’ici la fin de nos débats.
Beerli Christine (R, BE): Erlauben Sie mir, zu Ihrer Informa-tion nur ein ganz kleines Element in diese Diskussion einzu-fügen. Der zweisprachige Kanton Bern hat im Jahre 1993grossmehrheitlich eine Verfassung angenommen, die in ihrerfranzösischsprachigen Version absolut den Elementen ent-spricht, wie sie im Antrag Brunner Christiane enthalten sind.Das zur Information. Es ist machbar.
Brunner Christiane (S, GE): Je ne vois aucun inconvénient àdifférer la prise de position de notre Conseil à la fin de nos tra-vaux, si la Commission de rédaction admet les principes telsque je les propose, qu’elle s’inspire de la Constitution du can-ton de Berne, rédigée en français à la satisfaction de toutesles femmes de langue française de ce canton, et qu’elle nouspropose ainsi une rédaction finale qui corresponde à cesprincipes. Et si par hasard, ou par malheur, les propositionsde la Commission de rédaction ne correspondaient pas auxprincipes énumérés, nous pourrions alors reprendre ma pro-position et dire: «Voilà, votons cette proposition!»Je dois dire que je fais confiance aux travaux de la Commis-sion de rédaction. Mais j’estime souhaitable qu’à la fin de nostravaux, on puisse effectivement examiner si ces principesont été appliqués et respectés.
Schmid Carlo (C, AI): Diese Diskussion bringt mich in Verle-genheit. Wenn es zu einer materiellen Abstimmung kommt,werde ich mich der Stimme enthalten.Ich kenne im Welschland nicht sehr viele Leute, aber doch ei-nige. Ich habe Frauen getroffen, die mit der Auffassung vonFrau Brunner Christiane einverstanden sind, und andereFrauen, die mit der Auffassung von Herrn Cavadini Jean ein-verstanden sind. Es gibt auch im Welschland Frauen, die sa-gen, das sei keine Frage des Geschlechts, sondern eineFrage des Sprachverständnisses.
Es stehen sich zwei Minderheiten gegenüber. Da muss ichmich, als Deutschschweizer, nicht einmischen.
Cavadini Jean (L, NE): Monsieur le Président, vous êtes dansl’obligation de nous faire prendre une décision puisqu’il y a uneproposition. Si nous l’adoptons formellement, avec le mandatdécisif formulé par Mme Brunner, vous nous mettez dans unesituation que nous ne pouvons pas maîtriser absolument.Une formulation neutre, telle qu’elle est demandée, supposeune systématique. Nous avons dit que nous souhaitions,chaque fois que cela était possible, faire la proposition de cequi est compatible à la fois avec le respect du principe del’égalité auquel nous sommes tous acquis – nous le répéte-rons jusqu’à épuisement de nos interlocuteurs – et avec lerespect d’une langue française que l’on ne peut décidémentpas maltraiter, ne serait-ce que pour l’amour de la femme qui,chez moi, est illimité! (Hilarité)Monsieur le Président, je vous demande de ne pas nous con-traindre à adopter ici la proposition Brunner Christiane et derenvoyer la décision sur cette proposition à la fin de l’exer-cice, au moment où nous pourrons avoir quelque chose quise tienne, qui soit cohérent et qui soit respectueux à la fois duprincipe politique et du principe linguistique.
Präsident: Ich habe festgestellt, dass Herr Cavadini bereitist, bei der neuerlichen Prüfung des französischen TextesFrau Brunner dort entgegenzukommen, wo es möglich ist.Frau Brunner ihrerseits hat volles Vertrauen in die Redak-tionskommission.Unter diesen Umständen schlage ich Ihnen vor, der Redak-tionskommission den französischen Text ausnahmsweisenicht erst vor der Schlussabstimmung vorzulegen, sondernvor der Differenzbereinigung. Wir könnten dann über den An-trag von Frau Brunner entscheiden, wenn er überhaupt nochnötig ist.
Leuenberger Moritz, Bundesrat: In der Tat handelt es sichhier um ein Problem der französischsprachigen Schweiz.Jede Sprache hat ihre eigenen Gesetzmässigkeiten, undzwar gemäss der jeweiligen Kultur und gemäss dem Land, indem sie gesprochen wird. Von daher hat Frau Brunner recht:Es kann nicht einfach die Sprachregelung, wie sie sich inFrankreich – geprägt von der Académie française – entwik-kelt hat, hier übernommen werden.Insbesondere die Frage der Gleichberechtigung der Ge-schlechter kommt in jeder Sprache vollkommen anders zumAusdruck. Ich habe einen Freund – er war Präsident des in-ternationalen Anwaltsverbandes und geprägt durch die femi-nistische Diskussion in der deutschsprachigen Schweiz –, ereröffnete in Finnland einen Kongress und sagte, wie erglaubte, fortschrittlich: «Liebe Anwältinnen und Anwälte»,was einen furchtbaren Protest der Feministinnen von Skan-dinavien auslöste, weil dort die feministisch gängige Aus-drucksweise «Anwälte», also der männliche Ausdruck, ist.Alles andere wird als eine fürchterliche Beleidigung derFrauen empfunden.Das zeigt, dass sich die sprachlichen Begriffe in jedem Kul-turbereich auf eine völlig verschiedene Art und Weise entwik-keln. Als einer, von dem Sie wissen, dass ich mich eher müh-sam auf französisch ausdrücke, kann ich mich hier wirklichmit wenig Legitimation einmischen und Ihnen raten, ob Siesich auf eine Fussnote oder auf eine neue Sprachregelungeinigen sollen.Es ist mir nur aufgefallen, dass auch in Frankreich ge-schlechtsneutrale Begriffe in dem Sinne gewählt werden, in-dem es z. B. heisst: «Allons, enfants de la Patrie!» Ich würdeIhnen auch vorschlagen: Überlassen Sie das Ihrer Redak-tionskommission, und dort den französisch sprechendenMännern und Frauen.
Präsident: Damit ist der Auftrag an die Redaktionskommis-sion erteilt, sich des Problems noch einmal anzunehmen undvor der Differenzbereinigung eine neue französische Fahnemit allfälligen kreativen Vorschlägen vorzulegen. – Sie sind
Constitution fédérale. Réforme 32 E 20 janvier 1998
Bulletin officiel de l’Assemblée fédérale / Tiré à part
damit einverstanden. Der Antrag Brunner Christiane ist bisdahin zurückgestellt.
Art. 6Anträge der Kommissionen: BBlPropositions des commissions: FF
Rhinow René (R, BL), Berichterstatter: Der 2. Titel der Ver-fassung schliesst sich an die einleitenden Bestimmungen an,erhält dadurch also einen prominenten Platz in der Verfas-sung.In der Tat bildet der Schutz der Menschenrechte, die auf derBasis der unveräusserlichen Menschenwürde gründen, ei-nen der zentralen Pfeiler und Legitimationsfaktoren des mo-dernen Verfassungsstaates überhaupt. Die Menschenrechtestehen im Zentrum des inhaltlich verstandenen Prinzips derRechtsstaatlichkeit. Dieses wird ergänzt durch den Grund-satz der Sozialstaatlichkeit, wie er in allen europäischen Ver-fassungen in der einen oder anderen Weise verankert ist.Von daher schien es der Kommission einleuchtend zu sein,Grundrechte und Sozialziele in einem Verfassungsteil ge-meinsam zu verankern. Beide zusammen sind Pfeiler des so-zialen Rechtsstaates, betonen also das Aufeinanderbezo-gensein von Freiheit und Ausgleich, was gut eidgenössischerTradition und den herrschenden Gerechtigkeitsvorstellungenin unserem Lande entspricht.Dabei darf allerdings nicht übersehen werden, dass sichbeide Regelungsbereiche, Grundrechte und Sozialziele, inmehrerlei Hinsicht kategorisch voneinander unterscheiden.Grundrechte sind verfassungsmässige Rechte, d. h. vor demRichter – in letzter Instanz vor dem Bundesgericht, teilweisevor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte –einklagbare, unmittelbar anwendbare, subjektive Rechte. Siekönnen zwar nach den Regeln von Artikel 32 des Entwurfeseingeschränkt werden – gestützt auf eine gesetzliche Grund-lage, im öffentlichen Interesse und unter Wahrung des Ver-hältnismässigkeitsprinzips und ihres Wesensgehaltes. Siesind aber nicht vom Gesetz abhängig, im Gegenteil. Auch derGesetzgeber, ja alle staatlichen Organe sind grundsätzlichverpflichtet, Grundrechte zu schützen und ihre Gehalte in derganzen Rechtsordnung zur Geltung kommen zu lassen.Demgegenüber stellen die Sozialziele, wie ihr Name sagt,Staatszielbestimmungen dar. Sie enthalten keine subjektivenRechte, sind als solche also nicht einklagbar. Sie sollen demStaat die Richtung weisen, die er, d. h. insbesondere der Ge-setzgeber, einzuschlagen hat, wenn er seine andernorts fest-gehaltenen Aufgaben erfüllt. Wenn in diesem Rahmen ein-klagbare Ansprüche begründet werden sollen, hat dies durchden Gesetzgeber zu erfolgen, was er beispielsweise bei derSozialversicherungsgesetzgebung auch getan hat. Zudemunterstehen die Sozialziele verschiedenen Vorbehalten, dieteilweise schon erwähnt worden sind:1. dem gesellschaftlichen Subsidiaritätsprinzip, das die pri-vate Verantwortung betont;2. der bundesstaatlichen Kompetenzverteilung;3. der Existenz vorhandener Ressourcen.Bei den Grundrechten ging es also primär darum, die heuteim geschriebenen und ungeschriebenen Verfassungsrechtund im für die Schweiz geltenden internationalen Recht ent-haltenen Rechte zusammenzufassen, in einem eigentlichenKatalog übersichtlich zu normieren und Transparenz für dieBürgerinnen und Bürger zu schaffen.Bei den Sozialzielen stand das Bemühen voran, die sozialeVerantwortung des Gemeinwesens zum Ausdruck zu brin-gen, wie sie sich heute im Rahmen der Rechtsordnung vonBund und Kantonen manifestiert und bereits im Zweckartikel,Artikel 2, und im sogenannten Wohlfahrtsartikel, Artikel 31bisAbsatz 1, sowie in weiteren Bestimmungen unserer gelten-den Bundesverfassung verankert ist.Dabei werden die aktuellen Spannungsfelder in Form der er-wähnten Vorbehalte offen ausgewiesen. Es handelt sichalso – im Gegensatz zu teilweise erhobenen Vorwürfen –auch hier um eine klassische Nachführung. Wohl sind dieSozialziele detaillierter gefasst, differenzierter nach Lebens-und Sozialbereichen dargestellt. Trotzdem findet sich kein
einziges Ziel darunter, das nicht bereits heute in unsererRechtsordnung seine Anerkennung finden würde.Die Kommission hat zusätzlich zu Grundrechten und Sozial-zielen auch die «Bürgerrechte» in diesen Titel aufgenom-men. Der Bundesrat regelt die Bürgerrechte im allgemeinenKapitel über das Verhältnis von Bund und Kantonen, undzwar unmittelbar anschliessend an die Bundesgarantien. Esist zwar nicht zu bestreiten, dass die Regelung der Bürger-rechte auch mit der bundesstaatlichen Kompetenzverteilungzu tun hat. Aber primär geht es um die Begründung der Zu-gehörigkeit der Menschen zum schweizerischen Gemeinwe-sen, und zwar in seiner dreistufigen Form. Der Kommissionschien es deshalb einleuchtender, das Bürgerrecht und seineVoraussetzungen in einen Zusammenhang zu den Grund-rechten zu bringen.Die Grundrechte stehen grundsätzlich allen Menschen zu,die politischen Rechte nach tradiertem Verständnis nur denBürgern und Bürgerinnen. Insofern vermittelt das Bürger-recht den Zugang zum Stimmrecht. Es hat damit mehr mit dergrundlegenden Rechtsstellung des einzelnen als mit demVerhältnis von Bund und Kantonen zu tun.Noch ein Wort zur Behandlung der Grundrechte in der Kom-mission. Wir haben den Entwurf des Bundesrates fast voll-umfänglich übernommen. Diskutiert haben wir vor allem übereine allfällige Erweiterung des Diskriminierungsartikels(Art. 7). Wir haben jedoch davon abgesehen. Die Kommis-sion hat zudem über eine neue Fassung des Rechtes auf Exi-stenzsicherung diskutiert, wobei wir gewisse Zusätze einge-fügt haben. Es war bereits die Rede davon. Ich möchte hieraber dick unterstreichen, dass – im Gegensatz zu Zuschrif-ten, die wir erhalten haben – das Recht auf Existenzsiche-rung zum geltenden, ungeschriebenen Verfassungsrecht ge-hört und keine neue Erfindung des Bundesrates oder derKommission ist.Die Kommission hat ferner bei der Meinungs- und Informa-tionsfreiheit einen eigenen Artikel über die Medienfreiheit ge-schaffen. Umstritten war dabei das Redaktionsgeheimnis,das wir nicht beseitigen wollten, das wir aber auf die Geset-zesebene verschoben haben.Die Kommission hat auch die Frage erörtert, ob Eigentums-beschränkungen, die einer Enteignung gleichkommen, odereigentliche Enteignungen voll oder angemessen zu entschä-digen sind. Wir haben uns hier ganz klar für die Fassung desBundesrates entschieden. Einen Minderheitsantrag sehenSie auf der Fahne.Schliesslich hat die Kommission recht ausführlich über dasStreikrecht diskutiert. Hier möchte ich dazu nicht mehr sa-gen; Sie finden die verschiedenen Anträge auf der Fahne.Bei der Petitionsfreiheit wurde der Passus gestrichen, dassdie Behörden von solchen Petitionen Kenntnis zu nehmenhaben. Allerdings basierte der Entschluss der Kommissioneher auf der Meinung, das sei überflüssig. Man wollte denBehörden nicht raten, das künftig nicht mehr zu tun.Beim Bürgerrecht, das wir neu in diesen Titel aufnehmen,geht es insbesondere um zwei Neuerungen. Einerseits sollder Bund – in Artikel 32b Absatz 3 – die Einbürgerung staa-tenloser Kinder erleichtern, und andererseits haben wir dasBegriffspaar «Stimm- und Wahlrecht» der Einfachheit halberauf Stimmrecht reduziert und uns damit der französischenSprachregelung angeschlossen. Dort ist auch nur von «droitde vote» die Rede.
Inderkum Hansheiri (C, UR), Berichterstatter: Gestatten Siemir, bevor ich zu Artikel 6 komme, noch zwei Vorbemerkun-gen zu den Grundrechten:Die erste Vorbemerkung betrifft die Frage des Grundrechts-trägers oder der Grundrechtsträgerin. Als Grundsatz gilt,dass jede natürliche Person und, falls geeignet, auch jede ju-ristische Person Träger des Grundrechtes sein kann. Selbst-verständlich sind auch Kinder Träger von Grundrechten. Wieverhält es sich bezüglich der Ausländer? Sie sind Träger derGrundrechte, wenn das betreffende Recht dem Menschenum seiner Persönlichkeit willen zusteht. Ich werde bei der Be-handlung oder Vorstellung der einzelnen Artikel, soweit erfor-
20. Januar 1998 S 33 Bundesverfassung. Reform
Amtliches Bulletin der Bundesversammlung / Separatdruck
derlich, auf die Frage der Trägerschaft zu sprechen kommen.Eine zweite Vorbemerkung: Wenn wir die Grundrechte imSinne einer Nachführung kodifizieren, müssen wir uns be-wusst sein, dass wir heute nicht alles und jedes fixieren kön-nen. Wir müssen, zumindest bei einzelnen Grundrechten, sooffen formulieren, dass eine gewisse Dynamik darin liegt.Auch dazu werde ich, soweit erforderlich, bei der Vorstellungder einzelnen Grundrechte zu sprechen kommen.Zu Artikel 6 «Menschenwürde»: Artikel 6 garantiert den Re-spekt und den Schutz der Würde des Menschen. Die Bestim-mung findet sich heute in der Bundesverfassung nicht ex-pressis verbis. Es handelt sich aber klar nicht nur um ein,sondern um das Grundrecht. Die Menschenwürde ist gera-dezu das Auffanggrundrecht, gleichermassen der Angel-punkt des Kapitels «Grundrechte». Er beeinflusst die Ausle-gung und Fortbildung der anderen Grundrechte. Die Kom-mission teilt mit Überzeugung die Auffassung des Bundesra-tes, dass der Grundrechtskatalog in einer modernenVerfassung mit der Menschenwürde zu beginnen hat.Man könnte gegen die Formulierung einwenden, sie sei zu all-gemein. Im deutschen Grundgesetz beispielsweise heisst es:«Die Menschenwürde ist unantastbar.» Im Wissen darum,dass die Menschenwürde leider tagtäglich angetastet und mit-unter verletzt wird, hat sich die Kommission ohne grosse Dis-kussion der Fassung des Bundesrates angeschlossen. Ichmöchte aber mit aller Deutlichkeit darauf hinweisen, dassselbstverständlich immer und überall danach zu streben ist,dass die Menschenwürde geachtet und geschützt wird.
Angenommen – Adopté
Art. 7Anträge der Kommissionen: BBlPropositions des commissions: FF
Antrag BeerliAbs. 2.... der sozialen Stellung, der Lebensform, der religiösen ....
Antrag SpoerryAbs. 1Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Niemand darfdiskriminiert werden.Abs. 2Streichen
Antrag LeumannAbs. 2.... der Sprache, des Alters, der sozialen Stellung ....
Antrag BrändliAbs. 2.... einer körperlichen, geistigen oder psychischen Behinde-rung.Abs. 4Das Gesetz sorgt für die Gleichstellung der Behinderten; essieht Massnahmen zum Ausgleich oder zur Beseitigung be-stehender Benachteiligungen vor.
Proposition BeerliAl. 2.... de sa situation sociale, de son genre de vie, de ses con-victions ....
Proposition SpoerryAl. 1Tous les hommes sont égaux devant la loi. Nul ne doit subirde discrimination.Al. 2Biffer
Proposition LeumannAl. 2.... de sa langue, de son âge, de sa situation sociale ....
Proposition BrändliAl. 2.... corporelle, mentale ou psychique.Al. 4La loi pourvoit à l’égalité des personnes handicapées; elleprévoit des mesures en vue de la compensation ou de l’élimi-nation des inégalités existantes.
Inderkum Hansheiri (C, UR), Berichterstatter: Artikel 7 ent-hält die Rechtsgleichheit und entspricht von seiner Konzep-tion her dem Artikel 4 der geltenden Verfassung, der be-kanntlich vor noch nicht allzulanger Zeit durch das Prinzip derGleichberechtigung von Mann und Frau ergänzt wurde.Absatz 1 bedarf offensichtlich keiner Erläuterung. Die Be-stimmung «Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich»dürfte selbstverständlich sein.Absatz 3 ist bis auf ein Wort identisch mit Artikel 4 Absatz 2der geltenden Verfassung.Neu ist nun, dass die Bestimmung über die Rechtsgleichheitin Absatz 2 mit einem Diskriminierungsverbot angereichertwird. Dieses Diskriminierungsverbot gilt selbstverständlichallgemein, handelt es sich doch um nichts anderes als umeine Konkretisierung des Rechtsgleichheitsgrundsatzes innegativer Formulierung.In Absatz 2 werden jedoch einige Diskriminierungstatbe-stände ausdrücklich erwähnt. Diese Aufzählung aber – dasist von entscheidender Bedeutung – ist nicht abschliessend,was durch das Wort «namentlich» klar und unmissverständ-lich zum Ausdruck kommt. Es darf also nicht der Schluss ge-zogen werden, fehlende Kriterien für mögliche Diskriminie-rungen dürften Anlass für Diskriminierungen sein – etwa inbezug auf die geschlechtliche oder sexuelle Orientierung –,ganz im Gegenteil. Wir haben ja diesbezüglich sehr vieleSchreiben erhalten.Wenn wir aber etwa das Kriterium der geschlechtlichen Ori-entierung oder auch weitere Kriterien, wie beispielsweise dasAlter, ausdrücklich aufnähmen, könnte dies zwar nicht recht-lich, aber politisch gesehen eine weitergehende Bedeutunghaben als eben die blosse Betonung der Nichtdiskriminie-rung. Eine derartige Aufnahme könnte nämlich einen Auftrag,positiv tätig zu werden, suggerieren.Die Verankerung eines dergestalt dynamischen Elementeswürde aber nach Auffassung der Kommission über die Nach-führung hinausgehen. Bei den Beispielen, die in Absatz 2aufgeführt sind, handelt es sich um Bereiche, die in der Ver-gangenheit immer wieder Anlass von Diskriminierungen undVerfolgungen waren. Es geht in diesem Sinne um die klassi-schen Bereiche Rasse, Geschlecht, Minderheit, Sprachesowie Weltanschauung und damit um Diskriminierungstat-bestände, die Sie etwa in internationalen Konventionen fin-den.
Beerli Christine (R, BE): Der Satz «Alle Menschen sind vordem Gesetz gleich» muss für mich im Zentrum jeder Verfas-sung stehen. Rechtsgleichheit und Schutz vor Diskriminie-rung sind die Grundpfeiler jedes liberalen Rechtsstaates. DerSatz «Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich» genügt. Erbeinhaltet alles, was in Absatz 2 ausgesagt wird, und um-fasst auch meinen Antrag. Er macht alles weitere überflüssig.Wenn man jedoch nach dem Konzept des Bundesrates undIhrer Kommission bei Artikel 7 einen Absatz 2 einfügt, indemman Gruppierungen erwähnt, die ausdrücklich nicht diskrimi-niert werden dürfen, wird es heikel. Dann muss man sich vorqualifiziertem Schweigen hüten und darf diejenigen Gruppennicht vergessen, die am meisten Gefahr laufen, in Staat undGesellschaft wirklich diskriminiert zu werden.Eines sei klar festgehalten: Die Aufnahme einer Gruppe inArtikel 7 Absatz 2 bedeutet Schutz vor staatlicher Diskrimi-nierung. Sie ist keine Handlungsanweisung an den Gesetz-geber und bewirkt auch keine direkte Drittwirkung, sondernschafft höchstenfalls eine psychologische Hemmschwelle fürgesellschaftliche Diskriminierungen und Benachteiligungen.Also: entweder, oder! Entweder wir beschränken uns auf daseinfache und umfassende «Alle Menschen sind vor dem Ge-setz gleich», oder wir nehmen den von der nationalrätlichen
Constitution fédérale. Réforme 34 E 20 janvier 1998
Bulletin officiel de l’Assemblée fédérale / Tiré à part
Kommission vorgeschlagenen Zusatz der Lebensform inAbsatz 2 auf, einen Zusatz, der die wirklich der Gefahr derDiskriminierung ausgesetzten Gruppen der Homosexuellenschützen soll.Ich bitte Sie, meinen Antrag zu Absatz 2 anzunehmen.
Leumann Helen (R, LU): Wir haben gestern beim Eintretensehr kritische, aber auch sehr unterstützende Voten gehört.Unsere Bundesverfassung muss verständlich sein. Sie mussfür Bürgerinnen und Bürger verständlich sein, und das ist fürLaien manchmal nicht so einfach. Doch muss es uns gelin-gen, die Diskussion in der Bevölkerung auch auf einer Laien-ebene in Gang zu bringen. Es gibt viele Gruppierungen, diesich bereits intensiv mit dieser Verfassung auseinanderge-setzt haben, zum Teil, weil sie sich etwas davon erhoffen,zum Teil aber auch, weil berechtigte Anliegen vorliegen. Ichdenke gerade an den Antrag Beerli.Ich möchte hier vor allem auf einen Punkt eintreten, nämlichauf den Einbezug von Kindern und Jugendlichen: Als Präsi-dentin der überparteilichen parlamentarischen Jugend-gruppe hat es mich sehr beeindruckt, mit wieviel Engage-ment sich die Vertreter dieser Jugendorganisationen hinterihre Anliegen gestellt haben. Sie haben tatsächlich auch vielerreicht.Es ist jedoch schwierig zu verstehen, weshalb beim Diskrimi-nierungsverbot das Alter nicht aufgeführt wird, das eben ge-rade die Jugendlichen speziell mit einbeziehen würde. Wennich Herrn Inderkum zugehört habe, wird es für mich noch un-verständlicher. Absatz 2 lautet nämlich im ersten Satzteilkurz und bündig: «Niemand darf diskriminiert werden ....»,und das sagt eigentlich alles.Aber dann beginnt eine Aufzählung: «.... nicht wegen derHerkunft, der Rasse, des Geschlechts, der Sprache ....» usw.Der Nachteil von Aufzählungen ist, dass sich dann immerGruppen finden, hier die Jugendgruppen, die nicht aufgezähltsind und somit befürchten, dass dieser Absatz für sie nichtgilt. Es ist daher nicht einsichtig, weshalb das Alter nicht auchspeziell aufgeführt ist – oder die gleichgeschlechtlichen Part-ner gemäss Antrag Beerli.Ich meine, dass wir uns entscheiden müssen, entweder dieAufzählungen zu streichen und nur das grundsätzliche Dis-kriminierungsverbot zu erwähnen, wie gemäss AntragSpoerry, was dann alle Menschen und Menschengruppeneinschliesst, oder aber die Aufzählung gemäss Antrag Beerli,meinem Antrag und eventuell noch Anträgen mit der Erwäh-nung anderer Gruppierungen zu vervollständigen. Denn ent-weder braucht es eine Aufzählung, damit dieser Absatz et-was aussagt – dann müsste sie vollständig sein –, oder esbraucht keine Aufzählung – dann wäre es meines Erachtensehrlicher, sie wegzulassen.Wenn es aber eine Aufzählung braucht, bitte ich Sie um Un-terstützung meines Antrages, und zwar nicht aus juristi-schen, sondern aus politischen Gründen, damit auch solcheAbsätze für Laien verständlich sind.
Brändli Christoffel (V, GR): Die Aufnahme der Behinderungin den Katalog der Tatbestände, die vom Diskriminierungs-verbot erfasst werden, ist sicher zu begrüssen. Es geht beimeinem Antrag um den Begriff der Behinderung. Wir habenhier eine Differenz zur nationalrätlichen Kommission. UnsereKommission unterscheidet zwischen geistiger und körperli-cher Behinderung, die nationalrätliche Kommission unter-scheidet zwischen geistiger, körperlicher und psychischerBehinderung.Ich beantrage Ihnen aus folgenden Gründen, die Fassungder nationalrätlichen Kommission zu übernehmen: In der me-dizinischen und sozialrechtlichen Praxis ist die Unterschei-dung in geistige, körperliche und psychische Behinderungunbestritten. Bei der laufenden IV-Revision wird ebenfallsvon dieser Dreiteilung ausgegangen. Der Ständerat hat da-bei im Rahmen der Revision dieser Definition oppositionsloszugestimmt; ich verweise auf Artikel 4 des IV-Gesetzes.Wenn wir nun hingehen und nur von geistiger und körperli-cher Behinderung sprechen, dann grenzen wir die psychischBehinderten aus – bzw. diskriminieren wir sie. Man hätte na-
türlich darüber diskutieren können, dass man nur von Behin-derungen spricht. Wenn man aber die Gruppen der Behin-derten aufzählt, muss man dies vollständig tun.Ich bitte deshalb im Interesse der Klarheit, die Definition ge-mäss Fassung der nationalrätlichen Kommission aufzuneh-men.
Spoerry Vreni (R, ZH): Ich beantrage Ihnen – und die voran-gegangenen Voten bestärken mich in diesem Antrag –,Absatz 2 von Artikel 7 mit der nichtabschliessenden Aufzäh-lung möglicher Diskriminierungsgründe zu streichen und ineinem erweiterten Absatz 1 festzuhalten, dass alle Men-schen vor dem Gesetz gleich sind und Diskriminierungendemzufolge in jedem Fall verboten sind.Nicht betroffen von meinem Antrag ist selbstverständlichAbsatz 3 von Artikel 7, wonach Mann und Frau gleichberech-tigt sind und das Gesetz für ihre Gleichstellung zu sorgen hat.Dieser Absatz ist erfreulicherweise in einer separaten Volks-abstimmung angenommen worden und steht somit nicht zurDiskussion.Zurück zu Absatz 2: Wie komme ich zu meinem Antrag, die-sen Absatz zu streichen? Als unsere heutige Bundesverfas-sung geschaffen wurde, waren Herabsetzungen bestimmterGruppierungen von Menschen innerhalb der Gesellschaftnoch an der Tagesordnung. Es war eines der wichtigen Zieleder neuen Eidgenossenschaft, mit den sachlich nicht ge-rechtfertigten Ungleichbehandlungen von Menschen aufzu-hören. Damit lag es auf der Hand, die festgestellten Diskrimi-nierungsgründe in der Verfassung einzeln aufzuzählen. Eshandelte sich dabei um eine abschliessende Aufzählung; dasWort «namentlich», das heute eingefügt werden soll, fehlte.In der Zwischenzeit hat sich die Gesellschaft weiterentwik-kelt. Bestimmte Merkmale von Menschen, die im letztenJahrhundert noch Anlass zu Diskriminierungen gaben, stel-len heute glücklicherweise kaum noch ein Problem dar. Dafürgibt es neue Gruppen, die sich in bestimmten Punkten vonanderen Bürgerinnen und Bürgern unterscheiden und des-halb einer gewissen Diskriminierung ausgesetzt sind. EinDiskriminierungsverbot ist daher unverändert nötig.Der Bundesrat lässt nun diesem Verbot eine Auflistung fol-gen und präzisiert, dass die aufgezählten Gründe nicht ab-schliessend seien, sondern durch das Wort «namentlich» le-diglich exemplarischen Charakter hätten. Der Bundesrat unddie vorberatende Kommission sagen – und das sicher zuRecht, das bestreite ich nicht –, dass es sich bei dieser Auf-zählung nicht um einen abschliessenden Katalog handle,sondern dass auch Menschen, die nicht in der Aufzählungvorkommen, durch ein Diskriminierungsverbot geschütztseien, so z. B. Lesben und Schwule, aber auch betagte Men-schen oder Jugendliche, soweit sie Diskriminierungen aus-gesetzt werden.Begreiflicherweise stellt sich aber für die Betroffenen – daswurde in den vorherigen Begründungen sehr klar – sofort dieFrage, warum sie denn nicht auch genannt sind. Sie fürchten,dass diese nicht vollständige Aufzählung doch die Absichthat, bestimmte Gruppen besonders zu schützen, und dieNichtaufzählung, so wie das Frau Beerli ausgeführt hat, alsqualifiziertes Schweigen auszulegen sei. Nachdem ich dieAusführungen des Berichterstatters gehört habe, beginne ichdies immer mehr zu verstehen. Meines Wissens hat er ge-sagt, eine erweiterte Aufzählung könne dem Artikel ein Ge-wicht geben, das man so nicht wolle.Deshalb verlangen die nicht erwähnten Gruppierungen mitNachdruck, dass sie ebenfalls expressis verbis in der Verfas-sung aufgeführt werden. Ihr Gefühl der Enttäuschung mani-festiert sich mit Bezug auf die homosexuellen Menschen imAntrag Beerli, mit Bezug auf die Jugendlichen im Antrag Leu-mann; Herr Brändli will neben den geistig und körperlich Be-hinderten auch die psychisch Behinderten ausdrücklich er-wähnt haben.Im Nationalrat stehen bei Artikel 7 acht Minderheitsanträgezur Beratung an; auch dies ein Ausdruck des Unbehagensund der Unsicherheit, welche vor allem durch diese nicht ab-schliessende Aufzählung möglicher Diskriminierungsgründehervorgerufen worden sind.
20. Januar 1998 S 35 Bundesverfassung. Reform
Amtliches Bulletin der Bundesversammlung / Separatdruck
In Anbetracht dieser Tatsache komme ich zum Schluss, dasswir am ehesten dem Ziel einer mehrheitsfähigen transparen-ten, verständlichen neuen Verfassung gerecht werden, wennwir schlicht und einfach am Grundsatz festhalten, wonachalle Menschen vor dem Gesetze gleich sind, Diskriminierun-gen verboten sind und – wenn sie vorkommen – von jeder be-troffenen Person eingeklagt werden können.Eine Diskriminierung ist eine sachlich ungerechtfertigte Un-gleichbehandlung oder allenfalls auch eine Gleichbehand-lung von Menschen, bei denen unterschiedliche Merkmaleeine Ungleichbehandlung aufdrängen oder eine Gleichbe-handlung verunmöglichen. Und dieser Grundsatz gilt für alleMenschen in diesem Land, gleich welcher Herkunft oderRasse, gleich welcher Sprache oder sozialer Stellung siesind, gleich welche Überzeugung sie haben, gleich ob sie altoder jung sind, welche sexuelle Orientierung sie ausweisen,und gleich ob sie im Besitze all ihrer Kräfte sind oder mit einerBehinderung leben müssen.Wenn Sie diesem Antrag nicht folgen können, müsste ichmich für eine abschliessende Aufzählung aller heute erkann-ten möglichen Diskriminierungstatbestände in unserer Ge-sellschaft entschliessen.Damit will ich folgendes unterstreichen:Erstens soll mit einer generellen Formulierung in meinemSinne niemandem etwas weggenommen werden, sondernim Gegenteil sollen damit wirklich alle eingeschlossen sein.Aber eine lückenlose Aufzählung widerspricht meiner Vor-stellung von einer schlanken Verfassung.Zweitens ist der Sinn einer umfassenden Aufzählung nichteinzusehen, wenn ohnehin alle gemeint sind.Drittens – und vor allem – könnte auch eine aus heutigerSicht vollständige Aufzählung bereits in wenigen Jahren wie-der lückenhaft sein, weil sich die Gesellschaft auch in Zukunftweiterentwickeln wird und Gruppen mit weiteren Merkmalenentstehen dürften, die Anlass zu neuen Diskriminierungengeben können.Aus diesem Grunde bitte ich Sie, meinem Antrag zu folgen.Aus meiner Sicht stellt er eine klare Lösung dar, die nieman-den bevorzugt, aber auch niemanden ausschliesst, die aberauch keine Hoffnungen weckt, welche im Rahmen einernachgeführten Verfassung nicht erfüllt werden können, wieFrau Beerli dies zu Recht und präzise ausgeführt hat.
Simmen Rosemarie (C, SO): Bei der Vorberatung des Ge-schäftes der Verfassungsrevision habe ich mich sehr einge-hend mit Absatz 2 von Artikel 7 auseinandergesetzt, denneine Diskriminierung innerhalb eines Rechtsstaates ist einesehr schwerwiegende Angelegenheit. Es ist unsere Pflicht,alles vorzukehren, damit niemand in diesem Lande diskrimi-niert wird. Es haben sich viele Gruppen von Menschen anuns gewandt, die Homosexuellen, Gruppen verschiedenenAlters – von den Kindern und Jugendlichen bis zu den altenMenschen –, die Behinderten und auch andere, kleinereGruppen. Unter all diesen Leuten war niemand, von dem ichnicht hätte sagen müssen: Es ist richtig, dass diese Men-schen nicht diskriminiert werden dürfen.Je länger ich mich mit dieser Frage befasst habe, desto unsi-cherer bin ich geworden. Ich habe mich gefragt, ob es nochandere Gruppen gibt, die sich nicht gemeldet haben, sei es,weil sie mit diesen Vorgängen nicht vertraut sind, sei es ausirgendeinem anderen Grund. Ich habe mich gefragt, ob esGruppen gibt, an die ich eigentlich selber hätte denken sollenund an die auch ich nicht gedacht habe. Je länger ich darübernachgedacht habe, desto unsicherer bin ich geworden.Natürlich heisst es im Text «namentlich», und das bedeutet,dass es keine abschliessende Aufzählung ist. Aber geradedie Reaktionen, die wir bekommen haben, zeigen auf, dasses für die Bürgerinnen und Bürger wichtig ist und dass es ei-nen Unterschied macht, ob man in dieser Aufzählung er-wähnt ist oder nicht.Aus all diesen Gründen – die heutige Diskussion hat michdarin bestärkt – bin ich zum Schluss gekommen, dass wir unsvon der Realität und von dem, was wir eigentlich möchten,um so mehr entfernen, je mehr wir hier hineinschreiben.
Ich werde dem Antrag Spoerry zustimmen, gerade weil ichden Schutz der Minderheiten als etwas Essentielles be-trachte und niemanden, auch nicht indirekt und nur psycho-logisch, davon ausschliessen möchte.
Wicki Franz (C, LU): Ich kann mich vollumfänglich den Über-legungen von Frau Simmen anschliessen. In unserer Kom-mission haben wir uns eingehend mit dieser Verfassungsbe-stimmung befasst. Wir sind damals zum Schluss gekommen,dass wir mit dem Ausdruck «namentlich» eigentlich alles auf-fangen werden. Nun, die inzwischen eingetroffenen Zuschrif-ten verschiedenster Gruppen, die heutige Diskussion und dieheute vorliegenden Anträge führen auch mich dazu, dem An-trag Spoerry zuzustimmen. Wir könnten nämlich so nicht nureinen einfachen Ausweg finden – das wäre für mich zu ein-fach –, aber die Überlegung ist doch die: Wir machen heuteeinen Katalog aus einem gewissen Zeitgeist heraus, und wirwissen nicht, was für Diskriminierungsmöglichkeiten oderDiskriminierungsgefahren morgen bestehen.Ich bin für diesen Antrag Spoerry auf Streichung der Diskri-minierungsgründe, möchte aber meine Ansicht zu Protokollgeben: Wenn wir die im Entwurf angeführten Tatbeständenicht mehr wörtlich aufnehmen, sind wir keineswegs der Mei-nung, dass irgendwelchen Diskriminierungen Tür und Tor ge-öffnet werden sollen. Vor allem möchte ich auch persönlichzu diesen Zuschriften, mit denen uns die Lesben und Homo-sexuellen ihr Anliegen unterbreiteten, sagen, dass wir damitkeineswegs diese Gruppierungen der Diskriminierung aus-setzen wollen. Wir möchten das Verbot jeder Diskriminierungganz ausdrücklich in der Bundesverfassung festhalten.
Maissen Theo (C, GR): Ich kann mich kurz fassen, weil ichmich der Vorrednerin und dem Vorredner anschliessen kann.Nach all diesen Diskussionen und Zuschriften meine ich,dass die Lösung von Frau Spoerry die klarste ist. Zudem istfür mich die Tatsache entscheidend, dass in einer solchen Si-tuation immer die Gefahr besteht, dass eine Aufzählung nichtnur objektiv erfolgt, sondern auch nach der Lautstärke, mitder sich die Gruppierungen zu Wort melden – und dass viel-leicht gerade jene, die in einer Gesellschaft am schwächstensind und unter der Diskriminierung leiden, dann nicht zumZug kommen.Für den Fall, dass wir diese Aufzählung trotzdem machen,habe ich aber eine Frage an Frau Beerli, und zwar in bezugauf diese Einbindung der Lebensform, zu der wir ja viele Zu-schriften erhalten haben. Diese Frage stellt sich auch ange-sichts der Aussage des Kommissionssprechers, wonach dieGefahr besteht, dass noch weitere Forderungen suggeriertoder Gesetzgebungen initialisiert werden könnten. Für michstellt sich im Zusammenhang mit der Problematik der gleich-geschlechtlich ausgerichteten Gruppierungen die Frage desVerhältnisses zu Artikel 12, Recht auf Ehe: Wenn man denAntrag Beerli annimmt und in Absatz 2 eine Aufzählungmacht, wenn wir also den Vorschlag betreffend Lebensfor-men integrieren, ist es dann denkbar, dass daraus derSchluss abgeleitet wird, eine Diskriminierung bestehe auch,wenn Artikel 12, Recht auf Ehe, für gleichgeschlechtlichePartner nicht gewährt wird?Das ist für mich eine essentielle Frage in bezug auf eine Be-schlussfassung zu einem allfälligen Absatz 2 mit detaillierterAufzählung.
Onken Thomas (S, TG): Persönlich wollte ich mich insbeson-dere für den Antrag Beerli einsetzen, für den ich ihr ausdrück-lich danke. Es scheint jetzt allerdings so, als ob die Diskus-sion bereits sehr stark in Richtung der generellen Formulie-rung von Frau Spoerry geht. Gleichwohl möchte ich hier nochein Wort dazu sagen, dass andere «Lebensformen», wennes zu einer Aufzählung kommt, ausdrücklich einbezogenwerden.Die organisierten Zuschriften und Kartenaktionen, mit denenman immer wieder an uns gelangt, sind mitunter problema-tisch. Sie stossen teilweise auf eine instinktive Ablehnung.Diese Kartenaktion von homosexuellen Menschen und vonihren Eltern aber hat mich zutiefst berührt und betroffen ge-
Constitution fédérale. Réforme 36 E 20 janvier 1998
Bulletin officiel de l’Assemblée fédérale / Tiré à part
macht. Denn jede dieser Karten war eine individuelle Bot-schaft, ein handgeschriebener Appell von einer berührendenund bekenntnishaften Offenheit. Jede Zuschrift war intelli-gent formuliert, hat argumentiert und Einsicht geschaffen,und die Texte waren, wie mir aufgefallen ist, oft in einer sehrschönen, sehr empfindsamen Schrift geschrieben. Wer sichdie Aufgeschlossenheit für solche Zuschriften von Bürgerin-nen und Bürgern bewahrt hat, der muss dafür empfänglichsein und davon einen starken Impuls erhalten haben.Die grosse Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger kümmertsich eigentlich kaum darum, was wir hier mit dieser Nachfüh-rung unserer Verfassung machen; das ist nun einmal eineTatsache. Vielleicht ändert sich das noch, vielleicht könnenwir ein bisschen Bewegung in die Diskussion in der Bevölke-rung hineinbringen. Aber eine Realität ist es, dass kaum je-mand wirklich mit Anteilnahme verfolgt, was wir hier tun.Die einzigen die reagiert haben, sind die, die sich von dieserVerfassung, namentlich von dieser Verfassungsbestimmung,wirklich noch etwas erhoffen oder erwarten. Diese haben anuns appelliert, und zwar nicht nur die Homosexuellen, son-dern auch andere Gruppierungen. Es handelt sich um Men-schen, die genau wissen, wovon sie sprechen, wenn vomDiskriminierungsverbot die Rede ist, um Menschen, die nochimmer sehr stark beargwöhnt oder missverstanden werden,die ausgegrenzt und teilweise geächtet und in der gesell-schaftlichen Realität nach wie vor auch diskriminiert werden.Es geht um Menschen, die eine andere sexuelle Orientierunghaben, aber im übrigen das gleiche Erleben, das gleicheEmpfinden und Fühlen, den gleichen Wunsch, den wir allehaben, nämlich nach Verständnis, Zuneigung, einer Gebor-genheit in der Gemeinschaft und auch den gleichen berech-tigten Wunsch nach einem Schutz vor Benachteiligungen.Diesen Schutz sollten wir in geeigneter Form gewähren. DieFormulierung von Frau Beerli erlaubt dies. Sie bezieht diese«andere sexuelle Orientierung» ausdrücklich ein. Wennschon eine nicht abschliessende Aufzählung stattfinden soll,wie es die Kommission vorgeschlagen hat, dann sollten we-nigstens diejenigen erwähnt werden, die diese Benachteili-gung auch heute noch immer wieder persönlich erfahren,und nicht bloss ein Katalog von Kriterien aufgenommen wer-den, die vielfach schon längst zum unbestrittenen Bestandeines Diskriminierungsverbotes gehören.Ob diesen Menschen mit der generellen Formulierung vonFrau Spoerry Rechnung getragen wird, ob ihr Anliegen damitaufgenommen werden kann, weiss ich nicht, ich bezweifle esaber. Wahrscheinlich wäre ihnen die explizite Erwähnungdes Tatbestandes lieber. Doch selbst die Formulierung, dieFrau Spoerry anregt, ist besser als eine nicht abschliessendeAufzählung, die gerade diese Form von häufiger Benachteili-gung nicht ausdrücklich erwähnt.Ich unterstützte deshalb, mit Nachdruck und aus Überzeu-gung, den Antrag Beerli.
Schmid Carlo (C, AI): Ich unterstütze Frau Spoerry. In derDiskussion will ich Ihnen gerne zugestehen, dass mich die Si-tuation, wie wir sie heute haben, doch überrascht: Wir spre-chen heute im Zusammenhang mit dem alten Artikel 4, demheutigen Artikel 7, nur noch von Diskriminierung. Und Diskri-minierung wird dabei als eine ungerechtfertigte Ungleichbe-handlung verstanden.Vor 150 Jahren hat man, wie aus dem alten Artikel 4 hervor-geht, mit dem Untertanenverhältnis aufgeräumt, also der ei-nen Form der Diskriminierung, und zudem mit vier Formender Privilegierung, nämlich mit den Vorrechten des Ortes, derGeburt, der Familie und der Person.Ich denke, es ist bemerkenswert, dass wir heute eigentlichnicht mehr von Privilegierung sprechen. Einer der Vorzügeder alten Verfassung ist, dass die Privilegien, soweit sie denStaat betreffen, wirklich zusammen mit allen alten Zöpfendes Ancien régime abgeschnitten worden sind. Dies solltenwir auch einmal anerkennen.Ich bin der Meinung, dass die umfassendste Form zur staat-lichen Verbannung der Diskriminierung jene ist, die FrauSpoerry vorgeschlagen hat. Zuhanden einer späteren Kom-missionssitzung möchte ich aber auch zu bedenken geben,
dass man die Frage der Privilegierung in der heutigen Zeitstudiert, die von gewaltigen gesellschaftlichen Veränderun-gen sowie von Paradigmenwechseln zwischen Staat undBürgern geprägt ist. Kommen nicht neue Privilegien auf unszu, zu denen der Staat unter Umständen noch etwas zu sa-gen hätte? Aber dies ist nur eine Anregung.Ich berate diesen Artikel 7 auf alle Fälle mit grosser Dankbar-keit unseren Vorfahren gegenüber.
Rochat Eric (L, VD): La discrimination revient à appliquer àdeux personnes différentes de façon différente les droits quileur sont garantis, soit par la constitution, soit par la loi. Il y adonc une inéquité de traitement par rapport à un droit garanti.C’est en fait la contradiction, c’est l’opposé du principe del’égalité énoncé dans l’alinéa 1er: «Tous les hommes sontégaux devant la loi.» A ce titre-là, on pourrait presque se pas-ser de parler de discrimination. La discrimination n’est que lanégation de l’égalité. Je pense cependant avec tous les inter-venants qu’il est nécessaire de le dire parce que dans untexte aussi fondamental que notre constitution la discrimina-tion ne peut pas ne pas être condamnée.En revanche, l’énumération qui suit à l’alinéa 2 a plus dechance d’être incomplète que d’apporter un surplus de droitsà ceux qui sont concernés, à savoir nous tous. D’autant plusque tous les droits fondamentaux et libertés sont énumérésde l’article 8 à l’article 28 de façon exhaustive et que la discri-mination ne consiste, à ce moment-là, qu’à ne pas appliquerun de ces articles de façon équivalente à deux personnes dif-férentes.Dans ce sens-là, je pense que Mme Spoerry a raison avecson amendement. Il est bon de condamner strictement la dis-crimination. Il n’est pas utile de faire l’énumération qui suit;elle affaiblit le principe principal qui est d’abord énoncé.Je vous propose de soutenir la proposition Spoerry.
Rhinow René (R, BL), Berichterstatter: Ich möchte den nichteinfachen Versuch unternehmen, noch einige Überlegungenzur rechtlichen Tragweite dieser Diskriminierungsbestim-mungen anzustellen. Ich schicke aber meinen Ausführungenvoraus, dass es hier teilweise um offene Rechtsfragen geht,so dass ich Ihnen nicht einen einhelligen Stand von Lehreund Rechtsprechung übermitteln kann.1. Diskriminierung heisst einmal rechtliche Ungleichbehand-lung einer bestimmte Gruppe, einer Minderheit; Ungleichbe-handlung nur deswegen, weil sich Menschen einer solchenGruppe zugehörig fühlen oder ihr angehören, und weil sichdiese Gruppe in einer bestimmten Hinsicht von der Mehrheitunterscheidet.Mit der Vorstellung der Diskriminierung ist aber stets nochetwas Zusätzliches verbunden, nämlich eine herabwürdi-gende, eine ausgrenzende Einstellung oder Haltung der Be-völkerungsmehrheit oder der staatlichen Organe. Diskrimi-nierung ist deshalb mehr als einfach nur ungerechtfertigteUngleichbehandlung, weil sie eine kollektive Dimension hat,auf eine Gruppe verweist und weil sie auch eine wertendeoder abwertende Dimension enthält.Wenn der Vorschlag des Bundesrates sagt, niemand dürfediskriminiert werden, muss man den zweiten Teil des Satzesmiteinschliessen. Er heisst nämlich: «namentlich wegen».Das «wegen» ist das Entscheidende der Diskriminierung undnicht einfach nur das nackte Wort «Diskriminierung» für sichallein. Deshalb hat die Bundesverfassung von 1848 und ha-ben auch andere Verfassungen wie neuere internationaleMenschenrechtspakte immer besondere Fälle von Diskrimi-nierungen aufgezählt, bei denen es darum ging, historischeoder aktuell erlebte Benachteiligungen zu verbieten odermöglichst zu verhindern.2. Diskriminierung bezieht sich auf den Staat. Er wird in diePflicht genommen, nicht gesellschaftliche Gruppen und Pri-vate. Es ist deshalb in all denjenigen Fällen vor übersteiger-ten Erwartungen zu warnen, wo die vorhandene Diskriminie-rung vor allem eine gesellschaftliche Diskriminierung ist undder Staat – jedenfalls nach heutiger Auffassung, nach heuti-gem Stand – eigentlich kaum als derjenige auftritt, der dieseGruppe ausgrenzt. Dem Staat erwächst auch, allein gestützt
20. Januar 1998 S 37 Bundesverfassung. Reform
Amtliches Bulletin der Bundesversammlung / Separatdruck
auf das Diskriminierungsverbot, noch keine direkte Pflicht,die Beseitigung von gesellschaftlichen Diskriminierungen aufdem Wege der Gesetzgebung vorzunehmen.3. Diese spezifischen Diskriminierungsverbote haben alsorechtlich die Bedeutung, dass ungleiche Behandlungen einerbesonders qualifizierten Begründungspflicht unterstehen.Sie dürfen nicht einfach an das Unterscheidungsmerkmalanknüpfen, an die Eigenschaft, welche die diskriminierteGruppe definiert. Aber auch dort sind Ungleichbehandlun-gen, wenn sie qualifiziert zu rechtfertigen sind, weiterhinmöglich, weil es keine absolute Gleichheit gibt.4. Das Diskriminierungsverbot allein enthält noch kein Egali-sierungsgebot. Wenn wir Diskriminierungstatbestände auf-nehmen, verlangen wir damit vom Gesetzgeber nicht, realeGleichheit herzustellen. Dies gälte nur, wenn die Verfassungeinen Gesetzgebungsauftrag enthält, wie das im heutigenArtikel 4 Absatz 2 bzw. in Absatz 3 von Artikel 7 des Entwur-fes der Fall ist oder wie das Herr Brändli mit Absatz 4 für dieBehinderten erreichen möchte. Wenn wir also die jetzt dis-kutierten Tatbestände ansehen, so ist wohl zu überlegen,welchen Stellenwert sie wirklich haben und ob nicht Erwar-tungen und rechtlicher Gehalt teilweise weit auseinander-klaffen.5. Die rechtliche Tragweite besteht darin, dass mit dem Ver-weis auf spezifisch zu schützende Gruppen eine erhöhte Be-gründungspflicht eingeführt wird, zudem wird politisch-psy-chologisch ein wichtiger Akzent gesetzt, indem es dem Ver-fassunggeber besonders um den Schutz einzelner Gruppengeht.Schliesslich muss ich darauf hinweisen, dass die Verfassungnicht nur ein rechtliches Dokument darstellt, sondern aucheine politisch-integrative Tragweite aufweist. Viele Men-schen, die Schutz beanspruchen, möchten Garantien in denVerfassungstext aufnehmen.Deshalb habe ich auch Mühe mit dem Antrag Spoerry, ob-wohl er offenbar hier auf eine gewisse Sympathie stösst.Denn für sich allein genommen sagt der Satz, niemand dürfediskriminiert werden, nicht viel aus. Er ist rechtlich vollum-fänglich in Absatz 1 enthalten, wonach niemand ungleich be-handelt werden darf. Denn Diskriminierung bezieht sich im-mer auf eine bestimmte Gruppenzugehörigkeit, auf ein be-sonderes Merkmal dieser Gruppe.Also: Wenn Sie streichen wollen, dann sollten Sie eigentlichauch diesen Satz streichen und sagen, es brauche keinenAbsatz 2. Wenn Sie den Satz «Niemand darf diskriminiertwerden» beibehalten, dann eröffnen Sie allenfalls dem Rich-ter die Möglichkeit, selbst zu bestimmen, welche Gruppenbesonders zu schützen sind, oder auch zurückzugehen undbestimmte Gruppen nicht mehr zu schützen, die heute durchdie Verfassung besonders geschützt werden. Sie erreichenmit diesem Satz eigentlich keine Klarheit, sondern bewirkenim Gegenteil eine zusätzliche Unklarheit.Ich bitte Sie deshalb, entweder der Kommission und damitdem Bundesrat zuzustimmen oder im einen oder anderenFall eine Erweiterung des Kataloges vorzunehmen, wie esbeantragt worden ist, aber nicht den ganzen Katalog zu strei-chen und quasi das Kind mit dem Bade auszuschütten. Poli-tisch würde das von all denjenigen nicht verstanden, die nachdem Entwurf des Bundesrates oder bereits nach heutigemVerfassungsrecht besonders geschützt sind.Zum Schluss: Erinnern wir uns der psychologischen Tatsa-che, dass die Streichung eines einmal publizierten Textes inder Öffentlichkeit immer anderen Bedingungen unterworfenist als die Nichtaufnahme eines neuen Textes, der noch keineErwartungen geweckt hat!
Brunner Christiane (S, GE): Je partage pleinement l’opinionqui vient d’être exprimée par mon préopinant. Pour moi, laConstitution fédérale est plus qu’un code juridique, est plusqu’un code tout à fait sec. Elle représente aussi un code éthi-que qui reflète la sensibilité et la volonté morale de la popu-lation. Si la liste des demandes d’extension de protectioncontre les discriminations s’est allongée, c’est bien la preuveque le besoin, la demande pour plus de justice et de tolé-rance augmentent dans notre société et se déplacent peut-
être aussi d’un groupe à l’autre, suivant à quel stade d’évolu-tion nous nous trouvons.Si on prend l’exemple de la cause de discrimination liée àl’homosexualité, je pense que c’est un bon exemple qui indi-que qu’il faut maintenir une liste exemplative à l’article 7alinéa 2. Nous sommes, en fait, encore mal à l’aise devantl’homosexualité. Et si deux hommes ou deux femmes échan-gent un geste affectueux l’un à l’égard de l’autre dans la rueou dans notre entourage immédiat, on est gêné, on est scan-dalisé, on doit encore réfléchir à ce qu’il convient de fairedans un cas comme celui-là.Je suis persuadée qu’il ne faut pas sous-estimer la valeursymbolique d’une disposition antidiscriminatoire dans laConstitution fédérale. Même si ces exemples de discrimina-tion sont des causes exemplatives, même si l’on introduit legenre de vie comme le propose Mme Beerli, je sais que çane va pas changer la vie quotidienne des homosexuels dujour au lendemain, mais je suis persuadée que cet ajout, quipeut nous sembler, à nous, tout à fait insignifiant, est signifi-catif pour les personnes concernées et que cela exprime àl’égard de ce groupe de personnes homosexuelles notre vo-lonté d’affirmer le droit à la tolérance et au respect commepour toutes les autres personnes.Je me réjouis d’une évolution qui va dans le sens d’un débatcontinu sur les causes de discrimination que l’on mentionneà titre exemplatif dans la Constitution fédérale. Je pense que,dans ce cas, la simplicité de la proposition Spoerry s’opposeau maintien d’une réflexion, s’oppose au maintien d’un débatqui ne peut jamais être clos parce qu’il doit suivre l’évolutionqui se passe dans notre société, mais c’est un débat qui en-richit notre société d’une manière générale et qui accordeaussi aux êtres humains qui en éprouvent le besoin la garan-tie que notre droit fondamental les protège contre toute dis-crimination.Je crois que pour nous, en tant que parlementaires, il appa-raît peut-être qu’une telle disposition est inutile puisque, juri-diquement, on peut interpréter les causes de discrimination.Mais, au niveau de la population, au niveau des personnesconcernées, il n’est pas indifférent de savoir que cette protec-tion particulière, cette reconnaissance particulière de leurstatut et de leur égalité est précisée dans le texte de la Cons-titution fédérale, et ils ne peuvent pas dire: «Voilà, c’est sim-ple, on est compris dans le fait que notre constitution interditles discriminations ou garantit l’égalité des droits.» Il faut con-crétiser cela. Pour certains groupes de personnes, c’est im-portant d’avoir l’affirmation de cette protection, de cette ga-rantie. Et même si, dans quelques années peut-être, un autregroupe de personnes viendra avec une autre demande, onpourra aussi la satisfaire. Eh bien, on tient compte de ce quiapparaît dans notre société, mais on garde aussi ce qui ré-sulte de notre passé. Il n’est pas indifférent de ne plus men-tionner les discriminations quant au sexe, quant à la langueou quant à la situation sociale. Ce sont encore des causes dediscrimination qu’il convient de mentionner, même à titreexemplatif, dans le texte de la Constitution fédérale.Ce sont les raisons pour lesquelles je vous invite à refuser laproposition Spoerry et à soutenir aussi bien la propositionBeerli que la proposition Leumann.
Beerli Christine (R, BE): Ich möchte nur die Frage von HerrnMaissen beantworten, die er mir gestellt hat. Ich bin ihm dasschuldig, obschon der Kommissionspräsident schon daraufeingegangen ist.Eine Aufnahme in Artikel 7 Absatz 2 bedeutet Schutz vorstaatlicher Diskriminierung; es geht um ein Diskriminierungs-verbot und nicht um ein Gleichbehandlungsgebot. Das istkeine Handlungsanweisung an die staatlichen Organe; dem-zufolge könnte auch kein Recht auf Ehe oder irgend etwas indieser Art und Weise daraus abgeleitet werden, wenn die Le-bensformen in Artikel 7 Absatz 2 aufgenommen würden.Ich erlaube mir noch eine kleine Anregung zuhanden vonFrau Spoerry. Ich habe einleitend gesagt, für mich genügeder Satz «Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich», esbrauche den Satz «Niemand darf diskriminiert werden» nicht.Wenn Frau Spoerry diesen Satz trotzdem aufrechterhalten
Constitution fédérale. Réforme 38 E 20 janvier 1998
Bulletin officiel de l’Assemblée fédérale / Tiré à part
möchte, so steht er meines Erachtens in Absatz 1 nicht amrichtigen Ort, sondern er müsste praktisch als «Schrumpfab-satz 2» stehenbleiben. Man könnte Absatz 2 also «zusam-menstreichen», ohne dass inhaltlich etwas verlorenginge, in-dem man dort nur noch sagen würde: «Niemand darf diskri-miniert werden.»
Spoerry Vreni (R, ZH): Zunächst zu Frau Beerli: Ich bin mitdieser Anregung sehr einverstanden. Ich finde sie eine klareVerbesserung gegenüber meinem ursprünglichen Antrag.Ich habe die Formulierung meines Antrages so gewählt, weilsie mit einem Minderheitsantrag im Nationalrat identisch istund weil es u. a. auch ein Bestreben sein soll, die Differenzenzwischen den Räten möglichst zu eliminieren. Ich bin aberder Meinung, dass es eine Verdeutlichung ist, wenn man dasDiskriminierungsverbot in einem separaten Absatz regelt.Hingegen bin ich nicht der Meinung von Herrn Rhinow. Ichkann nicht nachvollziehen, weshalb die Feststellung, dasseine Diskriminierung verboten ist, für sich alleine nichts aus-sagen soll. Es ist das Verbot, aktiv in einer falschen Richtungzu handeln. In diesem Sinne sagt dieser Satz für mich mehraus als der Satz, dass die Würde des Menschen zu achtenund zu schützen ist. Er ist zumindest ebenso aussagekräftigwie der Satz, dass alle Menschen vor dem Gesetz gleichsind, sonst müssten wir diese passiven Formulierungen auchmit einem Katalog von Beispielen anreichern. Niemandwürde anregen, diese passiven Formulierungen aus der Ver-fassung zu streichen, weil wir alle wissen, was wir damit sa-gen wollen. Das gilt auch für das Diskriminierungsverbot. Wirverbieten, jemanden zu diskriminieren. Das ist von mir ausgesehen eine ganz wichtige Aussage.Ich kann auch nicht nachvollziehen, dass es mehr Gewichthaben soll, wenn man etwas, das bereits einmal vorgeschla-gen worden ist, nicht mehr erwähnt, als wenn etwas, was alsqualifiziertes Schweigen ausgelegt wird, nicht aufgenommenwird. Wenn wir sagen, dass zwar bei der exemplarischenAufzählung alle gemeint sind, dass wir bestimmte Gruppenaber doch nicht erwähnen wollen, dann hat das von mir ausgesehen ebenfalls recht viel Gewicht.Frau Simmen hat es besser zusammengefasst als ich dastun kann: Im Laufe der Diskussion ist die Überzeugung ent-standen, dass die Aufzählung, wie auch immer wir sie ma-chen, ein Stück weit unbefriedigend sein muss. Deshalbwürde ich es begrüssen, wenn man sich auf den einfachenGrundsatz beschränken könnte.Frau Brunner möchte ich sagen, dass die Diskussion überdiese Problematik sehr wichtig ist, dass sie zur Sensibilisie-rung für diese Fragen beiträgt, dass in den Materialien ent-halten ist, was wir meinen und was wir nicht meinen, nämlichdass wir Diskriminierungen von wem auch immer und wieauch immer in unserem Land nicht haben wollen – dass sieeinklagbar sind.So gesehen meine ich, dass die Diskussion wertvoll ist, dassaber eine nicht vollständige Aufzählung unter Umständenmehr Schaden anrichtet als die klare Feststellung des Grund-satzes.
Leuenberger Moritz, Bundesrat: Absatz 1, Rechtsgleichheit,ist unbestritten. Absatz 2 handelt von etwas anderem, vonder Diskriminierung. Ich bin froh, dass sich wenigstens alsEventualkonsens herausgestellt hat, dass Absatz 2 stehen-bleiben und die Nichtdiskriminierung auf jeden Fall genanntwerden muss, dass also nicht der ganze Absatz gestrichenwerden kann. Somit geht es nur noch um die Frage, ob in die-sem Absatz 2 eine exemplifikatorische Aufzählung einzelnerDiskriminierungselemente erfolgen soll oder nicht.Rein juristisch, positivrechtlich gedacht, hat Frau Spoerryrecht; es ist rein juristisch nicht notwendig. Der ganz sprödeGrundsatz würde rechtlich gesehen genügen. Politisch abersieht der Bundesrat das etwas anders: Diese Verfassungwird auch deshalb gemacht, damit sich dieses Land der Min-derheiten mit ihr identifizieren kann. Zu dieser Identifikationgehört auch, dass alle Menschen, die diskriminiert werdenkönnten, in diesem Verfassungstext sehen, dass sie nichtdiskriminiert werden dürfen.
Wir bringen damit zum Ausdruck, dass diese Nichtdiskrimi-nierung keine Selbstverständlichkeit ist. Die Verfassung willauch illustrieren, was sie mit diesem einfachen Grundsatz ei-gentlich zum Ausdruck bringen will.Unsere Verfassung ist diesbezüglich nicht die einzige. Auchkantonale Verfassungen kennen solche Aufzählungen. Siewurden erarbeitet durch Zuschriften, wie Herr Onken sie z. B.nannte; durch Anträge, wie sie Frau Beerli und Frau Leu-mann gestellt haben; diese wiederum sind getragen von Min-derheiten in diesem Lande, die sich hier wiedererkennen wol-len.Auch Menschenrechtspakte nennen derartige exemplifikato-rische Aufzählungen, gerade wegen dieser psychologischenWirkung. Die EMRK kennt diese Aufzählungen auch. IndemSie eine solche Aufzählung machen, gestehen Sie ein, dassdie Diskriminierung im Leben immer eine Bedrohung für dieMinderheiten und ihre Vermeidung nicht selbstverständlichist.Ich will nicht den Eindruck erwecken, dieser Absatz würdeeine Drittwirkung entfalten. Das tut er nicht. Er richtet sich nuran den Staat, aber dennoch hat er gewissermassen eineethische Drittwirkung, indem sich auch andere gesellschaftli-che Kräfte – Arbeitgeber, Medien zum Beispiel – darauf be-sinnen müssen: Im Prinzip gibt es einen Grundsatz der Nicht-diskriminierung. Ich würde Ihnen empfehlen, diese beispiel-hafte Aufzählung als ethisches Bekenntnis aufzunehmen.Die Verfassung ist nicht nur einfach eine Grundlage für spä-tere rechtliche Auseinandersetzungen und Interpretationen,die dann in Lausanne vorgenommen werden. Absicht dieserNachführung ist es ja auch, dass sie von der Bevölkerungdieses Landes getragen wird. Jetzt einfach sämtliche Bei-spiele herauszustreichen, wäre zwar eine sehr saubere undradikale Lösung, aber es würde ein bisschen den Eindruckder Resignation und der einfachsten Lösung erwecken. Wiewenn man sich mit der faktischen Diskriminierung, die es inunserer Schweiz gegenüber verschiedenen Kreisen ebendoch noch gibt, nicht auseinandersetzen wollte. Auch wenndem nicht so ist, kann es diesen Eindruck machen bzw. soverstanden werden. Deshalb ersuche ich Sie, an der Lösungdes Bundesrates festzuhalten.Was die einzelnen Anträge angeht, möchte ich offen sein.Die Antragsteller haben ja begründet, warum sie sie gestellthaben, nämlich weil sich eben viele Leute an sie gewandt ha-ben. Gerade deswegen ist das ein Argument, sich diesen An-trägen nicht zu verschliessen.Der einzige Antrag, mit dem ich rein sprachlich etwas Mühehabe, ist der Antrag Brändli betreffend Absatz 2, weil ich nichtganz sehe, was der Unterschied zwischen psychisch undgeistig Benachteiligten sein soll; für mich ist es eigentlich dasgleiche. Das ist aber nicht inhaltlich gemeint, sondern reinsprachlich.Ich würde Ihnen empfehlen, den Antrag Spoerry abzulehnenund im Zweifelsfall allen anderen Anträgen, die hier gestelltworden sind, zuzustimmen.
Brändli Christoffel (V, GR): Ich möchte nur etwas zu dieserAufteilung der Behinderungen sagen: Das ist die Definition,wie sie der Bundesrat bei der IV-Gesetzgebung vorgenom-men hat; er hat dort diese Dreiteilung – psychisch, geistig undkörperlich – definiert und auch gesagt, was das ist.
Präsident: Frau Spoerry hat ihren Antrag abgeändert: Siewill den zweiten Satz neu als Absatz 2 definieren.
Abs. 1 – Al. 1Angenommen gemäss Antrag der KommissionAdopté selon la proposition de la commission
Abs. 2 – Al. 2
Präsident: Hier stehen sich zwei Konzepte gegenüber: dasKonzept gemäss Antrag Spoerry und das Konzept des Bun-desrates, allenfalls angereichert durch weitere Aufzählun-gen.
20. Januar 1998 S 39 Bundesverfassung. Reform
Amtliches Bulletin der Bundesversammlung / Separatdruck
Wir bereinigen zunächst das Konzept Bundesrat und stim-men separat über die Einzelanträge ab. Dann stellen wir dasErgebnis dem Konzept gemäss Antrag Spoerry gegenüber. –Sie sind damit einverstanden.
Erste Eventualabstimmung – Premier vote préliminaireFür den Antrag Beerli 26 StimmenDagegen 14 Stimmen
Zweite Eventualabstimmung – Deuxième vote préliminaireFür den Antrag Leumann 16 StimmenDagegen 17 Stimmen
Dritte Eventualabstimmung – Troisième vote préliminaireFür den Antrag Brändli 21 StimmenDagegen 17 Stimmen
Definitiv – DéfinitivementFür den Antrag Spoerry 29 StimmenFür den Antrag der Kommission/Beerli/Brändli 14 Stimmen
Abs. 3 – Al. 3Angenommen – Adopté
Abs. 4 – Al. 4
Brändli Christoffel (V, GR): Aus der Sicht der Behinderten –ich verweise auf die parlamentarische Initiative Suter – sinddrei Anliegen zu diskutieren:1. das Diskriminierungsverbot,2. der Gleichstellungsauftrag,3. der Rechtsanspruch auf Gleichbehandlung.In bezug auf den Rechtsanspruch auf Gleichbehandlung ha-ben beide Verfassungskommissionen die Aufnahme einerBestimmung verweigert. Es ist eine Auffassung, die man imRahmen einer blossen Nachführung der Verfassung vertre-ten kann, auch wenn damit das Problem nicht gelöst wird. Ichbitte die Kommission, je nach Ergebnis der Beratungen imNationalrat, allenfalls auf diese Frage zurückzukommen.In bezug auf den Gleichstellungsauftrag – darum geht es inmeinem Antrag – bestehen zwischen den beiden Kommissio-nen unterschiedliche Auffassungen: Die nationalrätlicheKommission hat eine entsprechende Ergänzung aufgenom-men. Die ständerätliche Kommission hat eine solche abge-lehnt.Es ist meiner Meinung nach unbestritten, dass mit einemDiskriminierungsverbot allein die Rechts- und Chancen-gleichheit für behinderte Menschen nicht erreicht werdenkann. Es bedarf dazu weiterer gesetzlicher Bestimmungen,welche einerseits das Benachteiligungsverbot für einzelneLebensbereiche konkretisieren und anderseits Massnahmenzum Ausgleich und zur Beseitigung bestehender Nachteilevorsehen.Wichtig ist, dass diese Massnahmen nicht allein über die Bei-träge der Sozialversicherungen – insbesondere über die IV –finanziert werden, sondern dass das Gesetz präventiv Be-stimmungen vorsieht, welche teure Sonderlösungen über-flüssig machen.Auch muss – wie in einem Gutachten von Professor Kölznachgewiesen worden ist – nicht damit gerechnet werden,dass mit der Aufnahme dieses Absatzes plötzlich jede so-ziale Gruppe ihren Gleichstellungsartikel verlangt. Für reli-giöse, politische und weltanschauliche Gruppierungen sowiefür sprachliche und ethnische Minderheiten dürfte das Diskri-minierungsverbot gemäss diesem Gutachten zur Erreichungeiner faktischen Egalisierung bereits genügen. Die Gleich-stellung sozial Benachteiligter – das heisst, vorwiegend wirt-schaftlich Benachteiligter – erfolgt hingegen im Rahmen dereinzelnen Ausprägungen des Sozialstaates.Es ist auch nicht damit zu rechnen, dass die Aufnahme undErfüllung der vorgeschlagenen Bestimmungen eine Kosten-lawine nach sich ziehen wird. Viele Ausgrenzungen Behin-derter rühren heute von einem mangelnden Verständnis fürderen Anliegen her. Die Förderung des Verständnisses
könnte z. B. mit einem verhältnismässig geringen finanziellenAufwand im Rahmen von verschiedenen schulischen und be-ruflichen Ausbildungen betrieben werden. Der heute üblicheBetrieb von Sonderschulen und Heimen dürfte beispiels-weise sogar teurer sein als die Integration in die normale Um-gebung.Der Ansatz der nationalrätlichen Kommission geht ohneZweifel in die richtige Richtung. Ich bitte Sie deshalb, meinemAntrag zuzustimmen.
Inderkum Hansheiri (C, UR), Berichterstatter: So sympa-thisch mir – und wahrscheinlich auch vielen von Ihnen – die-ses Anliegen auch ist, muss ich Ihnen doch beantragen, derKommission zu folgen und den Antrag Brändli abzulehnen,und zwar aus folgenden Gründen: Das Konzept ist: Absatz 1beinhaltet den Grundsatz, nämlich «Alle Menschen sind vordem Gesetz gleich»; Absatz 2 ist die Konkretisierung diesesGrundsatzes in einem wichtigen Bereich, das Diskriminie-rungsverbot; Absatz 3 ist gleichermassen eine Lex specialis,was die Gleichberechtigung von Mann und Frau betrifft.Nun möchte Herr Brändli gleichermassen eine Lex specialisfür das Verhältnis zwischen Nichtbehinderten und Behinder-ten schaffen. Ich verweise in diesem Zusammenhang auf dieAusführungen des Kommissionspräsidenten zum recht kom-plexen Begriff der Diskriminierung. Wir würden vom Staatnicht nur die Verhinderung von etwas Negativem verlangen,sondern die Schaffung von etwas Positivem. Das Hauptargu-ment ist, dass wir damit über die Nachführung hinausgehenwürden.
Leuenberger Moritz, Bundesrat: Es ist an Ihnen zu entschei-den. Ich kann mich diesem Antrag nicht widersetzen.
Schmid Carlo (C, AI): Das Furchtbare an diesem Antrag ist,dass man sich ihm politisch korrekt kaum widersetzen kann.Aber ich bin nicht sicher, ob er durchdacht ist. Ich weiss nicht,was in allen Konsequenzen auf uns zukommt. Daher werdeich diesem Antrag nicht zustimmen.
Brändli Christoffel (V, GR): Ich habe versucht, Ihnen darzu-legen, dass es hier natürlich schon um ein Gebot geht, dasanalog zum Artikel 3 aufgenommen wird. Ich habe bewusstdarauf verzichtet, einen Antrag bezüglich des Rechtsanspru-ches auf Gleichbehandlung zu stellen, wie er in der parla-mentarischen Initiative enthalten ist und im Nationalrat ge-stellt wird. Ich glaube, diese Problematik ist im Rahmen ei-ner Nachführung nicht lösbar. Hingegen bin ich der festenÜberzeugung, dass hier ein positives gesetzgeberischesHandeln – es wird mit dieser Ausführung ja nichts präjudi-ziert – notwendig ist, um Behinderte in unsere Gesellschaftzu integrieren. Es geht hier um mehrere hunderttausendPersonen. Und es genügt eben nicht, Lösungen mit demDiskriminierungsverbot zu treffen.Sie präjudizieren mit meinem Antrag nichts; die nationalrätli-che Kommission hat dies sehr eingehend diskutiert und dieseFassung aufgenommen. Die Kommissionsmehrheit hatebenfalls den Rechtsanspruch weggelassen; es gibt aberMinderheitsanträge.
Aeby Pierre (S, FR): J’ai énormément de sympathie pour laproposition Brändli, mais je dois avouer qu’après la décisionque nous avons prise à l’alinéa 2 d’indiquer seulement quepersonne ne doit être discriminé, on a tout à coup l’impres-sion d’un parachutage. Pour pouvoir introduire un alinéasupplémentaire, je fais la proposition – on n’a pas pu voterlà-dessus – de revenir sur la solution de la commission,c’est-à-dire sur l’article 7 tel qu’il est proposé par la commis-sion, et de l’opposer à la proposition Spoerry.Si l’article 7 est accepté selon proposition de la commission,nous pourrons beaucoup plus facilement introduire un alinéasupplémentaire comme le prévoit la proposition Brändli.Mais, dans la situation actuelle, ça me paraît difficile parcequ’on n’a vraiment laissé que les tout grands principes. Si onintroduit maintenant un alinéa spécial pour les personneshandicapées, on va dire: «Mais pourquoi est-ce qu’il n’y a pas
Constitution fédérale. Réforme 40 E 20 janvier 1998
Bulletin officiel de l’Assemblée fédérale / Tiré à part
un alinéa pour tous les autres?», puisqu’on n’a plus cetteénumération fondamentale.Cette énumération fondamentale – et ça a bien été expliquépar le président de la commission, M. Rhinow – avait ici toutesa valeur, si bien que je propose d’opposer, ce qui n’a jamaisété fait, la proposition de la commission à la propositionSpoerry et ensuite seulement de nous prononcer sur l’alinéasupplémentaire selon la proposition Brändli.
Präsident: Herr Aeby beantragt Rückkommen auf Absatz 2.
Abstimmung – VoteFür den Ordnungsantrag Aeby 2 StimmenDagegen 24 Stimmen
Abs. 4 – Al. 4
Abstimmung – VoteFür den Antrag Brändli 11 StimmenDagegen 20 Stimmen
Art. 8Anträge der Kommissionen: BBlPropositions des commissions: FF
Inderkum Hansheiri (C, UR), Berichterstatter: Artikel 8 ga-rantiert den Schutz vor Willkür und die Wahrung von Treuund Glauben. Diese Rechte sind durch die Rechtsprechungdes Bundesgerichtes, welches sie aus Artikel 4 herleitet, an-erkannt.Was diese Bestimmung betrifft, ist zunächst auf das Verhältniszu Artikel 4, Grundsätze rechtsstaatlichen Handelns, zu ver-weisen. Artikel 4 – ich habe darauf hingewiesen – enthält dieVerpflichtung der staatlichen Behörden, aber auch der Priva-ten, im Verhältnis zueinander nach Treu und Glauben zu han-deln. Bei Artikel 8 geht es um den grundrechtlichen Aspekt.Hinzuweisen ist vor allem auf die Frage der Durchsetzbarkeitdes Willkürverbotes. Weil dieses bis anhin vom Bundesge-richt aus Artikel 4 abgeleitet worden ist, hat das Bundesge-richt in seiner Rechtsprechung festgehalten, dass das Will-kürverbot nur durchgesetzt werden könne, wenn in einer ge-setzlichen Bestimmung ein normierter, verbriefter Anspruchauf eine konkrete Behandlung bestehe.Dies hat sogar dann gegolten, wenn – wie im Fall des Kan-tons Bern – ein durch die Kantonsverfassung garantiertesWillkürverbot besteht; ich verweise auf den Bundesgerichts-entscheid 121 II 267f.Das Bundesgericht hat wörtlich festgehalten: «Ob ein Be-schwerdeführer durch eine behauptete Verfassungsverlet-zung hinreichend betroffen ist, um mittels staatsrechtlicherBeschwerde den Schutz des eidgenössischen Verfassungs-richters anrufen zu können, bestimmt sich allein nachArtikel 88 des Obligationenrechtes.»Nun gibt unsere Kommission nicht nur ihrer Hoffnung Aus-druck, sondern sie ist klar der Auffassung, dass das Bundes-gericht inskünftig aufgrund von Artikel 8 – falls Sie ihm zu-stimmen sollten – seine Praxis wird ändern müssen. Dennmit der ausdrücklichen Erwähnung des Willkürverbotes imGrundrechtskatalog wird klar zum Ausdruck gebracht, dasses sich hierbei um ein selbständiges verfassungsmässigesRecht handelt.
Angenommen – Adopté
Art. 9Anträge der Kommissionen: BBlPropositions des commissions: FF
Inderkum Hansheiri (C, UR), Berichterstatter: DieserArtikel 9 enthält das Recht auf Leben und persönliche Frei-heit. Vieles ist ungeschriebenes Grundrecht gemäss Praxisdes Bundesgerichtes; dieses Grundrecht ist aber auch völ-kerrechtlich verankert, wie z. B. in Artikel 2 der EMRK, inArtikel 6 des Uno-Paktes II oder in Artikel 6 des Uno-Über-einkommens über die Rechte des Kindes.
In Absatz 1 beantragt die Kommission, anstatt «ein» «das»Recht auf Leben zu schreiben; es geht hier nicht um irgend-ein Recht auf Leben, sondern um das Recht auf Lebenschlechthin.Absatz 2 enthält verschiedene Erscheinungsformen der per-sönlichen Freiheit. Diese Aufzählung ist nicht abschliessend,was wiederum durch das Wort «namentlich» zum Ausdruckgebracht wird. Dies belässt dem Bundesgericht den entspre-chenden Spielraum, um bei seiner Rechtsprechung in die-sem sehr anspruchsvollen Grundrecht den aktuellen Ent-wicklungen Rechnung zu tragen.In Absatz 2 beantragt die Kommission, die drei Worte «in je-dem Fall» zu streichen, mit der Begründung, dass es von ei-nem absoluten Verbot per definitionem keine Ausnahme ge-ben kann.
Leuenberger Moritz, Bundesrat: Ich bin mit der Kommis-sionsfassung einverstanden.
Angenommen – Adopté
Art. 10Anträge der Kommissionen: BBlPropositions des commissions: FF
Inderkum Hansheiri (C, UR), Berichterstatter: Hier schlägtdie Kommissionsmehrheit sowohl im Titel als auch im Texteine andere Formulierung vor. Sie will die letzten Zweifel aus-räumen, dass es sich hier um ein Recht auf Existenzmini-mum handeln könnte, und klarmachen, dass es um dasRecht auf Existenzsicherung geht, das als «Recht auf Hilfe inNotlagen» nach dem Prinzip der Subsidiarität zu umschrei-ben ist.Das Bundesgericht hat in seinem Entscheid BGE 121 III367ff. ein Recht auf Existenzsicherung in diesem Sinne, ins-besondere auch aufgrund einer beinahe einhelligen Aner-kennung in der Lehre, anerkannt. Das Bundesgericht hataber auch ausdrücklich festgehalten, dass das Grundrechtauf Existenz auf ein Minimum, eben auf eine Hilfe in Notla-gen, ausgerichtet sein soll. Ausdrücklich hält das Bundesge-richt im erwähnten Entscheid fest: «In Frage steht dabei al-lerdings nicht ein garantiertes Mindesteinkommen. Verfas-sungsrechtlich geboten ist nur, was für ein menschenwürdi-ges Dasein unabdingbar ist und vor einer unwürdigenBettelexistenz zu bewahren vermag.» Daraus ergibt sichklar, dass jemand, der in eine Notlage geraten ist, die für einmenschenwürdiges Dasein unerlässlichen Mittel bekommt,um überleben zu können.Die von der Kommission vorgeschlagene Formulierung gibtdie Verfassungswirklichkeit besser wieder und verdeutlicht –wie erwähnt –, dass es sich nicht um ein Recht auf ein Exi-stenzminimum handelt. Wichtig ist im Entscheid des Bundes-gerichts der Hinweis auf die Überlebenshilfe. Es geht um eineÜberbrückungshilfe. Es geht um eine Hilfe zur Selbsthilfe.Aber dazu haben wir noch einen Antrag der Minderheit.
Aeby Pierre (S, FR): Il ne s’agit pas ici d’une simple formula-tion différente. La proposition de la majorité de la commissionva beaucoup plus loin qu’une simple formulation, que le faitde dire les choses de manière différente. J’aimerais rappelerque la proposition de minorité que je défends avec M. Gentilne vise rien d’autre que de rester fidèle au projet du Conseilfédéral.Nous sommes en train d’examiner un catalogue des droitsfondamentaux. M. Schmid a pris la peine, dans sa proposi-tion à l’article 32 alinéa 1bis, de décrire de façon non pas ex-haustive, mais relativement complète, les limites des droitsfondamentaux. C’est une des propositions à l’article 32 ali-néa 1bis.On pourra discuter de la question: voulons-nous une disposi-tion qui donne les limites des droits fondamentaux? Mais il ya à l’article 10 tout de même quelque chose d’extrêmementparticulier: contrairement à ce que propose M. Schmid àl’article 32 alinéa 1bis, on vise un seul droit fondamental – eton ne peut pas mettre en doute que ce soit un droit fonda-
20. Januar 1998 S 41 Bundesverfassung. Reform
Amtliches Bulletin der Bundesversammlung / Separatdruck
mental – et on lui introduit une restriction: «.... et n’est pas enmesure de subvenir à son entretien ....» Pour les autresdroits, le droit au mariage, la liberté de conscience et decroyance, etc. – on peut relire tout ce chapitre –, on n’a ja-mais, ou à de rares exceptions près – on reparlera du droit degrève et du secret de rédaction notamment –, introduit d’em-blée une limite dans le texte même. C’est un signe qu’on veutune moindre garantie, une garantie plus faible pour les con-ditions minimales d’existence.A mon avis, ça n’est pas juste dans la mesure où nous som-mes un Etat démocratique, un Etat libéral et un Etat social.Nous devons traiter des aspects qui relèvent des droits dé-mocratiques, de la liberté et de la sécurité sociale dans lemême esprit. A l’article 10, notre Etat serait défini comme unEtat démocratique, libéral, mais un peu moins social que lesdeux autres termes. C’est pour ça que je défends la solutiontrès consensuelle proposée par le Conseil fédéral.Il y a un autre élément inadmissible, c’est le titre. Le titre duConseil fédéral est une notion objective: «Droit à des condi-tions minimales d’existence». Cela signifie qu’il y a un stan-dard qui est la nourriture, le logement, d’une façon générale,et le vêtement. Une fois qu’on est habillé, qu’on a à mangeret qu’on est logé, selon certains standards qui sont ceux d’unEtat moderne, on a atteint les conditions minimales d’exis-tence. En revanche, quand on dit «Le droit d’obtenir de l’aidedans des situations de détresse», on ne dit rien sur le genred’aide, qui peut être complète ou partielle; surtout, la «dé-tresse» est un mot qui porte en lui-même une notion éminem-ment subjective, et pas forcément une notion de besoin. Jeconnais une personne extrêmement riche qui s’est trouvéedans une situation de détresse profonde parce qu’elle aperdu la moitié de sa fortune! C’est une situation de détresseà laquelle, humainement, on peut compatir, mais c’est une si-tuation de détresse qui n’a rien à voir avec des conditions mi-nimales d’existence. Donc, la formulation de la majorité de lacommission passe complètement à côté du droit fondamen-tal qu’on veut consacrer ici, à l’article 10.Par ma proposition de minorité, j’aimerais que l’on revienne,à l’occasion de ce débat, à la formulation originelle du projetdu Conseil fédéral.
Inderkum Hansheiri (C, UR), Berichterstatter: Ich möchtenur nochmals an die Eintretensdebatte von gestern anknüp-fen, wo wir bekanntlich festgestellt haben, dass der Begriffder Nachführung unter anderem darin besteht, dass wir dieVerfassungswirklichkeit verbriefen. Das erwähnte Recht aufExistenzsicherung ist in der heutigen Verfassung nicht fest-geschrieben, obwohl – wie bereits erwähnt – das Bundesge-richt dieses Recht als ungeschriebenes Grundrecht aner-kannt hat.Nach Auffassung der Kommissionsmehrheit geht es deshalbjetzt darum, dass wir dieses Recht in der Verfassung mög-lichst so festschreiben, wie es eben gedacht ist. Aus diesemGrunde haben wir auch den Titel geändert, damit – wie dasBundesgericht betont hat – nicht suggeriert wird, dass es sichhier um ein Recht auf ein Existenzminimum handelt. Wir ha-ben zusätzlich mit der Formulierung «.... und nicht in derLage ist, für sich zu sorgen» das Subsidiaritätsprinzip, wel-ches vom Bundesgericht ebenfalls anerkannt wurde, aus-drücklich festgeschrieben.Ich glaube, es dürfte klar und unbestritten sein, dass grund-sätzlich jede Person für sich selber zu sorgen hat. Das impli-ziert, dass man dann auch wieder versucht, aus einer Notsi-tuation herauszukommen; aber falls jemand im Sinne einerÜberbrückungshilfe dieses Rechtes auf Existenzsicherungbedarf, soll es auch durchgesetzt werden können.
Leuenberger Moritz, Bundesrat: Der Bundesrat hält an sei-ner Fassung fest. Dieser Artikel steht im Kapitel «Grund-rechte», und wenn bei Artikel 10 allein schon der Titel – nach-her aber auch der Text – relativiert wird, wird damit der Ein-druck erweckt, dieses Menschenrecht auf Existenz würdeausgerechnet in diesem Bereich tatsächlich relativiert.Der Bundesrat drückt sich klarer, vielleicht etwas plakativeraus als Ihre Kommission in dem von ihr gewählten Text. Er
sagt, es gebe ein «Recht auf Existenzsicherung». JedesGrundrecht, das vorher auch genannt wurde, erfährt in derPraxis durch die Gesetze, aber auch durch die Rechtspre-chung eine Relativierung. Dennoch haben Sie bei der Fas-sung des Bundesrates diese Relativierung jetzt nicht schonin die Maximen, die am Anfang der Bundesverfassung fest-gehalten werden, hineingebracht. Wenn dieses Subsidiari-tätsprinzip hier in Artikel 10 genannt werden soll, widersprichtdas auch etwas der gewählten Gesamtsystematik.Das Subsidiaritätsprinzip ist in Artikel 33 der Bundesverfas-sung ausdrücklich genannt. Der dortige Artikel im Kapitel«Sozialziele» beginnt mit «In Ergänzung zu privater Initia-tive und Verantwortung setzen sich ....» Dieses Subsidiari-tätsprinzip ist in der Verfassung selbst genannt, und es wi-derspricht irgendwie der hehren Aufzählung von Grundzie-len, wenn ausgerechnet das nur hier am Anfang genanntwird.Ich ersuche Sie, der Minderheit und dem Bundesrat zuzu-stimmen.
Abstimmung – VoteFür den Antrag der Mehrheit 29 StimmenFür den Antrag der Minderheit 6 Stimmen
Art. 11Anträge der Kommissionen: BBlPropositions des commissions: FF
Inderkum Hansheiri (C, UR), Berichterstatter: Artikel 11 be-schlägt den Schutz der Privatsphäre. Dieser Artikel ist mit derRechtsprechung des Bundesgerichtes und mit der Praxis derOrgane der EMRK zu Artikel 8, dem er materiell entspricht,identisch.Er hat in der Kommission zu keinen grösseren DiskussionenAnlass gegeben. Eine Frage, die sich stellte, war die, ob«jede Person» für die Adressaten des Grundrechtes richtigsei. Die Frage wurde mit der Begründung bejaht, dass vonder Norm selbstverständlich auch die juristischen Personenerfasst werden. Andererseits ist klar, dass nur natürliche Per-sonen gemeint sind, wenn in diesem Artikel von der Achtungdes Familienlebens die Rede ist.
Angenommen – Adopté
Art. 12Anträge der Kommissionen: BBlPropositions des commissions: FF
Inderkum Hansheiri (C, UR), Berichterstatter: Auch hierkann ich mich kurz fassen.Dieser Artikel entspricht Artikel 54 der heutigen Bundesver-fassung, beschränkt sich aber auf einen einzigen Satz desInhaltes «Das Recht auf Ehe ist gewährleistet». Diese Be-stimmung garantiert die Ehe als Institut.Andere Formen des Zusammenlebens zwischen Mann undFrau oder zwischen gleichgeschlechtlichen Partnern ge-niessen keinen institutionellen Schutz. Dies bedeutet abernicht – darauf lege ich Wert –, dass derartige andere For-men des Zusammenlebens verboten wären. Sie sind im Ge-genteil gestattet, weil sie nicht verboten sind. Und sie dür-fen, vor allem aufgrund von Artikel 7 Absatz 2, nicht diskri-miniert werden.Diese Bestimmung hat in der Kommission nicht Anlass zu ei-gentlichen Diskussionen gegeben.
Leuenberger Moritz, Bundesrat: Zuhanden der Materialienmuss ich lediglich festhalten, dass aus Artikel 12 nicht einePflicht zur Ehe abgeleitet werden kann. (Heiterkeit)
Angenommen – Adopté
Art. 13Anträge der Kommissionen: BBlPropositions des commissions: FF
Constitution fédérale. Réforme 42 E 20 janvier 1998
Bulletin officiel de l’Assemblée fédérale / Tiré à part
Inderkum Hansheiri (C, UR), Berichterstatter: Artikel 13 be-trifft die Glaubens- und Gewissensfreiheit. Er enthält Ele-mente der Artikel 49 und 50 der heutigen Bundesverfassung,soweit sie individualrechtlichen Charakter haben.Es wurde dabei versucht, die bisherige bundesgerichtlichePraxis in eine generell-abstrakte Norm zu kleiden. Die Praxisist auch durch das internationale Recht abgedeckt, insbeson-dere durch Artikel 9 EMRK und durch Artikel 18 des Uno-Paktes II. Hier ist noch zu vermerken, dass sich «jede Per-son» nur auf natürliche und nicht auf juristische Personen be-zieht. Die Glaubens- und Gewissensfreiheit ist, mit anderenWorten, menschenbezogen.
Angenommen – Adopté
Art. 14Anträge der Kommissionen: BBlPropositions des commissions: FF
Inderkum Hansheiri (C, UR), Berichterstatter: Wir haben eshier mit Artikeln 14 und Artikel 14a zu tun, mit der Meinungs-,Informations- und Medienfreiheit. Ihre Kommission bean-tragt, wie unser Präsident bereits erwähnt hat, entgegen demEntwurf des Bundesrates die Medienfreiheit aus Artikel 14herauszunehmen und in einem separaten Artikel zu regeln.Was die Meinungs- und Informationsfreiheit betrifft, so han-delt es sich unbestrittenermassen um klassische Nachfüh-rung.Bei der Medienfreiheit geht es nicht darum, die Pressefreiheitoder die Freiheit von Radio und Fernsehen im Sinne der be-stehenden Verfassungsbestimmungen in Zweifel zu ziehen.Pièce de résistance – auch das wurde vom Kommissionsprä-sidenten bereits erwähnt – bildet das Redaktionsgeheimnis,und zwar nicht zuletzt aufgrund von Vorkommnissen, dienoch nicht lange zurückliegen. Ich erinnere an den Fall Jag-metti in der «Sonntags-Zeitung». Manche von uns mögen et-was Mühe bekunden, wenn die Medienschaffenden – Jour-nalistinnen und Journalisten – bezüglich der Quellen ihrer In-formationen mit Selbstverständlichkeit einen absoluten Ge-heimnisschutz verlangen, nicht wenige von ihnen aber demStaat und der Politik – bzw. ihren Organen – das gleicheRecht nicht zugestehen wollen.Als Gesetzgeber dürfen wir uns aber nicht von solchen Vor-kommnissen und Eindrücken leiten lassen. Tatsache ist undbleibt, dass der Europäische Gerichtshof für Menschen-rechte in seinem Entscheid Goodwin gegen das VereinigteKönigreich entschieden hat, dass die Informationsquelle ge-schützt werden müsse und eine Verpflichtung zu ihrer Auf-deckung nur dann mit Artikel 10 der EMRK vereinbar ist,wenn ein zwingendes, übergeordnetes Interesse vorliegt.Aus diesem Grund können wir das Redaktionsgeheimnisnicht ignorieren. Wir müssen es vielmehr im Rahmen derNachführung erwähnen, wollen dabei aber aus den erwähn-ten Gründen expressis verbis zum Ausdruck bringen, dassgerade das Redaktionsgeheimnis nicht schrankenlos gilt,sondern nur in dem durch den Gesetzgeber gesteckten Rah-men.
Gentil Pierre-Alain (S, JU): Le rapporteur vient de le dire, leproblème essentiel de cet article, c’est la question du secretde rédaction. C’est sur ce point que je concentrerai la dé-fense de la proposition de minorité.Il convient de rappeler, en préambule, que le secret de rédac-tion, selon le message du Conseil fédéral, n’est pas absolu,mais qu’il doit permettre en cas de litige au juge de peser l’im-portance respective de l’intérêt public à connaître une sourced’information et le droit du journaliste de ne pas la révéler;donc, rien de bien extraordinaire.Si ce problème est jugé comme une question sensible de larévision constitutionnelle, c’est bien moins pour le principe,qui n’est pas tellement en cause ici, que pour son application,même si personne n’ose le dire ouvertement. Car cette ques-tion de secret rédactionnel, c’est un épisode de plus dans lalongue liste des relations tumultueuses qu’entretiennent lesjournalistes et les politiciens.
Je me permettrai de résumer ces relations comme suit: noussommes condamnés à vivre ensemble, mais chaque partierêve de posséder un moyen infaillible d’avoir le dernier mot.Tout politicien a invoqué au moins une fois le droit de ré-ponse pour comprendre aussitôt que le remède était pire quele mal; j’imagine que tout journaliste a aussi eu, au moins unefois, la surprise d’entendre le politicien qui lui avait clairementannoncé un scoop la veille déclarer le lendemain qu’il avaitété mal compris par un journaliste incompétent. Bref, c’estune histoire sans fin.En discutant de cette affaire de secret de rédaction, nous de-vons être attentifs au problème suivant: pensons-nous à l’in-térêt de l’Etat et de la collectivité en général ou bien voulons-nous régler des comptes avec la presse? Avec tout le respectque je dois à la majorité de la commission, j’incline à penserque sa proposition relève plutôt du règlement de compte.Car, soyons clairs, le Conseil fédéral et le Parlement, l’admi-nistration peut-être aussi, sont excédés par les «fuites» et ilsont imaginé qu’un bouchon constitutionnel pourrait colmaterle trou. C’est tout à fait disproportionné et, surtout, c’est inef-ficace. Pour qu’il y ait une fuite, il faut qu’il y ait un émetteuret qu’il y ait un récepteur. Lorsqu’on se demande à qui profitele crime – le mot est fort –, on peut se dire que cela rapporteun peu aux journalistes qui assurent un titre, mais cela rap-porte aussi, et parfois davantage, à certains politiciens, àleurs adversaires, aux fonctionnaires, bref à ceux qui livrentl’information. Il est bien sûr décevant de voir certains docu-ments tronqués, inexacts ou faux atterrir sur des bureaux derédaction, mais il est encore plus décevant de constater quecertains politiciens ont érigé la fuite, la rumeur, la demi-véritécomme méthode d’information. Ce sont d’ailleurs les mêmesqui se plaignent ensuite des fuites.A franchement parler, je serais intéressé à ce qu’on medonne un exemple réel d’une menace pour la stabilité del’Etat, due à une fuite journalistique, ces derniers temps. J’at-tends. Par contre, nous avons tous des exemples précis etréels de comportements d’information décevants qui, eux,ont occasionné des problèmes à notre Etat et à notre sys-tème politique. La démocratie ne sera que renforcée parl’existence d’une presse libre et indépendante. Qu’il y ait desaccrocs, c’est inévitable, qu’il y en ait eu passablement cesderniers temps, c’est vrai, mais cela ne doit pas nous con-duire à affaiblir la liberté de la presse. Le remède serait pireque le mal.J’aimerais réaffirmer que la formulation de la minorité neconstitue pas un blanc-seing pour la presse, mais qu’elle per-met une réelle pesée des intérêts, les intérêts de la presseétant incontestables, ceux de la collectivité ne l’étant pasmoins.Je vous recommande donc de soutenir la proposition de mi-norité.
Leuenberger Moritz, Bundesrat: Der Bundesrat kann sichder Zweiteilung dieser Problematik anschliessen, indem fürdie Medienfreiheit speziell ein Artikel geschaffen und diesedamit besonders herausgestrichen wird.Indessen ist Absatz 3 dieser neuen Bestimmung doch etwasgar restriktiv, indem nämlich das Grundprinzip, wonach dasRedaktionsgeheimnis gewährleistet ist, nicht mehr genanntwird; es wird nur noch gesagt, der Gesetzgeber bestimmeden Umfang des Redaktionsgeheimnisses, was immerhintheoretisch selbst ein Redaktionsgeheimnis im Umfange nullmit einschliessen könnte. Dem ist aber, wie Ihr Kommissions-sprecher gesagt hat, nicht so. Der Europäische Gerichtshoffür Menschenrechte hat schon entsprechend entschieden,und auch das Bundesgericht hat zweimal so entschieden.Es müsste mindestens zuhanden der Materialien festgehal-ten sein, dass es einen Grundsatz gibt, wonach das Redak-tionsgeheimnis gewährleistet ist, und dass danach der Ge-setzgeber, wie bei allen anderen Grundrechten auch, eineRelativierung und eine Präzisierung vornehmen kann.
Präsident: Ich stelle die beiden Konzepte einander gegen-über: Antrag der Mehrheit betreffend die Artikel 14 und 14aund Antrag der Minderheit nur zu Artikel 14.
20. Januar 1998 S 43 Bundesverfassung. Reform
Amtliches Bulletin der Bundesversammlung / Separatdruck
Abstimmung – VoteFür den Antrag der Mehrheit 33 StimmenFür den Antrag der Minderheit 5 Stimmen
Art. 14aAnträge der Kommissionen: BBlPropositions des commissions: FF
Angenommen gemäss Antrag der MehrheitAdopté selon la proposition de la majorité
Art. 15Anträge der Kommissionen: BBlPropositions des commissions: FF
Inderkum Hansheiri (C, UR), Berichterstatter: Bei Artikel 15ist vorweg darauf hinzuweisen, dass es hier lediglich – aberimmerhin – um den grundrechtlichen Aspekt der Sprachen-freiheit geht. Mit der Sprache haben wir uns bereits beiArtikel 3a befasst, und sie wird uns vor allem noch beiArtikel 83 beschäftigen.Was nun die Sprachenfreiheit als Grundrecht anbetrifft, so istsie im Jahre 1965 vom Bundesgericht als ungeschriebenesGrundrecht anerkannt worden. Sie garantiert nach derRechtsprechung des Bundesgerichtes den Gebrauch derMuttersprache. Darunter wird diejenige Sprache verstanden,in der man denkt und die man am besten beherrscht. DieMuttersprache ist somit nicht zwangsläufig die Sprache, wel-che man als erste erlernt hat.Wie jedes Grundrecht ist auch die Sprachenfreiheit Schran-ken unterworfen: Die wichtigste Schranke im Verhältnis zumStaat besteht in der Benützung einer Amtssprache des Bun-des, des Kantons, des Bezirks oder der betreffenden Ge-meinde.Die Ihnen vorgeschlagene Formulierung ist schlank und of-fen. Sie erlaubt es dem Bundesgericht, seine Rechtspre-chung den veränderten Verhältnissen anzupassen. In derKommission hat diese Bestimmung zu keinen weiteren Dis-kussionen Anlass gegeben.
Angenommen – Adopté
Art. 16Anträge der Kommissionen: BBlPropositions des commissions: FF
Inderkum Hansheiri (C, UR), Berichterstatter: Die Kunstfrei-heit wird vom Bundesgericht – das können Sie in der Bot-schaft nachlesen – nicht als ungeschriebenes Grundrechtanerkannt. Sie ist aber durch Artikel 15 Absatz 3 des Uno-Paktes I sowie durch Artikel 19 Absatz 2 des Uno-Paktes IIabgedeckt. Die dritte Rechtsquelle findet sich in Artikel 10der EMRK.In der Kommission hat diese Bestimmung ebenfalls nicht An-lass zu Diskussionen gegeben. Der vorberatenden Kommis-sion hat sich – wenn ich noch darauf hinweisen darf – dieFrage gestellt, ob nur von der Freiheit der Kunst oder auchvon der Freiheit des künstlerischen Ausdrucks gesprochenwerden solle. Die Freiheit des künstlerischen Ausdrucks istnatürlich vom Grundrecht mit erfasst. Wenn wir die Freiheitdes künstlerischen Ausdrucks aber ausdrücklich auf Verfas-sungsstufe erwähnen würden, kämen wir automatisch in eineDiskussion über die Frage, was Kunst ist, hinein. Das wolltenwir vermeiden.
Angenommen – Adopté
Art. 17Anträge der Kommissionen: BBlPropositions des commissions: FF
Inderkum Hansheiri (C, UR), Berichterstatter: Hier kann ichmich ebenfalls kurz fassen. Auch hier hat sich der vorbera-tenden Kommission – nicht der Plenarkommission, sondernder vorberatenden Subkommission – eine ähnliche Frage ge-
stellt wie bei der Kunstfreiheit, nämlich die, ob auch die Un-errichtsfreiheit in diese Verfassungsbestimmung aufzuneh-men sei. Angesichts der sehr kontroversen Ergebnisse imVernehmlassungsverfahren hat die Kommission darauf ver-zichtet und beantragt Ihnen, bei der Formulierung des Bun-desrates, die im übrigen unbestritten ist, zu bleiben.
Angenommen – Adopté
Art. 18Anträge der Kommissionen: BBlPropositions des commissions: FF
Inderkum Hansheiri (C, UR), Berichterstatter: Die Versamm-lungsfreiheit ist unbestrittenermassen ein ungeschriebenesVerfassungsrecht und als solches im Sinne eines unerlässli-chen Elementes zur Ausübung der politischen Rechte durchdas Bundesgericht anerkannt. Zudem ist sie auch völker-rechtlich durch Artikel 11 EMRK und Artikel 21 Uno-Pakt IIabgestützt.Bei dieser Bestimmung könnte man sich allenfalls fragen, obAbsatz 3 erforderlich sei. Im Interesse der Klarheit befürwor-ten wir dies. Im übrigen ist aber ebenso klar, dass eine Bewil-ligungspflicht selbstverständlich nur für solche Versammlun-gen besteht, bei welchen in rechtlicher Hinsicht ein gesteiger-ter Gemeingebrauch vorliegt.
Angenommen – Adopté
Art. 19Anträge der Kommissionen: BBlPropositions des commissions: FF
Inderkum Hansheiri (C, UR), Berichterstatter: Hier kann ichmich ganz kurz fassen. Wir befinden uns unbestrittenermas-sen bei der Nachführung. Ich habe keine Bemerkungen, zu-mal auch diese Bestimmung in der Kommission diskussions-los akzeptiert wurde.
Angenommen – Adopté
Art. 20Anträge der Kommissionen: BBlPropositions des commissions: FF
Marty Dick (R, TI), rapporteur: L’article 20 reprend substan-tiellement l’article 45 alinéa 1er de la constitution actuelleavec quelques précisions en plus. Cette disposition garantità tout Suisse le droit de s’établir en un lieu quelconque dupays. Cela implique que les cantons et les communes nesauraient s’opposer à l’établissement d’un Suisse sur leurterritoire, qu’ils ne sauraient empêcher ou rendre plus difficilele départ de ce même Suisse qui entendrait s’établir ailleurset, surtout, cela implique l’interdiction de renvoyer les indi-gents dans leur canton d’origine. Les restrictions qui sontpossibles sont celles, en particulier, liées à l’obligation de ré-sidence des fonctionnaires. Cela est précisé par une jurispru-dence du Tribunal fédéral.L’article parle des «Suisses», ce qui implique que cette li-berté ne s’applique pas aux étrangers. Il existe néanmoins undroit limité d’établissement pour les étrangers, et cela dans lamesure où ils disposent d’un statut qui se fonde sur des dis-positions de la police des étrangers.Il y a, à l’alinéa 2, une divergence avec le projet du Conseilfédéral. Le projet dit: «Les Suisses ont le droit de quitter laSuisse et d’y revenir.» Nous proposons de substituer «reve-nir» par «d’entrer en Suisse». Cela vise en particulier le casdes Suisses qui naissent à l’étranger et qui ont le droit d’en-trer en Suisse. Si on dit «revenir», ça implique partir. Or, il ya des Suisses qui naissent à l’étranger et qui ont le droit d’en-trer en Suisse en tout temps.
Angenommen – Adopté
Constitution fédérale. Réforme 44 E 20 janvier 1998
Bulletin officiel de l’Assemblée fédérale / Tiré à part
Art. 21Anträge der Kommissionen: BBlPropositions des commissions: FF
Marty Dick (R, TI), rapporteur: Nous sommes ici égalementen plein dans la mise à jour. Il s’agit de la protection contrel’expulsion, l’extradition et le refoulement. Cette dispositionn’a soulevé aucune discussion de principe. On maintient évi-demment la règle de l’interdiction de l’expulsion d’un citoyensuisse, de même l’interdiction de l’extradition d’un Suissevers un Etat étranger dans la mesure où l’intéressé n’y con-sent pas.Quant aux étrangers, il y a une interdiction ou des restrictionspour les réfugiés qui ne peuvent pas être refoulés vers unEtat dans lequel ils sont persécutés. Ils ne peuvent pas nonplus être refoulés vers un Etat où ils risquent d’être torturésou de subir des traitements ou des peines cruels et inhu-mains. Ces principes sont depuis longtemps codifiés dansdes accords internationaux qui ont été souscrits par laSuisse.L’article 21 a été adopté, à l’unanimité, par la commission.
Schmid Carlo (C, AI): Ich habe eine Frage, welche dieSeite 171 unten der Botschaft deutscher Sprache betrifft: Esgeht um das Auslieferungsverbot von Schweizern. Die Bot-schaft nimmt hier Bezug auf den Artikel 10 des Bundesbe-schlusses vom 21. Dezember 1995 über die Zusammenar-beit mit den internationalen Gerichten zur Verfolgung vonschwerwiegenden Verletzungen des humanitären Völker-rechtes. Ich glaube, alle im Saal waren dabei, als wir das be-schlossen haben. Es ist mir völlig klar: Grundrechte könnenmit formellem Gesetz eingeschränkt werden; daher geht dasin Ordnung. Wie ich mich aber entsinne, ist seinerzeit argu-mentiert worden, es handle sich hier gar nicht um eine Aus-lieferung, sondern um eine andere Form der Herausgabe ei-nes Schweizers. Ich stelle fest, dass wir seinerzeit einmalmehr nicht ganz korrekt informiert worden sind.
Angenommen – Adopté
Art. 22Anträge der Kommissionen: BBlPropositions des commissions: FF
Marty Dick (R, TI), rapporteur: Article 22 «Garantie de la pro-priété»: matériellement, cette disposition correspond à l’ac-tuel article 22ter de la constitution. On renonce toutefois à re-prendre l’alinéa 2, qui concerne la restriction du droit à la pro-priété, car, dans le projet, l’article 32 prévoit d’une façongénérale les règles pour la restriction des droits fondamen-taux.La seule véritable discussion que nous avons eue en com-mission se rapporte au principe de l’indemnité en cas d’ex-propriation ou en cas de restriction de la propriété. Nousavons dans le droit actuel une divergence évidente entre laversion allemande et italienne, d’une part, et la version fran-çaise, d’autre part: en allemand et en italien, on parle de«volle Entschädigung»/«piena indennità», alors que le fran-çais parle de «juste indemnité». C’est une divergence mani-feste. La doctrine et la jurisprudence ont affirmé à plusieursreprises que ce sont bien les versions allemande et italiennequi sont correctes: elles expriment le principe de l’«Eigen-tumsgarantie als Wertgarantie». Le texte français est en réa-lité une traduction incorrecte. Dans la mesure où cette ver-sion est reprise, comme elle l’est dans la proposition de mi-norité, on va au-delà d’une mise à jour, et on veut modifier lesrègles actuelles qui sont à la base de la garantie de la pro-priété.Je vous invite dès lors à vous rallier au projet du Conseil fé-déral et à voter la proposition de la majorité de la commis-sion.
Aeby Pierre (S, FR): M. Marty vient de l’expliquer: la pro-priété aujourd’hui, en tout cas visuellement, est beaucoupmieux protégée dans le projet rédigé par le Conseil fédéral
que dans l’actuelle constitution. Dans cette dernière, on parleà l’article 22ter alinéa 2 de la compétence des cantons et dela Confédération en matière d’expropriation. Aujourd’hui,comme telles, on ne trouve plus ces possibilités, elles sontreléguées à l’article 32 où on a, de façon assez générale, desprincipes concernant la limitation des droits fondamentaux.C’est un droit fondamental qui concerne une minorité, voireune petite minorité, de Suisses. Il me semble que l’expres-sion «équitable» – qu’est-ce qu’il y a de mieux que ce qui estéquitable? – correspond à ce que nous souhaitons en ma-tière d’expropriation.Pour ceux qui connaissent la pratique, notamment en ma-tière autoroutière, on peut dire que la notion de «pleine in-demnité» a conduit à certains abus qui ne sont pas étrangersaux coûts très importants que nous connaissons dans laconstruction de nos infrastructures, en particulier de nos rou-tes. Une «indemnité équitable» permet au propriétaire qui su-bit une expropriation formelle ou matérielle de retrouver,quant à son statut patrimonial, la même situation qu’il avaitauparavant. Il est très clair qu’aujourd’hui, la notion de«pleine indemnité» conduit en Suisse dans une très grandemajorité de cas à l’enrichissement de l’exproprié. Ça, c’estune particularité de notre pays qui doit disparaître. Nous de-vons avoir le courage d’y mettre fin dans le cadre d’un exer-cice de mise à jour de la constitution.C’est la raison de la proposition de minorité qui prévoit «in-demnité équitable» à la place de «pleine indemnité».
Büttiker Rolf (R, SO): Nach dem Votum von Herrn Aebymuss man, glaube ich, zu Artikel 22 schon noch etwas sa-gen. Wie Herr Marty Dick gesagt hat: Gemäss der bisherigenLösung in Artikel 22ter Absatz 3 der geltenden Verfassung istvolle Entschädigung zu leisten, und das wird mit dem Antragder Minderheit Aeby ausgehöhlt. Das wäre ein entscheiden-der Wechsel in der Praxis und hätte mit Nachführung nichtsmehr zu tun. Der Wechsel und die Auswirkungen wären grös-ser, als man gemeinhin annimmt.Mit dem Wort «angemessen» würde natürlich gerade in die-sem wichtigen Bereich für viele Bürgerinnen und Bürger Un-klarheit einkehren. Wie sollen die Gerichte entscheiden? Indiesem Bereich gibt es sehr viele Gerichtsentscheide. Daskann ich Ihnen als amtierender Gemeindepräsident sagen,und damit komme ich bereits zur Praxis.Es geht in diesen Fällen vor allem um Strassenbau oder an-dere Dinge, die meist für viele mit Emissionen verbundensind. Nach dem Antrag der Minderheit Aeby müssten dieseBürgerinnen und Bürger neben diesen Nachteilen noch inKauf nehmen, dass ihnen das Land enteignet würde unddass sie dafür nicht voll entschädigt würden.Das kann so nicht akzeptiert werden. In einem liberalen Ver-ständnis spielt das Eigentum grundsätzlich eine zentraleRolle, und der Antrag der Minderheit Aeby ist mindestens einkleiner Anschlag auf das Eigentum.Aus all diesen Gründen möchte ich Ihnen beliebt machen,den Antrag der Minderheit Aeby abzulehnen.
Marty Dick (R, TI), rapporteur: J’aimerais vous rappelerqu’une proposition tout à fait analogue a été repoussée en1968 par le Conseil national. Ce qui démontre que, si nousadoptions la proposition de minorité, nous irions clairement etmanifestement au-delà des limites qu’impose une mise àjour.
Leuenberger Moritz, Bundesrat: Der Bundesrat bittet Sie, anseiner Version festzuhalten. Heute gibt es eine volle Ent-schädigung – ungeachtet des französischen Textes, der al-lenfalls eine andere Interpretation erlauben könnte. Die Be-richte stützen sich auf die deutsche und italienische Version.Würde nur noch eine «angemessene» Entschädigung ge-schuldet, ginge dies über die Nachführung der Bundesver-fassung hinaus. Das wäre eine materiell gravierende Ände-rung im Vergleich zur heutigen Rechtslage.Deswegen ersuchen wir Sie, dem Antrag der Mehrheit zuzu-stimmen.
20. Januar 1998 S 45 Bundesverfassung. Reform
Amtliches Bulletin der Bundesversammlung / Separatdruck
Abstimmung – VoteFür den Antrag der Mehrheit 34 StimmenFür den Antrag der Minderheit 5 Stimmen
Art. 23Anträge der Kommissionen: BBlPropositions des commissions: FF
Marty Dick (R, TI), rapporteur: La liberté économique: nousparlons aujourd’hui, en fait, de la liberté du commerce et del’industrie, principe consacré à l’article 31 de la constitutionactuelle. Le Tribunal fédéral a, avec le temps, élargi cette no-tion. Il ne s’agit, aujourd’hui déjà, pas seulement du com-merce et de l’industrie, mais de toute activité économique lu-crative privée. Le projet, dans ce nouvel article 23, entendconsacrer la liberté économique en tant que droit fondamen-tal, en tant que droit individuel. Cette précision est importanteafin d’éviter toute confusion: la liberté économique est com-prise ici comme droit de l’individu d’exercer une activité lucra-tive.L’article 23 n’entend donc pas définir l’ordre économiquedans notre pays. Cela est réglé aux articles 85 et suivants.La liberté économique dont on parle à l’article 85 est de na-ture institutionnelle et ne peut être restreinte que par uneautre disposition constitutionnelle. La liberté économiquedont nous traitons maintenant à l’article 23, c’est-à-dire laliberté individuelle d’exercer une activité économique, peutêtre restreinte comme tous les autres droits fondamentaux,c’est-à-dire conformément aux règles de l’article 32 du projetde constitution, que nous allons examiner tout à l’heure.Cela implique une base légale, une restriction justifiée par unintérêt public, et cela exige aussi que soit respecté le prin-cipe de la proportionnalité, étant entendu que l’essencemême du droit fondamental reste inviolable.La liberté économique comme droit fondamental est recon-nue également aux étrangers au bénéfice d’un permis d’éta-blissement. Le Tribunal fédéral a encore tout récemment re-fusé en revanche de reconnaître la liberté du commerce et del’industrie aux étrangers au bénéfice seulement d’un permisde séjour. Comme elle est formulée, la disposition permet undéveloppement ultérieur de la jurisprudence, par exemplel’éventuelle extension à notre pays du principe de la libre cir-culation.La commission a approuvé l’article 23 à l’unanimité.
Angenommen – Adopté
Art. 24Anträge der Kommissionen: BBlPropositions des commissions: FF
Cottier Anton (C, FR), rapporteur: La question à laquellenous devons répondre à l’article 24, c’est de savoir si un droitfondamental de grève répond aux critères de la mise à jourde la constitution.Il semble que cette mise à jour a été définie hier par le Con-seil fédéral et le président de la commission. Elle a pour butd’inscrire les normes, le droit jurisprudentiel, le droit coutu-mier et l’acquis suisse dans la nouvelle constitution.Est-ce que le droit fondamental de grève respecte ces critè-res? Ceux qui répondent par l’affirmative invoquent pour jus-tifier leur thèse deux conventions internationales auxquellesla Suisse a adhéré. Il s’agit de la convention OIT No 87, quiest de l’Organisation internationale du travail, et du PacteONU I.La majorité de la commission, en revanche, défend l’aviscontraire. Avec une voix d’écart, la commission a décidé debiffer le droit de grève aux alinéas 3 et 4.Qu’en est-il de la justification du droit de grève tiré de cesconventions? C’est un fait que la Suisse a souscrit et a ad-héré aux deux conventions. Mais, pour la majorité de la com-mission, l’ordre juridique national, l’acquis suisse en somme,s’oppose à un droit de grève. La plupart des cantons et laConfédération interdisent la grève aux employés de la fonc-tion publique. Je vous cite l’article 23 alinéa 1er de la loi fé-
dérale sur le statut des fonctionnaires qui dit ceci: «Il est in-terdit au fonctionnaire de se mettre en grève et d’y inciterd’autres fonctionnaires.» Il va de soi que ce droit fondamentalde grève s’appliquerait aussi bien aux employés du secteurprivé que du secteur public. La législation actuelle est doncsans équivoque: elle interdit la grève à la fonction publique.Une mise à jour devrait respecter la législation en vigueur.Est-ce que deux conventions internationales permettent depasser par-dessus de nombreuses lois cantonales et fédéra-les interdisant la grève au personnel de la fonction publique?La portée juridique de ces deux conventions est telle que cesdernières ne sont pas applicables directement. Elles sontdonc «no self executing». Lors de la ratification de la conven-tion de l’OIT par la Suisse, on ne parlait pas de droit de grève.La convention prévoyait la liberté syndicale. Plus tard, aprèsla ratification suisse, une commission internationale d’ex-perts a donné une nouvelle interprétation de la notion de li-berté syndicale et, selon cette commission, la liberté syndi-cale comprendrait aussi un droit fondamental de grève pourles secteurs privés et publics. Pour nous, cette commissionpeut, certes, émettre un avis, mais elle ne lie pas notre pays.Lorsqu’en 1991, le Conseil fédéral a proposé aux Chambresfédérales la ratification de la seconde convention, celle duPacte ONU I, il a déclaré que l’interdiction de la grève pres-crite à l’article 23 de la loi fédérale sur le statut des fonction-naires était maintenue. Cette disposition s’opposerait au droitde grève énoncé dans cette convention. Le droit national pri-merait cette convention. Ce fut en 1991, lors de la ratificationdu Pacte ONU I.Cinq ans après, avec le nouveau projet de constitution, onchange le fusil d’épaule. Or, d’un point de vue juridique, noussommes avec notre législation, avec notre acquis suisse, loind’un droit fondamental de grève à inscrire dans la constitutionpar le moyen de la simple mise à jour. J’admets que le seuléclairage juridique ne suffit pas. Il faut une appréciation poli-tique aussi.Depuis plus de cinquante ans, la politique de notre payss’inspire du partenariat social. Il s’illustre, à quelques excep-tions près qui confirment la règle, par une absence de grèveet encore par la paix sociale. J’admets que le phénomène dela globalisation met le partenariat social à rude épreuve, maisla réponse ne saurait être la création d’un droit fondamentalde grève. Introduire un droit fondamental de grève, notam-ment aussi pour la fonction publique – c’est principalementde cela qu’il s’agit –, c’est abandonner l’acquis suisse, la cul-ture du partenariat social qui a prévalu depuis la conventionqui a consacré la paix du travail. Hier, lors de l’entrée en ma-tière, l’un des intervenants a déclaré – je crois qu’il s’agissaitde M. Iten – que nos concitoyennes et nos concitoyensavaient d’autres soucis que l’étude d’une nouvelle constitu-tion, et qu’ils étaient préoccupés par le chômage. Certaine-ment, et il avait raison: le peuple est plus préoccupé par letravail, par l’emploi que par la création d’un droit fondamentalde grève.Pour ces raisons, au nom de la majorité de la commission, jevous invite à biffer les alinéas 3 et 4.
Marty Dick (R, TI): C’est vrai, le Tribunal fédéral ne reconnaîtpas le droit de grève comme droit fondamental. A dire vrai, ilne soutient même pas le contraire, parce que jusqu’à présentil a réussi à éviter de répondre à cette question. Donc, le Tri-bunal fédéral ne se prononce en fait pas sur la nature de droitfondamental du droit de grève. Par contre, la majeure partiede la doctrine juridique suisse reconnaît ce caractère de droitfondamental, et vous trouvez dans cette doctrine toute unesérie de professeurs qui ne sauraient être taxés ni de subver-sifs, ni de gauchistes.Si l’instrument de la grève ne fait pas – et je dis heureuse-ment – partie de nos habitudes, il n’en demeure pas moinsque nul ne saurait, aujourd’hui, affirmer qu’il n’existe pas undroit de grève. La discussion aujourd’hui est de savoir si cedroit doit être reconnu au niveau de la constitution. Et si jeparle de droit de grève, je parle et nous parlons aussi du droitde lock-out qui en est le pendant. Or, ce droit est prévu dansdes traités internationaux très précis auxquels la Suisse a
Constitution fédérale. Réforme 46 E 20 janvier 1998
Bulletin officiel de l’Assemblée fédérale / Tiré à part
souscrit et qu’elle s’est engagée à respecter. Ça, c’est pourl’aspect juridique.Comme le rapporteur l’a bien dit, il y a une dimension politi-que qu’on ne saurait ignorer. Je dois avouer que j’ai eu moi-même de la peine à faire ce pas de reconnaissance du droitde grève dans la constitution, parce que je le ressens moi-même comme étranger à nos habitudes et nos coutumes, ànotre culture de dialogue. Mais cette raison n’est pas encoresuffisante, et, au fil des discussions, des débats que nousavons eus au sein de la commission, je me suis persuadéqu’il fallait faire un pas. Et ce pas, nous devons le faire toutd’abord pour éviter une confrontation qui me paraît inutile etqui risque de mettre en danger tout l’édifice de cet exercice.A l’article 24, la formulation de la proposition de la mino-rité I, que je représente – minorité pour 1 voix dans la com-mission –, est une bonne formulation de compromis. Jecrois même qu’elle a l’avantage de mettre des garde-foustrès précis pour un développement ultérieur de la jurispru-dence du Tribunal fédéral. Je suis même persuadé que sinous n’inscrivons rien dans la constitution, le Tribunal fédé-ral risquerait d’avoir une plus grande liberté pour dévelop-per le droit de grève comme droit constitutionnel non écrit.Avec cette version, nous fixons des limites très précises. Jecrois que ce texte est «konsensfähig», évite une confronta-tion.J’aimerais dire une dernière chose qui n’est pas juridique,mais qui a une valeur politique et psychologique. Aujourd’hui,alors que des milliers de personnes sont licenciées, perdentleur travail après des décennies de travail au nom de la li-berté économique, au nom de la restructuration des entrepri-ses, refuser purement et simplement la mention du droit degrève dans une mise à jour de la constitution sonne un peucomme une provocation. En adoptant une version commevous la propose la minorité I, nous faisons un acte, je ne dispas de conciliation, mais un acte d’équilibre dans une situa-tion qui, aujourd’hui, est nettement défavorable aux tra-vailleurs.Je vous invite, par conséquent, à adopter la proposition de laminorité I.
Gentil Pierre-Alain (S, JU): Mes deux préopinants ont suffi-samment insisté sur le fait que la dimension juridique de cettediscussion n’était pas l’élément le plus déterminant pour mepermettre de me concentrer sur des éléments de réflexionpolitique.M. Cottier l’a dit dans son argumentation: la grève est, de ma-nière objective, un élément relativement étranger à noscoutumes et à notre culture des relations de travail. C’est toutà fait clair et il y a d’abondantes statistiques pour le démon-trer.Le Conseil fédéral, dont la témérité n’est pas le défaut le plusconnu, a donc pris un certain nombre de précautions pourque le droit de grève, qui est reconnu dans sa version, soitdécrit en conformité avec ces coutumes et cette culture. Ona donc un droit de grève qui est très sérieusement corseté etqui est lié à toute une série de conditions formulées de ma-nière explicite.1. La grève «sauvage» est exclue. Une grève, au sens duprojet du Conseil fédéral, ne se conçoit qu’organisée par uneassociation syndicale et donc, comme telle, liée à la libertéd’association.2. La grève doit se rapporter aux relations de travail. Ceci estmentionné également explicitement. La grève «politique» vi-sant à faire pression sur les autorités est donc exclue.3. La grève ne doit pas violer une obligation conventionnelle,notamment l’obligation de maintenir la paix du travail. Il fautauparavant épuiser la discussion en recourant aux instancesarbitrales, voire aux tribunaux. 4. Enfin, la loi peut interdire ledroit de grève à certaines catégories de personnes pour as-surer un service minimum. La perspective de la grève de cer-tains fonctionnaires, des hôpitaux, des pompiers, à laquelleM. Cottier a fait allusion, est donc tout à fait exclue.On a donc une formulation du droit de grève qui est fort pru-dente, qui contient toute une série de cautèles et qui excluttout exercice politique de cette liberté.
En écoutant M. Cottier, je me demandais donc si nous par-lions de la même chose. J’entendais M. Cottier parler de lagrève au sens où elle est pratiquée dans certains Etats voi-sins comme un instrument politique. La formulation du Con-seil fédéral est claire: elle exclut tout à fait un tel type degrève. Elle s’inscrit parfaitement dans les habitudes de négo-ciation qu’ont les partenaires sociaux dans notre pays et ellemérite comme telle de figurer dans le texte de la constitution.C’est la raison pour laquelle je vous propose d’approuver leprojet du Conseil fédéral repris par la minorité II.
Forster Erika (R, SG): Ich habe mich in der Kommission da-für ausgesprochen, Artikel 24 Absätze 3 und 4 zu streichenund somit in der nachgeführten Verfassung Streik und Aus-sperrung nicht zu erwähnen.Es ist während der vergangenen Stunden immer wieder be-tont worden, wie heikel das Konzept der Nachführung sei.Wo sollen Reformen von begrenzter Tragweite einfliessen,wo nicht? Wir haben uns in der Kommission bei derartigenFragen immer wieder auf den Standpunkt gestellt, dass Re-formen, wenn sie auf breitesten Konsens zählen können, indie Nachführung einfliessen können. Diese letzte Anforde-rung ist im Zusammenhang mit dem Streikrecht meines Er-achtens nicht gegeben.Es muss verhindert werden, dass just in einem Moment, indem das Instrument des Arbeitskampfes in Europa wiedervermehrt eingesetzt zu werden droht, das Thema im Rahmenunserer Verfassungsrevision so sehr in den Vordergrund ge-stellt wird, dass dem Revisionswerk überall dort Oppositionerwächst, wo eine explizite Regelung des Streikrechtes aufVerfassungsstufe auf Widerstand stösst.Wir waren uns in der Kommission einig, dass der Formulie-rung der Minderheit zwar nicht die Funktion eines Grundrech-tes zukommt. Wir wissen auch, dass das Bundesgericht bisheute nie ein Grundrecht auf Streik und Aussperrung aner-kannt hat. Andererseits gewährt die herrschende Lehreheute eindeutig ein solches Recht, aber eben kein Grund-recht.In dieser für mich verwirrlichen Situation scheint es mir bes-ser, auf eine Aufnahme des Streikrechtes in die Verfassungzu verzichten und es beim Status quo zu belassen. Dieserschliesst das Recht auf Streik und Aussperrung, wie gesagt,nicht aus. Es ändert sich also am jetzigen Zustand nichts,während die Aufnahme einer entsprechenden Bestimmungeinen durch die Rechtsprechung noch nicht geklärten Zu-stand für mich gewissermassen vorauseilend klären würde,und das geht über die Nachführung hinaus.Unsere Bürgerinnen und Bürger sind zweifelsohne auf dieWorte «Streik» und «Aussperrung» sensibilisiert, wissen siedoch nur zu gut, dass unsere Kultur der Sozialpartnerschaftmehr Wohlstand gebracht hat als die Streikkultur unserenNachbarländer. Darauf sollten und können wir stolz sein.Eine Aufnahme von Streik in irgendeiner Form in die Verfas-sung erfordert zwingend ein nachfolgendes Gesetzgebungs-verfahren, was zu jahrelanger Thematisierung der Streikpro-blematik führen würde. Ich befürchte, vermutlich mit vielenanderen besorgten Schweizerinnen und Schweizern, dassdamit indirekt mit einer Werthaltung gebrochen wird, die unsim Grunde genommen allen lieb ist, egal, welchem politi-schen Lager wir angehören.In diesem Zusammenhang möchte ich noch etwas bemer-ken, nämlich dass die Schweizer Regelung, den Streik nichtausdrücklich als Grundrecht zu erwähnen, auch Ausdruckunseres Demokratieverständnisses ist. Im Unterschied zuRegelungen in repräsentativen Demokratien, wo der Streikauch zu politischen Zwecken eingesetzt wird, haben wir dieMöglichkeit, auf allen Ebenen des Arbeitsrechtes und der Re-gelung der Arbeitgeber- und Arbeitnehmerbeziehungen nichtnur zu legiferieren, sondern auch mit demokratischen Mittelnlaufend präventiv oder korrigierend Einfluss zu nehmen. DasStreikrecht als Invdividualrecht erhält somit bei uns aufgrundder demokratischen Strukturen eine Relativierung, welcheauch im Zusammenhang mit der Nachführung beachtet wer-den sollte.
20. Januar 1998 S 47 Bundesverfassung. Reform
Amtliches Bulletin der Bundesversammlung / Separatdruck
Aus all diesen Gründen bitte ich Sie, der Kommissionsmehr-heit zu folgen und die beiden Absätze 3 und 4 zu streichen.Das ändert am heutigen Zustand nichts, verhindert aber un-nötige Konflikte im Gesamtzusammenhang.
Reimann Maximilian (V, AG): Nur eine kurze Wortmeldungzu diesem wichtigen Artikel, in der Absicht, Ihnen aufzuzei-gen, wie schwer sich ein bürgerlicher Parlamentarier im Ver-laufe unserer Kommissionsarbeit mit dem Streikrecht getanhat.Ich hatte in der ersten Lesung der Version des Bundesrateszugestimmt, und zwar aus dem Hauptgrund heraus, dass all-fällig streikwilligen Kreisen in unserem Land expressis verbisvor Augen geführt werden solle, dass Streiken keine Ein-bahnstrasse sei, sondern dass dem Streik auch die Aussper-rung entgegengestellt werden müsse. Die Aussperrung istein harter Eingriff in den sozialen Frieden und trifft vor allemjene Arbeitnehmer, die an sich nicht gewillt sind, zum Kampf-mittel des Streiks zu greifen.Aber so ganz wohl war es mir mit meiner ursprünglichen Mei-nung in dieser wichtigen sozialpartnerschaftlichen Fragenicht; ich schwenkte dann im Zuge der zweiten Lesung zu je-nem Lager über, das weder den Streik noch die Aussperrungverfassungsmässig verankert haben möchte, sei es aus-drücklich als solches Recht oder indirekt in der Version derMinderheit I. Das soll nicht heissen, dass man vor den Begrif-fen «Streik» und «Aussperrung» den Kopf in den Sand stek-ken würde. Diese arbeitsrechtlichen Kampfmassnahmensind nun einmal existent, glücklicherweise bei uns in derSchweiz kaum, aber in anderen Ländern um so mehr.Niemand wünscht den Streik, niemand wünscht die Aussper-rung. Im Zuge der Kommissionsarbeit habe ich mich dannüberzeugen lassen, dass Streik und Aussperrung bis anhinkein ungeschriebenes Verfassungsrecht darstellten. FrauForster hat uns das eben nochmals klar und deutlich in Erin-nerung gerufen. Dabei, so meine ich, soll es bleiben.Deshalb bitte ich Sie, der Mehrheit zuzustimmen.
Frick Bruno (C, SZ): Es scheint mir fast, als ob die Debatteauf den Satz reduziert werden könnte: Wer Streik ablehnt,streicht ihn aus der Verfassung. Aber so einfach geht esnicht!Die Frage lautet für uns in der Tat: Besteht heute ein verfas-sungsmässiges Recht – wenn auch ein eingeschränktes –,Streik auszuüben? Darin sind sich alle, die darüber geschrie-ben haben – Rechtsgelehrte, Gelehrte in Sachen Politik – ei-nig: Es besteht. Allerdings ist einzuräumen, dass sich dasBundesgericht über das Streikrecht privatrechtlich Angestell-ter noch nicht zu äussern hatte. Es hat sich aber über dasStreikrecht der Beamten geäussert und dieses klar abge-lehnt. Das tut auch die Verfassung; sie beschränkt das Streik-recht von Beamten im Rahmen des Gesetzes.Da nun aber im Kern ein Streikrecht besteht, würden wir hin-ter das heute gültige Verfassungsrecht zurückgehen und dieVerfassung materiell ändern, wenn wir es streichen würden –und das dürfen wir nicht. Die Fassung der Minderheit I unddes Bundesrates schränkt ja das Streikrecht auf seinen heu-tigen Gehalt ein; nur unter restriktiven Voraussetzungen darfgestreikt werden: Nur wenn es die Arbeitsbeziehungen be-trifft und dem keine anderen Friedenspflichten entgegenste-hen.Ich möchte auch der Argumentation von Frau Forster wider-sprechen, die sagt, es widerspreche unserer Demokratie undwir hätten andere Möglichkeiten, uns zu äussern. DiesesStreikrecht widerspricht unserer Auffassung – und auch der-jenigen, die Sie vertreten, Frau Forster – nicht: Ein Streik istnur dann gerechtfertigt, wenn er Arbeitsverhältnisse betrifft.Also haben sogenannt politische Streiks – Solidaritätsstreiks,Frauenstreiks und anders motivierte – in der Schweiz auchkünftig nichts zu suchen. Das gilt es klar zu sagen.Unser Demokratieverständnis verlangt vielmehr, dass dieSozialpartner auch harte Mittel benützen dürfen, wenn insehr schwierigen Auseinandersetzungen zwischen Arbeit-nehmern und Arbeitgebern kein anderes Mittel mehr möglichist. Das gehört auch zur politischen Auseinandersetzung. Die
Verfassung gibt dem Arbeitgeber das Recht auszusperren,dem Arbeitnehmer – unter den gleichen restriktiven Bedin-gungen – das Recht zu streiken. Daher darf sich, auch werden Arbeitsfrieden erhalten will, Streiks grundsätzlich ablehntund sie nicht wünscht, nicht davor verschliessen, dass einbeschränktes Streikrecht bereits heute auf Verfassungsstufebesteht – als ungeschriebenes Recht, zugegeben, aber esbesteht unbestritten.Ich habe bis heute in der Kommission und im Rat eineStimme vermisst: Diejenige, die mir einen namhaften Kennerdieser Materie zitieren kann, der das Streikrecht in diesembeschränkten Kerngehalt ablehnt. Ich glaube, ich werde sieauch künftig nicht hören.
Cottier Anton (C, FR), Berichterstatter: Ich möchte nur etwasrichtigstellen und Herrn Frick antworten. Wir gehen mit derFassung der Mehrheit natürlich nicht hinter die heutige ver-fassungsmässige Situation zurück, sondern wir bekräftigensie, wie sie heute ist, wie sie namentlich in den Gesetzen derKantone und des Bundes für die Beamtenschaft besteht, undwie sie das Bundesgericht bestätigt hat. Auch beim Streik-recht bestehen bei den Professoren verschiedene Meinun-gen. Professor Schindler zum Beispiel hat eine andere Mei-nung dargelegt, als Sie es heute tun. Deshalb vertritt dieMehrheit der Kommission diese Meinung hier.
Danioth Hans (C, UR): Ich habe mich im Vorfeld der Bera-tung mit dieser Frage ebenfalls befasst. Ich meine, es wäreeine Illusion zu glauben, dass wir das Problem lösen, wennwir nichts sagen; Herr Kollege Frick hat mit Recht darauf hin-gewiesen.Ich möchte in Ergänzung zu seinen Ausführungen ganz klarauf einen Bundesgerichtsentscheid hinweisen, der der Inter-pretation von Frau Forster widerspricht. Das Bundesgerichtsagt im Entscheid 111 II 253 folgendes, mit einem Satz: DasBundesgericht hat die Frage nach der Grundrechtsqualitätdes Streikrechtes bisher zwar offengelassen – es hat es nichtnicht anerkannt, sondern offengelassen –, es lehnt indessendie Rechtsmeinung, wonach das Streikrecht noch keinenEingang in das schweizerische Arbeitsrecht gefunden habe,als «offensichtlich zu absolut und zu summarisch» ausdrück-lich ab.Hier müssen wir natürlich auch das internationale Recht se-hen. Der Bundesrat hat es ja einbezogen. Ich verweise aufArtikel 11 der EMRK, auf Artikel 8 des Internationalen Paktesüber wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte und aufArtikel 3 des ILO-Übereinkommens Nr. 87. Diese schliessendas Streikrecht natürlich nicht aus.Zur Argumentation von Kollege Marty: Wenn wir nichts sa-gen, dann öffnen wir der bundesgerichtlichen Rechtsfortent-wicklung, wie sie ja umschrieben wird, doch ein breites Betä-tigungsfeld. Oder anders gesagt: Wenn wir uns hier klar aufeine eindeutig schweizerische Fassung des Streikrechtes,das nicht politisch motiviert werden darf, beschränken, habenwir auch eine bessere Gewähr dafür, dass in Zukunft unserenAbsichten entsprochen wird.Von daher gesehen stehe ich mit Überzeugung für die Auf-fassung der Minderheit I ein, die hier klar einen Damm gegenausufernde Interpretationen errichtet.
Brunner Christiane (S, GE): Je pense que je dois me consi-dérer, conformément à la définition donnée par M. Reimann,dans les «Streikwilligen in diesem Lande». Mais vouloir ins-crire le droit de grève dans la Constitution fédérale n’a rien àvoir avec la volonté ou l’absence de volonté de prendre desmesures de lutte. Contrairement à ce que dit un représentantéminent de l’Union centrale des associations patronales, sion parle du droit de grève, on ne veut pas nécessairement lemettre en pratique. Le fait d’en parler en règle générale, aucontraire, fait qu’on a de bonnes raisons de ne pas le mettreen pratique. Je ne comprends pas le raisonnement de la ma-jorité de la commission.Tout d’abord, restons en Suisse sans parler des conventionsinternationales. M. Cottier a développé toute une théorie parrapport aux conventions internationales, et, pour ne pas bles-
Constitution fédérale. Réforme 48 E 20 janvier 1998
Bulletin officiel de l’Assemblée fédérale / Tiré à part
ser certaines susceptibilités, je pense qu’on peut parler uni-quement de notre droit Suisse.Le droit de grève est implicitement reconnu dans de nom-breuses dispositions légales de notre pays. Par exemple,dans le Code des obligations, on règle de manière très claireque, si les partenaires sociaux concluent une convention col-lective de travail, par là même et en même temps et de par laloi, ils décident de renoncer à recourir à des moyens collectifsde lutte. C’est réglé de par la loi. On peut dire que si, dans laloi, on estime que, pendant cette période, il est interdit de re-courir à des moyens collectifs de lutte, a contrario, en dehorsde ces périodes, il est évidemment autorisé de recourir à desmoyens collectifs de lutte. Il en va de même dans les dispo-sitions légales cantonales ou fédérales qui instituent des or-ganes chargés de prévenir ou de régler dans la mesure dupossible les différences d’ordre collectif dans le domaine dutravail.L’Etat met ses services à disposition des partenaires sociauxpour leur permettre d’éviter ou de résoudre des situationsconflictuelles et, par là même, il reconnaît implicitement ledroit au conflit et à l’utilisation des moyens collectifs de lutte.Ces dispositions sont inscrites dans notre législation indé-pendamment de celles qui seraient par ailleurs applicablesen vertu du droit international.Ensuite, la majorité de la commission demande de biffer lesalinéas 3 et 4 de l’article 24 du projet du Conseil fédéral.L’alinéa 2 de cet article dispose que «les conflits sont, autantque possible, réglés par la négociation et la médiation».Donc, on admet qu’il peut exister des conflits, et que norma-lement, autant que possible, on doit essayer de les réglerpar la négociation collective ou par la médiation avec l’inter-vention de l’Etat. Là aussi, dans l’alinéa 2, on admet qu’ilpeut y avoir des conflits collectifs entre travailleurs et em-ployeurs.Il est incontestable à mon sens que l’on peut affirmer qu’enSuisse, les mesures collectives de lutte sont fondamentale-ment autorisées et que notre ordre juridique reconnaît et ga-rantit le droit de grève. Ainsi, si je suis l’idée du Conseil fédé-ral de vouloir une mise à jour de la Constitution fédérale,nous devons aussi inscrire un droit fondamental qui est undroit d’un type particulier, je le reconnais: ce n’est pas un droitindividuel, c’est un droit collectif – un travailleur ou une tra-vailleuse tout seul ne peut se mettre en grève –, et c’est leseul droit fondamental qui est un droit collectif.Ensuite, l’argumentation développée à propos de l’interdic-tion de grève pour les fonctionnaires. D’une part, j’aimeraisrappeler que tous les cantons ne connaissent pas cette inter-diction. Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de le confirmerdans un arrêt non publié qui concernait une affaire gene-voise, parce que la loi genevoise, elle, n’interdit pas le re-cours à la grève pour les fonctionnaires. La loi le règle – leConseil fédéral a prévu, évidemment, cette disposition; ellepeut régler et interdire le recours à la grève pour certaines ca-tégories de personnes. En l’état, la situation reste telle qu’elleest: certains cantons vont interdire le recours à la grève; laConfédération, à l’heure actuelle, également, et d’autres can-tons ne l’ont pas fait ou n’ont pas de raison de changer leurpratique.Maintenant, au niveau politique: je dois dire honnêtementque la discussion m’étonne, parce que toute notre traditionde paix sociale est fondée sur le fait que l’on reconnaît le droitde grève. Et il n’y aurait pas de paix sociale si nous ne pou-vions pas discuter avec nos partenaires sociaux, avec les as-sociations d’employeurs, et leur dire: «Ecoutez, nous nousmettons d’accord sur telles conditions de travail, nous les ré-glons, nous réglementons les choses, et en même temps etpour la même durée, nous renonçons à toute mesure collec-tive de lutte.» Toute notre tradition de partenariat social re-pose sur la reconnaissance implicite du droit de recourir àdes mesures collectives de lutte.Il faut prendre conscience de l’importance du fondement dupartenariat social en Suisse. Le partenariat social repose surle fait qu’il n’a pas fallu se bagarrer comme dans d’autrespays pendant des années pour faire reconnaître le droit degrève. Parce que, sinon, nous n’aurions pas non plus de tra-
dition de partenariat social. Les deux éléments vont de pair,et, si nous voulons poursuivre notre politique de partenariatsocial, il faut aussi admettre et dire clairement que l’on recon-naît implicitement, avec toutes les limites que le Conseil fé-déral a jugé bon d’y mettre, le droit de grève comme moyende défense des conditions de travail des travailleuses et destravailleurs de notre pays.Je vous invite à rejeter la proposition de majorité consistant àbiffer les alinéas 3 et 4. Si vous adoptez cette proposition,vous remettriez en cause et lanceriez un débat sur l’ensem-ble du bien-fondé de cette mise à jour de la Constitution fé-dérale. Je vous invite à adopter l’une des deux propositionsde minorité, étant entendu que celle de la minorité II est pluscohérente, mais celle de la minorité I a au moins le mérite dela clarté.
Die Beratung dieses Geschäftes wird unterbrochenLe débat sur cet objet est interrompu
20. Januar 1998 S 49 Bundesverfassung. Reform
Amtliches Bulletin der Bundesversammlung / Separatdruck
Dritte Sitzung – Troisième séance
Dienstag, 20. Januar 1998Mardi 20 janvier 1998
15.00 h
Vorsitz – Présidence: Zimmerli Ulrich (V, BE)
___________________________________________________________
96.091
Bundesverfassung.ReformConstitution fédérale.Réforme
Fortsetzung – Suite
___________________________________________________________
A1. Bundesbeschluss über eine nachgeführte Bundesverfas-sung (Titel, Art. 1–126, 185) (Fortsetzung)A1. Arrêté fédéral relatif à une mise à jour de la Constitutionfédérale (titre, art. 1–126, 185) (suite)
Art. 24 (Fortsetzung) – Art. 24 (suite)
Cavadini Jean (L, NE): Nous avons, dans un souci de res-serrement de nos débats, voulu aller à l’essentiel et je tente-rai de m’y conformer. Mais nous avons entendu, avant la sus-pension de nos travaux, un certain nombre d’affirmations for-tes, politiques, et j’aimerais apporter ici l’avis d’un des mem-bres appartenant à la majorité de votre commission.La grève, c’est un concept presque mythique, c’est l’ultimerecours, c’est l’arme des désarmés. Mais, hormis le lyrismeau-delà duquel nous voulons aller, nous vivons dans cetteréalité suisse dont nous devons donner une définition consti-tutionnelle.Faut-il inscrire ce droit au niveau constitutionnel? Telle est laquestion qui nous est posée, avec des nuances. La premièreréponse que nous partageons tous, c’est que nous refusonsun droit de grève qui serait politique. Nous entendons limiterle droit de grève – que personne ne conteste, j’aimerais bienle rappeler – à sa définition légale; nous aimerions le bornerau domaine législatif. C’est là l’enjeu. Il n’y a pas d’autres af-frontements que celui-là.Mme Brunner a très bien rappelé que ce droit se trouve ins-crit dans toute une série de dispositions législatives: qu’il setrouve dans le Code des obligations, qu’il se trouve, impliciteou explicite, dans les conventions collectives de travail, qu’ilse trouve dans la loi fédérale sur le statut des fonctionnaires,tout le monde en convient.La question se pose: devons-nous aller au-delà? Devons-nous l’inscrire dans la constitution? La majorité de la commis-sion répond: non, parce que cette grève, qui doit rester lemoyen ultime, le moyen exceptionnel, deviendrait alors unrecours régulier, formalisé, reconnu constitutionnellement.C’est sur point que nous ne pouvons pas tomber d’accordavec les arguments qui nous ont été donnés. Notre ordre ju-ridique suisse admet le droit de grève. Nous l’admettons tousici. Il est reconnu, et souventes fois, dans nos lois. Nous sou-haitons simplement qu’il reste limité à la loi et que cette der-nière en définisse l’exercice.Un dernier point: Mme Brunner a dit ce matin que c’était fina-lement le seul droit non individuel fondamental. Ce n’est pastout à fait exact, nous en conviendrons les uns et les autres.La liberté d’association, la liberté syndicale sont des droitsnon individuels fondamentaux – à moins que chacun d’entre
nous fonde son syndicat, ce qui est une perspective assez in-téressante, mais dénuée de réalisme, jusqu’à plus ample in-formé! Nous sommes véritablement devant une évidence, etcette évidence ne nous permet pas de recommander l’ins-cription du droit de grève dans la constitution.Voilà pourquoi, avec la majorité de la commission, nous vousdemandons non pas de nier le droit de grève – c’est à la foisinjuste, stupide et dépassé –, mais de le limiter précisémentlà où il doit se trouver, c’est-à-dire dans la loi.
Rhinow René (R, BL), Berichterstatter: Wir müssen bei die-ser Diskussion zwei Seiten unterscheiden, nämlich einerseitsdie verfassungsrechtliche oder allgemein die rechtliche Seiteund andererseits den Symbolgehalt, der dieser Bestimmungoder zumindest der Diskussion darüber zukommt. Ich versu-che zuerst einige Überlegungen rechtlicher Natur anzustel-len.1. Es ist unbestritten, und Herr Cavadini hat darauf hingewie-sen, dass Streik und Aussperrung als Arbeitskampfmassnah-men in unserer Rechtsordnung zulässig sind, allerdings nurinnerhalb gewisser Grenzen. Diese sind genannt worden. Icherwähne nur stichwortartig: Es muss sich um eine Ultima ra-tio handeln; die Friedenspflicht darf nicht verletzt sein, wennsie in Gesamtarbeitsverträgen festgelegt ist; Schlichtungs-verhandlungen dürfen nicht umgangen oder ausgeschlossenwerden; es darf sich nicht um einen politischen Streik han-deln.Ich möchte ebenfalls festhalten – und das ist vielleicht in un-serer langen Friedenszeit etwas vergessen worden, aber ichstimme hier Frau Brunner voll und ganz zu –, dass die zuRecht gerühmte Sozialpartnerschaft mit der Möglichkeit vonStreik und Aussperrung verbunden ist. Beides sind zwei Sei-ten einer Münze, die zusammengehören. Man darf deshalbnicht sagen, die Sozialpartnerschaft allein gehöre zum We-sen unserer Wirtschafts- und Sozialordnung.Ich bin dankbar, dass diese rechtliche Ausgangslage von nie-mandem angefochten worden ist.2. Umstritten ist aber, ob sich dieses Recht als Kollektivrechtnur aus der Rechtsordnung allgemein ergibt oder ob es denCharakter eines selbständigen – oder aus der Koalitionsfrei-heit abgeleiteten – verfassungsmässigen Rechtes aufweist.Das ist der umstrittene Punkt. Die Lehre beantwortet dieseletzte Frage, indem sie ein solches Recht aus der Koa-litionsfreiheit ableitet. Das Bundesgericht lässt die Frage of-fen. Herr Danioth hat uns die Passage vorgelesen. Hier be-steht keine eindeutige und einstimmige rechtliche Auffas-sung.3. Was bedeuten die vorliegenden Anträge unter diesen Ge-sichtspunkten? Der Entwurf des Bundesrates und der Antragder Minderheit II (Aeby) bejahen nun den grundrechtlichenCharakter. Damit wird aber der Spielraum der Nachführungnicht verlassen. Dieser wird insofern ausgeschöpft, als einerechtliche Unklarheit nun durch eine Festlegung des Verfas-sunggebers ausgemerzt wird. Es gehört nach Auffassungdes Bundesrates und der Kommission auch zur Nachfüh-rung, dass gewisse rechtliche Unklarheiten entschieden wer-den. Es liegt also kein Verstoss gegen die Nachführung vor,aber wir sind natürlich frei, diesen Schritt zu tun oder ihn nichtzu tun. Wir sind auch frei, eine bestimmte Frage offenzulas-sen und nur in diesem Zusammenhang wie bisher nicht fest-zulegen.Wenn Sie sich für den Antrag der Kommissionsmehrheit ent-scheiden, dann tun Sie genau dies; Sie bewegen sich dabeiimmer noch auf dem Boden des geltenden Rechtes, des Sta-tus quo, aber Sie überlassen es wie bis anhin der Praxis, spä-ter allfällige Konkretisierungen vorzunehmen. Die Eindeutig-keit stellen Sie also gerade nicht her, sondern Sie führen diegeltende Unsicherheit weiter.Das darf man selbstverständlich tun, aber man muss es wis-sen. Man darf dem Antrag der Kommissionsmehrheit aberauch nicht vorwerfen, er wolle hinter das geltende Recht zu-rückgehen. Da muss ich Herrn Frick korrigieren: Ich glaubenicht, dass man umgekehrt aus einer Gutheissung oder Ab-lehnung dieses Antrages entsprechende Schlüsse ziehendarf. Die Ablehnung des bundesrätlichen Antrages hätte, zu-
Constitution fédérale. Réforme 50 E 20 janvier 1998
Bulletin officiel de l’Assemblée fédérale / Tiré à part
mindest nach Meinung der Kommissionsmehrheit – dies hatheute morgen auch Frau Forster verdeutlicht –, nicht dieTragweite eines «qualifizierten Schweigens».Wenn Sie dem Antrag der Minderheit I zustimmen, bewegenSie sich auch im Rahmen des geltenden Rechtes, begründenaber im Unterschied zur bundesrätlichen Fassung keinGrundrecht, kein verfassungsmässiges Recht auf Streik undAussperrung. Aber Sie erwähnen in der Verfassung mit denStichworten «Streik» und «Aussperrung», dass diese dochzum geltenden Recht gehören. Er wird auf die geltendeRechtslage ohne Begründung eines verfassungsmässigenAnspruchs verweisen. Zusätzlich normieren Sie aber Schran-ken, die bisher nicht in der Verfassung waren, geben alsodem Richter Leitplanken mit, wenn dieser allenfalls einmalversucht sein könnte, diese Grenzen auszuweiten. Und mitdem Antrag der Minderheit verzichten Sie auch auf den Auf-trag, den der bundesrätliche Entwurf enthält, wonach der Ge-setzgeber Streik und Aussperrung zu regeln hätte.Noch ein Wort zur politisch-symbolischen Seite dieser Streit-frage. Hier stehen sich zwei Auffassungen diametral gegen-über: Auf der einen Seite wird befürchtet, allein die Diskus-sion über den Streik, erst recht das Erwähnen des Streiks inder Verfassung, setzten ein falsches Signal, verschlechtertendie Situation unseres Wirtschaftsstandortes, führten zu Ver-unsicherung, ja man malt das Gespenst des Streiks an dieWand, welches der Gefährdung des Sozialfriedens Tür undTor öffne. Es ist sogar die waghalsige Behauptung aufgestelltworden, wer den Streik regle, der wolle ihn auch. Dies istaber so absurd, wie wenn man denjenigen, die den Konkursregeln wollen, vorwerfen würde, sie wollten den Konkurs. Aufder anderen Seite des politischen Spektrums wird befürchtet,dass die Streichung dieses Streikrechtes aus der Verfassungein Signal in die Gegenrichtung sei, nämlich gegen die So-zialpartnerschaft und gegen die Arbeitnehmerinnen undArbeitnehmer sowie deren Organisationen. Man wolle haltdoch verdeckt irgendwie einen Schritt zurück machen.Nun wissen wir alle, dass Signale nicht aus dem Nichts ent-stehen. Sie werden aufgebaut und verstärkt. Sie sind auchvon beiden Seiten gepflegt worden. Diese Signale sind nuneinmal da, auch wenn teilweise Argumente beigezogen wer-den, die sich nicht auf die geltende Rechtslage abstützenkönnen. Was sollen wir jetzt tun? Es wäre weise, wenn wirdiese Signale nicht noch zusätzlich verstärken würden, son-dern die Wogen zu glätten versuchten und der Vernunft denVorrang einräumen würden. Für mich heisst dies, dass we-der das angsteinflössende Recht auf Streik noch die ebensoangsteinflössende Streichung des Streikrechtes in der Ver-fassung gutzuheissen sind.Ich stimme deshalb dem Minderheitsantrag I (Marty Dick) zu,weil er beiden Seiten gestattet, das Gesicht zu wahren undHand zu einer gemeinsam getragenen Bestimmung zu bie-ten. Unser Land hat ein solches Signal verdient.
Leuenberger Moritz, Bundesrat: Streik und Aussperrungsind Institute unserer Rechtsordnung. Sie sind auch Gegen-stand einer ziemlich ausführlichen Rechtsprechung, einernoch viel grösseren Literatur. Sie sind zum Teil auch Gegen-stand, allerdings sehr marginal, einer gewissen Praxis, diezugegebenermassen in letzter Zeit etwas an Bedeutung ver-loren hat. Ob nun Streik und Aussperrung ein Grundrechtsind oder ob sie Derivate eines anderen Grundrechtes, näm-lich der Versammlungsfreiheit, der Vereinsfreiheit oder derKoalitionsfreiheit, sind, das hat die Rechtsprechung offenge-lassen.Ich finde das rechtlich gar nicht so wichtig. Aber politischfinde ich doch wichtig, dass wir in dieser Zeit, in der die Bun-desverfassung nachgeführt wird, in unsicheren Zeiten leben,in Zeiten der Deregulierung, der Privatisierung, der Änderungdes Beamtenstatus. Auch Bundesbetriebe werden dereinstandere arbeitsrechtliche Bedingungen kodifizieren. Esherrscht deswegen in weiten Kreisen eine gewisse Angst vordem Verlust von Arbeitsplätzen. Es ist – nicht in diesem Rat,aber von gewissen politischen Parteien und Verbänden – ge-genüber dieser Totalrevision die Befürchtung geäussert wor-den, die Totalrevision werde auch dazu benutzt, gerade
heute die Stellung der Arbeitnehmerschaft zu verschlechtern.Vor allem deswegen finde ich es nicht geschickt, was Ihnendie Mehrheit vorschlägt. Sie will die beiden Absätze 3 und 4streichen. Es soll weder das Streikrecht noch die Aussper-rung in der Bundesverfassung genannt werden. Da wird ar-gumentiert werden, das sei gegenüber heute ein Rückschritt.Nun ist zum Teil richtigerweise ausgeführt worden, dass eskein Rückschritt wäre, dass die Mehrheit keinen Rückschrittwill. Aber immerhin: Die beiden Rechte würden in der Verfas-sung nicht genannt. Das wäre zwar kein qualifiziertesSchweigen, aber es würde doch so empfunden: Das Streik-recht wird in der Verfassung gar nicht mehr erwähnt.Aber wir möchten, dass es erwähnt wird. Der Bundesratschlägt einen Kompromiss vor. Er hat nicht etwa bloss dasStreikrecht und die Aussperrung als Recht genannt, sondernganz ausdrücklich gesagt, unter welchen Bedingungen diebeiden angewendet werden können. Und er hat die Möglich-keit vorgesehen, dass das Gesetz diese Rechte regelt unddass der Streik für bestimmte Kategorien von Personen ver-boten wird. Mit diesem Kompromiss hat der Bundesrat denBedenken, die gegenüber dem Streikrecht gehegt werden,Rechnung getragen.Ich möchte Sie ersuchen, dem Bundesrat zuzustimmen, da-mit jetzt nicht das ganze Werk der Totalrevision angezweifeltwird. Auf jeden Fall sollten Sie der Minderheit I (Marty Dick)zustimmen, falls Sie den Antrag der Minderheit II (Aeby) be-ziehungsweise die Fassung des Bundesrates bachab schik-ken.Der Antrag der Minderheit I hat zwar den Nachteil, dass erdas Streikrecht und das Aussperrungsrecht – ähnlich wievorhin das Redaktionsgeheimnis bei der Medienfreiheit –nicht ausdrücklich nennt, aber doch indirekt davon ausgeht,indem die Bedingungen aufgeführt werden. Was Absatz 4betrifft, ist der Antrag der Minderheit I auch etwas weniger gutals die Fassung des Bundesrates, weil nämlich die Formulie-rung, dass das Gesetz die Ausübung dieser Rechte regelnkönne, dann nicht mehr enthalten ist. Aber immerhin würdedie Minderheit I die beiden Rechte wenigstens indirekt nochgarantieren.Erste Priorität hat die Fassung des Bundesrates, zweite Prio-rität hat die Minderheit I, unter gar keinen Umständen aberkann der Bundesrat der Mehrheit zustimmen.
Abs. 1, 2 – Al. 1, 2Angenommen – Adopté
Abs. 3, 4 – Al. 3, 4
Abstimmung – Vote
Eventuell – A titre préliminaireFür den Antrag der Minderheit I 31 StimmenFür den Antrag der Minderheit II 8 Stimmen
Definitiv – DéfinitivementFür den Antrag der Mehrheit 24 StimmenFür den Antrag der Minderheit I 16 Stimmen
Art. 25–28Anträge der Kommissionen: BBlPropositions des commissions: FF
Marty Dick (R, TI), rapporteur: Il s’agit des garanties de pro-cédure qui se sont développées sur la base de la jurispru-dence relative à l’article 4 de la constitution et de la Conven-tion européenne des droits de l’homme. Ce sont des princi-pes extrêmement importants, mais qui font aujourd’hui partiede notre patrimoine juridique et culturel. Ce sont toutes les rè-gles relatives à l’interdiction du déni de justice: le droit d’avoirun procès équitable, d’avoir sa cause jugée dans des délaisraisonnables. Je répète, des principes qui font partie d’unEtat moderne fondé sur le droit. Ils n’ont donné lieu à aucuneréserve critique.Les petits changements que vous constatez sont de naturerédactionnelle. A l’alinéa 3 de l’article 25, le projet du Conseil
20. Januar 1998 S 51 Bundesverfassung. Reform
Amtliches Bulletin der Bundesversammlung / Separatdruck
fédéral prévoit un pluriel «les personnes», alors qu’à l’alinéa1er, nous avons «toute personne» au singulier. Nous avonsestimé que le singulier se justifiait également à l’alinéa 3.Donc, il n’y a pas de changement substantiel, c’est un chan-gement rédactionnel à l’article 25.A l’article 26, c’est aussi un changement secondaire qui nemodifie pas la substance de l’article. Nous avons estimé né-cessaire de prévoir expressément que «les tribunaux d’ex-ception sont interdits».
Angenommen – Adopté
Art. 29Anträge der Kommissionen: BBlPropositions des commissions: FF
Antrag BüttikerAbs. 2Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Proposition BüttikerAl. 2Adhérer au projet du Conseil fédéral
Marty Dick (R, TI), rapporteur: Le droit de pétition est le droitde toute personne d’adresser des pétitions aux autoritéssans pour cela en subir de préjudice. C’est là le fondementde ce droit constitutionnel, et, en tant que tel, ce droit n’adonné lieu à aucune discussion. Ce qui a donné lieu à discus-sion, c’était de savoir quelle devait être l’attitude des autori-tés. Le projet du Conseil fédéral, qui reprend le droit actuel,prévoit: «Les autorités doivent en prendre connaissance.» Ila semblé à la majorité de la commission que, dans un texteconstitutionnel, cette phrase n’était pas nécessaire, tant il estévident qu’une autorité doit prendre connaissance des péti-tions.Pour les «Materialien», pour l’interprétation future de cet ar-ticle, je vous lis simplement quelques mots du président de lasous-commission, qui a présenté le résultat des travaux dusous-groupe qui proposait justement de biffer l’alinéa 2: «DieSubkommission 2 hat gefunden, es sei eine Frechheit, denBehörden zu unterstellen, dass sie etwas nur lesen, wennman es ausdrücklich sagt.»Cela devait être dit pour faire comprendre l’esprit dans lequelnous abolissons l’alinéa 2. Il paraît évident que lorsqu’on re-çoit une pétition, on en prend connaissance; a contrario, onpourrait, si une autre disposition ne spécifie pas précisémentque l’autorité doit lire le texte qu’on lui adresse, en déduirequ’elle ne doit pas le lire.Autre chose est de savoir si l’autorité doit répondre à une pé-tition. Là, nous estimons que nous irions au-delà du droit ac-tuel. Aujourd’hui, on reconnaît que l’autorité n’a pas d’obliga-tion de répondre à des pétitions; elle doit en prendre connais-sance. Le droit constitutionnel du citoyen n’est pas d’obtenirune réponse, mais de pouvoir s’exprimer, de pouvoir s’adres-ser à une autorité d’une façon libre, et surtout sans subir depréjudice. Nous devons, dans une mise à jour de la constitu-tion, nous en tenir à ce principe. Si nous exigeons l’obligationde répondre, nous faisons un pas de plus et nous modifionsle contenu de cette norme constitutionnelle. J’ai fait partied’un gouvernement et je me rends compte quels pourraientêtre les dangers; ça demanderait une réflexion beaucoupplus profonde. Si nous voulions introduire l’obligation de ré-pondre, on pourrait facilement aujourd’hui paralyser l’activitéd’une autorité, générer par ordinateur des milliers et des mil-liers de requêtes à l’autorité, qui serait chaque fois obligée d’yrépondre.La majorité de votre commission vous propose donc d’adop-ter l’article 29 sans l’alinéa 2. Nous biffons cet alinéa 2, jevous l’ai dit, parce que nous estimons que son contenu estimplicite déjà dans l’alinéa 1er.
Gentil Pierre-Alain (S, JU): Sur un point, je partage l’avis durapporteur de la commission. Il me paraît en effet que men-tionner le fait que les autorités doivent prendre connaissance
des pétitions est au mieux un pléonasme, au pire l’insinuationqu’une autorité n’ouvre pas son courrier. Le projet du Conseilfédéral est donc insatisfaisant.Mais la proposition de la majorité n’est pas satisfaisante nonplus, parce qu’elle ne tient pas la balance égale entre le droitdu citoyen, qu’a très bien évoqué M. Marty, et la responsabi-lité de l’autorité. A quoi sert le droit d’un citoyen d’adresserune pétition s’il ne peut pas être certain que les autorités vontnon seulement ouvrir le courrier, mais encore examiner leproblème posé et lui donner une suite qui relève de la libertéde l’exécutif ou du législatif interpellé?Répondre à une pétition ne signifie pas, du point de vue de laminorité, accepter le contenu de cette pétition, donner unesuite favorable à cette pétition, mais signifie simplement queles autorités doivent informer les pétitionnaires de la manièredont leur pétition sera traitée.Sans cette obligation faite à l’autorité de répondre à une pé-tition, nous craignons que le droit de pétition soit un droit videde sens. On écrit à une autorité, mais c’est un petit peucomme on jette une bouteille à la mer, sans être sûr qu’avantune éternité des résultats concrets se manifesteront. Il meparaît nécessaire de spécifier qu’au droit du citoyen de dépo-ser une pétition correspond une obligation de l’autorité deconsacrer un moment à l’examen de cette pétition et d’infor-mer les pétitionnaires de la manière dont elle sera traitée,même si c’est pour dire aux pétitionnaires que l’autorité saisietrouve que la pétition n’a pas de sens et qu’il n’y sera pasdonné suite. Mais l’information en retour est livrée et il nousparaît que c’est un corollaire nécessaire du droit de pétitionqui, sans cela, n’a pas grand sens.Nous vous proposons donc de soutenir la proposition de laminorité.
Büttiker Rolf (R, SO): Ich beantrage Ihnen, in diesem Falledem Bundesrat zu folgen. Ich meine, es wäre eine Frechheit,der Mehrheit zu folgen und Absatz 2 einfach ersatzlos zustreichen. Als Kommissionsmitglied muss ich selbstkritischzugeben, dass die Kommission hier etwas unglücklich ope-riert hat. Auch das Protokoll besagt nicht klar, warumAbsatz 2 mit einer derartigen Mehrheit gestrichen worden ist,und auch der Berichterstatter hat wenig dazu beigetragen,Sie davon zu überzeugen, dass Absatz 2 einfach ausser Ab-schied und Traktanden fallen soll.Wir dürfen die Bedeutung einer Petition für Bürgerinnen undBürger – als Ventil, als «Dampfablasser», als verbaler Not-ruf – nicht unterschätzen. Das Petitionsrecht ist ein sehr altesRecht, und es ist, wie bereits gesagt, allen Menschen zu-gänglich, unabhängig von ihrer Staatsbürgerschaft. Wir müs-sen bei der Analyse auch zugeben, dass wir auf Bundes-ebene eine grosse Lücke haben: Zwischen dem «Nichts»und der Volksinitiative liegt eigentlich nur das Petitionsrecht.Der Bund kennt keine anderen Instrumente wie z. B. Einzel-initiative oder Volksmotion, die einige Kantone kennen. ImNormalfall kann man auch davon ausgehen, dass eine Peti-tion zur Kenntnis genommen und darauf auch ein Echo ge-geben wird, d. h. im Klartext eine Antwort. Es gibt übrigensauch eine Dissertation Muheim, die diese Aussage wissen-schaftlich erhärtet. Die Verpflichtung der Behörden, in jedemFall darauf zu antworten, wie es die Minderheit Gentil bean-tragt, geht aber eindeutig zu weit. Wir kennen die Missbräu-che, wir haben sie auch schon gesehen und erlebt – nicht vonQuerköpfen, aber von Querulanten, die vielleicht auch in glei-cher Sache in kurzer Zeitkadenz mehrmals intervenieren,und man muss die Frage stellen, ob sie zwingend in jedemFalle eine inhaltliche Antwort erwarten dürfen.Aus all diesen Gründen ist es meines Erachtens richtig, beiAbsatz 2 dem Bundesrat zu folgen und das Petitionsrechtmodern nachzuführen.
Schmid Carlo (C, AI): Ich beantrage Ihnen, dem Antrag Büt-tiker zu folgen. Was Herr Büttiker und der Bundesrat wollen,ist nichts anderes als das, was man «kaufmännischen An-stand» nennt. Das lernt man schon in der Bürolehre. Wennman einen Brief erhält, dann ist er eine Antwort wert, sei esauch nur ein Einzeiler: «Ich bestätige den Eingang Ihres
Constitution fédérale. Réforme 52 E 20 janvier 1998
Bulletin officiel de l’Assemblée fédérale / Tiré à part
Schreibens.» Alles andere ist nicht anständig. Ich meine da-her, dass die Streichung von Absatz 2 ein völlig falsches Zei-chen nach aussen ist.Demgegenüber bin ich der Auffassung, dass die MinderheitGentil recht hätte – wenn es geltendes Recht wäre. Aber:Wenn man nachführen will, dann soll man nicht etwas Zu-sätzliches tun. Der «kaufmännische Anstand» würde es ge-bieten, den Antrag der Minderheit Gentil ebenfalls anzuneh-men.Nur: Das Petitionsrecht – da dürfen wir uns keinen Illusionenhingeben – ist natürlich ein alter Zopf. Woher kommt das Pe-titionsrecht? Lesen Sie den zweiten Halbsatz von Artikel 29Absatz 1! Es stammt aus der Zeit des Ancien régime. Es isteine Strafbefreiungsnorm. Früher riskierte man, sich strafbarzu machen, wenn man seine eigenen Gedanken unaufgefor-dert an die Obrigkeit richtete. Das war unbotmässig. Das wardamals der eigentliche Grund für die Einführung des Peti-tionsrechtes. Davon kann heute keine Rede mehr sein.Das Petitionsrecht ist heute im Prinzip ein Schlag ins Wasser.Gestern haben die Rudolf-Steiner-Schulen eine Petition ein-gereicht, dass man in der Verfassung das Recht der Elternauf Erziehung ausdrücklich erwähnen solle. Ich bin zufälligmit Herrn Dr. Zuegg, der die Petition eingereicht hat, im Zugnach Bern gefahren. Ich habe ihm gesagt: Schade, dass ihrdas gemacht habt, das nützt überhaupt nichts, die Petitionwird eingereicht, wir nehmen sie zur Kenntnis und beantwor-ten sie, wenn wir anständig sind, aber was dann läuft, ist null.Das Petitionsrecht ist das Papier nicht wert, auf dem es ge-schrieben steht. Es ist eine Strafbefreiungsgarantie, mehrnicht.Heute die Idee zu haben, dass es einer Behörde in den Sinnkommt, einen Bürger zu bestrafen, weil er sie anspricht, istaberrant. Von daher ist Herrn Büttiker und dem Bundesrat zufolgen. Das ist etwa das, was man noch in der Verfassungstehenlassen kann. Der Rest sind Theatertänze, bei denenman wirklich nicht mitmachen soll.
Rhinow René (R, BL), Berichterstatter: Ein kurzes Wort zumVotum von Herrn Schmid: Inhaltlich bin ich seiner Meinung.Wir sollten hier dem Bundesrat folgen. Aber zu meinen, essei völlig ausgeschlossen und käme keiner Behörde in derSchweiz je in den Sinn, jemanden, der seinen Namen untereine Petition gesetzt hat, irgendwelche Nachteile spüren zulassen – nicht eine Strafe natürlich –, so weit würde ich danndoch nicht gehen. Ich habe auch das Vertrauen und die Si-cherheit, dass sich die grosse Mehrheit der Behörden in denallermeisten Fällen an dieses Gebot hält. Aber es ist nichtauszuschliessen, dass ein unliebsamer Bürger auf Dauerden Nachteil irgendwie spüren könnte – und da gibt es sehrfeine Wege, um ihn das spüren zu lassen. Ich würde deshalbdieser Bestimmung trotzdem einen realen Gehalt zuschrei-ben.
Leuenberger Moritz, Bundesrat: In der Tat kann man sichmanchmal fragen, welches heute noch die Bedeutung desPetitionsrechtes ist, insbesondere wenn man sieht, dass fürdie grossen petitionsproduzierenden Verbände und Gesell-schaften der Hauptzweck einer Petition ist, Pakete mit Unter-schriftenbögen vor laufender Fernsehkamera zu übergeben,und dass es ihnen eigentlich egal ist, was nachher mit derPetition geschieht.Dennoch bin ich der Ansicht von Herrn Rhinow, denn es be-steht beispielsweise die Gefahr – und es gab solche Fälle –,dass solche Petitionen in öffentlichen Inseraten lanciert wer-den. Ich denke an Vereinigungen, in denen vor allem Lehrervertreten waren, die andere Erziehungsmethoden wollten;die wurden von einer kantonalen Erziehungsdirektion regi-striert. Es stellt sich die Frage, ob dies ein Nachteil war, ins-besondere wenn dann diese Registratur im Moment einesStellengesuches wieder verwendet wurde. Oder: Schüler, dieeine Petition machen, sollen ein Recht haben, dies ohneNachteile zu tun. Dies betrifft alle, die in einem besonderenGewaltverhältnis zum Staat stehen, insbesondere auch Häft-linge. Häftlingen, die sich in einer Petition an die Oberbe-hörde, sei das der Justizdirektor, der Regierungsrat oder das
Parlament, über ihren Bezirksanwalt oder Untersuchungs-richter beschweren, soll kein Nachteil erwachsen. Daher hatdiese Bestimmung einen Sinn.Die Frage ist – ich gehe damit direkt zum Antrag der Minder-heit über –, ob jede Petition beantwortet werden muss. Ichmeine: im Prinzip ja. Das ist eine Frage des Anstandes, wieHerr Schmid zu Recht gesagt hat. Schauen Sie z. B. die Si-tuation des Parlamentes an: Das Parlament muss eine Peti-tion materiell beantworten; es ist dazu verpflichtet, hat sichdiese Auflage selbst gegeben. Man kann sich sagen, dass esin einer Demokratie nichts als recht ist, wenn die politischeBehörde eine Petition – und die kann unter Umständen nuraus einer Zuschrift bestehen – beantwortet, sich inhaltlich da-mit auseinandersetzt.Indessen kann das – das hat Herr Marty bereits gesagt – inder Praxis zu Schwierigkeiten führen. Da werden z. B. wegeneinzelnen kleinen Teilen des bilateralen Vertrages mit derEuropäischen Union von einigen Umweltschutzorganisatio-nen Kartenaktionen lanciert; ich bekomme jeden Tag einpaar Kilo Postkarten – schön fein, mit einer Position, mit ei-nem jeweils anderen Absender: Ja, müssen die jetzt alle be-antwortet werden? Wo liegt die Grenze zwischen Petitionund Stimmungsmache und allenfalls auch Querulantentum?Daher hat der Bundesrat den Kompromiss vorgeschlagen,dass man von einer Petition Kenntnis nehmen muss; ichmuss diese Karten lesen – meistens ist es derselbe Text –und kann sie dann beiseite legen. Die Verpflichtung zu einerAntwort ist in der Regel da; eine Verpflichtung in jedem Fallbzw. ein verfassungsrechtlich garantierter Anspruch auf eineAntwort ging dem Bundesrat hingegen etwas weit, als er da-mals diesen Artikel 29 diskutierte.So ersuche ich Sie, bei der Fassung des Bundesrates zu blei-ben.
Abs. 1 – Al. 1Angenommen – Adopté
Abs. 2 – Al. 2
Abstimmung – Vote
Eventuell – A titre préliminaireFür den Antrag Büttiker 26 StimmenFür den Antrag der Minderheit 5 Stimmen
Definitiv – DéfinitivementFür den Antrag Büttiker 23 StimmenFür den Antrag der Mehrheit 10 Stimmen
Art. 30Anträge der Kommissionen: BBlPropositions des commissions: FF
Marty Dick (R, TI), rapporteur: L’article 30 codifie la liberté devote aujourd’hui déjà reconnue par le Tribunal fédéralcomme droit constitutionnel non écrit. Le droit de vote et d’éli-gibilité interdit toute discrimination et confère à l’électeur ledroit de s’exprimer en toute liberté, ce qui constitue un prin-cipe essentiel pour le fonctionnement de toute démocratie.Cet article important n’a suscité aucune réserve critique de lapart de la commission, qui vous recommande de l’adopter.
Angenommen – Adopté
Art. 31Anträge der Kommissionen: BBlPropositions des commissions: FF
Marty Dick (R, TI), rapporteur: Nous en sommes à la réalisa-tion des droits fondamentaux. On estime que les droits fon-damentaux sont tout d’abord une protection du particulier parrapport au pouvoir étatique, ce qui est vrai et ce qui est tou-jours toujours vrai. Mais ce rapport vertical n’est pas le seulqui doit être considéré. De plus en plus, on admet que lesdroits fondamentaux ont aussi des effets horizontaux. C’est
20. Januar 1998 S 53 Bundesverfassung. Reform
Amtliches Bulletin der Bundesversammlung / Separatdruck
ce qui est dit à l’alinéa 3: «Les autorités veillent à ce que lesdroits fondamentaux, dans la mesure où ils s’y prêtent, soientaussi réalisés dans les relations qui lient les particuliers entreeux.» Donc, pas tous les droits fondamentaux peuvent avoirdes effets horizontaux, ils ne peuvent pas toujours les avoirde la même façon, mais il y a des droits fondamentaux quidoivent avoir, et qui ont des effets aussi entre particuliers.Pensons au principe «A travail égal, salaire égal», etc.L’article 31 précise aussi – et nous retournons au principe dela verticalité – que quiconque assume une tâche de l’Etat esttenu évidemment de respecter les droits fondamentaux pré-vus par la constitution.
Angenommen – Adopté
Art. 32Anträge der Kommissionen: BBlPropositions des commissions: FF
Antrag Schmid CarloAbs. 1bisEinschränkungen von Grundrechten dürfen nur erlassenwerden im Interesse der Sicherheit und Unabhängigkeit derEidgenossenschaft, der öffentlichen Ruhe und Ordnung, deswirtschaftlichen Wohls der Eidgenossenschaft, des Schutzesder Gesundheit und der Moral oder des Schutzes der Rechteund Freiheiten anderer.
Proposition Schmid CarloAl. 1bisToute restriction d’un droit fondamental peut seulement êtreordonnée dans l’intérêt de la sécurité et de l’indépendancede la Confédération, de la paix et de l’ordre publics, du bien-être économique, de la protection de la santé et de la moraleou de la protection d’un droit fondamental ou des libertésd’autrui.
Marty Dick (R, TI), rapporteur: Nous sommes arrivés à la res-triction des droits fondamentaux, restriction qui est possiblesur la base de trois critères: il doit y avoir une base légale, unintérêt public et cette restriction doit avoir lieu selon le prin-cipe de la proportionnalité.La commission a estimé devoir modifier non pas le contenude cet article, mais sa disposition. La clause dite de «police»lui paraissait trop mise en évidence. La nouvelle version del’article 32, qui figure sur le dépliant de la commission, a re-cueilli l’unanimité de la commission.La proposition Schmid Carlo veut fixer dans la constitutionquels sont les motifs d’intérêt public. A l’alinéa 1bis il est pré-cisé: «Toute restriction d’un droit fondamental peut seule-ment être ordonnée dans l’intérêt de la sécurité ....» J’aime-rais faire remarquer au Conseil que cette proposition consti-tue manifestement un pas en arrière par rapport au droit ac-tuel, parce que, si vous vous en tenez à cette liste, vous nepourrez plus, par exemple, avoir une restriction de la pro-priété pour des motifs liés à l’aménagement du territoire, àdes objectifs de politique énergétique, à l’usage des eaux,etc. Donc cette proposition laisse des vides importants etconstitue un pas en arrière par rapport à la situationd’aujourd’hui.Je vous recommande, par conséquent, de vous en tenir autexte proposé par votre commission.
Schmid Carlo (C, AI): Ich war nicht Mitglied der Verfassungs-kommission, und dass ich in dieser Frage einen eigenen An-trag eingereicht habe, erfolgte ganz klar nicht in der Erwar-tung, dass ich in der Sache selbst heute zu den Gewinnernzähle. Es ist schwierig, in diesen zentralen Fragen gegeneine derart fundierte Kommissionsmeinung überhaupt An-träge zu stellen. Aber ich möchte Sie zum Nachdenken ein-laden. Wenn Sie dann vielleicht eine Differenz schaffen,dann bin ich sehr glücklich.Worum geht es mir? Es geht mir darum, die Rolle des Bun-desgerichtes gegenüber dem Gesetzgeber zu klären – eineRolle, die vor allem im Bereich der Grundrechte, der Verfas-
sungsinterpretation und der Verfassungsfortführung durchdas Bundesgericht sehr diffizil ist. Ich meine, das Leitmotivder Aufgabenverteilung zwischen den politischen Behördeneinerseits und dem Bundesgericht andererseits müsste essein, dass wir sagen, die Politik politisiere und das Gerichtüberprüfe die Rechtmässigkeit.Nun ist bei der Einschränkung der Grundrechte das alte Drei-gestirn der Einschränkungsvoraussetzungen jedem Jurastu-denten im ersten Semester geläufig: Erstens braucht es fürdie gültige Einschränkung irgendeines Grundrechtes einegesetzliche Grundlage, in der Regel im formellen Sinn, zwei-tens das öffentliche Interesse und drittens die Verhältnismäs-sigkeit. Ich gestehe dem Bundesgericht gerne zu, dass eswie niemand anders in der Schweiz in der Lage ist, die Fragezu beantworten, ob eine Einschränkung eines Grundrechtesauf einer hinreichenden gesetzlichen Grundlage beruht. Dasist völlig ausser Zweifel. Ich gestehe dem Bundesgerichtauch zu, dass es in der Lage ist – das gehört zu den gericht-lichen Eigenarten seiner Tätigkeit –, Fragen der Verhältnis-mässigkeit zu überprüfen. Ich bin aber der Auffassung, es seiklassischerweise nicht eine Aufgabe des Gerichtes, zu beur-teilen, ob – ja oder nein – eine Einschränkung im öffentlichenInteresse liegt. Das ist Sache der Politik, und ich meine,grundsätzlich sollte das Bundesgericht in dieser Frage durchuns gebunden werden.Der Idealzustand würde darin bestehen, dass wir vonArtikel 6 der Verfassung bis hin zu Artikel 32 – nämlich über-all dort, wo es um die Grundrechte geht – jene öffentlichen In-teressen namhaft machen würden, die es dem Gesetzgebergestatten, mittels eines Gesetzes Grundrechte einzuschrän-ken. Das ist natürlich eine komplizierte Geschichte und er-schwert die Verfassunggebung; aber vielleicht wäre es garnicht so dumm. Die andere extreme Haltung – nämlich jene,bei Artikel 32 einfach ein öffentliches Interesse zu reklamie-ren – führt dazu, dass plötzlich das Gericht politisiert wird unddann zu bestimmten Ergebnissen kommt, die in klassischerWeise vor allem in den fiskalischen und wirtschaftlichen Be-reichen dazu führen, dass das Bundesgericht kantonale Ge-setze kassiert und sagt, diese Interessen allein genügtennicht. Hier überschreitet das Gericht meiner Meinung nachseine ureigene Kompetenz. Wenn nämlich der kantonaleSouverän sich dahingehend äussert, dass er etwas als vonhinreichendem öffentlichen Interesse betrachtet, dann solltedas Bundesgericht dies nicht umstossen können. Es wäredies nämlich sonst nicht Rechtsprechung, sondern vielmehrPolitik.Nun gebe ich mir natürlich Rechenschaft darüber, dass beider momentan herrschenden Gemütslage keinesfalls dieMöglichkeit besteht, die Judikatur des Bundesgerichtes überdie Kantone einzuschränken; wir müssten dies, mit andernWorten, vielmehr auf der Ebene der Bundesverfassungselbst machen. Was ich deshalb versucht habe, ist, einen Ka-talog aufzustellen, über den das Bundesgericht nicht hinaus-gehen kann oder – um es positiv zu sagen – den das Bundes-gericht als öffentliches Interesse anerkennen muss. Dies inder Meinung aber, dass es sinnvoll wäre, bei jeder einzelnenGrundrechtsposition individuell zu entscheiden, welches dieöffentlichen Interessen sind, die tatsächlich dazu führen kön-nen, dass man dieses Grundrecht einschränken darf.Ich bin natürlich nicht Internationalist genug, um bei solchenFragen nicht doch internationale Abkommen zu prüfen: Inden vergangenen Jahren haben wir eine ganze Menge vonGrundrechtskatalogen in internationalen Verträgen über-nommen, z. B. die EMRK, den Uno-Pakt I oder den Uno-Pakt II, der allerdings nicht direkt anwendbar ist. Immer fol-gen diese Verträge dem eigentlich richtigen Schema – genauwie etwa die Kinderrechtskonvention, die Konvention überden Schutz der Frauen vor Diskriminierung oder die Rassen-diskriminierungskonvention –, bei jeder Grundrechtspositiongenau aufzulisten, welches die öffentlichen Interessen sind,die eine allfällige Einschränkung rechtfertigen.Das geschieht im Bewusstsein, dass der Gesetzgeber nichtdarüber hinausgehen kann, der Richter das aber auch nichtablehnen darf. Ich meine, das ist eine Überlegung, die zu-handen des Zweitrates gemacht werden muss. Wäre es nicht
Constitution fédérale. Réforme 54 E 20 janvier 1998
Bulletin officiel de l’Assemblée fédérale / Tiré à part
richtig, dass wir auf Verfassungsstufe selbst festlegen, wel-ches das jeweils massgebende öffentliche Interesse ist?Wir haben uns heute morgen und auch heute nachmittag beiArtikel 24 in extenso über die Tatsache beklagt, dass dasBundesgericht völlige Freiheit habe, das zu tun, was ihm be-liebe, wenn wir es nicht regeln würden. Bei Artikel 32 geht esmir genau darum, dass wir als verfassunggebende Vorberei-tungsinstanz dem Bundesgericht in Zukunft nicht mehr ge-statten, frei von der Leber weg zu politisieren. Politisieren istunser Geschäft, Recht zu sprechen nicht; Recht zu sprechenist das Geschäft des Bundesgerichtes, das Politisieren nicht.Der Kernpunkt ist das öffentliche Interesse.Ich bitte Sie daher, mindestens in diesem Sinne die Chancezu eröffnen, dass diese Gedanken im Zweitrat und dann beiuns in der Differenzbereinigung noch einmal vertieft ange-gangen werden können.
Rhinow René (R, BL), Berichterstatter: Herr Schmid sagt mitRecht, das Politisieren sei unser Geschäft. Wenn Sie seinemAntrag folgen, nehmen Sie uns die Grundlage dafür, dass wirweiterhin politisieren können, jedenfalls ein gutes Stück weit.Ihr Antrag, Herr Schmid, gehört in die Kategorie «gutgemeintist oft das Gegenteil von gut». Warum? Was tut denn dasBundesgericht, wenn es das öffentliche Interesse prüft? Esuntersucht, ob unserer Rechtsordnung ein solches Interesseentnommen werden kann, also ob beispielsweise beim Bundeine Bundeskompetenz vorliegt, ob das Anliegen von derRechtsordnung und damit auch von der Politik, die wir hiermachen, geschützt ist, oder ob ein Kanton ein solch ge-schütztes Interesse verfolgt. Das ist in erster Linie die Auf-gabe des Gerichtes, wenn es das öffentliche Interesse prüft,welches geeignet sein könnte, ein Freiheitsrecht einzu-schränken.Wenn Sie jetzt hier vorschreiben, dass Einschränkungen vonGrundrechten nur in bestimmten Fällen erlassen werden dür-fen, nehmen Sie uns beispielsweise die Möglichkeit, Energie-politik zu betreiben, und wir könnten auch keine Raumpla-nungsgesetze mehr erlassen, weil es dann sofort heissenwürde, die Eigentumsgarantie stehe dem absolut entgegen,deshalb könnten gar keine Einschränkungen mehr erfolgen.Wie wollen Sie Raumplanung betreiben – Herr Marty Dick hates gesagt –, wenn Sie nicht ein Stück weit die Eigentumsga-rantie beschränken dürfen? Wie wollen Sie Energiepolitik be-treiben, wenn Sie nicht ein Stück weit Grundrechte beschrän-ken dürfen? Fast jedes Bundesinteresse, fast jede Bundes-aufgabe hat früher oder später zumindest in einem Teilbe-reich auch einen gewissen Eingriff in einzelne Freiheitsrechtezur Folge.Zweitens prüft das Bundesgericht – insbesondere im Rah-men des Verhältnismässigkeitsgrundsatzes –, ob im Einzel-fall das geltend gemachte öffentliche Interesse so viel ge-wichtiger ist als das private Freiheitsinteresse, dass es denEingriff legitimiert. Diese Abwägungsfunktion, Herr Schmid,haben Sie dem Bundesgericht ausdrücklich zugesprochen.Ich möchte Sie nicht mit längeren Ausführungen zur Praxisdes Bundesgerichtes und zu den Grundrechtsschrankenhinhalten. Aber: Diese Frage hat nichts mit internationalenVerträgen zu tun, weil die Praxis des Bundesgerichtes unddie Lehre viel weiter zurückgehen als die Verträge – oderzumindest weiter zurück als bis zum Zeitpunkt, in welchemwir ihnen beigetreten sind. Diese Frage hat auch nichts miteiner Gemütslage zu tun, wie Sie, Herr Schmid, gesagt ha-ben, denn es geht wirklich darum, uns selbst nicht in derMöglichkeit zu beschneiden, öffentliche Interessen zu be-stimmen.Ein letzter Punkt: Sie wollen die Autonomie der Kantone wah-ren. Aber mit dieser Bestimmung nehmen Sie auch den Kan-tonen in bestimmten Fällen die Möglichkeit weg, ihre Politikautonom zu betreiben.Ihr Antrag zielt genau in die falsche Richtung.
Leuenberger Moritz, Bundesrat: Herr Schmid möchte dasöffentliche Interesse in der Verfassung präzisieren, und zwarmit dem Zweck, dass das Bundesgericht künftig nicht «freivon der Leber weg politisieren» kann. Ich frage mich, ob die
Formulierung, die hier gewählt wurde, diesbezüglich nicht so-gar zu einem Bumerang führen könnte. Einerseits sind zwareinzelne Elemente des öffentlichen Interesses, wie sie diePraxis entwickelt hat, genannt. Andere sind aber nicht ge-nannt. Ich denke z. B. an den Umweltschutz. Man könnte ihndann unter irgendeinem Begriff subsumieren, aber es könntetrotzdem zu Unklarheiten führen.Ein anderer Begriff ist aber ausdrücklich genannt, nämlichderjenige der Moral. Wenn die Moral hier als Bestandteil desöffentlichen Interesses ausdrücklich genannt wird, dannfrage ich mich bei aller Sympathie – ich will mich gar nichtdarüber lustig machen, im Gegenteil, ich sage ja immer, dassmoralisches Handeln Grundlage für jedes gesetzgeberischeund exekutive Handeln sein soll –, wie das Bundesgerichtdann «frei von der Leber weg politisieren würde », um IhreWorte zu gebrauchen. Ich bin ja nicht Justizminister, deshalbdarf ich auch etwas Freches zum Bundesgericht sagen.Die Einschränkung muss gemäss Absatz 1 verhältnismässigsein – die Verhältnismässigkeit ist ja auch Bestandteil der ge-richtlichen Überprüfung –, und sie bedarf einer gesetzlichenGrundlage. Die gesetzliche Grundlage garantiert, dass de-mokratisch zusammengesetzte Parlamente darüber diskutie-ren und entscheiden, was öffentliches Interesse ist und wasnicht. Deshalb ist das der eigentliche Garant. Den Versuch,das öffentliche Interesse griffiger zu fassen, empfinde ich alssehr löblich – ich anerkenne ihn –, aber es scheint mir etwasschwierig zu sein, das zu machen. Die bisherige Rechtspre-chung hat ja meines Erachtens gezeigt, dass der vom Bun-desrat und von Ihrer Kommission vorgeschlagene Wegdurchaus gangbar ist.
Schmid Carlo (C, AI): Nachdem ich auf weiter Flur alleinebin, gestatten Sie mir sicher, dass ich eine kurze Replik ma-che:1. Ich verstehe die Einwände von Herrn Rhinow natürlichhundertprozentig. So, wie dieser Antrag dasteht, hat er recht.Wir sparen da bestimmte öffentliche Interessen aus, die wirheute bereits als anerkannt betrachten, mindestens in die-sem Saal. Wie ich aber schon am Anfang gesagt habe, gehtes mir nicht darum, dass dieser Artikel effektiv so stehen-bleibt, sondern dass man die Frage der Funktion des Bun-desgerichtes bei der Beurteilung des öffentlichen Interessesin beiden Räten ernsthaft diskutiert. Meine Idealvorstellung –aber zur Konkretisierung fehlte mir als Nichtmitglied derKommission die Zeit und auch die Kompetenz – bestehtdarin, dass wir von Artikel 6 an bis zu Artikel 30 jeweils in ei-nem Absatz sagen, was die anerkennenswerten öffentlichenInteressen sind, die bei der Beschränkung des entsprechen-den Grundrechtes überhaupt anerkannt sind. Diese Diskus-sion eröffnen Sie aber nur dann, wenn Sie meinem AntragFolge leisten, denn sonst geht das öffentliche Interesse un-ter. Das wird im Nationalrat genau so beschlossen, wie eshier beschlossen wird.2. Herr Bundesrat, wenn Sie die Moral «antüpfen», versteheich das. Ich habe auch etwas gelächelt, als ich das geschrie-ben habe. Aber es ist geltendes Recht, Herr Bundesrat. Ichhabe aus der EMRK wahllos einen Artikel herausgenom-men: Wie kann die Meinungsäusserungsfreiheit, Artikel XYder EMRK, beschränkt werden? Sie werden das so sehen,wie ich es gesagt habe. So weit daneben bin ich also nicht.In der EMRK haben wir aber zu jeder einzelnen Position imGrundrechtskatalog wechselnde Bestimmungen über dieeinschränkenden Gründe, und das wäre hier auch richtigund mindestens im Zweitrat auch noch ernsthaft zu diskutie-ren.Das ist der Grund, weswegen ich Ihnen aus taktischen Grün-den empfehle, meinem Antrag zuzustimmen.
Leuenberger Moritz, Bundesrat: Der Bundesrat hält an sei-ner Formulierung von Artikel 32 nicht fest. Die Kommissionhat alle Elemente übernommen, aber sie anders gegliedert.Die Hauptsache ist, dass alle Elemente drin sind.
Abs. 1, 1ter, 2, 3 – Al. 1, 1ter, 2, 3Angenommen – Adopté
20. Januar 1998 S 55 Bundesverfassung. Reform
Amtliches Bulletin der Bundesversammlung / Separatdruck
Abs. 1bis – Al. 1bis
Abstimmung – VoteFür den Antrag der Kommission 22 StimmenFür den Antrag Schmid Carlo 11 Stimmen
Art. 32aAnträge der Kommissionen: BBlPropositions des commissions: FF
Aeby Pierre (S, FR), rapporteur: D’abord peut-être une re-marque générale concernant ces articles 32a à 32d. Nousavons passablement remanié à la fois le vocabulaire, aussibien dans la langue allemande que dans la langue française,et notamment dans les titres, et nous avons opéré certainessimplifications. Cela a déjà été dit, il est préférable de suivreles textes aussi à partir de l’article 45 et jusqu’à l’article 48 duprojet du Conseil fédéral.D’abord sur la systématique. Nous avons préféré, sans oppo-sition en commission, déplacer ces quatre articles qui traitentde la citoyenneté d’une façon générale, et de la nationalitésuisse, ainsi que du statut des Suissesses et des Suisses del’étranger. Ces articles sont beaucoup plus proches desdroits fondamentaux que nous venons de traiter que placéscomme ils l’étaient auparavant, entre les «Garanties fédé-rales» et les «Relations avec l’étranger». La commission duConseil national ne s’est pas ralliée pour l’instant à cette sys-tématique, mais je crois que nous pouvons considérer tout demême qu’elle est meilleure. Et nous pouvons espérer que,dans la procédure d’élimination des divergences, le Conseilnational adoptera à son tour cette systématique.En ce qui concerne l’article 32a intitulé «Citoyenneté» enfrançais, «Bürgerrecht» au singulier en allemand: comptetenu du fait qu’en allemand le titre du chapitre, désormais 1a,est «Bürgerrechte» au pluriel, nous avons passé ici au singu-lier.A l’alinéa 1er, l’ordre des trois composantes incontournablesdu droit de cité en Suisse – c’est-à-dire le droit de cité com-munal, cantonal et fédéral – a été inversé par rapport au pro-jet du Conseil fédéral. La formulation du Conseil fédéral,dans l’ordre qu’elle adopte: 1. la commune, 2. le canton, 3. laConfédération – et encore pas dans les deux langues! –, estune énumération qui reprend celui de la procédure que nousconnaissons. Nous préférons une formulation de principe oùl’on établit le droit de cité suisse, cantonal et communal, danscet ordre, pour désigner aussi son importance et la valeur in-ternationale du qualificatif de «suisse».Pour l’alinéa 2, il n’y a pas de remarque particulière à formu-ler, si ce n’est qu’en évoquant la réserve pour ce qui con-cerne les dispositions cantonales et communales en relationavec les bourgeoisies et les corporations, la commission pro-pose une formulation plus claire que celle du projet du Con-seil fédéral.Je crois que, sans arrière-pensée, nous pouvons adopter cetarticle 32a.
Angenommen – Adopté
Art. 32bAnträge der Kommissionen: BBlPropositions des commissions: FF
Aeby Pierre (S, FR), rapporteur: En ce qui concerne l’article32b, cela a déjà été évoqué par le président de la commis-sion, nous avons adapté pour une fois le texte allemand autexte français concernant l’acquisition et la perte de la natio-nalité et des droits de cité.A l’alinéa 2, nous avons également dû modifier la terminolo-gie française.Et enfin, à l’alinéa 3, la commission a voulu mentionner ex-pressément la possibilité de la naturalisation des enfantsapatrides. Cet alinéa permet donc de tenir compte d’un voeuassez largement exprimé. Rappelons que, dans la constitu-tion actuelle, la «Heimatlosigkeit» est mentionnée à l’ar-ticle 110 alinéa 2.
Cette proposition n’a pas été adoptée par la commissionsans une discussion assez approfondie. Le résultat du voteétait cependant clair malgré une minorité assez forte qui atoutefois renoncé à présenter une proposition ici.
Leuenberger Moritz, Bundesrat: Ich muss darauf hinweisen,dass Absatz 3, den Sie neu beantragen, eigentlich das Prin-zip der Nachführung verletzt. Sie gehen hier also weiter. An-dererseits muss ich sagen, dass der Antrag internationalenBestrebungen entspricht. Wahrscheinlich hat sich Ihre vorbe-ratende Kommission gesagt, dass sie beim Streikrecht einengravierenden Fehler gemacht habe und diesen jetzt hier wie-dergutmachen wolle. Insofern will ich Ihnen die Gelegenheitzu dieser Wiedergutmachung nicht nehmen und opponierediesem neuen Absatz 3 nicht, obwohl ich dies eigentlich tunmüsste.
Präsident: Ich mache darauf aufmerksam, dass noch derRandtitel übernommen werden müsste, «Erwerb und Verlustdes Bürgerrechtes». Das ist auf der Fahne vergessen wor-den. Ich bitte die Redaktionskommission, dafür zu sorgen,dass der Randtitel übernommen wird.
Angenommen – Adopté
Art. 32cAnträge der Kommissionen: BBlPropositions des commissions: FF
Aeby Pierre (S, FR), rapporteur: Concernant l’article 32c, iln’y a pas beaucoup d’éléments à relever, si ce n’est qu’àl’alinéa 4, la commission a biffé la deuxième phrase du projetdu Conseil fédéral, considérant que celle-ci était, en l’espèce,superflue.
Angenommen – Adopté
Art. 32dAnträge der Kommissionen: BBlPropositions des commissions: FF
Aeby Pierre (S, FR), rapporteur: J’aimerais signaler ici, con-cernant le texte français, que c’est une des dispositions quiva certainement nous occuper ultérieurement, ou occuper laCommission de rédaction. Nous parlons ici en français des«Suisses de l’étranger» et le texte allemand parle très claire-ment d’«Auslandschweizerinnen und -schweizer». C’est undes articles qui a justifié le dépôt de la proposition BrunnerChristiane.Pour le reste, concernant l’alinéa 2bis, la commission a vouluinsister ici sur l’engagement de la Confédération afin de «ren-forcer les liens qui unissent les Suisses de l’étranger entreeux et à la Suisse»; la deuxième phrase a été biffée, étantégalement considérée comme superflue.
Präsident: Ich halte fest, dass auf der deutschen Fahne imGegensatz zur französischen wiederum der Randtitel fehlt.
Angenommen – Adopté
Art. 32eAntrag DaniothTitelBürgerpflichtenWortlautJede Person trägt nach ihren Kräften zur Bewältigung derAufgaben in Staat und Gesellschaft bei.
Proposition DaniothTitreDevoirs civiquesTexteChaque personne contribue, dans la mesure du possible, àl’accomplissement des devoirs dans l’Etat et la société.
Constitution fédérale. Réforme 56 E 20 janvier 1998
Bulletin officiel de l’Assemblée fédérale / Tiré à part
Danioth Hans (C, UR): Ich habe Ihnen einen Antrag zu ei-nem neuen Artikel 32e mit dem Titel «Bürgerpflichten» ge-stellt: «Jede Person trägt nach ihren Kräften zur Bewältigungder Aufgaben in Staat und Gesellschaft bei.» Wie in meinemEintretensvotum angekündigt, erlaube ich mir, diesen Antragzu stellen, um als Grundregel und gleichsam als Kontrapunktzu den zahlreichen Grundrechten eine Grundpflicht in dieVerfassung aufzunehmen.Wir zählen im Verfassungsentwurf über zwanzig Grund-rechte und sonstige Rechte aller Art. Damit wird zwar nichtrevolutionär neues Verfassungsrecht geschaffen, aber dochkodifiziert. Ich habe selbstverständlich nichts gegen die Ver-ankerung dieser heute allgemein anerkannten Grundrechtein der Verfassung einzuwenden, und ich habe ihnen auch zu-gestimmt. Es darf aber nicht das einseitige Bild entstehen,dass der Bürger und die Bürgerin gegenüber dem Staat nurRechte und Ansprüche geltend machen, sich im übrigen abermit mehr oder weniger hohen Steuerabgaben der Verpflich-tungen dem Staat gegenüber ein für allemal entledigen kön-nen.Dass unsere Sozialwerke angesichts der Anspruchsmenta-lität vieler und wegen der demographischen Entwicklungaus den Fugen zu geraten drohen, wird uns gerade heutedrastisch vor Augen geführt. Es fehlt dafür nicht nur dasGeld, sondern – so meine ich – zunehmend auch die Bereit-schaft zu persönlicher Einschränkung und persönlichemOpfer.Es ist heute keine Utopie mehr, angesichts der laufenden Re-duktion der Arbeitszeit und damit der entsprechenden Zu-nahme der Freizeit nicht nur ein sinnvolles Freizeitverhalten,sondern auch eine sogenannte Sozialzeit zu fordern. Ich ver-weise auf das eindrückliche Referat von Herrn Hans Ruh,Professor für systematische Theologie mit Schwerpunkt So-zialethik an der Universität Zürich, anlässlich des GPK-Semi-nars, welches kürzlich stattgefunden hat.Zwar ist einzuräumen, dass bereits heute zahlreiche Men-schen über ihren Familienkreis hinaus in der Gemeinde frei-willige oder sonst ehrenamtliche Arbeit leisten. Doch zu vielestehen noch abseits und betrachten die Gemeinschaft als et-was Aussenstehendes.Der Verfassungsartikel über eine Bürgerpflicht würde dieethische Verpflichtung zu einem persönlichen Beitrag in derkleineren und grösseren Gemeinschaft wenigstens sichtbarmachen. Es handelt sich also nicht um eine durchsetzbareVerpflichtung wie bei den Steuern, zumal auf eine Konkreti-sierung auf Verfassungsstufe bewusst verzichtet wird, wiedies auch bei einzelnen Grundrechten der Fall ist. Diese ethi-sche Grundnorm wäre anderseits aber auch mehr als eineblosse Deklaration schöner Ideale. Die Eigenverantwortungdes Bürgers und der Bürgerin ist direkt angesprochen.Die Bürgerpflicht soll die Bürgerrechte und Grundrechte nichtrelativieren oder einschränken, sondern ergänzen – das zueinem Votum von Kollege Schmid zu anderen Anträgen, vorallem zum Antrag Seiler Bernhard. Diese Bürgerpflicht ent-hält zwei Komponenten: eine Leistungs- und eine Sozialkom-ponente. Die Leistungskomponente besteht darin, dassgrundsätzlich jedem Glied der Gesellschaft ein bescheidenerBeitrag zumutbar ist, eine Leistung, die nicht einfach in Lohnoder anderen Ansprüchen abgegolten wird. Die Sozialkom-ponente kommt im Passus «nach ihren Kräften» zum Aus-druck und besagt, dass nur solche Beiträge erwartet werdenkönnen, die von der körperlichen oder geistigen Leistungsfä-higkeit einer Person her überhaupt möglich sind.Wenn dies nun als Selbstverständlichkeit bezeichnet werdenwill, wie das heute beim Antrag Seiler Bernhard zur ethischenVerantwortung generell als Relation zu den Sozialzielen be-zeichnet worden ist, dann geht mein Vorschlag für eine ethi-sche Norm über das Rechtliche hinaus, obgleich sie nicht er-zwingbar ist. Herr Kollege Rhinow, der Präsident der Kom-mission, hat heute davor gewarnt, dass man rechtlich nichtdurchsetzbare Verpflichtungen in die Verfassung aufnimmt.Ich stelle aber die Gegenfrage unter Berufung auf das gest-rige Votum unseres geschätzten Kommissionspräsidenten,wo er zu einem Höhenflug ansetzte, als er sagte, die Verfas-sung sei zu erneuern und schaffe die Voraussetzungen da-
für, dass das Land sich mit den Grundlagen, mit dem rechtli-chen Fundament und mit den obersten Werten und Prinzi-pien der Schweizerischen Eidgenossenschaft auseinander-setzen könne. Ich pflichte diesem Bekenntnis unseresKommissionspräsidenten bei und meine, dass neben diesenvielen Rechten und als Kontrapunkt zu den Bürgerrechtendiese Bürgerpflicht sehr wohl begründet ist, dies heute unbe-strittenermassen je länger, desto mehr. Ich frage zumSchluss: Wo kann eine derartige Grundnorm, eine Bürger-pflicht, ihren rechtlich richtigen Platz finden, wenn nicht in un-serem Grundgesetz?Ich möchte Sie bitten, meinem Antrag zuzustimmen.
Wicki Franz (C, LU): Ich habe für den Antrag Danioth rechtviel Sympathie. Mit diesem Antrag wird die Mitverantwortungangesprochen, die unseren Staat Schweiz mitprägen soll.Wenn der Staat, und gerade der Wohlfahrtsstaat, funktionie-ren soll, braucht es eine gute Partnerschaft unserer Bürgerin-nen und Bürger bei der Mitgestaltung dieses Staates. Daherwürde es der neuen Verfassung wohl anstehen, wenn wirgrundsätzlich die Verpflichtung der Bürgerinnen und Bürgerfür unseren Staat an geeigneter Stelle in die Vorlage einfü-gen würden. Wenn wir uns vor Augen führen, wie die An-spruchs- und Konsumhaltung zugenommen hat und wie sichviele Mitglieder unserer Gesellschaft zunehmend vom öffent-lichen Leben abkapseln, so ist es auch vom Verfassungge-ber her mit Sicherheit nicht überheblich, grundsätzlich auf dieMitwirkungspflicht aufmerksam zu machen. Wir dürfen undmüssen versuchen, auch verfassungsrechtlich hervorzuhe-ben, dass zwischen individueller Freiheit und Gemeininter-esse ein Gleichgewicht notwendig ist.Der Antrag Danioth geht in diese Richtung, und daher stimmeich ihm zu und bitte Sie, dies Ihrerseits ebenfalls zu tun.
Seiler Bernhard (V, SH): Ich unterstütze den Antrag Danioth,weil er mein Anliegen von heute morgen, das eine gewisseSelbstverantwortung von den Bürgerinnen und Bürgern er-wirken wollte, eben erfüllt. Heute morgen haben verschie-dene Redner, unter anderem auch Herr Bundesrat Koller,die Meinung vertreten, solche Hinweise gehörten nicht in dieBundesverfassung. Ich versuchte Ihnen zu erklären, dassder Bürger und die Bürgerin wohl nachlesen können, wel-chen Zweck die Bundesverfassung haben soll, welcheGrundrechte die Bürgerinnen und Bürger haben, welche So-zialziele vorgesehen seien usw. Ich meine, man darf auchvon den Bürgern eine gewisse Gegenleistung erwarten. Siesollen, wie Herr Danioth das formuliert hat, «nach ihren Kräf-ten zur Bewältigung der Aufgaben in Staat und Gesell-schaft» beitragen. Wenn ich heute morgen von «Futter-krippe» gesprochen habe, so sollte diese Futterkrippe nichtnur vom Bund gefüllt werden müssen, sondern auch von denBürgerinnen und Bürgern. Auch sie müssen nach ihren Mög-lichkeiten eben herangezogen werden; nur dann fühlen siesich in unserem Land auch tatsächlich als aktive Staatsbür-ger.Deshalb bitte ich Sie, den Antrag Danioth zu unterstützen.
Aeby Pierre (S, FR), rapporteur: A mon sens, l’article 32epose en priorité une question de systématique. De plus, je nesuis pas sûr de l’avoir très bien compris. En français, on com-prend qu’il s’agit de devoirs civiques. C’est donc bien res-treint essentiellement aux devoirs de citoyen, c’est-à-dire departiciper à la vie publique d’une façon ou d’une autre et d’ac-complir les devoirs qu’on est en droit d’attendre de chaque ci-toyen moyen.Le but en soi est louable. Je me pose tout de même la ques-tion si c’est au bon endroit que cette proposition est faite et sinous ne devrions pas en parler plutôt au titre 4 traitant del’exercice des droits populaires. Ou alors, si cela va plus loin,ça n’est pas très, très lisible dans la langue française.Par ailleurs, la formulation me paraît sans nuance: «Chaquecitoyen contribue ....» C’est un ordre qui est donné par l’Etatà chaque citoyen ou à chaque personne de contribuer. A par-tir de là, je me pose la question de savoir si un canton ne peutpas édicter une législation prévoyant la mise en application
20. Januar 1998 S 57 Bundesverfassung. Reform
Amtliches Bulletin der Bundesversammlung / Separatdruck
de cet article 32e et donnant des règles plus précises de l’en-gagement de l’individu dans la société. A mon sens, cela meparaît aller beaucoup trop loin, en tout cas de la façon dontc’est écrit ici. Cela mérite une réflexion beaucoup plus fonda-mentale que celle que nous pouvons mener ici en séanceplénière de notre Conseil.Comme rapporteur, je ne peux pas me rallier à cet article32e. Je parle évidemment en mon nom personnel, maisaprès avoir vécu ce genre de discussion dans les nombreu-ses séances de commission. Je vous invite dès lors à rejeterla proposition Danioth.
Rhinow René (R, BL), Berichterstatter: Die Kommissionhatte keine Gelegenheit, zu diesem Antrag Stellung zu neh-men; sie hat aber einen eigentlichen Pflichtenartikel, der sichauf die Einhaltung der Rechtsordnung bezog, diskutiert undabgelehnt; sie hat auch einen Verantwortungsartikel abge-lehnt, wie er heute morgen in verschiedenen Variationen zurDiskussion stand. Im Grunde genommen geht es um eineganz ähnliche Fragestellung wie heute vormittag, und wir ha-ben dort zweimal entschieden, nicht in diese Richtung zu ge-hen und keine Pflichten in allgemeiner Form in die Verfas-sung aufzunehmen. Auch die Kommissionsmehrheit stehtgrundsätzlich auf diesem Boden.Wenn man den vorliegenden Antrag betrachtet, dann hat ernatürlich etwas Sympathisches und Verlockendes, weil wirgewiss alle der Meinung sind, dass unser Gemeinwesen aufdie Mitwirkung und das Engagement des einzelnen angewie-sen ist; dies insbesondere in einer Zeit, in der wir das Gefühlhaben, dass zumindest ein Teil unserer Gesellschaft sichnicht mehr so sehr für diesen Staat engagieren will. Immer-hin muss ich auch beifügen, dass sich ein anderer, notabene beträchtlicher Teil des Volkes sehr wohl aktiv beteiligt,und zwar sowohl in der Politik als auch, in ganz unterschied-lichen Verhältnissen und Bereichen, in der Gesellschaftselbst. Ich glaube also nicht, dass wir ein so verantwortungs-loses Volk geworden sind, wie dies zum Teil angedeutetworden ist.Ich möchte aber ein paar Fragen aufwerfen, um Ihnen kon-kret die Probleme eines solchen Artikels in der Verfassungaufzuzeigen: Erstens steht der Artikel im Bereich des Bürger-rechtes und ist mit «Bürgerpflichten» überschrieben; im deut-schen Text heisst es dann «jede Person», und ich gehe des-halb davon aus, dass nur die Bürger und Bürgerinnen ge-meint sind und die anderen 20 Prozent unserer Gesellschaft«pflichtenlos» sind, wir von ihnen also nichts fordern, auchnicht im Bereich der Gesellschaft. Spitzfindigerweise könnteman Herrn Danioth sogar fragen, was er mit den Ausland-schweizern vorhat, die auch Bürger sind: Müssen diese in ih-rem Staat oder allenfalls in der Schweiz ihre entsprechendenAufgaben erfüllen? Bei aller Spitzfindigkeit also stellt sich hierzumindest ein Problem der Formulierung.Zweitens frage ich mich, was unter «Aufgaben im Staat» zuverstehen ist: Dieser Antrag ist so vage, dass er eigentlichgar nichts aussagt. Wenn wir sagen wollten, jedermannmüsse stimmen gehen, dann müssten wir zu einer Stimm-pflicht kommen. Dies ist aber offensichtlich nicht damit ge-meint. Wenn wir sagen wollten, jeder müsse irgendwo einAmt übernehmen, müssten wir eine solche Verpflichtung sta-tuieren. Muss er sich in einer Partei engagieren oder zumin-dest Leserbriefe schreiben oder einfach aufmerksam die Zei-tung lesen? Ich sträube mich dagegen, dass der einzelneeine diffuse «staatliche Verpflichtung» hat, im Gemeinwesenmitzuwirken.Ich komme zur nächsten Frage: Was heisst Mitwirkung beider Bewältigung von Aufgaben in der Gesellschaft? Da ma-che ich ein noch grösseres Fragezeichen. Wollen wir dennvon Verfassung wegen dem Bürger sagen, dass er eine Ver-pflichtung habe, in der Gesellschaft irgendwie aktiv zu sein?Ist es nicht gerade der Sinn der Freiheitsrechte, dass wir esden Menschen selbst überlassen, wo, wie und in welchemAusmass sie in der Gesellschaft aktiv sein wollen? Herr Itenhat das richtige Wort geprägt: Unser Staat beruht auf Voraus-setzungen, die er selbst nicht garantieren kann. Wir könnennun nicht all diese Voraussetzungen, die wir nicht garantie-
ren können, in die Verfassung schreiben und auf diese Weiseeinzufangen versuchen.Herr Danioth hat zu Recht gesagt, dass die Bestimmungnicht erzwingbar sei. Er hat mich auch zitiert – ich fühle michgeehrt. Aber ich möchte die Gegenfrage stellen: Es gibt an-dere Wege, Verfassungsnormen oder -gehalte zu berück-sichtigen, auch wenn sie nicht direkt erzwingbar sind. Kannalso das Bundesgericht aufgrund einer solchen Bestimmungbeispielsweise gesetzliche Normen auslegen, jemanden ver-antwortlich machen, weil er sich in Staat und Gesellschaftnicht genügend engagiert habe? Es ist nicht ausgeschlos-sen, dass das dies geschehen könnte, weil es sich um einenVerfassungsgrundsatz handelt. Dies scheint mir eine gefähr-liche Entwicklung zu sein.Wegen einer gewissen politischen Sympathie hätte ich esvorgezogen, dass etwas Ähnliches in der Präambel stünde,indem man dort beispielsweise die Formulierung «im Be-wusstsein, dass unser Gemeinwesen der Mitwirkung allerbedarf» anfügen würde. Damit wäre ein Signal für diese Mit-wirkung gesetzt; man könnte auch die private Verantwortungdort erwähnen. In einem Abschnitt aber, wo es um das Bür-gerrecht geht, wo wir grundsätzlich Rechte regeln, habe ichgrosse Mühe, eine so allgemeine Pflichtennorm mit einer völ-lig anderen Struktur aufzunehmen.
Danioth Hans (C, UR): Herr Kollege Rhinow hat nun in akri-bischer Weise die Einwände aufgezählt. Jeder für sich ge-nommen hat etwas; sie kommen mir aber im gesamten dochetwas formalistisch vor. Diese Norm, die bewusst hinter denBürgerrechten plaziert ist, die generell eine Pflicht beinhaltet,in dieser Gemeinschaft nicht nur entgegenzunehmen, wasder Staat garantiert, sondern sich in der Gemeinde, in derGesundheitspflege, in der Altersbetreuung, in der Rücksichtauf die Behinderten zu engagieren, dies ist nicht ein erzwing-barer Grundsatz. Niemand erwartet, dass man die AHV-Ren-ten oder auch andere Sozialleistungen im Grundsatz undmassgeblich von dieser Bestimmung abhängig macht. Aberes ist nicht mehr und nicht weniger als ein ethischer Impera-tiv, der weiss Gott unserer Verfassung gut anstehen würde,wie andere Bestimmungen, z. B. die Würde des Menschenbetreffend. Dies ist nicht etwas, das man sofort begreifen unddurchsetzen kann. Ich meine, der Ständerat als das Gewis-sen dieses Parlamentes täte gut daran, hier einmal einenPflock einzuschlagen, dann kann man die Positionierung, dieFormulierung, die Ausgestaltung im Zweitrat überprüfen.Ich möchte Sie bitten, sich den von Professor von Matt er-wähnten Ruck zu geben.
Leuenberger Moritz, Bundesrat: Zuerst muss ich darauf hin-weisen, dass die Pflichten der Bürgerinnen und Bürger oderEinwohnerinnen und Einwohner ganz generell auch an ande-rer Stelle festgehalten sind. Das ergibt sich z. B. aus der Prä-ambel, wo von Solidarität und Offenheit gegenüber der Weltund von Verantwortung gegenüber künftigen Generationengesprochen wird. Es ergibt sich auch aus dem Grundsatz vonTreu und Glauben. Oder es ergibt sich etwa aus der Drittwir-kung von Freiheitsrechten. Daneben gibt es auch zahlreichedetaillierte Pflichten: die Schulpflicht, die Steuerpflicht, dieMilitärpflicht. Die Sportpflicht gibt es vorläufig – zum Glück! –noch nicht.Es ist auch richtig, dass der Antrag Danioth vielleicht fragwür-dig plaziert ist, weil ich mir sage: Er ist ja nicht unbedingt einGegenstück zu den Bürgerrechten. Man sagt nicht: Ihr müsstdeswegen in dieser Gesellschaft solidarisch sein, weil ihr dieGnade vom Staat bekommen habt, abstimmen zu dürfen.Das macht es etwas fragwürdig. Aber das sind – wie Sie zuRecht sagen – formelle Einwände.In einer Zeit, wo der Gesprächsstoff an Partys nur davon han-delt, dass man zuviel Steuern zahlen müsse und dass umge-kehrt der Staat zuwenig Autobahnen und zuwenig Flugplätzebaue, also in einer Zeit der völligen Desolidarisierung, habeich schon grosse Sympathie für diesen Grundsatz. Man kannihn ja später noch anderswo plazieren. Ich würde es abernicht übers Herz bringen zu sagen: Stimmen Sie Herrn Da-nioth nicht zu.
Constitution fédérale. Réforme 58 E 20 janvier 1998
Bulletin officiel de l’Assemblée fédérale / Tiré à part
Abstimmung – VoteFür den Antrag Danioth 23 StimmenDagegen 5 Stimmen
Die Beratung dieses Geschäftes wird unterbrochenLe débat sur cet objet est interrompu
21. Januar 1998 S 59 Bundesverfassung. Reform
Amtliches Bulletin der Bundesversammlung / Separatdruck
Vierte Sitzung – Quatrième séance
Mittwoch, 21. Januar 1998Mercredi 21 janvier 1998
08.00 h
Vorsitz – Présidence:Zimmerli Ulrich (V, BE)/Iten Andreas (R, ZG)
___________________________________________________________
96.091
Bundesverfassung.ReformConstitution fédérale.Réforme
Fortsetzung – Suite
___________________________________________________________
A1. Bundesbeschluss über eine nachgeführte Bundesverfas-sung (Titel, Art. 1–126, 185) (Fortsetzung)A1. Arrêté fédéral relatif à une mise à jour de la Constitutionfédérale (titre, art. 1–126, 185) (suite)
Art. 33Anträge der Kommissionen: BBlPropositions des commissions: FF
Antrag RochatRückweisung an die Kommission
Antrag Brunner ChristianeAbs. 1....g. jede ausländische Person sozial und beruflich integriertwird.
Proposition RochatRenvoi à la commission
Proposition Brunner ChristianeAl. 1....g. toute personne étrangère soit intégrée socialement et pro-fessionnellement.
Aeby Pierre (S, FR), rapporteur: Cet article 33 n’est rien deplus, rien de moins non plus que la reconnaissance, au planconstitutionnel, que la Suisse est aussi un Etat social; passeulement un Etat démocratique, pas seulement un Etat libé-ral, mais aussi un Etat social. C’est toute la dimension, c’esttout le prolongement social de la notion de «prospérité com-mune» mentionnée à l’article 2 du projet, cette prospéritécommune qui a un contenu concret, qui a un sens et qu’il fautpouvoir expliquer aux citoyens. C’est également un cataloguede buts sociaux que les pouvoirs publics doivent tenter d’at-teindre dans l’exercice de leurs compétences respectives.L’article 33 regroupe des principes que nous avons déjàaujourd’hui, pour la plus grande majorité, pour la quasi-tota-lité d’entre eux, disséminés en plusieurs endroits dans notreconstitution. Il est fondamental de voir que cet article 33 nefonde aucune compétence de quelque nature que ce soit, nipour la Confédération ni pour les cantons. Il n’y a donc rien,en termes de compétence directe, qui soit énuméré dans cetarticle par rapport aux autres articles de la constitution.D’autre part – c’est l’alinéa 2 et ça me paraît également tout
à fait fondamental –, aucun droit individuel ne peut être déduitde cet article 33. Il convient de poser clairement la limite et ladifférence entre l’article 33 et les droits fondamentaux quenous avons examinés hier. Ces droits fondamentaux peuventfaire, eux, l’objet d’actions en justice, par exemple, et peuventêtre revendiqués comme ayant été violés par n’importe quelcitoyen. Ici, nous ne nous trouvons pas du tout dans ce casde figure.Nous avons eu en commission une très longue discussion.C’est la preuve que certains ou certaines d’entre nous peu-vent se trouver effarouchés par la simple lecture de cequ’est aujourd’hui notre Etat social. C’est la preuve que devoir noir sur blanc la façon dont nous vivons – la Suisse estasociale – effraie encore, malheureusement, une partie duParlement et une partie, plutôt faible à mon avis, de la popu-lation suisse. Je crois qu’on ne peut pas dire, comme cela aété dit en commission, qu’une moitié de la population suisseest favorable à ces buts sociaux et que l’autre moitié estcontre et qu’il s’agit pour nous, aujourd’hui, en quelquesorte, de pile ou face. Non, je crois que c’est aller beaucouptrop loin.La formulation arrêtée par la commission reprend la définitiondu champ d’application qu’on trouve à l’alinéa 1er lettre a duprojet du Conseil fédéral et l’intègre dans un alinéa 1a. Ontrouve là la protection particulière due à la famille, à l’enfantet à la personne âgée. Il n’y a rien de nouveau dans cetalinéa 1a. C’est déjà contenu dans la lettre a du projet duConseil fédéral. Pour le reste, la lettre a, selon la version dela commission, amputée de la partie reprise dans l’introduc-tion, en quelque sorte, est exactement la même que dans leprojet du Conseil fédéral.Les autres lettres – b, c, d, e et f – ont été reprises telles quel-les du projet du Conseil fédéral.Ultime modification: la dernière phrase de l’alinéa 2 a été bif-fée, étant considérée comme pouvant être source de confu-sion. Elle est inutile. Il n’est pas nécessaire de préciser quela loi détermine à quelles conditions un tel droit existe, carcela ressort très clairement du fait qu’il n’y a aucun droit indi-viduel à se prévaloir de ces buts sociaux. La première phrasede l’alinéa 2 est donc suffisante, et c’est dans ce sens que lacommission a biffé la deuxième phrase.Je m’exprimerai d’emblée, si vous le permettez, sur la propo-sition de renvoi Rochat. Aussi bien les experts, que le Conseilfédéral, que l’administration fédérale et, enfin, que notrecommission ont suffisamment réfléchi et débattu de cetarticle 33 pour pouvoir affirmer qu’aujourd’hui il est mûr pourêtre approuvé par notre Conseil, et je ne vois pas très bien lesens du renvoi qui nous est proposé. Je considère que ças’apparente à une manoeuvre qui a quelque chose dedilatoire et, à mon sens, ce serait un signal tout à fait erroné.Si l’on veut braquer la population suisse contre ce projet demise à jour de la constitution, après les décisions que nousavons prises hier notamment de supprimer le mot même de«grève» de notre constitution, comme pour nier une réalitésociologique et juridique très présente, si l’on continue dansce sens – et c’est un peu le signal que donnerait un renvoi àla commission aujourd’hui de l’article 33 –, il y a peu dechance que l’on puisse mener à terme cet exercice, car, rap-pelons-le et ça me paraît fondamental, une Constitution fédé-rale implique un consensus national minimum. Renvoyeraujourd’hui l’article 33, ce n’est pas aller dans le sens de ceconsensus national minimum.
Rochat Eric (L, VD): Je remercie M. Aeby d’avoir supposémes intentions. Nous aurions pu effectivement en parleravant, et je dois m’excuser de ne pas avoir pris contact aveclui: j’ai déposé cet amendement tard hier après-midi.Le chapitre 2 «Buts sociaux» et l’article 33, le seul article qu’ilcontient, sont pour moi un remarquable fourre-tout. Nous ytrouvons en effet:1. des droits et des obligations qui ne sont pas un complé-ment de l’initiative et de la responsabilité privées, et pour les-quels les moyens disponibles ne déterminent pas l’étenduedes mesures législatives. Je pense à l’assurance-vieillesse etsurvivants, à l’assurance-invalidité, à l’assurance-accidents,
Constitution fédérale. Réforme 60 E 21 janvier 1998
Bulletin officiel de l’Assemblée fédérale / Tiré à part
à l’assurance-maladie, l’assurance-chômage, l’assurance-maternité. Il ne s’agit pas vraiment de buts sociaux, il s’agitde réalisations déjà effectuées et d’obligations qui existentdéjà;2. des droits en passe d’être réalisés, en fonction desmoyens disponibles, tels les soins nécessaires à la santé;3. des buts pour lesquels il n’existe aucune base constitution-nelle, telle l’obtention pour chacun d’un logement approprié àdes conditions supportables, ou d’un travail garantissant l’en-tretien à des conditions supportables;4. des droits fondamentaux en devenir, tel le droit à une for-mation continue – la formation initiale étant déjà à disposition;5. des voeux pies, comme d’encourager les jeunes à deve-nir des personnes indépendantes et socialement responsa-bles.C’est donc pour cette raison, Monsieur le Président de lasous-commission, que je souhaite que la commission sepenche à nouveau sur le chapitre 2 et son article 33. En effet,les dispositions qui sont prévues mériteraient d’être séparéesen un ou deux articles déterminant, d’une part, ce qui est déjàeffectué, ce qui est déjà en place – je l’ai énuméré –, d’autrepart, ce qui représente des souhaits ou des buts sociaux,comme le titre du chapitre l’indique. Je souhaite une restruc-turation qui soit plus claire, qui soit plus nette, de cechapitre 2.On pourra en faire deux articles distincts, l’un sur les droits,l’autre sur les buts sociaux. On ne peut tout de même pasmettre sur le même plan et dans la même catégorie l’intégra-tion culturelle et l’AVS! Ce sont tout de même deux chosesqui sont très différentes.Je fais donc la proposition de renvoyer cet article, ou plutôtce chapitre, à la commission pour nouvel examen et, plusspécifiquement, séparation claire des concepts très diffé-rents que contient l’article 33.
Brunner Christiane (S, GE): Nous avons insisté, dans le ca-dre du message et dans le cadre de notre débat d’entrée enmatière, sur le fait que la constitution devait incarner l’héri-tage politique et l’identité de la Suisse, qu’elle devait traduirece qu’elle représente, ce qu’elle est et aussi ce qu’elle doitêtre à l’avenir.Que représente la Suisse aujourd’hui? Elle est notamment lereflet d’une identité multiculturelle, due non seulement à sesdiverses sensibilités nationales, mais également à l’enrichis-sement culturel et social apporté par les personnes étrangè-res qui vivent, pour beaucoup, depuis de nombreuses an-nées dans notre pays. Les étrangers et les étrangères cons-tituent le cinquième de la population résidant en Suisse et lestrois quarts d’entre eux sont au bénéfice d’un permis d’éta-blissement. Dès lors, comme tous les nationaux, leur pers-pective de vie s’inscrit aussi et avant tout dans celle de la par-ticipation au présent et à l’avenir de la Suisse, en qualité d’ac-trices et d’acteurs de son développement, de son futur et deson identité. Les étrangers et les étrangères contribuent àl’essor économique de la Suisse de par leur travail, le paie-ment de leurs impôts, leurs cotisations, leur qualité de con-sommateurs et consommatrices. Les personnes étrangèrescontribuent également à l’essor culturel et participent de l’es-prit innovateur du pays de par leur bagage intellectuel lié àl’histoire de leur pays d’origine et, bien sûr, par leur expé-rience de vie.L’article 33 du projet de Constitution fédérale exprime lafonction sociale que doit assumer l’Etat fédéral. La Confédé-ration et les cantons doivent réaliser certains objectifs so-ciaux. Cette disposition en énumère également les destina-taires, à savoir les personnes vivant dans notre pays pourlesquelles il est nécessaire d’aménager une protection spéci-fique.Le rapport de la Commission fédérale des étrangers, publiéen juin 1996 à la suite d’un mandat confié par le Conseil fé-déral, et intitulé «Esquisse pour un concept d’intégration»,conclut notamment: «L’intégration ne saurait être laissée auhasard ou confiée à la seule responsabilité de chacun.Compte tenu de sa portée pour la société et la politique na-tionale, les conditions de base et les finalités relèvent ici de
la compétence de l’Etat. Les immigrants, qui sont mal inté-grés professionnellement et socialement ou qui ne le sontpas du tout, sont davantage menacés par le chômage et lapauvreté, le besoin d’assistance, la maladie, la toxicodépen-dance et la criminalité.»Le rapport de la commission d’experts présidée par M. KlausHug, publié en 1997, à la suite également d’un mandat confiépar le Conseil fédéral, traduit la même volonté de garantir l’in-tégration des étrangers et des étrangères. Les conclusions etpropositions formulées par ces commissions d’experts man-datées par le Conseil fédéral nous amènent à la conclusion,voire au constat suivant: l’intégration autant sociale que pro-fessionnelle des étrangers et des étrangères s’inscrit indubi-tablement et complètement dans l’esprit de l’article 33 duprojet de Constitution fédérale. L’intégration des étrangers etdes étrangères entre dans le cadre de la fonction sociale quese doivent d’assumer la Confédération et les cantons, fonc-tion qui répond, pour les personnes étrangères comme pourles autres groupes de personnes mentionnés à l’article 33, àun besoin spécifique de protection. L’intégration des étran-gers et des étrangères est un objectif social fondamental enSuisse et c’est à ce titre qu’il doit être inscrit dans la Consti-tution fédérale, parmi les autres objectifs sociaux.Ce sont là les raisons pour lesquelles je vous prie de bienvouloir donner suite à ma proposition qui consiste à vouloirajouter une lettre g à l’alinéa 1er de l’article 33, pour intégrerce nouvel objectif social.
Rhinow René (R, BL), Berichterstatter: Ich äussere mich nurzum Rückweisungsantrag Rochat. Der Antrag Brunner Chri-stiane lag der Kommission nicht vor. Ich kann mich dazu nichtals Kommissionspräsident äussern.Wir haben über diesen Artikel 33 in der Kommission ausführ-lich diskutiert, mit verschiedenen Vorschlägen und Variantender Gliederung. Wir haben in der Kommission auch über ei-nen ähnlichen Wunsch, wie ihn Herrn Rochat jetzt formulierthat, beraten. Ich muss Ihnen sagen, dass es praktisch un-möglich ist, diese Ziele nun fein säuberlich aufzuteilen in er-füllte oder solche, die auf bestem Wege dazu sind, solche,die bereits auf Bundesebene konkretisiert sind und andere,die noch anstehen oder noch kaum realisiert sind. Denn esgeht bei diesen Zielen und ihrer Erfüllung um ein Mehr oderWeniger. Es hat darunter kaum solche, die man als praktischerfüllt abhaken könnte; ebensowenig aber solche, bei denenwir noch gar nichts tun. Bei einem Verhältnis von mehr undweniger können Sie nicht eine kategoriale Trennung in Zieledes Typus A und des Typus B vornehmen.Es kommt ein Weiteres dazu: Wenn wir das versuchen woll-ten, dann müssten wir wiederum zwischen Bund und Kanto-nen aufteilen. Denn wir sprechen hier beide Ebenen an, ge-rade in dieser Offenheit, weil wir nicht die Ausscheidung derKompetenzen zwischen Bund und Kantonen verändern wol-len. Sobald wir aber Ziele, die nicht erfüllt sind, und solche,die erfüllt sind, ansprächen, müssten wir auch hier differen-zieren. Was tut der Bund, und was haben die Kantone getanoder noch nicht getan?Ich möchte Sie im Namen der Kommission bitten, heute zuentscheiden und nicht die ganze Sache an die Kommissionzurückzuweisen.
Leuenberger Moritz, Bundesrat: Wie der Präsident der Ver-fassungskommission dargelegt hat, ist dieser Sozialartikelsowohl in der Vernehmlassung als auch in der Kommissionausführlich diskutiert worden. Nach der Vernehmlassung ister auf Verwaltungsebene nochmals vollständig überarbeitetworden. Es ist nicht einzusehen, was eine Rückweisung anVerbesserungen bringen könnte. Ich schliesse damit nichtaus, dass er nicht noch besser formuliert werden könnte,aber es gibt Momente im Leben, wo man sagen muss: Jetztist etwas ausdiskutiert, jetzt haben wir ein Resultat; es ist viel-leicht nicht maximal, aber doch immerhin optimal.Ich ersuche Sie, auf diesen Artikel einzutreten. Wenn Sie kon-krete Abänderungsanträge hätten, müssten diese vorge-bracht werden, so wie dies Frau Brunner getan hat. Ihren An-trag kann ich nicht unterstützen, und zwar um so weniger, als
21. Januar 1998 S 61 Bundesverfassung. Reform
Amtliches Bulletin der Bundesversammlung / Separatdruck
Sie es gestern beim Diskriminierungsverbot mehrheitlich ab-gelehnt haben, beispielhaft aufzuzählen, welche Gruppen indiesem Lande insbesondere nicht diskriminiert werden dürfen.Bei der Integration geht es natürlich um ein ähnliches Anlie-gen: Wieso – kann man sich fragen – sollen ausgerechnetnur die Ausländerinnen und Ausländer bei den integrations-politischen Bemühungen genannt werden? Behinderte oderDrogenabhängige, die sich wieder integrieren wollen, hättendiesen Anspruch auch. Wieso nennt man sie nicht? DieKompetenz des Bundes, ausländerpolitisch zu handeln, isthinten in Artikel 112 festgehalten. In welchem Ausmasse diePraxis – ich denke an die Eidgenössische Ausländerkom-mission – oder der Gesetzgeber – ich denke an das Anag –die Integration tatsächlich praktiziert bzw. legiferiert, ist derPraxis und dem Gesetzgeber überlassen.
Abstimmung – VoteFür den Antrag Rochat 5 StimmenDagegen 30 Stimmen
Abs. 1a, 1 Bst. a–f, 2 – Al. 1a, 1 let. a–f, 2Angenommen – Adopté
Abs. 1 Bst. g – Al. 1 let. g
Abstimmung – VoteFür den Antrag Brunner Christiane 4 StimmenDagegen 31 Stimmen
Art. 34Anträge der Kommissionen: BBlPropositions des commissions: FF
Rhinow René (R, BL), Berichterstatter: Der 3. Titel («Bundund Kantone») enthält drei Kapitel, ein erstes über das allge-meine Verhältnis von Bund und Kantonen, ein zweites überdie Zuständigkeiten des Bundes und ein drittes über die Fi-nanzordnung. Ich werde dem grossen Umfang dieses Titelsentsprechend meine Vorbemerkungen auf die drei Kapitelaufteilen.Das erste Kapitel regelt die allgemeinen Grundsätze unsererBundesstaatlichkeit. Es knüpft an Artikel 3 an, den wir prak-tisch unverändert im Sinne eines Traditionsanschlusses ausdem geltenden Verfassungsrecht übernommen haben. Die-ses Kapitel basiert auf umfangreichen und intensiven Ge-sprächen zwischen der Bundesverwaltung und der Konfe-renz der Kantonsregierungen, und auch Ihre Kommissionbzw. die zuständige Subkommission hat diesen Kontakt wei-tergeführt, weil es uns ein grosses Anliegen war, dieses Ka-pitel im Einverständnis mit den Kantonen und ihren Vertre-tern auszugestalten. Die Änderungen, die wir beschlossenhaben, haben schlussendlich ebenfalls praktisch alle die Zu-stimmung der Kantone erhalten. Wegleitend war für den Bun-desrat wie für die Kommission, dass wir einen moderneren,gelebten Föderalismus zum Ausdruck bringen können, ins-besondere das kooperative Verhältnis und Zusammenwirkenvon Bund und Kantonen im Geiste der Subsidiarität und derSolidarität.Wo hat nun die Kommission wichtige Änderungen ange-bracht? Einmal hat sie die Systematik im Interesse der Klar-heit und Übersichtlichkeit geändert. Der Bundesrat teilt dieRegeln über die Kompetenzverteilung auf, indem er einer-seits diese Frage bereits in den Absätzen 2 und 3 von Arti-kel 3 anspricht – also in den einleitenden Bestimmungen undausserhalb dieses Kapitels –, anderseits aber dieses Anlie-gen erst in Artikel 35 im zweiten Abschnitt dieses Kapitelsweiterführt und mittendrin einen Artikel über die Zusammen-arbeit zwischen Bund und Kantonen einfügt.Die Kommission hat hier – wie erwähnt – Änderungen ange-bracht. Sie belässt bei den einleitenden Bestimmungen inArtikel 3 nur den Absatz 1 mit dem Grundbekenntnis zumBundesstaat und zur Souveränität der Kantone. Das 3. Ka-pitel beginnt mit einem neuen Abschnitt 1a «Aufgaben vonBund und Kantonen». Hier wird nun die klassische Regel derKompetenzverteilung zwischen den beiden Ebenen festge-
halten, und zwar einerseits in Artikel 34a Absatz 1: «DerBund erfüllt die Aufgaben, die ihm die Bundesverfassung zu-weist.» und andererseits in Artikel 35 betreffend die Kantone,die an sich überall zuständig sind, wo keine Bundeskompe-tenz gegeben ist: Sie bestimmen autonom, «welche Aufga-ben sie im Rahmen ihrer Zuständigkeiten erfüllen» sollen.Darauf folgt der 2. Abschnitt, der im wesentlichen dem bun-desrätlichen Entwurf entspricht. Er enthält allerdings neu ein-leitend den Artikel über die Grundsätze der Zusammenarbeit,nimmt aber den bereits im 1. Abschnitt aufgeführten Artikelüber die Stellung der Kantone nicht noch einmal auf. Derneue Abschnitt 2a ist überschrieben mit «Zusammenwirkenvon Bund und Kantonen». Mit dieser neuen Systematik wirddreierlei erreicht:1. Wie erwähnt wird die Regelung des Verhältnisses vonBund und Kantonen in diesem 1. Kapitel des 3. Titels zusam-mengefasst.2. Ferner wird der Vorrang der Kompetenzverteilungsregelvor den allgemeinen Bestimmungen über die Zusammenar-beit betont, denn bevor Sie die Zusammenarbeit zwischenzwei Grössen regeln können, müssen Sie zuerst definieren,wofür diese Grössen zuständig sind.3. Mit der neuen Überschrift «Zusammenwirken von Bundund Kantonen» wollen wir besser zum Ausdruck bringen,dass es bei den Artikeln 36ff. nicht nur um die Stellung derKantone geht, sondern um Bund und Kantone und um derenZusammenwirken.Ein zweiter Bereich von Änderungen betrifft die Vermeidungunklarer, vieldeutiger neuer Begriffe im Verfassungstext. Sohaben wir zwar Sinn und Geist der Begriffe «Solidarität»,«Subsidiarität» und «Hoheitsrechte» übernommen; diesedrei Begriffe finden Sie im Entwurf des Bundesrates. Aber dieBegriffe selbst haben wir nicht übernommen.Die Idee der Subsidiarität kommt neu zum Ausdruck inArtikel 34a Absatz 2, indem der Bund nur diejenigen Aufga-ben übernehmen soll, «die einer einheitlichen Regelung be-dürfen». Da ist ausgedeutscht, was eigentlich unter Subsidia-rität in diesem Zusammenhang zu verstehen ist.Die Idee der Solidarität wird in Artikel 35a Absätze 1 und 2mit den Formulierungen – ich nenne sie hintereinander – dergegenseitigen Unterstützen, der Zusammenarbeit, der Rück-sichtnahme sowie der «Amts- und Rechtshilfe» eigentlichausreichend verankert. Daneben in diesem Zusammenhangnoch den Grundsatz selbst in seiner Vieldeutigkeit und ver-fassungsrechtlichen Problematik zu erwähnen, schien unswenig zweckmässig zu sein.Auch auf den Begriff «Hoheitsrechte» haben wir verzichtet,weil er mehr als unklar ist und – jedenfalls staatsrechtlich – inder Luft hängt. Wir verwenden zudem den Terminus «Umset-zung» und nicht «Umsetzung und Vollzug», weil Vollzug ei-gentlich zur Umsetzung gehört. Dies nur, damit keine Fragenauftauchen.Schliesslich hat die Kommission in diesem 1. Kapitel dreiNeuerungen beschlossen, auf die ich Sie hinweisen möchte:Erstens finden Sie in Artikel 37 Absatz 3 eine Verpflichtungdes Bundes, den Kantonen ausreichende Finanzierungs-quellen zu belassen; das ist mehr als nur auf finanzielle MittelRücksicht zu nehmen.Zweitens hat die Kommission in Artikel 41 Absatz 2 den Ge-meinde- und Städteartikel eingeführt, der dann allerdingsnoch mit der Erwähnung der Berggebiete angereichertwurde.Drittens haben wir in Artikel 33 Absatz 3 bei Gebietsverände-rungen zwischen Kantonen das Erfordernis des fakultativenReferendums beschlossen. Heute gilt hier das Obligatoriumvon Volk und Ständen, wie wir spätestens seit dem Kantons-wechsel der Gemeinde Vellerat zur Kenntnis genommen ha-ben.Schliesslich darf ich in Erinnerung rufen, dass wir den5. Abschnitt des bundesrätlichen Entwurfes über das Bürger-recht bereits im 2. Kapitel behandelt haben; er ist also hiernicht mehr aufzunehmen.
Aeby Pierre (S, FR), rapporteur: Je peux me limiter à quel-ques commentaires très brefs et je vais commenter, en com-
Constitution fédérale. Réforme 62 E 21 janvier 1998
Bulletin officiel de l’Assemblée fédérale / Tiré à part
plément de ce que vient de dire le président de la commis-sion, M. Rhinow, les articles 34a à 40. Ensuite, je reprendraila parole lorsque vous examinerez l’alinéa 2 de l’article 34a,pour développer ma proposition de minorité.Il suffit de signaler, en complément de ce qui a déjà été dit defaçon extrêmement complète, que l’article 34a alinéa 1er re-prend l’article 3 alinéa 2 du projet du Conseil fédéral, confor-mément à la systématique qui vous a déjà été expliquée.En ce qui concerne l’article 35: le terme de «subsidiarité» adisparu dans l’ensemble de ce chapitre, considérant qu’ils’agissait là d’une notion plutôt floue. En revanche, le prin-cipe de la subsidiarité est présent dans presque chaque dis-position. Ici on a le principe que les cantons sont compétentspour définir eux-mêmes les tâches qu’ils accomplissent dansle cadre de leur sphère propre.En ce qui concerne l’article 35a «Principes»: c’est du droitconstitutionnel non écrit, mais c’est l’expression très fidèle del’acquis suisse, ou de la réalité constitutionnelle vécue.L’alinéa 1er correspond à l’article 34 alinéa 1er du projet duConseil fédéral, l’alinéa 2 correspond à l’article 34 alinéa 2de ce même projet. Comme tel, l’article 34 alinéa 4 du projetn’a pas été repris, considérant qu’il allait de soi que les diffé-rends entre cantons et Confédération doivent d’abord être ré-glés par la négociation.En ce qui concerne l’article 36: il est peut-être utile de signa-ler quelques exemples concrets de cette participation descantons, prévue par la Constitution fédérale, au processusde décision fédérale: notamment l’article 50 – la politiqueétrangère, on sera amené à en reparler –, l’article 131 «Ré-férendum facultatif en matière législative» – possibilité pourhuit cantons d’exercer ce droit –, l’article 132 – la majoritédes cantons dans une partie de nos votations –, et, enfin, onpeut également citer l’initiative cantonale à l’article 151.En ce qui concerne l’article 37: nous avons considéré quel’exécution était déjà comprise dans la mise en oeuvre, c’estpour ça que, dans le titre, vous ne retrouvez pas ce termed’«exécution». Je peux peut-être répéter que les cantons setrouvent renforcés dans leur sphère d’activité, notammentpar l’alinéa 3 de l’article 37, en ce sens qu’on fait allusion aux«sources de financement suffisantes» que la Confédérationdoit impérativement leur laisser, ce qui est beaucoup plusque simplement la notion de «moyens».
Angenommen – Adopté
Art. 34aAnträge der Kommissionen: BBlPropositions des commissions: FF
Abs. 1 – Al. 1Angenommen – Adopté
Abs. 2 – Al. 2
Aeby Pierre (S, FR): C’est à dessein que j’ai commenté l’en-semble du chapitre tout à l’heure pour que nous puissionsbien nous rendre compte combien le principe de subsidiaritéest présent. Je rappelle qu’aussi bien l’article 37 quel’article 38 donnent une large place à la compétence canto-nale.Il m’a semblé, et c’est un point de vue partagé par une mino-rité importante de la commission – le résultat du vote en com-mission a été de 8 voix contre 6 –, que l’alinéa 2 était formuléde manière restrictive, presque négative serais-je tenté dedire: la Confédération «n’assume que (’nur’) les tâches quiréclament une réglementation uniforme». On pourrait dire lamême chose, mais de façon beaucoup plus positive: la Con-fédération «assume les tâches qui réclament une réglemen-tation uniforme». Ça ne change pas à proprement parler lesdomaines de compétence dans ce chapitre. Ces derniers dé-coulent bien plus des articles 37 et 38 que de l’article 34a quipose simplement le principe. C’est une façon positive d’énon-cer ce principe. Nous sommes quand même une petite na-tion, un petit Etat de sept millions d’habitants: nous ne pou-vons pas continuer à vivre constitutionnellement et légale-
ment notre réalité avec une définition aussi négative du pou-voir de la Confédération.Je vous invite à suivre la forte minorité de la commission et àaccepter la formulation positive de ce principe.
Leuenberger Moritz, Bundesrat: Ich beantrage Ihnen eben-falls, der Minderheit zu folgen, wissend, dass der Unter-schied nicht gewaltig ist. Aber die Formulierung der Minder-heit ist etwas schlanker und sieht nicht ganz so restriktiv auswie diejenige der Mehrheit. Am Hauptakzent der Subsidiaritätwird in keinem Fall etwas geändert. Es wird letztlich immereine politische Ermessensfrage sein, in welchem Fall derBund tätig werden will. Aber die Formulierung der Minderheitist schöner.
Abstimmung – VoteFür den Antrag der Mehrheit 27 StimmenFür den Antrag der Minderheit 7 Stimmen
Art. 35, 35a, 36–40Anträge der Kommissionen: BBlPropositions des commissions: FF
Angenommen – Adopté
Art. 41Anträge der Kommissionen: BBlPropositions des commissions: FF
Antrag UhlmannAbs. 2Streichen
Antrag RochatAbs. 2Der Bund berücksichtigt bei der Erfüllung seiner Aufgabendie besonderen Interessen der Gemeinden, vor allem solcherin städtischen Agglomerationen und im Berggebiet.
Proposition UhlmannAl. 2Biffer
Proposition RochatAl. 2Dans l’accomplissement de ses tâches, la Confédérationprend en considération les intérêts particuliers des commu-nes, dans les agglomérations urbaines et les régions de mon-tagne tout spécialement.
Aeby Pierre (S, FR), rapporteur: Dans cette section 3, qui n’aqu’un article, il s’agit d’introduire dans la constitution la troi-sième entité, le troisième niveau du pouvoir public dans notrepays, la commune. Ce faisant, il est bien clair que la com-mune ne peut avoir le même statut qu’un canton dans notreconstitution et que le pouvoir communal, l’autonomie com-munale sont entièrement aménagés par les diverses législa-tions cantonales. Ici, nous n’avons pas suivi les voeux descommunes suisses, ceux de l’Union des villes suisses no-tamment, qui auraient souhaité un partenariat plus direct en-tre l’échelon communal et l’échelon fédéral. Cela me semblejuste, en l’espèce, de bien voir que, si la constitution recon-naît l’entité «commune» comme telle, il n’y a aucun lien directentre la commune et la Confédération, et cela reste dans lasphère des cantons.Voilà pour l’instant, Monsieur le Président. J’enchaîne parcequ’il est difficile de dissocier la proposition de la majorité dela commission de ma proposition de minorité.Il y a ici, à mon sens, un léger dérapage par rapport à uneproposition faite en sous-commission qui était d’introduire,d’une manière ou d’une autre, la notion de «ville» dans laConstitution fédérale, de l’introduire en tenant compte du faitde la réalité économique, de la réalité politique, de la réalitéculturelle et sociale que représente la structure urbaine,aujourd’hui, dans la Suisse de cette fin du XXe siècle. Il n’y
21. Januar 1998 S 63 Bundesverfassung. Reform
Amtliches Bulletin der Bundesversammlung / Separatdruck
avait pas d’autre intention que de prendre acte du fait que laSuisse est majoritairement un pays urbain, un pays de villeset d’agglomérations petites ou moyennes à l’échelon euro-péen. En fait, la ville vue comme la concrétisation d’une cer-taine catégorie de communes bien spécifique.Il ne s’agissait pas du tout – parce qu’on a l’impression ici quela minorité veut supprimer la mention des régions de monta-gne et du soutien aux régions de montagne – de faire, danscet article, de la politique structurelle, de la politique conjonc-turelle ou de la péréquation. D’ailleurs, nous avons dans leprojet de constitution, à l’article 91, les principes de based’une politique de soutien aux régions économiquement fai-bles. Nous avons, à l’article 92, les principes de base d’unepolitique structurelle qui mentionne expressément les ré-gions de montagne, et nous avons à l’article 126 – péréqua-tion financière – également une mention de ces régions quiméritent une certaine aide. Donc, il ne s’agit pas ici d’un do-maine de politique conjoncturelle ou structurelle, si bienqu’on ne voit pas trop pourquoi l’on parlerait de régions demontagne.Il ne s’agit pas non plus de dire: les villes ont besoin d’uneaide structurelle comme les régions de montagne. Non, lesvilles n’ont pas besoin d’une aide structurelle dans notrepays. En ce sens, je suis aujourd’hui assez partagé. Si l’onintroduit la notion de «régions de montagne», alors mieuxvaut, à la limite, s’en tenir à la version du Conseil fédéral.Il y a une autre subtilité. Une partie de la commission a insistépour que le mot «ville» ne figure surtout pas dans la constitu-tion. La proposition de la majorité de la commission parled’«agglomérations urbaines». Le mot «ville» a disparu. Celacorrespond à une sensibilité que, personnellement, je necomprends pas. Est-ce qu’on a peur aujourd’hui en Suisse deparler de «ville»? Je viens personnellement d’un canton oùnous avons des villes, des agglomérations urbaines et aussides régions de montagne, où nous cohabitons avec ces ré-gions de montagne. La région de montagne n’a rien à voiravec la commune! C’est un corps étranger dans ce concept.A mon avis, il faut soit revenir à la version du Conseil fédéral,soit adopter la proposition de minorité.Actuellement, la proposition de la majorité de la commissionà l’alinéa 2 ne correspond pas à l’idée initiale. Je pose laquestion avant de terminer: pouvons-nous vraiment éviter lemot «ville»? Sommes-nous à ce point complexés de par no-tre histoire, par rapport à l’expression même de «ville» enSuisse aujourd’hui, que nous avons peur de mettre ce motdans la constitution? Je ne l’espère en tout cas pas.J’espère que ma proposition de minorité obtiendra votre sou-tien.
Rochat Eric (L, VD): La proposition de la majorité de la com-mission et la proposition de la minorité présentent toutes lesdeux et des avantages et des inconvénients. Ma propositiontendrait à réunir les avantages en une seule formulation et àen supprimer ce que je considère comme des inconvénients.Prenons tout d’abord la proposition de la majorité de la com-mission: «Dans l’accomplissement de ses tâches, la Confé-dération prend en compte les exigences des communes, enparticulier pour les agglomérations urbaines et dans les ré-gions de montagne.» Avantage: il est juste demandé à laConfédération de se préoccuper, dans l’accomplissement deses tâches, des souhaits et de la situation particulière descommunes. Il est vrai que les communes des agglomérationsurbaines et celles des régions de montagne, vu l’incidenceplus importante et plus fréquente d’actions de la Confédéra-tion, sont à mettre en évidence dans ce souci fédéral. Incon-vénient: que ce soit l’expression «prendre en compte», quece soit «les exigences des communes», la proposition de lamajorité de la commission donne presque un mandat à laConfédération et reconnaît aux communes le droit d’avoirdes exigences à son égard. C’est à mon avis aller trop loindans la relation directe commune/Confédération, et une for-mulation moins contraignante pour la Confédération doit êtrerecherchée.Prenons ensuite la proposition de la minorité: «La Confédé-ration et les cantons prennent en considération la situation
particulière des villes et agglomérations urbaines.» Avan-tage: nous ne retrouvons pas «prise en compte», nous ne re-trouvons pas «exigences». Inconvénient: la proposition de laminorité va nettement plus loin que celle de la majorité de lacommission, dans le sens où elle a un caractère général quin’est pas limité à l’accomplissement des tâches fédérales.Elle omet, par ailleurs, les communes de montagne dont jesouligne encore leurs relations fréquentes avec la Confédé-ration dans le cadre de l’agriculture, du paysage, de l’armée,que sais-je encore.Je vous propose donc une version combinée qui limite lesouci de la Confédération aux secteurs dans lesquels elle ades tâches à accomplir, qui adoucit son devoir d’attention enle faisant passer de la prise en compte à la prise en considé-ration, qui ne retient que les intérêts particuliers et rejette lesexigences dont nous pouvons admettre qu’elles doivent pas-ser par le canton, qui retient finalement le caractère particu-lier des relations des communes de montagne et de cellesdes agglomérations urbaines avec la Confédération: «Dansl’accomplissement de ses tâches, la Confédération prend enconsidération les intérêts particuliers des communes, dansles agglomérations urbaines et les régions de montagne toutspécialement.»Je vous recommande de soutenir ma proposition.
Uhlmann Hans (V, TG): Ich gehe davon aus, dass der Bun-desrat an seiner Version festhält, wonach die Organisationder Gemeinden und deren Autonomie ganz klar in den Hän-den der Kantone liegt. Darum kann ich mich kurz fassen. Ichgehe davon aus, dass der Bundesrat dann seine Version ver-teidigt und dafür weitere Argumente liefert.Mir geht es vor allem darum, dass aufgrund des neuenAbsatzes 2 gemäss Kommissionsmehrheit nicht Gemeindenzweier Klassen in der Verfassung stipuliert werden. Esheisst hier «insbesondere in städtischen Agglomerationenund in Berggebieten». Von anderen Gemeinden, die viel-leicht ebenso berücksichtigt werden sollten – Rand- oderGrenzgemeinden oder Grenzgebiete –, wird kein Wort ge-sagt.Ich meine, die Umschreibung der Stellung und Organisationder Gemeinden sei wirklich Sache der Kantone, allein derKantone. Ein sogenanntes Bundesgemeindegesetz – das istes fast – entspricht der Stellung der Gemeinden als Gebiets-körperschaften und Strukturelemente der Kantone nicht. Dasgeht über die Nachführung hinaus. Schon bisher ist die Stel-lung der Gemeinden je nach Kanton sehr unterschiedlich.Das liegt in der Natur der Sache. Ostschweizer Gemeindenverfügen gegenüber Westschweizer Gemeinden über einewesentlich grössere Autonomie.Ich wende mich insbesondere entschieden gegen die Bevor-zugung von Gemeinden in städtischen Agglomerationen undin Berggebieten. Was heisst das überhaupt? Welche Ge-meinden zählen zu den städtischen Agglomerationen undwelche Kriterien gelten für die Ausscheidung von Berggebie-ten? Spielt der Produktionskataster gemäss Landwirtschafts-gesetz eine Rolle? Welche Kriterien ziehen Sie hier bei? Ge-biete im Mittelland – natürlich auch im Thurgau, das verhehleich nicht – würden hier einmal mehr nicht erwähnt. Es istüberhaupt nicht einzusehen, weshalb Randgebiete wie unserKanton nicht auch berücksichtigt werden sollten.Ich meine jedoch – das ist meines Erachtens die saubersteLösung –, dass auf die Erwähnung solcher Spezialanliegengenerell im Sinne des bundesrätlichen Entwurfes zu verzich-ten ist. Weder die Stadt Basel noch St. Moritz verdienenmehr Rücksichtnahme als Kreuzlingen oder eine Landge-meinde im bernischen Mittelland. Nach meiner Erfahrung be-deutet eine solche Rücksichtnahme vermehrte finanzielleUnterstützung und kaum etwas anderes.Das Problem der Kernstädte und Agglomerationen und auchder Berggebiete berührt wichtige kantonsinterne Fragen desFinanzausgleichs, der Gemeindeorganisation, aber auch derinterkantonalen Zusammenarbeit. Diese zu regeln, über-steigt die Nachführung in dieser Verfassung. Das gehört indas Projekt «Neuer Finanzausgleich». Davon wird ja nichtnur gesprochen; dieser neue Finanzausgleich ist jetzt in Be-
Constitution fédérale. Réforme 64 E 21 janvier 1998
Bulletin officiel de l’Assemblée fédérale / Tiré à part
ratung, und zwar in Zusammenarbeit mit den Kantonen, mitden Städten und mit den Gemeinden.Mit der Formulierung der Mehrheit, mit der besonderen Er-wähnung der Gemeinden in städtischen Agglomerationen undin Berggebieten, werden die restlichen Gemeinden – diesestellen vielleicht sogar bald eine Minderheit dar – benachtei-ligt, um nicht zu sagen diskriminiert. Ich glaube, klar dargelegtzu haben, dass diese Formulierung, welche in Absatz 2 vonder Mehrheit, aber auch von der Minderheit Aeby und vonHerrn Rochat in seinem Antrag vorgesehen ist, falsch ist.Ich hätte mich bereit erklären können – das wäre wahrschein-lich eine Zwischenlösung gewesen –, wenn man nur den er-sten Halbsatz bis zum Komma belassen hätte: «Der Bundnimmt bei der Erfüllung seiner Aufgaben Rücksicht auf dieAnliegen der Gemeinden.» Das wird er ohnehin tun müssen.Alles weitere gehört nicht in die Verfassung.Ich bitte Sie, meinem Antrag zuzustimmen.
Rhinow René (R, BL), Berichterstatter: Kurz etwas zum An-trag Rochat: Wenn ich den Antrag und dessen Begründungrichtig verstanden habe, dann bezieht er sich eigentlich aufden französischen Text, denn in der deutschen Fassung sind«Rücksicht nehmen auf die Anliegen» und «die Interessenberücksichtigen» praktisch dasselbe.Wie mir aber Herr Rochat erklärt hat, hat er den Antrag vorallem bezüglich des französischen Textes formuliert, wo inder Tat eine Differenz zwischen seiner Version und dem vonder Kommissionsmehrheit beschlossenen Text besteht. Wirkönnen den Antrag bezüglich der französischen Fassung an-nehmen. Ich werde mich also dem Antrag nicht widersetzen,weil er – jedenfalls für die deutsche Sprache – keine Ände-rung bringt.
Rochat Eric (L, VD): Je remercie M. Rhinow, président de lacommission. Effectivement, ne disposant pas des deux tex-tes au départ, je n’ai pas pu m’en rendre compte. Dans letexte français, on parle «des exigences des communes»,«die Forderungen». Je crois que ce n’est pas du tout le sensdu texte allemand. Il y a donc un problème de traduction et,effectivement, quand je propose «des intérêts particuliers»,je rejoins à ce moment-là, sans le savoir, la traduction inté-grale du texte allemand. Je pense que si nous pouvions ad-mettre de revoir la traduction en français de cet article, con-formément au texte allemand qui a été établi, je peux retirermon amendement.
Aeby Pierre (S, FR), rapporteur: M. Rochat a raison. Sa pro-position correspond à la traduction exacte du texte allemandde la proposition de la majorité de la commission.
Präsident: Der Antrag Rochat bezieht sich somit nur auf denfranzösischen Text.
Loretan Willy (R, AG): Ich möchte vorerst meiner Zufrieden-heit darüber Ausdruck geben, dass unsere vorberatendeKommission die Kernanliegen meiner Motion vom 22. Juni1995 zum Thema «Föderalistische Zusammenarbeit im Bun-desstaat» im wesentlichen aufgenommen hat. Damit lege ichgleichzeitig meine Interessenbindung erneut offen, die Sie imübrigen im Amtlichen Bulletin unseres Rates vom 12. De-zember 1995 nachlesen können. Ich war seinerzeit Mitglieddes Vorstandes des Schweizerischen Städteverbandes. Ichbin zurzeit noch einer der Vizepräsidenten der parlamentari-schen Gruppe Kommunalpolitik, und ich war, wie Sie viel-leicht wissen, während Jahren Gemeindepräsident, wie vielevon Ihnen das wohl auch gewesen sind.Ich darf kurz rekapitulieren: Die Motion vom 22. Juni 1995war von 19 Kolleginnen und Kollegen mitunterzeichnet wor-den, aus heutiger Sicht betrachtet neckischerweise auch vonHerrn Kollege Uhlmann. Man kann natürlich seine Meinungändern. Er hat sich am Schluss seines Votums vor allem aufgewisse Formulierungen in Artikel 41 Absatz 2 bezogen. Ichkomme darauf zurück.Die Motion wollte den Bundesrat beauftragen, im Rahmendieser Totalrevision die folgenden drei Grundsätze zur Stel-
lung und Funktion der Gemeinden verfassungsrechtlich zuverankern:1. Bund und Kantone und, als Bestandteile der Kantone, dieGemeinden teilen sich in die Aufgaben des gesamtstaatli-chen Gemeinwesens. Das hätte die Kommission eigentlichim Artikel 35a verankern sollen. Es fand nicht statt. Es gibt imNationalrat entsprechende Anträge. Wir werden vermutlichim Rahmen der Differenzbereinigung noch darauf zu spre-chen kommen. Ich habe deshalb bei Artikel 35a auf einenAntrag verzichtet.2. Der Bund trägt bei der Schaffung von neuen Rechtsgrund-lagen sowie bei der Planung und Verwirklichung von öffentli-chen Werken den möglichen Auswirkungen auf die Kantoneund Gemeinden Rechnung.3. Die Bundesverfassung gewährleistet die Autonomie derGemeinden, dies im Rahmen der Gesetzgebung der Kan-tone. Die Gemeinden können die Verletzung ihrer Autonomiemit staatsrechtlicher Beschwerde beim Bundesgericht an-fechten, dies nicht nur gegenüber den Kantonen, sondern –neu – auch gegenüber dem Bund.Die Debatte über diese Motion fand am 12. Dezember 1995statt. Der Vorsteher des Eidgenössischen Justiz- und Polizei-departementes, Herr Bundesrat Koller, betrachtete diePunkte 1 und 2 der Motion als weitestgehend dem Ist-Zu-stand entsprechend. Ihre Verankerung in der Bundesverfas-sung hätte, wie er sagte, eher deklamatorischen Charakter.Sie hätten daher – so meine Schlussfolgerung – vom Bun-desrat eigentlich problemlos in die neue Bundesverfassungeingefügt werden können, was ja nun gemäss Antrag derKommissionsmehrheit geschehen soll. Das ist, Herr KollegeUhlmann, Nachführung ungeschriebenen Verfassungsrech-tes.Der Punkt 3 der Motion, wonach die Gemeindeautonomieneu auch gegenüber den Bundesbehörden zu gewährleistensei, enthalte, sagte damals Herr Bundesrat Koller, «politi-schen Zündstoff» und werfe sehr heikle staatspolitische Fra-gen auf. Dies sei der Grund, weshalb sich der Bundesrat ei-nerseits problem- und projektbezogen um eine immer inten-sivere Zusammenarbeit zwischen den drei staatlichen Ebe-nen bemühen werde, weshalb aber andererseits verfas-sungsrechtliche Neuordnungen nur in enger Zusammenar-beit mit den Kantonen realisierbar wären. Das ist geschehen,und zwar in engem Kontakt zwischen dem Bundesrat undden Kantonen und insbesondere auch im Kontakt unsererVerfassungskommission mit der Konferenz der Kantonsre-gierungen. Die Motion wurde auf Drängen von BundesratKoller und auf mein Nachgeben hin ohne Widerspruch alsPostulat überwiesen.Anlässlich des Vernehmlassungsverfahrens zur Totalrevi-sion wünschten die Kommunalverbände – der Schweizeri-sche Städteverband und der Schweizerische Gemeindever-band – die Aufnahme von vier Grundsätzen in die Bundes-verfassung, welche die Existenz und die Mitwirkung der Ge-meinden im dreistufigen Bundesstaat anerkennen. Sieentsprachen den Forderungen meiner Motion.Am 25. April 1997 deponierten sodann die beiden Verbändebei den Parlamentsdiensten zuhanden der Verfassungskom-missionen eine von 1700 von insgesamt knapp 3000 Exeku-tiven von Städten und Gemeinden unterschriebene Erklä-rung zur Revision, welche die Forderungen der Verbände un-terstützte.In seinem Entwurf zur nachgeführten Verfassung nahm derBundesrat keine der zentralen Forderungen der Städte undGemeinden auf, wie ich sie in meiner Motion vertreten hatte.Er war dazu auch nicht verpflichtet, weil meine Motion ledig-lich als Postulat überwiesen worden war. Man sieht, neben-bei bemerkt, welche Kraft überwiesene Postulate haben odereben nicht haben.Zum Kern der Sache: Es ist anzuerkennen, dass der Bundes-rat in Artikel 41 seines Entwurfes ungeschriebenes Verfas-sungsrecht nachführt. Die Kommission hat das übernom-men, indem die Gemeindeautonomie in Verbindung mit Ar-tikel 177 – betreffend die Verfassungsgerichtsbarkeit – nunbundesrechtlich anerkannt und garantiert wird. Die Gemein-deautonomie erhält verfassungsrechtlichen Schutz gegen-
21. Januar 1998 S 65 Bundesverfassung. Reform
Amtliches Bulletin der Bundesversammlung / Separatdruck
über den Kantonen, indessen nicht, wie es die Motion for-derte, gegenüber den Bundesbehörden.Meine Frage, Herr Kommissionspräsident Rhinow, ist nun,warum eigentlich die Gemeindeautonomie nicht auch gegen-über den Bundesbehörden garantiert werden soll. Dies ist inbeiden Räten noch zu klären.Die Verfassungskommission unseres Rates hat, wie derBundesrat, im neuen Artikel 35a – bzw. Artikel 34 gemässEntwurf des Bundesrates – die Gemeinden nicht explizit auf-geführt, was mit Blick auf Artikel 41 eigentlich folgerichtiggewesen wäre. Zentral ist indessen, dass im neuen Ab-satz 2 dieses Artikels 41 gemäss Kommissionsmehrheit dieInteressen der Gemeinden ausdrücklich erwähnt werden.Das Prinzip der Rücksichtnahme auf die «Anliegen der Ge-meinden» – «les exigences des communes» ist etwas stär-ker, wie Herr Rochat den französischen Text zu Recht ge-rügt hat – ist realisiert, diese Angelegenheit ist nunmehr be-reinigt. Der Bund hat bei seiner Aufgabenerfüllung auf die In-teressen bzw. die Anliegen der Gemeinden Rücksicht zunehmen.Die ausdrückliche Erwähnung der städtischen Agglomeratio-nen, daran stösst sich vor allem Herr Uhlmann, rechtfertigtsich von der Tatsache her, dass viele nationale Problembe-reiche hier konzentriert anfallen und der Lösung harren; zudenken ist etwa an Raumplanungs-, Umwelt-, Verkehrs- undFinanzprobleme. So lässt sich insbesondere die Neuordnungdes bundesstaatlichen Finanzausgleichs nicht ohne den Ein-bezug und die Mitwirkung der Gemeinden und insbesondereder Städte und ihres Agglomerationsumfeldes bewältigen.Das wird dann in Artikel 126 des Entwurfes, beim Finanzaus-gleich, nachzutragen sein. Ein Antrag, nicht von meinerSeite, ist unterwegs.Die Berggebiete, ebenfalls in Absatz 2 von Artikel 41 aus-drücklich erwähnt, geniessen zwar bereits heute den beson-deren Schutz und die entsprechende Zuneigung des Bun-des. Gegen ihre Erwähnung in der von der Kommissions-mehrheit vorgeschlagenen Formulierung ist indessen nichtseinzuwenden.Wir kennen bereits die Anträge der nationalrätlichen Verfas-sungskommission zu den Artikeln 34 bzw. 35a und 41. Diebeschlossenen Formulierungen kommen den Forderungender Kommunalverbände noch mehr entgegen, wobei aller-dings nur eine Kommissionsminderheit in Artikel 34 bzw. 35adie Gemeinden als Aufgabenträger bei der Erfüllung öffentli-cher Aufgaben nebst Bund und Kantonen erwähnt haben will.Ich habe heute bewusst auf Anträge verzichtet, weil wir – da-bei schliesse ich die Kommunalverbände ein – mit der Fas-sung unserer Kommissionsmehrheit leben können. Ichmöchte aber ausdrücklich von irgendwelchen Abschwächun-gen abraten. Solche werden uns in einem Brief, der uns Endeder letzten Woche von der Konferenz der Kantonsregierun-gen (KdK) zugestellt wurde, sinngemäss empfohlen, wenndie KdK darin nach wie vor die Fassung des Bundesrates vonArtikel 41 befürwortet, also mit anderen Worten gegen denneuen Absatz 2 Position bezieht.Dies ist die eine Seite des Briefes. Die andere ist indessendie: Die KdK ersucht uns, «nicht über den Antrag der stände-rätlichen Kommission hinauszugehen». Damit akzeptiert siedie Lösung unserer Kommissionsmehrheit als Kompromiss-formel, der ich mich anschliessen könnte.Wichtig ist die Mitteilung der KdK, wonach sie mit dem Städ-teverband übereingekommen ist, den Dialog fortzusetzenund die Probleme aufgabenbezogen anzugehen. Von einemWiderstand der Kantone gegen den neuen Absatz 2 kannalso nicht die Rede sein.Ich bitte Sie daher, heute nach dem Grundsatz «Leben undleben lassen» den Anträgen der Kommissionsmehrheit zuzu-stimmen. Ich behalte mir vor, im Rahmen der Differenzberei-nigung noch bessere Formulierungen aus dem Nationalrat zuunterstützen. Damit habe ich auch gesagt, dass der AntragUhlmann abgelehnt werden sollte. Herr Uhlmann hat immer-hin signalisiert, dass er mit einem Kompromiss leben könnte,wenn man die Verweise nach dem Ausdruck «insbesondere»wegliesse. Das ist eine interessante Bemerkung mit Blick aufdie Differenzbereinigung.
Eine totale Streichung von Absatz 2 würde aber den zwi-schen Kommission, Kantonen, den beiden Kommunalver-bänden, den Städten und Gemeinden erzielten Konsens ge-fährden. Davor warne ich.Ich bitte Sie also, bei Absatz 2 von Artikel 41 dem Antrag derMehrheit zuzustimmen.
Uhlmann Hans (V, TG): Ganz kurz zu meinem Kollegen Lo-retan: Ich habe die Motion unterschrieben, weil sie die Anlie-gen und die Autonomie der Gemeinden betrifft. Es steht inder Motion nichts von Gemeinden verschiedener Klassen.Nun soll dies jedoch im Verfassungstext geschehen. Das ist,was mich an der ganzen Geschichte stört. Hier besteht eineDifferenz.Wenn ich heute nochmals einen Antrag stellen würde, würdeich den zweiten Teil des Satzes in Absatz 2 weglassen. Dannkönnte ich mich damit einverstanden erklären, aber ich habeden Antrag nun einmal so gestellt. Wenn eine Zwischenlö-sung zustande kommt, kann ich mich damit einverstandenerklären. Das ist die Begründung, warum ich damals die Mo-tion unterschrieben habe und mich heute gegen diese For-mulierung im zweiten Teil des Satzes, wie sie aus der Kom-mission hervorgegangen ist, wehre.
Danioth Hans (C, UR): Ich möchte auf das erste Votum vonHerrn Uhlmann Bezug nehmen und folgendes ausführen: Ichbin natürlich sehr für die Förderung der Berggemeinden undmeine auch, dass der besonderen Lage und Problematik derstädtischen Agglomerationen, wie sie sich heute zeigen,Rechnung getragen werden soll. Eine Förderungsbestim-mung halte ich also für angezeigt. Allerdings hat bereits HerrKollege Loretan auf Artikel 126 hingewiesen. Indessen frageich mich schon, und ich frage die Kommissionsmehrheit, obhier die Dynamik, welche jetzt in Artikel 41 hineingebrachtwird, richtig ist.Ich verstehe den Artikel 41, wie es der Titel sagt, als Interpre-tation der Stellung der Gemeinden, als Interpretation undFeststellung ihres Autonomiestatus. Ich frage mich, ob hier indiese Regelung der Autonomie der Gemeinden diese Dyna-mik hineingehören soll, eben die Förderung der städtischenAgglomerationen und der Berggebiete.Der Bund muss bei der Erfüllung seiner Aufgaben Rücksichtauf die Anliegen aller Gemeinden nehmen. Herr Kollege Uhl-mann hat mit vollem Recht auf Ungerechtigkeiten und Un-gleichheiten, die daraus entstehen können, hingewiesen.Das würde ich bedauern. Von daher würde ich es eigentlichsehr begrüssen, wenn Herr Uhlmann seinen Antrag so stel-len würde, wie er ihn am Schluss mündlich modifiziert hat:Die Bestimmung in Absatz 1 gemäss Bundesrat und Kom-mission übernehmen und Absatz 2 nicht völlig, sondern nurden Halbsatz vom Komma an – «insbesondere in städtischenAgglomerationen und in Berggebieten» – streichen. Denndas ist hier tatsächlich ein Fremdkörper.Dass ich nicht ganz falsch liege, bestätigt auch die Stellung-nahme der Konferenz der Kantonsregierungen, die ja ganzsicher für die Anliegen der Mehrheit zugänglich wäre. In die-sem Sinne möchte ich eigentlich Herrn Uhlmann empfehlen,diesen Antrag abzuändern; ich würde ihm so zustimmen.
Bloetzer Peter (C, VS): Ich muss meinem Kollegen Hans Da-nioth widersprechen, und zwar möchte ich hier die Argu-mente erwähnen, die uns in der Subkommission und auch imPlenum dazu bewogen haben, ihnen die Fassung der Mehr-heit zu beantragen.Es kann nicht von der Hand gewiesen werden, dass städti-sche Agglomerationen in der heutigen Zeit Aufgaben über-nommen haben, übernehmen und weiterhin übernehmenmüssen, die weit über den Rahmen eines Kantons, ja sogarüber den Rahmen unseres Landes hinauswirken. Ich denkean Zentren wie die grössten Städte in unserem Land, an Zen-tren, die internationale Aufgaben haben. Wenn wir von denGemeinden sprechen, so ist es richtig, auch die städtischenAgglomerationen zu nennen, welche Aufgaben übernehmen,die im Interesse nicht nur der Kantone, sondern unseres gan-zen Landes erfüllt werden müssen. Diese Tatsache wird
Constitution fédérale. Réforme 66 E 21 janvier 1998
Bulletin officiel de l’Assemblée fédérale / Tiré à part
durch den Bundesrat, die Bundesversammlung und durchStaat und Gesellschaft anerkannt.Wenn wir die städtischen Agglomerationen im besonderennennen, ist es richtig, dass man auch die Berggemeindennennt. Auch das Alpengebiet hat einen Auftrag und eine Be-deutung, die über den kantonalen Rahmen und den Rahmenunseres Landes hinausgehen. Das ist zusammengefasst derGrund, warum ich glaube, dass die Fassung der Mehrheitausgewogen ist und die Verfassungswirklichkeit am bestenausdrückt.Ich ersuche Sie, diesem Antrag der Mehrheit zuzustimmen.
Uhlmann Hans (V, TG): Das hohe Präsidium hat mir gesagt,ich müsse den Änderungsantrag schriftlich stellen, obwohl esnur um die Weglassung des zweiten Teiles dieses Satzesgeht. Ich möchte im Interesse der Sache deshalb dem Vor-schlag des Präsidenten nachkommen und werde den geän-derten Antrag sogleich einreichen.
Präsident: Es handelt sich um eine wichtige Bestimmung.Es dürfen keine Unklarheiten bestehen. Herr Uhlmann hatangekündigt, dass er seinen Antrag zugunsten eines korri-gierten Antrages zurückzieht. Wir verschieben die Diskus-sion und die Abstimmung darüber, bis der neue Antragschriftlich vorliegt.Nach der Behandlung von Artikel 52 kommen wir auf denArtikel 41 zurück.
Verschoben – Renvoyé
Art. 42Anträge der Kommissionen: BBlPropositions des commissions: FF
Aeby Pierre (S, FR), rapporteur: La section 4 traite des ga-ranties fédérales.A l’article 42, qui reprend l’article 6 de la Constitution fédéraleactuelle, on pose le principe que chaque canton doit se doterd’une constitution démocratique et que celle-ci doit avoir étéadoptée ou modifiée par une majorité de citoyennes et de ci-toyens.
Angenommen – Adopté
Art. 43Anträge der Kommissionen: BBlPropositions des commissions: FF
Aeby Pierre (S, FR), rapporteur: Ici, nous avons affaire à lasphère de protection de la Confédération concernant l’ordreconstitutionnel des cantons. Cette disposition de l’article 43reprend ce que l’on trouve aux articles 5 et 16 de la constitu-tion actuellement en vigueur.La commission s’est plus particulièrement penchée surl’alinéa 3 qui se réfère à l’alinéa 2 concernant les troubles, lesmenaces par un danger émanant d’un autre canton. Il fautrappeler peut-être que – ce que chacun sait – l’on sortait dela guerre du Sonderbund à l’époque de la rédaction de laconstitution actuelle. Donc, l’alinéa 2 a été maintenu, mais laquestion des coûts a été jugée comme indigne de rang cons-titutionnel par la commission. On peut laisser la question descoûts d’une éventuelle intervention fédérale se régler àl’amiable, ou par une décision de l’Assemblée fédérale, lecas échéant.
Angenommen – Adopté
Art. 44Anträge der Kommissionen: BBlPropositions des commissions: FF
Aeby Pierre (S, FR), rapporteur: En ce qui concernel’article 44, je fais d’abord une remarque d’ordre rédactionnelconcernant l’alinéa 1er du texte français: «le nombre et le ter-ritoire des cantons» a été remplacé par «l’existence et le sta-
tut propre de chaque canton, ainsi que le territoire cantonal».Une telle adaptation n’a pas été nécessaire en allemand,étant donné qu’on ne faisait pas allusion à cette question de«nombre».Pour le reste, la commission a tenu à intégrer ici une initiativedu canton du Jura, notamment suite au cas de la votation po-pulaire sur la commune de Vellerat. La commission a prévuà l’alinéa 3 qu’il n’est plus nécessaire de consulter le peupleet les cantons lorsque les populations des cantons concer-nés peuvent se prononcer. A ce moment-là, ça n’est plus lepeuple et les cantons suisses qui se prononcent, mais c’estl’Assemblée fédérale qui, sous forme d’arrêté, constate quedes cantons ont modifié leurs frontières.On pourrait reprocher à la commission d’aller un peu au-delàd’un simple exercice de mise à jour. Nous considérons, vu lesréactions de la population, vu le fait aussi que l’exemple de lavotation sur Vellerat est souvent cité pour dire que nous sol-licitons un peu trop les droits populaires et pour justifier no-tamment une révision de la question du nombre de signatu-res dans l’exercice du référendum et de l’initiative, qu’il y a unmandat tacite de la population et des cantons pour réglercette affaire et que nous sommes encore ici dans le cadre dela réalité constitutionnelle vécue.Pour le reste, il n’y a pas d’autres remarques à faire sur cetarticle 44.
Angenommen – Adopté
Art. 45–48Anträge der Kommissionen: BBlPropositions des commissions: FF
Angenommen – Adopté
Art. 49Anträge der Kommissionen: BBlPropositions des commissions: FF
Rhinow René (R, BL), Berichterstatter: Das 2. Kapitel («Zu-ständigkeiten») des 3. Titels ist sehr umfangreich. Hier findenSie die Zuständigkeiten des Bundes oder, juristisch gesagt,die Bundeskompetenzen. Damit sind wir bei einem Grund-pfeiler unseres Bundesstaates angelangt, denn wie wir vor-hin im 1. Kapitel des 3. Titels und in Artikel 3 bestätigt haben,brauchen alle Aufgaben des Bundes eine Verankerung in derBundesverfassung. Es handelt sich also um eine abschlies-sende Aufzählung der Gebiete, der Aufgaben, die in die Zu-ständigkeit des Bundes fallen.Wir finden hier aber mehr als blosse Zuständigkeiten. WennSie in der Folge die Artikel näher ansehen, merken Sie, dasses auch darum geht, in gewissen Fällen die Aufgaben näherzu umschreiben. Sie werden auch Verfassungsziele finden,also Vorstellungen darüber, wie diese Aufgaben zu erfüllensind.Die Logik dieser Kompetenzverteilung verlangt, dass eigent-lich nur die Bundesaufgaben und damit nur der Bund erwähntwerden, denn alles, was hier nicht dem Bund zugewiesenwird, gehört in die Zuständigkeiten der Kantone. Trotzdemwerden in mehreren Artikeln die Kantone erwähnt, und diesnamentlich in zwei Fällen:Einmal geht es darum, bei Verfassungsaufträgen Bund undKantone in die Pflicht zu nehmen, also zum Ausdruck zu brin-gen, dass beide Ebenen gewisse Ziele verfolgen sollen. Dasist der eine Fall.Der andere Fall betrifft Bereiche, wo es um eine sensible Ab-grenzung der Zuständigkeiten geht, wo man klarstellen will,wo die Kantone zuständig bleiben. Diese Erwähnung derKantone hat rechtlich nicht unbedingt eine grosse Bedeu-tung, aber politisch eben doch, weil damit zum Ausdruck ge-bracht wird, wo die Grenzen der Bundeszuständigkeiten zuziehen sind.Sie finden die Erwähnung der Kantone in diesem zweiten Falletwa im Bereich der Kultur, des Schulwesens, der Amtsspra-chen, aber auch der Armee, beim Wasserartikel oder beimNatur- und Heimatschutz, bei den Nationalstrassen oder im
21. Januar 1998 S 67 Bundesverfassung. Reform
Amtliches Bulletin der Bundesversammlung / Separatdruck
Verhältnis von Kirche und Staat; letzteres betrifft allerdingseinen Artikel, der von uns gestrichen wurde.Die Kommission ist inhaltlich weitgehend dem Bundesrat ge-folgt. Wir haben versucht, die Erwägungen des Bundesratesbei den einzelnen Artikeln nachzuvollziehen und vor allemauch zu überprüfen, ob der Bundesrat nicht durch Neuformu-lierungen oder Kürzungen in irgendeiner Weise seinen Zu-ständigkeitsbereich zu Lasten der Kantone ausgeweitet hat.Nach unserer Meinung ist das nicht der Fall. Auch die Konfe-renz der Kantonsregierungen hat, soviel ich weiss, nirgendsden Standpunkt vertreten oder vertritt ihn mindestens heutenicht mehr, es sei in irgendeiner Weise auf kaltem Wege eineAusweitung der Bundeszuständigkeiten vorgenommen wor-den.Wir haben bei vielen Artikeln – wegen dieser genauen Prü-fung der Zuständigkeiten – längere Diskussionen geführt,die sich jetzt nicht unbedingt in einzelnen Artikeln nieder-schlagen, weil wir letztlich dem bundesrätlichen Text gefolgtsind.Immerhin haben wir einige punktuelle Änderungen vorge-nommen; ich habe in meinem einleitenden Votum in der Ein-tretensdebatte darauf hingewiesen. Ich erwähne sie noch-mals mit Stichworten:Wir haben das Ordensverbot gestrichen; wir haben den Kan-tonen einen Auftrag erteilt, für den Grundschulunterricht füralle Kinder zu sorgen; wir haben einen Statistikartikel einge-fügt, auch das Nachhaltigkeitsprinzip; wir haben im An-schluss an die Luftfahrt die Raumfahrt als Bundeskompetenzerwähnt, einen Jugendartikel beschlossen, den Bistumsarti-kel sowie die Bedürfnisklausel im Gastgewerbe gestrichen –allerdings mit einer langen Übergangsfrist – und schlussend-lich ein Klonverbot im Zusammenhang mit dem Genschutz-artikel eingefügt.Ein Hinweis auf die Systematik: Die Kommission hat auchhier nichts Umwälzendes getan, aber sie hat einen Abschnittdieses Kapitels nach vorne geschoben, nämlich den5. Abschnitt gemäss bundesrätlichem Entwurf über «Bildung,Forschung und Kultur». Er schien uns gerade in der heutigenZeit für unser Land von zentraler Bedeutung zu sein. Wir ha-ben beschlossen, ihn nach den ersten beiden Abschnitten –«Beziehungen zum Ausland» und «Sicherheit, Landesvertei-digung, Zivilschutz» – als Abschnitt 2a vor dem Abschnittüber «Umwelt und Raumplanung» einzufügen.Den 4. Abschnitt gemäss bundesrätlichem Entwurf – «Öffent-liche Werke, Verkehr, Energie, Kommunikation» – ist eine ArtSammelsuriumabschnitt geworden. Die Kommission hat ihnin zwei Abschnitte aufgeteilt. Der erste umfasst «ÖffentlicheWerke und Verkehr» (4. Abschnitt), der zweite «Energie undKommunikation» (Abschnitt 4a). Innerhalb des 6. Abschnit-tes über die «Wirtschaft» sind einzelne Artikel umgestelltworden.Den Bereich «Kultur und Sprache» in Abschnitt 2a hat dieKommission neu in zwei Artikel gegliedert: in einen Kulturar-tikel (Art. 57g) und einen Sprachenartikel (Art. 57h); denFilmartikel (Art. 57i) haben wir aus dem Bereich der «Ener-gie» in den etwas näher liegenden Abschnitt «Kultur» hin-übergenommen. Ich lasse es bei diesen Bemerkungen be-wenden; Herr Aeby wird uns weiter durch diesen Abschnittführen.
Aeby Pierre (S, FR), rapporteur: La question des relationsavec l’étranger, notamment de l’action et des compétencesde la Confédération dans ce domaine, n’a pas toujours ététrès claire dans notre histoire. Et on peut dire que cette sec-tion réconcilie, en quelque sorte, les cantons avec la Confé-dération, d’une part. D’autre part, elle précise très, très con-crètement les objectifs de la Confédération et du peuplesuisse dans l’optique des relations étrangères qui sont deplus en plus nombreuses, et qui ont, à n’en point douter, desconséquences extrêmement importantes sur la vie de tousles jours. Il n’y a pas de loi qu’on adopte aujourd’hui sans ten-ter de faire en sorte que cette loi soit eurocompatible; il n’y apas de domaine que l’on examine sans tenir compte de cequi se fait chez nos voisins, et parfois même au-delà, sur leplan planétaire.
L’alinéa 1er pose le principe traditionnel qui veut que «les af-faires étrangères relèvent de la compétence de la Confédé-ration», de l’Etat fédéral, et non pas des cantons.L’alinéa 2 donne les objectifs généraux de notre politiqueétrangère. Ici, la commission a longuement discuté sur cesobjectifs généraux. Nous avons même, à un moment donné,sollicité l’administration afin que celle-ci nous propose quel-ques variantes par rapport au projet du Conseil fédéral.Après avoir examiné ces variantes, nous sommes revenus,de façon tout à fait sage, dirais-je, à la version du Conseil fé-déral. Cependant, tout à la fin de l’alinéa 2, en ce qui con-cerne les efforts de promotion entrepris par la Confédérationpour «le respect des droits de l’homme, la démocratie et lacoexistence pacifique des peuples» – énumération qui n’estqu’exemplative, et pas exhaustive –, nous avons éprouvé lebesoin d’introduire la notion qui évoque le développementdurable. Développement durable que nous avons aussi intro-duit plus loin, dans la section concernant notamment l’amé-nagement du territoire et la protection de l’environnement.Mais ici, nous parlons de «la préservation du milieu naturel»,milieu naturel planétaire bien entendu puisqu’il s’agit dans lecas présent de relations avec l’étranger.Ensuite, l’alinéa 3 fait l’obligation à la Confédération de pren-dre en considération les compétences et la sauvegarde desintérêts des cantons. Nous verrons ça beaucoup plus en dé-tail lorsque nous examinerons la concrétisation de ce prin-cipe de l’alinéa 3, à l’article 50, tout à l’heure.
Angenommen – Adopté
Art. 50Anträge der Kommissionen: BBlPropositions des commissions: FF
Aeby Pierre (S, FR): L’article 50 mérite un commentaire. Onpeut dire que la version du Conseil fédéral est issue d’unelongue période de négociation avec les cantons. Plus préci-sément, de négociation avec les représentants des cantonsdans le cadre de la Conférence des gouvernements canto-naux, autrement dit la KdK.Cette dernière a connu une renaissance à partir de 1992,c’est-à-dire après le vote négatif du peuple et des cantonssuisses sur l’adhésion à l’EEE. A ce moment-là, un certainnombre de cantons ont estimé qu’ils avaient à prendre partplus directement à la politique étrangère de notre pays. Siles relations avec le Conseil fédéral, lors des réunions dé-sormais institutionnalisées, n’ont pas été empreintes de cor-dialité et de confiance mutuelle – en tout cas au début, onpeut le dire –, il faut bien admettre qu’au fil de ces réunions,la confiance entre les représentants des cantons et le Con-seil fédéral a petit à petit refait surface. Aujourd’hui, les rela-tions sont bien meilleures qu’elles ne l’ont été parfois par lepassé.La majorité de la commission a toutefois estimé que l’ar-ticle 50 rédigé par le Conseil fédéral était compliqué et qu’ilreflétait un peu trop les laborieuses étapes de la négociation.Il est vrai que nous avons pris ici quelques libertés en com-mission par rapport à certaines exigences des cantons quiportaient parfois sur tel mot ou telle expression. L’un dansl’autre, cette version compliquée de l’article 50 en trois ali-néas a été nettement améliorée par la commission. Elle avoulu poser les principes très clairs suivants:A l’alinéa 1er, «les cantons sont associés à la préparationdes décisions de politique extérieure affectant leur compé-tence ou leurs intérêts essentiels». Nous avons biffé le restede l’alinéa, considérant que cela méritait un alinéa 1bis, oùnous reprenons le devoir d’information «en temps utile et demanière détaillée» de la Confédération.L’alinéa 2 donne à l’avis des cantons un poids particulier. Ilest évident que, par le Conseil fédéral, la Confédération con-sulte non seulement les cantons, mais encore les milieux del’économie, etc. Le poids de l’avis des cantons en politiqueextérieure est tout à fait particulier lorsque leurs intérêts di-rects sont touchés. C’est ce que nous posons comme prin-cipe dans cet alinéa.
Constitution fédérale. Réforme 68 E 21 janvier 1998
Bulletin officiel de l’Assemblée fédérale / Tiré à part
L’alinéa 2 contient en plus le principe de l’association descantons à la négociation, mais «de manière appropriée»: lescantons doivent être associés «de manière appropriée» à lanégociation. Ça laisse une marge de manoeuvre aussi bienau Conseil fédéral qu’aux cantons, c’est-à-dire à leurs repré-sentants, sur la façon dont on les associe dans tel ou tel dos-sier. C’est tout à fait d’actualité de parler de cette question,avec notamment le dossier des transports et du transit où l’onsait que les cantons ont été très régulièrement et très systé-matiquement informés par M. Leuenberger, conseiller fédé-ral, qui les a convoqués avec plus ou moins de succès à di-verses séances au fur et à mesure que se déroulaient ces pé-nibles négociations bilatérales.L’alinéa 3 a été jugé superflu par la commission, étant donnéqu’il est déjà contenu dans d’autres dispositions et qu’il vapour ainsi dire de soi.Je vais maintenant très brièvement donner les différencesentre la proposition de minorité et celle de majorité. Je con-sidère – évidemment, c’est un avis personnel – que cetteproposition de minorité offre plus de garanties aux cantons,qu’elle est plus précise, mais en revanche qu’elle pose defaçon très claire la limite de leur participation à la négocia-tion.Il y a donc deux aspects: le début de la proposition de mino-rité est favorable aux cantons, la fin peut être considéréecomme défavorable – quoique, on peut en discuter. «Lors-que les intérêts essentiels ou les compétences des cantonssont touchés ....»: on retrouve la version de la majorité et leprojet du Conseil fédéral. Simplement, la proposition de mi-norité utilise le terme de «touchés», qui me paraît plus précisque «affectant leurs compétences». Affecter des compéten-ces ou des intérêts, ou toucher des compétences ou des in-térêts: on les touche plus facilement. «Affecter», en tout casen français, est une notion qui a plus d’exigences.Quant à l’information, ma proposition de minorité la prévoit«sans délai», et non pas «en temps utile». L’information «entemps utile», c’est plus de marge de manoeuvre pour le Con-seil fédéral. Ici, l’information se fait «sans délai», c’est-à-diretout de suite.Ensuite, on retrouve l’élément qui veut que la prise de posi-tion des cantons revête un «poids particulier»: ici, pas de dif-férence. Mais il y a une différence quand les cantons sont as-sociés, et non pas «de manière appropriée»: ils sont asso-ciés, non pas à la négociation comme telle, mais aux «tra-vaux préparatoires des négociations internationales». Et çame paraît plus clair: les cantons doivent être associés auxtravaux préparatoires, mais après, on doit admettre que leConseil fédéral dispose d’une certaine marge de manoeuvredans le déroulement de la négociation.Voilà pour ces nuances, qui ne sont pas fondamentales, jem’empresse de le dire, et qui distinguent les propositions dela majorité et de la minorité de la commission.
Rhinow René (R, BL), Berichterstatter: Die Unterschiedesind meines Erachtens nicht weltbewegend. Aber ich würdeIhnen doch raten, keine unnötige grössere Formulierungsdif-ferenz zum Bundesrat und zur Kommissionsmehrheit zuschaffen.Der bundesrätliche Entwurf und der Kommissionsantrag be-ginnen mit dem Grundsatz der Mitwirkung der Kantone inzwei Fällen, nämlich wenn ihre Zuständigkeiten berührt undwenn ihre wesentlichen Interessen betroffen sind. Danachfolgt, wie das zu geschehen hat, nämlich mit der unverzügli-chen Information und mit dem Einholen von Stellungnahmen.An dritter Stelle wird erwähnt, wann den Stellungnahmen be-sonderes Gewicht zukommt, und dies bezieht sich eben aufdie Zuständigkeiten der Kantone. Wenn ihre Zuständigkeitenbetroffen sind und nicht nur ihre allgemeinen Interessen, sollden Stellungnahmen ein besonderes Gewicht zukommen.Das war auch das Anliegen der Konferenz der Kantonsregie-rungen.Diese Abfolge, diese Differenzierung in diesen drei Schritten,wird durch die neue Formulierung der Minderheit Aeby ei-gentlich nicht verdeutlicht, sondern im Grunde genommeneingeebnet.
Deshalb würde ich Ihnen raten, der Mehrheit zu folgen. Aberes würde kein kapitaler Wechsel vorgenommen, wenn Siedem Minderheitsantrag Aeby folgen würden.
Schmid Carlo (C, AI): Ich möchte der Kommissionsmehrheitdanken, dass sie in Absatz 1 den letzten Satzteil des zwei-ten Satzes gestrichen hat. Das ist eine wichtige Entschei-dung.Auch mein Kanton macht bei der Konferenz der Kantonsre-gierungen mit. Diese gemeinsame Organisation ist eine dien-liche, eine nützliche Organisation, aber sie ist kein Verfas-sungsorgan. Sie soll in der Verfassung nicht erwähnt werden,und sie darf sich nicht an die Stelle der Kantone setzen. Essoll auch in Zukunft die Möglichkeit bestehen, dass die Kan-tone direkten Zugang zum Bund haben und dass der Bund di-rekten Zugang zu den einzelnen Kantonen hat, ohne Media-tion durch diese Konferenz der Kantonsregierungen. Das istder staatspolitische Sinn und Inhalt dieser Streichung, die ichals Kantonsvertreter – als Stände- und als Regierungsrat –voll unterstütze. Ich möchte der Kommissionsmehrheit dafürdanken.
Leuenberger Moritz, Bundesrat: Der Bundesrat unterstütztden Antrag der Kommissionsmehrheit mit den Änderungengegenüber der bundesrätlichen Fassung.Obwohl die Diskussion jetzt hier sehr kurz war, ist zu sagen,dass dieser Artikel im Rahmen der Vorarbeiten der Botschaftund in der Vernehmlassung unglaublich umstritten war: DieKantone haben ganz vehement darauf gepocht, in der Aus-senpolitik mehr Mitspracherechte zu haben. Als einer, der imMoment in einer solchen aussenpolitischen Verhandlungs-phase steckt, muss ich Ihnen sagen: Es ist nicht sehr leicht,dieses Mitspracherecht auch tatsächlich zu gewähren; esgeht zum Teil um Entscheidungen, die teils innerhalb von Ta-gen, wenn nicht von Stunden, getroffen werden müssen.Daher bin ich um den Antrag der Kommissionsmehrheit froh,der diese Differenzierung macht. Wenn es um kantonaleKompetenzen geht – ja, dann soll diese vermehrte Mitspra-che tatsächlich erfolgen. Der Bund hat sich Mühe gegebenund will sich Mühe geben, diese Beteiligung tatsächlich zugarantieren. Ist diese Prozedur auch notwendig, wenn esbloss noch um kantonale Interessen geht – und ich frage Sie:Wann sind kantonale Interessen nicht im Spiel? –, dann wirdes schon sehr schwierig.Daher bitte ich Sie, dem Mehrheitsantrag zuzustimmen undden Minderheitsantrag abzulehnen.
Abstimmung – VoteFür den Antrag der Mehrheit 31 StimmenFür den Antrag der Minderheit 4 Stimmen
Art. 51Anträge der Kommissionen: BBlPropositions des commissions: FF
Aeby Pierre (S, FR), rapporteur: L’article 51 a fait l’objet derelativement peu de discussions en commission. Il est nor-mal, dans un Etat fédéral, que les cantons puissent concluredes traités avec l’étranger, mais dans les domaines qui relè-vent de leur compétence, et ces traités, évidemment, ne doi-vent être contraires ni aux intérêts de la Confédération ni àceux des autres cantons. On prévoit, à l’alinéa 2, l’approba-tion par la Confédération.De plus, à l’alinéa 3, on prévoit que, d’une façon générale, lescantons traitent directement avec les autorités de pays étran-gers qui ont rang inférieur et pour les autres cas, c’est la Con-fédération qui intervient comme intermédiaire, lorsqu’un can-ton souhaite s’adresser directement à un gouvernementétranger.
Angenommen – Adopté
Art. 52Anträge der Kommissionen: BBlPropositions des commissions: FF
21. Januar 1998 S 69 Bundesverfassung. Reform
Amtliches Bulletin der Bundesversammlung / Separatdruck
Aeby Pierre (S, FR), rapporteur: En ce qui concerne l’article52, il faut dire que nous avons décidé, après discussion, dele biffer. Ce faisant, nous créons une divergence avec le Con-seil national. Ce n’est pas inutile de le mentionner: ce n’estpas un article fondamental que cet article des dons et desdistinctions octroyés par des gouvernements étrangers. Il estpourtant assez remarquable que notre commission ait biffécet article d’un coeur léger et – si mon souvenir est exact –sans vote particulier, alors que, au Conseil national, la com-mission, par 25 voix contre 4, a précisément refusé de le bif-fer.De quoi s’agit-il? C’était certainement d’une actualité brû-lante au moment où la constitution actuelle a vu le jour. Ils’agit de l’article 12 qui est un article important de la Consti-tution de 1848: c’est cette crainte des décorations par desEtats étrangers, c’est cette volonté d’empêcher les membresde l’administration, du Gouvernement d’être sollicités par desEtats étrangers, d’être récompensés. Et ça va très loinaujourd’hui. On a considéré que, dans l’application, ça pou-vait empêcher, par exemple, une personnalité suisse de re-cevoir une distinction d’une organisation internationale. On aparlé d’organisations sportives, on a parlé d’organisationscomme l’Organisation mondiale de la santé ou d’autres, où ilarrive que des distinctions, des titres soient décernés. C’estdans ce sens-là que la commission a estimé que l’article 52avait quelque chose d’anachronique, non pas dans les prin-cipes qu’il pose, mais dans le fait de les insérer dans la cons-titution. Il est évident que la loi règle, de toute façon, de ma-nière extrêmement précise, qui peut ou ne peut pas recevoirune distinction ou une décoration lorsqu’il exerce telle ou tellefonction. Cela ne veut pas dire que c’est un domaine à ne pasrégler. Cela ne signifie pas non plus que c’est un domainesans danger, mais il n’a pas rang constitutionnel, à notre avis.C’est pourquoi nous vous proposons de biffer cet article 52.
Leuenberger Moritz, Bundesrat: Auf etwas möchte ich Siedoch hinweisen: Artikel 52 hätte dem Bund auch die Kompe-tenz gegeben, kantonalen Behörden zu verbieten, solche Zu-wendungen und Orden entgegenzunehmen. Indem die Kom-mission jetzt Artikel 52 streicht, sind die Kantone wieder al-lein zuständig, eine entsprechende Gesetzgebung zu erlas-sen. Wenn Sie das streichen, stärken Sie also die kantonaleAutonomie bezüglich der Entgegennahme von Orden undZuwendungen.
Präsident: Ich frage den Bundesrat an, ob er am fürsorgeri-schen Aspekt von Artikel 52 in diesem Sinne festhaltenmöchte.
Leuenberger Moritz, Bundesrat: Nein, ich bin mit der Strei-chung einverstanden.
Angenommen – Adopté
Art. 41
Neuer Antrag UhlmannAbs. 2Der Bund nimmt bei der Erfüllung seiner Aufgaben Rücksichtauf die Anliegen der Gemeinden. (Rest des Absatzes strei-chen)
Nouvelle proposition UhlmannAl. 2Dans l’accomplissement de ses tâches, la Confédérationprend en compte les exigences des communes. (Biffer lereste de l’alinéa)
Präsident: Inzwischen ist Ihnen der modifizierte Antrag Uhl-mann ausgeteilt worden. Ich eröffne nochmals die Diskus-sion.
Uhlmann Hans (V, TG): Absatz 1 ist ja unbestritten, und beiAbsatz 2 wird nun mit diesem neuen Antrag sichergestellt,dass der Bund bei der Erfüllung seiner Aufgaben Rücksicht
auf die Anliegen der Gemeinden – auf die Anliegen aller Ge-meinden – nimmt. Damit ist meines Erachtens auch klar,dass eben in dieser Verfassung nicht Gemeinden zweiter Ka-tegorie entstehen.Ich bitte Sie also, dem abgeänderten Antrag zuzustimmen;die weitere Begründung habe ich vorhin schon abgegeben.
Aeby Pierre (S, FR), rapporteur: Je ne suis pas sûr: on a denouveau «les exigences» maintenant. C’est juste ou non?
Präsident: Diese französische Übersetzung ist falsch. Wirhaben beschlossen, von «intérêts» und nicht von «exi-gences» zu sprechen. Ebenso muss es «prend en considéra-tion» heissen.
Simmen Rosemarie (C, SO): Wir führen hier auch eine Dis-kussion durch, die etwas mit Artikel 7 Absatz 2 zu tun hat,den wir gestern behandelt haben. Dort ist es spiegelbildlichso, dass wir niemanden diskriminieren und insbesondere nie-manden diskriminieren wollen. Heute ist es so, dass wirRücksicht auf die Anliegen der Gemeinden nehmen wollen.Da sind alle gleich, und es gibt gemäss Antrag der Mehrheitsolche, die noch gleicher sind: die städtischen Agglomeratio-nen und die Berggemeinden.Ich denke, dass es auch aus Gründen der Kohärenz richtigist, dem modifizierten Antrag Uhlmann zu folgen, also den all-gemeinen Willen zum Ausdruck zu bringen, dass der BundRücksicht zu nehmen hat, und alle anderen Zutaten beiseitezu lassen.
Plattner Gian-Reto (S, BS): Ich bin der Meinung, dass durchdie Nennung einerseits der Gemeinden und anderseits derGebiete diesem Anspruch von Frau Simmen nicht widerspro-chen wird. Eine städtische Agglomeration ist keine Ge-meinde, und ein Berggebiet ist auch keine Gemeinde.Hier geht es darum, den Bund besonders in die Pflicht zunehmen, damit er gemeindeüberschreitende und allenfallssogar kantonsübergreifende Agglomerationen wie z. B. die,aus der ich stamme, besonders berücksichtigt. Diese Auf-gabe erhält er nicht, wenn hier nur von Gemeinden die Redeist; man soll ihn darauf hinweisen, dass es regionale Pro-bleme gibt, und zwar schwerwiegende.Ich bin also gegen die Streichung dieses Zusatzes, und ichbitte Sie, der Kommissionsmehrheit zuzustimmen.
Leuenberger Moritz, Bundesrat: Das ist eine Bestimmung,die bei der Vorbereitung der Totalrevision und dann in derVernehmlassung sehr beachtet worden ist.Die Konferenz der Kantonsregierungen hat Ihnen einen Briefgeschrieben. Beachten Sie bei diesem Brief, dass die Konfe-renz der Formulierung Ihrer Kommissionsmehrheit zustim-men kann, dass sie damit leben kann. Sie schreibt auch,dass sich der Bund nicht in das Verhältnis der Kantonsregie-rungen zu den Gemeinden und insbesondere zu den städti-schen Agglomerationen einmischen soll. Er soll vielmehr beider Erfüllung seiner Aufgaben Rücksicht auf die Anliegen derGemeinden in besonderen Situationen nehmen.Herr Uhlmann hat die Frage aufgeworfen, ob die besondereErwähnung der städtischen Agglomerationen indirekt eineDiskriminierung anderer Gemeinden, insbesondere ländli-cher Gemeinden sei. Das ist nicht die Meinung dieses Arti-kels. Mit dieser Bestimmung soll heute einer gewordenenWirklichkeit Rechnung getragen werden. Es geht – beachtenSie den Unterschied zum Diskriminierungsverbot! – um einegrosse Mehrheit der schweizerischen Bevölkerung. Zwi-schen 70 und 80 Prozent der Bevölkerung leben heute in Ag-glomerationen.Denken Sie beispielsweise an eine Agglomeration wieSchwamendingen. Sie hat die Bevölkerungszahl eines mitt-leren schweizerischen Kantons, aber sie hat weder eine Ver-tretung im Ständerat noch eine Vertretung im Nationalrat.Niemand von Schwamendingen ist im Parlament. Es gibtstädtische Agglomerationen, die sind im Bund überhauptnicht vertreten, und doch konzentrieren sich in diesen Gebie-ten Aufgaben von nationalem Interesse, nicht nur kulturelle,
Constitution fédérale. Réforme 70 E 21 janvier 1998
Bulletin officiel de l’Assemblée fédérale / Tiré à part
sondern auch soziale und wirtschaftliche, die wir berücksich-tigen und wahrnehmen müssen. Es ist nicht nur eine kurze,temporäre Erscheinung, es ist eine gewaltige Änderung, diehier in den letzten Jahrzehnten stattgefunden hat. Weil dieseAgglomerationen trotz des Dreistufenmodells bisher nir-gends angesprochen werden, soll sie die Verfassung aus-drücklich erwähnen.Das ist insbesondere deswegen keine Benachteiligung ande-rer Regionen, weil solche ja in der Verfassung ausdrücklichgenannt sind. Bitte beachten Sie das! Es gibt die Bergge-biete, sie sind in der Verfassung genannt. Es gibt wirtschaft-lich bedrohte Landesteile, auch sie sind ausdrücklich in derVerfassung genannt. Es gibt das Alpengebiet, das ist mehr-fach in der Verfassung genannt. Auch die Randgebiete sindmehrfach in der Verfassung genannt. Jetzt soll hier das Pro-blem der städtischen Agglomeration ebenfalls genannt wer-den. Ich bitte Sie, dem zuzustimmen.Es gibt weitere Formulierungen, die im selben Ausmass inder Verfassung vorkommen, z. B. die Berücksichtigungs-pflicht bezüglich Familien, betreffend die wirtschaftliche Ent-wicklung einzelner Gebiete des Landes und insbesondere,wie ich gesagt habe, der Berggebiete. Der Bund soll sichnicht in die kantonale Kompetenz einmischen und vorschrei-ben, kantonale Regierungen hätten im besonderen ihre städ-tischen Agglomerationen zu berücksichtigen.Deswegen lehnt der Bundesrat den Antrag der MinderheitAeby ab. Aber wir, der Bund, der auch im ganzen Vernehm-lassungsverfahren eigentlich so organisiert ist, dass diese In-teressengebiete zu kurz kommen, möchten diese Bestim-mung hier haben. Damit verlassen wir den Pfad der Nachfüh-rungspflicht nicht, weil es heutige Wirklichkeit ist, dass wir aufsolche Agglomerationen in der Praxis tatsächlich Rücksichtnehmen müssen. Es ist bei verschiedenen Diskussionenüber die Gräben in diesem Land – zwischen der Romandieund der deutschsprachigen Schweiz z. B. – immer wieder be-tont worden, dass der wirkliche, der gefährliche Graben fürdieses Land der kulturelle Graben zwischen Stadt und Landist. Hier möchten nun die Städte auch erwähnt werden, etwasaufholen.Ich bitte Sie zusammen mit der Mehrheit Ihrer Kommission,diesem Wunsch stattzugeben.
Spoerry Vreni (R, ZH): Ich möchte nochmals unterstreichen,was insbesondere Herr Bloetzer und Herr Plattner und jetztauch Herr Bundesrat Leuenberger ausgeführt haben. Wennder Bund auf Gemeinden Rücksicht zu nehmen hat, dannmuss er vor allen Dingen dort Rücksicht nehmen, wo beson-dere Probleme anstehen. Das ist einerseits im Berggebiet derFall, wo wenig Leute wohnen, aber wo grosse Gemeindege-biete mit besonderen Aufgaben sind, die viel Geld kosten. Aufder anderen Seite sind es die Agglomerationen, die, wie er-wähnt wurde, nicht nur besondere Aufgaben lösen, sondernwegen einer gewissen Anonymität auch besondere Problemeanziehen. Wenn wir deshalb die Spezifizierung streichen,welche die Mehrheit der Kommission eingefügt hat, dannmacht der Artikel von mir aus gesehen nicht mehr viel Sinn.Deswegen muss ich den Antrag Uhlmann ganz klar ablehnenund bitte Sie, dem Antrag der Mehrheit zuzustimmen.
Weber Monika (U, ZH): Ich möchte «ständerätlich-höflich»eine Korrektur an dem anbringen, was Herr Bundesrat Leu-enberger gesagt hat. Schwamendingen hat nicht «keinenStänderat oder keine Ständerätin». Ich bin da und schliesseauch meine Kollegin Vreni Spoerry mit ein. Wir fühlen unsbeide auch Schwamendingen verpflichtet. (Heiterkeit)
Rhinow René (R, BL), Berichterstatter: Wenn Sie dem An-trag Uhlmann zustimmen möchten, müssen Sie sich vorerstgut überlegen, was es bedeutet, allgemein Rücksicht auf dieAnliegen «der» Gemeinden zu nehmen – in einem Land mit3000 Gemeinden, wo die Unterschiede zwischen Juf und derStadt Zürich grösser nicht sein könnten! Was sind dann diegemeinsamen Interessen aller Gemeinden?Ein Zweites: Ich muss noch einmal darauf hinweisen, dassder Antrag der Mehrheit der Kommission ein Kompromiss ist,
der nach langen Diskussionen und Verhandlungen zwischender Konferenz der Kantonsregierungen, dem Gemeinde- unddem Städteverband zustande gekommen ist. Wenn wir dieseBasis aufbrechen, beginnt dasselbe noch einmal von vorne.Ich möchte Sie deshalb davor warnen, das Rad wieder zu-rückzudrehen. Vor allem, wenn Sie die städtischen Agglome-rationen herausstreichen, die sonst nirgends in der Verfas-sung stehen, während die Berggebiete andernorts erschei-nen, ist das eigentlich ein Stück weit ein Affront gegenüberden Organisationen, die sich bis jetzt in diesem Prozess sehreingesetzt haben.Ein Schlusswort an alle, die etwas Mühe mit diesem Absatzhaben: Die Verfassung ist auch ein Zeichen, wieweit wir denAusgleichsgedanken in diesem Lande ernst nehmen. Ichbitte jetzt all diejenigen, die nicht in den städtischen Agglome-rationen wohnen, daran zu denken, dass es diese andereSchweiz gibt und dass sie auch in der Verfassung erwähntsein möchte.
Abs. 1 – Al. 1Angenommen – Adopté
Abs. 2 – Al. 2
Präsident: Der Antrag Rochat ist, was die französische Fas-sung betrifft, unbestritten und gilt für den französischen Textals angenommen.
Abstimmung – Vote
Eventuell – A titre préliminaireFür den neuen Antrag Uhlmann 17 StimmenFür den Antrag der Minderheit 16 Stimmen
Definitiv – DéfinitivementFür den Antrag der Mehrheit/Rochat 31 StimmenFür den neuen Antrag Uhlmann 8 Stimmen
Art. 53Anträge der Kommissionen: BBlPropositions des commissions: FF
Aeby Pierre (S, FR), rapporteur: Concernant l’article 53 quiporte le titre «Sécurité»: il doit être considéré comme un arti-cle introductif à cette section. Il est à relever que la sécurité,de manière générale, est de la double compétence et de ladouble responsabilité de la Confédération, d’une part, et descantons, d’autre part: chacun doit respecter la sphère d’acti-vité de l’autre, et mandat leur est donné de coordonner leursefforts en matière de sécurité intérieure.Je n’ai pas de remarques supplémentaires à faire sur cetarticle 53.
Angenommen – Adopté
Art. 54Anträge der Kommissionen: BBlPropositions des commissions: FF
Antrag SpoerryAbs. 1Die Schweiz hat eine Armee.
Proposition SpoerryAl. 1La Suisse a une armée.
Aeby Pierre (S, FR), rapporteur: L’article 54 porte le titre«Armée». Il me paraît important de relever que nous avons,dans cet article, la notion d’armée donnée par ce titre, et, en-suite, les différents alinéas concrétisent la mission de cettearmée.Alors, pourquoi la commission a-t-elle supprimé l’alinéa 1er?Notre commission a supprimé l’alinéa 1er parce que, dans ladiscussion, il s’est avéré que nous nous sommes engagés
21. Januar 1998 S 71 Bundesverfassung. Reform
Amtliches Bulletin der Bundesversammlung / Separatdruck
sur une voie de traverse en nous posant la question: mais en-fin, est-ce qu’on peut dire aujourd’hui: «La Suisse a une ar-mée de milice», sachant que nous allons très vraisemblable-ment être amenés à professionnaliser certains secteurs decette armée? Elle l’a supprimé aussi par crainte qu’on puissetirer de cet alinéa 1er – «la Suisse a une armée de milice» –l’interdiction de professionnaliser. Dans ce sens, la commis-sion a simplement estimé – c’est vrai qu’elle l’a fait à une ma-jorité d’une voix – qu’on pouvait biffer l’alinéa 1er.Si l’on dit, dans le titre de l’article 54, «Armée», c’est évidentque la Suisse a une armée. L’alinéa 1er est une formulationdéclamatoire, qui, en plus, utilise la notion de «la Suisse» –et c’est la seule fois que, dans la constitution, on parle de «laSuisse» comme sujet; on parle toujours de la Confédération,ou de la Confédération et des cantons, ou des citoyens, deshommes, quiconque, etc.; même dans les relations étrangè-res, on ne trouve pas «la Suisse» en fonction sujet. Alors, dèsl’instant où la notion de milice tombait, il nous semblait allerde soi qu’on pouvait, dans cet article 54, biffer l’alinéa 1er.Pour ce qui est des alinéas 2 et 3, on trouve là les missionsgénérales dévolues à notre armée, dont on a suffisammentdébattu ces dernières années pour qu’on puisse considérerqu’il s’agit là à la fois de la réalité constitutionnelle et d’unevolonté de la population et d’un consensus général sur le rôlede l’armée pour la défense du pays et de sa population, surle rôle de l’armée en matière de menaces concernant notam-ment la sécurité intérieure et les situations d’exception. Sim-plement, à l’alinéa 2, nous avons introduit que: «L’arméecontribue à prévenir la guerre et à maintenir la paix». En toutcas dans le texte français, dans le texte allemand aussi, laformulation du Conseil fédéral pouvait laisser entendre queseule l’armée, dans le pays, avait «pour mission de prévenirla guerre et de contribuer au maintien de la paix». On a vudans les objectifs généraux de la Confédération, dans la po-litique étrangère, que l’armée n’est pas seule investie decette mission, mais que la Confédération, les cantons et toutela population peuvent être considérés comme investis decette mission. C’est pour ça qu’on utilise ici le terme «.... con-tribue à ....»Voilà pour l’essentiel des discussions qui se sont dérouléesen commission concernant cet article 54. Je prendrai éven-tuellement position tout à l’heure, au besoin, sur propositionindividuelle qui a été déposée.
Spoerry Vreni (R, ZH): Wie Herr Iten richtig gesagt hat, be-trifft mein Antrag nur den Absatz 1. Die Absätze 2 und 3 müs-sen von mir aus gesehen nicht geändert werden.Ich möchte Sie darauf hinweisen, dass der Absatz 1 gemässEntwurf des Bundesrates lautet: «Die Schweiz hat eine Miliz-armee.» Die ständerätliche Kommission hat diese Aussagegestrichen, dies im Gegensatz zum Nationalrat, der die Fas-sung des Bundesrates tel quel übernimmt, und zwar offen-sichtlich völlig geschlossen, denn erstaunlicherweise gibt esim Nationalrat, wo aus dem Schoss der Kommission128 Minderheitsanträge eingereicht worden sind, ausgerech-net zu diesem Absatz keinen Minderheitsantrag.Als Nichtmitglied der betreffenden Subkommission habe ichmich deshalb gefragt, was unsere Kommission dazu geführthat, den Absatz 1 des bundesrätlichen Entwurfes zu strei-chen. Offensichtlich ist diese Streichung nicht deswegen er-folgt, weil die vorberatende Kommission die Institution Armeein Frage stellen will, sondern gemäss Protokoll deshalb, weilsie sich mit dem Begriff der Milizarmee auf Verfassungsstufenicht anfreunden kann. Der Begriff «Milizarmee» ist zwar imVolk verankert, aber er kommt in der heutigen Verfassungnicht vor. Zudem gibt es bereits heute in unserem Milizsy-stem Funktionen, die berufsmässig wahrgenommen werden.Auch deshalb hat die vorberatende Kommission gewünscht,auf die Aufnahme des Begriffs der Milizarmee zu verzichten,obwohl niemand – auch die Rechtsgelehrten nicht – bestrei-tet, dass in der Schweiz der Übergang von der Milizarmee zueiner Berufsarmee eine Verfassungsänderung bedingenwürde. In der Bundesverfassung ist die allgemeine Wehr-pflicht festgehalten, und solange die allgemeine Wehrpflichtin der Verfassung steht, was auch in Zukunft der Fall sein
soll, könnte man nicht ohne Änderung der Verfassung zu ei-ner Berufsarmee übergehen.Ich habe mich von diesem Argument überzeugen lassen. Ichhabe mich belehren lassen, dass es tatsächlich nicht notwen-dig ist, in der Bundesverfassung von einer Milizarmee zusprechen, weil die allgemeine Wehrpflicht verankert ist undweil diese automatisch zu einer Milizarmee führt, wie sie imVolk verstanden und erlebt wird. Aus diesem Grunde habeich mir erlaubt, Ihnen einen neuen Antrag vorzulegen, beidem der Hinweis auf die Organisation unserer Armee nachdem Milizprinzip nicht mehr erscheint. Am ersten Satz mei-nes Antrages muss ich aber festhalten. Er lautet: «DieSchweiz hat eine Armee.»Diese Tatsache ist ja heute nicht mehr so unbestritten, wiesie das dannzumal bei der Schaffung der Eidgenossenschaftwar. Im letzten Jahrhundert war die Landesverteidigung diezentrale Bundesaufgabe, die ungefähr drei Viertel aller Mittelbeansprucht hat. Das Budget des ersten Jahres unseresBundesstaates hat eine knappe Million Franken umfasst, undetwa 80 Prozent davon waren für die Landesverteidigungeingesetzt. Heute – das wissen Sie – sind es noch ungefähr12 Prozent unserer Bundesausgaben, die für die Landesver-teidigung zur Verfügung stehen. Deswegen scheint es mirnicht opportun, das vom Bundesrat ausgedrückte Bekenntniszu unserer Armee, das im Nationalrat gemäss Fahne unbe-stritten geblieben ist, in unserem Rat nicht zu übernehmen.Es entspricht der heute gelebten Verfassungswirklichkeit undder Überzeugung einer Mehrheit in unserem Volk, und des-wegen bitte ich Sie, meinen Antrag zu unterstützen.
Reimann Maximilian (V, AG): Bei aller Kollegialität mit FrauSpoerry bin ich doch ein bisschen erstaunt, dass sie uns alsMitglied der Verfassungskommission mit relativ vielen Einzel-anträgen eindeckt. Diese Gelegenheit hätte sie doch in derKommission gehabt. Ich bin erst recht erstaunt, dass nochein korrigierter Antrag kommt, der in Tat und Wahrheit dementspricht, was Ihnen die Kommission beantragt.Wir haben in Artikel 54 den Titel «Armee». Damit sagen wir,dass wir eine Armee haben. Und wir fangen an: «Die Armeedient der Kriegsverhinderung.» Jetzt besprechen wir in re-daktioneller Art und Weise noch einmal, ob wir den Satz «DieSchweiz hat eine Armee» retten sollen oder nicht. Da sich dienationalrätliche Kommission bereits für eine andere Versionentschieden hat, hätten wir doch bei einer allfälligen Diffe-renzbereinigung Gelegenheit, darüber zu diskutieren. Hier imPlenum tun wir meines Erachtens zuviel in Sachen Kommis-sions- oder Redaktionsarbeit.Deshalb bitte ich Sie: Lassen Sie es bei der Version der Kom-mission bewenden! In Tat und Wahrheit weichen wir über-haupt nicht von dem ab, was Frau Spoerry uns mit ihrer kor-rigierten Version vorschlägt.
Leuenberger Moritz, Bundesrat: Der Bundesrat kann unterdem Strich mit beiden Anträgen leben. Wie immer Sie ent-scheiden, möchte er aber doch folgendes festhalten:1. Die Tatsache, dass die Schweiz eine Armee hat, hat Ver-fassungscharakter, ob es nun dasteht oder nicht.2. Das gilt auch für den Gedanken, dass dies eine Milizarmeeist, wie immer das formuliert ist.Natürlich leben wir in einer Zeit, in der die Armee professio-nalisiert wird. Sollte aber irgendeinmal die Überzeugung oderdie politische Absicht zum Tragen kommen, dass wir nurnoch eine Berufsarmee haben möchten, dann müsste ohne-hin eine Verfassungsänderung erfolgen. Denn der Gedanke,dass es sich bei unserer Armee um eine Milizarmee handelt,ergibt sich natürlich auch aus der allgemeinen Wehrpflicht.Das hat Verfassungscharakter.Deswegen möchte ich betonen: Dass wir eine Armee habenund dass es eine Milizarmee ist, das ist ohnehin Bestandteilder Verfassung, wie immer Sie entscheiden.
Rhinow René (R, BL), Berichterstatter: Wir müssen uns be-wusst sein, dass wir heute den Begriff «Miliz» nirgends imVerfassungsrecht verankert haben. Wenn wir just in dieserZeit neu einen Verfassungsbegriff «Miliz» schaffen, dann la-
Constitution fédérale. Réforme 72 E 21 janvier 1998
Bulletin officiel de l’Assemblée fédérale / Tiré à part
den wir uns auch Auslegungsprobleme auf, die wir heute sonicht haben.Am Charakter der Miliz wird nichts geändert. Das muss ichdeutlich unterstreichen. Das haben alle gesagt. Wir möchtennur nicht, dass neu ein Verfassungsbegriff «Miliz» entsteht,bei dem man sich dann fragen muss: Was soll es bedeuten,wenn dieser nach 150 Jahren plötzlich neu in der Verfassungerscheint?Das ist der Grund, warum der Begriff «Miliz» von der Kommis-sion nicht als Verfassungsbegriff aufgenommen worden ist.
Abs. 1 – Al. 1
Abstimmung – VoteFür den Antrag der Kommission 20 StimmenFür den Antrag Spoerry 16 Stimmen
Abs. 2, 3 – Al. 2, 3Angenommen – Adopté
Art. 55Anträge der Kommissionen: BBlPropositions des commissions: FF
Aeby Pierre (S, FR), rapporteur: D’abord le titre de l’article:en français, nous avons «Service militaire et service de rem-placement»; en allemand, «Militär- und Ersatzdienst». Je nesuis pas compétent pour vous résumer toute la discussion,mais l’abandon du terme «Wehrpflicht», considéré commedésuet, a fait l’objet de passablement de discussions cheznos collègues alémaniques. Finalement, c’est sans opposi-tion que ce nouveau titre a été adopté.Pour le reste, la formulation de la commission opère un trèsléger rééquilibrage – homéopathique, mais c’était voulu – en-tre le service militaire comme tel et le service de remplace-ment ou le service civil de remplacement. On retrouve àl’alinéa 1er: «Tout homme de nationalité suisse est astreintau service militaire. La loi prévoit un service civil de rempla-cement.» Selon l’alinéa 2, «les Suissesses peuvent servirdans l’armée à titre volontaire». Ensuite, aux alinéas 3 et 4,on retrouve les principes du projet du Conseil fédéral avecquelques modifications rédactionnelles qui ne sont pas d’im-portance fondamentale.Enfin, on biffe l’expression «subie pendant le service» àl’alinéa 5 relatif au principe de la compensation du revenupour les journées de service effectuées. Il semblait à la com-mission que cela allait de soi et que ce n’était pas non plusforcément toujours pendant le service, mais qu’on s’évitaitdes difficultés d’interprétation en mentionnant simplement la«juste compensation pour la perte de revenu».
Angenommen – Adopté
Art. 56Anträge der Kommissionen: BBlPropositions des commissions: FF
Aeby Pierre (S, FR), rapporteur: L’article 56 correspond auxarticles 20 à 22 de la constitution actuelle. Il a fait l’objet depeu de discussion. Il n’a été combattu par personne.C’est le projet du Conseil fédéral qui a été accepté ici commetel.
Angenommen – Adopté
Art. 57Anträge der Kommissionen: BBlPropositions des commissions: FF
Aeby Pierre (S, FR), rapporteur: A l’article 57 intitulé «Pro-tection civile», on pose le principe de l’organisation de la pro-tection civile pour la population et le territoire de notre pays.Pour l’essentiel, nous avons repris en commission la formu-lation du projet du Conseil fédéral, tout en modifiant quelquepeu la disposition relative aux biens culturels, étant entendu
que les biens culturels ont été considérés comme faisant par-tie de la protection générale des biens.Pour le reste, nous avons harmonisé l’article 57 alinéa 5avec l’article 55 alinéa 5 pour ce qui concerne la perte de re-venu.
Angenommen – Adopté
Art. 57aAnträge der Kommissionen: BBlPropositions des commissions: FF
Aeby Pierre (S, FR), rapporteur: En ce qui concerne la sys-tématique, la commission a voulu, en plaçant dans lasection 2a – il faut quand même le rappeler – la formation, larecherche et la culture, donner plus d’importance à ce chapi-tre qui représente en quelque sorte ce que la constitution ditde la matière grise ou du capital humain du pays. C’estcomme on veut. Placée plus loin, entre l’énergie, les trans-ports et l’économie, un peu égarée, cette section perdait unpeu de son importance. Il est juste que la commission aitvoulu donner à cette section l’importance qu’elle mérite.Article 57a, «Formation» – c’est l’article 78 du projet du Con-seil fédéral, qui a donc été avancé: le principe de base qui estposé est celui que l’instruction publique relève de la compé-tence des cantons. Ce principe, auquel nous sommes fonda-mentalement attachés en Suisse, à tort peut-être, n’a jamaisété mis en discussion.A l’alinéa 2, vous trouvez le principe de l’enseignement debase obligatoire et gratuit. Ce sont des principes propres àtous les Etats démocratiques.A l’alinéa 3, renforcement voulu dans l’expression des res-ponsabilités de la Confédération en ce qui concerne la forma-tion professionnelle: l’aspect de nouvelles répartitions des tâ-ches et de nouvelles péréquations entre les cantons et laConfédération, les résultats issus de la consultation et, de-puis, la prise de position assez claire du Conseil fédéral n’ontévidemment pas été absents de nos débats.A l’alinéa 4, nous mentionnons la gestion des hautes écolestechniques, confiée à la Confédération, sans les mentionneren détail ici.Enfin, à l’alinéa 5, il s’agit de la question de la laïcité de l’en-seignement public obligatoire.Nous retrouvons donc à l’article 57a tous les grands princi-pes concernant la formation et l’instruction publique, telsqu’ils doivent figurer dans une constitution moderne.Signalons aussi que nous ne mettons absolument pas à malla réalité constitutionnelle vécue et que cet article ne nouspose aucun problème par rapport au concept de la mise àjour.
Angenommen – Adopté
Art. 57bAnträge der Kommissionen: BBlPropositions des commissions: FF
Aeby Pierre (S, FR), rapporteur: L’article 57b, «Recherche»,a été adopté dans la version du projet du Conseil fédéral,cela correspond à l’article 79 de celui-ci.Cet article a été adopté sans opposition. La commission a sa-lué l’exigence de subordonner le soutien de la Confédérationà l’existence d’une coordination. Elle a salué également lapossibilité conférée par l’article 3 de gérer des centres de re-cherche qui doivent être, aujourd’hui dans un Etat moderne,dans les compétences données aux pouvoirs publics.
Angenommen – Adopté
Art. 57cAnträge der Kommissionen: BBlPropositions des commissions: FF
Aeby Pierre (S, FR), rapporteur: L’article 57c, nouvellementintroduit par la commission par rapport au projet du Conseil
21. Januar 1998 S 73 Bundesverfassung. Reform
Amtliches Bulletin der Bundesversammlung / Separatdruck
fédéral, peut surprendre. Pourtant, c’est un fait que la Confé-dération n’a pas en soi une compétence explicite aujourd’huien matière de statistique. Et qui parle de statistique, parle derécolte de données, de traitement de données, de questionsextrêmement délicates. La commission a estimé, après avoireu un échange de correspondance avec l’Office fédéral de lastatistique et après avoir questionné de manière approfondieles représentants du Département fédéral de justice et policedans ce domaine, qu’une compétence explicite de la Confé-dération en matière de collecte de données à des fins statis-tiques avait sa place dans une constitution mise à jour.C’est pour cette raison que l’on trouve cet article 57c dans leprojet de la commission.
Rhinow René (R, BL), Berichterstatter: Gestatten Sie mireine kleine Ergänzung zu den Ausführungen von Herrn Aeby:Wir finden hier eine Rosine aus der bundesrätlichen Bot-schaft, die ich Ihnen nicht vorenthalten möchte. Auf Seite281f. wird vom Bundesrat ausführlich begründet, warum einStatistikartikel notwendig ist. Dort heisst es etwa, im Rahmender Nachführung der Bundesverfassung sei es naheliegend,eine Klärung vorzunehmen und die Statistikkompetenz desBundes in der Bundesverfassung zu verankern. «Der Bun-desrat schlägt deshalb vor, einen allfälligen Statistikartikeldurch eine Kompetenz zur Gesetzgebung im Registerbereichzu vervollständigen.» Aber ohalätz – im Verfassungsentwurfvon 1996 findet sich kein Statistikartikel.Ich möchte mich nicht zu einer These versteigen, weder der-gestalt, dass die Botschaft im Bundesrat nicht gelesen wor-den, noch dass im Bundesrat der Artikel nachträglich durch-gefallen ist und man vergessen hat, die Botschaft anzupas-sen. Jedenfalls haben wir ihn wieder in den Verfassungsent-wurf eingesetzt und möchten vom Bundesrat gern den Dankdafür erhalten. (Heiterkeit)
Büttiker Rolf (R, SO): Ich bin froh, dass dieser Statistikartikeljetzt in der Verfassung ist, obwohl er erstens über die Nach-führung eigentlich hinausgeht und zweitens in Absatz 2 auchdie Kompetenzen der Kantone beschneidet. Ich möchte aberverlangen, dass dieser Statistikartikel nicht toter Buchstabebleibt, Herr Bundesrat. Ich weiss, dass ich bei Ihnen beim fal-schen Bundesrat bin. Aber ich hoffe, Herr Bundesrat, dassbei der Volkszählung 2010 dieser Artikel auch zum Tragenkommt und uns etwa 100 Millionen Franken Einsparungbringt.
Leuenberger Moritz, Bundesrat: Ich bin aufgefordert wordenzu danken, und ich tue das sehr gerne. Ich bin auch glücklichdarüber, dass dieser Statistikartikel aufgenommen wird.Ich möchte betonen, dass die Reihenfolge der einzelnen Be-reiche in den Artikeln 57a bis 57l mit der Bedeutung ihres In-haltes nichts zu tun hat, sonst käme sicher die Kultur nichtnach dem Sport und die Statistik käme nicht vor der Jugend-und Erwachsenenbildung. Das sind andere Kriterien, die hiergewählt wurden.
Angenommen – Adopté
Art. 57dAnträge der Kommissionen: BBlPropositions des commissions: FF
Aeby Pierre (S, FR), rapporteur: Cet article, qui correspondà l’article 80 du projet du Conseil fédéral, a été adopté dansla version de celui-ci par la commission qui n’a pas tenu dediscussions extrêmement approfondies en la matière.Elle a toutefois salué au passage le fait que, dans le respectde l’autonomie cantonale en matière d’instruction, la Confé-dération pouvait prendre elle-même des mesures destinéesà promouvoir la formation. Cela n’a pas été considéré commecontraire au principe général que l’instruction publique estune compétence cantonale.
Angenommen – Adopté
Art. 57eAnträge der Kommissionen: BBlPropositions des commissions: FF
Aeby Pierre (S, FR), rapporteur: Il y a passablement de mo-difications à l’article 57e.Tout d’abord, une remarque que m’ont faite très gentimentles représentants de l’administration: il semblerait qu’il y aitune toute petite erreur typographique, mais grosse pour lesens, dans le dépliant en allemand. Il s’agit bien de «Ju-gend», d’un côté, c’est-à-dire des jeunes, et de la formationdes adultes, de l’autre, et en aucun cas de la formation desjeunes. Le trait d’union après le «d» de «Jugend» doit doncdisparaître dans le titre de l’article, m’a-t-on dit, pour qu’il y aitconcordance.La lecture de l’article montre bien évidemment que l’on parledes besoins de la jeunesse et des enfants, d’un côté, et de laformation des adultes, de l’autre, mais non pas de la forma-tion de la jeunesse. Si, dans mes propos, il devait y avoirquelque chose de pas clair, je laisserai le soin à M. Rhinowde me corriger ou de compléter ces explications.La commission a voulu introduire dans cet article des dispo-sitions en faveur de l’enfance et de la jeunesse. Nous avonscherché à prévoir en plusieurs endroits de la constitution dequelle manière encourager et protéger plus particulièrementles enfants et les jeunes dans notre pays. Nous avons trouvéla solution. Nous n’avons pas trouvé de solution dans lesdroits fondamentaux des individus, parce que la protectionde la jeunesse ne permettait pas d’entrer dans le cataloguedes droits fondamentaux. Dans les buts sociaux, nous avonsévoqué cette question, mais en relation avec les conséquen-ces économiques de l’âge, notamment. Nous avons aussiévoqué la famille, et c’est indiqué dans ce contexte.La commission a voulu rompre une lance en faveur de la jeu-nesse. C’est pourquoi nous retrouvons à l’alinéa 1a un élé-ment assez nouveau pour la Confédération et les cantons:c’est d’avoir à tenir compte, dans l’accomplissement de leurstâches, des besoins particuliers des enfants et des jeunes,surtout en matière d’encouragement et de protection.Ensuite, à l’alinéa 1er, nous parlons des activités extrascolai-res des enfants et des jeunes, ainsi que de la formation desadultes que la Confédération peut favoriser en complémentdes mesures cantonales.S’il y a donc un article pour les jeunes dans la constitution,c’est à l’article 57e qu’on le trouve. Je dis cela, car plusieursd’entre nous ont été fortement sollicités, à un moment donnédes délibérations, par diverses organisations de jeunessepour que la constitution mentionne de façon plus explicite,d’une manière ou d’une autre, ces besoins de protection etd’encouragement accrus pour cette catégorie de notre popu-lation. Nous retrouvons donc tout ceci à l’article 57e.
Rhinow René (R, BL), Berichterstatter: Eine kleine Ergän-zung zu den Ausführungen des Kommissionssprechers:Absatz 1a ist das Resultat der Kontakte, die wir mit den Ju-gendorganisationen gepflegt haben. Er entspricht weitge-hend – wenn auch nicht ganz – ihren Wünschen und ist des-halb für die Jugend in diesem Land von ausserordentlichgrosser Bedeutung. Er ist damit zweifellos auch von symbo-lischer Bedeutung. Ich möchte festhalten, dass er sich nichtnur auf den Bereich der Bildung beschränkt, obwohl dieserArtikel hier im Abschnitt über Bildung, Forschung und Kultursteht. Die Rücksichtnahme auf Förderungs- und Schutzbe-dürfnisse von Kindern bezieht sich nicht nur auf die Ausbil-dung im engeren Sinne, sondern ist ein allgemeines Anliegender Förderung von Kindern und Jugendlichen. Das möchteich zuhanden der Materialien festhalten.
Angenommen – Adopté
Art. 57fAnträge der Kommissionen: BBlPropositions des commissions: FF
Constitution fédérale. Réforme 74 E 21 janvier 1998
Bulletin officiel de l’Assemblée fédérale / Tiré à part
Aeby Pierre (S, FR), rapporteur: L’article sur le sport reprendles principes constitutionnels existants (art. 27quinquies cst.).Il n’a pas fait l’objet de débats fondamentaux en commission.Nous l’avons accepté dans la version du Conseil fédéral.
Angenommen – Adopté
Art. 57gAnträge der Kommissionen: BBlPropositions des commissions: FF
Antrag RochatAbs. 2(die Änderung betrifft nur den französischen Text)
Antrag SimmenAbs. 1Für den Bereich der Kultur sind primär die Kantone zustän-dig.Abs. 2.... unterstützen und, unter Beachtung der kantonalen Zu-ständigkeiten, eigene Massnahmen ergreifen.
Proposition RochatAl. 2La Confédération peut promouvoir des activités culturellesprésentant un intérêt national.
Proposition SimmenAl. 1La culture est en premier lieu du ressort des cantons.Al. 2.... un intérêt national et prendre des mesures propres en te-nant compte des compétences cantonales.
Simmen Rosemarie (C, SO): Sowohl der Kommissionspräsi-dent als auch der Bundesrat und verschiedene Sprecher ha-ben in ihren Eintretensvoten darauf hingewiesen, dass die«mise à jour» der Verfassung, die wir jetzt vornehmen, denZweck hat, den Verfassungstext der gelebten Wirklichkeit an-zunähern. In diesem Sinne ist die Aufnahme dieses Kulturar-tikels sicher auch ein Nachvollzug dessen, was in unseremLande bereits Tatsache ist.Aufgrund meiner Erfahrungen, die ich auf dem Gebiet derKulturförderung und Kulturpflege auf Bundesebene gemachthabe, möchte ich den Antrag der Kommission etwas präzisie-ren und somit noch etwas näher an die Realität heranführen.Wenn Sie einverstanden sind, spreche ich zu den Absät-zen 1 und 2 gemeinsam, denn das Ganze hat einen innerenZusammenhang.Wirklichkeit ist, dass in unserem föderalistischen, mehrspra-chigen und multikulturellen Land das Schwergewicht der Kul-turförderung ganz bestimmt immer bei den Kantonen liegenwird. Auch das ist Status quo: Wir haben weder ein National-theater noch eine Nationalgalerie; alle diese grossen Vorha-ben sind bei den Kantonen und allenfalls bei den Städten an-gesiedelt. Auch der Aufwand, den der Bund für die Kultur-pflege betreibt, ist natürlich wesentlich kleiner als das, wasdie Kantone und vor allem auch Private leisten.Aber es gibt nun doch Gebiete, wo dem Bund eine eigeneFunktion zukommt. Denken Sie z. B. an die Massnahmen,die die Verständigungskommissionen unserer beiden Rätevorgeschlagen und gefordert haben: Massnahmen für denkulturellen und nationalen Zusammenhalt unseres Landes,zwischen den verschiedenen Sprach- und Kulturregionen,oder denken Sie an die kulturelle Präsenz der Schweiz imAusland, wo ebenfalls die Schweiz als Land gefordert ist unddargestellt werden soll.Es ist auch nicht so – damit komme ich noch kurz aufAbsatz 2 zu sprechen –, dass der Bund kulturelle Bestrebun-gen nur unterstützen können soll; das soll er selbstverständ-lich. Aber er muss auch die Möglichkeit haben, auf diesemGebiet selber aktiv zu werden und eigene Massnahmen zutreffen – selbstverständlich immer unter Beachtung der kan-tonalen Zuständigkeiten. Hier ist also der seinerzeit so ge-
fürchtete und berüchtigte «eidgenössische Kulturvogt», dernoch unsere Ahnen bei der Verfassunggebung von 1848 sosehr geschreckt hat, sicher nicht zu fürchten.Was ich Ihnen hier beantrage, nämlich die Anerkennung,dass die Kulturförderung primär Sache der Kantone ist unddass der Bund unter gebührender Beachtung der kantonalenZuständigkeit auch selbst tätig werden kann, ist nichts ande-res als das Niederschreiben einer lange geübten, bewährtenPraxis. Wir haben die Zusammenarbeit zwischen Bund undKantonen in Artikel 35a Absatz 1 so festgeschrieben, dassBund und Kantone einander in der Erfüllung ihrer Aufgabenunterstützen und zusammenarbeiten. Artikel 57g in meinererweiterten Version ist sicher nichts anderes als ein erstesBeispiel dafür, wie so etwas funktionieren kann.Ich bitte Sie deshalb, meinem Antrag zuzustimmen.
Präsident: Frau Simmen, Sie haben vielleicht festgestellt,dass in der französischen Fassung die Übersetzung desWortes «primär» verlorengegangen ist. Das wird nachgeholt.Der korrigierte Antrag wird dann aufgelegt.
Simmen Rosemarie (C, SO): Ich habe die französische Ver-sion erst jetzt durchgesehen, und ich möchte die Redaktions-kommission oder die Verwaltung noch bitten zu prüfen, obder Passus «prendre des mesures» der deutschen Formulie-rung «eigene Massnahmen zu ergreifen» entspricht odernicht, damit es klar ist.
Aeby Pierre (S, FR), rapporteur: D’abord, quelques indica-tions concernant la rédaction de l’article 57.Il semble que personne ne souhaite contester le fait que lacommission a décidé de créer, à l’article 57h, un article spé-cifique sur les langues. Ça a déjà été dit dans le débat d’hier,et même d’avant-hier, dans les premières dispositions de laconstitution: nous avons été amenés à évoquer la questiondes langues, non plus vue simplement comme une compo-sante de la culture des différentes régions du pays, maiscomme un principe de base de notre Etat (art. 5 du titre 1er).Les langues ont ici un article qui leur est spécialement con-sacré. Donc, nous parlerons de cette question des languestout à l’heure.Pour en revenir à l’article 57g: dans les trois alinéas qui sub-sistent dans la version proposée par la commission, puisqueles autres alinéas forment une bonne partie de l’article sur leslangues (art. 57h), je suis emprunté pour prendre position aunom de la commission à propos de ce que souhaiterait la pro-position Simmen. L’expérience politique que j’ai me montreque la culture est un point très sensible dans notre pays.C’est une des questions qui peut déchaîner les passions à unmoment donné. Et si l’on dit que la culture est en premier lieudu ressort des cantons – je ne sais pas si «primär» signifie«en premier lieu» –, ça signifie que la Confédération souhai-terait être plus active dans ce domaine. Personnellement, çane me gênerait pas trop. Mais, ayant occupé des responsa-bilités au niveau cantonal notamment, je crois que nous nepouvons pas ici, dans ce Conseil, décider maintenant quenous enlevons aux cantons cette prépondérance absolue ence qui concerne leurs compétences quant à la culture. Jecrains que, du côté des minorités, cela soit ressenti commeune volonté d’une culture confédérale, tout en comprenantbien pour ma part qu’il n’y a aucune mauvaise intention ni vo-lonté de «Kulturkampf», ou que sais-je, dans la propositionSimmen. Mais l’histoire du pays est tout de même assez ré-cente, certaines étapes de cette histoire aussi, et je préfèrequant à moi, en mon nom personnel, m’opposer à la proposi-tion Simmen.Mais on vient de me distribuer une nouvelle version: «.... esten premier lieu du ressort des cantons», c’est bien ça! Cen’est pas très, très méchant vu comme ça. Mais, à mon sens,n’ayant pas pu discuter de cette question en commission, jepréfère aujourd’hui m’opposer à cette proposition.A l’alinéa 2, la proposition Simmen apporte un complément:«.... en tenant compte des compétences cantonales». Iciaussi, je ne vois pas très bien ce qu’on vise par cette modifi-cation. Est-ce qu’il y a des cantons vraiment plus compétents
21. Januar 1998 S 75 Bundesverfassung. Reform
Amtliches Bulletin der Bundesversammlung / Separatdruck
que d’autres en matière de culture? Il se peut aussi que«compétences» soit une traduction imprécise ou mal choisie.Je préfère que, dans cet article intitulé «Culture», on s’entienne à la version de la commission, comportant les trois ali-néas proposés.
Cavadini Jean (L, NE): M. Aeby a dit l’essentiel de ce quiconvenait, mais j’aimerais politiquement demander qu’on neprenne pas en considération la proposition Simmen pour lesraisons suivantes:1. Nous rappelons que nous travaillons à une mise à jour decette constitution dont un des objectifs réside dans la clairerépartition des tâches entre les cantons et la Confédération.Or, nous avons posé comme principe au début des travauxque la compétence qui serait donnée aux cantons devraitl’être de la façon la plus nette, la plus distincte possible, etl’on a réservé bien entendu le champ de l’éducation et celuide la culture.2. Nous vous rappelons qu’il y a eu votation populaire sur unprojet d’article culturel, et que peuple et cantons l’avaient re-fusé à une très faible majorité; on avait refusé de voir inscritedans la constitution une répartition des tâches culturelles.Nous devons être clair.Votre commission a repris ces éléments. Elle a dit: la cultureest du ressort des cantons. Comme nous savons que quel-ques domaines relèvent nécessairement de l’intérêt national,nous avons prévu un alinéa 2 parlant de la capacité pour laConfédération de promouvoir de telles activités.3. Mme Simmen va à l’encontre du raisonnement que je tentede rappeler puisqu’elle introduit en allemand la notion de«primär»: «Für den Bereich der Kultur sind primär die Kan-tone zuständig.» Et de nouveau, dans un premier texte fran-çais, la notion que Mme Simmen introduit avait disparu.Une deuxième version ne nous rassure pas plus, je diraismême qu’elle nous inquiète puisqu’elle dit: «La culture est enpremier lieu du ressort des cantons.» On réintroduit l’ambi-guïté que l’on voulait éviter.C’est la raison pour laquelle je vous demande de vous en te-nir à la proposition de votre commission, qui est déjà le résul-tat d’un compromis entre les fédéralistes «sauvages et féro-ces» et les centralistes jacobins qui n’ont que très rarementnotre approbation.Nous vous demandons donc de vous tenir à la claire réparti-tion des tâches et de laisser sans nuance: «La culture est duressort des cantons.»
Leuenberger Moritz, Bundesrat: Bis jetzt war es ja so, dassdas Landesmuseum, die Landesbibliothek und die Pro Hel-vetia weiss Gott auf schwachen juristischen Füssen standen.Soweit ich mich erinnere, wurden sie nämlich – insbesonderedas Landesmuseum Zürich – mit der Präambel der Bundes-verfassung begründet. Zum Glück steht in dieser Präambelnoch der «liebe Gott», denn «wer Gott, dem Allerhöchsten,traut, der hat auf keinen Sand gebaut». Wäre aber Gott nichtin der Präambel, stünden eigentlich sowohl Landesmuseumund Landesbibliothek als auch Pro Helvetia – dies hätte auchfür deren Ex-Präsidentin gegolten – völlig im «luftleerenRaum».Dem soll nun abgeholfen werden, indem ein Kulturartikel indie Verfassung aufgenommen wird. Herzlichen Dank dafür,dass Sie ihn einstimmig akzeptiert haben! Der Bundesratwollte aber nur die heutige Verfassungswirklichkeit nachfüh-ren. Er wollte nicht mehr.Der Antrag Simmen könnte nun dahingehend interpretiertwerden, dass eine Ausweitung einer lokal oder regional an-knüpfenden Kulturpolitik des Bundes ermöglicht würde. DieKantone haben sich in der Vernehmlassung vehement gegeneine solche Tendenz gewehrt. Wir möchten damit auch dasScheitern der Kultur-Initiative von 1986 und des viel modera-teren Gegenvorschlages, was wir bedauern, berücksichti-gen.Ich muss Sie daher im Namen der strikten Fortführung derheutigen Verfassungswirklichkeit ersuchen, den Antrag Sim-men abzulehnen. Dass ich das mit Bedauern tue, setze ichnur in Klammern hinzu.
Abs. 1 – Al. 1
Abstimmung – Vote
Für den Antrag der Kommission 24 StimmenFür den Antrag Simmen 7 Stimmen
Abs. 2 – Al. 2
Rochat Eric (L, VD): Je pourrai être tout à fait bref. Là en-core, il s’agit d’un problème de traduction entre la version al-lemande et la version française. La version allemande ditclairement «kulturelle Tätigkeiten» – «des» activités culturel-les. La version française dit: «les activités culturelles». C’estévidemment très différent.Lorsque la Confédération peut promouvoir «des» activitésculturelles présentant un intérêt national, cela signifie qu’ellepeut choisir parmi toutes les activités culturelles celles qu’elleveut promouvoir. En mettant: «peut promouvoir les activitésculturelles présentant un intérêt national», cela donne un de-voir supplémentaire à la Confédération.Il s’agit bien d’une modification rédactionnelle, d’une ques-tion de traduction entre le texte allemand et le texte français,mais je souhaiterais qu’elle soit bien acceptée par notre Con-seil, parce que cela a des conséquences sur la significationde cet alinéa 2.
Präsident: Frau Simmen hat mitgeteilt, dass ihr Antrag zuAbsatz 2 hinfällig wird, da ihr Antrag zu Absatz 1 abgelehntworden ist.Der Antrag Rochat betrifft den französischen Text.
Angenommen gemäss Antrag RochatAdopté selon la proposition Rochat
Abs. 3–6 – Al. 3–6Angenommen – Adopté
Art. 57hAnträge der Kommissionen: BBlPropositions des commissions: FF
Aeby Pierre (S, FR), rapporteur: L’article 57h est l’article surles langues. Un article qui, soit dit en passant, avait disparudans le projet du Conseil fédéral. La commission a souhaitéun article spécifique sur les langues, dans lequel elle ad’ailleurs intégré, outre l’article 83, l’article 136 du projet duConseil fédéral.L’alinéa 1er correspond à l’article 136 du projet du Conseil fé-déral: il définit les langues officielles de la Suisse et précise,pour le romanche, que c’est aussi une langue officielle avecles personnes qui parlent cette langue pour leurs relationsavec la Confédération.L’alinéa 2 contient un élément de nouveauté. Il reprend pourl’essentiel l’article 83 alinéa 6 du projet du Conseil fédéral,mais il ajoute à cet article 83 alinéa 6 que les cantons«veillent à la répartition traditionnelle des langues et tiennentcompte des minorités linguistiques». Il est très clair que lacommission introduit ici une notion de territorialité de la lan-gue. S’il faut la chercher dans la constitution, c’est ici, àl’alinéa 2, qu’elle figure. La commission a estimé que d’évo-quer la territorialité des langues faisait partie de la protectiongénérale des minorités du pays et a tenu à cet alinéa 2.Pour le reste, les alinéas 3 et 4 reprennent simplement lesalinéas correspondants de l’article 83 du projet du Conseil fé-déral; ils n’ont pas fait l’objet de discussions particulières encommission.
Angenommen – Adopté
Art. 57iAnträge der Kommissionen: BBlPropositions des commissions: FF
Constitution fédérale. Réforme 76 E 21 janvier 1998
Bulletin officiel de l’Assemblée fédérale / Tiré à part
Antrag RochatAbs. 2Streichen
Proposition RochatAl. 2Biffer
Aeby Pierre (S, FR), rapporteur: Je rappelle que cet articleintitulé «Film», au singulier en français, se trouvait perdu(art. 77 du projet du Conseil fédéral) du côté de la politiqueénergétique, tout de suite après la communication par câble,les concessions, etc. Techniquement, la fabrication d’un filmn’a rien à voir avec l’énergie, les télécommunications, laquestion des concessions.Ici, c’est tout autre chose qui est visé par cet article qui re-prend l’article 27ter de la constitution actuelle. La commis-sion établit à l’alinéa 1er la possibilité de «promouvoir la pro-duction cinématographique suisse ainsi que la culture ciné-matographique». A l’alinéa 2, elle prévoit la possibilité d’en-courager «une offre de films variée et de qualité».A l’alinéa 1er, on pose le principe de la compétence; àl’alinéa 2, la commission a rédigé de façon tout à fait nouvellece qui, dans le projet du Conseil fédéral, pouvait être compriscomme on ne sait trop quelle prescription sur la police desconstructions ou autre. La législation sur le cinéma est aussiun instrument de contrôle possible pour l’importation desfilms. En supprimant cet aspect prévu par le Conseil fédéral,la commission a décidé qu’il y avait bien d’autres législationsqui permettent d’agir dans ce domaine, et que ce genre dedisposition n’avait pas sa place dans la constitution.En ce qui concerne la proposition Rochat, si l’on biffe l’ali-néa 2, on prive l’actuelle législation sur les films d’une baseconstitutionnelle importante.Je souhaite qu’on en reste à la version de la commission.
Rochat Eric (L, VD): L’alinéa 1er, nous l’avons dit, est incon-testé et il dit déjà tout: «La Confédération peut promouvoir laproduction cinématographique suisse ainsi que la culture ci-nématographique.» Il est évident qu’avec une base constitu-tionnelle comme celle-ci, la Confédération peut se doter desmoyens en ordonnances et en lois pour régler cette promo-tion si elle souhaite la faire.L’alinéa 2, avec ses relents de culture cinématographiqued’Etat, pose un double problème: celui des définitions, d’unepart, celui des applications, d’autre part.Qu’est-ce déjà qu’un film de qualité? Il y a quelques règlesdes films à succès qui sont connues: la durée des baisers, lesscènes de poursuite en voiture, les scènes de chambre quisont préalablement déterminées et qui sont imposées auxréalisateurs par le producteur. Ces règles existent-elles pourla qualité cinématographique? Le succès d’un film fait-il par-tie de ces critères ou devons-nous, a contrario, considérertrès helvétiquement que tout ouvrage qui est boudé par le pu-blic est un chef-d’oeuvre méconnu? Il est parfaitement im-possible d’édicter des dispositions pour une offre de films dequalité.Et qu’est-ce qu’une offre de films variée? Devons-nous don-ner au Conseil fédéral la possibilité d’édicter des dispositionsprescrivant des quotas de documentaires, de fictions, defilms à intérêt ethnographique, touchant l’enfance ou les per-sonnes âgées, les minorités sexuelles ou religieuses, quesais-je encore? «La Confédération peut promouvoir la pro-duction cinématographique suisse ainsi que la culture ciné-matographique»: nous en avons assez dit avec l’alinéa 1erpour permettre l’indispensable soutien fédéral au cinémasuisse. La liberté des réalisateurs, la liberté du public nousimposent de cesser là nos intrusions dans le domaine de l’in-défini et permettez-moi ce jeux de mots, non pas de l’objectif,mais du subjectif.Je vous recommande de biffer l’alinéa 2 de l’article 57i.
Simmen Rosemarie (C, SO): Ich weiss nicht, ob Herr Rochatmit seinem Streichungsantrag für Absatz 2 der ganzen Sa-che nicht einen Bärendienst erweist. Es ist eine Tatsache,
dass die Filmkultur in der Schweiz sehr unterschiedlich ist; esherrscht wirklich eine Vielfalt. Zum Beispiel unterscheidetsich die Szene des französischsprachigen Films total vonderjenigen des deutschsprachigen. Indem man nun die Mög-lichkeit für den Bund streicht, zur Förderung der Vielfalt ge-wisse Vorschriften zu erlassen, geht man auch dort in derRichtung eines Mehrheitsfilms, wo die grösseren Mittel lie-gen. Aus meiner Erfahrung scheint mir, dass wir gerade inder Schweiz eigentlich gut beraten wären, wenn wir Mass-nahmen, die tendenziell auf die Stärkung von Minderheitenund die Unterstützung der Vielfalt abzielen, unter allen Titelnunterstützen würden.Ich würde Ihnen empfehlen, Absatz 2 nicht zu streichen.
Leuenberger Moritz, Bundesrat: Die Filmförderung ist Teilder Kulturförderung, und der Filmartikel war im ersten Ent-wurf des Bundesrates nicht zufällig beim Radio- und Fern-sehartikel plaziert. Der Kommissionspräsident hat darüberetwas geschmunzelt und gesagt, das gehöre doch nicht dort-hin. Aber die kulturelle Bedeutung des Films hängt natürlichauch mit seinem enormen Verbreitungspotential zusammen.Früher betraf das die Kinos; heute sind es aber in erster Liniedie Fernsehanstalten. Und das ist für die Verbreitung unse-res Kulturgutes – Frau Simmen hat darauf hingewiesen –und, damit zusammenhängend, für unsere nationale Identitätvon eminenter Bedeutung.Deshalb verdient die Filmförderung in der Verfassung – mitAbsatz 2 – erwähnt zu werden. Die Regelungskompetenzwar ja schon bisher in Artikel 27ter der Bundesverfassungenthalten. Würden Sie diesen Absatz 2 streichen, nähmenSie eine materielle Änderung vor.Ich ersuche Sie, davon abzusehen – auch unter dem Aspektder Fortführung des geltenden Rechtes, den wir bis jetzthochhielten.
Abs. 1 – Al. 1Angenommen – Adopté
Abs. 2 – Al. 2
Abstimmung – VoteFür den Antrag der Kommission 29 StimmenFür den Antrag Rochat 5 Stimmen
Art. 57kAnträge der Kommissionen: BBlPropositions des commissions: FF
Aeby Pierre (S, FR), rapporteur: C’est une section impor-tante de notre constitution et la commission en a très longue-ment examiné la systématique propre.Après plusieurs tentatives de structurer ce chapitre d’une fa-çon différente par rapport à celle proposée par le Conseil fé-déral, nous avons renoncé à le faire, étant entendu qu’il y adans ces dispositions des aspects extrêmement sensibles.Plusieurs de ces dispositions ont fait l’objet de votations po-pulaires épiques et la commission n’a pas voulu donner l’im-pression, tout à coup, qu’il s’agissait de toucher à, notam-ment, certaine protection du paysage, de sites ou du patri-moine en modifiant par trop la structure de rédaction des ar-ticles.On peut dire que la section 3, pour une constitution mise àjour, est certainement celle dont la structure et la rédactionpèchent le plus et où l’on ne constate pas de grands progrèspar rapport à la constitution actuelle. Il faut aussi dire quec’est précisément le domaine dans lequel des votations po-pulaires récentes ont introduit des éléments, et qu’on auraitpu nous soupçonner de vouloir contourner la volonté popu-laire si on avait changé trop de choses.Il est vrai que la systématique concernant les eaux, les forêts,la protection de l’environnement, l’aménagement du terri-toire, la protection du patrimoine pourrait ici être meilleure. Entout cas, le jour où des professeurs de droit enseignerontcette matière à leurs élèves, ils seront obligés de prendrepeut-être une autre structure.
21. Januar 1998 S 77 Bundesverfassung. Reform
Amtliches Bulletin der Bundesversammlung / Separatdruck
Toujours est-il que la commission a fait preuve d’audace dèsle début. Elle a voulu ancrer le développement durablecomme principe de base, comme principe fondamental, nonpas seulement pour cette section, mais aussi pour notrepays, pour la Suisse: «La Confédération et les cantons agis-sent en permanence en faveur d’un rapport équilibré entre lanature et sa capacité de renouvellement et son utilisation parl’homme.» Ce n’est pas inintéressant de disposer tout au dé-but de cette section d’une définition, parmi d’autres, mais en-fin d’une définition du développement durable.C’est vrai qu’aujourd’hui, dans notre population, beaucoupde personnes ne savent pas encore exactement ce qu’on en-tend par «développement durable», en tout cas en Suisse ro-mande. Je ne sais pas ce qu’il en est dans les autres aireslinguistiques. On peut donc saluer une définition du dévelop-pement durable et cette notion fondamentale de «capacité derenouvellement» des richesses qui nous sont données depar notre milieu naturel.Ce développement durable, nouveau chapeau de cette sec-tion, c’est aussi, on peut le dire, la réalité constitutionnelle vé-cue. Ça n’est pas aller au-delà d’une mise à jour: on a beau-coup parlé de développement durable, à titre d’exemple,dans le débat sur l’Exposition nationale 2001. Celle-ci, qui seveut la projection de notre passé et de notre présent dansl’avenir, accorde une large place au développement durable.Il n’y a rien de gênant.C’est sans opposition que la commission a accepté l’ar-ticle 57k.
Angenommen – Adopté
Art. 57lAnträge der Kommissionen: BBlPropositions des commissions: FF
Aeby Pierre (S, FR), rapporteur: Il y a beaucoup de choses àdire sur cet article 57l et sur l’article 58 suivant concernantl’aménagement du territoire, et ça me paraît fondamental queces choses soient dites ici.Précisément à un moment où l’administration fédérale est enrestructuration permanente, où des offices changent ou sontsusceptibles de changer de département, on pourrait êtretenté de déduire de l’emplacement de l’article 57l, «Protec-tion de l’environnement», qu’il y a primauté par rapport àl’article 58, «Aménagement du territoire». En fait, dans lesdébats de la commission, il était très clair que les tâches deprotection de l’environnement et d’aménagement du territoiresont à tout le moins équivalentes. Une minorité de membresde la commission estimait même que l’aménagement du ter-ritoire aurait dû occuper le deuxième rang, à la suite immé-diate du développement durable, et que la protection de l’en-vironnement était un moyen d’aménager harmonieusementnotre territoire. Donc, ça n’est pas sans discussion et pas parhasard que l’on trouve maintenant les articles 57l et 58 dansl’ordre qu’ils occupent dans cette section. Au cours de la pro-cédure de consultation également, cette question a fait l’objetde passablement de prises de position de différents milieuxtrès sensibles à cet aspect des choses.L’article 57l, «Protection de l’environnement», doit être con-sidéré comme la première concrétisation de l’article 57k,«Développement durable». Comment est-ce qu’on assure ledéveloppement durable? En protégeant l’environnement. Al’alinéa 1er, la compétence de la Confédération est claire-ment donnée concernant la protection de l’homme, du milieunaturel, les atteintes nuisibles et incommodantes. Lesalinéas 2 et 3 correspondent à l’article 59 du projet du Con-seil fédéral et ne s’écartent absolument pas des dispositionsconstitutionnelles que nous connaissons déjà aujourd’hui.
Maissen Theo (C, GR): Ich habe eine Frage und eine Bemer-kung zu Artikel 57l. Die Frage ist zu Absatz 2. Wenn man denzweiten Satz liest, «Die Kosten der Vermeidung und Beseiti-gung tragen die Verursacher», so fragt man sich als Leser:die Vermeidung und Beseitigung wovon? Ich habe den Ein-druck, dass das vom Sprachlichen her nicht genügt. Natürlich
macht man gedanklich den Sprung zu Abfällen usw., aber fürmich ist dieser Satz von der Aussage her nicht befriedigend.Eine materielle Bemerkung: Es geht hier um die Anwendungdes Verursacherprinzips, das im Umweltschutz grundsätzlichrichtig ist. Aber wir haben uns auch im Zusammenhang mitder Revision des Gewässerschutzgesetzes darüber unter-halten, dass das Verursacherprinzip eben nicht einfach soumgesetzt werden kann, weil berücksichtigt werden muss,dass es natürlich Verursachungen gibt, die man nicht volldem Verursacher anlasten kann. Ich denke an den Umwelt-schutz in schwach besiedelten Gebieten. Da entstehen der-art unverhältnismässige Kosten – sei das beim Abwasseroder zum Teil auch bei der Abfallbewirtschaftung –, dass esnicht zumutbar ist, einfach zu sagen: Die sind die Verursa-cher, die bezahlen dafür. Wenn wir das machen, dann lehnenwir eine Besiedlung des Landes, wie wir sie möchten – haus-hälterisch und sinnvoll, wie es mit der Raumplanung ange-strebt wird – eigentlich ab. Dann verhindern wir sie damit,weil diese Gebiete, wenn das Verursacherprinzip einfach soumgesetzt wird, nicht mehr besiedelbar sind; es wird für deneinzelnen zu teuer.Ich habe hier keinen Vorschlag gemacht, wie man das än-dern kann. Denn ich bin in der Verfassungsmaterie zuwenigbewandert, um sagen zu können, wie man das formulierensollte. Ich meine jedoch, dass man dieser Frage nachgehenmüsste und z. B. zuhanden der Materialien erklären sollte,dass es dort, wo die Verursacherkosten übermässig werden,wenn man sie überwälzt, weiterhin Ausgleichsmöglichkeitengibt. Das wäre das eine. Das andere wäre, in der Kommis-sion noch entsprechende Formulierungen zu finden.
Rhinow René (R, BL), Berichterstatter: Hier werden zweiGrundsätze aufgenommen, die unserem Umweltrecht zu-grunde liegen. Es ist die Crux jeder kurzen Formulierung inder Verfassung, dass man nicht alle Ausnahmen und Spezi-alfälle mit hineintragen kann. Aber es handelt sich hier nichtum eine Vollzugs- oder Verordnungsbestimmung, die nunwie eine gewöhnliche Norm tel quel anwendungsfähig wäre,sondern um zwei Prinzipien. Prinzipien sind an und für sichnie nach dem Schema «alles oder nichts», sondern im Sinneder Optimierung anzuwenden. Ich habe vom Verfassungs-recht her kein Problem, als Kommissionspräsident festzuhal-ten, dass diese Bestimmung als Prinzip anzuwenden ist, dasdurch Gesetze, Verordnungen und die Praxis zu konkretisie-ren ist.
Leuenberger Moritz, Bundesrat: Ich kann mich den Ausfüh-rungen von Herrn Rhinow anschliessen. Einerseits beinhaltetder Artikel eine Regelung der Kompetenzen von Bund undKantonen, und zum andern hält er das Verursacherprinzipfest; gemäss diesem Verursacherprinzip ist nachher zu legi-ferieren.Die Diskussion, wie dann zu legiferieren ist und was demVerursacherprinzip in Tat und Wahrheit jeweilen entspricht,haben wir beispielsweise bei der leistungsabhängigenSchwerverkehrsabgabe und der Berechnungsweise gehabt.Das ist an sich ein plastisches Beispiel dafür, dass sich wis-senschaftlich ohnehin nie ganz genau ermitteln lässt, worindie Ursache besteht, wer der Verursacher ist und welche Ko-sten er genau verursacht. Das ist immer auch eine politischeund gesellschaftliche Ermessensfrage, die bei der Gesetzge-bung, d. h. im Parlament, ihren Ausdruck finden wird. DasPrinzip als generelle Stossrichtlinie und die Legitimation,dem Verursacher dann die entsprechenden Kosten zu über-bürden, sind in diesem Artikel festgelegt.
Präsident: Ein Änderungsantrag ist nicht gestellt. Die Be-merkungen fliessen in die Materialien ein. Es wird Sache desZweitrates sein, allenfalls darauf zurückzukommen.
Angenommen – Adopté
Art. 58Anträge der Kommissionen: BBlPropositions des commissions: FF
Constitution fédérale. Réforme 78 E 21 janvier 1998
Bulletin officiel de l’Assemblée fédérale / Tiré à part
Aeby Pierre (S, FR), rapporteur: Ici, la commission a tenu àclarifier et à exprimer d’une autre manière la façon dont lescantons sont associés à la mise en oeuvre de l’aménage-ment du territoire en Suisse. A l’alinéa 1er, on rappelle queles principes applicables sont de compétence fédérale – c’esttrès clair dans notre ordre juridique, cela ne change pas –,mais on dit: «Cet aménagement incombe aux cantons et sertune utilisation judicieuse et mesurée du sol et une occupationrationnelle du territoire.» On fixe donc de façon plus claire,notamment en français, mais aussi en allemand, commentles cantons doivent procéder à ces principes d’aménage-ment. La formulation de la commission paraît ici meilleure.L’alinéa 2 est celui du projet du Conseil fédéral. Il fixe la tâcheessentielle d’encouragement et de coordination de la part dela Confédération en matière d’aménagement du territoire, en-couragement et coordination qu’on n’a pas toujours connuspar le passé dans ce domaine. Dans l’optique notamment denos infrastructures, cette question revêt une acuité particu-lière aujourd’hui.En ce qui concerne l’alinéa 3: ce n’est pas seulement la Con-fédération, comme le prévoyait le Conseil fédéral, qui doitprendre en considération les exigences majeures de l’amé-nagement du territoire, mais les cantons également ont cetteresponsabilité. C’est pour ça que la commission a ajouté queles cantons prennent aussi en considération les exigencesde l’aménagement du territoire.
Angenommen – Adopté
Art. 59Anträge der Kommissionen: BBlPropositions des commissions: FF
Präsident: Artikel 59 ist als Folge der Umstellung mit Arti-kel 57l dahingefallen.
Angenommen – Adopté
Art. 60Anträge der Kommissionen: BBlPropositions des commissions: FF
Antrag RhynerAbs. 1Für die haushälterische Nutzung .... Einwirkungen des Was-sers werden durch den Bund unter Berücksichtigung der ge-samten Wasserwirtschaft:a. Grundsätze festgelegt über die Erhaltung und Erschlies-sung der Wasservorkommen, über die Nutzung der Gewäs-ser zur Energieerzeugung und für Kühlzwecke sowie überandere Eingriffe in den Wasserkreislauf;b. Vorschriften erlassen über den Gewässerschutz, die Si-cherung angemessener Restwassermengen, den Wasser-bau, die Sicherheit der Stauanlagen und die Beeinflussungder Niederschläge.Abs. 2, 3StreichenAbs. 4Über die Wasservorkommen verfügen unter Vorbehalt priva-ter Rechte die Kantone oder die nach der kantonalen Gesetz-gebung Berechtigten. Sie können für die Wassernutzung ....
Proposition RhynerAl. 1Afin de pourvoir à l’utilisation rationnelle des eaux, à .... dom-mageable de l’eau, la Confédération, en tenant compte del’économie des eaux:a. fixe les principes applicables à la conservation et à la miseen valeur des ressources en eau, à l’utilisation de l’eau pourla production d’énergie et le refroidissement et à d’autres in-terventions dans le cycle hydrologique;b. édicte des dispositions sur la protection des eaux, sur lemaintien des débits résiduels appropriés, sur l’aménagementdes cours d’eau, sur la sécurité des barrages et sur les inter-ventions de nature à influencer les précipitations.
Al. 2, 3BifferAl. 4Les cantons, ou ceux qui en ont le droit en vertu de la légis-lation cantonale, disposent des ressources en eau, sous ré-serve des droits des personnes privées. Ils peuventprélever ....
Aeby Pierre (S, FR), rapporteur: L’article 60 résume dans sixalinéas la politique fédérale en matière d’eaux et déterminetrès clairement où sont les compétences. On y retrouve lesdomaines traditionnels qu’on trouve dans les articles 24 et24bis de la constitution actuelle.Nous avons à l’alinéa 1er les dispositions sur l’utilisation ra-tionnelle des ressources en eau; à l’alinéa 2, le principe trèsimportant de la conservation et de la mise en valeur des res-sources en eau; à l’alinéa 3, la question de la protection deseaux, expressément voulue et approuvée par le corps élec-toral.A l’alinéa 4 relatif à la compétence cantonale, la commissiona apporté une modification dans le sens que les cantons peu-vent prélever dans les limites prévues par la législation fédé-rale une taxe pour l’utilisation de cette eau, et que la Confé-dération, de son côté, a le droit d’utiliser les eaux pour sesentreprises de transport. On a donc ici un domaine extrême-ment sensible qui a fait l’objet de discussions en commission,mais où, très facilement, un consensus a été trouvé pour nepas toucher au principe actuel de compétence cantonale enla matière.Ensuite, l’alinéa 5 est classique en la matière et l’alinéa 6rappelle la tâche de la Confédération de prendre en considé-ration, véritablement et concrètement, les intérêts des can-tons.
Rhyner Kaspar (R, GL): Artikel 60 dieser Verfassungsvor-lage soll an die Stelle des geltenden Artikels 24bis der gelten-den Bundesverfassung treten. Der Artikel 24bis der Bundes-verfassung ist im Jahre 1975 totalrevidiert worden. Er ist alsoverhältnismässig neu oder noch jung, so dass sich fragenlässt, ob man ihn überhaupt ändern soll, denn es ist eine Än-derung. Die Botschaft sagt nämlich nicht, dass er durch so-genanntes ungeschriebenes Verfassungsrecht irgendwieüberholt oder sonst beanstandet worden wäre. Es kann alsobei der heutigen Verfassungsreform nur um die angestrebteVereinheitlichung von Dichte und Sprache gehen. Eine sol-che Vereinheitlichung darf aber nicht zu materiellrechtlichenÄnderungen führen. Dazu käme es aber, auch wenn nichts inder Botschaft steht.Ich begründe das folgendermassen: Absatz 1 des Verfas-sungsentwurfes scheint auf den ersten Blick den Ingress desgeltenden Absatzes 1 von Artikel 24bis der Bundesverfas-sung zu übernehmen. Dieser Ingress ist jedoch eine Zweck-bestimmung, die besagt, wozu die nachfolgend aufgeführtenKompetenzen zu dienen haben.Mit der vorgeschlagenen neuen Fassung von Absatz 1 desEntwurfes dagegen überträgt man dem Bund mit der «unbe-schränkten Sorge» eine Aufgabe, welche eine Generalkom-petenz beinhaltet. Die Kompetenzen des Bundes werdenausgeweitet, denn mit dem Begriff «sorgen» läuft es daraufhinaus, dass der Bund die uneingeschränkte Einflussnahmeauf die Wasserhoheit ausüben kann. Eine solche General-kompetenz hat das Parlament aber, wie in der Botschaft aufSeite 250 bemerkt ist, bei der Revision von 1975 zurückge-wiesen. Es hätte auch keinen Sinn, in den Absätzen 2 und 3des Entwurfes zwischen Grundsatzgesetzgebung und Vor-schriften zu unterscheiden, wenn der Bund gestützt aufAbsatz 1 in jedem Fall doch wieder umfassend zuständigist.Der Vorentwurf von 1995 enthielt übrigens keine Bestim-mung, die Absatz 1 des Entwurfes von 1996 entspricht. Auchtut sich die Botschaft etwas schwer damit, dass dem Bundbei der Wasserwirtschaft unterschiedliche Kompetenzen zu-stehen. Sie sehen das auf Seite 250 der Botschaft. Dies istaber dadurch begründet, dass die Wasserwirtschaft eineweitläufige Materie mit verschiedenartigen Aspekten bildet,
21. Januar 1998 S 79 Bundesverfassung. Reform
Amtliches Bulletin der Bundesversammlung / Separatdruck
so dass Unterschiede bei den Bundeskompetenzen in derNatur der Sache liegen.Die Entstehungsgeschichte von Artikel 24bis Absätze 1 und2 der geltenden Verfassung zeigt, dass zunächst über eineRangordnung der verschiedenen Zwecke diskutiert wurde.Man kam dann von einer solchen ab und fand die Lösungdarin, dass kein Zweck einseitig dominieren solle, sonderndass aus der Gesamtsicht vorzugehen sei. Dies ist mit demBegriff «in Berücksichtigung der gesamten Wasserwirt-schaft» im Ingress von Artikel 24bis Absatz 1 zum Ausdruckgebracht worden. Letzterer umfasst alles, insbesondere denSchutz qualitativer und quantitativer Art sowie die Nutzung.Absatz 2 von Artikel 24bis schliesst mit den Worten «Zumgleichen Zweck erlässt der Bund Bestimmungen ....» anAbsatz 1 an, wozu auch dessen Ingress gehört. Der Hinweisauf die gesamte Wasserwirtschaft ist somit massgebend; esscheint nicht verständlich, warum er jetzt im Entwurf fehlt.Absatz 1 Buchstaben a und b meines Antrages übernehmenunverändert Absatz 2 und 3 des Entwurfes.Zusammengefasst: Der Antrag, den ich stelle, schafft Klar-heit darüber, dass der Bund in der Wasserwirtschaft keineGeneralvollmacht erhält, welche auch mit den Grundsätzenüber die Nachführung und der in der Botschaft anerkanntenkantonalen Gewässerhoheit nicht vereinbar wäre.Zu Absatz 4: Durch die Streichung des Vorbehaltes zugun-sten privater Rechte und des Hinweises auf die durch daskantonale Recht Berechtigten tritt die Unsicherheit ein, obkünftig nur noch allein der Kanton verfügen kann. Das wider-spräche der Eigentumsgarantie; es kann nicht im Sinne derVerfassungsreform liegen, Unklarheiten zu schaffen.Ich bitte Sie, diesem Antrag eines neu gefassten Artikels 60zuzustimmen. Es geht darum, die bisherige Wasserhoheitder Kantone, die zwar schon weit eingeschränkt ist, im bishe-rigen Rahmen zu bewahren.
Rhinow René (R, BL), Berichterstatter: Darf ich als Kommis-sionspräsident zum Antrag Rhyner kurz Stellung nehmen?Die Kommission bzw. die entsprechende Subkommissionwar sich der Thematik bewusst, weil unser früherer KollegeHefti aus dem gleichen Kanton wie Herr Rhyner uns seiner-zeit mit diesen Fragestellungen konfrontiert hatte. Er hatteuns Eingaben zugestellt und beantragt, dass wir mehr oderweniger auf die alte Fassung zurückkommen sollten. HerrRhyner nimmt dieses Anliegen jetzt wieder auf.Wir haben geprüft, ob im neuen Entwurf des Bundesrateseine materielle Änderung zu sehen ist, und wir sind zumSchluss gekommen, dass das nicht der Fall ist. Ich gebe zu,dass der Begriff «sorgen» in Absatz 1 vielleicht Sorgen berei-ten könnte, wenn man ihn nicht im Zusammenhang mitAbsatz 2, Absatz 3 und auch Absatz 4 liest. Geht es um dieKompetenz des Bundes, dann sind die Absätze 2, 3 und 4massgeblich. In Absatz 2 ist die Grundsatzgesetzgebungs-kompetenz enthalten. Nach Absatz 3 hat der Bund die Kom-petenz, eigentliche Vorschriften zu erlassen – wie bis anhin.Gemäss Absatz 4 verfügen die Kantone – verfügen die Kan-tone! – wie bis anhin über die Wasservorkommen.Was neu in Absatz 1 vorangestellt worden ist, ist eine Zielbe-stimmung. Der Bundesrat sagt es in seiner Botschaft. Manwill den Bund auf diese Ziele verpflichten. Das etwas un-glückliche Wort «sorgen» ist aus diesem Blickwinkel herauszu sehen. Es begründet keine neue, eigenständige Bundes-kompetenz. Ich möchte das hier ganz klar festhalten. Daswar jedenfalls die Meinung in der Kommission.Die anderen Änderungen schienen uns nicht entscheidendzu sein. Wenn etwa der Passus «.... stehen unter Vorbehaltprivater Rechte den Kantonen oder den nach der kantonalenGesetzgebung Berechtigten zu» nicht wieder aufgenommenwird, dann sind das Kürzungen, die wir im Interesse der Klar-heit vorgenommen haben, ohne dass materiell etwas geän-dert worden ist, weil die Wahrung der kantonalen Autonomieund der Interessen der durch die Gesetzgebung als berech-tigt Erklärten selbstverständlich vorbehalten ist oder an ande-rer Stelle sogar ausdrücklich erwähnt wird.Ich habe ein gutes Gewissen, wenn ich Ihnen sage, dass ma-teriell keine Änderung bezweckt wird. Vielleicht können wir
dankbar sein, dass Herr Rhyner diesen Antrag eingereichthat, weil dann erst recht auch das Neue im Lichte des Bishe-rigen interpretiert werden muss.Ich möchte zum Schluss sagen: Der heutige Artikel 24bis istmit seinen sechs Absätzen, die noch durch viele Untergliede-rungen (Bst. a, b, c, d, e usw.) angereichert worden sind, einellenlanger und etwas geschwätziger Artikel. Es gehört auchzur Nachführung, dass man solche langen, fast unlesbarenVerfassungsartikel auf die wesentlichen Pfeiler und Verfas-sungsgehalte zurückstutzt.Noch einmal: Nicht eine Änderung ist beabsichtigt, sonderneine Klärung und Straffung!
Rhyner Kaspar (R, GL): «Die Botschaft hör’ ich wohl, alleinmir fehlt der Glaube.» Ich meine, ähnliche Zusammenhängeschon beim Raumplanungsgesetz gehört zu haben. Es wur-den ähnliche Zusicherungen gemacht, wonach die Kantonein ihren Bereichen nach wie vor zuständig und souveränseien und es in diesen und jenen Bereichen keine Änderun-gen gäbe. Dann ging es den bekannten Weg nach Lausanne,und das Bundesgericht kam aufgrund gewisser Auslegungenzur anderen Auffassung.Das Wort «sorgen» gibt dem Bund nach meiner Auffassungeine Globalkompetenz. Wenn ich für jemanden zu sorgenhabe, dann betrifft das alle Bereiche. Wenn ich für meine Kin-der zu sorgen habe, dann betrifft das die Erziehung, das Am-biente, in dem sie aufwachsen, die Ausbildung usw. – daswissen Sie alle auch. «Sorgen» öffnet eine dermassen offenePalette, dass ich der Zusicherung des Kommissionspräsi-denten gerne glauben würde, aber die Vergangenheit lässtmich sehr daran zweifeln.Ich erwähne auch, dass mein Antrag noch kürzer ist als derneue Entwurf, noch mehr zusammengefasst: Die Absätze 2und 3 von Artikel 1 sind sinngemäss übernommen worden,der Artikel 4 soll die besonderen Rechte gegenüber Privatenetwas präziser darstellen, und den Artikeln 5 und 6 habe ichnichts Neues beizufügen.Überlegen Sie sich die Bedeutung, die breite Palette diesesWortes «sorgen»! Ich übernehme ein Wort des Kommissi-onspräsidenten, wonach dieses «sorgt» uns Sorgen bereitenkönnte. Stimmen Sie meinem Antrag zu!
Maissen Theo (C, GR): Ich meine, es ist richtig, dass wir beidieser Nachführung Artikel, die historisch gewachsen undzum Teil etwas «geschwätzig» geworden sind, straffen. Ichmeine aber auch, diese Straffung sollte nicht dazu führen,dass man dann ellenlange Erklärungen braucht, um zu be-greifen, was darunter zu verstehen ist.Mich haben die Aussagen des Kommissionspräsidenten, wieer diesen Absatz 1 erklärt, sehr misstrauisch gemacht. Nachseinen Ausführungen wird dieser Absatz 1 dann durch dieAbsätze 2 und 3 offenbar wieder abgeschwächt bzw. relati-viert.Ich meine aber, wenn man strafft, kürzt und transparenter ma-chen will, sollte man auch die Prioritätenfolge der einzelnenAbsätze etwas beachten. Im Grunde genommen enthält beieinem solchen Artikel, der die wichtige Materie Wasser regelt,der erste Absatz einmal den «Aufhänger» und die Grundlage.Wenn es nun im neuen Entwurf in Absatz 1 heisst: «Der Bundsorgt ....» – und Kollege Rhyner hat eindrücklich dargelegt,was mit diesem «sorgt» alles verbunden ist; das ist praktischdie ganze Handhabung der Wasserwirtschaft –, so meine ich,dass das vom Aufbau des Artikels her falsch ist.Wenn man z. B. Absatz 2 vorangestellt hätte, wo es heisst:«Er legt Grundsätze fest ....», wäre der Ausgangspunkt be-reits wieder anders, vor allem wenn dann Absatz 1 in eineranderen Stufenfolge eingebaut würde. Es kommt hier ein un-gutes Gefühl zum Ausdruck, dass sich tatsächlich materiell-rechtlich etwas ändert.Aufgrund der ausführlichen Darlegungen des Kommissions-präsidenten, dass es das gleiche sei wie in der geltendenBundesverfassung, meine ich, dass wir hier nicht auf demrichtigen Weg sind.Ich bitte Sie deshalb, dem Antrag Rhyner zuzustimmen, wo-mit die Gelegenheit besteht, in einer zweiten Runde oder im
Constitution fédérale. Réforme 80 E 21 janvier 1998
Bulletin officiel de l’Assemblée fédérale / Tiré à part
Zweitrat diese Sache noch einmal anzusehen, damit beimLesen sofort verständlich wird, dass sich materiellrechtlichnichts ändert. So, wie es jetzt hier steht, meine ich, ist der er-ste Eindruck der, dass es nicht mehr dasselbe ist wie das,was in der geltenden Verfassung steht.
Rhinow René (R, BL), Berichterstatter: Ich habe ja, wie ein-leitend bemerkt, ein gewisses Verständnis dafür, dass sichZweifel um dieses Wort «sorgt» ranken können, auch wennes sich im Lichte der Botschaft und im Lichte der Beratungenklar um Ziele handelt. Aber ich biete an, dass wir diesen Arti-kel in die Kommission zurücknehmen, weil wir so oder so erstin der Frühjahrssession den Rest dieses Aufgabenteils been-den können. Wir werden versuchen, jene Präzisierungen ein-zubringen, die allenfalls notwendig sind, um klar auszudrük-ken, dass es sich hier nicht um eine neue Generalkompetenzdes Bundes handelt. Wenn Herr Rhyner allenfalls auch miteiner modifizierten Fassung nicht einverstanden wäre, könn-ten wir den Antrag Rhyner selbstverständlich im Rat noch-mals zur Diskussion stellen und dann im Lichte der neuenVorlage der Kommission entscheiden.
Präsident: Ich gehe davon aus, dass wir uns dem nicht wi-dersetzen, wenn die Sorge derart kooperativ um sich greift.Der Artikel wird in die Kommission zurückgenommen und inder Frühjahrssession nochmals vorgelegt werden.
Verschoben – Renvoyé
Art. 61Anträge der Kommissionen: BBlPropositions des commissions: FF
Aeby Pierre (S, FR), rapporteur: L’article 61 est une disposi-tion tout à fait standard concernant la forêt. L’alinéa 1er fixele principe du devoir de la Confédération en ce qui concerneles «fonctions protectrice, économique et sociale» de la forêtdans notre pays. Les alinéas 2 et 3 n’appellent quant à euxpas de remarques particulières.
Angenommen – Adopté
Art. 62Anträge der Kommissionen: BBlPropositions des commissions: FF
Aeby Pierre (S, FR), rapporteur: L’alinéa 1er de l’article 62,«Protection de la nature et du patrimoine», fixe la compé-tence cantonale en la matière. Les alinéas 2, 3, 4 et 5 qui sui-vent sont, eux, issus très directement chaque fois de vota-tions populaires. La commission n’a pas voulu intervenir defaçon significative et marquante dans ces alinéas que certai-nement vous connaissez tous relativement bien, ce qui faitqu’il n’est pas nécessaire pour moi de les passer en revue.Simplement, j’aimerais attirer votre attention sur le fait que lanotion de «Denkmal» en allemand, et de «biens culturels» enfrançais a disparu, et qu’on parle maintenant de «monumentsnaturels et culturels» et, dans la version allemande, de «Na-tur- und Kulturdenkmäler».
Angenommen – Adopté
Art. 63Anträge der Kommissionen: BBlPropositions des commissions: FF
Aeby Pierre (S, FR), rapporteur: L’article 63 fixe la compé-tence de la Confédération en ce qui concerne la pêche et lachasse. Si la deuxième partie de l’article a été supprimée,c’est-à-dire la partie concernant «.... la sauvegarde de la di-versité des espèces de poissons, de mammifères sauvageset d’oiseaux», c’est que nous avons considéré en commissionque l’alinéa 4 de l’article 62 contient déjà et de façon plus largecette disposition, en ce sens qu’il appartient à la Confédérationd’édicter «.... des dispositions afin de protéger la faune, la flore
et de maintenir leur milieu naturel dans sa diversité», et de pro-téger «.... les espèces menacées d’extinction». Donc, il y avaitlà une sorte de répétition qui nous a paru inutile. C’est pourcela que l’on met un point final après «chasse».
Angenommen – Adopté
Art. 64Anträge der Kommissionen: BBlPropositions des commissions: FF
Aeby Pierre (S, FR), rapporteur: Les adaptations qui ont étéopérées par la commission à l’article 64, qui correspond àl’article 25bis de la constitution actuelle, sont purement ré-dactionnelles. La commission a introduit une espèce de logi-que en parlant d’abord de la garde et du traitement des ani-maux, ensuite de leur abattage, des expériences, ensuite del’aspect utilisation, importation, transport et commerce desanimaux dans les lettres d, e, f. Donc, il n’y a pas de modifi-cation substantielle. On retrouve, malgré les six lettres a à f,le projet du Conseil fédéral.
Angenommen – Adopté
Art. 65Anträge der Kommissionen: BBlPropositions des commissions: FF
Aeby Pierre (S, FR), rapporteur: Nous entamons ici un as-pect plutôt technique de la constitution, mais qui, de façon ex-trêmement traditionnelle, appartient à notre charte fonda-mentale. Il s’agit – c’est le lieu de le rappeler – de bien définirquelles sont les compétences fédérales, quelles sont éven-tuellement celles des cantons dans cette matière.L’article 65 sur la compétence générale de la Confédérationde «réaliser des travaux publics et d’exploiter des ouvragespublics ou d’encourager leur réalisation» est absolument in-contesté et n’a pas fait l’objet de discussions en commission,c’est la version du Conseil fédéral qui a été adoptée tellequelle.
Angenommen – Adopté
Art. 66Anträge der Kommissionen: BBlPropositions des commissions: FF
Aeby Pierre (S, FR), rapporteur: Une simple remarque con-cernant l’article 66, c’est que, bien évidemment, cette opéra-tion de mise à jour de la constitution maintient dans la com-pétence de «la Confédération d’édicter des dispositions surla circulation routière».L’alinéa 3 prévoit que «l’utilisation des routes publiques estexempte de taxes» et que «l’Assemblée fédérale peut auto-riser des exceptions». On connaît donc les exceptions quiexistent aujourd’hui à ce principe de base.
Angenommen – Adopté
Art. 67Anträge der Kommissionen: BBlPropositions des commissions: FF
Aeby Pierre (S, FR), rapporteur: L’article 67 n’a pas fait l’ob-jet de grandes discussions en commission, bien qu’à un mo-ment donné, la question suivante se soit posée: est-ce quenous mettons cet article 67 de côté en attendant les résultatsdes travaux sur la nouvelle péréquation et la nouvelle répar-tition des tâches entre les cantons et la Confédération, sa-chant que c’est un des aspects qui sera vraisemblablementpassablement discuté ces prochains temps? C’est un do-maine où compétences et charges financières relatives auréseau de nos routes nationales sont réparties.La commission a laissé cet article dans la version du Conseilfédéral. Il semble que, pour l’instant, nous avons eu raison de
21. Januar 1998 S 81 Bundesverfassung. Reform
Amtliches Bulletin der Bundesversammlung / Separatdruck
le faire. Il y a tout lieu de croire que les délibérations sur laConstitution fédérale seront terminées au moment où nousaurons peut-être une décision définitive dans ce domaine. Jene sais pas s’il est judicieux que M. Leuenberger, conseillerfédéral, s’exprime sur cet article 67; ça n’est peut-être pasinintéressant pour nous de saisir là l’occasion d’avoir une in-formation.
Leuenberger Moritz, Bundesrat: Es war die Geschäftsprü-fungskommission oder die Finanzkommission des National-rates, die nach einer kürzlich stattgefundenen Sitzung undnach Erhalt eines entsprechenden Berichtes dezidiert derMeinung war, dass der Unterhalt und auch der Bau der Na-tionalstrassen nicht mehr Kantonssache, sondern Bundessa-che sein sollen.Ich frage mich, ob jetzt nicht die Gelegenheit wäre, zuzugrei-fen und vielleicht diesen Artikel noch einmal zurückzustellen.Vorher haben Sie sich dazu bereit erklärt, einen anderen Ar-tikel auch erst in der Frühjahrssession zu behandeln.Es gibt in der Tat wesentliche Gründe, dass der Bund für denUnterhalt der Nationalstrassen zuständig sein soll. Der Bundkann kantonsübergreifend ausschreiben, und er kann dieeingereichten Offerten mit jenen anderer Firmen vergleichen.Damit Sie nachher nicht wieder eine Verfassungsrevision an-gehen müssen, würde ich Sie ersuchen, wie vorhin den Arti-kel über das Wasser, auch Artikel 67 zurückzustellen undsich diesen Bericht der Geschäftsprüfungskommission bzw.der Finanzkommission des Nationalrates anzusehen.
Präsident: Der Bundesrat empfiehlt uns, diese Bestimmungan die Kommission zurückzugeben – mit Blick auf die Abklä-rungen, die im Gange sind.
Aeby Pierre (S, FR), rapporteur: On peut être d’accord aveccette proposition. Je remercie le Conseil fédéral d’annonceren quelque sorte par là qu’il y aura peut-être des nouveautésdans le courant de l’année.
Rhinow René (R, BL), Berichterstatter: Ich habe etwas Hem-mung, das Gegenteil zu vertreten, nachdem sich jetzt derSprecher der Kommission im anderen Sinne geäussert hat.Ich möchte einfach ein Bedenken anmelden: Wir sind Erstrat,und ich frage mich, ob es zweckmässig ist, wenn wir auf-grund eines Berichtes einer nationalrätlichen Kommissionunsere Arbeit einstellen. Es erscheint mir zweckmässiger zusein, wenn wir heute entscheiden und der Nationalrat ge-stützt auf die Erwägungen seiner Kommission allfällige Kor-rekturen anbringt, worauf wir dann im Differenzbereinigungs-verfahren entscheiden, ob wir uns anschliessen wollen odernicht.
Aeby Pierre (S, FR), rapporteur: L’article 67 alinéa 3 qui faitallusion au «terrain utilisable à des fins économiques» qui«doit être ménagé autant que possible», a été supprimé,parce que c’était le seul intérêt important auquel on pensaitau moment de la mise en place des dispositions et de la lé-gislation sur la construction des routes nationales. Depuis, denombreuses dispositions sur la protection de la nature, sur laprotection des paysages, sur la lutte contre le bruit, qui sontdes intérêts d’égale valeur, ont vu le jour. Il a semblé à lacommission qu’il n’y avait plus de raison d’énumérer ici, àl’alinéa 3, un intérêt spécifique par rapport à tous les autres.Toute cette pesée des intérêts en présence, qui souvent finitau Tribunal fédéral, dans les procédures d’expropriation etdans les procédures d’opposition lors de la construction desroutes nationales, montre que la situation est extrêmementcomplexe. Alors, ou bien on énumérait tous les intérêts im-portants – et ils figurent dans de nombreux articles de laconstitution –, ou bien on n’en énumérait aucun. C’est dansce sens-là que nous avons supprimé l’alinéa 3.Mais cet intérêt est protégé. Il est protégé par beaucoupd’autres dispositions.
Präsident: Wir stimmen über die Rückweisung dieses Arti-kels an die Kommission ab. Die Kommission beantragt, den
Artikel nicht zurückzuweisen und ihn gemäss ihrem Vor-schlag anzunehmen.
Abstimmung – VoteFür den Antrag der Kommission 17 StimmenDagegen 4 Stimmen
Art. 68Anträge der Kommissionen: BBlPropositions des commissions: FF
Aeby Pierre (S, FR), rapporteur: C’est en fait le texte de l’ini-tiative des Alpes de fraîche date qui se retrouve ici. Il n’y apas un mot à ajouter ou à retrancher, c’est repris tel queldans la nouvelle constitution. C’est d’ailleurs pour cela qu’il ya une disposition transitoire.
Angenommen – Adopté
Art. 69, 70Anträge der Kommissionen: BBlPropositions des commissions: FF
Aeby Pierre (S, FR), rapporteur: Je vous propose de grouperles articles 69 et 70 qui prévoient tous deux des redevances,des impôts ou des taxes, acceptés dans notre constitution defraîche date. La commission a repris tel quel le projet du Con-seil fédéral qui lui-même a repris tel quel ce qui figure dans laconstitution.
Angenommen – Adopté
Art. 71Anträge der Kommissionen: BBlPropositions des commissions: FF
Aeby Pierre (S, FR), rapporteur: Nous avons ajouté «la navi-gation astronautique», aussi bien dans le titre que dans le li-bellé de cet article. La navigation astronautique est bien évi-demment de la compétence de la Confédération, commel’aviation et la navigation de façon générale.
Angenommen – Adopté
Art. 72Anträge der Kommissionen: BBlPropositions des commissions: FF
Aeby Pierre (S, FR), rapporteur: A l’époque de son introduc-tion dans la constitution, le thème des chemins et sentiers pé-destres avait mobilisé et sensibilisé très fortement la popula-tion du pays. En commission, nous avons eu une discussiondont le sens était: peut-on toucher à cet article quasiment sa-cré relatif aux chemins et sentiers pédestres? Il y avait aussiun point de vue qui tendait à dire que, dans le fond, les che-mins et sentiers pédestres n’ont pas grand-chose à voir dansla section 4 «Travaux publics, transports, énergie, communi-cations», mais pourrait tout aussi bien figurer dans lasection 3 «Aménagement du territoire et environnement»:tout dépend de quel point de vue on se place.La commission a fait preuve de courage puisqu’elle a revu larédaction de cet article en pensant lui apporter plus de clarté.Ceci ne doit pas du tout être interprété dans le sens d’unerestriction du champ d’application de cet article relatif auxchemins et sentiers pédestres. On supprime à l’alinéa 1er laquestion de l’aménagement et de l’entretien de ces réseauxqui sont de la compétence des cantons et on l’intègre àl’alinéa 2 où on donne à la Confédération un devoir de sou-tien et de coordination.Quant à l’alinéa 3, la commission a estimé pouvoir s’en pas-ser sans autre, étant donné qu’il fait double usage avec lesdeux premiers alinéas et avec les dispositions prévues dansla section consacrée à l’aménagement du territoire.
Angenommen – Adopté
Constitution fédérale. Réforme 82 E 21 janvier 1998
Bulletin officiel de l’Assemblée fédérale / Tiré à part
Art. 73Anträge der Kommissionen: BBlPropositions des commissions: FF
Aeby Pierre (S, FR), rapporteur: Politique énergétique de laConfédération: je crois que ce sont plutôt les dispositions lé-gislatives qui nous préoccupent actuellement. L’article cons-titutionnel n’est pas contesté; il n’a pas été véritablement dis-cuté dans ses détails pour les raisons qui ont déjà été expri-mées. Il correspond à ce que nous avons aujourd’hui dans laConstitution fédérale en vigueur.
Angenommen – Adopté
Art. 74, 74aAnträge der Kommissionen: BBlPropositions des commissions: FF
Aeby Pierre (S, FR), rapporteur: Ici, la commission a souhaitédiviser l’article 74 du projet du Conseil fédéral en deux articles,l’article 74 et l’article 74a, considérant que l’énergie nucléairecomme telle méritait un article bien spécifique, que la questiondu transport et de la distribution d’énergie posait des problè-mes d’un tout autre ordre, et qu’il s’agissait ici de résoudreautre chose. Si bien que l’article 74 en soi dit simplement que«la législation sur l’énergie nucléaire relève de la compétencede la Confédération». C’est de sa compétence exclusive.J’enchaîne avec l’article 74a. On parle ici de transport d’éner-gie, et il peut s’agir d’énergie qui n’est pas forcément nu-cléaire: on transporte de l’énergie hydraulique ou d’autres ty-pes d’énergie, pas forcément nucléaires. C’est pour cela quela commission a souhaité faire deux articles. Nous reprenonsaux alinéas 1er et 2 les dispositions de l’article 74 alinéas 2et 3 du projet du Conseil fédéral.
Präsident: Der Bundesrat ist mit der Aufteilung einverstan-den.
Angenommen – Adopté
Art. 75Anträge der Kommissionen: BBlPropositions des commissions: FF
Aeby Pierre (S, FR), rapporteur: L’article 75 n’appelle pas deremarque particulière, si ce n’est que le terme de «servicespostaux» est remplacé par «la législation sur les servicespostaux et les télécommunications», qui relève de la compé-tence de la Confédération. Cela correspond à la législationque nous avons approuvée ici l’année dernière.La même chose concernant l’alinéa 3 qui a été biffé: cetteobligation n’est plus dans la législation. Faut-il la maintenirdans la constitution? C’est un pas que la commission a faitsans, je dois dire, de grandes discussions à l’occasion de cetexercice de mise à jour.
Angenommen – Adopté
Art. 76, 77Anträge der Kommissionen: BBlPropositions des commissions: FF
Aeby Pierre (S, FR), rapporteur: Cet article dispose que «lalégislation sur la radio et la télévision ainsi que sur les autresformes de diffusion de productions et d’informations ressor-tissant aux télécommunications publiques relève – bien évi-demment – de la compétence de la Confédération», ce prin-cipe est repris.Ensuite, nous avons l’émission traditionnelle de la radio et dela télévision du service public de radio et de télévision dansnotre pays.Les alinéas 3 à 5 reprennent les dispositions de la constitu-tion actuelle.
Angenommen – Adopté
Art. 78–83Anträge der Kommissionen: BBlPropositions des commissions: FF
Angenommen – Adopté
Präsident: Damit brechen wir die Beratungen über denEntwurf A1 der neuen Bundesverfassung ab. Wir werden inder Frühjahrssession mit Artikel 84 fortfahren.
Die Beratung dieses Geschäftes wird unterbrochenLe débat sur cet objet est interrompu
4. März 1998 S 83 Bundesverfassung. Reform
Amtliches Bulletin der Bundesversammlung / Separatdruck
Dritte Sitzung – Troisième séance
Mittwoch, 4. März 1998Mercredi 4 mars 1998
08.00 h
Vorsitz – Présidence: Zimmerli Ulrich (V, BE)
___________________________________________________________
96.091
Bundesverfassung.ReformConstitution fédérale.Réforme
Fortsetzung – Suite
___________________________________________________________
A1. Bundesbeschluss über eine nachgeführte Bundesverfas-sung (Titel, Art. 1–126, 185) (Fortsetzung)A1. Arrêté fédéral relatif à une mise à jour de la Constitutionfédérale (titre, art. 1–126, 185) (suite)
Präsident: Wir haben in der Januar-Sondersession einen Ar-tikel dieser Vorlage an die Kommission zurückgewiesen: denArtikel 60 (AB 1998 S 77). Wir bereinigen ihn als ersten.
Art. 60Neuer Antrag der KommissionAbs. 1Der Bund sorgt im Rahmen seiner Zuständigkeiten für diehaushälterische Nutzung ....Abs. 2–6BBl
Antrag RhynerAbs. 1Für die haushälterische Nutzung .... Einwirkungen des Was-sers werden durch den Bund unter Berücksichtigung der ge-samten Wasserwirtschaft:a. Grundsätze festgelegt über die Erhaltung und Erschlies-sung der Wasservorkommen, über die Nutzung der Gewäs-ser zur Energieerzeugung und für Kühlzwecke sowie überandere Eingriffe in den Wasserkreislauf;b. Vorschriften erlassen über den Gewässerschutz, die Si-cherung angemessener Restwassermengen, den Wasser-bau, die Sicherheit der Stauanlagen und die Beeinflussungder Niederschläge.Abs. 2, 3StreichenAbs. 4Über die Wasservorkommen verfügen unter Vorbehalt pri-vater Rechte die Kantone oder die nach der kantonalen Ge-setzgebung Berechtigten. Sie können für die Wassernut-zung ....(Fortsetzung gemäss Antrag der Kommission)Art. 60Nouvelle proposition de la commissionAl. 1Dans les limites de ses compétences, la Confédération pour-voit ....Al. 2–6FF
Proposition RhynerAl. 1Afin de pourvoir à l’utilisation rationnelle des eaux, à .... dom-mageable de l’eau, la Confédération, en tenant compte del’économie des eaux:a. fixe les principes applicables à la conservation et à la miseen valeur des ressources en eau, à l’utilisation de l’eau pourla production d’énergie et le refroidissement et à d’autres in-terventions dans le cycle hydrologique;b. édicte des dispositions sur la protection des eaux, sur lemaintien des débits résiduels appropriés, sur l’aménagementdes cours d’eau, sur la sécurité des barrages et sur les inter-ventions de nature à influencer les précipitations.Al. 2, 3BifferAl. 4Les cantons, ou ceux qui en ont le droit en vertu de la légis-lation cantonale, disposent des ressources en eau, sous ré-serve des droits des personnes privées. Ils peuvent prélever....(suite selon proposition de la commission)
Aeby Pierre (S, FR), rapporteur: L’article 60 a été renvoyé encommission lors de nos précédents débats sur le projet de ré-forme de la constitution, suite à l’intervention de M. Rhynerqui évoquait l’aspect surtout psychologique de la nouvelle ré-daction, et qui émettait des craintes en ce qui concerne lacompétence des cantons en la matière.Rappelons peut-être les grandes lignes de cet article 60 quifixe à la fois l’utilisation des forces hydrauliques, la conserva-tion de nos ressources en eau, ainsi que les règles pourl’érection d’ouvrages hydrauliques.La commission s’est penchée sur les reproches adressés àcet article et sur les craintes que sa rédaction risquait de fairenaître. Vous êtes en possession aujourd’hui d’une nouvelleproposition de la Commission de la révision constitutionnelle,du 10 février 1998, qui, à l’alinéa 1er, apporte le complémentsuivant, en français: «Dans les limites de ses compétences,la Confédération pourvoit à l’utilisation rationnelle des res-sources en eau, à la protection de ces ressources et à la luttecontre l’action dommageable de l’eau.» En allemand, ce sontles termes «im Rahmen seiner Zuständigkeiten» qui ont étéajoutés à l’alinéa 1er.La commission, à l’unanimité, pense que cette solution de-vrait apaiser les craintes de M. Rhyner qui, en l’occurrence,défendait le point de vue de plusieurs cantons.
Rhyner Kaspar (R, GL): Ich ersuche Sie, meinem Antragvom 19. Januar 1998 zuzustimmen. Damit habe ich auch er-klärt, dass ich an diesem Antrag festhalten möchte. Ich dankeder Kommission, dass sie sich nochmals damit befasst undentsprechend auseinandergesetzt hat, aber die Fassung desneuen Antrages, so, wie sie vorliegt: «Der Bund sorgt imRahmen seiner Zuständigkeiten für die haushälterische Nut-zung ....», kommt meinem Anliegen vom 19. Januar nichtentgegen. Ich habe damals deutlich erwähnt, dass für michdas Wort «sorgen» dem Bund bzw. der Verwaltung viel zuweite und grosse Kompetenzen einräumt.Auf Seite 250 der Botschaft steht, die Räte hätten vor gutzwanzig Jahren bei der Revision von Artikel 24bis der Bun-desverfassung das Anliegen, dem Bund beim Wasser dieGeneralkompetenz einzuräumen, abgelehnt. Damit scheintsich die Bundesverwaltung noch nicht abgefunden zu habenund versucht nun offenbar über die Nachführung, sich ihreWünsche zu erfüllen. Nun will man das auf diesem Weg – aufeinem Umweg, nach meiner Interpretation – wieder einfüh-ren. Da befürchte ich, dass vor allem beim Restwasser eineunbeschränkte Bundeskompetenz reklamiert wird.Wie schon erwähnt, wurde in den Kommissionen diskutiert,ob unter den in Artikel 24bis der Bundesverfassung aufge-führten Zwecken einzelne gegenüber anderen einen Vorranghätten, wobei sich zeigte, dass die Verwaltung damals mög-lichst nahe an die Gewässerschutz-Initiative herankommenwollte. Den Kommissionen und den Räten ging das zu weit.
Constitution fédérale. Réforme 84 E 4 mars 1998
Bulletin officiel de l’Assemblée fédérale / Tiré à part
Sie fanden die Lösung darin, dass die Gesamtsituationmassgebend sei.Dieser Grundsatz der Berücksichtigung der gesamten Was-serwirtschaft findet sich als Teil des im Ingress von Artikel24bis Absatz 1 der Bundesverfassung enthaltenen Zweckes,welcher dann ausdrücklich und ohne Einschränkung auch fürAbsatz 2 übernommen wurde und somit auch für die Rest-wasser gilt. Die Formulierung «in Berücksichtigung der ge-samten Wasserwirtschaft» soll nicht unter dem Mantel derNachführung unter den Tisch gewischt werden.Ich ersuche Sie, meinem Antrag, so, wie ich ihn am 19. Ja-nuar 1998 gestellt habe, zuzustimmen.
Koller Arnold, Bundesrat: Wir sind mit der neuen Formulie-rung, die die Kommission in Absatz 1 einfügt, einverstanden.Es heisst nun ausdrücklich: «Der Bund sorgt im Rahmen sei-ner Zuständigkeiten ....» Damit wird einmal terminologischklargemacht, dass es hier nicht um die Begründung irgend-welcher neuer Bundeskompetenzen geht, sondern dass essich hier um eine rein programmatische Zielbestimmung han-delt. Die Kompetenzen werden in den anschliessenden Ab-sätzen festgelegt. Das zeigt ein Blick auf den nächstfolgen-den Artikel 61 sofort. Auch da haben wir die Formulierung«sorgt dafür». Überall, wo wir diese Formulierung in dernachgeführten Verfassung brauchen, ist klar, dass es sichnicht um Kompetenzbegründungen handelt, sondern um pro-grammatische Zielbestimmungen. Insofern glaube ich, dasswir – vor allem auch durch die Aufnahme des Zusatzes «imRahmen seiner Zuständigkeiten» – den Bedenken, die HerrRhyner geäussert hat, juristisch adäquat begegnet sind.Ich möchte Sie bitten, der neuen Formulierung der Kommis-sion zuzustimmen.
Abstimmung – VoteFür den neuen Antrag der Kommission 20 StimmenFür den Antrag Rhyner 18 Stimmen
Rhyner Kaspar (R, GL): Ich stelle den Antrag, dass wir – imSinne einer Wiedererwägung – nochmals abstimmen
Präsident: Herr Rhyner stellt den Ordnungsantrag, die Ab-stimmung zu wiederholen. – Sie sind damit einverstanden.
Abstimmung – VoteFür den neuen Antrag der Kommission 22 StimmenFür den Antrag Rhyner 16 Stimmen
Art. 84Anträge der Kommissionen: BBlPropositions des commissions: FF
Antrag InderkumZustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Proposition InderkumAdhérer au projet du Conseil fédéral
Aeby Pierre (S, FR), rapporteur: L’article 84 divise au-jourd’hui l’opinion. Rappelons les faits qui sont sous-jacentsau débat que nous allons avoir sur les relations entre l’Egliseet l’Etat à propos du maintien ou de la suppression de cet ar-ticle:– Il y a quelques années déjà, il y a eu la nomination d’unévêque coadjuteur à Genève, ce qui avait profondément dé-plu aux milieux réformés.– Il y a eu l’affaire Haas, qui est tout de même assez récentepour que je puisse me passer d’en décrire tous les détails.Dans le prolongement de cette affaire, entre guillemets, lacréation du diocèse du Liechtenstein, qui a été considéréepar une partie de l’opinion publique suisse comme une ma-noeuvre de Rome.– Enfin, dernièrement, la presse dominicale s’est fait très lar-gement l’écho de démarches maladroites du nonce apostoli-que en Suisse pour opérer ce qu’on a appelé un «nouveauparachutage» en direction de l’évêché de Coire.
C’est dire que si les délibérations de la sous-commission sesont déroulées dans une grande sérénité – nous étions àSchaffhouse au Zunfthaus zum Rüden, l’inspiration du lieunous a permis de débattre de façon tout à fait sereine et deprendre position, à l’unanimité, pour la suppression del’article 84, j’y reviendrai –, il est vrai qu’en commission plé-nière de 21 membres, vous le savez, la majorité a été moinsnette. Il est tout aussi vrai qu’aujourd’hui, je ne sais plus tropqui est encore d’accord et qui ne l’est plus avec la suppres-sion de cet article, étant donné les nombreuses réactionscontradictoires enregistrées dans divers milieux.Disons, pour résumer, que les catholiques sont divisés endeux camps à propos de cet article, et les protestants égale-ment. Je vais essayer de défendre ici, et c’est mon intimeconviction, le point de vue de la sous-commission et de lacommission en faisant abstraction du contexte un peu difficileque je viens de décrire. Je crois qu’il était impératif que celasoit dit avant que nous entrions dans le vif du sujet.En soi, l’article 84 contient trois alinéas. Et c’est l’alinéa 3 quipose problème, cet alinéa issu de la guerre du Sonderbundet qui stipule: «Il ne peut être érigé d’évêché sans l’approba-tion de la Confédération.» Depuis belle lurette, la doctrines’accorde à dire qu’il s’agit là d’une limitation de la liberté deconscience et de croyance, telle qu’elle est ancrée àl’article 13 du projet de réforme de la constitution. Qui plusest, depuis, nous sommes en contradiction, et c’est certain,avec l’article 14 de la Convention européenne des droits del’homme, et avec l’article 26 du Pacte international relatif auxdroits civils et politiques. Ces sont là des évidences que tousles juriste, aujourd’hui, reconnaissent. L’alinéa 3 est une dis-position discriminatoire par rapport à une Eglise, et il doit dis-paraître logiquement de la constitution. Il doit disparaîtred’autant plus logiquement que la réalité constitutionnelle vé-cue, celle que nous voulons traduire dans cet exercice demise à jour, nous montre que, dans ce domaine, le Conseilfédéral observe depuis très longtemps déjà la plus grandedes réserves, et que s’il intervient, il n’a pas besoin del’alinéa 3 pour le faire.Les alinéas 1er et 2, quant à eux, n’ont plus vraiment de rai-son d’être si l’alinéa 3 disparaît. Ils n’ont plus de raison d’êtreparce que l’alinéa 1er constate une compétence cantonale,et que cette compétence cantonale est incontestée. Donc, ilest inutile de préciser dans la Constitution fédérale que lesrapports entre l’Eglise et l’Etat sont du ressort des cantons.L’alinéa 2 est entièrement compris dans l’article 35a de notreversion de la réforme de la constitution (version CRC-CE), ar-ticle qui prévoit l’aide mutuelle et l’assistance entre cantonset Confédération si l’ordre public est troublé.En conséquence, c’est fondée sur ces considérations que lacommission a décidé qu’il fallait biffer l’article 84, d’autantplus qu’il correspond tout à fait à l’opinion exprimée danscette salle en juin 1995, suite à l’initiative parlementaire Hu-ber (94.433), à laquelle notre Conseil, faut-il le rappeler, avaitdécidé de donner suite.Je vous suggère de ne pas accorder trop d’importance auxréactions épidermiques qu’on constate dans certains milieux,dont il ne faut pas non plus exagérer le nombre, à propos decet article, et je vous encourage à adopter la proposition dela commission et à biffer purement et simplement l’article 84.Cela correspond à une constitution d’un Etat moderne, d’unEtat laïc qui laisse la question des Eglises à la conscience dechacun, dans la mesure où l’ordre public n’est pas perturbé.En plus, cet article 84, qui n’existait pas comme tel dansl’avant-projet mis en consultation, est à mon avis mal placé.Si l’on veut maintenir l’alinéa 3, alors c’est à l’article 13 qu’ilfaut l’intégrer, comme restriction à la liberté de conscience etde croyance. Mais je rappelle que cette restriction met laSuisse dans une situation délicate par rapport à ses engage-ments internationaux, et je ne crois pas que la paix confes-sionnelle soit menacée chez nous de manière si forte qu’ilfaille légiférer dans la constitution sur cette question.Je vous prie d’adopter la proposition de la commission.
Inderkum Hansheiri (C, UR): Sie werden möglicherweise et-was erstaunt sein, dass dieser Antrag, den Artikel 84 beizu-
4. März 1998 S 85 Bundesverfassung. Reform
Amtliches Bulletin der Bundesversammlung / Separatdruck
behalten, ausgerechnet von einem Vertreter der CVP underst noch eines katholischen Kantons der Innerschweizkommt. In der Tat, diesen Antrag zu stellen, fällt mir nichtleicht. Artikel 84, insbesondere dessen Absatz 3, der ja denbisherigen Artikel 50 Absatz 4, den sogenannten Bistumsar-tikel, weiterführen soll, gehört ohne Zweifel von der Sacheher nicht in die Bundesverfassung der Schweizerischen Eid-genossenschaft, und zwar deshalb, weil er in nicht gerecht-fertigter Weise in die Organisation der Kirche eingreift und diekantonale Kirchenhoheit einschränkt. Diese Feststellung giltum so mehr in einer Zeit, da – nicht zuletzt auch im Rahmender vorliegenden Verfassungsrevision – zu Recht auf die Be-deutung der Grund- und Menschenrechte für eine gedeihli-che Entwicklung von Politik und Gesellschaft hingewiesenwird.Aber es kann nun einmal nicht genug betont werden, dass wiruns im Rahmen der Beratung der Vorlage A eben nicht mit ei-ner beliebigen Totalrevision unseres Grundgesetzes befas-sen, sondern nur mit einer Nachführung. Zugestanden,«Nachführung» ist ein komplexer Begriff, der nicht einfach ei-ner enggezogenen Grenzlinie gleichkommt, sondern derauch gewisse materielle Änderungen zulässt. So kann insbe-sondere eine materielle Änderung auch darin bestehen, dassBestimmungen, welche als sachlich nicht gerechtfertigt, alswesensfremd oder als überholt gelten, gestrichen werden.Unabdingbare Voraussetzung ist jedoch, dass über dieseFragen ein allgemeiner Konsens besteht. Würde somit in derschweizerischen Bevölkerung und Gesellschaft ein allgemei-ner Konsens darüber bestehen, dass Artikel 84, insbeson-dere dessen Absatz 3, wesensfremd oder ein Anachronis-mus, ein alter Zopf, sei, so könnten wir ihn im Rahmen derNachführung gewiss streichen.Es ist aber offensichtlich, dass dieser Konsens zurzeit nichtoder jedenfalls noch nicht besteht. Dies hat sich unter ande-rem bei zwei Gelegenheiten deutlich manifestiert: einerseitsim Rahmen der Beratungen der parlamentarischen InitiativeHuber (94.433) in diesem Saal und andererseits im Rahmendes Vernehmlassungsverfahrens betreffend die vorliegendeVerfassungsreform und auch im Rahmen von Ereignissenund Zuständen neueren Datums, vor allem im Bistum Chur.Bemerkenswert ist demzufolge, dass sich der Widerstandgegen eine Streichung dieses Artikels und insbesondere vonAbsatz 3 nicht nur aus evangelischen, sondern ebensosehraus katholischen Kreisen erhebt, wie Kollege Aeby bereitserwähnt hat.Hieraus ist meines Erachtens der Schluss zu ziehen, dasseine Streichung von Artikel 84 im Rahmen der vorliegendenRevision nicht zu unterschätzende Emotionen und Wider-stände auslösen könnte, so dass das Projekt Totalrevision inGefahr gebracht werden könnte. Ehrlichkeit, Glaubwürdigkeitund Fairness gebieten daher, dass wir diesen Artikel im Rah-men der Nachführung stehenlassen. Es geht nun einmalnicht an, Begehren, die uns politisch nicht ins Konzept pas-sen, mit dem Argument zu begegnen, diese würden über dieNachführung hinausgehen, um dann gleichermassen im Ge-genzug an die Nachführung andere Massstäbe anzulegen,wenn es um Anliegen geht, die man befürwortet, die einemins Konzept passen.Zumindest scheint es mir wichtig, dass wir über diese Fragehier eine eingehende und – daran zweifle ich nicht – sachli-che Diskussion führen können. Wenn Sie nach gewalteterDiskussion dann der Kommission zustimmen würden, sowürde dies mein Tagesglück bestimmt nicht trüben. Anderer-seits möchte ich darauf hinweisen: Wenn Sie meinem Antragzustimmen, dann ist das Thema damit natürlich nicht vomTisch. Es wird sich dann allenfalls die Frage stellen, ob wirdiese Bestimmung zum Gegenstand einer Variante machenkönnten oder müssten, und es bliebe dann nach meiner Auf-fassung immer noch die parlamentarische Initiative Huber imRaum stehen.
Wicki Franz (C, LU): Der Bistumsartikel ist ein Relikt ausdem Kulturkampf. Es ist höchste Zeit, dass wir uns von sol-chen Bestimmungen trennen. Der Vorbehalt, dass Bistümernur mit Genehmigung des Bundes errichtet werden dürfen,
steht in Widerspruch zur kooperativen Religionsfreiheit, wiewir sie in Artikel 13 klar als Verfassungsgrundsatz festgelegthaben. Er ist nicht nur überholt, sondern auch diskriminie-rend, da er nur bei den katholischen Mitbürgerinnen und Mit-bürgern zur Anwendung kommt.Die Streichung des Bistumsartikels im Rahmen der Nachfüh-rung ist durchaus folgerichtig. Die Streichung dieser Bestim-mung gehört in den Bereich der «Entstaubung» der Verfas-sung. Die Nachführung soll ja gemäss der Botschaft die Män-gel der geltenden Bundesverfassung mit einer realitätsbezo-genen Verfassungsreform beheben, und das wollen wir hier.Wir müssen es den Kirchen überlassen, wie sie sich organi-sieren. Die Zustimmung des Staates ist nicht notwendig.Wenn die Katholiken mit einem Bistumsvorsteher Schwierig-keiten haben, müssen sie das Problem selber lösen. DerStaat kann die internen Probleme einer Konfession nichtregeln, und es wäre auch falsch, wenn der Staat dies tunmüsste.Daher bitte ich Sie – und verweise in diesem Zusammenhangauf die Ausführungen von Herrn Kollega Aeby –, dem Antragder Kommission zuzustimmen und diesen Artikel 84 zu strei-chen.
Bieri Peter (C, ZG): Am 13. Dezember 1994 hat unser ehe-maliger Kollege Hans Jörg Huber hier die parlamentarischeInitiative eingereicht, welche verlangt, Artikel 50 Absatz 4 derBundesverfassung sei aufzuheben. Gemäss AmtlichemBulletin hat bei der Behandlung im Rat der damalige Präsi-dent der SPK, Herr Schmid Carlo, im Namen der Kommissionklargemacht, dass hier ein Reformbedarf bestehe, zumal die-ser Artikel auf das letzte Jahrhundert zurückgehe und sichdie Verhältnisse in der Zwischenzeit erheblich geändert hät-ten. Die SPK hat damals mit 8 zu 0 Stimmen beantragt, derparlamentarischen Initiative Huber Folge zu geben.Hans Jörg Huber begründete seine parlamentarische Initia-tive eingehend:Zum ersten erwähnte er das Verhältnis zwischen Staat undKirche, das sich in den letzten Jahren derart entspannt habe,dass die verbliebenen Ausnahmeartikel beseitigt werdenkönnten.Zum zweiten bestehe aufgrund des Beschlusses des Zwei-ten Vatikanischen Konzils das Verlangen, dass gesamt-kirchlich die Grenzen der Diözesen überprüft und allenfallsden neuen pastoralen Bedürfnissen angepasst werden kön-nen.Zum dritten erwähnte der Initiant, dass es auch auf der Seitedes Staates gute Gründe dafür gebe, diese menschenrechts-widrige Behinderung der Religions-, Versammlungs- und Or-ganisationsfreiheit zu eliminieren. Letztlich richtet sich derBistumsartikel auch gegen die Kantone, da diesen ansonstendie Kirchenhoheit zukommt.Dem Votum des ehemaligen Kollegen Huber ist auch zu ent-nehmen, dass der Bundesrat im Jahre 1994 auf eine Interpel-lation Leuba zur selben Thematik im Nationalrat geantwortethabe, er werde im Rahmen der Totalrevision der Bundesver-fassung die Aufhebung von Artikel 50 Absatz 4 beantragen.Der Bundesrat kann hier – und das ist zuzugeben – mit Rechtsagen, die heutige Vorlage sei keine eigentliche Totalrevisionmehr, was jedoch nicht bedeuten muss, dass man alte, über-holte Relikte des Kulturkampfes bei dieser Nachführung nichtaus der Verfassung eliminiert.Der parlamentarischen Initiative Huber wurde am 12. Juni1995 Folge gegeben. Demzufolge hätte von seiten der Kom-mission eine entsprechende Vorlage binnen zweier Jahreausgearbeitet werden müssen. Diese Frist wurde im Hinblickauf die Bundesverfassungsreform verlängert. Wenn wir hiernun entgegen unserem früheren Beschluss für die Beibehal-tung stimmen, ist meiner Meinung nach die parlamentarischeInitiative nach wie vor auf dem Tisch. Da man jedoch bereitsbei der Behandlung dieser Initiative auf die Möglichkeit derBehandlung im Rahmen der Verfassungsreform hingewiesenhat, möchte ich hier nur aus dem schriftlichen Bericht derSPK zitieren: «Die anstehende Totalrevision der Bundesver-fassung bietet nach Ansicht der Kommission wie auch des In-itianten die Chance, das Anliegen der Initiative zu erfüllen.»
Constitution fédérale. Réforme 86 E 4 mars 1998
Bulletin officiel de l’Assemblée fédérale / Tiré à part
Die Initiative könnte «in diesem grösseren Rahmen behan-delt, erfüllt und abgeschrieben werden».Ich habe mich damals ebenfalls für die parlamentarische In-itiative Huber ausgesprochen. Wenn wir hier nun trotz dieserBeteuerungen zurückkrebsen, dann ist dies für mich auf-grund der dargelegten Vorgeschichte doch schwer verständ-lich. Zudem müsste dann eine genaue Zielvorgabe für dieBehandlung der parlamentarischen Initiative Huber vorgelegtwerden können. Andererseits käme ich nicht um den Ein-druck herum, dass all diejenigen, die von dieser offensichtli-chen Benachteiligung – um nicht den damals diskutiertenAusdruck «Diskriminierung» zu verwenden – betroffen sind,sich geprellt und auch etwas in den früheren Versprechun-gen getäuscht fühlen würden. So wie wir uns aufgerafft undVersprechungen gemacht haben, so sollten wir nun auch denMut zur Tat beweisen.Aufgrund dieser Betrachtung der parlamentarischen Debattein der jüngeren Vergangenheit beantrage ich Ihnen, diesenBistumsartikel zu streichen; oder wir müssten – wenn dasnicht möglich ist – doch immerhin eine klare Zusicherung ha-ben, dass mit der parlamentarischen Initiative Huber jetzt et-was gemacht werden soll.
Koller Arnold, Bundesrat: Für den Bundesrat ist bei der Be-handlung dieses Artikels 84 wichtig, dass wir die materiell-rechtliche Seite von der Frage des Vorgehens unterschei-den.In bezug auf die materiellrechtliche Fragestellung hat IhrKommissionsreferent zu Recht die Problematik vor allem vonAbsatz 3 dargelegt. Wir sind uns einig, dass die Absätze 1und 2 nicht unbedingt nötig sind, weil sie sich aus allgemei-nen Prinzipien ableiten lassen. Bleibt also vor allem die Pro-blematik dieses Bistums-Absatzes, Artikel 84 Absatz 3 desVerfassungsentwurfes bzw. Artikel 50 Absatz 4 der gelten-den Bundesverfassung.Dieser Genehmigungsvorbehalt für die Errichtung neueroder die Gebietsänderung bestehender Bistümer ist zweifel-los – ich glaube etwas anderes vertritt heute auch niemandmehr – unter grund- und völkerrechtlichen Aspekten proble-matisch. Grundrechtlich liegt hier ganz klar eine Beschrän-kung der Glaubens- und Gewissensfreiheit nach Artikel 13des Verfassungsentwurfes vor. Zudem ist die Bestimmungauch angesichts des Diskriminierungsverbotes, Artikel 7 desEntwurfes, zweifelhaft, weil sie im wesentlichen eine Konfes-sion, die römisch-katholische, betrifft.Die Schweiz hat sich zudem in mehreren internationalen Ver-trägen zur Garantie der Religionsfreiheit bekannt. Absatz 3widerspricht diesen staatsvertraglichen Verpflichtungen oderist damit sehr, sehr schwer vereinbar. Der Internationale Paktüber bürgerliche und politische Rechte garantiert in Artikel 18die Religionsfreiheit und untersagt in Artikel 26 Diskriminie-rungen unter anderem aufgrund der Religion. Die Europäi-sche Menschenrechtskonvention (EMRK) enthält ein Diskri-minierungsverbot in Artikel 14 und garantiert die Religions-freiheit in Artikel 9. Der zweite Absatz dieses EMRK-Artikelsverbietet Einschränkungen der Religionsfreiheit, ausser sieseien im Interesse der öffentlichen Sicherheit unbedingt not-wendig. Davon kann hier sicher nicht die Rede sein. Das istdie ganz klare materiellrechtliche Ausgangslage.Warum möchte der Bundesrat nun doch an diesem Absatz 3bzw. an Artikel 50 Absatz 4 der geltenden Bundesverfassungfesthalten? Es ist auf der einen Seite vor allem das Konzeptder Nachführung. Bei aller Problematik ist dieser Artikel 50Absatz 4 der Bundesverfassung geltendes Recht, und derBundesrat hat den Auftrag erhalten, in der nachgeführtenBundesverfassung das geltende, geschriebene und unge-schriebene Verfassungsrecht wiederzugeben. An diesenAuftrag haben wir uns gehalten.Nun haben Sie zwar – und auch der Nationalrat – in einigenganz wenigen Punkten rechtspolitische Neuerungen ein-geführt; aber Sie haben sich bisher doch mit grosser Kon-sequenz an das Prinzip gehalten, das nur dann zu tun, wenndiese rechtspolitischen Neuerungen eindeutig nicht strittig,nicht kontrovers sind. Das war der Fall bei der Wählbarkeits-voraussetzung des weltlichen Standes, bei welcher niemand
dagegen Einspruch erhebt, dass man diese Diskriminierungdes geistlichen Standes aufhebt. Hier aber haben die Ver-nehmlassung und auch die Reaktionen im Hinblick auf dieheutige Beratung ganz klar gezeigt, dass der Bistumsarti-kel – leider auch aufgrund jüngster Ereignisse – immer nochsehr viele Emotionen auslöst und kontrovers ist. Herr Aebyhat in seiner Einführung zu Recht gesagt, sowohl Katholikenwie Protestanten hätten diesbezüglich unterschiedlicheEmpfehlungen abgegeben. Ich darf Sie auch daran erinnern,dass der parlamentarischen Initiative von alt Ständerat Hu-ber hier nur knapp Folge gegeben worden ist, nämlich mit 18zu 16 Stimmen.Das alles zeigt natürlich, dass dieser Artikel nach wie vorsehr kontrovers ist. Ich glaube, Sie sollten deshalb hier undjetzt bei diesem Prinzip bleiben, dass Sie keine ganz klarkontroversen rechtspolitischen Neuerungen in diese nachge-führte Verfassung aufnehmen. Denn sonst ist das eindeutigeine Belastung dieser doch grossen Arbeit, die wir miteinan-der hier leisten. Ich sage immer: Wir müssen hier nur den Bis-tumsartikel streichen, die Kantonsklausel für die Wahl in denBundesrat herausnehmen und dazu ein neues klagbares So-zialrecht, beispielsweise ein Recht auf Wohnung, in die Ver-fassung aufnehmen, dann ist die Niederlage in der Volksab-stimmung irgendwie vorprogrammiert. Dann kommt es zu ei-ner Addition von unterschiedlichen Opponenten. Das kanneigentlich nicht unser Ziel sein. Wenn schon diese Nachfüh-rung nicht gelingt, dann werden sich auch die weiteren Re-formpakete in einem Vakuum befinden. Sie sehen, wie sehrwir – beispielsweise in der nationalrätlichen Kommission –grösste Probleme mit dem Reformpaket der Volksrechte ha-ben. Ohne diesen erfolgreichen Start mit der Nachführungwird der ganze Reformprozess der Verfassung wahrschein-lich fast definitiv gebremst. Das können wir uns in einer Zeit,wo wir Reformen in diesem Staat doch unbedingt nötig ha-ben, gar nicht leisten.Der Bundesrat ist daher überzeugt, dass es einem Gebot po-litischer Klugheit und auch einem Gebot der Konzepttreue imRahmen der Nachführung der Bundesverfassung entspricht,wenn Sie diesen Artikel hier belassen. Wir sind uns aber be-wusst, dass das Problem natürlich gelöst werden muss, undmeinen, dass es politisch sehr viel klüger ist, wenn wir nach-her die parlamentarische Initiative Huber wieder auflebenlassen – sie ist im Moment nur sistiert – und dieses kontro-verse und leider nach wie vor emotionelle Problem unsererVerfassung nicht im Rahmen einer formellen Totalrevision,sondern einer Partialrevision lösen. Das ist ein Gebot derKlugheit.Deshalb möchte ich Sie bitten, hier dem Entwurf des Bundes-rates und dem Antrag Inderkum zuzustimmen.
Abstimmung – VoteFür den Antrag der Kommission 20 StimmenFür den Antrag Inderkum 17 Stimmen
Art. 85Anträge der Kommissionen: BBlPropositions des commissions: FF
Antrag MaissenAbs. 3Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Proposition MaissenAl. 3Adhérer au projet du Conseil fédéral
Aeby Pierre (S, FR), rapporteur: Je pars du principe que leprésident de la commission renonce à faire un commentairegénéral de cette section. Alors je vais en dire quelques motsen préambule.Cette section réunit une série de dispositions constitutionnel-les qui ont un lien très étroit avec l’économie. Ça n’est pas leseul endroit de la constitution où on trouve des principes con-cernant l’économie, parce que les dispositions sont nom-breuses dans d’autres parties: songeons à l’aménagement
4. März 1998 S 87 Bundesverfassung. Reform
Amtliches Bulletin der Bundesversammlung / Separatdruck
du territoire, à la protection de l’environnement, à la libertécontractuelle, etc. L’économie est présente dans presquechaque chapitre, mais ici la section 6 «Economie» regroupeles dispositions constitutionnelles essentielles relatives à lapolitique économique de la Confédération.Le principe général qui régit toute cette section est celui quiveut que, dans notre ordre économique, il n’y a pas d’ingé-rence systématique de la part de l’Etat, et que la Suisse ap-plique le principe de la liberté du marché et de la libre entre-prise.Cela étant, l’article 85 a été remanié par la commission. Il sedivise en quatre parties correspondant aux quatre principesessentiels, formulés de manière générale, de l’ordre écono-mique de notre pays. Ici, la commission a voulu de façon trèsclaire donner la priorité à l’alinéa 2 qu’elle a placé en tête, es-timant qu’il appartient à la Confédération et aux cantons deveiller à sauvegarder les intérêts de l’économie nationale etde contribuer avec l’économie privée à la prospérité et à lasécurité économique de la population. C’est le chapeau detout l’article et c’est pour cela que la commission l’a placé entête. Ensuite, les autres alinéas sont des reprises du projet duConseil fédéral avec des modifications rédactionnelles.L’article 2bis consacre que, dans les limites de leurs compé-tences respectives, cantons et Confédération peuvent pren-dre des mesures pour favoriser l’économie privée. Les pou-voirs publics peuvent donc accorder un soutien à l’économie,c’est le deuxième principe.Le troisième principe, c’est le respect du principe de la libertééconomique.Enfin, le quatrième principe, à l’alinéa 3, prévoit que seulessont admises les dérogations prévues par la constitution oufondées sur les droits cantonaux régaliens.L’articulation de cet article paraît judicieuse par rapport à laphilosophie générale qui sous-tend cette section 6 «Econo-mie».Je vous invite à adopter la proposition de la commission.
Maissen Theo (C, GR): In Artikel 85 Absatz 3 beantragt dieKommission, es solle die Formulierung «insbesondere Mass-nahmen, die sich gegen den Wettbewerb richten» einge-schoben werden.Nun muss man sehen, dass das Prinzip des freiheitlichenWirtschaftssystems in Artikel 23 Absatz 1 festgehalten ist,wo es heisst: «Die Wirtschaftsfreiheit ist gewährleistet.» Dasist die grundrechtliche Komponente für unser Wirtschaftssy-stem. Nun wird in Artikel 85 die Wirtschaftsfreiheit institutio-nell verankert, indem hier der Handlungsrahmen für Bundund Kantone gesetzt wird. Man muss auch sehen, dass einZusammenhang zu Artikel 87 besteht, in welchem die Wett-bewerbspolitik geregelt ist.Der Antrag der Kommission führt nun nach meinem Dafürhal-ten nicht zu einer Klärung der Situation des Verhältnisses derKantone zur Wirtschaftsfreiheit, indem über die Nachführunghinaus etwas hineingebracht wird, was wir heute in der Ver-fassung nicht haben. Es bedarf jedoch hier einer eindeutigenRegelung; es geht nämlich um die Eigenständigkeit der Kan-tone im Rahmen der geltenden und auch der nachgeführtenVerfassung. Wenn man den Zusammenhang zur geltendenVerfassung herstellt, geht es in Absatz 3 insbesondere umdie Regalrechte der Kantone: zum einen um Grund- und Bo-denregale und zum anderen insbesondere um die Feuerver-sicherungsmonopole.In Artikel 85 Absatz 3 wird ausdrücklich festgehalten, dassdiese kantonalen Regalrechte vorbehalten bleiben – genauso, wie es heute in Artikel 31 Absatz 2 der Bundesverfassungsteht –, wobei festzuhalten ist, dass der Umfang dieses Re-galvorbehaltes nicht restlos geklärt ist. Man kann das in derBotschaft zum Verfassungsentwurf auf Seite 297 nachlesen.Erfasst sind – hier wird das festgehalten – die historischenRegale und Monopole wie etwa das Jagd- oder das Bergre-gal. Die Praxis zum geltenden Artikel 31 Absatz 2 Bundes-verfassung hat allerdings die Bildung neuer kantonaler Mo-nopole unter gewissen Voraussetzungen zugelassen.Wenn wir nun diesen Zusatz betreffend den Wettbewerb ein-führen, wird dieser Sachverhalt, den wir heute haben, nicht
geklärt, sondern es gibt eine weitere Unklarheit darüber, wasnun diese ergänzte Norm konkret bedeuten soll. Ich meine,im Rahmen der Nachführung – um eben diese bestehendenMonopole nicht plötzlich von irgendeiner Seite in Frage ge-stellt zu erhalten – sollte man diesen Zusatz der Kommissionbei den Kantonen nicht aufnehmen, sondern beim Entwurfdes Bundesrates bleiben, der sich strikte an die gegebeneVerfassungsgrundlage hält, in diesem Sinne eine Nachfüh-rung ist und nicht zu weiteren Unklarheiten führt.Ich bitte Sie also, meinem Antrag zuzustimmen und die Fas-sung des Bundesrates zu wählen.
Paupe Pierre (C, JU): Je tiens ici à appuyer la propositionMaissen dans la mesure où l’on a le sentiment de créer uneinstabilité avec l’ajout qu’a fait la Commission de la révisionconstitutionnelle. Mais, dans le fond, il suffirait peut-être queM. le conseiller fédéral nous précise si cet ajout constitue unemodification des droits régaliens cantonaux. En fait,M. Maissen l’a évoqué, il s’agit pour nous d’un problème par-ticulier en ce qui concerne les assurances immobilières. Lesétablissements cantonaux d’assurance des bâtiments sontconsidérés comme des droits régaliens cantonaux. Maisquand on ajoute qu’il faut lutter contre tout ce qui peut porteratteinte à la concurrence, est-ce qu’on modifie alors le statutpar rapport à la situation actuelle?C’est vrai que l’ajout peut permettre une interprétation diffé-rente. C’est la raison pour laquelle, si M. le conseiller fédéralne peut pas nous certifier qu’il n’y a pas de modification dansles droits régaliens des cantons, interprétés dans le droit queconstituent ces monopoles des établissements cantonauxd’assurance – monopoles qui constituent effectivement undroit régalien –, si tel n’est pas le cas, je considère alors qu’ilserait préférable de soutenir le projet du Conseil fédéral et dene pas déstabiliser son contenu par un rajout.
Gemperli Paul (C, SG): Ich möchte zuerst meine Interessen-bindung offenlegen: Ich war einige Jahre Präsident des Inter-kantonalen Rückversicherungsverbandes, in dem die 19kantonalen Gebäudeversicherungen zusammengeschlos-sen sind, um ihre Rückversicherung entsprechend zu organi-sieren. Heute allerdings habe ich mit diesem Verband nichtsmehr zu tun; ich bin nur alt Präsident.Der derzeitige Artikel 31 Absatz 1 der Bundesverfassung ge-währleistet die Handels- und Gewerbefreiheit «im ganzenUmfange der Eidgenossenschaft». Artikel 31 Absatz 2 ver-pflichtet die Kantone ausdrücklich auf die gleichen Grund-sätze. Dieser Absatz 2 erhielt seine Ausgestaltung im Jahre1947 anlässlich der Revision der Wirtschaftsartikel der gel-tenden Verfassung. Bemerkenswert ist vor allem, dass Ab-satz 2 ausdrücklich die kantonalen Regalrechte vorbehält.Sie werden garantiert. Nun ist zuzugeben, dass dieser Vor-behalt bezüglich des materiellen Inhaltes nicht in jeder Bezie-hung Klarheit bringt. Dazu stehe ich ausdrücklich.Eines ist aber doch klar: Inhaltlich wurde mit der Revision derWirtschaftsartikel in Artikel 31 Absatz 2 keine Änderung ge-genüber dem bisherigen Recht gewollt. Es sollte vielmehr nureine Bereinigung stattfinden; die bereits aufgrund des altenAbsatzes 2 von Artikel 31 der Verfassung von 1874 beste-henden Regalrechte sollten weiterhin den Kantonen verblei-ben. So war unbestritten, dass nach der Revision von 1947das Bergregal, das Jagdregal und das Fischereiregal denKantonen verbleiben.Walther Burckhardt, der grosse Kommentator der Bundes-verfassung, war zudem der Ansicht, dass damit auch die ob-ligatorische staatliche Immobilienbrandversicherung vorbe-halten sei. Diese Ansicht hatte auch der Bundesrat im Rah-men von Beschwerdeentscheiden vertreten, beispielsweiseim Rahmen eines Entscheides bei der waadtländischen Mo-nopolversicherung. Das war noch im letzten Jahrhundert, imJahre 1884.Durch die Gewährleistung der Kantonsverfassungen – Thur-gau 1989, Solothurn 1987, Basel-Landschaft 1986, Aargau1989 und Jura 1979 – hat die Vereinigte Bundesversamm-lung überdies einzelne kantonale Monopole im Bereiche derGebäudeversicherung auch in jüngster Vergangenheit aus-
Constitution fédérale. Réforme 88 E 4 mars 1998
Bulletin officiel de l’Assemblée fédérale / Tiré à part
drücklich anerkannt. Zu schliessen ist daraus, dass sowohlBundesrat wie Bundesversammlung unwidersprochen davonausgegangen sind, dass die Gebäudeversicherungsmono-pole zu den historisch geschützten Regalrechten gehören.Zusammenfassend ist jedenfalls klar, dass die Verfassungs-praxis davon ausging, dass die bestehenden Regale und Mo-nopole weitergeführt werden können. Bei der Revision derWirtschaftsartikel im Jahre 1947 wollte man mit Bezug auf dieRechtslage keine Änderung herbeiführen.Nun weiss ich allerdings, dass die Auslegung heute zum einendifferenzierter erfolgt, und es geht mir hier nicht darum, einenMethodenstreit heraufzubeschwören. Ich weiss, dass sichauch Herr Rhinow intensiv mit diesem Problem beschäftigthat.Ich möchte vom Bundesrat aber klar den Stellenwert der heu-tigen Revision beurteilt haben. Vor allem geht es darum zuwissen, ob wir uns auch hier im absoluten Kontext der Nach-führung befinden. Das würde heissen, dass sich gegenüberder bisherigen Rechtslage grundsätzlich nichts ändert.Die rechtliche Lage ist nach wie vor diskutabel, aber sie ver-schlechtert sich für die Kantone gegenüber dem bestehen-den Recht nicht. Übrigens darf ich hier noch einen Einschubmachen: Selbst wenn das Gebäudeversicherungsmonopolentgegen der herrschenden Lehre nicht als kantonales Re-galrecht im Sinne von Artikel 31 Absatz 2 zweiter Satz derBundesverfassung anerkannt würde, wäre es als kantonalerEingriff in die Handels- und Gewerbefreiheit wohl zulässig,wenn es sich auf eine gesetzliche Grundlage stützt, im öffent-lichen Interesse liegt und verhältnismässig ist.Die Fortschreibung der Bundesverfassung darf nicht zu einerVerschlechterung der bisherigen rechtlichen Situation füh-ren. Das ist das Wesentliche meines Anliegens. Die Stellungder Kantone bezüglich ihrer Gebäudeversicherungsmono-pole muss gemäss dem heutigen Rechtszustand beibehaltenwerden; sonst würde man über den Rahmen der Nachfüh-rung hinausgehen. Das wäre meines Erachtens nicht akzep-tabel und würde natürlich auch bezüglich der Akzeptanz zuKonsequenzen führen. Es würde auch eine Diskussion, dieallenfalls in diesem Lande einmal noch geführt werden muss,unterdrückt. Es geht nämlich um die Frage, ob bestimmte,theoretisch vermutete ökonomische Konsequenzen auftre-ten, wenn Staatsaufgaben privatisiert oder private Tätigkei-ten verstaatlicht werden. Diese Frage lässt sich meines Er-achtens nicht einfach anhand von theoretischen Modellenbeantworten. Man muss sich vielmehr mit den konkretenFakten beschäftigen und die Kriterien festlegen, nach denenman die Überlegenheit respektive die Unterlegenheit bemes-sen will. Im Zentrum der ökonomischen Betrachtung steht indiesem Zusammenhang zweifellos die Effizienz. Wer bezüg-lich des Verhältnisses von Leistung und Gegenleistung gün-stig abschneidet, gilt als effizienter und damit wirtschaftlichüberlegener. Es stellt sich dann natürlich die Frage, ob hieraus allgemeinen Wohlfahrtsüberlegungen heraus nicht aucheine Ausnahme gerechtfertigt werden kann. Das habe ichgrundsätzlich anzumerken.Ich möchte nun den Bundesrat bitten, mir die Frage zu beant-worten, ob meine Annahme richtig ist, dass sich an der heu-tigen Rechtslage auch mit der Nachführung nichts ändert. Ichwäre auch dankbar zu wissen, ob der Einschub, wie ihn dieKommission vorsieht, allenfalls eine Änderung herbeiführt.Wenn er eine Änderung herbeiführt, müsste ich von vornher-ein dem Antrag Maissen zustimmen.
Rhinow René (R, BL): Ich bin versucht, im Sinne einer Offen-legung der Interessenbindungen mitzuteilen, dass ich wederetwas für noch etwas gegen die Gebäudeversicherung habe;ich bin aber immerhin zwangsweise als Hauseigentümer dortversichert. Es ist eine Eigenheit unserer Wirtschaftsverfas-sung, dass die Handels- und Gewerbefreiheit – oder Wirt-schaftsfreiheit, wie sie jetzt heisst – nicht nur wie alle anderenGrundrechte geschützt ist, sondern dass sie ganz besondersabgesichert wird, wenn es um den Grundsatz dieser Wirt-schaftsfreiheit geht. Dieser besondere Schutz liegt darin,dass Abweichungen einer besonderen Verfassungsgrund-lage bedürfen.
Hier reden wir von Abweichungen, weil es nicht um gewöhn-liche Einschränkungen geht, sondern eben darum, dass derGrundsatz der Wirtschaftsfreiheit tangiert werden soll. Die-ser Begriff findet sich bereits in der geltenden Verfassung; esist darauf hingewiesen worden, dass er keine Erfindung dernachgeführten Verfassung ist. Es war lange Zeit umstritten,was denn eigentlich unter dem Grundsatz der Wirtschafts-freiheit zu verstehen sei. Heute darf man davon ausgehen,dass diese Frage vom Bundesgericht und von der herr-schenden Lehre weitgehend geklärt worden ist. Grundsatzder Wirtschaftsfreiheit heisst Schutz der Marktkonformität,Schutz des Wettbewerbs, soweit es um staatliche Massnah-men geht. Abweichungen vom Grundsatz der Wirtschafts-freiheit sind also vor allem staatliche Massnahmen, die sichgegen den Wettbewerb richten. Das sind beispielsweiseLenkungsmassnahmen, Preisvorschriften, die zentral denMechanismus des Marktes aus den Angeln haben, Kontin-gente usw.Das Bundesgericht verwendete bisher den Begriff der wirt-schaftspolitischen Massnahmen, um diese Zielrichtung zumAusdruck zu bringen. Der Bundesrat umschreibt die Bedeu-tung des Grundsatzes der Wirtschaftsfreiheit in der Botschafttreffend: «Bund und Kantone dürfen den Grundsatz der Wirt-schaftsfreiheit nicht beeinträchtigen. Es ist ihnen – entspre-chend der Praxis des Bundesgerichts zu Artikel 31 BV – un-tersagt, Regelungen und Massnahmen zu treffen, die denWettbewerb unter privaten Wirtschaftssubjekten verzerrenoder den Wettbewerb sogar ganz verunmöglichen. Es dürfennicht einzelne Konkurrenten bevorzugt und andere benach-teiligt werden. ’Gewerbegenossen’» – wie dieser altmodischeAusdruck heisst – «sind gleich zu behandeln.» Oder modernformuliert: «Staatliches Handeln muss grundsätzlich wettbe-werbsneutral sein.» (Botschaft S. 294) Das entspricht der bisherigen Praxis und der herrschendenLehre. Genau das soll der Passus zum Ausdruck bringen,den die Kommission beschlossen hat, nämlich dass Abwei-chungen vom Grundsatz der Wirtschaftsfreiheit insbeson-dere Massnahmen sind, die sich gegen den Wettbewerb rich-ten.Der Bezug, den Kollege Maissen zu Artikel 87 hergestellthat, ist nicht gerechtfertigt. Es geht hier nicht um die Kartell-oder Wettbewerbspolitik, es geht nicht um einen Gestal-tungsauftrag des Staates, Wettbewerb herzustellen, privateBindungen oder gar Kartelle aufzulösen, sondern es gehtdarum, dass sich der Staat selbst bei seinen Handlungen anden bestehenden Wettbewerb zu halten hat. Das soll hierzum Ausdruck gebracht werden, und zwar – ich betone esnochmals – in Übereinstimmung mit der herrschenden Lehreund der Praxis.Herr Maissen befürchtet nun, dass hier eine zusätzlicheHandhabe gegen kantonale Monopole aufgerichtet werdenkönnte. Ich darf Sie beruhigen, Herr Maissen: Das ist nichtdie Meinung. Dieser Passus ändert nichts an der bestehen-den Rechtslage. Einmal wird hier, wie Sie richtig gesagt ha-ben, genau gleich wie in der bestehenden Fassung, der Vor-behalt der kantonalen Regalrechte beibehalten. Dann istaber auch richtig, dass nach heutiger Rechtslage bereits un-sicher und unklar ist, wieweit andere Monopole der Kantonezulässig sind. Bis jetzt ist man davon ausgegangen, dass diebestehenden geschützt sind. Aber es ist offen, wieweit neueeingeführt werden dürfen. Diese Unklarheit, die in der Tat be-steht, wird genau gleich weitergeführt, im Sinne des «negati-ven Nachführens», etwas pointiert gesagt. Man schleppt alsogewisse Unsicherheiten weiter. Aber das ist eben auchNachführung, denn jede Präzisierung würde hohe Wider-stände und vielleicht auch neue Unsicherheiten auslösen. Eskann aber auch nicht die Meinung sein, dass wir mit dernachgeführten Verfassung zusätzlichen Monopolschutz be-treiben.Herr Gemperli hat eine ausgezeichnete Formulierung gefun-den, die mir gefallen hat. Er hat gesagt, die Rechtslage bleibediskutabel, aber sie verschlechtere sich nicht. Ich kann dasvoll und ganz unterstreichen.Ich bitte Sie, der Kommission zu folgen, und ich gebe gerneals Kommissionspräsident die Zusicherung ab, dass sich mit
4. März 1998 S 89 Bundesverfassung. Reform
Amtliches Bulletin der Bundesversammlung / Separatdruck
Absatz 3 gemäss Kommission an der gegenwärtigen Rechts-lage bezüglich der Kantone nichts ändert.
Koller Arnold, Bundesrat: Im 6. Abschnitt wird die Wirt-schaftsverfassung der Schweiz nachgeführt. Dieses Themaist von grösster verfassungsrechtlicher und politischer Be-deutung. Wir haben uns aber auch hier streng an das Kon-zept der Nachführung gehalten.Zentrales Element unserer geltenden Wirtschaftsverfassungist die Handels- und Gewerbefreiheit oder die – wie wir jetztrichtiger sagen – Wirtschaftsfreiheit. Sie ist ein Grundrecht,das in Artikel 23 des Verfassungsentwurfes garantiert ist. Siegewährleistet die freie «privatwirtschaftliche Erwerbstätig-keit» für jeden Berechtigten.Die Wirtschaftsfreiheit gewährleistet aber auch die Privatwirt-schaft oder die freie Wirtschaft als Ganzes. Diese institutio-nelle Garantie ist die zwangsläufige Folge der Gewährlei-stung der individuellen Wirtschaftsfreiheit. Dieser von derVerfassung gewollte Zustand ist in der gesamten Tätigkeitdes Staates zu berücksichtigen. Die Literatur spricht hier zuRecht von der konstitutiven Funktion der Wirtschaftsfreiheit.Zu dieser institutionell garantierten Privatwirtschaft gehörtauch die Wettbewerbswirtschaft. In der Literatur war dieFrage des Stellenwertes des Wettbewerbes in dieser privat-wirtschaftlich garantierten Wirtschaftsordnung lange Zeitkontrovers. Ich möchte dazu klar Stellung nehmen:Der Wettbewerb ist ein wesentliches Element unserer Wirt-schaftsverfassung, unserer Wirtschaftsordnung; er ist abernicht das alleinige Element. Wir haben nicht die Ordnung, wiesie beispielsweise im EWG-Vertrag in Artikel 3 Litera f klarvorgesehen ist, wo es heisst, dass das Ziel der Gemeinschaftdie Errichtung eines Systems sei, das den Wettbewerb inner-halb des gemeinsamen Marktes vor Verfälschungen schütze.Damit würde von Verfassung wegen eine Wettbewerbswirt-schaft in einem absoluten Sinn gewährleistet. Unsere Wirt-schaftsverfassung kennt keine generelle Garantie des Wett-bewerbes. Das zeigt schon der Kartellartikel. Der Kartellarti-kel unterscheidet bekanntlich Kartelle, die unter dem Titel derWirtschaftsfreiheit legitim sind, und Kartelle, die sozial undvolkswirtschaftlich schädliche Auswirkungen zeitigen unddeshalb zu bekämpfen sind. An dieser Ordnung ändern wirmit dieser nachgeführten Verfassung nichts.Wir ändern auch mit dem Zusatz, den Ihre Kommission be-antragt, nichts, denn dieser Zusatz bezieht sich nicht auf dieStellung der Privaten untereinander, sondern auf das staatli-che Handeln. Hier ist nun allerdings klar: Der Staat muss sichim wirtschaftlichen Wettbewerb neutral verhalten. StaatlicheMassnahmen dürfen den Wettbewerb zwischen privaten Un-ternehmen nicht verzerren oder verunmöglichen. Diesbezüg-lich bringt dieser Zusatz Ihrer Kommission eine erwünschtePräzisierung der bisherigen Praxis des Bundesgerichtes. DerBundesrat kann dieser erwünschten Präzisierung in bezugauf die staatlichen Massnahmen zustimmen.Der Staat kann vom Grundsatz der Wirtschaftsfreiheit zwarabweichen, aber eben nur dort, wo ihn die Bundesverfassungdazu ermächtigt. Man spricht in diesem Zusammenhang voneinem Verfassungsvorbehalt für Massnahmen, die vomGrundsatz der Wirtschaftsfreiheit abweichen. Das machenwir in der nachgeführten Verfassung klar.Zur Frage der sogenannten Monopole oder Regalien und vorallem zum Problem der Gebäudeversicherungsmonopole:Wir machen, wie in der geltenden Verfassung, ganz klar ei-nen Vorbehalt zugunsten der kantonalen Regalrechte. Daranändert, wie gesagt, auch dieser Zusatz Ihrer Kommissionnichts. Was die Gebäudeversicherungsmonopole anbelangt,hat die Praxis diese bisher toleriert. Ob das unter dem Titel«historische Regalrechte» geschieht, wie ein Teil der Rechts-lehre annimmt, oder unter dem Titel der polizeilich begründe-ten Monopole, ist – das hat Herr Gemperli offenbar auch ge-meint – offengeblieben. Mit der Nachführung der Bundesver-fassung ändern wir an diesem geltenden Rechtszustandnichts. Wir bleiben auch hier dem Konzept der Nachführungtreu. Wie gesagt, bringt diesbezüglich auch der Zusatz IhrerKommission keinerlei Änderung. Er bringt nur die erwünschtePräzisierung, dass sich der Staat in seinen Massnahmen an
das Prinzip der Wettbewerbsneutralität halten muss, es seidenn, es gebe eine Abweichungsermächtigung für wirt-schaftspolitische Massnahmen.In diesem Sinne möchte ich Sie bitten, der Kommission zuzu-stimmen.
Maissen Theo (C, GR): Ich möchte für die wertvolle Diskus-sion zu diesem Punkt danken. Sie hat dazu geführt, dass eseine Klärung gegeben hat und – vor allem – sowohl vomKommissionspräsidenten Rhinow wie von Herrn BundesratKoller zuhanden der Materialien klar festgehalten worden ist,dass sich an der heutigen Situation bezüglich der Regal-rechte nichts ändert. Das war ja mein Anliegen.Nachdem das hier so klar und deutlich gesagt worden ist, er-übrigt sich mein Antrag, und ich ziehe ihn zurück.
Angenommen gemäss Antrag der KommissionAdopté selon la proposition de la commission
Art. 86Anträge der Kommissionen: BBlPropositions des commissions: FF
Aeby Pierre (S, FR), rapporteur: L’article 86, intitulé «Activitééconomique lucrative privée», n’a pas fait l’objet de grandesdiscussions et, en tout cas, d’aucune contestation lors desdébats en commission. Il reprend et met à jour une partie del’article 31 actuel sur la liberté du commerce et de l’industriesur tout le territoire de la Confédération, et aussi l’alinéa 2 del’article 31bis de la constitution actuelle.Simplement, j’attire peut-être votre attention en particulier surl’alinéa 2 qui fait obligation à la Confédération de veiller «.... àcréer un espace économique suisse homogène». C’est toutela dimension du marché intérieur, ou du «Binnenmarkt», quiest ici évoquée; ça paraît fondamental dans l’optique de toutela législation qui s’est mise en place et qui continue à se met-tre en place sur le marché intérieur.La deuxième partie de l’alinéa 2 concerne la possibilitéd’exercer sa profession dans toute la Suisse. Ici aussi, la lé-gislation n’est pas entièrement à jour par rapport à la prati-que, par rapport à nos engagements internationaux, par rap-port à notre plus récente législation suisse en la matière.J’évoque ici la question des avocats, par exemple, mais onpourrait aussi parler d’autres professions.En tout état de cause, cet article 86 correspond tout à fait àune mise à jour et il n’y a pas d’autres commentaires à y ap-porter.
Koller Arnold, Bundesrat: Nur eine Bemerkung zu diesemneuen Ausdruck «einheitlicher schweizerischer Wirtschafts-raum», den wir hier einführen: Der Grundsatz der Einheit desschweizerischen Wirtschaftsraumes liegt, wenn auch nichtexplizit, bereits dem heutigen Verfassungsrecht zugrunde.Das heutige Recht bringt die bundesstaatliche Dimension derWirtschaftsverfassung im Zusammenhang mit dem Grund-recht der Handels- und Gewerbefreiheit zum Ausdruck, die«im ganzen Umfange der Eidgenossenschaft gewährleistet»ist. In der Rechtsprechungspraxis hat diese Formel allerdingswenig Durchsetzungskraft entfaltet, weshalb der Bund vorkurzem das Binnenmarktgesetz erlassen hat. Mit der neuenFormulierung wird der Grundsatz der Einheit des schweizeri-schen Wirtschaftsraumes im Interesse der nötigen Transpa-renz noch klarer hervorgehoben.
Angenommen – Adopté
Art. 87Anträge der Kommissionen: BBlPropositions des commissions: FF
Aeby Pierre (S, FR), rapporteur: En ce qui concerne l’article87, «Politique en matière de concurrence», il n’a pas non plusété contesté en commission et a fait l’objet de peu de discus-sions. Il est pourtant essentiel. Il pose les principes d’une lé-gislation qui peut être importante. Il convient tout de même de
Constitution fédérale. Réforme 90 E 4 mars 1998
Bulletin officiel de l’Assemblée fédérale / Tiré à part
rappeler ici qu’en matière de cartels, la marge d’action du lé-gislateur, c’est-à-dire du Parlement, est tout à fait importante.Le Parlement pourrait notamment, dans certain cas, en appli-cation de cet article, utiliser l’instrument de l’interdiction descartels, même si, à ce jour, il ne l’a pas fait ou, en tout cas, nel’a pas fait de manière très claire.L’article 87, donc, remplit ici une fonction essentielle dans cetexercice de mise à jour. Il reprend ce que nous connaissonsaujourd’hui à l’article 31bis alinéa 3 lettre d et à l’article31septies de notre constitution actuelle.
Angenommen – Adopté
Art. 88Anträge der Kommissionen: BBlPropositions des commissions: FF
Aeby Pierre (S, FR), rapporteur: L’article 88, divisé en troisalinéas, impose à la Confédération de prendre des mesurespour protéger les consommateurs. Il n’y a pas de forme po-testative ici. C’est très clair: «la Confédération prend des me-sures ....» Les alinéas 2 et 3 constituent des concrétisationsde cette politique de protection des consommateurs. Il n’y apas de remarque particulière à faire à ce propos, si ce n’estque, là aussi, en commission, les débats ont été assez brefset les discussions n’ont pas été très nombreuses. Il n’y a pasde contestation.
Angenommen – Adopté
Art. 88aAnträge der Kommissionen: BBlPropositions des commissions: FF
Aeby Pierre (S, FR), rapporteur: L’article 88a reprend l’article90 du projet du Conseil fédéral, dans une systématique diffé-rente placée entre la protection des consommateurs et la po-litique monétaire. On a cet article sur les banques et les as-surances. Seule remarque ici: la commission a souhaité don-ner plus d’importance au statut particulier des banques can-tonales. C’est ainsi qu’à l’alinéa 1er, on retrouve d’emblée lerôle et le statut de ces banques cantonales. Je crois que cettedémarche est justifiée. Elle a été approuvée par la majoritéde la commission. Pour le reste, l’ensemble de l’article n’estpas modifié. L’alinéa 1bis et l’alinéa 3 découlent précisémentdu fait d’avoir hissé les banques cantonales au niveau del’alinéa 1er.
Angenommen – Adopté
Art. 89 Abs. 1, 2, 4 – Art. 89 al. 1, 2, 4Anträge der Kommissionen: BBlPropositions des commissions: FF
Angenommen – Adopté
Art. 89 Abs. 3Neuer Antrag der KommissionMehrheit.... ausreichende Währungsreserven. Ein Teil dieser Reser-ven wird in Gold gehalten.Minderheit(Aeby, Gentil)Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Antrag Spoerry.... ausreichende Währungsreserven. Ein angemessener Teildieser Reserven wird in Gold gehalten.
Art. 89 al. 3Nouvelle proposition de la commissionMajorité.... des réserves monétaires suffisantes. Une part de celles-ci doit consister en or.
Minorité(Aeby, Gentil)Adhérer au projet du Conseil fédéral
Proposition Spoerry.... des réserves monétaires suffisantes. Une partie raisonna-ble de ces réserves est conservée sous forme d’or.
Spoerry Vreni (R, ZH): Eine starke Mehrheit Ihrer Kommis-sion beantragt Ihnen bei Artikel 89 eine neue Fassung. DieGeschichte ist ein bisschen kompliziert. Ich will versuchen,die Frage so einfach wie möglich darzulegen, und be-schränke mich dabei auf die Problematik des Goldes.Bei der Nachführung ist in Artikel 89 die Goldbindung derWährung aufgehoben worden. Dieser Vorschlag des Bun-desrates ist absolut richtig, denn die Goldbindung der Wäh-rung existiert seit langem nicht mehr. Die geltende Verfas-sungsbestimmung ist somit toter Buchstabe, und sie soll imRahmen der Nachführung korrigiert werden.Eine andere Frage hingegen ist jene der Goldreserven imRahmen der Währungsreserven, über die wir verfügen. ImEntwurf des Bundesrates wird ebenfalls der Hinweis auf dieGoldreserven fallengelassen. Unser Land verfügt aber heuteüber beträchtliche Goldreserven. Wir haben vor wenigen Mo-naten ein Gesetz verabschiedet, mit dem wir die Frage derGoldreserven neu geregelt haben.Die Goldreserve ist also eine Realität. So hat das auch dieKommission des Nationalrates gesehen, die sich nicht demBundesrat angeschlossen hat, sondern welche die Erwäh-nung der Goldreserve im Rahmen der Nachführung wieder indie Verfassung aufgenommen hat. Nach nochmaliger Dis-kussion beantragt Ihnen nun auch Ihre vorberatende Kom-mission, das ebenfalls zu tun. Der Grund dafür ist, dass seitder Vorbereitung der Nachführung der Bundesverfassung mitBezug auf diese Frage eine veränderte Situation entstandenist.Nicht nur, aber auch wegen des Vorschlages der Solidaritäts-stiftung muss die Frage der Goldreserven neu diskutiert wer-den. Deswegen hat diese Frage in der Zwischenzeit ein et-was anderes Gewicht erhalten. Vornehmlich aus diesemGrunde legt der Bundesrat ausserhalb der Nachführung ei-nen separaten Währungsartikel vor, der jetzt vorbereitet undin absehbarer Zeit zur Abstimmung kommen wird. Im Rah-men dieser separaten Abstimmung über einen neuen Wäh-rungsartikel werden die wohl nicht ganz unbestrittenen Fra-gen der Goldreserven wie auch jene der Politik der Schwei-zerischen Nationalbank im generellen diskutiert werden müs-sen.Aus diesem Grunde erscheint es der Kommission als nichtopportun, die Frage der Goldreserven im nachgeführten Ver-fassungstext nicht mehr zu erwähnen und damit eigentlichauch zu unterstellen, sie seien nicht mehr nötig. Wir meinen,diese Frage sollte nicht in der Nachführung zur Diskussiongestellt werden, sondern wir sollten auf diese separate Ab-stimmung warten und dort die ganze Problematik zusammendiskutieren. Es gilt also folgendes Fazit zu ziehen: Im Rah-men der Nachführung, die wir heute mit Artikel 89 diskutie-ren, ist es richtig, dass die Goldbindung wegfällt, weil dieGoldbindung der Währung nicht mehr existiert. Damit istdiese Korrektur eine echte Nachführung. Der Hinweis aber,dass ein Teil unserer Währungsreserven in Gold gehaltenwerden muss, soll im Rahmen der Nachführung weiterbeste-hen, weil es nichts anderes als die Wiedergabe des aktuellenZustandes ist. Die Frage, was mit den Goldreserven in Zu-kunft geschehen soll, wird in der separaten Verfassungsvor-lage diskutiert, die bereits eine Vernehmlassung passiert hatund in wenigen Monaten abstimmungsreif sein dürfte.Aus diesem Grunde ist die Mehrheit Ihrer Kommission zurAnsicht gekommen, dass die beiden Verfahren im Interesseder Transparenz nicht verwischt werden dürfen und dass dieErwähnung einer angemessenen Goldreserve im Rahmender Nachführung weiterhin nötig ist.
Aeby Pierre (S, FR): En 1992, la Suisse a signé les accordsrelatifs à sa participation aux institutions de Bretton Woods,
4. März 1998 S 91 Bundesverfassung. Reform
Amtliches Bulletin der Bundesversammlung / Separatdruck
dont fait partie le Fonds monétaire international. Notre paysa pris des engagement, comme tous les autres Etats, en ma-tière monétaire.Mme Spoerry l’a bien expliqué, aujourd’hui la couverture-orest une illusion dans le système monétaire international. Jeconsidère que la majorité de la commission cède à la tenta-tion d’utiliser des moyens d’explication complexes, cède à latentation émotionnelle, psychologique pour justifier le fait dene pas abandonner cette notion d’«or». C’est à usage pure-ment interne et ça ne correspond pas à la réalité vécueaujourd’hui.On craint des amalgames, des confusions avec la Fondation«Suisse solidaire» et des oppositions sur ce point. La ques-tion n’est pas fondamentale, mais je considère que nous de-vons faire preuve de rigueur dans cette mise à jour et ne pasdonner dans le côté émotionnel et psychologique. Nous con-tribuons ainsi à entretenir, si nous modifions le projet du Con-seil fédéral, l’illusion qu’une certaine quantité d’or garantitnos réserves monétaires.En conséquence de quoi je vous invite à adopter la versiondu Conseil fédéral qui était celle de notre commission avantque nous changions d’avis. Ces considérations de tactiquede vote n’ont pas lieu d’être lorsqu’on révise une constitutionet surtout pas dans un sujet qui est juridiquement et techni-quement tout à fait limpide et qui n’est contesté par personneaujourd’hui. Il y a unanimité absolue aussi bien des écono-mistes que des juristes; il y a unanimité absolue au plan dudroit international pour dire que nous n’avons pas besoin decouverture-or et que nous n’avons pas à maintenir ce signedu passé dans une constitution moderne, contemporaine etmise à jour.Je vous invite à voter le projet du Conseil fédéral à cet article.
Koller Arnold, Bundesrat: In Artikel 89 führen wir die gel-tende Währungsverfassung nach, und zwar nicht wortwört-lich gemäss dem Text des geltenden Artikels 39 der Bundes-verfassung, sondern wir führen die reale, die gelebte und teil-weise auch in internationalen Abkommen fixierte Währungs-verfassung nach. Hier besteht gegenüber dem bisherigenArtikel 39 vor allem in bezug auf zwei Punkte eine seit lan-gem andauernde Abweichung:Es betrifft dies den Artikel 39 Absatz 6, die sogenannte Ein-lösungspflicht der Nationalbank für die Banknoten. Es be-steht nach dem geltenden Recht grundsätzlich eine solcheEinlösungspflicht, ausser in Kriegszeiten oder in Zeiten ge-störter Währungsverhältnisse. Diese Einlösungspflicht ist seitJahrzehnten suspendiert, und es geht nicht mehr an, dass wirvon einer Fiktion dauernd gestörter Währungsverhältnisseausgehen. Deshalb verzichten wir in der nachgeführten Ver-fassung auf die Einlösungspflicht.Wir verzichten auch auf die Goldbindung in bezug auf den gel-tenden Artikel 39 Absatz 7. Sie wissen, wir haben im Jahre1973 bei der Einführung der flexiblen Wechselkurse auf dieGoldbindung verzichtet, und als wir, wie Herr Aeby ausgeführthat, 1992 den Bretton-Woods-Institutionen beigetreten sind,haben wir uns auch zu einem Verbot einer solchen Goldbin-dung verpflichtet. Wir könnten die Goldbindung heute gar nichtmehr einführen, es sei denn durch Kündigung der Bretton-Woods-Institutionen, und das will und verlangt ja niemand.Das sind die wesentlichen Anpassungen im neuen Artikel andie heute seit Jahrzehnten gelebte Verfassungswirklichkeit aufdem Gebiete der Währungsverfassung. Daraus ergibt sich nunauch, dass die Schweizerische Nationalbank heute bekannt-lich über überschüssige Goldbestände verfügt. Eine Experten-gruppe, die den neuen Währungsartikel vorbereitet hatte, derja jetzt im Finanzdepartement ansteht, hat festgestellt, dassdie Nationalbank einen Anteil von etwa 1400 Tonnen am ge-samten Goldbestand von heute 2590 Tonnen aus ihrer Bilanzausgliedern könnte und trotzdem noch volkswirtschaftlich dienötigen Währungsreserven in Gold gehalten würden.Die Schweizerische Nationalbank will ja am Prinzip festhal-ten, dass ein Teil, ein volkswirtschaftlich, gesamtwirtschaft-lich gerechtfertigter Teil, auch künftig in Gold gehalten wird.Das ist der Grund, weshalb ich dem Antrag Ihrer Kommissionzustimmen kann. Entscheidend ist, dass wir – wie gesagt –
diese beiden Änderungen im Sinne der gelebten Verfas-sungswirklichkeit vornehmen. Wir verzichten auf die Einlö-sungspflicht. Wir heben die Goldparität auf, was der gelebtenVerfassungswirklichkeit und den internationalen Verpflich-tungen entspricht. Dass ein angemessener Teil der Wäh-rungsreserven der Schweizerischen Nationalbank aber auchweiterhin in Gold gehalten werden soll, ist auch auf seiten derNationalbank vollständig unbestritten.Deshalb habe ich gegen diese Präzisierung Ihrer Kommis-sion nichts einzuwenden.
Präsident: Der Antrag Spoerry ist zurückgezogen worden.
Abstimmung – VoteFür den Antrag der Mehrheit 25 StimmenFür den Antrag der Minderheit 4 Stimmen
Art. 90Anträge der Kommissionen: BBlPropositions des commissions: FF
Präsident: Dieser Artikel wird durch den neuen Artikel 88aersetzt.
Angenommen – Adopté
Art. 91Anträge der Kommissionen: BBlPropositions des commissions: FF
Aeby Pierre (S, FR), rapporteur: Nous arrivons ici à cinq ar-ticles assez fondamentaux, qui méritent peut-être une re-marque générale: l’article 91 sur la politique conjoncturelle,l’article 93 sur la politique économique extérieure, l’article 94sur l’approvisionnement du pays, l’article 94a sur la politiquestructurelle et l’article 95 sur la politique agricole. Nousavons là cinq articles sur des politiques très précises de laConfédération, au milieu desquels se trouve l’article sur l’ap-provisionnement du pays, qui est également un article fon-damental.Pour en revenir à l’article 91, celui de la politique conjonctu-relle, il n’a pas fait l’objet de discussions contradictoires encommission. C’est un article général, qui pose les bases dela législation. En la matière, les moyens comme tels ne fontpas l’objet d’un consensus suffisant pour que le Conseil fédé-ral ait pu les intégrer dans l’article 91. Nous avons tout demême, à l’alinéa 1er, la prévention contre le chômage et lerenchérissement, mais rien sur les moyens – ça, je l’ai expli-qué. A l’alinéa 3, ce qui me paraît important à relever, nousavons les quatre domaines où la Confédération peut dérogerà la liberté économique: les domaines du crédit, de la mon-naie, du commerce extérieur et des finances publiques.Pour le reste, l’article 91 reprend l’article 31quinquies de laconstitution actuelle. Je n’ai pas d’autres remarques à formu-ler.
Angenommen – Adopté
Art. 92Anträge der Kommissionen: BBlPropositions des commissions: FF
Aeby Pierre (S, FR), rapporteur: L’article 92 a été biffé par lacommission et reporté après l’article 94, à l’article 94a «Poli-tique structurelle», qui permet à la Confédération, ici, de pra-tiquer une politique d’équilibre au sein de notre pays et surnotre territoire. Il permet le soutien aux régions économique-ment menacées et la promotion de branches économiques etde professions qui en auraient besoin, et cela, naturellement,en dérogeant au principe de la liberté du commerce.Cet article 94a n’est pas combattu. Il fait l’objet d’une dispo-sition transitoire à l’article 185 chiffre 5a, disposition transi-toire qui prévoit une période de dix ans pour la clause du be-soin, dix ans d’adaptation pour les établissements publics. Lacommission, constatant que la clause du besoin était con-
Constitution fédérale. Réforme 92 E 4 mars 1998
Bulletin officiel de l’Assemblée fédérale / Tiré à part
traire aux principes de la loi sur le marché intérieur, à tous lesprincipes de libéralisation du marché intérieur, et égalementen tenant compte de votations qui ont eu lieu dans plusieurscantons et qui ont aboli cette clause du besoin, a souhaité nepas la reprendre. C’est pour ça qu’elle ne figure plus àl’article 94a, mais qu’il y a un délai de dix ans, dix ans pen-dant lesquels les cantons qui connaissent encore cetteclause du besoin pour les établissements publics ont le de-voir de s’adapter. La commission a considéré que ce délaiétait bien suffisant pour qu’aucun canton ne se sente atteintdans sa souveraineté. Et de toute façon, sur cet aspect-là, sasouveraineté aujourd’hui est contraire à l’ordre du commerceinternational et au marché interne suisse.En conséquence, je vous invite à adopter la proposition de lacommission.
Angenommen – Adopté
Art. 93Anträge der Kommissionen: BBlPropositions des commissions: FF
Aeby Pierre (S, FR), rapporteur: L’article 93 est nouveau,mais il correspond à des dispositions implicitement conte-nues dans la constitution actuelle concernant la politiqueéconomique extérieure et les intérêts de l’économie suisse àl’étranger. Il n’a pas fait l’objet de discussions particulières encommission.
Angenommen – Adopté
Art. 94Anträge der Kommissionen: BBlPropositions des commissions: FF
Aeby Pierre (S, FR), rapporteur: Concernant l’article 94, il n’ya pas de remarque à faire à propos des alinéas 1er et 3. Enrevanche, notre commission a décidé de biffer l’alinéa 2, nonsans certaines discussions. La commission a considéré qued’assurer l’approvisionnement du pays en céréales et en fa-rine panifiables était une exhortation qui tenait aussi bien dela politique agricole et du soutien à l’agriculture que d’une po-litique d’approvisionnement du pays, et donc qu’on pouvaitbiffer l’alinéa 2.Dans une deuxième phase, la commission s’est ravisée.Vous n’avez pas le renvoi sur le dépliant, mais il faut se re-porter à l’article 185 chiffre 5b «Dispositions transitoires adart. 94 (Approvisionnement du pays)». Là, jusqu’au 31 dé-cembre 2003, la commission maintient cette mention de«l’approvisionnement du pays en céréales et en farine pani-fiables», de manière à ce qu’il n’y ait pas de blocage à ce pro-pos, notamment dans les milieux agricoles. Mais il est vraique parler aujourd’hui de céréales et de farine panifiables àl’article 94 a un relent de quelque chose de désuet et, d’icicinq ans, cette disposition disparaîtra également de la dispo-sition transitoire, qui doit cependant éviter un blocage inutileau moment du vote du peuple et des cantons sur ce projet deconstitution révisée.
Angenommen – Adopté
Art. 94aAnträge der Kommissionen: BBlPropositions des commissions: FF
Präsident: Ich gehe davon aus, dass Sie mit Artikel 94aauch Artikel 185 Ziffer 5a der Übergangsbestimmungen ge-nehmigt haben.
Angenommen – Adopté
Art. 95Anträge der Kommissionen: BBlPropositions des commissions: FF
Aeby Pierre (S, FR), rapporteur: La commission n’a pasvoulu modifier quoi que ce soit à cet article 95, si ce n’est letitre, de façon justifiée, pour introduire la notion de «politiqueagricole», qui paraît plus claire et plus conforme à l’ensem-ble de ces dispositions de politique économique d’une façongénérale. A part donc le titre, rien n’a changé. Cet article afait l’objet d’un vote récent et très clair du peuple et des can-tons suisses; il n’y a pas de remarque à formuler à son pro-pos.
Angenommen – Adopté
Art. 96Anträge der Kommissionen: BBlPropositions des commissions: FF
Aeby Pierre (S, FR), rapporteur: L’article 96, à la commissiondu Conseil des Etats, n’a pas fait l’objet de discussions parti-culières, contrairement à ce qui s’est passé au Conseil natio-nal où une décision a été prise à une faible majorité, mais oùune discussion très large a eu lieu sur les effets de la con-sommation d’alcool et sur l’engagement éventuel de la Con-fédération pour lutter contre les conséquences de l’alco-olisme. Il n’est donc pas exclu que nous ayons à revenir unjour sur l’article 96, suivant le sort qui lui aura été réservé auConseil national. Pour l’instant, il n’appelle pas de remarqueen l’état.
Angenommen – Adopté
Art. 97Anträge der Kommissionen: BBlPropositions des commissions: FF
Aeby Pierre (S, FR), rapporteur: On a beaucoup parlé del’article 97 dont le libellé correspond à celui de l’article 35 dela constitution actuelle, lequel, devenu article 97, n’est pasencore en vigueur, je le rappelle, bien qu’il ait été voté par lepeuple, le 7 mars 1993. C’est exactement ce que le peuple avoté, et c’est cet article qui nous cause de grandes difficultésdans la législation actuelle sur les maisons de jeux et les ca-sinos.La problématique vient de ce que, selon l’alinéa 1er, la légis-lation sur les jeux de hasard est de la compétence de la Con-fédération, et, selon l’alinéa 4, l’admission des appareils àsous servant aux jeux d’adresse relève, elle, de la compé-tence des cantons. C’est sur cette notion de hasard etd’adresse, cette dualité, cette contradiction contenue dansl’article 97 que nous avons et que nous aurons encore denombreuses difficultés.En commission, il a été dit que nous aurions dû avoir le cou-rage de modifier l’article 97, d’en faire éventuellement unevariante. L’idée n’a finalement pas été retenue. Pour l’instant,il ne reste qu’à l’adopter tel qu’il figure sur le dépliant, danssa version approuvée par le peuple en 1993.
Präsident: Diese Bestimmung steht in Zusammenhang miteiner Übergangsbestimmung, Artikel 185 Ziffer 5c. Darf ichSie bitten, den Kommentar zu der Übergangsbestimmungauch gleich zu geben, damit wir beide Bestimmungen ge-meinsam verabschieden können?
Aeby Pierre (S, FR), rapporteur: Oui, la disposition transitoireà laquelle vous faites allusion existe déjà aujourd’hui dans laconstitution. Elle dit que l’article 35 de la constitution n’entreen vigueur que lorsqu’il y aura une législation d’application.Cette disposition transitoire a simplement été reprise tellequelle de la constitution actuelle.
Angenommen – Adopté
Art. 98Anträge der Kommissionen: BBlPropositions des commissions: FF
4. März 1998 S 93 Bundesverfassung. Reform
Amtliches Bulletin der Bundesversammlung / Separatdruck
Aeby Pierre (S, FR), rapporteur: Le seul commentaire à ap-porter à l’article 98 sur les armes et le matériel de guerre estque, entre le projet du Conseil fédéral et les délibérations dela commission, le peuple et les cantons suisses ont admis desupprimer la régale des poudres, «Pulverregal». La commis-sion a tenu compte de cette votation et a corrigé en ce sensle projet du Conseil fédéral en biffant l’alinéa 3.
Angenommen – Adopté
Art. 99Anträge der Kommissionen: BBlPropositions des commissions: FF
Aeby Pierre (S, FR), rapporteur: Tout d’abord, d’une façongénérale, quelques mots sur la section 7 qui regroupe lescompétences fédérales dans tout le domaine de la sécuritésociale.La consultation a permis à différents milieux de faire part deleurs voeux d’une modernisation de nos garanties en matièrede sécurité sociale, et notamment de la mise en place d’uneréglementation qui fasse abstraction de l’état civil, de ma-nière à ce que notre système de sécurité sociale soit fondésur l’individu et moins sur son état civil ou sa situation fami-liale. Evidemment, bien que méritant à mes yeux d’être sou-tenues, ces propositions constituent des réformes et ellesn’ont pas pu être prises en compte dans un exercice de sim-ple mise à jour et de réalité constitutionnelle vécue.En ce qui concerne l’article 99, «Encouragement de la cons-truction de logements et de l’accession à la propriété», il cor-respond tout à fait à l’article 34sexies de la constitution ac-tuelle. A l’alinéa 1er, il précise que la Confédération peut en-courager la construction et l’acquisition de logements. Al’alinéa 2, il parle de l’encouragement particulier à l’équipe-ment de terrains. Selon l’alinéa 2bis, la Confédération peutédicter des dispositions sur l’équipement de ces terrains pourla construction de logements et sur la rationalisation de laconstruction.Pour le reste, la commission a simplement changé l’ordredes mots – les intérêts de la famille, des indigents, des han-dicapés et des personnes âgées – considérant qu’il était peuheureux de suggérer que les personnes âgées sont peut-être une catégorie de handicapés. C’était en tout cas lescraintes de la commission et c’est pourquoi les personnesâgées ont été placées immédiatement après les familles, àl’alinéa 3.Je n’ai pas d’autres remarques à formuler sur l’article 99 quifait l’unanimité de la commission.
Koller Arnold, Bundesrat: Ich spreche nur ganz kurz. Ichkann dem neuen Absatz 2bis ausdrücklich zustimmen. Eswird hier klarer zwischen der Kompetenz zur Rechtsetzungund den weiteren Förderungsmassnahmen unterschieden.Die ganze Bestimmung wird somit klarer.
Angenommen – Adopté
Art. 100Anträge der Kommissionen: BBlPropositions des commissions: FF
Aeby Pierre (S, FR), rapporteur: L’article 100 n’appelle qu’uncommentaire pour le texte allemand, où, à l’alinéa 2, la for-mulation a été simplifiée. Vous le constatez sur le dépliant. Letexte français, lui, n’a pas du tout été modifié.Cet article sur la protection des locataires correspond auxdispositions actuelles de la constitution.
Angenommen – Adopté
Art. 101Anträge der Kommissionen: BBlPropositions des commissions: FF
Antrag LeumannAbs. 1....abis. das Mindestalter für die Zulassung zur Arbeit, nament-lich ein Kinderarbeitsverbot;....
Proposition LeumannAl. 1....abis. sur l’âge minimal pour l’autorisation au travail, notam-ment une interdiction pour le travail des enfants;....
Aeby Pierre (S, FR), rapporteur: L’article 101 sur le travail n’afait l’objet, de la part de la commission, que d’une correctionrédactionnelle à l’alinéa 3 qui ne concerne que le texte alle-mand.La commission a beaucoup débattu de la question de l’inter-diction du travail des enfants, à placer dans l’article 101. Elleest finalement arrivée à la conclusion que c’était une évi-dence dans notre ordre juridique et que ça pouvait, suivant larédaction d’une telle interdiction, donner lieu à certaines diffi-cultés, notamment sur la manière d’interpréter l’interdictiondu travail des enfants dans l’agriculture, pour des travaux vi-ticoles, l’engagement pendant les vacances dans les zonesagricoles, etc. Donc, l’interdiction pure et simple aurait dûêtre précisée de manière telle que l’on alourdit l’article 101.La Suisse ayant ratifié la Convention internationale sur lesdroits de l’enfant, il ne nous est pas paru utile, pour des rai-sons de systématique, d’introduire ici textuellement cette in-terdiction, certains membres de la commission considérantmême que pour un Etat tel que le nôtre, une telle mentionavait quelque chose de désuet et ne correspondait pas dutout aux mentalités, d’autant plus qu’elle ne recouvrait aucunrisque actuel en matière de travail des enfants.C’est la raison pour laquelle la commission a acceptél’article 101 dans la version du Conseil fédéral.
Leumann Helen (R, LU): Wenn wir Bilder sehen – aus derDritten Welt meistens –, auf denen kleine Kinder mit kleinenFingern Teppiche knüpfen, weil ihre kleinen Finger so feineKnoten machen können, oder wenn wir von anderen solchenBeispielen hören, dann fühlen wir uns wohl, weil wir wissen,dass bei uns so etwas nicht passiert. Für uns ist ein Verbotder Kinderarbeit selbstverständlich. Es ist richtig, dass dasVerbot der Kinderarbeit ein Teil der geltenden schweizeri-schen Rechtsordnung ist und dass wir auch gemäss interna-tionalem Recht verbindliche Richtlinien haben. Es ist auchrichtig, wie die Kommission dies sagt, dass aus diesen Über-legungen die Einfügung einer Bestimmung zum Verbot derKinderarbeit nicht notwendig wäre.Wenn ich die Bundesverfassung durchsehe und andereSelbstverständlichkeiten darin festgeschrieben finde – wiezum Beispiel in Artikel 12 ein Recht auf Ehe oder in Artikel 15die Sprachenfreiheit –, dann, meine ich, steht es auch unse-rer Bundesverfassung sehr gut an, wenn darin ein Verbot derKinderarbeit besser sichtbar gemacht und ausdrücklich er-wähnt wird. Dazu kommt, dass die Mehrheit der Kommissiondes Nationalrates das Verbot der Kinderarbeit als Antrag imRat einbringen wird.Ich meine, wir sollten das gleiche tun und dem Nationalratnicht nachstehen.
Koller Arnold, Bundesrat: Es handelt sich hier bei Artikel 101um die Nachführung der Artikel 34ter und 116bis der Bundes-verfassung. Es geht also um zentrale Elemente unserer Ar-beitsverfassung.Absatz 1 gibt dem Bund Rechtsetzungskompetenzen im Ar-beitsrecht: Schutz der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer,Verhältnis zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite, All-gemeinverbindlicherklärung von Gesamtarbeitsverträgen.Absatz 2 enthält die Bedingungen für die Allgemeinverbind-licherklärung der Gesamtarbeitsverträge, und Absatz 3 regeltden Bundesfeiertag.
Constitution fédérale. Réforme 94 E 4 mars 1998
Bulletin officiel de l’Assemblée fédérale / Tiré à part
Es scheint mir wichtig, hier klarzumachen, dass der Text desEntwurfes bezüglich der Mitbestimmungsfrage die im heutegeltenden Text zu findende Unbestimmtheit über die Trag-weite – ob nur eine betriebliche oder auch eine Mitbestim-mung auf Unternehmensebene zugelassen werden soll – be-wusst ebenfalls offenlässt. Insofern halten wir uns streng andas Konzept der Nachführung.Was die Frage eines Kinderarbeitsverbotes anbelangt, be-steht ja Einigkeit darüber, dass das Kinderarbeitsverbot Be-standteil der geltenden schweizerischen Rechtsordnung ist.Es findet sich sowohl in dem für die Schweiz verbindlichen in-ternationalen Recht als auch in unserem internen, nationalenRecht. Bezüglich des internationalen Rechtes sei auf dasÜbereinkommen über die Rechte des Kindes hingewiesen,welches für die Schweiz seit dem 26. März 1997 in Kraft ist.Artikel 32 verlangt die Festlegung eines Mindestalters odermehrerer differenzierter Mindestalter für die Zulassung zurArbeit. Dasselbe verlangt Artikel 10 Ziffer 3 des Paktes I derinternationalen Menschenrechtspakte, der Pakt über wirt-schaftliche, soziale und kulturelle Rechte, welchen dieSchweiz ebenfalls unterzeichnet hat. Das zum für uns ver-bindlichen Völkerrecht.Unsere eigene, interne Gesetzgebung enthält ebenfalls dieerforderlichen Regelungen, einerseits im Arbeitsgesetz, aberauch im Heimarbeitsgesetz, wo wir differenzierte, adäquateRegelungen haben. Insofern besteht sicher keine Notwen-digkeit, das Kinderarbeitsverbot nun auf Verfassungsstufezu heben. Wenn Sie das, wie Frau Leumann es beantragt,tun, ist dies eine bewusste Heraufstufung eines Prinzipes,das heute auf der Stufe der einfachen Gesetzgebung schongilt.Wir haben das andernorts, beispielsweise beim Datenschutz,gemacht. Der Datenschutz ist heute nur im Datenschutzge-setz geregelt. Wir haben aber gefunden, der Datenschutzhabe heute und in Zukunft eine derartige Bedeutung, dasswir ihn bewusst zum Verfassungsprinzip heraufgestuft ha-ben. Andererseits haben wir ja viele Bestimmungen im Alko-holbereich – denken Sie an das Absinthverbot und all dieseBestimmungen – auf die Stufe von Gesetzgebung und Ver-ordnung herabgestuft. Solche Heraufstufungen und Herab-stufungen im Rahmen der Nachführung sind nun natürlichweitestgehend Fragen der politischen Opportunität. Wir wa-ren der Meinung, dass es eigentlich nicht opportun ist, hiereine Heraufstufung vorzunehmen, weil sonst der Eindruckentstehen könnte, wir hätten – wie gewisse Entwicklungslän-der – heute noch Probleme mit Kinderarbeit. Das ist aber ein-deutig nicht der Fall. Deshalb würden wir es vorziehen, dasnicht zu tun; aber es ist letztlich eine Opportunitätsfrage.
Abs. 1 – Al. 1
Abstimmung – VoteFür den Antrag der Kommission 17 StimmenFür den Antrag Leumann 3 Stimmen
Abs. 2, 3 – Al. 2, 3Angenommen – Adopté
Art. 102Anträge der Kommissionen: BBlPropositions des commissions: FF
Aeby Pierre (S, FR), rapporteur: L’article 102, qui concernenotre régime de prévoyance vieillesse, survivants et invali-dité, n’appelle aucune remarque. C’est la base constitution-nelle d’une législation qui nous préoccupe presque en per-manence. Heureusement, tout le monde est d’accord sur cetarticle 102, au plan constitutionnel.
Angenommen – Adopté
Art. 103Anträge der Kommissionen: BBlPropositions des commissions: FF
Aeby Pierre (S, FR), rapporteur: L’article 103 sur l’assu-rance-vieillesse, survivants et invalidité a simplement faitl’objet d’une clarification de la part de la commission, on peut,je crois, le présenter ainsi.D’une part, à l’alinéa 1er lettre b, la commission a modifiél’ordre d’énumération à propos des rentes: premièrement,«elles sont adaptées au moins à l’évolution des prix», etdeuxièmement, «la rente maximale n’est pas supérieure audouble de la rente minimale». La lettre c a été biffée. Làaussi, par souci de clarification, elle a été remplacée par unalinéa 1bis qui, aux lettres a et b, montre clairement et sansconfusion possible les deux sources de financement de l’as-surance: par les cotisations des assurés, avec l’obligationpour l’employeur d’en prendre à sa charge la moitié aumoins; par la Confédération, et par les cantons pour autantque la loi le prévoie.Pour l’article 103, ce sont les seuls commentaires que jepeux faire. Il n’est pas du tout combattu en commission et faitl’objet de l’unanimité des membres.
Koller Arnold, Bundesrat: Die Änderungen, die Ihre Kommis-sion am Entwurf des Bundesrates vorgenommen hat, sindrein redaktionell und systematisch, indem die in Absatz 1Buchstabe c enthaltenen Grundsätze über die Finanzierungvon AHV und IV in einem eigenen Absatz zusammengefasstwurden. Eine gleiche Umstrukturierung wird auch in denArtikeln 104 und 105 vorgenommen.Diese Neustrukturierung der Artikel überzeugt, und ich kanndaher zustimmen. Im übrigen hat auch bereits die national-rätliche Verfassungskommission diesen redaktionellen Än-derungen zugestimmt.
Aeby Pierre (S, FR), rapporteur: Je voulais juste signaler unemodification purement rédactionnelle dans le texte français,où le mot «invalides» a été remplacé par «personnes handi-capées».
Angenommen – Adopté
Art. 104Anträge der Kommissionen: BBlPropositions des commissions: FF
Aeby Pierre (S, FR), rapporteur: L’article 104 sur la pré-voyance professionnelle n’a pas fait l’objet de discussion par-ticulière en commission. Il appelle les mêmes remarques ré-dactionnelles à la lettre e. Par souci de cohérence, la lettre ea été remplacée par l’alinéa 1bis, lequel reprend les mêmesprincipes qu’on retrouve à l’alinéa 1bis lettre a du précédentarticle 103: «la prévoyance professionnelle est financée parles cotisations des assurés; l’employeur prend à sa chargeau moins la moitié du montant de la cotisation de ses assu-rés.» A l’alinéa 2, on a la suite de cette disposition.
Angenommen – Adopté
Art. 105Anträge der Kommissionen: BBlPropositions des commissions: FF
Aeby Pierre (S, FR), rapporteur: L’article 105 sur l’assu-rance-chômage n’a pas, lui non plus, fait l’objet de discussionparticulière. On note d’abord dans le texte français, à lalettre a, la correction rédactionnelle où l’on parle de «com-pensation appropriée» plutôt que de «juste compensation»;la lettre c est biffée au profit de l’alinéa 1bis. C’est égalementici une cohérence rédactionnelle avec les précédentsarticles 103 et 104. Il n’y a donc pas ici de remarque particu-lière.
Angenommen – Adopté
Art. 106Anträge der Kommissionen: BBlPropositions des commissions: FF
4. März 1998 S 95 Bundesverfassung. Reform
Amtliches Bulletin der Bundesversammlung / Separatdruck
Aeby Pierre (S, FR), rapporteur: L’article 106 doit être abso-lument compris dans le sens d’une répartition de compé-tence entre la Confédération et les cantons. Il ne s’agit nulle-ment de faire la confusion avec ce qui est dit, tant àl’article 10 dans les droits fondamentaux à propos du mini-mum d’existence garanti, qu’à l’article 33 dans les buts so-ciaux. Ici, c’est une question de compétence qui est réglée,et rien d’autre. Cet article n’a pas fait l’objet de discussion ausein de la commission.
Angenommen – Adopté
Art. 107Anträge der Kommissionen: BBlPropositions des commissions: FF
Aeby Pierre (S, FR), rapporteur: L’article 107 reprend le fa-meux article 34quinquies de la constitution actuelle, cet arti-cle qui, après 50 ans, n’a toujours pas fait l’objet d’une maté-rialisation au plan de notre législation. Il n’a pas fait l’objet dediscussion au sein de la commission.
Angenommen – Adopté
Art. 108Anträge der Kommissionen: BBlPropositions des commissions: FF
Angenommen – Adopté
Art. 109Anträge der Kommissionen: BBlPropositions des commissions: FF
Aeby Pierre (S, FR), rapporteur: L’article 109 a fait l’objet dediscussion en raison de la proximité des termes «la santé del’homme et des animaux» à son alinéa 1er. Cette proximitédes hommes et des animaux a gêné les membres de la com-mission, si bien que nous avons modifié l’alinéa 1er en neparlant ni de l’homme ni des animaux, considérant que c’étaitune adjonction dont on pouvait se passer, si bien quel’alinéa 1er aujourd’hui a la teneur suivante: «Dans les limitesde ses compétences, la Confédération prend des mesuresafin de protéger la santé.» Et on retrouve les hommes et lesanimaux à la lettre b, lorsqu’il s’agit de «la lutte contre les ma-ladies transmissibles, les maladies très répandues et les ma-ladies particulièrement dangereuses de l’homme et des ani-maux», où cette proximité de l’être humain et du règne ani-mal passe mieux. Donc, le sens de l’article 109 n’est absolu-ment pas changé.
Angenommen – Adopté
Art. 110, 111, 111aAnträge der Kommissionen: BBlPropositions des commissions: FF
Aeby Pierre (S, FR), rapporteur: C’est vrai que la commis-sion s’est très longuement entretenue de ces articles, nonpas que nous mettions en cause un des principes de ces ar-ticles extrêmement sensibles, de ces articles qui sont assezrécents dans notre constitution, mais nous souhaitions ame-ner des distinctions très claires. Nous souhaitions que laconstitution soit effectivement lisible, nous souhaitions biendistinguer ce qui est la procréation médicalement assistée,qui n’a rien à voir avec le génie génétique; nous souhaitionsaussi bien distinguer le génie génétique dans le domaine hu-main et dans le domaine non humain. C’est pour ça que vousavez quelques adaptations de ces dispositions, d’abord lasubdivision «Génie génétique dans le domaine non humain»du projet du Conseil fédéral (art. 110), et «Procréation médi-calement assistée et génie génétique dans le domaine hu-main» (art. 111). Ici aussi, on a souhaité bien distinguer le rè-gne animal du règne des êtres humains. Pour le reste, lacommission comme le Conseil fédéral ne se seraient pas
permis de toucher aux principes fondamentaux qui règlentces deux articles très sensibles.
Koller Arnold, Bundesrat: Zunächst bin ich Ihnen dankbar,dass Sie an diesem heutigen Artikel 24novies, der in einerdenkwürdigen Abstimmung im Mai 1992 als Gegenentwurfzur «Beobachter»-Initiative angenommen worden ist, mög-lichst nichts ändern.Sie wissen, dass in diesem Bereich politisch nach wie vor vie-les in Bewegung ist; es ist noch nichts zur Ruhe gekommen,im Gegenteil: Es sind neue Initiativen eingereicht worden, ei-nerseits die Gen-Schutz-Initiative, über die wir im Juni ab-stimmen, anderseits die Initiative «für menschenwürdigeFortpflanzung (FMF)»; hier befindet sich das Fortpflanzungs-medizingesetz als indirekter Gegenvorschlag zur Beratung inden Räten. Ob eine Aufteilung wirklich der Weisheit letzterSchluss ist, ist eine Frage, die ich noch offenlassen möchte;seinerzeit hat man sich aufgrund einer Rücksprache mit No-belpreisträger Arber in Basel für einen ganzheitlichen Artikelentschieden. Herr Arber hat gewisse Beziehungen aufge-zeigt, auch wenn sie vielleicht eher etwas entfernt sind. Dar-über werden wir dann auch im Nationalrat nochmals spre-chen.Dagegen bin ich froh, dass Sie ein ausdrückliches Klonverbotaufgenommen haben: Man kann zwar mit gutem Grund sa-gen, ein Klonverbot ergebe sich bereits aus dem geltendenArtikel, nämlich aus der Bestimmung, die alle Eingriffe in dasErbgut als unzulässig erklärt; seit das Schaf Dolly Weltbe-rühmtheit erlangt hat, hat sich aber offenbar gezeigt, dassgewisse Grenzfälle doch nicht klar geregelt wären. Mit die-sem klaren Klonverbot machen wir jedermann klar, dass dasKlonen unzulässig ist, dass es, auch wenn es – wie etwabeim Embryosplitting – nicht mit einem Eingriff in menschli-che Keimzellen verbunden ist, trotzdem ganz klar von Ver-fassung wegen verboten ist. Insofern bringt diese Ergänzungeine erwünschte Klärung, die auch mit der Bioethik-Konven-tion des Europarates in Übereinstimmung steht.Zuhanden der Redaktionskommission möchte ich noch einterminologisches Problem aufwerfen: Wir sprechen inAbsatz 2 Litera c von «Verfahren der Fortpflanzungshilfe».Unterdessen hat sich eine andere Terminologie durchge-setzt; man spricht heute eher von einer «medizinisch unter-stützten Fortpflanzung». Das ist eine Frage, die der Redakti-onskommission überlassen werden kann. Wir hätten dannauch eine Harmonisierung mit dem Fortpflanzungsmedizin-gesetz.
Angenommen – Adopté
Art. 112Anträge der Kommissionen: BBlPropositions des commissions: FF
Rhinow René (R, BL), Berichterstatter: Herr Frick als zustän-diger Berichterstatter ist noch nicht unter uns; ich springe indie Lücke und kann ganz kurz erwähnen, dass die Kommis-sion mit Artikel 112 grundsätzlich die geltende Rechtslageübernimmt. Absatz 1 beinhaltet die Bundeskompetenz be-züglich Ausländerrecht und Asylrecht; Absatz 2 gibt demBund die Möglichkeit der Ausweisung, falls die Sicherheit desLandes gefährdet ist. Die Änderung, welche die Kommissionangebracht hat, betrifft nicht die Sache selbst, sondern dieOrganzuständigkeit. Während der bundesrätliche Entwurfausdrücklich den Bundesrat als das zuständige Organ in derVerfassung festhält, lässt die Kommission die Frage des Or-gans offen und sagt nur, dass ausgewiesen werden kann,wenn die Sicherheit des Landes gefährdet wird. Damit ist esmöglich, auf Gesetzesebene auch ein anderes Organ als dieoberste Landesregierung für zuständig zu erklären.
Angenommen – Adopté
Art. 113Anträge der Kommissionen: BBlPropositions des commissions: FF
Constitution fédérale. Réforme 96 E 4 mars 1998
Bulletin officiel de l’Assemblée fédérale / Tiré à part
Wicki Franz (C, LU), Berichterstatter: Der 9. Abschnitt um-fasst die Bestimmungen über Zivilrecht, Strafrecht, Opferhilfeund Messwesen. Die Systematik in diesem Abschnitt scheintetwas gekünstelt. Man hat den Eindruck, die relativ neue Op-ferhilfebestimmung sowie das Messwesen hätten irgendwoin der Verfassung untergebracht werden müssen. In der Bot-schaft wird dann zur Rechtfertigung angeführt, das Zusam-menleben der Menschen werde im Alltag in rechtlicher Hin-sicht wesentlich vom Privat- und vom Strafrecht geprägt. Fürdie Bürgerinnen und Bürger als Wirtschatfssubjekte spielezudem das Messwesen eine unabdingbare Voraussetzungfür einen reibungslosen Ablauf zahlreicher Tätigkeiten; esmache deshalb Sinn, diese drei Bereiche in einem gemeinsa-men Abschnitt zu regeln.Was die Opferhilfe anbetrifft, kann gesagt werden, dass siemit strafrechtlichen Taten zusammenhängt; daher ist es ge-rechtfertigt, die Ansprüche des Opfers solcher Taten in dieNähe des Strafrechtes zu bringen.Zu Artikel 113, «Zivilrecht»: Dieser Artikel führt die Bestim-mungen von Artikel 64, Artikel 53 Absatz 1 und Artikel 61 dergeltenden Verfassung nach. In der Vernehmlassung führtedieser Artikel nicht zu grossen Kontroversen. Betonenmöchte ich, dass bei dieser Nachführung die Frage, ob dasZivilprozessrecht von Bundesrechtes wegen vereinheitlichtwerden solle, bewusst ausgeklammert wird. Diese Frage istBestandteil des Reformpaketes C, der Justizreform. Wir wer-den also im Laufe der Session, d. h. konkret morgen, aufdiese Frage eingehen.Zu Absatz 1: Hier erklärt sich der Bund zuständig für den Er-lass von Zivilrecht. Was heisst nun der Begriff «Zivilrecht»?Das Zivilrecht, auch Privatrecht genannt, regelt im wesentli-chen die Rechtsbeziehungen unter Bürgerinnen und Bür-gern. Eine genaue Zivilrechtsdefinition ist jedoch nicht mög-lich. Dies hat sich bisher auch in der Anwendung vonArtikel 64 der heutigen Bundesverfassung gezeigt. Die Wis-senschaft und die Gerichtspraxis entwickelten verschiedeneTheorien. Der Bundesrat seinerseits hat eine etwas eigeneLehre entwickelt, nämlich die sogenannte typologische Ab-grenzung. Rechtsnormen werden demnach dann als zivil-rechtlich angesehen, wenn sie typisch privatrechtliche Zieleverfolgen und herkömmlicherweise zum Privatrechtsbereichgehören.Wichtig ist, dass sich aus Artikel 113 Absatz 1 die Kompe-tenzabgrenzung zwischen Bund und Kantonen ergibt.Kommt der Bundesgesetzgeber zum Schluss, etwas sei Pri-vatrecht, ist er zuständig. Ist etwas nicht Privatrecht, gilt dieZuständigkeit der Kantone. Ob man etwas als Zivilrecht de-klariert oder nicht, hat also Einfluss auf die Zuständigkeits-ordnung und auf den Rechtsweg.Zu Absatz 2: Dieser übernimmt Artikel 64 Absatz 3 der heuti-gen Verfassung. Sache der Kantone sind das Gerichtsver-fahren, die Gerichtsorganisation und die Rechtsprechung. Esist aber ein anerkannter Grundsatz, dass das kantonale Pro-zessrecht die Anwendung des Bundesprivatrechtes nicht be-einträchtigen oder verhindern darf. Wichtig ist es auch zu be-achten, dass trotz der hier statuierten kantonalen Zuständig-keit das Bundesgericht letzte Instanz ist und bleibt. Dies er-gibt sich nämlich aus den Bestimmungen von Artikel 176ff.über das Bundesgericht. Wir dürfen also Artikel 113 nicht un-abhängig von den Bestimmungen betrachten, welche im Or-ganisationsteil der Bundesverfassung enthalten sind. Artikel113 ist zusammen mit Artikel 178 auszulegen.Zu Absatz 3: Dieser bestimmt, dass rechtskräftige Zivilurteilein der ganzen Schweiz ohne weiteres vollstreckbar sind. Vor-aussetzung für solche Zivilurteile ist jedoch, dass sie vonbeschlussfähigen und zuständigen Gerichten erlassen wur-den.Ein Hinweis ist auch auf das Schuld-, Betreibungs- und Kon-kursrecht zu machen. Funktionell gesehen gehört dieserRechtsbereich eigentlich zum öffentlichen Recht. Aber nachunserer Rechtstradition ist die Zugehörigkeit zum Privatrechtals selbstverständlich angesehen worden. Das Bundesamtfür Justiz erklärte in der Kommission, man könne deshalbdarauf verzichten, dies ausdrücklich in der Verfassung zu er-wähnen.
Angenommen – Adopté
Art. 114Anträge der Kommissionen: BBlPropositions des commissions: FF
Wicki Franz (C, LU), Berichterstatter: Ich möchte als erstesbemerken: Die Frage, ob das Strafprozessrecht vereinheit-licht werden solle, wird an dieser Stelle bewusst ausgeklam-mert. Sie wird im Rahmen der Justizreform behandelt wer-den.Wie heute in Artikel 64bis der Bundesverfassung wird demBund neu in Artikel 114 Absatz 1 die Kompetenz eingeräumt,das materielle Strafrecht zu regeln. Der Bund hat von dieserKompetenz namentlich auch durch den Erlass des Strafge-setzbuches (StGB) Gebrauch gemacht. Die Kantone könnenlediglich Übertretungstatbestände regeln, wenn – wie es inder Botschaft heisst – «das eidgenössische Recht den An-griff auf ein Rechtsgut nicht durch ein geschlossenes Systemvon Normen regelt». Hingegen sind die Verfolgung und dieBeurteilung gemeiner Straftaten nach wie vor Sache derKantone. Damit ist die Kompetenz verbunden, die entspre-chenden prozess- und organisationsrechtlichen Bestimmun-gen zu erlassen. Auch der Strafvollzug ist und bleibt im Rah-men der sehr allgemeinen Bestimmungen des StGB Sacheder Kantone.In Absatz 2 haben wir eine Subventionsnorm verpackt. DerBund hat die Möglichkeit, finanzielle Unterstützung für die Er-richtung von Vollzugsanstalten, für Verbesserungen im Straf-vollzug sowie für Erziehungsmassnahmen zu gewähren.Dies entspricht der heutigen Bundesverfassung.Absatz 3 ist eine Wiederaufnahme von Artikel 64bis Absatz 2der Bundesverfassung. Die Kantone behalten ihre Zustän-digkeit in den Bereichen Gerichtsorganisation, Gerichtsver-fahren und Rechtsprechung. Wie erwähnt, wird die Frage, obdas Strafprozessrecht vereinheitlicht werden solle, im Rah-men der Justizreform zur Diskussion stehen.
Angenommen – Adopté
Art. 115Anträge der Kommissionen: BBlPropositions des commissions: FF
Wicki Franz (C, LU), Berichterstatter: Bei Artikel 115 geht esum die Opferhilfe. Diese Bestimmung entspricht Artikel 64terder geltenden Bundesverfassung, der aufgrund einer Volks-initiative eingeführt; das entsprechende Bundesgesetz istseit dem 1. Januar 1993 in Kraft. In der heute geltenden Fas-sung wird von Straftaten gegen Leib und Leben gesprochen.Neu heisst es nun: «Bund und Kantone sorgen dafür, dassPersonen, die durch eine Straftat in ihrer körperlichen, psy-chischen oder sexuellen Integrität beeinträchtigt wordensind, Hilfe erhalten ....» In der Kommission nahmen wir zurKenntnis, dass es sich hier um eine Präzisierung handelt,welche bereits im Bundesgesetz über die Opferhilfe vorge-nommen worden ist, und dass dies der Praxis des Bundes-gerichtes entspricht.
Angenommen – Adopté
Art. 116Anträge der Kommissionen: BBlPropositions des commissions: FF
Wicki Franz (C, LU), Berichterstatter: Die Bestimmung ent-spricht Artikel 40 der heutigen Bundesverfassung. Sie er-laubt dem Bund, das Mass- und Gewichtssystem im Inter-esse eines sicheren Verkehrs mit messbaren Sachen zu ver-einheitlichen. Das gab zu keiner Diskussion Anlass, sinddoch die Masse seit längerer Zeit durch internationale Über-einkommen festgelegt. Zudem ist festzuhalten, dass die Be-stimmung alle Masse erfasst, also neben Länge, Fläche, In-halt und Gewicht auch Zeit, Elektrizität, Wärme, Schall,
4. März 1998 S 97 Bundesverfassung. Reform
Amtliches Bulletin der Bundesversammlung / Separatdruck
Strahlung und allenfalls weitere, die heute noch gar nicht be-stehen.Zu erwähnen ist noch, dass der Vollzug der Bundesgesetz-gebung den Kantonen vorbehalten ist, ohne dass es hier ei-gens gesagt wird. Zu denken ist insbesondere an die Ei-chung und an die verschiedenen Kontrollmöglichkeiten.
Angenommen – Adopté
Art. 117Anträge der Kommissionen: BBlPropositions des commissions: FF
Aeby Pierre (S, FR), rapporteur: Le chapitre 3 («Régime desfinances») va de l’article 117 à l’article 126; il marque la fin denos délibérations en tant que Conseil prioritaire sur cette par-tie du projet de mise à jour de la Constitution fédérale.Il y a pour ainsi dire fort peu de changements qui ont été ap-portés au régime général des finances de la Confédération.Ce régime général, vous le savez, est assorti de toute unesérie de dispositions transitoires. Presque chaque article dece chapitre est assorti d’une disposition transitoire, et sou-vent cette disposition transitoire impose une limite dans letemps. Ce délai transitoire a fait l’objet d’une discussion ap-profondie en commission.Plusieurs d’entre nous ont regretté qu’un Etat moderne, ou quise veut moderne, comme la Suisse ne puisse se doter d’unrégime des finances et d’un régime fiscal qui ne soient queprovisoires. Les impôts les plus importants de la Confédéra-tion, notamment la TVA et l’impôt fédéral direct, sont encoreet toujours limités dans le temps. On peut légitimement se po-ser la question de savoir si, le moment venu, la suppressionde ces limites temporelles pour les principaux impôts de laConfédération ne devrait pas constituer une des variantes quiseraient soumises au peuple et aux cantons. On peut consi-dérer comme tout à fait inadmissible aujourd’hui que notre Etatn’ait pas la pérennité de ses ressources fiscales qui soit ga-rantie par notre constitution. Là, nous dépassons très lar-gement l’objectif d’une mise à jour. C’est la raison pour la-quelle il n’y a aucun changement concernant le régime desfinances.Votre commission a pourtant bien approfondi ce thème. Ellea pris la peine – il y a eu très peu d’auditions au cours de nostravaux – d’auditionner M. Gygi qui est le chef de projet de lanouvelle péréquation financière, ainsi que M. Pfisterer, mem-bre du Conseil d’Etat du canton d’Argovie, concernant l’avisdes cantons sur ce projet de réforme de la répartition des tâ-ches et des charges entre les cantons dit «paquet de nou-velle péréquation». Il est apparu clairement que les études etles travaux en la matière ne sont pas suffisamment avancéspour les intégrer à la réforme de la constitution. C’est la rai-son pour laquelle nous avons fait abstraction de ce qui seprépare du côté de la nouvelle péréquation financière inter-cantonale.Cela étant, je peux commenter l’article 117 «Gestion des fi-nances». A l’alinéa 1er, obligation est faite à la Confédérationd’équilibrer à long terme ses comptes. Cette obligation n’estabsolument pas contestée. A l’alinéa 2, il est prévu que la po-litique d’amortissement du bilan prend en considération la si-tuation économique. L’article 117 est à la fois un article rigidedans les principes (al. 1er) et souple dans l’application (al. 2)pour tenir compte de la situation économique.A l’unanimité, la commission propose d’adopter l’article 117selon le projet du Conseil fédéral.
Angenommen – Adopté
Art. 118Anträge der Kommissionen: BBlPropositions des commissions: FF
Aeby Pierre (S, FR), rapporteur: L’article 118 pose les «Prin-cipes régissant l’imposition». La discussion a surtout portésur la question de savoir s’il fallait intégrer les cantons àl’alinéa 1er, en ce sens que la qualité de contribuable, l’objet
de l’impôt, son mode de calcul, doivent être définis par uneloi. C’est le principe de la base légale de toute fiscalité.Finalement, la commission a renoncé à mentionner les can-tons à l’alinéa 1er, considérant qu’ici, on aurait créé plus unproblème qu’autre chose, parce qu’il aurait fallu alors ajouterles communes. Nous n’avons pas voulu parler ici de la Con-fédération, des cantons et des communes, nous limitant àadresser cette adjonction à la Confédération, chaque cantondevant par ailleurs, en respectant les principes généraux dela bonne foi et de la légalité, mettre sur pied son propre ordrejuridique en matière fiscale. Je pense que ç’a été une sagedécision de la commission. La décision n’a d’ailleurs pas dutout été combattue.L’alinéa 2 reprend le principe de l’interdiction de la double im-position par les cantons et impose à la Confédération le de-voir de veiller à ce que cette double imposition n’existe pas.
Angenommen – Adopté
Art. 119Anträge der Kommissionen: BBlPropositions des commissions: FF
Aeby Pierre (S, FR), rapporteur: Il n’y a pas de remarque par-ticulière à propos de l’article 119, si ce n’est une améliorationrédactionnelle à l’alinéa 4, mais uniquement encore dans letexte français où l’on parle de «taxation et de perception»,plutôt que de dire que «l’impôt est fixé et levé ....». On aadapté le vocabulaire à celui qui a cours aujourd’hui en ma-tière fiscale.
Angenommen – Adopté
Art. 120Anträge der Kommissionen: BBlPropositions des commissions: FF
Aeby Pierre (S, FR), rapporteur: L’article 120 sur l’harmoni-sation fiscale reprend les articles 42quater et 42quinquies dela constitution actuelle. Cet article a été adopté sans opposi-tion et sans discussion par la commission.
Angenommen – Adopté
Art. 121Anträge der Kommissionen: BBlPropositions des commissions: FF
Aeby Pierre (S, FR), rapporteur: Article 121, «Taxe sur la va-leur ajoutée», «Mehrwertsteuer». Je fais abstraction des con-sidérations que j’ai émises en guise d’introduction sur la limi-tation dans le temps de la compétence fédérale de percevoirla TVA. Je fais simplement remarquer qu’à l’alinéa 3, nousavons remplacé l’arrêté de portée générale par la loi fédéralequi, en l’espèce, paraît mieux correspondre à ce type de lé-gislation, étant entendu qu’on doit en principe procéder parloi et non pas par arrêté en cette matière.
Angenommen – Adopté
Art. 121aAnträge der Kommissionen: BBlPropositions des commissions: FF
Aeby Pierre (S, FR), rapporteur: Effectivement, la commis-sion a biffé l’article 123 pour le reprendre intégralement àl’article 121a, considérant que l’article 121 traite de la TVA,impôt général de consommation, et qu’il était juste et logique,à la suite de l’imposition générale de la consommation,d’énumérer les formes d’impositions spéciales de la consom-mation, impositions spéciales que sont l’impôt sur le tabacbrut et sur le tabac manufacturé, les boissons distillées, labière, les automobiles, le pétrole et autres huiles minérales,la surtaxe sur les carburants, etc. Tous ces impôts sont desimpôts à la consommation spéciaux et leur place est effecti-
Constitution fédérale. Réforme 98 E 4 mars 1998
Bulletin officiel de l’Assemblée fédérale / Tiré à part
vement immédiatement après l’impôt de consommation engénéral qu’est la TVA.Pour le reste, cet article n’a pas fait l’objet de discussion par-ticulière en commission.
Angenommen – Adopté
Art. 122Anträge der Kommissionen: BBlPropositions des commissions: FF
Aeby Pierre (S, FR), rapporteur: L’article 122, à l’alinéa 1er,donne la compétence à la Confédération de percevoir desdroits de timbre sur les papiers-valeurs, les quittances desprimes d’assurance et les titres et, également, exonère dudroit de timbre les titres concernant les opérations immobiliè-res et hypothécaires.Quant à l’alinéa 2, c’est le principe de notre impôt anticipé surle revenu des capitaux mobiliers, l’imposition des gains surles loteries et des prestations d’assurance.Ces deux alinéas n’ont pas fait l’objet de discussion et lacommission s’est ralliée, à l’unanimité, au projet du Conseilfédéral.En revanche, la commission a biffé l’alinéa 3. Celui-ci a étéjugé désuet, en ce sens qu’il permet à la Confédération depercevoir un impôt spécial à la charge de personnes domici-liées à l’étranger, un impôt qui est une espèce de vengeanceou de rétorsion par rapport à des mesures fiscales qui se-raient prises par des Etats étrangers, sous-entendu contredes Suisses. Cet impôt de rétorsion d’ailleurs, nous a-t-on dit,n’a jamais fait l’objet d’une mise en application depuis qu’ilexiste et la Confédération n’a jamais utilisé cet outil.Compte tenu du fait que l’ensemble de ces questions fiscalesest aujourd’hui réglé dans le cadre de traités internationaux,multilatéraux ou bilatéraux, nous avons considéré que cen’était pas porter atteinte à la notion de mise à jour que desupprimer un alinéa qui n’a jamais été utilisé.
Koller Arnold, Bundesrat: Ihre Kommission beantragt, die imgeltenden Artikel 41bis Absatz 1 Litera d vorgesehene Retor-sionssteuer zu streichen. Sie ist in der Tat nie angewendetworden. Der Bundesrat opponiert dieser Streichung nicht,weil wir im künftigen Artikel 172 Absatz 3 die Möglichkeit ha-ben, zur Wahrung der Interessen des Landes Verordnungenzu erlassen. Im übrigen gibt auch Artikel 49 dem Bund dieKompetenz, Abwehrmassnahmen zu ergreifen, wenn solchenötig würden.
Angenommen – Adopté
Art. 123Anträge der Kommissionen: BBlPropositions des commissions: FF
Angenommen – Adopté
Art. 124Anträge der Kommissionen: BBlPropositions des commissions: FF
Aeby Pierre (S, FR), rapporteur: A l’article 124 qui concernele régime douanier, «Droits de douane», il n’y a pas de com-mentaire particulier, si ce n’est que suite à une erreur de tra-duction, la notion de «trafic des marchandises» avait disparuen français et que la commission l’a réintroduite. C’est unecorrection purement rédactionnelle, et maintenant, le textefrançais correspond à la précision qu’on trouve d’ailleursdans le texte allemand. Je n’ai pas d’autre remarque.
Angenommen – Adopté
Art. 125Anträge der Kommissionen: BBlPropositions des commissions: FF
Aeby Pierre (S, FR), rapporteur: L’article 125, «Exclusiond’impôts cantonaux et communaux» est le revers de la mé-daille des compétences fédérales en la matière. Il est néan-moins utile, c’est en tout cas l’avis de la commission et ça aété celui du Conseil fédéral, de préciser cette exclusion dansun article de la constitution, en l’occurrence ici, à l’article 125.Il a été adapté au point de vue rédactionnel pour tenir compteégalement, dans l’énumération, du fait que nous avons placémaintenant les impôts spéciaux à la consommation tout desuite après la TVA. C’est la raison pour laquelle il a fallu opé-rer, par souci de cohérence, cette modification rédaction-nelle, mais qui ne change absolument rien au sens de cet ar-ticle, qui n’a fait l’objet d’aucune opposition en commission.
Koller Arnold, Bundesrat: Der Grundsatz leuchtet hier jawirklich ein. Nach der Einführung der Mehrwertsteuer war al-lerdings die Reichweite etwas umstritten. Es ging vor allemum die Frage der Billettsteuern, die auf den Eintritten zu Aus-stellungen und zu kulturellen Veranstaltungen erhoben wer-den. Das Bundesgericht hat kürzlich alle kantonalen undkommunalen Billettsteuern für zulässig erklärt, und in diegleiche Richtung gehen nun auch die Anträge der WAK desNationalrates zum neuen Mehrwertsteuergesetz.
Angenommen – Adopté
Art. 126Anträge der Kommissionen: BBlPropositions des commissions: FF
Antrag Spoerry.... Er berücksichtigt bei der Gewährung von Bundesbeiträ-gen die Finanzkraft der Kantone sowie die städtischen Agglo-merationen und die Berggebiete.
Proposition Spoerry.... elle prend en considération la capacité financière des can-tons ainsi que les agglomérations urbaines et les régions demontagne.
Aeby Pierre (S, FR), rapporteur: L’article 126 n’a pas fait l’ob-jet de grandes discussions en commission. Je vous ai expli-qué tout à l’heure que la commission, comme le Conseil fé-déral, n’a pas voulu surcharger le projet de réforme de laconstitution avec des considérations tendant à changer quoique ce soit dans le régime de péréquation financière.L’article 126 est un des fondements d’un Etat fédéral qui tientà pratiquer la solidarité entre les cantons membres. En cesens, le projet du Conseil fédéral prévoit à juste titre ce prin-cipe d’encouragement de la péréquation financière entre lescantons, et le fait qu’il faut tenir compte des régions les plusfaibles économiquement, notamment des régions de monta-gne et des cantons à faible capacité.
Spoerry Vreni (R, ZH): Mein Antrag muss in einen Zusam-menhang mit Artikel 41 gestellt werden: Unser Rat hat in derSondersession in Artikel 41, wo es um die Stellung der Ge-meinden geht, mit 31 zu 8 Stimmen einen Absatz 2 eingefügt,wonach der Bund bei der Erfüllung seiner Aufgaben auf dieAnliegen der Gemeinden insbesondere in städtischen Agglo-merationen und in Berggebieten Rücksicht zu nehmen habe.Der Antrag der Minderheit Aeby, der lediglich die Städte unddie städtischen Agglomerationen erwähnt haben wollte, fand,nach meinem Dafürhalten zu Recht, keine Mehrheit.Die Debatte zeigte, dass wir in unserem Land zwei verschie-dene Arten von Gebieten haben, die besondere Lasten tra-gen. Einerseits die flächenmässig grossen, aber dünn besie-delten Berggebiete, andererseits die Kernstädte, welche Auf-gaben für eine ganze Region wahrnehmen, gleichzeitig abereinem Bevölkerungsverlust ausgesetzt sind und einen An-stieg bei den sozialen Problemen zu verzeichnen haben.Nun sind wir bei Artikel 126, der den Finanzausgleich regelt.Aus der Sicht der Kernstädte und deren Agglomerationenwird mit einem gewissen Erstaunen, zum Teil sogar mit Be-fremden zur Kenntnis genommen, dass sie, im Gegensatz zu
4. März 1998 S 99 Bundesverfassung. Reform
Amtliches Bulletin der Bundesversammlung / Separatdruck
Artikel 41, hier keine Erwähnung finden und dass allein dieBerggebiete aufgeführt sind. Die Erklärung, dass dies demText der aktuellen Verfassung entspreche, verfängt deshalbnicht mehr, weil sich die Probleme seit der Schaffung unsererBundesverfassung natürlich massiv verschoben haben. Seitdreissig Jahren erleiden die Städte einen massiven Bevölke-rungsverlust, ohne dass deshalb ihre Kernaufgaben und dieLeistungen für die umliegenden Regionen kleiner gewordenwären, im Gegenteil. Aus diesem Grund erscheint auch hier,neben der Erwähnung der Berggebiete, die explizite Auffüh-rung der städtischen Agglomerationen angebracht. Persön-lich könnte ich gut damit leben, wenn man in Artikel 126 nachdem Begriff der Kantone einen Punkt machen und auf jedeAufzählung verzichten würde. Solange aber die Berggebieteerwähnt sind, müssen auch die städtischen Agglomerationenaufgeführt werden; denn dann geht es darum, in der Verfas-sung auf jene Gebiete hinzuweisen, die heute in einer verän-derten Welt besondere Lasten tragen.Anfügen möchte ich noch, dass im neuen Finanzausgleichder sogenannte horizontale Finanzausgleich, also jener in-nerhalb einer Region, und zwar kantonsübergreifend, ver-stärkt werden soll. Der horizontale Finanzausgleich soll zu ei-ner wichtigen Stütze der neuen Finanzausgleichsordnungwerden. Dabei ist für mich klar, dass dann selbstverständlichauch die Mitsprache all jener gewährleistet sein muss, die be-zahlen.Mein Antrag hat keineswegs zum Ziel, mit Finanzspritzen dasKostenbewusstsein der Städte zu schwächen. Es gehtdarum festzuhalten, dass, analog zu Artikel 41, die Problemeder Kernstädte und ihrer Agglomerationen erkannt sind undman im Rahmen des zukünftigen Finanzausgleiches sowohlan die spezielle Situation der Berggebiete als auch an diespezielle Situation der städtischen Agglomerationen denkenmuss.In diesem Sinne bitte ich Sie, die Analogie zwischen Artikel41 und Artikel 126 herzustellen.
Wicki Franz (C, LU): Ich habe viel Verständnis für die Aus-führungen von Frau Spoerry. Wir müssen uns aber bewusstsein, dass der Text in Artikel 126 nur provisorischer Natur ist.Sie wissen, dass wir daran sind, eine grundlegende Reformder Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen an dieHand zu nehmen. Die Art und Weise der Subventionierungsoll neu festgelegt werden. Der Finanzausgleich im eigentli-chen Sinne wird also neu geregelt. Der Bundesrat hat am11. März 1996 das Vernehmlassungsverfahren eröffnet.Es schiene mir falsch, wenn wir jetzt an diesem alten Artikelbetreffend den Finanzausgleich etwas ändern würden. Wirmüssen nun wirklich im Grunde an die Regelung des Finanz-ausgleichs gehen und darauf hinwirken, dass wir bald zu ei-nem umfassenden neuen Verfassungsartikel kommen. Ichmöchte Sie, Herr Bundesrat, anfragen, wie das weitere Ver-fahren betreffend diesen neuen Finanzausgleich ist. Mir wäresehr daran gelegen, dass diese Sache nun vorangetriebenwürde.Mit Bezug auf den Antrag Spoerry bin ich der Meinung, dasswir ihn ablehnen sollten, um, wie bereits erwähnt, die ganzeSache des neuen Finanzausgleiches nicht – und wenn auchnur scheinbar – in falsche Bahnen zu lenken.
Maissen Theo (C, GR): Ich glaube, man muss gegenüberden Ausführungen von Frau Spoerry festhalten, dass dieAnalogie zwischen Artikel 41 und Artikel 126 (Finanzaus-gleich) nicht gegeben ist. Bei Artikel 41 sind wir davon aus-gegangen, dass es sich um die Erfüllung der Aufgaben han-delt, die der Bund generell hat, und nicht in erster Linie umdie Fragen des Lastenausgleichs. So ist beispielsweise vonden Städten immer wieder geltend gemacht worden – vor al-lem im Bereich der Drogenpolitik –, dass sie zuwenig Kontaktmit dem Bund hätten. Würde man dem Anliegen von FrauSpoerry bei Artikel 126 Rechnung tragen und die städtischenAgglomerationen erwähnen, ginge das weit über die Nach-führung hinaus. Ich habe mich immer auf den Standpunkt ge-stellt, wir sollten bei der Nachführung bleiben. Das soll auchhier so sein.
Der Begriff der städtischen Agglomerationen ist meines Er-achtens sachlich auch zuwenig durchdacht. In der geltendenVerfassung hat man abgesehen von der Berücksichtigungder Finanzkraft der Kantone Gebiete – die Berggebiete – er-wähnt, von denen man weiss, dass sie wegen der Kosten derräumlichen Weite auf spezielle Ausgleichsleistungen ange-wiesen sind.Für die städtischen Agglomerationen ist die Situation anders.Hier sind die Kernstädte von der Ertragsseite im Verhältnis zuihren Aufgaben her gesehen oft schlecht gestellt, währendGemeinden im gleichen Agglomerationsgürtel oft finanziellsehr gut dastehen. Diese Situation hat denn auch die Diskus-sion darüber ausgelöst, wie die Erbringung von Aufgaben derKernstädte, vorab im Bereiche der Kultur und des Sozialen,durch Beiträge von Gemeinden in der gleichen Agglomera-tion finanziell abgefedert werden kann.Insofern ist es ohne nähere Betrachtung sachlich nicht ge-rechtfertigt, hier den Begriff der städtischen Agglomerationenaufzunehmen, gibt es doch in diesen Agglomerationen selbergrosse Unterschiede bezüglich der Lasten und der finanziel-len Leistungskraft.Wie Kollege Wicki gesagt hat, wäre eine Änderung im Rah-men der aktuellen Diskussion um den Finanzausgleich, wonoch viele Fragen in bezug auf die Aufgabenteilung zwischenBund und Kantonen offen sind, in Aussicht zu nehmen.Ich bitte Sie deshalb, hier im Sinne der Kommission zu be-schliessen und sich auf die eigentliche Nachführung zu be-schränken.
Aeby Pierre (S, FR): J’aimerais préciser que je m’exprimemaintenant en mon nom personnel, et non au nom de la com-mission. Je m’exprime en mon nom parce que je suis peut-être à l’origine, et je le regrette, de ce qui est à mon sens,maintenant, une dérive.Lorsqu’on a débattu de l’article 41, j’ai présenté une proposi-tion en sous-commission puis en commission, qui faisait l’in-jonction à la Confédération et aux cantons – et tout autantaux cantons qu’à la Confédération – de tenir compte de la si-tuation particulière des villes. Cette proposition est devenuequelque chose de tout à fait informe: les cantons sont tom-bés; ce n’est plus que la Confédération qui doit faire atten-tion, et ce n’est pas aux «villes» – parce qu’on a eu peur decette notion de «ville» –, c’est aux «agglomérations urbai-nes»/«städtische Agglomerationen». Ensuite, on a fait unpas de plus: on n’a pas voulu parler des «städtische Agglo-merationen» sans mettre à l’article 41 les régions de mon-tagne – ce à quoi je m’étais opposé lorsqu’on a eu ce débat.Car ma proposition, elle n’était pas financière – maintenant,on est en train de parler de gros sous, de péréquation, de so-lidarité financière; ma proposition, qui disait aux cantons et àla Confédération de tenir compte des villes, c’était une propo-sition qui se plaçait sur un plan politique, sur un plan sociolo-gique et sur un plan culturel. C’était un message pour dire àla Suisse, où 70 pour cent des habitants se trouvent au-jourd’hui dans des villes ou des agglomérations: nous pre-nons connaissance, dans la constitution, de cette réalité po-litique, sociologique et culturelle qu’est la ville. Mais ça, nousne l’avons pas voulu, et nous avons fait de l’article 41 quel-que chose d’informe qui ne dit rien.Maintenant, on est en train, dans l’article 126, de faire encorepire si l’on suit la proposition Spoerry. Je regrette la tournureprise par ces éléments, mais dans ma proposition initiale, iln’était pas question d’argent, il était question de réalités so-ciologiques, il s’agissait de montrer que la Suisse du XXIesiècle est une grande métropole et qu’elle n’est pas un con-glomérat de cantons où les seules valeurs que l’on reconnaîtsont les valeurs traditionnelles et campagnardes. Mais ça n’apas été compris dans ce sens, et aujourd’hui on aboutit audernier élément de ce que j’ai appelé une dérive dans nos dé-libérations sur l’article 41. Malgré la sympathie que j’ai, etmalgré mon souhait de tenir compte des villes à l’article 41 –souhait qui n’a pas été réalisé –, je pense que la propositionSpoerry n’a pas sa place ici, à l’article 126.Je vous prie d’adopter la proposition de la commission, et parlà le projet du Conseil fédéral.
Constitution fédérale. Réforme 100 E 4 mars 1998
Bulletin officiel de l’Assemblée fédérale / Tiré à part
Loretan Willy (R, AG): Ich bin Frau Spoerry dankbar, dasssie diesen Antrag eingebracht hat. Ich finde ihn auch richtig.Er ist die logische Konsequenz unserer Beschlüsse beiArtikel 41. Darauf ist bereits hingewiesen worden.Zum ersten: Natürlich hängt nicht alles und jedes am Geld,aber sehr vieles. Wenn der Bund die Anliegen der Gemein-den, insbesondere der städtischen Agglomerationen und derBerggebiete, nach dem neuen Artikel 41 in seiner Aufgaben-erfüllung und auch bei der Vorbereitung der Gesetzgebungberücksichtigen will und muss, dann hat das enorm viel auchmit Geld, auch mit dem Finanzausgleich zu tun.Wenn wir jetzt – dieser Vorgriff ist insbesondere von HerrnWicki kritisiert worden – in Artikel 126 die «städtischen Ag-glomerationen» zusätzlich zum Berggebiet erwähnen, dannbegehen wir im Hinblick auf die Neuregelung des Finanzaus-gleiches zwischen Bund und Kantonen und innerhalb derKantone mit den Gemeinden keinen Sündenfall, denn dieseProbleme – Stichwort: «städtische Agglomerationen» – müs-sen ja ohnehin geregelt werden.Das steht im übrigen auch im bereits in der Debatte zuArtikel 41 zitierten Brief der Konferenz der Kantonsregierun-gen (KdK). Diese Konferenz ist bereit, die Diskussionen mitden Kommunalverbänden über den Finanzausgleich unterEinbezug der Probleme der städtischen Agglomerationenaufzunehmen. Die Herren Annoni und Pfisterer schreibenhier, man bitte darum, mit Bezug auf Artikel 41 nicht über denAntrag der ständerätlichen Kommission hinauszugehen. Ichdarf dieses Zugeständnis der KdK in freier Auslegung diesesBriefes auch auf Artikel 126 beziehen.Die zweite Bemerkung: Der Begriff der «städtischen Agglo-merationen» ist definiert. Das Bundesamt für Statistik führteine Liste dieser Agglomerationen. Die betreffenden Ge-meinden sind genau abgegrenzt. Man kann den AntragSpoerry also nicht daran «aufhängen», um ihn so zu erledi-gen.Die dritte Bemerkung betrifft den Einwand von Kollege Mais-sen: Wir wissen alle, dass es in Agglomerationsgebietenauch reiche Gemeinden gibt. Das ist das Problem der Kern-städte. Wenn man aber das Kriterium der städtischen Agglo-merationen im Zusammenhang mit dem Finanzausgleichhier einführt und dann in der Gesetzgebung umsetzt, dannwerden die reichen Gürtelgemeinden natürlich bei der Be-wertung der Finanzkraft einer städtischen Agglomeration be-rücksichtigt; ihre Finanzkraft fliesst also in die Gesamtfinanz-kraft einer städtischen Agglomeration ein. Auch dieses Argu-ment ist unbehelflich gegen den Antrag Spoerry.Schliesslich eine vierte Bemerkung: In der nationalrätlichenVerfassungskommission ist diese Problematik diskutiert wor-den. Es liegt – wenn ich das richtig in Erinnerung habe – einMinderheitsantrag analog zum Antrag Spoerry für die Diskus-sion im Nationalrat vor. Ich bin daher – damit komme ich wie-der auf den Anfang meines Votums zurück – befriedigt dar-über, dass die Debatte jetzt auch hier, im Erstrat, geführt wor-den ist, und ich bitte Sie auch mit Blick auf den Zweitrat umeinen positiven Entscheid, um ein positives Signal.Ich bitte Sie also, dem Antrag Spoerry zuzustimmen.
Bloetzer Peter (C, VS): Ich habe Frau Spoerry bei der Bera-tung von Artikel 41 in der Kommission und hier im Rate un-terstützt, weil ich das Anliegen, das in Artikel 41 behandeltwird, aus meiner staatspolitischen Auffassung heraus unter-stützen muss. Hingegen kann ich ihr bei diesem Artikel nichtmehr folgen, und zwar deshalb nicht, weil eine Projektgruppedes EFD und der Schweizerischen Konferenz der kantonalenFinanzdirektoren an der Arbeit sind, eine grundlegende Re-form des Finanzausgleichs zu schaffen. Der Antrag Spoerryist eine Vorwegnahme eines Teils dieser Reformarbeit.Wenn wir diesem Antrag folgten, würden wir den Rahmen derNachführung sprengen. Obwohl ich erwarte, dass das Resul-tat der Reformarbeit dem Antrag Spoerry entsprechen wird,ist es falsch, das Anliegen hier, im Rahmen der Nachführung,vorwegnehmen zu wollen.Aus diesem Grunde beantrage ich Ihnen, dem Bundesratund der Kommission zuzustimmen.
Wicki Franz (C, LU): Herr Loretan Willy hat den Minderheits-antrag, der im Nationalrat vorliegt, erwähnt. Ich möchte hierfolgendes festhalten: In der Verfassungskommission des Na-tionalrates wurde über den Antrag Spoerry eine Abstimmungdurchgeführt. Der Antrag wurde mit 22 zu 11 Stimmen – alsoganz klar – abgelehnt. Wir helfen also nicht viel, wenn wirheute dem Antrag Spoerry zustimmen. Zudem möchte ichnoch einmal betonen: Herr Thomas Pfisterer, Regierungsratdes Kantons Aargau, hat namens der Konferenz der Kan-tonsregierungen in der Verfassungskommission folgendesausgeführt: «Sicher wird die neue Bestimmung zum Finanz-ausgleich über das Niveau der Nachführung hinausgehen.Mit dem jetzt vorgeschlagenen Artikel 126 können wir uns imRahmen des bestehenden Finanzausgleiches einverstandenerklären.» Auch er hat unter anderem erklärt, bei der Nach-führung sei nicht eine Belastung einzufügen, sondern mit Mutan die neue Verfassungsbestimmung und an den neuen Fi-nanzausgleich heranzugehen.
Rhinow René (R, BL): Ich äussere mich hier in meinem per-sönlichen Namen und nicht als Kommissionspräsident. Indiesem Sinne möchte ich Sie bitten, den Antrag Spoerry zuunterstützen.1. Ich möchte darauf hinweisen, dass wir immer wieder überden Begriff der Nachführung gesprochen haben. Die Kom-mission hat bewusst nicht einen engen Begriff der Nachfüh-rung zugrunde gelegt, sondern immer wieder gesagt, ge-wisse Modifikationen mit Aussicht auf einen breiten Konsenskönnten Platz haben. Deshalb ist es nicht ganz korrekt, wennman jetzt sagt, die Nachführung gestatte diesen kleinenSchritt nicht. Natürlich sind wir frei, ob wir das tun wollen odernicht; aber es ist sicher nicht so, dass nun erstmalig und ein-malig das ganze Konzept durchbrochen würde. In dieseRichtung gehen auch die Voten, die gefallen sind. Die gegen-wärtigen Abklärungen, die gegenwärtigen Projekte gehengenau in diese Richtung. Also unterstützt das ja im Grundegenommen das Argument, dass die sich bildende Verfas-sungswirklichkeit eben vom Antrag Spoerry aufgenommenwird.2. Ich möchte ganz kurz Herrn Maissen widersprechen. Erhat gesagt, dass eigentlich nur die Kernstädte belastet seien.Natürlich ist in den Kernstädten das Problem am virulente-sten, aber berührt sind immer die ganzen Agglomerationen.Die Mobilitätsfragen, die Verkehrsfragen, die Gesundheits-fragen, die Bildungsfragen sind Angelegenheiten, die die Ag-glomerationen als ganze betreffen, und ein Auseinanderdivi-dieren in arme Städte und reiche Gürtel darf man so generellfür die Schweiz nicht vornehmen, obwohl das in gewissen Si-tuationen, in Teilbereichen, stimmen mag.3. Ich darf Sie schliesslich auf den Wortlaut des AntragesSpoerry hinweisen. Es heisst ja hier nur, bei der Gewährungvon Bundesbeiträgen seien die städtischen Agglomerationenzu berücksichtigen. Es ist weder von einer Höhe noch von ei-nem Ausmass, noch davon, dass jetzt alles umgekrempeltwerden soll, die Rede. Ich bitte die Vertreter und Vertreterin-nen der Berggebiete, auch darauf Rücksicht zu nehmen – so,wie wir selbstverständlich, mit Engagement und Überzeu-gung im Sinne des helvetischen Ausgleiches die Berggebieteimmer unterstützt haben und auch künftig unterstützen wol-len –, dass durch die neue Situation, die in den letzten zehn,zwanzig Jahren in den städtischen Agglomerationen einge-treten ist, dieser Ausgleichsgedanke auch hier Anwendungfinden soll.
Spoerry Vreni (R, ZH): Nach dem Votum von Herrn Rhinowkann ich mich kurz fassen. Ich möchte immerhin noch vierPunkte aufgreifen, die erwähnt wurden:1. Zur Feststellung, mein Antrag sprenge die Nachführungund gehe darüber hinaus: Im engen Sinne des Wortlautes:Ja, wenn man nur die Worte ansieht, ist es eine Erweiterungder geltenden Verfassung. Im Sinne der Nachführung, wiewir sie verstehen – dass wir nämlich die gelebte Wirklichkeitin die Verfassung aufnehmen wollen –, geht sie nach meinemDafürhalten nicht darüber hinaus. Wie jetzt mehrmals ausge-
4. März 1998 S 101 Bundesverfassung. Reform
Amtliches Bulletin der Bundesversammlung / Separatdruck
führt worden ist, sollte es doch unbestritten sein, dass nichtnur die Berggebiete Probleme haben, sondern zunehmendauch die Kernstädte mit ihren Agglomerationen.2. Zum Argument, man solle jetzt nichts machen, es kommeja ohnehin ein neuer Verfassungsartikel zum Finanzaus-gleich: Ich hoffe, dass dieser neue Verfassungsartikel kommtund dass das komplexe Vorhaben des neuen Finanzausglei-ches rasch zu einer definitiven Lösung führt. Aber ich binnicht der Meinung, dass wir mit der von mir beantragten Er-gänzung diese Arbeit in einer falschen Richtung präjudizie-ren. Es ist ja gerade einer der Inhalte des neuen Finanzaus-gleiches, dass der horizontale Finanzausgleich in den Regio-nen durch Unterstützung des Bundes gefördert werden soll;mit diesem Zusatz soll nicht mehr und nicht weniger gesagtwerden. Das ändert nichts daran, dass man nachher einenneuen, noch umfassenderen Artikel bringen muss; aber jederVerfassungsartikel muss ohnehin auf Gesetzesebene ausge-führt werden.3. Zum Agglomerationsgürtel: Die reichen Agglomerations-gemeinden könnten helfen, die Lasten der Städte zu tragen;damit bin ich einverstanden. Ich bin auch der Meinung, dassein Finanzausgleich innerhalb des gleichen Kantons und einMittragen der städtischen Aufgaben innerhalb des gleichenKantons nötig, wichtig und heute unerlässlich ist. Aber diestädtischen Agglomerationen befinden sich nicht unbedingtnur auf einem Kantonsgebiet; dort braucht es übergreifendeLösungen, mit welchen auch nicht zum gleichen Kanton ge-hörende Agglomerationsgemeinden mit einbezogen werdenkönnen. Das ist einmal mehr der Sinn des neuen horizonta-len Finanzausgleiches.4. Zu Herrn Maissen: Das ist die einzige Äusserung, die michein bisschen getroffen hat. Kollege Maissen sagt, dass diegeltende Verfassungsbestimmung eben so sein müsse, weildie Berggebiete spezielle Lasten hätten. Genau das ist das,was heute nicht mehr stimmt – oder nicht mehr alleinestimmt. Die Berggebiete haben unbestrittenermassen ihrespeziellen Lasten zu tragen, aber die Agglomerationsge-meinden eben auch. Meine vorgeschlagene Ergänzung wäreim Hinblick auf die Neuregelung der Finanzordnung ein Zei-chen in die Richtung, dass man das erkannt hat und man dasProblem auch dann, wenn es um Finanzen und nicht nur umDeklarationen geht, ernst nimmt und dazu steht.
Koller Arnold, Bundesrat: Klar und unbestritten ist, dass dieFormulierung von Artikel 126, wie sie Ihnen von Bundesratund Kommission vorgeschlagen wird, eindeutig eine Nach-führung der geltenden Verfassung ist, denn wir übernehmenmit diesem Artikel 126 den heute geltenden Artikel 42ter.Nun beantragt Frau Spoerry die Ergänzung, dass nicht nurdie Berggebiete, sondern auch die städtischen Agglomera-tionen bei der Regelung des Finanzausgleiches zu berück-sichtigen seien. Ich frage mich einfach, ob es zweckmässigist, jetzt – wo im EFD wirklich eine grundlegende Neuord-nung des Finanzausgleiches vorbereitet wird und noch die-ses Jahr eine Vernehmlassung über diese Fragen eröffnetwerden soll – diesen heute geltenden Text zu ändern. HerrBundesrat Villiger und der Gesamtbundesrat gedenken,noch in diesem Jahr den neuen Finanzausgleich in die Ver-nehmlassung zu geben. Dieser neue Finanzausgleich wirdallerdings nicht mehr nur einen einzigen Verfassungsartikelbetreffen; er wird eine Mehrheit von Artikeln im Bereich derZuständigkeiten zwischen Bund und Kantonen mit ein-schliessen und wird daher formell als eigenes, drittes syste-matisches Reformpaket – genau gleich wie das Reformpaketüber die Volksrechte und das Reformpaket über die Justiz –in die Vernehmlassung gehen und wahrscheinlich auch Ih-nen präsentiert werden.Aus diesem Grunde zieht es der Bundesrat vor, jetzt nicht«en chemin», auf dem Wege, noch Änderungen vorzuneh-men. Ich empfehle Ihnen daher, es bei der Formulierung vonBundesrat und Kommission bewenden zu lassen.
Abstimmung – VoteFür den Antrag der Kommission 19 StimmenFür den Antrag Spoerry 13 Stimmen
Art. 185Anträge der Kommissionen: BBlPropositions des commissions: FF
Präsident: In Ziffer 10 Absatz 4 ist es richtig, gleich wie beiZiffer 9 zu formulieren: «Die Befugnis zur Erhebung derMehrwertsteuer ist bis Ende 2006 befristet.» Französisch:«La taxe sur la valeur ajoutée peut être perçue jusqu’à la finde 2006.»Bei Ziffer 10a ist der französische Text zu korrigieren. Esmuss heissen «nouvelle loi fédérale» und nicht «nouvelle lé-gislation fédérale».
Angenommen – Adopté
Präsident: Die feierliche Gesamtabstimmung zur Nachfüh-rungsvorlage wird stattfinden, wenn der Teil A2 verabschie-det ist.
Die Beratung dieses Geschäftes wird unterbrochenLe débat sur cet objet est interrompu
Constitution fédérale. Réforme 102 E 5 mars 1998
Bulletin officiel de l’Assemblée fédérale / Tiré à part
Vierte Sitzung – Quatrième séance
Donnerstag, 5. März 1998Jeudi 5 mars 1998
08.00 h
Vorsitz – Présidence: Iten Andreas (R, ZG)
__________________________________________________________
96.091
Bundesverfassung.ReformConstitution fédérale.Réforme
Fortsetzung – Suite
__________________________________________________________
C. Bundesbeschluss über die Reform der JustizC. Arrêté fédéral relatif à la réforme de la justice
Eintretensdebatte – Débat d’entrée en matière
Rhinow René (R, BL), Berichterstatter: Mit der Vorlage überdie Reform der Justiz betreten wir nun den Boden einer ech-ten Verfassungsreform. Es handelt sich um eines der beidenReformpakete, die uns der Bundesrat neben der aktualisier-ten Verfassung vorgelegt hat.Gestatten Sie mir vier Vorbemerkungen, bevor ich auf den In-halt dieser Vorlage im Überblick eingehe:1. Dieser Reformbereich stützt sich grundsätzlich auf denText der aktualisierten Verfassung ab. Die Artikelnumerie-rung nimmt also die entsprechenden Artikelnummern derneuen Verfassung auf und ändert diese ab, nicht also dieje-nigen der geltenden Bundesverfassung. Trotzdem ist in denZiffern II bis IV dieser Vorlage vorgesehen, dass im Falle ei-ner Verwerfung der Vorlage A und einer Annahme derVorlage C diese trotzdem in Kraft treten kann. Die Bundes-versammlung hätte dann die Bestimmungen der beschlosse-nen Justizreform an die geltende Bundesverfassung anzu-passen.2. Sie finden die Reformbestimmungen auf drei Verfassungs-abschnitte aufgeteilt: die Verankerung der Rechtsweggaran-tie in Artikel 25a bei den Grundrechten, die Vereinheitlichungdes Zivil- und Strafprozessrechtes im Kapitel «Zuständigkei-ten des Bundes», Artikel 113 und 114, sowie den Kern derReform im 4. Kapitel des 5. Titels, mit der Überschrift «Bun-desgericht und andere richterliche Behörden».3. Es ist in Erinnerung zu rufen, dass nach der Minireformdes Bundesgesetzes über die Organisation der Bundes-rechtspflege (OG) 1991 gleichzeitig mit der Verfassungsre-form eine Totalrevision des OG an die Hand genommenwurde und wird, zu welcher das Vernehmlassungsverfahrensoeben sein Ende gefunden hat. Diese Totalrevision stütztsich aber in mehreren Punkten auf die hängige Justizreformauf Verfassungsebene ab, setzt diese also teilweise voraus.4. Ich teile Ihnen schliesslich mit, dass uns Kollege Wicki alsKommissionssprecher durch die Detailberatung führen wird.Welches sind nun die hauptsächlichen Beweggründe für dieJustizreform? In einer zusammenfassenden Sicht lassen siesich auf drei Hauptgründe konzentrieren: Erstens ist dasBundesgericht massiv überlastet. Die Folgen dieser Überla-stung sind insbesondere eine lange Verfahrensdauer in man-chen Fällen, eine tendenziell abnehmende Sorgfalt undGrundsätzlichkeit der Entscheidungen unter der zunehmen-
den Geltung eines effizienzgeprägten Erledigungsprinzipsund schliesslich eine Gefährdung der Koordination und Ein-heitlichkeit der obersten Rechtsprechung.Ich verzichte hier auf Angaben zur Statistik, auf die Nennungvon Zahlen eingegangener und erledigter Fälle. Ich verweiseSie auf die Zahlen, die kürzlich bezüglich Amtsbericht 1997in den Medien zu lesen waren. Ich verzichte auch auf einenähere Darlegung, warum es überhaupt soweit kommenkonnte, und verweise Sie diesbezüglich auf die Botschaft.Der zweite Grund für die Reform ist die Existenz gravierenderLücken im Rechtsschutz, ein für einen modernen Rechts-staat unwürdiger Zustand. So kennen wir keine allgemeineRechtsweggarantie, d. h. kein individuelles Recht auf Erledi-gung einer Streitsache durch einen unabhängigen Richter inallen Streitfällen. Wir kennen keine Verfassungsgerichtsbar-keit gegen Bundesgesetze und allgemeinverbindliche Bun-desbeschlüsse, was nicht nur den Schutz der individuellenFreiheitsrechte empfindlich schmälern kann, sondern auchdie Kantone gegenüber dem Bundesgesetzgeber ohnmäch-tig erscheinen lässt. Wir kennen kein Rechtsmittel, mit demsich die kantonalen Behörden im Bereich der Verfassungsju-stiz gegen ein letztinstanzliches kantonales Urteil beim Bun-desgericht zur Wehr setzen könnten. Wir kennen nur eineneingeschränkten richterlichen Rechtsschutz bei der Verlet-zung politischer Rechte auf Bundesebene. Wir kennen kei-nen richterlichen Rechtsschutz bei gewissen historisch er-klärbaren Materien, bei denen dem Bundesrat und eventuellauch der Bundesversammlung Rechtspflegefunktionen zu-kommen.Der dritte Grund für die Reform liegt in der zunehmend alsstossend empfundenen Zersplitterung des Verfahrensrech-tes im Bereich der Zivil- und Strafprozessordnungen. Über 27Strafprozessordnungen und 27 Zivilprozessordnungen in un-serem kleinräumigen Land erschweren den Rechtsschutz ineiner durch Mobilität und Internationalisierung geprägten Ge-sellschaft. Sie behindern die kantonsübergreifende Strafver-folgung und eine effiziente Bekämpfung der Kriminalität. Siesind der Rechtsdurchsetzung und der Rechtstransparenz ab-träglich.Nun zu den Zielen und neuen Instrumenten, welche zur Be-hebung der geschilderten Mängel eingeführt werden sollen;ich folge der Reihenfolge der soeben geschilderten Mängelim Justizbereich.Es geht erstens um die Stärkung des Bundesgerichtes alsoberstes Rechtspflegeorgan, zweitens um die Schliessungvon Lücken im System des Rechtsschutzes und drittens umdie Vereinheitlichung des Zivil- und Strafprozessrechtes.Zum ersten: Das Bundesgericht soll gestärkt werden, indemdie Vorinstanzen ausgebaut werden. Das Bundesgericht wirddamit in die Lage versetzt, sich auf eine Rechtskontrolle zubeschränken. Es wird auch mit einer Filterwirkung durch dieflächendeckend eingesetzten Vorinstanzen gerechnet. Aufgewisse Ausnahmen gehe ich hier nicht ein. Schliesslichwerden dadurch Zugangsbeschränkungen überhaupt erst er-möglicht. Zu diesen Vorinstanzen zählen neu kantonale rich-terliche Behörden im Bereich ihres eigenen kantonalen öf-fentlichen Rechtes, eine Erweiterung der erstinstanzlichenBehörden des Bundes, wo bislang keine Rekurs- undSchiedsinstanzen eingesetzt sind, ein organisatorisch selb-ständiges Strafgericht und eine Beschränkung des Direktpro-zesses, auch hier mit gewissen Ausnahmen.Ebenfalls der Stärkung des Bundesgerichtes dient die neu inder Verfassung verankerte Möglichkeit, durch Gesetze Be-schränkungen des Zugangs zum Bundesgericht vorzusehen.Die Formulierung dieser verfassungsrechtlichen Ermächti-gung, namentlich die Angabe eingrenzender Kriterien, berei-tet und bereitete etwelche Mühe. Ihre Kommission hat nachder Publikation ihrer Anträge Ende des letzten Jahres an ih-rer Sitzung vom 10. Februar 1998 eine modifizierte Lösungbeschlossen, um verschiedenen kritischen Einwänden Rech-nung tragen zu können. Sie finden diesen Antrag separat zuArtikel 178a.Schliesslich sollen die ausdrückliche Erwähnung des Bun-desgerichtes als oberste rechtsprechende Behörde und dieAufnahme des Grundsatzes der richterlichen Selbstverwal-
5. März 1998 S 103 Bundesverfassung. Reform
Amtliches Bulletin der Bundesversammlung / Separatdruck
tung die Stellung des Bundesgerichtes im Gefüge der ober-sten Verfassungsorgane deutlicher zum Ausdruck bringen.Zum zweiten Ziel der Reform, zur Verbesserung des Rechts-schutzes: Hierher gehört einmal die Einführung einer all-gemeinen Rechtsweggarantie, ein verfassungsmässigesRecht, welches heute nur teilweise gewährleistet ist.Er vermittelt die Befugnis, vor den Richter zu gelangen, undzwar in praktisch jedem Fall, nicht aber unbedingt die Be-fugnis, einen Fall auch vom Bundesgericht beurteilen zu las-sen.Hierher gehört auch der Ausbau des Rechtsschutzes bei denpolitischen Rechten, bei Wahlen und Abstimmungen desBundes, indem eine Stimmrechtsbeschwerde eingeführtwird, wie sie heute bereits bei kantonalen Wahlen und Ab-stimmungen besteht. Neu soll die Verfassung dem Gesetz-geber auch gestatten, eine Einheitsbeschwerde einzuführenund den Anwendungsbereich der Behördenbeschwerde aus-zudehnen.Kernstück der Verbesserung des Rechtsschutzes ist zweifel-los der Ausbau der Verfassungsgerichtsbarkeit gegen Bun-desgesetze und – nach alter Terminologie – allgemeinver-bindliche Bundesbeschlüsse.Die Gründe für diesen längst fälligen Schritt sind in der Bot-schaft ausführlich dargelegt. Sie werden in der Detailbera-tung näher beleuchtet und, wie Sie der Fahne entnehmenkönnen, von einer Minderheit abgelehnt.Es geht vor allem darum, der mehrfach gewandelten Situa-tion Rechnung zu tragen, wie sie durch die stark gewachseneBedeutung der Bundesgesetze, durch den StrassburgerSchutz unserer Grundrechte sowie durch den rechtsstaatlichund föderalistisch bedeutsamen Vorrang der Verfassung vordem Gesetz eingetreten ist.Der Antrag der Kommission, der dem bundesrätlichen Ent-wurf weitgehend folgt, enthält im wesentlichen fünf Elemente.Als Beschwerdegründe gelten nur die Verletzung verfas-sungsmässiger Rechte, wobei aber die Kantone auch dieVerletzung der Kompetenzordnung geltend machen können.Diese Verletzung kann nur im Rahmen der Anwendung einesGesetzes gerügt werden – es wird also keine abstrakte Nor-menkontrolle eingeführt –, es wird schliesslich kein speziellesVerfassungsgericht vorgesehen, sondern das Bundesgerichtsoll diese Fälle beurteilen, wobei die interne Organisationdurch den Gesetzgeber näher geregelt wird. Wichtig er-scheint dabei, dass der Gesetzgeber ein besonderes Proze-dere vorsieht, das der grossen Bedeutung dieser Überprü-fung Rechnung trägt. Die Entscheidungskompetenz schliess-lich wird beim Bundesgericht zentralisiert, weil es nicht denkantonalen Behörden obliegen kann, Bundesgesetze auf ihreVerfassungsmässigkeit hin zu überprüfen. Wenn Vorinstan-zen endgültig entschieden haben, wird die Möglichkeit einessogenannten Vorlageverfahrens eingeführt.Schliesslich zum dritten Reformziel, zur Vereinheitlichungdes Zivil- und Strafprozessrechtes. Hier verweise ich auf dieAusführungen des Kommissionssprechers in der Detailbera-tung. Diese Vereinheitlichung wird schon lange gefordert. Siebezieht sich schwergewichtig auf das Verfahren, doch, wieSie der Fahne entnommen haben, soll der Gesetzgeber nöti-genfalls auch gewisse organisationsrechtliche Vorschriftenerlassen dürfen, wenn dies eben unabdingbar ist. Hingegensoll die kantonale öffentliche Rechtspflege nicht zusätzlichvereinheitlicht werden.Die Justizreform will scheinbar Gegensätzliches realisieren:Entlastung des Bundesgerichtes einerseits und Ausbau desRechtsschutzes andererseits. Mit den vorgeschlagenenMassnahmen wird versucht, beide Ziele zu erreichen respek-tive zu optimieren. Die trotzdem bleibende Ambivalenz dieserZieldualität darf nicht aus den Augen verloren werden.Was heisst das? Ein Ausbau des Rechtsschutzes ohne Be-reitschaft zur strukturellen Entlastung des Bundesgerichteswürde den gegenwärtigen Zustand nochmals verschlimmern.Eine strukturelle Entlastung durch Zugangsbeschränkungenohne Einführung von Vorinstanzen würde umgekehrt denRechtsschutz gegenüber heute verschlechtern. Es handeltsich also bei diesem Paket um ein austariertes Ganzes, dasgrundsätzlich nicht aufgebrochen werden sollte, damit das
Gleichgewicht der Reformziele nicht gestört und damit insGegenteil verkehrt wird. Dies sollten Sie bei allen Abände-rungsanträgen mit bedenken.
Wicki Franz (C, LU), Berichterstatter: Von den drei vom Bun-desrat vorgelegten Verfassungsrevisionsvorlagen ist zeitlichgesehen die Justizreform die dringlichste. Die Belastung desBundesgerichtes in Lausanne und des Eidgenössischen Ver-sicherungsgerichtes in Luzern hat beunruhigende Ausmasseangenommen. Ich habe in diesem Rat als Mitglied der GPKschon mehrmals auf die alarmierende Situation aufmerksamgemacht. Letzte Woche haben Sie die Zahlen des Ge-schäftsberichtes 1997 der beiden eidgenössischen Gerichtezur Kenntnis nehmen können. Erneut wurde die unerträglichgewordene Arbeitsbelastung betont und nach einer wirksa-men Reform der Bundesjustiz gerufen. Beunruhigend sindnicht nur die Zunahme der Pendenzen und die damit verbun-dene Verlängerung der Verfahrensdauer. Zu befürchten istbei dieser Situation, dass das Bundesgericht seiner Aufgabeals oberstes Gericht zunehmend weniger nachkommenkann. Da zur Bewältigung des zu grossen Geschäftsvolu-mens das Erledigungsprinzip oberste Leitlinie bilden muss,leidet unweigerlich die Qualität der Rechtsprechung.Der Verfassungsentwurf schafft die Grundlage für Entla-stungsmassnahmen. Als solche sind in erster Linie die mög-lichst weitgehende Beschränkung der direkten Prozesse vordem Bundesgericht und die Zugangsbeschränkungen vorge-sehen.Ihre Verfassungskommission und noch vielmehr jene desNationalrates hatten bei den Zulassungsbeschränkungen mitder Formulierung der verfassungsmässigen Kriterien Mühe.Ich werde bei Artikel 178a auf den Werdegang des heutevorliegenden Antrages näher eingehen. Ihre Kommissionwar grossmehrheitlich der Meinung, dass die notwendigeEntlastung des Bundesgerichtes ohne Zugangsbeschrän-kungen irgendwelcher Art nicht erreicht werden kann. Daswar übrigens auch die einhellige Ansicht der Expertenkom-mission, wie uns dies der Vizepräsident dieser Kommission,Professor Walter Kälin, vor der Verfassungskommission be-stätigt hat.Ich persönlich bin der Überzeugung, dass zeitgerechte Ent-scheidungen der Rechtssicherheit am meisten dienen, unddiese können wir nur erreichen, wenn wir das Bundesgerichtnicht zum «Güselkübel» der Nation machen. Wir brauchenübrigens den Filter der Zugangsbeschränkungen auch, wennwir die Anrufung des Bundesgerichtes in neuen Bereichenermöglichen wollen, denn der Entwurf ermächtigt den Ge-setzgeber, weitere Zuständigkeiten des Bundesgerichtes zubegründen. Es wäre daher untragbar, dem Bundesgerichtneue Aufgaben zuzuweisen, ohne dass gleichzeitig für seineFunktionsfähigkeit gesorgt wird. In Anlehnung an eine Äus-serung von Bundesgerichtspräsident Peter Alexander Müllerpostuliere ich, dass in Zukunft bei jeder vom Parlament zugenehmigenden Vorlage auch geprüft werden muss, ob sichdaraus eine Mehrbelastung des Bundesgerichtes absehenlässt und ob – und allenfalls wie – diese für unser oberstesGericht verkraftbar ist. Analog der Ausgabenbremse gemässArtikel 88 der Bundesverfassung könnte so für den Bereichder Justiz eine «Belastungsbremse» eingeführt werden. Dieswürde bedeuten, dass der Gesetzgeber bei jeder Vorlage sa-gen müsste, welcher personelle und materielle Mehraufwandbei der Justiz damit verbunden ist.Gestatten Sie mir noch einen grundsätzlichen Hinweis überdas Verhältnis von Verfassung und Gesetz hier bei der Ju-stizreform. Die Verfassung ist die rechtliche Grundlage undGestaltungsordnung auch für den Bereich der Justiz. DieVerfassungsbestimmungen sollten nicht nur aus der momen-tanen Situation heraus formuliert werden; daher müssen sieoffen sein. Deshalb sollte die Verfassung dem Gesetzgebernur soweit notwendig Schranken in der konkreten Ausgestal-tung der Rechtswege und der Zuständigkeitsordnungen set-zen. Dies sollte ein Grundanliegen der Justizreform sein. DerGesetzgeber muss befähigt – und nicht behindert – werden,die Organisation der Rechtspflege den sich wandelnden Be-dürfnissen anzupassen. Dies zum Grundsätzlichen; ich
Constitution fédérale. Réforme 104 E 5 mars 1998
Bulletin officiel de l’Assemblée fédérale / Tiré à part
werde in der Detailberatung auf die einzelnen Neuerungenund Fragen eingehen.Nachdem wir bei Artikel 178a, bei den Bestimmungen betref-fend den Zugang zum Bundesgericht, einen Kompromissfanden, haben wir wirklich gegenteilige Meinungen nur nochin einem Punkt, und dies ist bei Artikel 178, der Normenkon-trolle, also bei der Frage, ob das Bundesgericht bei einemkonkreten Anwendungsfall Bundesgesetze auf ihre Verein-barkeit mit den verfassungsmässigen Rechten und dem Völ-kerrecht überprüfen darf. Ihre Kommission hat in diesemPunkt mit 14 zu 2 Stimmen der bundesrätlichen Vorlage zu-gestimmt.Abschliessend kann ich Ihnen daher bestätigen: Ihre Kom-mission steht hinter der Ihnen nun vorliegenden Justizreform.Es ist eine tragfähige Vorlage; die Chance besteht, dass siein absehbarer Zeit dem Volk vorgelegt werden kann.In diesem Sinne beantrage ich namens der Kommission Ein-treten und Zustimmung.
Koller Arnold, Bundesrat: Ich darf Sie einleitend daran erin-nern: Die Nachführung unserer Bundesverfassung – dass wirIhnen das gesamte geschriebene und ungeschriebene Ver-fassungsrecht in moderner Sprache, in neuer, überzeugen-der Systematik präsentieren – geht auf einen Bundesbe-schluss des Parlamentes aus dem Jahre 1987 zurück. Beider nachgeführten Bundesverfassung hat der Bundesrat vorallem ein Mandat des Parlamentes erfüllt. Bei der Vorberei-tung dieser Verfassungsreform haben wir dann gesehen,dass es damit nicht sein Bewenden haben kann, weil wirauch materiellen Reformbedarf geortet haben, vor allem imBereich unserer Institutionen.Das war der Grund, weshalb wir das parlamentarische Man-dat aufgrund unseres Initiativrechtes ausgedehnt haben unddie ganze Verfassungsreform als nach vorne offenen, dyna-mischen Prozess verstehen. Wir haben Ihnen in diesem Zu-sammenhang zwei erste Reformpakete unterbreitet, einesüber die Justizreform und ein zweites über die Reform derVolksrechte. Bereits in Bearbeitung sind zwei weitere Pa-kete, eines über die Reform des Finanzausgleichs und denFöderalismus sowie eines über die Staatsleitungsreform.Von allen diesen systematischen materiellen Reformpaketenist die Justizreform zweifellos die dringlichste. Sie alle ken-nen aufgrund der Beratungen hier im Rat die chronischeÜberlastung unserer obersten Gerichte. Sie sind heute nichtmehr in der Lage, ihre Funktion wirklich kompetent zu erfül-len, derart chronisch ist die Überlastung geworden. Wennman die Zahlen anschaut, dann sind sie wirklich eindrücklich.Wenn wir vom Jahr 1978 bzw. 1980 ausgehen, als wir dasletzte Mal die Zahl der Bundesrichter in Lausanne bzw. dieZahl der Versicherungsrichter in Luzern – von 28 auf 30 bzw.von 7 auf 9 – erhöht haben, dann stellen wir folgende Ent-wicklung der Geschäftslast fest:Im Jahre 1978 waren beim Bundesgericht in Lausanne 3001Neueingänge zu verzeichnen. Im Jahre 1997 waren es, wieder soeben erschienene Bericht des Bundesgerichtes aus-weist, 5408 Fälle. Wir haben also in diesen zwanzig Jahreneine Zunahme der eingegangenen Fälle um 80 Prozent.Nicht viel besser sieht es beim Eidgenössischen Versiche-rungsgericht aus. Im Jahre 1978 waren es 1300, letztes Jahr2019 Neueingänge – also auch dort eine Steigerung um55 Prozent, wobei diese Steigerung vor allem in Luzern auchim letzten Jahr angehalten hat. Im letzten Jahr war dort eineweitere Steigerung der eingegangenen Fälle um 8 Prozentzu verzeichnen.Wie sind wir mit dieser Zunahme der Fälle, die vom Bundes-gericht zu beurteilen waren, überhaupt fertig geworden? Wirhaben ständig irgendwelche Notmassnahmen ergriffen. Wirhaben am Bundesgericht zunächst 15 ordentliche Ersatzrich-ter bestellt, dann 15 ausserordentliche Ersatzrichter. Wir ha-ben die Zahl der Gerichtsschreiber von 24 auf 50 erhöht undhaben jedem Bundesrichter noch einen persönlichen Mitar-beiter beigegeben. Das alles – vor allem der Ausbau der In-frastruktur und des Mittelbaus – waren sicher notwendigeund auch gute Massnahmen. Aber ich glaube, wir sind uns
alle einig: Auf diesem Wege kann es nicht mehr weitergehen.Wenn es uns jetzt nicht gelingt, eine wirkliche Strukturreformzu realisieren, dann bleibt nur noch der Weg über immermehr Bundesrichter, über immer mehr Hilfspersonal, und daskann für ein oberstes Gericht des Landes kein vernünftigerWeg zur Bewältigung der Arbeitslast sein. Das ist der Hinter-grund dieser Vorlage über die Justizreform.Wir müssen also eindeutig eine Entlastung unserer oberstenGerichte erreichen. Damit dies nicht zu einer Reduktion desRechtsschutzes in unserem Land führt, müssen wir dieskompensieren – wie schon Herr Rhinow ausgeführt hat –, in-dem wir eine allgemeine Rechtsweggarantie vorsehen undüberall richterliche Vorinstanzen einführen. Damit ist es künf-tig grundsätzlich nicht mehr möglich, direkt Prozesse beimBundesgericht zu führen und überhaupt an das Bundesge-richt als erste richterliche Instanz zu gelangen.Der zweite Grund, weshalb wir eine Reform der Justiz alsvordringlich erachten, sind gewisse Lücken in unseremRechtsschutzsystem. Unsere Bundesverfassung kennt keineallgemeine Rechtsweggarantie im Sinne eines umfassendenZugangs zu einem unabhängigen Gericht. Ein gerichtlicherRechtsschutz fehlt namentlich dann, wenn der Bundesratoder ein Departement endgültig entscheidet, aber auch imwichtigen Bereich der politischen Rechte des Bundes. Dabeisehen wir gleichzeitig vor – das sei jetzt schon vermerkt –,dass für eigentliche politische Akte der obersten Behördennach wie vor Ausnahmen möglich bleiben müssen.Der Rechtsschutz ist sodann wegen der fehlenden Verfas-sungsgerichtsbarkeit gegenüber Bundesgesetzen und allge-meinverbindlichen Bundesbeschlüssen beschränkt. DerRechtsuchende kann sich heute nicht wehren, wenn seineverfassungsmässigen Freiheitsrechte durch ein Bundesge-setz verletzt werden. Diese Rechtsschutzlücke fiel bei derGründung unseres Bundesstaates, als die weitaus grössteZahl der Kompetenzen bei den Kantonen blieb, natürlichnicht ins Gewicht. Wegen der starken Zunahme der Bundes-kompetenzen seit der Gründung des Bundesstaates hatdiese potentielle Beeinträchtigung unserer Freiheitsrechtedurch Bundesgesetze aber stark an Bedeutung gewonnen.Der Reformdruck ergibt sich in diesem Punkt aber auch ausder Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK). DieStrassburger Instanzen und seit einiger Zeit auch das Bun-desgericht selber können prüfen, ob Bundesgesetze mit derEMRK vereinbar sind. Die EMRK ist damit vor Missachtungdurch den Bundesgesetzgeber geschützt; nicht so die unsnäher liegende Bundesverfassung. Das ist in der heutigenRechtslage zweifellos ein kaum zu begründender Wider-spruch und hat praktisch dazu geführt, dass das Bundesge-richt auf stillem Wege eine gewisse Verfassungsgerichtsbar-keit im Bereich der EMRK eingeführt hat – obwohl diese inunserer Bundesverfassung als solche gar nicht vorgesehenist –, um diesen Widerspruch zu lösen.Schliesslich steht auch das Zivil- und Strafprozessrecht aufder Mängelliste. Die kleinräumige Schweiz verfügt heute ne-ben den Verfahrensordnungen des Bundes über je 26 kanto-nale Prozessordnungen – dies in einer Zeit, in der dieRechtsbeziehungen kaum mehr an den Kantons- und Lan-desgrenzen haltmachen. Diese bestehende Rechtszersplit-terung im Prozessrecht schafft erhebliche Rechtsunsicher-heit. Im Zivilprozess können die unterschiedlichen Verfah-rensordnungen der Kantone zu Ungleichbehandlungen füh-ren, im Strafprozess wird damit die effiziente Verbrechensbe-kämpfung beeinträchtigt.Daraus ergaben sich für den Bundesrat auf dem Gebiet derJustiz die Reformziele. Es sind deren vier:1. Das Bundesgericht als oberstes Gericht soll wieder voll-umfänglich funktionsfähig werden und vor allem die beidenwichtigsten höchstrichterlichen Funktionen, die Wahrung derRechtseinheit und die Rechtsfortbildung, wieder sicherstel-len.2. Ein ebenso wichtiges Reformziel bildet die Gewährleistungeines wirksamen Rechtsschutzes in Form der allgemeinenRechtsweggarantie.3. Sodann soll eine behutsame Form der Normenkontrolleauch gegenüber Bundesgesetzen Platz greifen.
5. März 1998 S 105 Bundesverfassung. Reform
Amtliches Bulletin der Bundesversammlung / Separatdruck
4. Der Bund soll die Kompetenz erhalten, das Zivil- und Straf-prozessrecht zu vereinheitlichen.Das sind selbstverständlich Projekte der Gesetzgebungsko-difikation, die von der Grössenordnung her etwa neben dieVereinheitlichung des Zivil- und Handelsrechtes gestellt wer-den müssen und deren Realisierung entsprechend auchviele Jahre in Anspruch nehmen wird.Erlauben Sie mir nun noch kurz einige Bemerkungen zurFrage, mit welchen Massnahmen wir diese Reformziele er-reichen möchten.Der erste Bereich betrifft wie gesagt die Wiederherstellungder Funktionsfähigkeit des Bundesgerichtes. Als obersterrechtsprechender Behörde des Bundes obliegen dem Bun-desgericht die Sicherstellung der einheitlichen Anwendungdes Bundesrechtes, die Rechtsfortbildung und die Gewäh-rung von Rechtsschutz. Damit es diese Aufgaben wieder op-timal wahrnehmen kann, muss es wirksam entlastet werden.Zu diesem Zweck sehen wir vor allem drei Entlastungsmass-nahmen vor:1. Dem Bundesgericht sollen durchgehend richterliche Be-hörden vorgeschaltet werden. Das Bundesgericht entschei-det künftig grundsätzlich nicht mehr als erste richterliche In-stanz, sondern nimmt als letzte und oberste Instanz eineNachkontrolle der Rechtsanwendung vor. Jeder Praktikerweiss, dass im Gerichtsverfahren vor allem die Sachverhalts-ermittlung eine äusserst aufwendige Aufgabe ist, und diesewollen wir künftig dem Bundesgericht ersparen und sie vonrichterlichen Vorinstanzen erfüllen lassen. Das Bundesge-richt soll sich künftig auf eine nachträgliche Rechtskontrollebeschränken können. Damit wir dieses Ziel erreichen, wer-den wir ein erstinstanzliches Bundesstrafgericht einrichtenmüssen. Wir werden uns auch überlegen müssen, ob wir mitdem System der Rekurskommissionen im Bereich des Bun-desverwaltungsrechtes fortfahren wollen oder ob wir nichtauch ein erstinstanzliches Bundesverwaltungsgericht schaf-fen sollten.2. Das Bundesgericht soll von sachfremden Aufgaben entla-stet werden. Die Direktprozesse vor Bundesgericht werdensomit auf das absolut notwendige Minimum reduziert. Daskönnen wir nur durch eine Reform unserer Verfassung errei-chen, weil weitgehende Möglichkeiten von Direktprozessenbeim Bundesgericht in der heutigen Verfassung ausdrücklichvorgesehen sind.3. Eine nachhaltige Entlastung verspricht sich der Bundesratschliesslich vor allem von einer Verwesentlichung derhöchstrichterlichen Rechtsprechung. Zu diesem Zweck wirdeine Verfassungsgrundlage für Zugangsbeschränkungen be-reitgestellt.Der zweite Reformbereich bringt Verbesserungen desRechtsschutzes. Vorgesehen ist wie gesagt eine allgemeineRechtsweggarantie mit der Möglichkeit von gewissen Aus-nahmen, insbesondere für politische Akte. Sonst soll sichaber der Rechtsuchende in grundsätzlich allen Streitigkeitenan ein unabhängiges Gericht wenden können.Die Rechtsweggarantie kompensiert auch allfällige Zugangs-beschränkungen zum Bundesgericht. Der Rechtsuchendekann zwar seinen Prozess nicht mehr unter allen Umständenbis vor das Bundesgericht ziehen. Dafür ist ihm aber grund-sätzlich in jedem Fall die Beurteilung durch einen unabhängi-gen Richter garantiert.Zum dritten ist die Ausdehnung der Normenkontrolle aufBundesgesetze vorgesehen. Der Bundesrat möchte diesenwichtigen Reformschritt allerdings nach einem sehr massvol-len Modell realisieren. Bundesgesetze sollen künftig nur imkonkreten Anwendungsfall überprüfbar sein, und zwar einzigdurch das Bundesgericht. Wir sehen also keinerlei präventiveund keinerlei abstrakte Normenkontrolle vor, wie sie andereStaaten – beispielsweise Frankreich oder Deutschland –kennen. Dagegen sind wir der Überzeugung, dass eine Ver-fassungsgerichtsbarkeit beim Bund in Form dieser konkretenNormenkontrolle jetzt angesichts der grossen Ausdehnungder Kompetenzen des Bundesgesetzgebers ein unbedingtesErfordernis moderner Rechtsstaatlichkeit geworden ist.Als vierten Reformpunkt stellt die Justizreform die erforderli-chen Verfassungsgrundlagen bereit, um das Zivil- und das
Strafprozessrecht in der ganzen Schweiz zu vereinheitlichen.Erste Priorität wird dabei die Vereinheitlichung des Strafpro-zessrechtes haben; das ist eines von vielen unbedingt not-wendigen Mitteln in der Bekämpfung des organisierten Ver-brechens in unserem Land.Erlauben Sie mir abschliessend noch eine Bemerkung. Ichweiss, es gibt Leute, die sich fragen, ob wir diese unbedingtnötige Entlastung des Bundesgerichtes nicht einfach übereine OG-Revision realisieren könnten. Die Analyse hat ganzklar gezeigt, dass eine Revision aufgrund der bestehendenVerfassung sehr limitiert wäre. Es gibt eine ganze Anzahl vonRevisionspostulaten, die nur realisiert werden können, wennwir zunächst die Justizverfassung ändern. So lässt die gel-tende Verfassung für eine Beschränkung des Zugangs zumBundesgericht nur ganz wenig Spielraum. Das war auch beider vom Volk abgelehnten OG-Revision immer ein Diskus-sionspunkt. Sodann enthält die geltende Verfassung keineGrundlage für ein selbständiges Bundesstrafgericht, also fürdiese wichtige richterliche Vorinstanz, und ebensowenig füreine Pflicht der Kantone, durchgehend richterliche Behördenals letzte kantonale Instanzen einzusetzen.Ferner schreibt die geltende Verfassung gewisse Direktpro-zesse und den Grundsatz der Massgeblichkeit von Bundes-gesetzen zwingend vor, und wir haben keine Kompetenz fürdie Vereinheitlichung des Zivil- und des Strafprozessrechtes.Sie ersehen aus diesen Beispielen, dass es unbedingt nötigist, zuerst die Justizverfassung zu ändern, bevor wir dann imRahmen einer umfassenden OG-Revision diese neuen Kom-petenzen entsprechend konkretisieren.Das Vernehmlassungsergebnis zur Justizreform ist gesamt-haft sehr positiv ausgefallen. Mich hat vor allem beeindruckt,dass die Verfassungsgerichtsbarkeit – der vielleicht umstrit-tenste Punkt – von den Bürgerinnen und Bürgern, wohl wis-send, dass das natürlich ihre Freiheit stärkt, äusserst positivaufgenommen worden ist. Von etwa 2500 Stellungnahmenwaren über 2000 in diesem Punkt positiv, und nur knapp 500haben sich zu diesem wohl umstrittensten Punkt skeptischgeäussert.Diese Justizreform ist wirklich dringlich. Wenn uns die struk-turelle Reform unserer obersten Gerichte nicht gelingt, danngibt es schon sehr rasch nur noch die Möglichkeit, dass wirweiterwursteln, immer mehr Bundesrichter wählen, immermehr Hilfspersonal bestellen und damit das Bundesgerichtanstatt zu einer obersten Rechtsprechungsinstanz zu einerArt Fabrik machen, welche die zentralen Aufgaben, die Wah-rung der Rechtseinheit und die Rechtsfortbildung, nicht mehrerfüllen kann.In diesem Sinne möchte ich Sie bitten, auf diese Vorlage ein-zutreten.
Detailberatung – Examen de détail
Titel und Ingress, Ziff. I EinleitungTitre et préambule, ch. I introductionAnträge der Kommissionen: BBlPropositions des commissions: FF
Angenommen – Adopté
Art. 25aAnträge der Kommissionen: BBlPropositions des commissions: FF
Wicki Franz (C, LU), Berichterstatter: Artikel 25a sprichtvon der Rechtsweggarantie. Diese Bestimmung garantiertden Zugang zu einem unabhängigen Gericht in grundsätz-lich allen Rechtsstreitigkeiten. Sie stellt ein verfahrensrecht-liches Grundrecht dar; daher wird sie im Grundrechtsteil derVerfassung angeführt, deshalb also Artikel 25a. Die Rechts-weggarantie vermittelt das Recht, vor den Richter zu gelan-gen, aber nicht unbedingt die Beanspruchung des höchstenGerichtes, des Bundesgerichtes. Diese Garantie gilt na-mentlich auch in Verwaltungsangelegenheiten. Wenn hiervon Beurteilung gesprochen wird, heisst dies, dass das Ge-
Constitution fédérale. Réforme 106 E 5 mars 1998
Bulletin officiel de l’Assemblée fédérale / Tiré à part
richt den Sachverhalt und die Rechtsfragen umfassendüberprüft.Zu beachten ist, dass der zweite Satz von Artikel 25a aus-drücklich den Kantonen und dem Bund die Möglichkeit gibt,Ausnahmen von der Rechtsweggarantie festzulegen. In derBotschaft sind solche Ausnahmefälle exemplarisch ange-führt. Meines Erachtens sollte der Gesetzgeber diesen Aus-nahmenkatalog nicht zu eng fassen. Insbesondere sollte dieRechtsweggarantie nicht dazu führen, dass die Justiz verpo-litisiert wird. Im übrigen verlangt die Rechtsweggarantie kei-nen schrankenlosen Zugang zum Richter. Die Prozessord-nungen dürfen das Eintreten auf ein Rechtsmittel von denüblichen Sachverhaltsvoraussetzungen abhängig machen.Es bleibt namentlich zulässig, als Anfechtungsobjekt einenEntscheid der Behörde vorauszusetzen.Im Begriff «Rechtsstreitigkeit» kommt zum Ausdruck, dassnicht jedes faktische Handeln der Behörden oder der Ver-waltung Gegenstand gerichtlicher Beurteilung bilden muss.In Betracht kommt nur ein solches Verwaltungshandeln, dasin schützenswerte Rechtspositionen eingreift und bei demder Betroffene legitimiert ist, eine diesbezügliche Feststel-lungsverfügung zu verlangen. Ein Beispiel: Die Umbenen-nung einer Strasse hat zur Folge, dass ein Anwohner neuesBriefpapier drucken muss. Dies greift nicht in geschützteRechtspositionen ein. Mit der Rechtsweggarantie wird nichtdie Anfechtbarkeit von sogenannten Realakten, die nicht ge-setzliche Rechte oder Pflichten von Personen betreffen, ver-langt.Noch ein Letztes zu diesem Artikel, und zwar zum Begriff«richterliche Behörde»: Gemeint ist damit eine Instanz mitrichterlicher Unabhängigkeit. Über die Besetzung dieser In-stanz wird nichts ausgesagt. Es kann sich grundsätzlich umeine Einzelrichterin oder um einen Einzelrichter handeln.Die Kommission hat ohne Gegenstimmen dem bundesrät-lichen Entwurf zugestimmt.
Angenommen – Adopté
Art. 113Anträge der Kommissionen: BBlPropositions des commissions: FF
Wicki Franz (C, LU), Berichterstatter: Zu Artikel 113, «Zivil-recht»: Absatz 1 stimmt mit der nachgeführten Verfassungüberein, jedoch mit der wichtigen Ergänzung, dass auch dieGesetzgebung auf dem Gebiete des Zivilprozessrechtes Sa-che des Bundes ist; es wird also die Möglichkeit der Verein-heitlichung des Zivilprozessrechtes vorgesehen.Den Kantonen bleiben gemäss Absatz 2 die Organisationund die Rechtsprechung, soweit Bundesgesetze nicht etwasanderes vorsehen. Wir nehmen also eine Neuverteilung derRechtsetzungskompetenzen im Bereich des Prozessrechtesvor. Im Verfassungsentwurf von 1995 hatte der Bundesratnoch keine totale Vereinheitlichung des Zivilprozessrechtesvorgesehen, sondern nur eine Harmonisierung vorgeschla-gen. Aufgrund der Vernehmlassung liess der Bundesrat vomhalbherzigen Harmonisierungsvorschlag ab; tatsächlich hättedie blosse Harmonisierung an der vielbeklagten Rechtszer-splitterung – zumindest äusserlich – nicht viel geändert, dennnach wie vor bestünden dann 26 kantonale Zivilprozessord-nungen und eine Bundeszivilprozessordnung.Ihre Kommission hat Artikel 113 ohne Gegenstimme geneh-migt.
Angenommen – Adopté
Art. 114Anträge der Kommissionen: BBlPropositions des commissions: FF
Wicki Franz (C, LU), Berichterstatter: Hier geht es um dieVereinheitlichung des Strafprozessrechtes; diese Vereinheit-lichung war in der Vernehmlassung unbestritten. Wiederholtwar sie auch mit verschiedenen politischen Vorstössen ver-langt worden. Zudem wurden dazu sieben Standesinitiativen
eingereicht; wir haben diese heute auch auf der Traktanden-liste. In diesen Standesinitiativen wird die Vereinheitlichungdes Strafprozessrechtes gefordert, dies von den KantonenBasel-Stadt, Baselland, Solothurn, Aargau, Thurgau, St. Gal-len und Glarus.Das Prozessrecht hat an sich die Funktion der Durchsetzungdes materiellen Rechtes. Die Rechtszersplitterung in 26 kan-tonale und drei Bundesstrafprozessordnungen sind diesemZweck nicht förderlich. Zudem sollte vermieden werden, dassmit den 29 Strafprozessordnungen die Strafverfolgung im Zu-sammenhang mit der internationalen Kriminalität behindertwird.Ihre Verfassungskommission hat den Bestimmungen vonArtikel 114 Absätze 1 und 2 oppositionslos zugestimmt undsomit die Vereinheitlichung des Strafprozessrechtes gutge-heissen. Mit der neuen Verfassungsbestimmung bleiben dieKantone für das Gebiet des Strafprozessrechtes weiterhinzuständig, soweit und solange der Bund nichts legiferiert. DieOrganisation der Gerichte verbleibt auf alle Fälle bei denKantonen. Für den Straf- und Massnahmenvollzug sind dieKantone ebenfalls im bisherigen Rahmen zuständig, soweitdas Bundesgesetz nichts anderes bestimmt.In Absatz 3 beantragt die Kommission Streichung. Sie be-trachtet es als sachwidrig, in die neue Justizvorlage eine be-sondere Subventionsbestimmung aufzunehmen – dies vorallem dann, wenn in Zukunft über die Entflechtung der Aufga-ben zwischen Bund und Kantonen diskutiert werden soll. Ichkann aber formell festhalten, dass mit dem Weglassen vonAbsatz 3 zurzeit keine Streichung von Subventionen erfolgt.Hinsichtlich der Vereinheitlichung des Strafprozessrechtesist noch zu erwähnen, dass letzte Woche die Expertenkom-mission ihren Bericht der Öffentlichkeit vorgelegt hat. DerBericht «Aus 29 mach 1» – so lautet der Titel – liegt vor. So-weit ich feststellen konnte, fand dieser Bericht eine gute Auf-nahme. Es geht nun darum, diesen Bericht mit der Fachöf-fentlichkeit zu diskutieren und dort einen Konsens zu su-chen, wo die Kantone noch an ihren eigenen Modellen fest-halten.Es ist vorgesehen, einen Vorentwurf auszuarbeiten, der etwaim Jahre 2001 vorliegen dürfte. Die parlamentarische Bera-tung der neuen eidgenössischen Strafprozessordnung wirdwohl frühestens im Jahre 2002 oder 2003 stattfinden können.Mit dem Inkrafttreten wird im Jahre 2004 oder 2005 gerech-net.
Koller Arnold, Bundesrat: Erlauben Sie mir noch ein Wort inbezug auf die Planung: Wenn wir von Volk und Ständen dieKompetenz zur Vereinheitlichung des Zivilprozessrechtesund des Strafprozessrechtes erhalten, wird es natürlichJahre gehen, bis das realisiert ist. Angesichts unserer be-schränkten Ressourcen habe ich mich entschieden, im De-partement zunächst die Vereinheitlichung des Strafprozess-rechtes voranzutreiben. Hier ist vor kurzer Zeit ein Konzept-bericht unter dem Titel «Aus 29 mach 1» ergangen, der jetztin den interessierten Fachkreisen diskutiert wird. Wir werdenin bezug auf die Vereinheitlichung des Strafprozessrechteswahrscheinlich Ende nächsten Jahres eine Vernehmlas-sungsvorlage unterbreiten können. Sie wissen, dass derar-tige Kodifikationen natürlich für die Beratung in den Räten ei-nige Jahre in Anspruch nehmen. Selbst wenn wir diese Kom-petenz erhalten – was meines Erachtens nicht bestritten ist –,wird die Realisierung dieser wohl letzten grossen Vereinheit-lichungskodifikation in unserem Land klarerweise Jahre inAnspruch nehmen.
Angenommen – Adopté
Art. 176Anträge der Kommissionen: BBlPropositions des commissions: FF
Wicki Franz (C, LU), Berichterstatter: Die Artikel 176 bis 180gehören zum 5. Titel, der mit «Die Bundesbehörden» über-schrieben ist. Das 4. Kapitel befasst sich mit dem Bundesge-richt und mit anderen richterlichen Behörden.
5. März 1998 S 107 Bundesverfassung. Reform
Amtliches Bulletin der Bundesversammlung / Separatdruck
Nun zu Artikel 176: Hier geht es um die Stellung des Bundes-gerichtes. Wie wir beim Eintreten gehört haben, verfolgt derBundesrat mit der Justizreform zwei wesentliche Ziele:1. Die Reform soll die Voraussetzungen dafür schaffen, dassdie Geschäftslast des Bundesgerichtes reduziert wird unddass das Bundesgericht seine spezifischen Aufgaben alsoberstes Gericht wieder optimal erfüllen kann.2. Lücken im Rechtsschutz der Bürgerinnen und Bürger sol-len geschlossen, und der Rechtsschutz in allen Bereichensoll sichergestellt werden.Darüber, wie diese Ziele am besten zu erreichen sind, gehendie Meinungen auseinander. Die Subkommissionen der Ver-fassungskommission von National- und Ständerat haben da-her gemeinsame Expertenanhörungen durchgeführt. In derFolge wurden verschiedene Organisationsmodelle der Bun-desjustiz diskutiert. Es standen grundsätzlich drei Modellezur Diskussion, nämlich:1. Das Modell des Bundesrates, das in der Vorlage darge-stellt ist.2. Das Modell einer zweistufigen Bundesjustiz: Diese wird inzwei Instanzen aufgeteilt. Erste Instanz sind Bundeszivilge-richtshof, Bundesstrafgerichtshof und Bundesverwaltungs-gerichtshof. Zweite Instanz ist das Bundesgericht als Höchst-gericht, bestehend aus sieben bis neun Mitgliedern, zu demder Zugang durch ein strenges Annahmeverfahren be-schränkt ist und das für die Sicherstellung der Rechtseinheit,der Verfassungsgerichtsbarkeit und der Rechtsfortbildungzuständig ist.3. Regionalisierung des Bundesgerichtes: An die Stelle desheutigen Bundesgerichtes treten mehrere regionale Bundes-gerichte, welche je für einen Landesteil örtlich zuständig sind.Die Wahrung der Rechtseinheit, die Verfassungsgerichtsbar-keit und die grundlegende Rechtsfortbildung müssten für siedurch ein Höchstgericht wahrgenommen werden. DiesesHöchstgericht würde sich aus den Präsidenten und Präsiden-tinnen der regionalen Bundesgerichte zusammensetzen.Ihre Kommission hat sich mit 14 zu 2 Stimmen für das Modelldes Bundesrates ausgesprochen. Dieses knüpft an die heu-tige Organisation des Bundesgerichtes an. Die Organisationund die Grösse des Bundesgerichtes sollen auf Verfassungs-ebene nicht verändert werden.Auf die Frage der Zugangsbeschränkungen zum Bundesge-richt werde ich bei Artikel 178a eingehen.In bezug auf Artikel 176 sei noch erwähnt, dass die Verfas-sung den Grundsatz der Selbstverwaltung des Bundesge-richtes anerkennt. Dadurch wird die richterliche Unabhängig-keit im Verhältnis zur Exekutive gestärkt. Es darf aber nichtübersehen werden, dass sich auch die Justizverwaltung andie gesetzlichen Vorgaben und insbesondere an die von derBundesversammlung gesetzten finanziellen Rahmenbedin-gungen halten muss.
Angenommen – Adopté
Art. 177Anträge der Kommissionen: BBlPropositions des commissions: FF
Wicki Franz (C, LU), Berichterstatter: Artikel 177 («Zustän-digkeiten des Bundesgerichtes»): Dieser Artikel umschreibtdie Hauptaufgabe des Bundesgerichtes, nämlich die Ent-scheidung von Streitigkeiten. Es beurteilt Streitigkeiten we-gen Rechtsverletzungen. In Absatz 1 ist der Katalog der Rü-gegründe, die vor Bundesgericht geltend gemacht werdenkönnen, umfassend aufgeführt. Die Änderungsanträge IhrerKommission in Absatz 1 sind mehr redaktioneller Art.Eine Bemerkung ist zu Buchstabe d, zum Begriff «kantonaleverfassungsmässige Rechte», anzubringen: Es handelt sichhier um jene Rechte in kantonalen Verfassungen, die nichtmit den verfassungsmässigen Rechten des Bundes dek-kungsgleich sind. Die Kantone haben ja grundsätzlich dasRecht, in der Gewährung von kantonalen Garantien überjene des Bundes hinauszugehen.Anlass zur Diskussion gab die Formulierung in Absatz 4. Sieist ein Ausdruck der Gewaltentrennung. Das Bundesgericht
soll nicht über Bundesrat und Bundesversammlung gehobenwerden. Absatz 4 ist auch als Ausnahme zu Artikel 25a kon-zipiert, wo die Rechtsweggarantie verankert ist. Das Prinzipder Gewaltentrennung wird aber letztlich durch die Gesetz-gebung konkretisiert. Daher haben wir in der Kommission inAbsatz 4 eingeführt: «Soweit das Gesetz nichts anderesbestimmt ....» Damit hat es der Bundesgesetzgeber in derHand, die Zuständigkeit dort zu belassen, wo er es als poli-tisch richtig erachtet.
Angenommen – Adopté
Art. 178Anträge der Kommissionen: BBlPropositions des commissions: FF
Wicki Franz (C, LU), Berichterstatter: Hier haben wir den Titel«Normenkontrolle» gemäss Entwurf des Bundesrates re-spektive den Titel «Überprüfung von Bundesgesetzen» ge-mäss Kommissionsmehrheit. Dieser Artikel bringt eine wich-tige Neuerung: Im konkreten Anwendungsfall soll das Bun-desgericht die Möglichkeit haben zu prüfen, ob Bundesge-setze mit den verfassungsmässigen Rechten und mit demVölkerrecht übereinstimmen. Ihre Kommission hat mit 14 zu2 Stimmen der bundesrätlichen Vorlage zugestimmt.Es liegt ein Minderheitsantrag (Frick) vor, der diesen Ausbauder Verfassungsgerichtsbarkeit nicht will. Die Gegner be-fürchten vor allem, die Schweiz werde zu einer Justizdemo-kratie, und beschwören die Angst vor einem Richterstaat her-auf; eine Verfassungsgerichtsbarkeit vertrage sich nicht mitden Volksrechten.Mit der erwähnten grossen Mehrheit ist Ihre Kommissionaber überzeugt, dass der hier vorgeschlagene Ausbau derVerfassungsgerichtsbarkeit richtig ist. Die in der Botschaftangeführten Gründe sprechen klar dafür. Die dagegen vorge-brachten Argumente erweisen sich als unbegründete Be-fürchtungen. Die bisherige Erfahrung mit der Überprüfungvon kantonalen Gesetzen zeigt, dass die Verfassungsge-richtsbarkeit die Freiheit von Privaten wesentlich fördernkann, ohne dass die Demokratie durch «übermässige» Rich-ter gefährdet wird.Es stört sich niemand daran, dass Bundesrichter über einkantonales Gesetz befinden, das einmal in einer Volksab-stimmung gutgeheissen worden ist. Aufgabe der Verfas-sungsgerichtsbarkeit soll es sein, die Grundelemente der de-mokratischen, rechtsstaatlichen und bundesstaatlichen Ord-nung zu wahren. Es bedeutet hingegen nicht, dass das Bun-desgericht anstelle des demokratischen Gesetzgebersrechtspolitische Weichenstellungen vornimmt. Es ist undbleibt unbestritten, dass dem Gesetzgeber in dieser Hinsichtder Vorrang gebührt.Es geht darum, aus dem Prinzip des Vorranges der Bundes-verfassung die Konsequenzen zu ziehen. Wenn wir uns näm-lich darüber einig sind, dass die Verfassung dem Gesetzevorgeht, dann müssen wir es zulassen, dass die zentralenElemente der Verfassung praktisch durchgesetzt werdenkönnen. Auch wenn nicht bestritten werden kann, dass dieVerfassungsgerichtsbarkeit eine gewisse Politisierung derJustiz mit sich bringen kann, darf dies nicht überbewertetwerden. Der Bundesrat hat solchen Bedenken nämlich Rech-nung getragen, indem er nicht eine voll ausgebaute, umfas-sende, abstrakte Normenkontrolle vorschlägt. Er sieht einmassvolles Modell vor, welches das Verhältnis und die Funk-tionen der Gewalten im schweizerischen Staatsgefüge wahrt.Vorgeschlagen wird also eine konkrete Normenkontrolle.Bundesgesetze sollen also nicht als solche überprüft werdenkönnen, sondern sie können nur im Zusammenhang mit ei-nem bestimmten Fall Gegenstand der Überprüfung sein. Esgeht also nicht darum, den Gesetzgeber «zurückzukorrigie-ren». Der Richter muss im Einzelfall darüber befinden undfeststellen, dass der Gesetzgeber einen bestimmten Fall garnicht im Auge haben konnte und dass das Gesetz im konkre-ten Fall nicht angewendet werden darf, weil das Gesetz,wenn es so angewendet würde, im Widerspruch zur Verfas-sung stünde.
Constitution fédérale. Réforme 108 E 5 mars 1998
Bulletin officiel de l’Assemblée fédérale / Tiré à part
Eine abstrakte Normenkontrolle, wie sie ausländische Staa-ten kennen, wollen wir also nicht. Zudem wird das Recht, ei-nem Bundesgesetz die Anwendung zu versagen, nicht allenGerichten gegeben, sondern nur dem obersten Gericht. Essoll also nicht, wie dies zum Teil im ausländischen Recht derFall ist, ein Bezirks- oder ein Oberrichter entscheiden kön-nen, ob ein Bundesgesetz zur Anwendung kommt oder nicht.Im übrigen lässt der vorgeschlagene Verfassungstext mit derBestimmung von Absatz 3 die Möglichkeit durchaus offen, imEinzelfall eine angemessene Lösung zu finden. Stellt dasBundesgericht fest, dass es um eine Frage geht, über die dasParlament bewusst entschieden hat, so kann es in Anwen-dung von Artikel 178 Absatz 3 Zurückhaltung üben und dem-zufolge diese Norm nicht anwenden. Es kann sich beispiels-weise damit begnügen, die Verfassungswidrigkeit einer Ge-setzesnorm lediglich festzustellen, und es dem Gesetzgeberüberlassen, eine verfassungskonforme Regelung zu treffen.Im übrigen haben wir für die Überschrift eine für das Volk ver-ständliche Formulierung gewählt. «Normenkontrolle» ist einAusdruck der Juristen; wir beantragen nun «Überprüfung vonBundesgesetzen». Dabei wird der Begriff «Bundesgesetz» ineinem weiten Sinn verstanden; es sind die Erlasse der Bun-desversammlung mit normativem Gehalt und Referendums-pflicht. In diesem Sinne sprechen wir auch in Absatz 1 und inden folgenden Absätzen nur noch von «Bundesgesetz» undnicht mehr von «allgemeinverbindlichem Bundesbeschluss».
Frick Bruno (C, SZ): Sosehr wir die Justizreform im Grund-satz begrüssen, so entschieden lehnen wir die Verfassungs-gerichtsbarkeit ab. Sie wäre ein grosser politischer Fehler,weil sie am Kern unseres Demokratieverständnisses vorbei-gehen und das Bundesgericht zur obersten politischen In-stanz der Schweiz machen würde. Sie ist zum andern auchdeshalb falsch, weil sie keine Entlastung des Bundesgerich-tes, sondern diesem vielmehr eine massive zusätzliche Bela-stung bringt.Ich möchte diese Haltung in fünf Punkten begründen:1. In der Tat besteht heute ein Problem insofern, als der Eu-ropäische Gerichtshof für Menschenrechte in StrassburgBundesgesetze rügen kann, die gegen die EMRK verstos-sen. Das Bundesgericht hat darum entschieden, dass es sei-nerseits diese Rüge ebenfalls ausspreche und nicht einfachein Gesetz als EMRK-konform erkläre und nachher den Ent-scheid Strassburg überlasse. Insofern haben wir ein kleinesProblem. Das hat sich aber eingespielt. Die Kontrolle, wie siein diesem beschränkten Rahmen bezüglich EMRK-Konformi-tät ausgeübt wird, hat zu keinen ernsthaften Problemen An-lass gegeben. Es wäre aber falsch, diesen kleinen System-fehler zu korrigieren, indem wir nun grundsätzlich die Verfas-sungsgerichtsbarkeit über das Volk und das Parlament stel-len. Ich verstehe wohl den Wunsch vieler Juristen, eineeinheitlich reine Rechtsordnung zu verwirklichen, von derStufe der Verfassung über die Bundesgesetze bis zur letztenbundesrätlichen Verordnung und bis zur letzten Gemeinde-ordnung. Aber dieser Wunsch hat vor unserem entscheiden-den Demokratieverständnis und der Praxis, die sich als sehrsinnvoll bewährt hat, zurückzutreten.2. Mit der Verfassungsgerichtsbarkeit machen wir das Bun-desgericht zur obersten politischen Instanz der Schweiz. Daskönnen Sie nicht wegdiskutieren. Es geht einfach um dieFrage, wer in der Demokratie Schweiz das letzte Wort hat.Hat es das Volk, oder hat es das Bundesgericht? Sie stellendamit das Bundesgericht über das Volk, über seine Souverä-nität, und zwar in zentralen Bereichen. Es geht nicht nur umNebensächliches. Ich rufe Ihnen zwei Bereiche in Erinne-rung: Wir haben uns neu für ein AHV-Alter von 64 respektive65 Jahren entschieden. Das Volk hat das nach einem hefti-gen, intensiven Abstimmungskampf mitgetragen. Wir habenauch die Diskussion geführt, ob das verfassungsmässig ver-tretbar ist oder ob wir damit zu weit gehen.Beim Steuerrecht wissen wir, dass einige Bestimmungen,beispielsweise die Ehegattenbesteuerung, vom Bundesge-richt als nicht ganz verfassungsmässig gerügt wurden. Es hatseine Rechtsprechung allerdings in den letzten zehn Jahrenimmer wieder schwankend ausgeübt.
In den Bereichen, die ich genannt habe, sind politische Ent-scheide getroffen worden. Es kann nicht sein, dass diese po-litischen Entscheide letztinstanzlich durch das Bundesgerichtgetroffen werden. Politische Entscheide zu treffen ist Sachedes Parlamentes und des Volkes und nicht jene der Gerichte.Wenn wir so beschliessen, werden auch die Richterwahlenpolitische Wahlen. Eine Verpolitisierung der Richter wäre dieFolge. Dabei ist noch in keiner Weise klar – die Diskussionenin der Verfassungskommission haben es gezeigt –, wie dieseVerfassungsgerichtsbarkeit innerhalb des Bundesgerichtesausgeübt werden sollte. Soll das z. B. jede Kammer selber,soll das eine Präsidentenkonferenz, soll das eine spezielleKammer besonders legitimierter Bundesrichter tun können?Wenn wir sie einführen, wird die Folge sein, dass das Bun-desgericht die Verfassungsgerichtsbarkeit ausüben muss.Es wird also seiner Pflicht nachkommen müssen. Auch wennder Sprecher der Kommission, Herr Wicki, heute in Aussichtstellt, das Bundesgericht werde dann schon die nötige Zu-rückhaltung üben, dürfen wir die Augen nicht verschliessen:Das Bundesgericht wird entscheiden müssen. Es kann nichtsagen, es verzichte auf seine Kompetenz. Es wird seineKompetenz wahrnehmen müssen. Bezüglich der Entwick-lung der Auslegung ist etwas ja nicht ein- für allemal verfas-sungskonform oder nicht. Die Rechtsprechung des Bundes-gerichtes und die Auslegung der Verfassung entwickeln sich.Vieles, was wir heute als nicht mehr verfassungsgemäss an-schauen, hielten wir vor 20 Jahren mit dem Bundesgericht fürverfassungsmässig. Wir würden also auch die Rechtsent-wicklung in politischen Fragen dem Bundesgericht übertra-gen.3. Es ist mit dem Demokratieverständnis der Schweiz nichtvereinbar, die Richter über das Volk zu stellen. Das ist nichtsanderes als ein entscheidender Demokratieverlust. Wir ha-ben es in unserer Tradition und in unserem Bewusstsein bisheute gelebt, dass die politischen Entscheide vom Volk undvom Parlament getroffen werden. Das Volk hat das letzteWort und nicht die Richter. Es ist ein entscheidender Verlustfür unsere politische Kultur, und es ist auch nicht nötig – imVergleich zu anderen Staaten –, diese Kompetenz dem Ge-richt zu übertragen. Ich habe Verständnis, dass beispiels-weise Deutschland als parlamentarische Demokratie solcheEntscheide den Richtern überträgt, auch weil dort währenddes Regimes des Dritten Reiches im Namen des Volkes inder Gesetzgebung gröbste Fehler passiert sind. Bei uns wardas nie der Fall, wir brauchen diese Kontrolle nicht.4. Bezüglich Überlastung des Bundesgerichtes hat Herr Rhi-now zu Recht die abnehmende Sorgfalt der bundesgerichtli-chen Entscheide als Folge davon gerügt. Herr Wicki hat insgleiche Horn gestossen. Was bringt nun aber diese Verfas-sungsgerichtsbarkeit? Jeder Anwalt wird in Zukunft im An-wendungsfall auch die Rüge der Verfassungswidrigkeit einesBundesgesetzes vorbringen müssen, das ist seine Pflicht.Das wird er tun, sonst macht er seine Arbeit nicht gut genug.Das Bundesgericht wird also zusätzliche Arbeit haben. Eswird in jedem Einzelfall, sei es im Vorprüfungsverfahren, seies im Sachentscheid selber, diese Rüge prüfen müssen. Dasist nichts anderes als eine erhebliche zusätzliche Belastungdes Bundesgerichtes.Herr Wicki hat gesagt, er plädiere dafür, dass alle neuen Ge-setze und Bestimmungen auf ihre Bundesgerichtsverträglich-keit hin überprüft würden, darauf hin, ob sie zusätzliche Ar-beit für das Bundesgericht brächten. Tun Sie das bereits andieser Stelle: Diese Bestimmung bringt dem Bundesgerichtunnötigerweise zusätzliche Arbeit, auf die verzichtet werdenkann.Herr Wicki, ich halte dafür, dass wir hier einen Anwendungs-fall für Ihr Postulat haben.5. Das Parlament hat es sich in den sechs Jahren, in denenich hier sitze, immer gefallen lassen, sich selber abzuwerten.Wir haben die Ausgabenbremse eingeführt. Wir haben mitden Haushaltzielen der Souveränität des Parlamentes erheb-liche Fesseln angelegt. Ich weiss, dass das Parlament dastut; es lässt sich recht viel gefallen. Aber ich glaube, dass dasVolk sich diese Abwertung nicht gefallen lässt. Wenn dasParlament das tun will – wohlan! Aber das Volk wird sich
5. März 1998 S 109 Bundesverfassung. Reform
Amtliches Bulletin der Bundesversammlung / Separatdruck
diese Abwertung nicht gefallen lassen. Aus diesen Gründenbitte ich Sie, diese an sich gute Vorlage nicht mit dieser Be-stimmung zu belasten.Ich möchte abschliessend auf ein Argument eingehen, dasHerr Wicki in den Vordergrund gestellt hat. Er hat gesagt,auch kantonale Gesetze würden vom Bundesgericht auf ihreVerfassungsmässigkeit überprüft, und die Demokratie hättedeswegen keinen Schaden erlitten. Es gibt aber einen erheb-lichen qualitativen Unterschied, ob ein Gliedstaat, ein Kan-ton, sich ein Gesetz gibt, oder ob das gesamte Schweizervolkin seiner Souveränität Recht setzt. Das ist ein entscheiden-der qualitativer Unterschied. Daran dürfen wir nicht vorbeise-hen. Was für den Kanton gilt, muss bzw. darf hier nicht fürden Bund gelten. Solange diese Bestimmung in derVorlage C bleibt, muss ich die Vorlage als ganze ablehnen.Diese Bestimmung scheint mir zu gewichtig zu sein, als dassich einer damit belasteten Vorlage zustimmen könnte.Ich plädiere aber dafür, dass wir aus diesem Punkt eine Va-riantenfrage machen. Wenn wir das tun, kann diese Bestim-mung dem Volke als selbständige Frage vorgelegt werden,und sie ist es wert, als selbständige Frage vom Volk entschie-den zu werden. Wenn wir das aber nicht tun, kann ich derVorlage nicht zustimmen.Ich bitte Sie, dem Antrag der Minderheit zu folgen und beimheutigen Recht zu bleiben, welches besagt, dass Bundesge-setze über dem Bundesgericht stehen. Sie tun damit der De-mokratie einen grossen Dienst, Sie tun aber auch dem Bun-desgericht einen grossen Dienst, weil Sie damit wirklich effi-zient helfen, seine Überlastung abzubauen.
___________________________________________________________
Begrüssung – Bienvenue
Präsident: Ich habe die Ehre und das Vergnügen, Frau LeniFischer, Präsidentin der Parlamentarischen Versammlungdes Europarates, auf der Tribüne recht herzlich willkommenzu heissen. (Beifall)Ich tue das im Namen von Herrn Ständeratspräsident UlrichZimmerli, mit dem Sie heute abend zusammentreffen wer-den. Sie hatten gestern im Nationalrat die Gelegenheit, derDebatte über die Europaratsberichte der Schweizer Parla-mentarierdelegation und des Bundesrates beizuwohnen.Aus organisatorischen Gründen war es leider nicht möglich,die gleiche Debatte in dieser Kammer auch in Ihrem Beiseindurchzuführen.Wir sind uns der Bedeutung des Europarates und seiner Be-mühungen um die Schaffung eines europäischen demokrati-schen Sicherheitsraumes als solides Fundament für die so-genannte europäische Architektur bewusst. Dieser Raum sollauf den Grundwerten des Europarates – Demokratie, Men-schenrechte und Rechtsstaatlichkeit – basieren.Noch einmal: Herzlich willkommen in unserem Land, FrauPräsidentin Leni Fischer! (Beifall)
___________________________________________________________
Cavadini Jean (L, NE): Je me permets d’intervenir en appuides arguments apportés par M. Frick en vous demandant desuivre la proposition de minorité et de ne pas introduire cettenouveauté dans ce qui doit se limiter à une mise à jour de laconstitution.Bien sûr, c’est une question fondamentale, c’est peut-être laquestion fondamentale de cette partie de notre travail: qui,du juge ou du législateur, doit avoir le dernier mot? Assuré-ment, les réponses peuvent varier – nous ne serions pas di-visés en deux camps à peu près égaux dans ce Parlement sice n’était pas le cas –, mais ces réponses varient aussi selonla nature et l’histoire des institutions. M. Rhinow, présidentde notre commission, a cité les pays étrangers qui dispo-saient d’une cour constitutionnelle – la France, l’Allemagne,
les Etats-Unis – et ces exemples prestigieux devraient nousamener à suivre la voie que ces Etats ont choisie.Nous croyons que notre conception peut conserver ici sonoriginalité, sans porter atteinte à la pureté et à la force de no-tre démocratie. La construction de notre Etat ne comprendpas de recours législatif ultime à un tribunal fédéral. Le peu-ple délègue à l’élu la capacité de faire la loi, il se ménage dureste l’arme suprême que constitue par exemple le référen-dum, se réservant la capacité de juger si la loi définie est ad-missible ou non. Aucun des Etats cités précédemment nedispose d’un tel dispositif et le souci d’harmonisation ne doitpas nous conduire jusqu’à l’excès, bien sûr intellectuellementséduisant, de remettre au juge le droit ultime de donner sonapprobation ou sa désapprobation à une loi.Nous savons bien que la formule qui résume notre positionest un peu excessive, mais nous souhaitons éviter la créationde ce que l’on a appelé une «république des juges», qui doi-vent dire le droit – fût-il constitutionnel – et non le faire. Parmiles innovations que nous prenons le risque d’introduire dansla rénovation de notre constitution, celle-ci nous paraît bienmalheureuse et de nature à susciter d’abord le mécontente-ment, puis la méfiance et, enfin, l’opposition. Laissons au lé-gislateur le droit entier à la définition de la loi, et ne chargeonspas un aréopage de juges d’une tâche qu’il appréhenderaitd’une manière peu propre à donner plus de sérénité à notredémocratie. Je rappelle que les juges sont élus – M. Frick adéveloppé cet élément tout à l’heure, je n’y reviendrai pas.En donnant ce droit au Tribunal fédéral, il est possible qu’onsatisfasse le juriste, mais nous commettrions d’abord unefaute politique, car la capacité de décider de la loi doit resterau législateur élu par le peuple qui garde alors le dernier mot.En concluant, pouvons-nous nous demander quels avanta-ges nous pourrions tirer d’une modification de la dispositionactuelle, car pour changer, il faut en retirer un certain béné-fice. Nous n’en voyons décidément aucun. Combien de fois,au cours des deux dernières décennies, aurions-nous tiréavantage d’un recours possible et d’une décision contraire duTribunal fédéral concernant notre appareil législatif? Nousavons discerné quelques exemples, mais si discutables qu’ilsn’emportent pas notre conviction.Gardons donc notre droit constitutionnel actuel. Il a au moinsle poids de la clarté, de l’histoire et de la légitimité du peuple.
Bloetzer Peter (C, VS): Ich ersuche Sie, der Mehrheit derKommission zuzustimmen.Wenn ich auch Verständnis für die Minderheit habe, die mitder Zuständigkeit des Bundesgerichtes in der Normenkon-trolle Probleme hat, so muss ich doch sagen, dass aus demVerständnis unseres Rechtsstaates heraus die gegenwärtigeSituation auf die Dauer nicht befriedigen kann. Ich kommedeshalb zum Schluss, dass wir die Normenkontrolle im Rah-men der Justizreform einführen müssen.Heute ist es doch in der Tat so, dass ein Bürger keineRechtsinstanz hat, an die er sich wenden kann, wenn er sichin seinen verfassungsmässigen Rechten durch Bundesge-setze verletzt fühlt. Wenn der Verfassunggeber – das Volkund die Stände – Verfassungsrecht festschreibt und das Par-lament auf der Basis dieses Verfassungsrechtes so legife-riert, dass ein Gesetz dem Verfassungsrecht widerspricht –was zugegebenermassen vielleicht nie oder sehr selten vor-kommt –, hat der Bürger heute keine Instanz, die ihm zumRecht verhilft. Das ist auf Dauer nicht befriedigend.Es ist eben nicht so, wie Herr Frick sagt, dass das Volk in derSchweiz das letzte Wort hat. Vielmehr hat der Verfassungge-ber – das Volk und die Stände – das letzte Wort. Auch wennman als Parlamentarier das Recht behalten möchte, authen-tisch zu interpretieren und souverän festzulegen, wie Verfas-sungsrecht anzuwenden ist, so ist es eben doch so, dass esuns gut ansteht, wenn wir unsere Art, die Verfassung umzu-setzen, durch eine unabhängige Instanz überprüfen lassen.Heute stellen wir fest, dass das Vertrauen des Bürgers in diepolitischen Instanzen gerade auch auf eidgenössischerEbene im Schwinden begriffen ist. Wir alle wissen, was derBürger zu sagen pflegt: Wir können als Verfassunggeber ent-
Constitution fédérale. Réforme 110 E 5 mars 1998
Bulletin officiel de l’Assemblée fédérale / Tiré à part
scheiden, was wir wollen, «die da oben in Bern» machen jadoch, was sie wollen.Deshalb glaube ich, dass wir gut beraten sind, die vorge-schlagene akzessorische Normenkontrolle einzuführen,auch wenn es uns in unserem Stolz vielleicht ein wenig be-rühren könnte. Denn damit können die Bundesbehörden undunsere Institutionen nur an Vertrauenswürdigkeit gewinnen.Das wird letztlich die Handlungsfähigkeit unseres Staatesstärken, auf die wir angewiesen sind.Ich ersuche Sie deshalb, der Mehrheit zuzustimmen.
Schmid Carlo (C, AI): Der Präsident der Kommission hatheute morgen in seinem Eintretensreferat ausgeführt, Kern-stück der Verbesserung des Rechtsschutzes sei zweifellosder Ausbau der Verfassungsgerichtsbarkeit; das sagte HerrRhinow. Ich möchte eigentlich sagen, Kernstück der Vernich-tung der Volksrechte ist zweifellos der Ausbau der Verfas-sungsgerichtsbarkeit.Es stellt sich daher die Frage, ob es eine Antinomie zwischendem Recht der Bürger einerseits und den Volksrechten ande-rerseits gibt. Darauf werde ich zurückkommen. Ich unter-stütze den Antrag der Minderheit, denn er ist aus meinerSicht das einzig Vertretbare. Den Entwurf des Bundesratesund den Antrag der Mehrheit kann ich nicht mittragen.Ich meine, es gibt zunächst eine Antinomie zwischen Verfas-sungsgerichtsbarkeit und Volksrecht. Ich bin keineswegs derAuffassung, dass die Verfassungsgerichtsbarkeit per se einDing der Unmöglichkeit sei. Wenn ein Volk meint, es gebe inseinem Land eine kleine Zahl von Leuten, denen es zutraut,die Verfassung zu hüten, dann ist dies das gute Recht diesesVolkes. Das setzt aber auf alle Fälle voraus, dass diese Ver-fassungshüter Mandatare des Volkes in seiner Eigenschaftals Verfassungsgeber sind und den Auftrag haben, die vomVolk erlassene Verfassung gegen Gesetze zu verteidigen,die eben nicht vom Volk, sondern nur von seinen Abgeordne-ten erlassen worden sind. Verfassungsgerichtsbarkeit ist da-mit ein Element im System der Gewichtsverteilung, der«checks and balances» im parlamentarischen System. Diefür vier Jahre gewählten und während dieser Zeit praktischkeiner weiteren Aufsicht unterstellten Volksvertreter haben inihren Handlungen eine Freiheit, welche eigentlich nur undausschliesslich durch ein Verfassungsgericht begrenzt undüberwacht werden kann. In einem solchen Kontext hat dieVerfassungsgerichtsbarkeit durchaus ihren Sinn.In unserem Verfassungskontext, wo es eben um Gesetzegeht, die nicht vom Parlament, sondern auf dem Weg des fa-kultativen Referendums – und sei es nur in der Form desNichtergreifens desselben – vom Volk erlassen werden, isteine Antinomie zwischen dem Gesetzgeber, nämlich demVolk, und dem Verfassungshüter, nämlich dem Richter, einefatale Konstruktion, eine absolut fatale Konstruktion.Sie ist deswegen fatal, weil in extremis das Volk sich in Op-position zu seinen Richtern befindet oder die Richter in Op-position zum Volke sind. Ich meine, die Vorstellung, dassvom Volk erlassene Gesetze direkt oder indirekt von vomVolk gewählten Richtern geschützt werden, ist schizophren.Nun verkenne ich nicht – damit eröffne ich einen Exkurs inden Bereich des Föderalismus –, Herr Bloetzer, dass derVerfassungsgeber das Volk und die Stände sind und dassder Gesetzgeber in der Schweiz «nur» das Volk ist. Ich ver-kenne auch nicht, dass gerade die kleinen Kantone unterdem besonderen Schutze dieser Art des Föderalismus ste-hen, indem sie nämlich den Schutz des Ständemehrerforder-nisses beim Erlass von Verfassungsrecht geniessen.Trotzdem muss ich sagen: Die Vorstellung, dass drei, fünf odersieben Personen einen Volksentscheid beurteilen wollen, istfür mich – nicht als Föderalist, sondern als Demokrat – schlichtunakzeptabel. Mit der Einführung der Verfassungsgerichts-barkeit wird die direkte Demokratie zu einer Farce. Volksent-scheide haben nur dann eine Bedeutung, wenn sie endgültigsind. Demokratie als Form der massgeblichen Partizipationdes Volkes an der Gestaltung seines Staates lässt sich nur so-lange aufrechterhalten, als sie nicht zum Spiel degradiert wird,als das Volk mit seinem Urnenverhalten tatsächlich endgültigEntscheide fixieren kann. Unter dem Vorbehalt eines Ge-
richtsentscheides an die Urne zu gehen ist für einen mündigenSchweizer Demokraten keine Perspektive.Noch einmal zurück zum Föderalismus: Es ist auch bemerktworden, Herr Wicki, dass wir mit dem Verfassungsgericht mitBezug auf die Kassation oder auf die Beurteilung von kanto-nalen Entscheiden und kantonalen Volksentscheiden guteErfahrungen gemacht hätten. Wenn das Bundesgericht einekantonale Abstimmung kassiert, dann kassiert es auch eineVolksabstimmung, aber das geht meines Erachtens deswe-gen an, weil ein Kanton nicht das Recht hat, übergeordnetesBundesrecht, an dessen Entstehung er mit seinem Volk auchbeteiligt gewesen ist, zu verletzen. Dass sich aber der Sou-verän der obersten Staatsebene von einem Organ der glei-chen obersten Staatsebene kassieren lässt, ist aberrant, istuntragbar.Was ist hier die Lösung? Ich meine, dass wir effektiv der Min-derheit folgen müssen. Wenn Sie der Mehrheit folgen, dannmüssen Sie ehrlicherweise die Systematik durchziehen. Esgibt ehrlicherweise nur eine Alternative: Entweder will mandie Verfassungsgerichtsbarkeit, oder man will die direkte De-mokratie, die Volksrechte. Wer die Verfassungsgerichtsbar-keit will, muss den Parlamentarismus einführen und mussehrlich dazu stehen, dass die Volksrechte ausgedient haben.Alles andere ist Augenwischerei. Das ist die Antinomie zwi-schen Verfassungsgerichtsbarkeit und Volksrechten, die An-tinomie zwischen Verfassungsgerichtsbarkeit und der Frei-heit.Herr Bundesrat Koller hat in der Einleitung bereits gesagt,dass sich rund 2500 Schweizer Bürgerinnen und SchweizerBürger zu dieser Frage positiv geäussert hätten. Man habesich für die Stärkung des Rechtsschutzes ausgesprochen.Ich will nicht polemisch sein, aber ich gehe natürlich davonaus – Herr Rhinow lacht! –, (Zwischenruf Rhinow: Aller-dings!) dass es eine beschränkte Menge des Schweizervol-kes ist, die sich an dieser Umfrage beteiligt hat, die aber na-türlich in bestimmter Weise daran interessiert war. Hier steheich nun nicht an, diese Antinomie zwischen Individualrechtenund Volksrechten einmal in der vollen Schärfe darzustellen;diese besteht.Zwar stimmt es, dass es Freiheit ohne Volksrechte undVolksrechte ohne Freiheit nicht geben kann. Es gibt hier einGleichgewicht, das nicht prästabiliert, sondern immer wiederzu suchen ist. Und ich meine, im Moment seien die Volks-rechte im Verhältnis zu den Freiheitsrechten eher zu schüt-zen. Eigennutz geht heute nicht nur in der Wirtschaft, son-dern insgesamt vor Gemeinnutz. Und ich will Ihnen nicht ver-schweigen, dass bei allem Verständnis für den Rechtsschutzdie Überlastung des Bundesgerichtes, von der wir in dieserVorlage ebenfalls reden, ein deutliches Zeichen dafür ist,dass der Bürger und die Bürgerin ein sehr poussiertes Ver-hältnis zu den eigenen Interessen haben.Herr Bloetzer, wenn Sie sagen, der Bürger müsse irgendwoeine oberste Instanz haben – ja, mein Gott, was gibt es dennHöheres als das Volk selbst? Die Idee, gegen einen Volks-entscheid noch irgendwo antreten zu können, ist etwas, wo-für ich von meiner Herkunft her schlicht kein Verständnishabe. Es geht schon um die Frage, die Herr Frick gestellt hat,nämlich darum, wer denn in der Schweiz das Sagen hat. Sindes die politischen, souveränen Instanzen, oder sind es einigeEinzelpersonen, die in ihrer Konstituierung als Gericht ebendoch nicht mehr als zwei, drei oder vier Personen sind?Damit komme ich zum dritten Teil, und das ist die Frage derPolitisierung der Gerichte. Was ist verfassungsmässig rich-tig, und was ist verfassungsmässig falsch? Wir politisierenso, als ob es darauf ganz klare Antworten gäbe, als ob dieVerfassung ein mathematisches Formelbuch wäre, das manhervorziehen und mit welchem man auf eine bestimmte ge-stellte Frage eine klare Antwort geben könnte. Das ist einefalsche Vorstellung von der Verfassung!Es mag klare Verfassungsentscheide geben, und in der Re-gel sind sie auch klar. Aber dort, wo sie sich in einer Grau-zone befinden, da ist Politik angesagt. Und ich will Ihnen ei-nes sagen: Es wird nicht möglich sein, Verfassungsgerichts-barkeit so zu praktizieren, dass sie einem akademischen Se-minar gleicht. Es wird immer eine politische Präferenz hinter
5. März 1998 S 111 Bundesverfassung. Reform
Amtliches Bulletin der Bundesversammlung / Separatdruck
einem Urteil stehen. Denn in diesen wichtigen Fragen wirdeben Politik betrieben, und letztlich leidet heute daran aus-drücklich und ausgesprochen das deutsche Verfassungsge-richt nach drei, vier unglückseligen Entscheiden.Verfassungsgerichtsbarkeit ist die in der Regel gut ausge-hende, glücklicherweise selten schlecht ausgehende, in derSubstanz aber immer juristische Verbrämung eines politi-schen Entscheides. Ich meine, das sollten wir ehrlicherweiseauch akzeptieren. Wenn wir also die Verfassungsgerichts-barkeit wollen, müssen wir dem Volk reinen Wein einschen-ken und sagen: Du hast ausgespielt, Du kannst alle vierJahre den National- und Ständerat wählen, aber damit hat essich.Machen wir nicht den gleichen Fehler, wie ihn der Bund voretwa fünfundzwanzig Jahren gemacht hat, als er der EMRKbeitrat, ohne dem Volk zu sagen, welche Wirkungen damitverbunden sind! Ich bin nicht gegen die EMRK, sie ist in derGarantie der Freiheitsrechte unübertroffen. Aber dieseEMRK hat innenpolitisch und staatspolitisch Änderungen be-wirkt, die man dem Schweizervolk hätte bekanntgeben müs-sen, nämlich dass das Volk letzten Endes nicht mehr souve-rän ist. Das unterlassen zu haben ist eine der Wurzeln desMisstrauens. Perpetuieren wir dieses Misstrauen nicht, in-dem wir ein Verfassungsgericht einführen, ohne dem Volkklar zu sagen, dass es damit in Sachentscheidungen, in Ge-setzes- und in Verfassungsentscheidungen politisch abdan-ken muss!Weil ich das nicht will, bin ich deshalb der Auffassung, dassder Minderheit zuzustimmen ist. Wenn Sie das nicht tun, bitteich Sie, dann bei der Vorlage der Volksrechte entsprechendrestriktiv zu sein.
Schiesser Fritz (R, GL): Gerade die letzten Äusserungenvon Herrn Schmid haben mich doch etwas überrascht, undzwar deshalb, weil sie von einem Vertreter eines kleinen Kan-tons kommen. Herr Schmid hat diese Problematik angespro-chen; ich muss offen gestehen, dass ich überrascht bin, dassder Widerstand gegen die Einführung der konkreten Normen-kontrolle beim Bundesgericht vor allem von Vertretern vonkleinen Kantonen kommt.Ich meine, die entscheidende Frage habe in diesem Ratheute morgen ein Nichtjurist gestellt; es war Herr Bloetzer. Erhat gefragt, wer denn eigentlich das letzte Wort in diesemLande habe. Das letzte Wort in diesem Lande, hat Herr Bloet-zer ganz einfach dargelegt, habe der Verfassunggeber. Waswir bis jetzt gehört haben, geht an dieser Feststellung vorbei.Was wir bis jetzt gehört haben, geht davon aus, dass wir indiesem Lande eine Volkssouveränität haben, die keine Gren-zen kennt. Das kann nicht richtig sein. Ich möchte auf einigeArgumente eingehen, die gefallen sind:Herr Schmid Carlo hat von einer Antinomie zwischen der Ver-fassungsgerichtsbarkeit und den Volksrechten und von einerfatalen Konstruktion der Normenkontrolle gesprochen. HerrSchmid, es liegt keine Antinomie zwischen Verfassungsge-richtsbarkeit und Volksrechten vor. Wenn eine Antinomie be-steht, dann ist es eine Antinomie zwischen Demokratie undRechtsstaat, die Verfassungsgerichtsbarkeit ist nur Instru-ment und Ausdruck des Rechtsstaates. Wir müssen uns dar-über klar werden, wo diese Antinomie besteht und ob dieVolksrechte derart schrankenlos sind, dass der Rechtsstaatund – in der sich hier stellenden Frage – die Durchsetzungder Verfassung grundsätzlich zu weichen hätten.Ich nenne ein Beispiel: Das Bundesgericht hat gegenüberden Kantonen verschiedentlich dargelegt, dass ein unter-schiedliches Pensionierungsalter verfassungswidrig sei. Wirhaben auf Bundesebene genau das, was das Bundesgerichtals Verfassungsgericht gegenüber den Kantonen als unzu-lässig bezeichnet hat. Was haben wir hier? Wir haben einenpolitischen Entscheid, weil wir uns nicht dazu haben durch-ringen können, die Verfassung auf Bundesebene durchzu-setzen. Dieses Beispiel zeigt mir klar, dass wir unter demSchutze der heutigen Artikel 113 und 114bis der Bundesver-fassung Kompromisse schliessen, die offenbar mit dem In-halt der Verfassung nicht vereinbar sind. Es ist ja schon selt-sam, dass in diesem Lande zweierlei Recht gelten soll, je
nachdem, ob kantonales oder eidgenössisches Recht inFrage steht, und dass eidgenössisches Recht nur deshalbgelten kann, weil es unter dem Schutze der Bestimmungsteht, dass das Bundesgericht Bundesgesetze grundsätzlichnicht überprüfen darf. Es tut es ja trotzdem, nämlich im Hin-blick auf die Vereinbarkeit mit der Europäischen Menschen-rechtskonvention. Das kann doch auf die Dauer kein Rechts-zustand sein.Herr Schmid, Sie haben von Schizophrenie gesprochen, undzwar in dem Sinne, dass vom Volke erlassene Gesetze vonRichtern überprüft würden. Wir haben das im Fall der kanto-nalen Erlasse; Sie haben es erwähnt. Kantonale Gesetze,auch wenn sie von einer Landsgemeinde erlassen werden,werden vom Bundesgericht überprüft. Natürlich haben wirdort insofern einen anderen Fall, als geprüft wird, ob ein Er-lass mit übergeordnetem Recht in Übereinstimmung steht.Aber in Ihrem Bild, wonach das Volk Gesetze erlasse und da-mit gleichsam sage, es habe die Verfassungsmässigkeit ein-für allemal festgestellt, kommt meines Erachtens die völligidealistische Vorstellung zum Ausdruck, jede Stimmbürgerinund jeder Stimmbürger setze sich zu Hause hin, nehme dieVerfassung hervor und schaue, ob das, worüber jetzt zu ent-scheiden sei, mit der Verfassung übereinstimme oder nicht.Wenn das Volk einen Entscheid mittels eines Referendumsfällt, fällt es einen politischen Entscheid und keinen Ent-scheid unter dem Aspekt der Verfassungsmässigkeit – oderdoch nur in höchst seltenen Fällen. Was ist, wenn das Refe-rendum nicht ergriffen wird? Geht man dann von der Vorstel-lung aus, das Volk habe stillschweigend die Verfassungs-mässigkeit dieses Gesetzes, zu dem das Referendum nichtergriffen wird, abgesegnet? Davon können wir doch nichtausgehen! Wenn man diese Vorstellung in die Welt setzt, wä-ren unsere Stimmbürgerinnen und Stimmbürger zu Hauseständig damit beschäftigt, nach unserer Schlussabstimmungjeweils zu prüfen, ob das, was die Bundesversammlung er-lassen hat, verfassungsmässig ist oder nicht.Es ist einfach so, dass in unserem Land auf Bundesebeneletztlich die Bundesversammlung – das sind also wir selber –darüber entscheidet, ob etwas verfassungsmässig ist odernicht. In den acht Jahren, welche ich jetzt diesem Rat ange-höre, habe ich feststellen müssen, dass wir ab und zu Zweifelgehabt haben, ob das, was wir erlassen, auch wirklich verfas-sungsmässig sei.Man kann nicht sagen, dass es für die Bundesversammlungnicht angängig wäre, wenn sich nun ein Verfassungsgerichtim Anwendungsfall – nicht abstrakt – zu dieser Frage äus-sern könnte. Es müsste dann seine Meinung nicht indirektzum Ausdruck bringen, über die Kassierung eines kantona-len Gesetzes, und so klarmachen, dass die gleiche Lösung,die auf Bundesebene getroffen worden ist, eigentlich verfas-sungswidrig ist.Zum Argument der Politisierung der Gerichte: Sie haben ge-sagt, es gebe nicht immer eine klare Antwort auf die Frage,was verfassungsmässig sei und was nicht. Da muss ich Ih-nen recht geben. Wir haben keinen Subsumtionsmechanis-mus, auch auf Verfassungsstufe nicht, das gibt es nicht.Auch die Verfassung lässt einen entsprechenden Spielraumoffen. Es darf davon ausgegangen werden, dass wir ein Ver-fassungsgericht haben, das verantwortungsbewusst handeltund die Verfassungswidrigkeit nur dann feststellt, wenn sieaus der Verfassung ableitbar und begründbar ist.Schliesslich noch ein Letztes – ich habe das bereits einlei-tend gesagt – zur Volkssouveränität: Wenn wir die Verfas-sungsgerichtsbarkeit einführen, müssten wir dem Volk sa-gen, es habe als oberste Behörde in unserem Land abge-dankt, heisst es. Diese Behauptung geht schon etwas weit.Erstens bleibt das Volk, zusammen mit den Ständen, souve-rän in bezug auf Änderungen der Verfassung, die für dasBundesgericht bindend sind, und zweitens gibt es auf derStufe des Gesetzes in unserem Staat keine schrankenloseVolkssouveränität. Dort kennen auch wir den Grundsatz derRechtsstaatlichkeit. Zwischen diesen Grundsätzen – Demo-kratie und Rechtsstaat – ist ein Gleichgewicht zu finden; dieVerfassungsgerichtsbarkeit ist ein Instrument, um diesesGleichgewicht herzustellen.
Constitution fédérale. Réforme 112 E 5 mars 1998
Bulletin officiel de l’Assemblée fédérale / Tiré à part
Vor langer Zeit habe ich mich mit diesen Fragen der konkre-ten Normenkontrolle sehr intensiv befasst. Ich habe mich –vielleicht war das eine Jugendsünde – glühend für die Einfüh-rung der konkreten Normenkontrolle ausgesprochen. Ich binetwas gesetzter geworden und kein so glühender Verfechterder konkreten Normenkontrolle mehr, aber eines habe ichgesehen: Es braucht in diesem Staat auf Bundesebene diesekonkrete Normenkontrolle, wenn wir ein Gleichgewicht zwi-schen Demokratie und Rechtsstaat einführen wollen, unddas möchte ich mit dieser Verfassungsgerichtsbarkeit. Ichbitte Sie, Artikel 178, der eine sehr zurückhaltende Form derVerfassungsgerichtsbarkeit bringt, zuzustimmen.In einem Punkt bin ich mit Herrn Frick einverstanden. Auf Ge-setzesebene, im Bundesrechtspflegegesetz, dessen Revi-sion noch aussteht, müssten wir gewisse institutionelle Ga-rantien einführen, damit nicht jede Kammer des Bundesge-richtes konkrete Normenkontrolle ausüben kann. Hier wärenÜberlegungen anzustellen, welcher Spruchkörper die kon-krete Normenkontrolle zu behandeln hat. Hier lassen sich an-gemessene institutionelle Vorkehrungen treffen.Ich bin dafür zu haben, aber ich bitte Sie, einen Grundsatz-entscheid zu fällen und diese konkrete Normenkontrolle nach120 Jahren Diskussion in unserem Lande nun endlich einzu-führen!
Frick Bruno (C, SZ): Nur eine kurze Erwiderung zur Ausein-andersetzung, wie die Einheitlichkeit der Rechtsordnung ge-schaffen werden soll.Wir dürfen nie vergessen, dass alle Punkte, bei denen auchwir uns die Frage gestellt haben, ob eine Regelung noch ver-fassungsmässig sei oder nicht, hochpolitische Fragen betra-fen. Denken Sie an die Steuergesetzgebung, an die Abgabenallgemein; denken Sie auch an die AHV, an das AHV-Alter.Das sind alles hochpolitische Fragen, die wohl einen rechtli-chen Hintergrund haben: beide betreffen die Gleichstellung.Aber nach einer intensiven Diskussion haben das Parlamentund nachher das Volk die Frage beantwortet. Wenn wir dieVerfassungsgerichtsbarkeit einführen – auch wenn mansagt, es geschehe auf zurückhaltende Art; sie ist in der Tatzurückhaltender, als wenn jedes Gesetz von vornhereinüberprüft werden könnte –, bleibt immer das Problem, dassdas Bundesgericht über hochsensible politische Bereicheentscheiden muss. Den Entscheid über Fragen, die auch wiruns gestellt haben – ist es verfassungsmässig, sind es politi-sche Entscheide? –, übertragen wir dem Bundesgericht.Wenn das Bundesgericht beispielsweise zum Schlusskommt, das AHV-Alter 64/65 widerspreche dem Grundsatzder Rechtsgleichheit, würde das AHV-Gesetz mit allen finan-ziellen Konsequenzen für den Bund im Einzelfall ausser Kraftgesetzt werden müssen, weil es ja einen individuellen An-spruch des Bürgers begründet. Diesen politischen Entscheidmüssen politische Instanzen treffen und nicht der Richter.
Gemperli Paul (C, SG): Die Frage, die zur Diskussion steht,ist zweifellos eine schwierige Frage. Wir sind im Spannungs-feld zwischen der absoluten Anerkennung von Volksrechtenauf der einen und dem Rechtsstaat auf der anderen Seite.Ich muss Ihnen sagen, dass ich persönlich im Laufe meinerpolitischen Tätigkeit hier einen Wandel durchgemacht habe.Ich glaube, ich wäre, als ich mein Amt in der sanktgallischenKantonsregierung antrat, noch voll auf der Linie von HerrnSchmid Carlo gestanden. Damals war ich auch ein absoluterVerfechter der Volkssouveränität, und mir haben sich immeretwas die Nackenhaare gesträubt, wenn man von einemAusbau des sogenannten Richterstaates gesprochen hat.Aber ich glaube, die Zeiten haben sich etwas geändert. Vorallem müssen wir auch sehen, welche Lösung jetzt konkretvorgeschlagen wird, um zu einer gerechten Beurteilung derAngelegenheit zu kommen. Ich glaube, man spürt heute weit-herum, dass das Prinzip der Volkssouveränität auch nicht einabsolutes Prinzip sein kann, das allen anderen Gütern vor-geht. Auch die Herstellung der Gerechtigkeit in einem Staat,bestehend auf den jetzigen gesetzlichen Grundlagen, ist einewichtige Voraussetzung für den Rechtsfrieden unter denMenschen, die in einem Lande zusammenleben müssen.
Es sind vor allem auch zwei ganz konkrete Beispiele aus mei-ner Tätigkeit gewesen, die bei mir einen Sinneswandel be-wirkt haben. Der eine Fall ist bereits von Herrn Schiesser er-wähnt worden. Es ging um die Frage des Rentenalters vonMann und Frau. Das Bundesgericht hat in Überprüfung kan-tonaler Gesetze klar festgehalten, dass das Rentenaltergleich angesetzt werden müsse. Herr Frick, das Bundesge-richt hat nicht von 63, 64 oder 65 Jahren gesprochen, son-dern festgehalten, dass hier ein Gleichheitsgrundsatz be-stehe, der für beide Geschlechter die Pensionierung im glei-chen Alter verlange. Das Gericht hat also nicht einen konkre-ten politischen Entscheid bezüglich des Rentenalters gefällt.Man hat einen Grundsatz festgelegt, und das ist natürlich et-was völlig anderes. Man hat nicht in politisch hochsensibleBereiche eingegriffen, sondern die detaillierte Ausgestaltungwieder der Demokratie übertragen. Die Demokratie hat dannentscheiden können, welches Alter sie hier will. Gerade hierzeigt sich doch typisch, dass wir nicht einfach eine ganze de-mokratische Ordnung ausser Kraft setzen, wenn gewisseGrundsätze vom Bundesgericht festgelegt werden.Nicht die Demokratie leidet, weil ja wieder der Gesetzgebergefordert ist. Mit der akzessorischen Kontrolle wird ja ein Ge-setz auch nicht einfach aufgehoben, sondern das Bundesge-richt sagt, dass die bestehende Ordnung verbessert werdenmüsse. Das ist auch betreffend des Entscheides eine andereQualität.Ein anderer Fall war die Ehegattenbesteuerung. Bei der Ehe-gattenbesteuerung hat das Bundesgericht im Bereich derKantone festgelegt, dass Konkubinatspaare und Ehepaareim wesentlichen nicht unterschiedlich besteuert werden dür-fen. Die Kantone mussten das so durchziehen. Auch hier hataber das Bundesgericht den Entscheid in einem Einzelfallgetroffen. Die Kantone hatten nachher ein breites Feld vonGestaltungsmöglichkeiten. Das Bundesgericht hat nicht einGesetz gemacht, sondern das Bundesgericht hat den Kanto-nen den Spielraum gegeben, hier gesetzgeberisch tätig zuwerden.Beim Bund ist die Gesetzgebung anders gelaufen. Ich haltees für untragbar, wenn wir in einem Staat plötzlich zweiRechtsebenen haben: eine Ebene, die das Bundesgericht imBereich der kantonalen Gesetzgebung als verfassungskon-form bezeichnet, und eine andere Ebene beim Bund, die –gemessen an den Grundsatzentscheiden des Bundesgerich-tes – nicht mehr verfassungskonform ist. Meines Erachtenskann es in einem Staat auf die Dauer nicht gutgehen, wennwir hingehen und zwei unterschiedliche Rechtsordnungenschaffen, die sich angeblich beide auf das gleiche Grundge-setz abstützen. So kann man mit der Gerechtigkeit in einemStaat nicht umgehen.Nun können Sie sagen: Wir übertragen Funktionen – HerrSchmid Carlo, ich verstehe das –, die sonst demokratisch ge-fasst werden, auf ein Gericht. Wenn Sie hier die konkreteAusgestaltung nehmen, wie sie im Antrag enthalten ist, dannstellen Sie fest, dass es ein sehr zurückhaltender Antrag ist,der den Gerichten nicht einfach «plein pouvoir» in jeder Rich-tung gibt. Ich würde nie zustimmen, wenn Sie eine abstrakteNormenkontrolle einführen möchten. Ich möchte nicht, dassman in diesem Rat jedesmal, wenn wir ein Gesetz verab-schieden, sagt: Wir gehen dann noch nach Lausanne, umden politischen Entscheid überprüfen zu lassen. Das kannalso nur im Einzelfall getan werden.Gestützt auf diese Erfahrung bin ich persönlich ein Vertreterder Meinung der Mehrheit und schliesse mich dieser über-zeugt an.Die Volksrechte haben nicht ausgedient, wenn sie sich imRahmen einer Rechtsordnung bewegen müssen. Man sagtvielmehr, dass «Gerechtigkeit ein Volk erhöht», Herr Schmid.Die beantragte Regelung bringt mehr Gerechtigkeit und istdaher meines Erachtens auch nicht gegen das Volk gerich-tet.
Schiesser Fritz (R, GL): Das Schöne in diesem Rat ist ja,dass wir die Möglichkeit zu Replik und Duplik haben. Deshalbmöchte ich auf das zweite Votum von Herrn Frick nochmalskurz eingehen.
5. März 1998 S 113 Bundesverfassung. Reform
Amtliches Bulletin der Bundesversammlung / Separatdruck
Ich nehme nochmals das Beispiel des Rentenalters. Das wardoch ein politischer Kompromiss, den wir hier geschlossenhaben, von dem wir wussten, dass er unter verfassungsmäs-sigen Aspekten nicht haltbar wäre. Wir haben das Urteil desBundesgerichtes auf kantonaler Ebene gekannt, und wir hat-ten als Parlament nicht den Mut, auch die verfassungsmäs-sige Komponente einzubeziehen, sondern haben das aufden Sankt-Nimmerleins-Tag verschoben. Dieses Beispielzeigt doch eklatant, dass wir in derartigen Bereichen diegrundlegenden Entscheide in der Verfassung, die von Volkund Ständen gefasst worden sind, beiseite schieben, nur weilwir wissen, dass unser Entscheid keine Konsequenzen hat.Das kann in einem Rechtsstaat nicht angehen!Zu den Urteilen des Bundesgerichts: Das Bundesgerichtbzw. das Verfassungsgericht sagt in keinem Urteil, eine Re-gelung müsste so oder so sein. Es stellt fest, was im Rah-men der Verfassung nicht mehr Platz hat. Alsdann ist es Sa-che der politischen Behörden, eine Lösung innerhalb diesesRahmens zu suchen. Es ist also nicht so, dass sich das Bun-desgericht als Verfassungsgericht an die Stelle der politi-schen Entscheidungsinstanzen setzt. Das kommt auch inAbsatz 3 ganz klar zum Ausdruck. Hier wird ausdrücklichvorbehalten, dass das Bundesgericht sich darauf berufenkann, dass die Frage, welche Regelung verfassungsmässigsei, eine politische Frage und deshalb nicht von ihm zu be-antworten sei.Noch ein letzter Punkt: Wir als Parlament sind Wahlorgan derBundesrichterinnen und Bundesrichter. Vielleicht schadet esnichts, wenn wir zur Kenntnis nehmen müssen, dass wir beidiesen Wahlen in Zukunft noch etwas genauer hinschauenmüssen, weil das Bundesgericht eine zusätzliche Kompetenzerhält und wir uns noch vermehrt mit der Auswahl der Rich-terinnen und Richter befassen müssen.Ich bitte Sie also nochmals, dieser sehr moderaten Lösungzuzustimmen und dann im Rahmen des Gesetzes noch all-fällige institutionelle Lösungen vorzusehen.
Rhinow René (R, BL), Berichterstatter: Die Schweiz ist eineDemokratie, und sie ist mit ihren Volksrechten sogar eineganz besondere Demokratie. Sie ist aber auch ein Bundes-staat und ein Rechtsstaat, dessen vornehmste Aufgaben derSchutz der Freiheit der Bürger und Bürgerinnen und derSchutz von Minderheiten in diesem Lande sind. Das tönt ansich sehr selbstverständlich, ist es aber, wie mir nach denFanfarenstössen einiger Vorredner scheint, offenbar dochnicht so ganz. Ich möchte deshalb versuchen, einige wesent-liche Argumente für die Fassung der Mehrheit und des Bun-desrates nochmals zu rekapitulieren.Ich bin, wie Herr Schiesser, etwas erstaunt, dass in einigenVoten, vor allem aber im Votum von Herrn Schmid, eine Deu-tung unserer Demokratie durchgeschimmert ist, die vielleichtmehr mit der Vergangenheit – wenn ich ihn provozierenmöchte, würde ich sagen: mit veraltetem Lehrbuchwissen –als mit der real gelebten Demokratie des 20. Jahrhunderts zutun hat.Die Verfassungsgerichtsbarkeit will nämlich alle drei Prinzi-pien, die für uns grundlegend sind, alle drei Leitwerte unsererhelvetischen Gemeinschaft, schützen und bewahren. Sie willdem Gesetzgeber – ja, dem Gesetzgeber! – gewisse Schran-ken setzen, wenn er gegen diese drei Grundpfeiler unsererGemeinschaft im Einzelfall verstossen sollte.Verfassungsgerichtsbarkeit ist systemwahrend; sie ist Ver-vollkommnung unserer Staatsideen, die eben nicht nur ausder Demokratie, und schon gar nicht etwa aus dem Parla-mentarismus bestehen, sondern auch aus Bundesstaatlich-keit, Rechtsstaatlichkeit und – hier weniger wichtig – auchaus der Sozialstaatlichkeit.Was heisst dies nun im einzelnen? Verfassungsgerichtsbar-keit schützt einmal die Bundesstaatlichkeit und die kantonaleAutonomie. Ich darf an das anknüpfen, was Herr Bloetzerund Herr Gemperli gesagt haben: Oberste Gewalt unseresLandes ist und bleibt der Verfassunggeber. Der Verfassung-geber besteht aus Parlament, Volk und Ständen. Sie sindund bleiben Verfassunggeber, nicht das Bundesgericht. Esist mir völlig unverständlich, dass man sagen kann, mit der
Einführung der Verfassungsgerichtsbarkeit werde das Bun-desgericht zum obersten Organ, es hätte damit das letzteWort. Es ist – wenn wir diese problematische Wendung ge-brauchen wollen – immer noch der Verfassunggeber, der dasletzte Wort hat. Denn Verfassungsgerichtsbarkeit heisst nichtÜberprüfung der Verfassung, sondern Überprüfung der Ge-setzgebung auf die verfassungsmässigen Rechte hin.Wir schützen also einen Grundpfeiler, der im Ständemehrzum Ausdruck kommt. Ich kann schon von daher nicht ver-stehen, dass es auch Vertreter der Kantone und ehemaligeRegierungsräte sind, die sich gegen die Verfassungsge-richtsbarkeit zur Wehr setzen – Anhänger des Ständemehrs.Denn es geht hier um den Schutz dieses Ständemehrs, weilder Gesetzgeber mit dem einfachen, fakultativen Referen-dum gegen dieses Ständemehr verstossen kann, und er hatdies auch schon getan.Die Verfassungsgerichtsbarkeit schützt auch die Demokratie;sie schützt die Volksrechte, Herr Schmid, weil das Volk imRahmen der Verfassungsgebung obligatorisch zum Zugekommt, während es bei der Gesetzgebung nur fakultativ undin der Regel faktisch nicht zum Zuge kommt. Wir wissen,dass die grosse Mehrzahl der Gesetze angenommen wer-den, ohne dass das fakultative Referendum ergriffen wird. Esist schon etwas gar krasse Theorie zu meinen, das Volk habejeden Paragraphen und jeden Artikel ausdrücklich gebilligt,ja, es habe sogar deren Verfassungsmässigkeit geprüft undbejaht, wenn das Referendum nicht ergriffen wird. Das mageine staatsrechtlich abstrakte Konstruktion sein, aber es isteben trotzdem eine demokratiefremde, lebensfremde Kon-struktion, die man nicht heranziehen darf, um später Frei-heitsanliegen hintanzustellen und zu vernachlässigen. DieVerfassungsgerichtsbarkeit schützt also den Bundesstaat,und sie schützt das Volk, wie es sich obligatorisch geäusserthat.Mit der konkreten Normenkontrolle wahren wir aber auch dieAutonomie der Kantone. Ich möchte das nochmals deutlichunterstreichen. Ich kann nicht verstehen, wenn Vertreter derKantone diesen Aspekt so geringschätzen. Heute kann sichdoch der Bundesgesetzgeber über die in der Bundesverfas-sung gewährleistete Kantonsautonomie hinwegsetzen. DieKantone haben kein Rechtsmittel, um sich gegen den Bun-desgesetzgeber zu wehren. Sie müssen kuschen, wenn derBundesgesetzgeber in ihre Autonomie eingreift. Umgekehrtkann aber der Bund die Kantone einklagen, wenn diese ihrenAutonomiebereich verlassen und insofern Bundesrecht ver-letzen sollten. Das ist doch aus föderalistischer Sicht ein un-erträglicher Zustand. Wollen Sie denn diesen Widerspruchzu Lasten der Kantone hinnehmen? Wollen Sie den Kanto-nen, Ihren Leuten, erklären, lieber möchten Sie dem Bundes-gesetzgeber den Vorrang zur Einschränkung der kantonalenAutonomie belassen, als dass Sie sich für die Autonomie derKantone einsetzten? Das kann ich schlicht und einfach nichtverstehen.Ein weiterer Grund für die vorgeschlagene Regelung liegtdarin, dass nach der neueren, korrekten bundesgerichtlichenPraxis die Kontrolle von Bundesgesetzen für Grundrechtepraktisch bereits eingeführt worden ist. Es ist gesagt wor-den – auch von Herrn Bundesrat Koller anlässlich der Eintre-tensdebatte –: Das Bundesgericht überprüft heute Bundes-gesetze im Anwendungsfall auf ihre Übereinstimmung mitder EMRK, d. h. mit den dort verankerten Freiheitsrechten.Diese Praxis ist korrekt; sie ist vor allem deshalb korrekt, weilArtikel 113 Absatz 3 der geltenden Bundesverfassung ebennicht nur von der Massgeblichkeit der Bundesgesetzespricht, die für das Gericht wegleitend ist, sondern auch vonder Massgeblichkeit der Staatsverträge. Beide Begriffe fin-den sich in Absatz 3 von Artikel 113. Wenn ich es richtig ver-standen habe, hat dies niemand kritisiert. Was soll denn nundie Ablehnung einer ehrlichen, offenen Verankerung derkonkreten Normenkontrolle, die diese Praxis ausdrücklichbejaht und aufnimmt? Ich frage mich: Geht es denn hier umeinen symbolischen Protestakt? Soll im Rahmen der Justiz-reform das Rad sogar zurückgedreht werden? Seien wirdoch ehrlich! Betreiben wir kein Schattenboxen, und gehenwir nicht hinter die Verfassungswirklichkeit zurück.
Constitution fédérale. Réforme 114 E 5 mars 1998
Bulletin officiel de l’Assemblée fédérale / Tiré à part
Es gibt aber heute in der Tat eine Lücke, die mit der neuenLösung geschlossen werden könnte. Die EMRK enthält ei-nen Katalog von Grundrechten, aber es fehlen in diesem Ka-talog namentlich zwei: die Wirtschaftsfreiheit und die Eigen-tumsgarantie. Was heisst das im Klartext? Es heisst, dass mitder geltenden Regelung die anderen Grundrechte besser ge-schützt sind als Wirtschaftsfreiheit und Eigentumsgarantie.Wenn Sie die konkrete Normenkontrolle ablehnen, dann be-jahen Sie gleichzeitig einen ungleichen Grundrechtsschutzgegenüber dem Bundesgesetzgeber, eine Konsequenz, diezumindest aus liberaler Sicht doch schlichtweg nicht hinge-nommen werden kann, eine Konsequenz, die dem integralenFreiheitsschutz diametral entgegensteht. Wollen Sie dasdenn wirklich?Wir halten in unserem Land die Demokratie hoch, und zwarzu Recht. Aber dann müssen wir auch bereit sein, den obli-gatorisch geäusserten Volkswillen im Rahmen der Verfas-sungsgebung zu schützen. Wir halten in unserem Land denFöderalismus und den Stellenwert der Kantone hoch, auchzu Recht. Dann müssen wir aber auch bereit sein, das Stän-demehr vor dem einfachen Volksmehr und die kantonale Au-tonomie vor Übergriffen des Bundesgesetzgebers zu schüt-zen. Wir halten die Freiheitsrechte in unserem Land hoch,nochmals: zu Recht! Dann müssen wir aber auch bereit sein,die Rechtsentwicklung unter der Geltung der EMRK anzuer-kennen und den individuellen Rechtsschutz auf alle verfas-sungsmässigen Rechte auszudehnen. Herr Schmid, es isteben eine leidvolle geschichtliche Erfahrung, dass der Frei-heitsschutz gerade nicht allein dem politischen Gesetzgeberüberlassen werden darf, sondern es gerade hierfür des unab-hängigen Richters bedarf. Sie haben – wie andere Rednerauch – von der Verpolitisierung der Justiz gesprochen. Ja,diese Tendenz besteht in der Tat! Aber gerade weil sie be-steht, weil wir unseren Sozialstaat ausgebaut haben, weil wirzum Gesetzgebungsstaat, zum Verwaltungsstaat gewordensind, haben wir auch den Richterstaat und damit die Verpoli-tisierung der Justiz gefördert. Gerade deshalb erscheint derFreiheitsschutz um so wichtiger, und es ist falsch, in diesemZusammenhang von der Verpolitisierung der Justiz zu spre-chen, wenn es um den besseren Schutz der Individualrechteder Bürger und Menschen geht.Es ist gesagt worden, es gehe hier um ein Juristenanliegen,noch schlimmer: um ein intellektuelles Anliegen. Das ist einetwas fauler Vorwurf! Es geht um Menschenrechte, um denSchutz des Föderalismus, um den Schutz des Volkes. Das istdoch kein reines Juristenanliegen!Es geht aber auch nicht um eine schiefe Gegenüberstellungvon Gesetzgeber und Gericht und schon gar nicht um eineschiefe Gegenüberstellung von Volk und Gericht. Es geht –ich wiederhole es – um den elementaren Schutz von Men-schenrechten und um Anliegen von Minderheiten gegenüberden politischen Mehrheiten. Das ist ein Kernelement desRechtsstaates!Es ist für mich eine verhängnisvolle Fehldeutung unsererStaatsidee, wenn Demokratie über Bundesstaat und Rechts-staat gestellt wird. Demokratie – ob eine parlamentarischeoder eine halbdirekte –, Freiheit und Föderalismus bedingensich in der Schweiz gegenseitig, sie sind zusammen mit derSozialstaatlichkeit unverzichtbare Grundpfeiler unserer Ge-meinschaft. Ohne Demokratie keine Freiheit, aber auch:ohne Freiheit keine Demokratie. Es ist nicht gleichgültig, wiesich das Volk äussert, wie der Meinungsprozess ausgestaltetist. Es ist nicht einfach die nackte Volksmehrheit, die über al-les entscheiden kann, sonst müssten wir in letzter Konse-quenz die Tyrannei der Mehrheit anerkennen. Das wollen wirin unserem Staat nicht, und das haben wir auch nie getan. Esgibt keine Allmacht des Gesetzgebers – das muss ich allensagen, die das so gesagt oder angedeutet haben –, das wäre«Rousseau pur», aber «Rousseau pur» hat nicht Eingang inunsere Verfassung gefunden!Wenn es Ihnen ein Anliegen ist, die Grundpfeiler unseres Ge-meinwesens, die Demokratie, den Föderalismus und vor al-lem auch den Freiheitsschutz wirklich voranzutreiben undrichtig zu gewährleisten, dann sollten Sie dieser konkretenNormenkontrolle zustimmen!
Wicki Franz (C, LU), Berichterstatter: Herr Rhinow hat dieganze Situation nochmals ganz klar dargelegt; es erübrigtsich, hier noch auf die einzelnen Voten einzugehen.Ich möchte zum Abschluss noch eine persönliche Bemer-kung machen: Als ich das erste Mal hörte, die Verfassungs-gerichtsbarkeit werde nun bei uns eingeführt – ich war da-mals noch nicht im Parlament –, kam bei mir eine spontaneReaktion, die in dieselbe Richtung ging wie jene der KollegenFrick und Schmid Carlo. Das rote Licht – Stopp, Volkssouve-ränität! – leuchtete auch bei mir auf. Nachdem ich jedoch dieVorlage des Bundesrates, so wie sie uns heute vorliegt, rich-tig angeschaut hatte, gelangte ich zur Überzeugung, dassdiese massvolle Möglichkeit der Überprüfung der Bundesge-setze richtig ist. Unsere Volkssouveränität wird in ihrenGrundfesten nicht erschüttert. Herr Schiesser hat es richtiggesagt: Auf der Stufe der Gesetze gibt es keine absoluteSouveränität. Das Volk hat sich eine Verfassung gegeben,und es ist nicht mehr als konsequent, dass diese Verfassungmassgebend ist und angewendet werden soll.Herr Schmid, der die Volkssouveränität heraufbeschwört,geht meines Erachtens von einer Fiktion aus. Er hat die Fik-tion, dass das Volk bei jeder Abstimmung, bei jedem Gesetz,das ihm vorgelegt wird, jeden Buchstaben ansieht und sichdann überlegt, ob das mit der Verfassung übereinstimmt.Das geht an der Realität vorbei. Das Volk hat einmal die Ver-fassung angenommen, und das Volk will, dass diese Verfas-sung angewendet wird, bis es selbst sie wieder ändert.Darum scheint es mir richtig, wenn Sie der Fassung derMehrheit zustimmen. Diese sehr beschränkte Verfassungs-gerichtsbarkeit können wir einführen; sie steht auch uns, demStaate Schweiz, gut an.
Koller Arnold, Bundesrat: Zunächst möchte ich Ihnen fürdiese wertvolle und nötige Diskussion ganz herzlich danken,denn es ist offensichtlich, dass Sie einen ganz wichtigenstaatspolitischen Entscheid zu treffen haben. Ich möchteauch von Anfang an zugestehen, dass tatsächlich ein Span-nungsverhältnis zwischen direkter Demokratie und Verfas-sungsgerichtsbarkeit bzw. Freiheitsschutz besteht und dasses nach Meinung des Bundesrates darum geht, dieses Span-nungsverhältnis zu einem möglichst optimalen Ausgleich zubringen. Für den Bundesrat waren die positiven Erfahrungenganz entscheidend, die wir mit der Verfassungsgerichtsbar-keit gegenüber den Kantonen gemacht haben. Diesbezüglichdürfen wir es uns im Widerstreit zwischen direkter Demokra-tie und Verfassungsgerichtsbarkeit bzw. Freiheitsschutzauch nicht zu einfach machen.Es ist doch wirklich so: Die Verfassungsgerichtsbarkeit ge-genüber den Kantonen, die wir seit 1874 in einem viel weitergehenden Ausmasse kennen, als wir sie jetzt gegenüber denBundesgesetzen einführen wollen, war für die Schweiz eineWohltat; das kann niemand bestreiten. Hätten wir diese Ver-fassungsgerichtsbarkeit gegenüber den Kantonen nicht ge-habt, wäre es in den letzten hundert Jahren um die Freiheitunserer Bürgerinnen und Bürger viel schlechter bestellt ge-wesen. Wenn Sie an alle diese Entscheide zum Schutz derHandels- und Gewerbefreiheit und anderer Freiheitsrechtedenken, die sich nur wegen des Umstandes durchgesetzt ha-ben, dass wir gegenüber kantonalen Erlassen und Rechtsan-wendungsakten über eine umfassende Verfassungsgerichts-barkeit verfügen, dann müssen wir doch den Schluss ziehen,dass diese hundertjährige Erfahrung zeigt, dass sich die Ver-fassungsgerichtsbarkeit hier in unserem Land zum Wohleunserer Bürgerinnen und Bürger ausgewirkt hat, dass sieden Freiheitsschutz in unserem Land ganz wesentlich ver-bessert hat. Deshalb kann ich den Gedankengängen, die vorallem von den Herren Frick und Schmid vorgetragen wordensind, wonach Verfassungsgerichtsbarkeit zu einer Vernich-tung der direkten Demokratie führe, nicht folgen. Ich will auchnicht polemisch werden, mein lieber Landsmann Schmid,aber ich war 33 Jahre stolzer Bürger des Souveräns in Ap-penzell. Ich hatte nie das Gefühl, dass ich in meiner Volks-souveränität als Gesetzgeber an der Landsgemeinde einge-schränkt war, weil diese Gesetze nachher der Verfassungs-gerichtsbarkeit des Bundes unterstanden. Dieses Gefühl
5. März 1998 S 115 Bundesverfassung. Reform
Amtliches Bulletin der Bundesversammlung / Separatdruck
hatte ich nie, denn es ist ja glücklicherweise so, dass die mei-sten Verletzungen der Verfassung dem Gesetzgeber unge-wollt passieren. Es ist glücklicherweise sehr selten, dass derGesetzgeber bewusst eine Verfassungsverletzung begeht.Aber die Anwendung unserer Gesetze – sowohl der kantona-len wie der Bundesgesetze – zeigt dann im konkreten Fall,dass man irgendeinen Gesichtspunkt nicht berücksichtigt hatund ungewollt in die Freiheitsrechte der Bürgerinnen undBürger eingegriffen hat.Es sind die positiven Erfahrungen mit der Verfassungsge-richtsbarkeit gegenüber den Kantonen, die den Bundesratzur Einsicht gebracht haben, dass diese Form von Verfas-sungsgerichtsbarkeit jetzt, gut hundert Jahre später – ichkomme darauf zurück –, zum Schutze der Freiheiten unsererBürger auch auf Bundesebene eingeführt werden muss. Da-bei war für uns von allem Anfang an klar, dass es angesichtsdieses Spannungsverhältnisses, das Sie aufgezeigt haben,sehr wichtig ist, welches System von Verfassungsgerichts-barkeit wir schliesslich wählen. Wir haben darauf relativ vielgeistige Anstrengung verwendet.Neben diesem zentralen Argument des Freiheitsschutzes derBürgerinnen und Bürger spielen auch andere Überlegungeneine Rolle. Sie sind genannt worden, namentlich die äusserstproblematische Lage im Bereich der Europäischen Men-schenrechtskonvention. Es ist doch für einen Staat höchst un-befriedigend, wenn das Bundesgericht die Übereinstimmungder Bundesgesetze mit der Verfassung bzw. mit der Europäi-schen Menschenrechtskonvention nicht prüfen kann und dieStrassburger Organe uns dann sagen, wir müssten Bundes-gesetze ändern.Wir haben das in einem konkreten Fall erlebt, beim Wieder-verheiratungsverbot gemäss Artikel 150 ZGB, wo bei Ehe-bruch vorgeschrieben ist, der Richter müsse ein Wiederver-heiratungsverbot von einem bis drei Jahren Dauer ausspre-chen. Dagegen wurde von einem betroffenen Bürger geklagt.Das Bundesgericht konnte wegen des geltenden Artikels 113der Bundesverfassung nicht Stellung nehmen; es hat wei-testgehend eine reine Durchlauffunktion erfüllt. Die Strass-burger Organe haben dann gesagt, dieses Wiederverheira-tungsverbot von drei Jahren vertrage sich nicht mit der Ehe-freiheit, wie sie in der Europäischen Menschenrechtskonven-tion garantiert ist.Nun wissen wir doch, dass die Menschenrechte in unsererVerfassung und in der Europäischen Menschenrechtskon-vention weitgehend übereinstimmen. Aber der Massstab, deranzuwenden ist, ist immer die Europäische Menschenrechts-konvention und nicht unsere eigene Verfassung. Das Bun-desgericht ist dann so weit gegangen, weil es diesen Wider-spruch so intensiv empfunden hat, dass es in sehr extensiverAuslegung dieses Artikels sagte, es könne ihm nicht verbo-ten sein, Bundesgesetze auf ihre Übereinstimmung mit derEMRK zu überprüfen; es habe zwar keine Entscheidungs-kompetenz wie die Strassburger Organe, aber immerhin einePrüfungsbefugnis.Sie sehen, auch das ist in einem ganz zentralen staatlichenBereich eine äusserst unbefriedigende Rechtslage.Es kommt – vor allem Herr Rhinow hat darauf hingewiesen –auch noch die föderalistische Begründung hinzu. Es ist in ei-nem wohlverstandenen Föderalismus schwer verständlich zumachen, dass der Bund zwar Kompetenzüberschreitungender Kantone sanktionieren kann, wie er das heute tun kann,dass sich die Kantone aber gegen Kompetenzüberschreitun-gen des Bundes nicht wehren können. Das verträgt sich nichtmit meinem Föderalismusverständnis, und deshalb wollenwir im Sinne dieser Verfassungsgerichtsbarkeit den Kanto-nen die Möglichkeit geben, Kompetenzüberschreitungen desBundesgesetzgebers kontrollieren zu lassen.Nun war für den Bundesrat allerdings von Anfang an sehrklar, dass angesichts dieses Spannungsverhältnisses dieWahl des Verfassungsgerichtsbarkeitssystems eine sehrzentrale Frage ist. Uns war von Anfang an klar, dass eineVerfassungsgerichtsbarkeit, wie sie etwa Deutschland oderdie Vereinigten Staaten – also rein parlamentarische bzw.präsidiale Systeme – haben, für uns nicht die adäquate Lö-sung ist. Denn Sie wissen es: In Deutschland gibt es eine ab-
strakte Normenkontrolle, und das deutsche Verfassungsge-richtsgesetz schreibt sogar vor, dass das Verfassungsgerichtdie verfassungswidrigen Gesetze als nichtig erklären muss.Das wäre in einem System der direkten Demokratie zweifel-los sehr problematisch.Deshalb haben wir uns eben um ein ganz anderes Systembemüht. Einmal soll die Verfassungsmässigkeit nur im kon-kreten Anwendungsfall überprüft werden können und nichtabstrakt oder präventiv wie in Deutschland, Italien oderFrankreich; da haben wir bewusst auf unser politisches Sy-stem Rücksicht genommen. Zuständig soll, im Sinne einesKonzentrationssystems, allein das Bundesgericht sein undnicht irgendeine richterliche Behörde. Und schliesslich – dasist wohl die wichtigste Anpassung – haben wir in bezug aufdie Sanktion in Artikel 178 Absatz 3 die weitestmögliche Fle-xibilität vorgesehen. Es kann keine Rede davon sein, dasswir hier die Richter an die Stelle des Gesetzgebers setzen,sondern was wir vorsehen, ist einzig, dass z. B. das Wieder-verheiratungsverbot in einem konkreten Fall nicht angewen-det wird. Überall dort, wo aber der Gesetzgeber Ermessens-spielraum hat, also überall dort, wo es um politische Ent-scheidungen geht, wird das Bundesgericht lediglich ein soge-nanntes Appellurteil erlassen. Das heisst, das Bundesgerichtwird feststellen, dass eine gesetzliche Regelung mit der Ver-fassung nicht in Übereinstimmung ist, und es wird den Ge-setzgeber auffordern, den verfassungsmässigen Zustandwiederherzustellen.Dass wir diesbezüglich keine Ängste haben müssen, zeigt diebisherige Erfahrung in bezug auf kantonale Gesetze: Bei denrelativ vielen Entscheiden, die das Bundesgericht z. B. gegen-über kantonalen Steuergesetzen getroffen hat, hat es ja keineeigene gesetzliche oder richterliche Regelung an die Stelle ei-nes verfassungsmässig problematischen kantonalen Steuer-gesetzes gesetzt. Vielmehr hat es bloss die Verfassungsver-letzung festgestellt und den Gesetzgeber aufgefordert, sei-nerseits einen verfassungsmässigen Zustand herzustellen.Hier haben wir einen hundertjährigen Beweis guter, vernünf-tiger richterlicher Zurückhaltung, und da müssen wir dochnicht davor Angst haben, dass sich das Bundesgericht nunplötzlich zum Gesetzgeber oder – wie gesagt worden ist – zurobersten politischen Behörde aufschwingt.Der Bundesrat ist überzeugt, dass wir mit diesem schweize-rischen System von konkreter Normenkontrolle und mit die-ser weitestgehenden Flexibilität in bezug auf die Sanktionenrichtig liegen. Wir haben in der Botschaft ganz klar gesagt,dass sogar die sogenannte Schubert-Praxis weitergeführtwerden kann, also die Beachtung eines bewussten Abwei-chens des Gesetzgebers von einer völkerrechtlichen Rege-lung.Der Bundesrat ist überzeugt, dass es Zeit ist, Demokratie undRechtsstaatlichkeit und vor allem den Freiheitsschutz derBürger bei uns wiederum zu einem optimalen Ausgleich zubringen. Vor 150 Jahren hat man die Verfassungsgerichts-barkeit den Kantonen gegenüber eingeführt, weil die Kan-tone damals das Sagen hatten. Jetzt, mit all den neuen Kom-petenzbegründungen, die der Bund realisiert hat, ist natürlichein ungeheures Konfliktpotential im Sinne von Eingriffen indie Freiheitsrechte der Bürgerinnen und Bürger entstanden.Deshalb ist die Zeit reif, dass wir dieses sehr vorsichtige Mo-dell der konkreten Normenkontrolle auch bei uns einführen.Noch ein letztes Wort: Ich begreife, dass man die Verfas-sungsgerichtsbarkeit im Namen des Volkes bekämpft. Aberletztlich geht es bei der Verfassungsgerichtsbarkeit vor allemum die Kontrolle des Parlamentes. Das müssen wir dochganz offen sagen; denn gegen wenige Gesetze wird das Re-ferendum ergriffen. Man kann nun sagen, man könnte das fa-kultative Referendum ergreifen. Aber wie ich schon ausge-führt habe: Die Verfassungswidrigkeiten werden am Anfangoft gar nicht erkannt, sondern sie manifestieren sich meistenserst bei der konkreten Anwendung der Gesetze.Deshalb bin ich überzeugt, dass das Volk selber im Sinnedes Schutzes seiner Freiheiten, wie man das vor mehr alshundert Jahren gegenüber den Kantonen gemacht hat, eineminentes Interesse an der Einführung dieser Verfassungs-gerichtsbarkeit hat. Es sind seine Freiheitsrechte, die der
Constitution fédérale. Réforme 116 E 5 mars 1998
Bulletin officiel de l’Assemblée fédérale / Tiré à part
Verfassunggeber in der Verfassung festlegt, und das ma-chen wir jetzt mit einem ausführlichen Katalog in der nachge-führten Verfassung. Es geht darum, die Freiheitsrechte desVolkes gegenüber dem Staat, auch gegenüber dem einfa-chen Gesetzgeber, zu stärken. Denn unser System bestehtnatürlich nicht nur aus dem Mehrheitsprinzip, sondern es be-steht wesentlich auch aus individuellem Freiheitsschutz. Ver-fassungsrecht beruht auf dem Entscheid von Volk und Stän-den, und den können wir nur sichern, wenn wir hier zu die-sem neuen Artikel, zu dieser vorsichtigen Form von Verfas-sungsgerichtsbarkeit, ja sagen.
Abstimmung – VoteFür den Antrag der Mehrheit 19 StimmenFür den Antrag der Minderheit 14 Stimmen
Art. 178aNeuer Antrag der KommissionAbs. 1, 2StreichenAbs. 1bisDas Gesetz gewährleistet den Zugang zum Bundesgericht.Abs. 2bisFür Streitigkeiten, die keine Rechtsfrage von grundsätzlicherBedeutung aufwerfen, kann es besondere Zugangsvoraus-setzungen vorsehen.Abs. 3.... von Bundesgesetzen mit der Bundesverfassung oderdem Völkerrecht.
Art. 178aNouvelle proposition de la commissionAl. 1, 2BifferAl. 1bisLa loi garantit l’accès au Tribunal fédéral.Al. 2bisElle peut prévoir des conditions d’accès particulières pour lescontestations qui ne soulèvent aucune question juridique deprincipe.Al. 3.... sur la constitutionnalité de lois fédérales avec la constitu-tion ou le droit international est cependant réservé.
Präsident: Hier liegt ein neuer Antrag der Verfassungskom-mission vor. Der Minderheitsantrag zu Artikel 178a Absatz1bis ist zurückgezogen worden.
Wicki Franz (C, LU), Berichterstatter: Bei Artikel 178a («Zu-gang zum Bundesgericht») geht es um die Frage, wie der Zu-gang zum Bundesgericht festgelegt werden soll und welchesdie Beschränkungen sein sollen. Zum Grundsätzlichen habeich mich bereits beim Eintreten geäussert. Hier ist darauf hin-zuweisen, dass wir nun eine tragfähige Lösung gefunden ha-ben. Wie Sie wissen, hat der Bundesrat Ende 1997 das neueBundesgerichtsgesetz in Vernehmlassung gegeben; EndeJanuar 1998 ist die Vernehmlassungsfrist abgelaufen. DieErgebnisse der Vernehmlassung haben die unterschiedli-chen Auffassungen betreffend die Zulassungsbeschränkun-gen weiter akzentuiert. Von seiten der SP und der Grünenwurde die Zugangsbeschränkung für aussichtslose und of-fenkundig unbegründete Beschwerden, die von der stände-rätlichen Kommission vorgeschlagen wurde, abgelehnt.Das hat noch einmal zu einer Diskussion zwischen den Ex-ponenten der Mehrheit und der Minderheit geführt; darannahmen auch Vertreter des Bundesgerichtes in Lausanneund solche des Versicherungsgerichtes in Luzern teil.Schliesslich zeichnete sich eine Lösung auf der Basis derKonzeption ab, welche die Mehrheit unserer Verfassungs-kommission erarbeitet hatte, jedoch mit Einschränkungen.Ihre Kommission hat nun die Formulierung, wie sie Ihnen aufeinem besonderen Blatt vorliegt, einstimmig gutgeheissen.Sie ersehen daraus, dass Kollege Aeby seinen Minderheits-antrag zurückgezogen hat.
In Absatz 1bis ist festgehalten, dass das Gesetz den Zugangzum Bundesgericht gewährleistet. Die Formulierung stellt soeine formelle wie auch eine materielle Aussage dar: Sie be-inhaltet einen Auftrag an den Gesetzgeber, den Zugang zumBundesgericht grundsätzlich sicherzustellen.In Absatz 2bis werden die Ausnahmen geregelt: Wir gehenvom Konzept der Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeu-tung aus, formulieren diesen Grundsatz aber negativ, indemwir sagen: «Für Streitigkeiten, die keine Rechtsfrage vongrundsätzlicher Bedeutung aufwerfen, kann es (das Gesetz)besondere Zugangsvoraussetzungen vorsehen.» Ihre Kom-mission ist der Meinung, es solle Aufgabe des Gesetzgeberssein, im Bundesgerichtsgesetz jene Kategorien von Fällenaufzulisten, die nicht von grundsätzlicher Bedeutung sindund bei denen sinnvollerweise Zugangsbeschränkungenmöglich sein sollen. Damit bleiben sämtliche Optionen aufder Ebene des Bundesgesetzes offen. In der Gesetzgebungkann ein mehrheitsfähiger Kompromiss ausdiskutiert undverabschiedet werden.Absatz 3 gibt dem Gesetzgeber die Befugnis, den Zugang fürbestimmte Sachgebiete zu beschränken. Dies war bereits inder Vernehmlassung weitgehend unbestritten und ist heuteeigentlich schon geltendes Recht.Ohne dass nämlich die Voraussetzungen gemäss Absatz2bis gegeben sind, können bestimmte Sachgebiete von derbundesgerichtlichen Beurteilung ausgenommen und eineranderen Instanz zur endgültigen Entscheidung zugewiesenwerden. Es kann sich hier also auch um Fälle mit Rechtsfra-gen von grundsätzlicher Bedeutung handeln. Um auch in die-sen vom Zugang an das Bundesgericht ausgenommenen Ma-terien die einheitliche Rechtsanwendung zu gewährleisten,wird in Absatz 3 ein Vorlageverfahren vorgesehen. Darunterwird ein Verfahren verstanden, das unterinstanzliche Richterdazu berechtigt bzw. verpflichtet, bestimmte Rechtsfragen,die sich in einem hängigen Prozess stellen, dem obersten Ge-richt zum Entscheid zu unterbreiten. Dadurch, dass die Ver-fassung hier ein solches Vorlageverfahren vorsieht, wirdgleichzeitig ein gewisses Korrektiv zum Ausschluss der Be-schwerde an das Bundesgericht eingebracht, indem das Bun-desgericht eben doch nicht vollständig ausgeklammert wird.
Aeby Pierre (S, FR): Je voudrais expliquer dans quels senti-ments la proposition de minorité a été retirée. Il me paraît es-sentiel de dire certaines choses dans ce débat.Le projet C sera vraisemblablement le premier projet de ré-forme soumis en votation populaire. Il est important, pourtous les partisans de cette réforme, que cela soit une réus-site. Dans ce sens, vous le savez, il y a eu une opposition as-sez nette, dès le départ, entre les partisans d’un accès aussilarge que possible au Tribunal fédéral et les partisans d’unaccès plutôt restreint, motif pris que le Tribunal fédéral estdéjà surchargé. Les divergences n’ont pas pu être éliminées,dans un premier temps, et ce n’est que dernièrement qu’unesolution de compromis a été trouvée.Je tiens à dire ici que la solution de compromis satisfait tousceux qui sont pour un large accès au Tribunal fédéral. L’arti-cle 1bis de cette proposition pose le principe de la garantiede cet accès. Quant à l’article 2bis, il permet, c’est vrai, deprévoir des conditions particulières, je dis bien particulières,et non pas des conditions plus restrictives, la notion même deconditions plus restrictives ayant été clairement éliminéedans les travaux de commission. Il s’agit de «conditions d’ac-cès particulières», et «pour les contestations qui ne soulè-vent aucune question juridique de principe».Qu’entend-on par «question juridique de principe»? Ce seral’objet d’un autre débat. Nous avons en somme repoussé nosdivergences à la phase législative. Mais lorsque nous met-trons cet article en application, nous aurons certainementl’occasion d’en débattre, et les opinions seront très partagéesquant à ce qu’on entend par «question juridique de principe».Il n’en demeure pas moins que, dans cette phase de réformeconstitutionnelle, l’article 178a tel qu’il est proposé mainte-nant par la commission, sans opposition, peut être accepté.Je rappelle enfin qu’il est essentiel, dans des domainescomme le droit du travail, la protection de l’environnement,
5. März 1998 S 117 Bundesverfassung. Reform
Amtliches Bulletin der Bundesversammlung / Separatdruck
l’aménagement du territoire, la défense des droits sociaux etdes droits fondamentaux de l’individu, que l’accès à la plushaute cour de justice de notre pays soit toujours systémati-quement garanti. Il est exclu de laisser ces questions fonda-mentales se régler à l’échelon de la justice cantonale qui estpar trop diverse. Nous avons besoin en la matière d’une ju-risprudence sûre, fiable, et seul le Tribunal fédéral peut nousdonner cette garantie.
Koller Arnold, Bundesrat: Das ist zweifellos ein zweiter sehrwichtiger und zum Teil auch umstrittener Artikel in dieser Ju-stizreform.Ich kann vorweg festhalten: Ich bin froh, dass man jetzt in be-zug auf die Zugangsbeschränkungen einen Kompromiss ge-funden hat – wobei der Tag der Wahrheit noch kommen wird,wenn wir diesen Kompromiss dann in der OG-Revision kon-kretisieren müssen. Aber ich glaube, die Leitplanken, die wirhier auf Verfassungsstufe setzen, sind die richtigen. Einer-seits gewährleisten wir den Zugang zum Bundesgerichtgrundsätzlich – das hängt mit seiner Funktion zusammen;nur so kann das Bundesgericht als oberstes Gericht dieRechtseinheit wahren, die Rechtsfortbildung vorantreibenund auch den Rechtsschutz gewähren –, anderseits mussauch klar sein, dass ein oberstes Gericht nicht total offen seinkann. Das stellen wir schon in den Kantonen fest. Wir habenauch in den Kantonen gewisse Zugangsbeschränkungen vonder ersten zur zweiten Instanz, und zwar über Streitwertbe-stimmungen und anderes.Deshalb ist ganz klar: Wenn wir dieses Ziel der Entlastungder beiden Bundesgerichte auf der Stufe Gesetzgebungdann auch wirklich erreichen wollen, werden wir um gewisseZugangsbeschränkungen nicht herumkommen. Es wird danndarum gehen, sie möglichst geschickt zu wählen, und zwarsicher nicht in dem Sinn, wie man das leider bei einer frühe-ren OG-Revision einmal getan hat, dass man Arbeits- undMietstreitigkeiten mittels zu hoher Streitwertgrenzen weitge-hend vom Bundesgericht fernhalten wollte. Hier werden wirim Rahmen der OG-Revision noch sehr viel wichtige undschwierige Kleinarbeit zu leisten haben. Aber ich glaube, aufVerfassungsstufe sind die Leitplanken jetzt richtig gesetzt.
Angenommen – Adopté
Art. 179Anträge der Kommissionen: BBlPropositions des commissions: FF
Wicki Franz (C, LU), Berichterstatter: Bei Artikel 179 geht esum weitere richterliche Behörden des Bundes. Sie wissen es:Ein wichtiger Grundsatz des Konzeptes der Justizreform istder Ausbau der richterlichen Vorinstanzen des Bundesge-richtes. Solche fehlen auf Bundesebene derzeit in zwei Be-reichen: zum einen im Bereich der erstinstanzlichen Bundes-strafgerichtsbarkeit, die durch Bundesassisen ausgeübt wird,zum anderen im Bereich des Bundesverwaltungsrechtes, so-weit keine eidgenössischen Rekurs- oder Schiedskommis-sionen bestehen.Der neue Artikel 179 schliesst nun diese Lücken. GemässAbsatz 1 ist ein erstinstanzliches Bundesstrafgericht zu er-richten. Es hat die Fälle zu beurteilen, welche das Gesetz derStrafgerichtsbarkeit des Bundes zuweist. Hier haben wir alsoetwas echt Neues. Die erstinstanzliche Bundesstrafgerichts-barkeit soll ausschliesslich durch dieses neue Bundesstraf-gericht wahrgenommen werden. Die Bundesassisen, welchenach der geltenden Verfassung die in Artikel 112 der gelten-den Verfassung aufgelisteten Tatbestände beurteilen, sind inder Praxis weitgehend obsolet geworden. Die Bundesassi-sen traten in diesem Jahrhundert erst zweimal zusammen,nämlich 1927 und 1933. Sie erscheinen aus heutiger Sichtverzichtbar. Das Institut der Bundesassisen wird deshalb er-satzlos gestrichen.In Absatz 2 wird als Konsequenz der Entlastung des Bundes-rates und des Parlamentes im Bereich der Verwaltungs-rechtspflege der Grundsatz verankert, dass auf Bundesebenegenerell verwaltungsunabhängige Instanzen eingeführt wer-
den, bei welchen Akte der Bundesverwaltung anzufechtensind, bevor diese gegebenenfalls an das Bundes-gericht wei-tergezogen werden können. Ob es sich dabei um Rekurskom-missionen, um eine kleinere Zahl von Verwaltungsgerichtenmit sachlich oder örtlich beschränktem Zuständigkeitsbereichoder um ein einziges, allgemeines schweizerisches Bundes-verwaltungsgericht handeln wird, ist dann vom Gesetzgeberzu entscheiden. Die Verfassung stellt diesbezüglich nochkeine Weichen.Absatz 3 ist in doppelter Hinsicht von Bedeutung: Zum einenräumt dieser Absatz dem Gesetzgeber die Möglichkeit ein,allenfalls weitere – neue – richterliche Behörden des Bundesvorzusehen, etwa ein erstinstanzliches Bundeszivilgericht fürStreitigkeiten aus dem Immaterialgüterrecht. Zum anderendeckt dieser Absatz weitere – schon bestehende – richterli-che Behörden des Bundes verfassungsrechtlich ab, ohneihre Beibehaltung in der bisherigen Form vorzuschreiben.Darunter fallen namentlich auch die Militärgerichte.
Angenommen – Adopté
Art. 179aAnträge der Kommissionen: BBlPropositions des commissions: FF
Wicki Franz (C, LU), Berichterstatter: Die Bestimmung«Richterliche Behörden der Kantone» ist nötig, um die Prin-zipien der richterlichen Vorinstanzen des Bundesgerichtesund der allgemeinen Rechtsweggarantie – wie wir das heutebeschlossen haben – auch im Bereich verwirklichen zu kön-nen, der in die Zuständigkeit der Kantone fällt.Mit Artikel 179a Absatz 2 hat die Kommission des Ständera-tes eine Ergänzung angebracht. Sie heisst: «Sie (die Kan-tone) können gemeinsame richterliche Behörden einsetzen.»In der Kommission ist die Ansicht vertreten worden, dass wirmit dieser Bestimmung keine neue Kompetenz für die Kan-tone schaffen. Wir bestätigen damit eine bestehende Kompe-tenz und machen sie transparent. Gleichzeitig begrüssen wires aber, wenn die Kantone gemeinsam auf dem Gebiet derJustiz zusammengehen. Wir haben im übrigen bewusst denBegriff «richterliche Behörden» gewählt und nicht nur «Ge-richte», denn auch die Strafverfolgungsbehörden sollen miteinbezogen werden.
Koller Arnold, Bundesrat: Ich möchte doch klarmachen, dassda nicht ungeheure neue Aufgaben auf die Kantone zukom-men. Aufgrund der letzten Revision des Bundesrechtspflege-gesetzes, das wissen Sie, sind die Kantone gemässArtikel 98a bereits jetzt verpflichtet, für das Bundesverwal-tungsrecht richterliche Instanzen vorzusehen. Die diesbe-zügliche Übergangsfrist ist am 15. Februar 1997 abgelaufen.Es kommt nun noch die Verpflichtung dazu, das auch für daskantonale Verwaltungsrecht zu tun. Die meisten Kantone ha-ben aber bereits heute ausgebaute Verwaltungsgerichte. Eskommen also nicht übermässige Lasten auf die Kantone zu.Das wollte ich einfach noch betonen.
Angenommen – Adopté
Art. 180Anträge der Kommissionen: BBlPropositions des commissions: FF
Wicki Franz (C, LU), Berichterstatter: Artikel 180 («Richterli-che Unabhängigkeit»): Sie sehen, dass Ihre Kommissiondiese Bestimmung gestrichen hat. Mit der Streichung wurdenicht der Grundsatz der richterlichen Unabhängigkeit gestri-chen, denn in Artikel 26 Absatz 1 steht nämlich bereits:«Jede Person, deren Sache in einem gerichtlichen Verfahrenbeurteilt werden muss, hat Anspruch auf ein auf Gesetz be-ruhendes, zuständiges, unabhängiges und unparteiischesGericht ....»Weil wir dies bereits dort geregelt haben, beantragt Ihre Kom-mission mit 18 zu 2 Stimmen, auf Artikel 180 zu verzichten.
Constitution fédérale. Réforme 118 E 5 mars 1998
Bulletin officiel de l’Assemblée fédérale / Tiré à part
Koller Arnold, Bundesrat: Dass die richterliche Unabhängig-keit ein ganz zentrales rechtsstaatliches Prinzip von grössterBedeutung ist, wird hier sicher nicht bestritten. Wir erleben jagerade bei den osteuropäischen Staaten, wie schwierig esist, wieder unabhängige Richter zu etablieren, wenn diesesPrinzip einmal verlorengegangen ist.Das Prinzip gilt natürlich sowohl für die Gerichte des Bundesals auch für jene der Kantone. Wir haben dieses zentraleRechtsstaatsprinzip an zwei Orten kodifiziert: einerseits wiegesagt bei den Grundrechten, um die grundrechtliche Dimen-sion aufzuzeigen, und andererseits hier, um die organisati-onsrechtliche Komponente zu unterstreichen. Aber weil wiruns in der Sache einig sind, genügt es sicher, wenn man esbeim grundrechtlichen Artikel bewenden lässt.Ich kann daher der von der Kommission beantragten Strei-chung zustimmen.
Angenommen – Adopté
Ziff. II–V – Ch. II–VAnträge der Kommissionen: BBlPropositions des commissions: FF
Wicki Franz (C, LU), Berichterstatter: Zu den Ziffern II bis Vhabe ich keine Bemerkungen. Der Kommissionspräsidenthat in seinem Eintretensreferat darauf hingewiesen. DerWortlaut ist an sich klar.
Angenommen – Adopté
Gesamtabstimmung – Vote sur l’ensembleFür Annahme des Entwurfes 26 StimmenDagegen 1 Stimme
Die Beratung dieses Geschäftes wird unterbrochenLe débat sur cet objet est interrompu
9. März 1998 S 119 Bundesverfassung. Reform
Amtliches Bulletin der Bundesversammlung / Separatdruck
Fünfte Sitzung – Cinquième séance
Montag, 9. März 1998Lundi 9 mars 1998
17.15 h
Vorsitz – Présidence: Zimmerli Ulrich (V, BE)
___________________________________________________________
96.091
Bundesverfassung.ReformConstitution fédérale.Réforme
Fortsetzung – Suite
___________________________________________________________
A2. Bundesbeschluss über eine nachgeführte Bundes-verfassung (Art. 127–184)A2. Arrêté fédéral relatif à une mise à jour de la Consti-tution fédérale (art. 127–184)
Präsident: Ich schlage Ihnen vor, heute bis ungefähr 19 Uhrzu tagen und die Vorlage in der April-Sondersession fertig zuberaten. – Sie sind damit einverstanden.
Rhinow René (R, BL), Berichterstatter: Mit der Vorlage A2befinden wir uns wieder auf dem Boden der Nachführung.Wir behandeln den zweiten Teil der Bundesverfassung,nachdem wir am letzten Donnerstag bis und mit Artikel 126beraten haben. Bei der Vorlage A2 ist der Ständerat Zweitrat.Der Nationalrat hat diesen Teil der aktualisierten Verfassungin der Januarsession als Erstrat behandelt.Unsere Verfassungskommission hat deshalb an ihrer Sitzungvom 10. Februar 1998 ihren eigenen Entwurf, wie er anläss-lich der Medienkonferenz vom 28. November 1997 vorge-stellt worden ist, noch einmal anhand der vom Nationalrat be-schlossenen Texte überprüft, so, wie es den übereinstim-menden Beschlüssen der Büros der beiden Räte und denGepflogenheiten unseres Zweikammersystems entspricht.Leider ist die Verfassungskommission des Nationalratesnicht so vorgegangen. Sie präsentiert in der dritten Wochedieser Session die Vorlage A1, bei der wir bekanntlich Erstratsind, ohne Prüfung unserer Beschlüsse, nur gestützt auf ihreeigenen Anträge vom November 1997.Auf der Fahne finden Sie bei uns deshalb die Beschlüsse desNationalrates und unsere bereinigten Anträge vom 10. Fe-bruar 1998.Die Vorlage A2 umfasst insgesamt drei Titel: den 4. Titel«Volk und Stände», den 5. Titel «Die Bundesbehörden» undden 6. Titel «Revision der Bundesverfassung und Über-gangsbestimmungen».Auch hier sind die Titel jeweils in Kapitel und diese wiederumteilweise in Abschnitte gegliedert. Zu reden geben wird ins-besondere der 5. Titel über die Bundesbehörden, in dem dieMehrheit der Verfassungskommission und zum Teil auchMinderheiten einige Neuerungen vorschlagen.Ich werde es als Kommissionspräsident wie bei den übrigenReformvorlagen halten und vor jedem Titel einige allgemeineBemerkungen voranstellen. Herr Frick, Präsident der zustän-digen Subkommission, wird uns die einzelnen Artikel vorstel-len, soweit dies sinnvoll erscheint.Zum 4. Titel («Volk und Stände») ist von meiner Warte ausnicht viel vorauszuschicken. Sie finden hier vier kleinere Mo-difikationen zum bundesrätlichen Entwurf: einmal eine termi-
nologische Veränderung des Doppelbegriffs «Stimm- undWahlrecht» in den Terminus «Stimmrecht», wie wir dies be-reits in der Vorlage A1 beschlossen haben; die Aufnahme ei-nes Parteienartikels in Artikel 127a, analog zum Beschlussdes Nationalrates; dann die ausdrückliche Festlegung, dassdie Bundesversammlung eine Volksinitiative nicht nur ganz,sondern auch teilweise ungültig erklären kann. Ausserdemfinden Sie eine terminologische Anpassung an den neuenBegriff des Gesetzes, wie er von uns in Artikel 153a vorge-schlagen wird, und – damit einhergehend – die Streichungdes allgemeinverbindlichen Bundesbeschlusses.
Art. 127Anträge der Kommissionen: BBlPropositions des commissions: FF
Art. 127aAntrag der KommissionTitelPolitische ParteienWortlautZustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Art. 127aProposition de la commissionTitrePartis politiquesTexteAdhérer à la décision du Conseil national
Frick Bruno (C, SZ), Berichterstatter: Herr Rhinow hat Ihnenausgeführt, dass wir uns im 4. Titel («Volk und Stände») reinauf die Nachführung beschränkt haben. Ich kann daher auchmeine Ausführungen kurz halten, und wenn Sie damit einver-standen sind, werde ich jeweils zusammenhängende Artikelgemeinsam erläutern.Ich beginne mit dem 1. Kapitel («Stimm- und Wahlrecht»).Wir haben in Übereinstimmung mit dem Nationalrat den Titeldes Kapitels geändert. Er lautet nun «Allgemeine Bestim-mungen», weil nicht mehr nur Artikel 127, sondern neu auchArtikel 127a dazu gehört.Weiter haben wir bei Artikel 127 den Titel von «Stimm- undWahlrecht» zu «Stimmrecht» geändert. Warum? Stimmrechtist nach heutiger Auffassung der Oberbegriff zum Stimm- undWahlrecht allgemein. So haben wir es bereits in Artikel 32dnormiert, und wir sind hier konsequent.Ich erläutere gleichzeitig den mit Artikel 127 zusammenhän-genden Artikel 127a; er wurde vom Nationalrat eingefügt. Un-sere Verfassungskommission hatte in ihrer ersten Lesungnoch auf diesen Artikel verzichtet, in der zweiten haben wiruns dem Nationalrat einstimmig angeschlossen.Worum geht es? In Artikel 127a heisst es, dass die poli-tischen Parteien an der Meinungs- und Willensbildung desVolkes mitwirken. Nach unserer Auffassung ist das rein de-klaratorisch und die Nachführung der bereits heute gelebtenRechtswirklichkeit. Implizit geht auch die Verfassung davonaus, dass die Parteien an der Meinungs- und Willensbildungmitwirken, denn ohne Parteien gäbe es keine Proporzwahl,ohne Parteien wäre auch kaum eine Abstimmung – in derVorbereitung, d. h. im Abstimmungskampf – durchzufüh-ren.Wir haben lediglich den Titel geändert. Der Nationalratsprach allgemein von «Meinungs- und Willensbildung», wirhaben es auf den Inhalt beschränkt, auf politische Parteien.Warum?Die Kommission des Nationalrates hatte eine weitergehendeBestimmung vorgeschlagen als die schliesslich vom Rat be-schlossene. Wir haben nun den Titel auf den Inhalt be-schränkt und ihn deshalb mit «Politische Parteien» abge-deckt; wir machen also Inhalt und Titel kongruent.Ich bitte Sie, in beiden Artikeln unserer Kommission zu fol-gen.
Schmid Carlo (C, AI): Ich habe mit etwelcher Überraschungund etwelchem Erstaunen diese Bestimmung in Artikel 127a
Constitution fédérale. Réforme 120 E 9 mars 1998
Bulletin officiel de l’Assemblée fédérale / Tiré à part
zur Kenntnis genommen und mich ernsthaft gefragt, ob es imRahmen einer Nachführung sinnvoll sei, dass in der Verfas-sung dort, wo es namentlich um die Volksrechte geht und wosonst eigentlich nur Verfassungsorgane ihren Platz haben,nun plötzlich die politischen Parteien aufscheinen.Die politischen Parteien sind bis zum heutigen Tag in derVerfassung nicht enthalten. Ich sehe keinen Grund, warumman diese politischen Parteien heute verfassungsmässig ze-mentieren muss. Es stellt sich vor allem die Frage, ob es rich-tig ist, dass nur die politischen Parteien genannt sind; dennvöllig unabhängig vom aktuellen Zustand der politischen Par-teien ist in der Willensbildung insgesamt ein Trend dahinge-hend festzustellen, dass heute – weniger wirtschaftliche Ver-bände wie in den siebziger Jahren – immer mehr sogenannteNichtregierungsorganisationen, aber auch kirchliche, auchkulturelle, auch karitative Organisationen an der Willensbil-dung massgeblich beteiligt sind, so dass man sich die Fragestellen kann: Wenn schon die politischen Parteien wie gesagtihre Nennung erhalten sollen, warum denn nicht andereGruppierungen auch? Von daher gesehen meine ich, dassdiese Bestimmung nicht zu Ende gedacht sei, dass sie insbe-sondere auch keine Nachführung sei, sondern eine etwasmissglückte Neuschöpfung.Ich stelle Ihnen den Antrag – ich glaube, das darf man, auchwenn er nicht schriftlich vorliegt –, Artikel 127a aus den ge-nannten Gründen zu streichen.
Frick Bruno (C, SZ), Berichterstatter: Aus dem Votum vonHerrn Schmid sprechen einige Befürchtungen.Zum ersten das Argument, dass die neue Bestimmung überdie Nachführung hinausgehe: Sie ist bereits heute gelebteWirklichkeit, und ohne die Mitwirkung der Parteien wäre dasProportionalwahlrecht, das von der Verfassung vorgesehenist, kaum zu realisieren.Zum zweiten ist der Artikel an der richtigen Stelle. Weil wirvom Stimm- und Wahlrecht unserer Bürger sprechen, ist esauch richtig, dass wir unmittelbar anschliessend sagen, dassdie Parteien mitwirken. Herr Schmid befürchtet eine «Zemen-tierung» der heutigen politischen Parteien. In der Schweizgibt es seit dem Jahre 1848 politische Parteien. Wir gehendavon aus, dass es sie auch in den nächsten Jahrzehnten,vielleicht in veränderter Form, geben wird.Eine nicht geäusserte Befürchtung von Herrn Schmid, dieaber in der Kommission zu reden gegeben hat, ist folgende:Bildet diese Bestimmung längerfristig eine Grundlage für dieParteienfinanzierung? Man hat als Partei an der Meinungsbil-dung mitzuwirken und will folglich dafür entschädigt sein.Wenn schon das Kinderhaben entschädigt wird, soll neuauch die politische Mitwirkung unterstützt werden. Kann mandas gestützt auf diese Bestimmung geltend machen? DieKommission ist klar der Auffassung, dass diese Bestimmungkeine Finanzierungsgrundlage darstellt.Der letzte Satz: Wir haben die Bestimmung wie der Natio-nalrat auf die politischen Parteien beschränkt und andereOrganisationen davon ausgenommen, weil nach heutigerAuffassung von den Organisationen mindestens die Par-teien mitwirken müssen. Andere wirken mit – das sehen wiralle Tage –, aber sie sind für die Umsetzung der Verfas-sung, insbesondere für die Wahlen und Abstimmungen, erstin zweiter Linie notwendig und massgebend.
Koller Arnold, Bundesrat: Dieser Artikel befand sich im Ent-wurf des Bundesrates im Reformpaket über die Volksrechte(Art. 116). Die beiden Verfassungskommissionen haben da-von nun wenigstens Absatz 1 in die Nachführungsvorlageaufgenommen. Der Bundesrat kann aus folgenden Überle-gungen zustimmen:Artikel 127a erwähnt explizit die politischen Parteien als Mit-wirkende an der Meinungs- und Willensbildung des Volkes.Er gibt damit geltendes Recht wieder. Die Parteien werdenschon heute verfassungsrechtlich vorausgesetzt. Sie sind alsTrägerinnen des politischen Wettbewerbes für das Proporz-wahlverfahren des Nationalrates unabdingbar, und in derNachführung sind sie ausdrücklich in der Bestimmung überdas Vernehmlassungsverfahren – ich verweise auf Artikel
138 – erwähnt. Die Parteien haben für die politische Willens-bildung in unserer Demokratie und in unserem parlamentari-schen System zweifellos einen hohen Stellenwert, der auchklar über jenen der NGO hinausgeht. Sie werden von derVerfassung als Teile der politischen Wirklichkeit vorausge-setzt.Ihre explizite Erwähnung – das ist neu, das ist gegenüberHerrn Schmid zuzugeben – scheint uns aus diesen Gründenberechtigt. Sie holt die Parteien aus ihrem normativen Schat-tendasein in das verfassungsrechtliche Licht. Aus demselbenGrund werden übrigens auch die Fraktionen erstmals in derVerfassung ausdrücklich erwähnt; ich verweise auf Artikel145. Mit der expliziten Anerkennung der Parteien werdenalso Verfassungsrecht und gelebte Verfassungswirklichkeitin Einklang gebracht.Aus diesem Grund kann der Bundesrat den Anträgen derVerfassungskommission zustimmen.
Art. 127Angenommen – Adopté
Art. 127a
Abstimmung – VoteFür den Antrag der Kommission 30 StimmenFür den Antrag Schmid Carlo 1 Stimme
Art. 128, 129Anträge der Kommissionen: BBlPropositions des commissions: FF
Frick Bruno (C, SZ), Berichterstatter: Wir kommen damitzum 2. Kapitel («Initiative und Referendum»). Ich möchte Siedarum bitten, dass wir anschliessend an dieses Kapitel dieArtikel 181 bis 184 («6. Titel: Revision der Bundesverfassungund Übergangsbestimmungen») behandeln, die zu keinenDiskussionen Anlass gaben, aber auch zur Verfassungsän-derung gehören.Bezüglich Initiativen und Referenden haben wir strikte dasgeltende Recht aufgearbeitet. Ich möchte zuerst die Artikel128 und 129 gemeinsam erläutern; sie behandeln das Initia-tivrecht.Artikel 128 regelt das Initiativrecht auf eine Totalrevision derVerfassung. Er gibt genau das heute geltende Recht wieder.Ich habe keine weitere Bemerkung anzubringen.Artikel 129 entspricht dem heute geltenden, praktiziertenRecht, soweit es die Volksinitiative betrifft. Wir können unsder Begründung anschliessen, die der Bundesrat in seinerBotschaft auf Seite 360ff. gegeben hat. Eine Ergänzungmöchte ich anbringen: Die Kommission hat in Übereinstim-mung mit dem Nationalrat die Bestimmung eingefügt, dasseine Initiative nicht nur total, sondern auch teilweise ungültigerklärt werden kann. Es geht um folgende Überlegung:Wenn nur ein Nebenpunkt einer Volksinitiative ungültig ist,wäre es nach dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit nichtrichtig, die ganze Initiative ungültig zu erklären; eine teilweiseUngültigkeit kann genügen. Wo sich aber ein Hauptpunkt ei-ner Initiative als ungültig erweist, wie das bei der Initiative derSchweizer Demokraten für eine sogenannt vernünftige Asyl-politik der Fall war, ist die ganze Initiative ungültig zu erklä-ren.
Koller Arnold, Bundesrat: Ihre Kommission beantragt, dieMöglichkeit der Teilungültigerklärung einer Volksinitiative be-reits im Rahmen der Nachführung – hier in Artikel 129Absatz 3 – aufzunehmen und nicht erst in Artikel 177a imReformpaket B über die Reform der Volksrechte, wie es derbundesrätliche Entwurf vorsah.Der Bundesrat kann sich diesem Antrag anschliessen. Es istnämlich eine Frage der Verhältnismässigkeit, nicht eineganze Initiative für ungültig zu erklären, wenn ein relativ un-bedeutender Teil der Initiative herausgenommen und da-durch die Substanz der Volksinitiative gerettet werden kann.Diese Auffassung entspricht auch der bundesgerichtlichen
9. März 1998 S 121 Bundesverfassung. Reform
Amtliches Bulletin der Bundesversammlung / Separatdruck
Rechtsprechung zu den kantonalen Initiativen. Wir entschei-den hier zudem eine offene Rechtsfrage auf Bundesstufe zu-gunsten der Volksrechte. Der Bundesrat hat sogar mit demNachführungsbegriff keine Probleme, weil die Klärung offe-ner Rechtsfragen – hier liegt eine offene Rechtsfrage vor,weil auch das Geschäftsverkehrsgesetz die Frage nicht klarbeantwortet – zweifellos zu den wohlverstandenen Aufgabender Nachführung der Bundesverfassung gehört.
Angenommen – Adopté
Art. 130, 131Anträge der Kommissionen: BBlPropositions des commissions: FF
Frick Bruno (C, SZ), Berichterstatter: Artikel 130 und 131 –beide betreffen das Referendum – möchte ich gemeinsamerläutern. Der Bundesrat schlägt uns die Aufarbeitung desheutigen Rechtes vor. Wir schliessen uns dem an, habenaber trotzdem einige kleine Änderungen eingefügt:Die erste Änderung betrifft Artikel 130 Absatz 1 Buchstabe c.Als Erstrat haben wir im Januar 1998 Artikel 44 mit einerneuen Regel normiert, wonach Gebietsveränderungen zwi-schen Kantonen neben der Zustimmung der betroffenen Be-völkerung und der Kantone keiner Abstimmung von Volk undStänden mehr bedürfen, sondern lediglich eines Beschlus-ses der Bundesversammlung. Entsprechend ist nun Litera cvon Absatz 1 überflüssig und wird gestrichen.Die zweite Änderung betrifft in Artikel 130 Absatz 1 Litera dund in Artikel 131 Absatz 1 Litera c und cbis. Diese Bestim-mungen müssen wir formell zurückstellen, bis wir überArtikel 153 und Artikel 154 betreffend die Erlassformen abge-stimmt haben werden. Dann, wenn wir das System genehmi-gen, genehmigen wir auch die Terminologie in den drei ge-nannten Bestimmungen.Die dritte Änderung betrifft schliesslich Artikel 131 Absatz 1.Wir haben konsequent zu unseren Beschlüssen in der Vor-lage A1 den Begriff «Stände» überall durch den Begriff «Kan-tone» ersetzt, dies nach dem Grundsatz, dass jeder halbeStand ein ganzer Kanton ist.Nun eine letzte Bemerkung, die das betrifft, was wir nicht indie Verfassung aufgenommen haben: Wir haben es in Über-einstimmung mit der Mehrheit im Nationalrat ausdrücklichabgelehnt, in Artikel 130 eine Bestimmung aufzunehmen,wonach Staatsverträge von besonderer Bedeutung dem Re-ferendum, der Abstimmung von Volk und Ständen, unter-breitet werden können. Wir haben dies in der Kommission mit8 zu 4 Stimmen abgelehnt, und zwar aus folgenden Grün-den:Der EWR – er ist diesbezüglich das einzige Beispiel – hättenach überwiegender Meinung nicht unbedingt Volk und Stän-den unterbreitet werden müssen; die Frage war kontrovers,ob nicht auch ein Volksentscheid allein genügt hätte. Hierfürgibt es keine Verfassungsgrundlage. Die Verfassungskom-mission ist aber der Ansicht, dass in ausserordentlichen Fäl-len – diese sind aber sehr selten – die Bundesversammlungweiterhin das Recht haben soll, neben der geschriebenenVerfassung als ausserordentliche Massnahme, gleichsamals «Ventil», besonders wichtige Staatsverträge Volk undStänden zur Abstimmung zu unterbreiten.Wir haben darauf verzichtet, eine solche Bestimmung aufzu-nehmen, weil ein solcher absoluter Ausnahmefall in der Ver-fassung wohl kaum befriedigend geregelt werden kann. Die-ser Verzicht ist kein qualifiziertes Schweigen; die Möglichkeit,ein solches «Ventil» zu öffnen, soll dem Parlament immernoch gegeben sein. Wir wollen aber bewusst die Verfassungnicht belasten und bei jedem künftigen Staatsvertrag die Dis-kussion darüber eröffnen, ob er Volk und Ständen unterbrei-tet werden solle. Die absolute Ausnahmemöglichkeit sollaber bestehenbleiben.
Art. 130 Abs. 1 Bst. a–c, 2 – Art. 130 al. 1 let. a–c, 2Angenommen – Adopté
Art. 130 Abs. 1 Bst. d – Art. 130 al. 1 let. d
Präsident: Absatz 1 Buchstabe d wird zurückgestellt, bis wirüber Artikel 153a beschlossen haben.
Verschoben – Renvoyé
Art. 131 Abs. 1 Bst. a, d, 2 – Art. 131 al. 1 let. a, d, 2Angenommen – Adopté
Art. 131 Abs. 1 Bst. b, c, cbis – Art. 131 al. 1 let. b, c, cbis
Präsident: Die Buchstaben b, c und cbis werden zurückge-stellt, bis wir über den Artikel 153a beschlossen haben.
Verschoben – Renvoyé
Art. 132Anträge der Kommissionen: BBlPropositions des commissions: FF
Frick Bruno (C, SZ), Berichterstatter: Es handelt sich hier umeine Wiedergabe des heutigen Rechtes, ohne jede Ände-rung.
Angenommen – Adopté
Art. 181–184Anträge der Kommissionen: BBlPropositions des commissions: FF
Angenommen – Adopté
Art. 133Anträge der Kommissionen: BBlPropositions des commissions: FF
Rhinow René (R, BL), Berichterstatter: Der 5. Titel («DieBundesbehörden») ist in diesem Zusammenhang wohl derbedeutsamste Teil dieser Vorlage. Er wird in vier Kapitel ge-gliedert.Das 1. Kapitel («Allgemeine Bestimmungen») enthält Rege-lungen, die grundsätzlich für alle drei Gewalten gelten. Essind das die Wählbarkeit, die Unvereinbarkeiten, die Amts-dauer, die Staatshaftung und – was in diesem Rahmen etwasfremd und ungewohnt anmuten mag – die Bestimmungenüber das Vernehmlassungsverfahren.Das 2. Kapitel regelt die Bundesversammlung. Es ist eben-falls in Abschnitte gegliedert; sie betreffen die Organisation,das Verfahren und die Zuständigkeiten.Das 3. Kapitel umfasst Bundesrat und Bundesverwaltung; esenthält einen Abschnitt über die Organisation und das Ver-fahren und einen Abschnitt über die Zuständigkeiten. Das4. Kapitel schliesslich ist für das Bundesgericht reserviert.Im Titel über die Bundesbehörden ist nun vor allem zu beach-ten, dass sowohl der Nationalrat wie Ihre Kommission ver-schiedene Anträge aufgenommen haben, die von denStaatspolitischen Kommissionen beider Räte im Rahmen derzweiten Phase der Parlamentsreform ausgearbeitet wordensind. Diese Anträge sind den Räten aufgrund umfangreicherVorarbeiten, die bis an den Anfang dieses Jahrzehntes zu-rückreichen, in der Form eines Zusatzberichtes vom 6. März1997 zur Verfassungsreform unterbreitet worden. Der Bun-desrat hat in seiner Stellungnahme vom 9. Juni 1997 zu denmeisten Anträgen der SPK ablehnend Stellung bezogen, je-denfalls soweit sie die Kompetenzverteilung zwischen Bun-desversammlung und Bundesrat betreffen. In der Zwischen-zeit freilich hat sich der Bundesrat in einigen Anträgen derMeinung des Nationalrates und der SPK-SR angeschlossen,allerdings mit einigen wichtigen Ausnahmen.Ihre Kommission hat diese Anträge ebenfalls sorgfältig ge-prüft. Ich mache Sie darauf aufmerksam, dass beide – Natio-nalrat und ständerätliche Kommission – zwanzig Änderun-gen zum bundesrätlichen Entwurf gutheissen. Bevor HerrFrick auf die einzelnen Punkte näher eingeht, möchte ich Ih-
Constitution fédérale. Réforme 122 E 9 mars 1998
Bulletin officiel de l’Assemblée fédérale / Tiré à part
nen mit einer stichwortartigen Aufzählung – quasi vor derKlammer – diese zwanzig Änderungen kurz skizzieren:– einmal die Streichung der Bestimmung, wonach nurStimmberechtigte weltlichen Standes in den Nationalrat, denBundesrat und das Bundesgericht gewählt werden können;– dann eine flexible Regelung der Unvereinbarkeiten, indemvermehrt auf das Gesetz verwiesen wird;– die Befugnis auch von einem Viertel des Ständerates –nicht nur des Nationalrates –, die Räte zu einer ausserordent-lichen Session einzuberufen;– demgegenüber die Streichung desselben Rechtes für fünfKantone;– die Schaffung des Amtes eines zweiten Vizepräsidenten inbeiden Räten;– dafür die Streichung der Kantonsklausel für Präsident undVizepräsident des Ständerates;– die Möglichkeit, dass einzelne Befugnisse der Bundesver-sammlung, die aber nicht rechtsetzender Natur sein dürfen,zur abschliessenden Erledigung an Kommissionen übertra-gen werden können;– die Unterstellung der Parlamentsdienste neu unter die Bun-desversammlung;– die klärende Neuredaktion des Initiativ- und Antragsrechteszu den Geschäften der Bundesversammlung;– die Ausweitung des Immunitätsrechtes auf Äusserungen inallen Organen der Bundesversammlung;– die Vereinfachung der Erlassformen der Bundesversamm-lung, indem es neu nur noch Bundesgesetze, Verordnungenoder Parlamentsverordnungen, Bundesbeschlüsse und ein-fache Bundesbeschlüsse geben soll, aber keine allgemein-verbindlichen Bundesbeschlüsse mehr;– die Einführung eines sogenannten materiellen oder bessermaterialen Gesetzesbegriffes, was bedeutet, dass die Ver-fassung vorschreibt oder umschreibt, was Gegenstand einesBundesgesetzes sein soll;– eine präzisere Fassung der Fälle, wann völkerrechtlicheVerträge nur vom Bundesrat, nicht aber von der Bundesver-sammlung genehmigt werden müssen;– die Einführung einer Evaluationsklausel, wonach die Bun-desversammlung für die Überprüfung der Wirksamkeit derMassnahmen des Bundes zu sorgen hat;– der Verzicht auf die Erwähnung der Zuständigkeit der Bun-desversammlung, die Grundzüge der Organisation der Bun-desbehörden festzulegen, weil sich diese Befugnis bereitsaus dem materialen Gesetzesbegriff ergibt;– die Aufnahme von zwei neuen Befugnissen in den Aufga-benkatalog der Bundesversammlung, nämlich die Mitwirkungbei den wichtigen Planungen der Staatstätigkeit und der Er-lass von Einzelakten, soweit ein Bundesgesetz dies vorsieht;– die Streichung der Bestimmung, dass der Bundeskanzlerzwingend gleichzeitig mit dem Bundesrat gewählt werdenmuss;– die Bundesversammlung hat die Pflege der Beziehungenzwischen Bund und Kantonen nicht nur zu beaufsichtigen,wie der Bundesrat vorschlägt, sondern für deren Pflege zusorgen;– der Bundesrat hat nicht bloss über die Einhaltung des Bun-desrechtes zu wachen, sondern ebenfalls dafür zu sorgen.Das sind die zwanzig – ich gebe es zu: mehr oder weniger –substantiellen Neuerungen, die alle vom Nationalrat und derKommission bzw. Kommissionsmehrheit unseres Ratesübernommen werden. Daneben gibt es Anträge beider odereiner der Staatspolitischen Kommissionen, welche nicht über-nommen werden, nämlich:1. dass die Bundesversammlung die grundlegenden Zieleder Aussenpolitik festzulegen habe; Sie finden einen ent-sprechenden Minderheitsantrag auf der Fahne;2. dass neben dem materialen Gesetzesbegriff auf die pro-blematische Figur der Gesetzesdelegation zu verzichten sei;3. dass das Gesetz die Grundzüge des Verordnungsverfah-rens zu regeln habe;4. dass durch Gesetz eine Ombudsstelle eingeführt werdenkönne; und5. dass auf Begehren von drei Vierteln der Mitglieder derBundesversammlung eine Gesamterneuerung des Bundes-
rates stattzufinden habe; hierzu haben Sie ebenfalls einenMinderheitsantrag auf der Fahne.Das sind die fünf Punkte, die vom Nationalrat und der Mehr-heit der Kommission unseres Rates nicht übernommen wor-den sind. Dann gibt es noch eine dritte Kategorie, nämlichAnträge der beiden SPK, die zwar vom Nationalrat beschlos-sen worden sind, bei denen wir Ihnen aber beantragen, nichtdem Nationalrat zu folgen. Es sind im wesentlichen sechsPunkte – ich beschränke mich auch hier auf die Stichworte –:– verfassungsmässig abgesicherte Informationsbefugnisseder parlamentarischen Kommissionen;– den ebenfalls verfassungsmässig gewährleisteten Beizugvon Dienststellen durch die Bundesversammlung;– die Regelung der Geheimhaltungspflichten gegenüber Auf-sichtskommissionen; in allen drei Fällen wollen wir auf dieGesetzesebene verweisen;– die Einführung des Auftrages als parlamentarisches Instru-ment im Rahmen der Oberaufsicht; auch hier finden Sie denAntrag einer Kommissionsminderheit auf der Fahne;– die Befugnis der Bundesversammlung, Notverordnungenund Notverfügungen im Bereich der äusseren und innerenSicherheit zu erlassen; und– die Pflicht zur nachträglichen Genehmigung sowohl vonaussenpolitischen Verordnungen als auch von Verordnun-gen im Rahmen der äusseren und inneren Sicherheit durchdie Bundesversammlung.Schliesslich schlägt Ihnen Ihre Kommission in zwei Fällenvor, Anträge der SPK zu übernehmen, die vom Nationalratnicht übernommen worden sind. Zum einen soll eine rechtli-che Grundlage in die Verfassung aufgenommen werden,dass Verwaltungsaufgaben an Organisationen ausserhalbder Bundesverwaltung übertragen werden können (Art. 166Abs. 3). Das hat der Nationalrat abgelehnt. Zum anderen be-grüssen wir die Vorschrift, wonach der Bundesrat nach ei-nem Truppenaufgebot nur dann die Bundesversammlung un-verzüglich einzuberufen habe, wenn der Truppeneinsatz vor-aussichtlich länger als drei Wochen dauert, nicht aber bei ei-nem Aufgebot von mehr als 2000 Angehörigen der Armee.Soweit die Stellungnahme zu den Anträgen der Staatspoliti-schen Kommissionen.Ich darf Sie aber noch auf eine Kontroverse hinweisen, diegerade zurzeit wieder aktuell ist. Es handelt sich um die be-rühmte Kantonsklausel, wonach aus einem Kanton nur einBundesrat gewählt werden darf. Der Nationalrat will dieseKlausel streichen. Ihre Kommissionsmehrheit möchte diesnicht tun, wohl aber eine Kommissionsminderheit. Wie ichsehe, hat Herr Danioth dazu noch zusätzlich einen Antrageingereicht.Beim Bundesgericht kann ich mich kurz fassen: Hier habensowohl der Nationalrat wie die ständerätliche Kommissionden Grundsatz der Selbstverwaltung des Gerichtes aufge-nommen. Der Nationalrat möchte darüber hinaus eine Ver-pflichtung statuieren, dass bei der Wahl der Bundesrichterauf die Vertretung der Amtssprachen Rücksicht zu nehmensei. Beide, der Nationalrat wie Ihre Kommission, haben zu-dem die Bestimmung über die Bundesassisen übereinstim-mend gestrichen.Damit bin ich am Ende meiner längeren Aufzählung. Esschien mir wichtig, dass Sie sehen, welche und wie viele An-träge der Staatspolitischen Kommissionen übernommenworden sind.
Frick Bruno (C, SZ), Berichterstatter: Gestatten Sie mir, be-vor ich Artikel 133 erläutere, dass ich nach der systemati-schen, gründlichen Darstellung des Kommissionspräsiden-ten kurz noch beleuchte, in welchem Stadium sich die Verfas-sungsrevision gegenüber den gesamten Reformbestrebun-gen «Staatsleitungsreform» und «Parlamentsreform» dar-stellt.Es geht ja bei der Behördenorganisation um die Rechte desParlamentes und des Bundesrates und um das Zusammen-spiel von Parlament und Bundesrat. Hier ist das geschrie-bene Recht seit 1848 ja nur geringfügig geändert worden.Die heutige Verfassung gibt auf viele Anforderungen einesmodernen Staates nicht mehr ausreichende Antworten. In
9. März 1998 S 123 Bundesverfassung. Reform
Amtliches Bulletin der Bundesversammlung / Separatdruck
den letzten Jahrzehnten musste oft sehr vieles interpretiertwerden. Es hat sich auch aufgrund der Ausdehnung derStaatstätigkeit eine Verschiebung der Gewichte zugunstendes Bundesrates ergeben. In diesem Lichte haben 1990 un-sere Ratskollegen Rhinow und Petitpierre parlamentarischeInitiativen für eine Parlaments- und eine Staatsleitungsreformeingereicht.Damals war die Verfassungsrevision noch nicht absehbar.Die Staatspolitischen Kommissionen haben eine Experten-kommission eingesetzt, Subkommissionen haben gearbeitet,und am 6. März des letzten Jahres lag der Schlussberichtvor. Gleichzeitig war nun die Verfassungsrevision spruchreif.Nun galt es also, die Frage zu beantworten, wieweit die An-träge der Staatspolitischen Kommission im Rahmen der Ver-fassungsrevision umgesetzt werden sollen. Der Bundesrathat sich nämlich – Sie kennen die Stellungnahme – gegen diepolitisch bedeutenden Änderungen gesträubt. Gleichzeitigaber hat er bereits eine Staatsleitungsreform in Aussicht ge-stellt: Nach dem heutigen Wissensstand soll noch im Laufedieses Jahres eine gründliche Staatsleitungsreform in Ver-nehmlassung gehen.Die Verfassungskommission hat sich für folgende Kriterienentschieden, nach welchen sie die Anträge der Staatspoliti-schen Kommissionen umsetzen oder eben auf später ver-schieben will:1. Wo es um die Klärung einer strittigen Frage geht, will siediese vornehmen.2. In die bestehenden Kompetenzen und Zuständigkeitensoll grundsätzlich nicht eingegriffen werden.3. Wenn eine materielle Änderung unbestritten ist odergrossmehrheitlich mitgetragen wird, soll sie im Rahmen derVerfassungsrevision heute realisiert werden. Diese zwanzigPunkte hat Ihnen Herr Rhinow vorgetragen.Es wird also heute abend nur noch beschränkt Streit um die«Fleischstücke in der Suppe» geben. Die grossen Streit-punkte, soweit sie politische Auseinandersetzungen sind,sind auf die Staatsleitungsreform verschoben worden, die janoch im Laufe dieses Jahres in die Vernehmlassung gehensoll.Zu den einzelnen Bestimmungen: In Artikel 133 ist die Ein-schränkung gestrichen, dass Geistliche nicht wählbar sind.Die Kommission hat diese Streichung in der Meinung vorge-nommen, dass es sich um eine unbestrittene Änderung han-delt, denn es geht um die Beseitigung einer Diskriminierungder Geistlichen aller grösseren Religionen. Es ist klar zu sa-gen, dass es sich bei dieser Streichung nicht um eine Herab-stufung auf Gesetzesebene handelt, sondern um eine Strei-chung.Die Verfassungskommission hat einstimmig entschieden.Wir bitten Sie, dem Entscheid zu folgen, um so mehr, als Sieja den Bistumsartikel in der letzten Woche ebenfalls gestri-chen haben.
Koller Arnold, Bundesrat: Erlauben Sie dem Bundesrat aucheinige allgemeine Bemerkungen zum 5. Titel («Die Bundes-behörden»):Der Bundesrat hat sich in seiner Botschaft auch hier strengan den parlamentarischen Auftrag gehalten, den Sie uns imJahre 1987 erteilt haben. Wir haben daher nur das geltende,geschriebene und ungeschriebene Verfassungsrecht aufge-nommen und haben auch hier von rechtspolitischen Neue-rungen abgesehen. Aufgrund der Arbeiten der Staatspoliti-schen Kommissionen der beiden Räte ist dann, was das Kon-zept anbelangt, eine schwierige neue Ausgangslage entstan-den.Ich kann in diesem Zusammenhang der Bemerkung vonHerrn Frick, dass sich in den letzten Jahren das Gewicht klarzugunsten des Bundesrates verlagert habe, nicht folgen.Neue wissenschaftliche Studien – beispielsweise die Studievon Professor Linder, Universität Bern, oder die Studie vonProfessor Riklin, HSG, zeigen im Gegenteil, dass das Parla-ment auch in den letzten Jahren – beispielsweise im Bereichder Gesetzgebung – sogar mehr Einfluss nimmt als früherund dass unser Parlament diesbezüglich auch im internatio-nalen Vergleich mit Berufsparlamenten sehr gut abschneidet.
Natürlich: Sie stehen über uns. Wir wissen, dass Sie – mitAusnahme der Rechte des Volkes – die oberste Gewalt sindund insofern auch nicht an das Mandat gebunden sind, dasSie uns 1987 erteilt haben. Aber ich glaube, dass es ein Ge-bot der politischen Klugheit ist, wenn Sie auch hier in eigenerSache mit wichtigen rechtspolitischen Neuerungen zurück-halten. Denn: Wie wollen Sie nachher in der Volksabstim-mung erklären, dass die Wirtschaftsverbände, die Gewerk-schaften und die Kantone aufgrund dieses Konzeptes derNachführung auf wichtige rechtspolitische Neuerungen ver-zichten mussten, wenn Sie in eigener Sache einen anderenMassstab anwenden? Ich bin deshalb dafür dankbar, dasssich jetzt auch Ihr Kommissionssprecher um eine solche Zu-rückhaltung bemüht hat.Das sollte Ihnen um so leichter fallen, als der Bundesrat, wiegesagt worden ist, bereits ein weiteres Reformpaket eingelei-tet hat, nämlich jenes über die Staatsleitungsreform, wo ei-nerseits die Regierung reformiert und andererseits das wich-tige Verhältnis zwischen Legislative und Exekutive neu gere-gelt werden sollen. Alle wichtigen rechtspolitischen Neuerun-gen gehören daher in jenes Paket. Das ist ein wichtigesAnliegen des Bundesrates. Eine solche Methode versprichtauch in der Volksabstimmung am ehesten Erfolg.
Angenommen – Adopté
Art. 134Anträge der Kommissionen: BBlPropositions des commissions: FF
Frick Bruno (C, SZ), Berichterstatter: Bei Artikel 134 nehmenwir eine sprachliche Änderung in Absatz 1 und eine materi-elle Änderung in Absatz 3 vor.Absatz 1 betrifft nur eine elegantere Umschreibung des Bun-desgerichtes. Die Änderung bei Absatz 3 hingegen ist mate-rieller Art. Bisher sind Bedienstete des Bundes generell vompassiven Wahlrecht als Nationalrat oder Nationalrätin ausge-schlossen. Das soll sich ändern. Sie kennen die Beispiele:Vor Jahren musste ein Bahnbeamter in Lichtensteig/SG aufseinen Beruf verzichten, nur damit er in den Nationalrat nach-rücken konnte. Wir wollen diese Bestimmung bewusst lok-kern. Neu soll das Gesetz die Unvereinbarkeiten regeln, wiees Absatz 4 bereits vorsieht. Also soll ein Zeughausbeamteraus dem Engadin wählbar sein, aber der Direktor eines Bun-desamtes soll nach unserer Meinung zweifellos weiterhinnicht als Nationalrat wählbar sein. Es gilt, diese Unvereinbar-keiten in Zukunft auf Stufe Gesetz auszuhandeln und zu nor-mieren.
Koller Arnold, Bundesrat: Da es sich hier gegenüber demEntwurf des Bundesrates um eine Herabstufung handelt,möchte ich die Bereitschaft des Bundesrates zu dieser Her-abstufung betonen. Es geht lediglich darum, dass wir auf Ge-setzesstufe eine differenziertere, adäquatere Lösung findenkönnen, so, wie das Herr Frick angetönt hat. Für uns bleibtklar, dass beispielsweise auch künftig die wichtigsten Chef-beamten nicht wählbar sind.
Angenommen – Adopté
Art. 135Anträge der Kommissionen: BBlPropositions des commissions: FF
Präsident: Ich gehe davon aus, dass die Umformulierungeine direkte Folge des Beschlusses bei Artikel 134 Absatz 1ist.
Frick Bruno (C, SZ), Berichterstatter: Das ist so, Herr Präsi-dent. Als zweites ist zu sagen, dass die Amtsdauer der Mit-glieder des Bundesgerichtes neu auf Stufe Verfassung gere-gelt ist; bisher war dies auf Stufe Gesetz der Fall. Es ist eineHeraufstufung ohne materielle Änderung.
Angenommen – Adopté
Constitution fédérale. Réforme 124 E 9 mars 1998
Bulletin officiel de l’Assemblée fédérale / Tiré à part
Art. 136Anträge der Kommissionen: BBlPropositions des commissions: FF
Frick Bruno (C, SZ), Berichterstatter: Das Streichen ist dieFolge Ihres Entscheides, den Sprachenartikel neu in Artikel57h aufzunehmen.
Angenommen – Adopté
Art. 137, 138Anträge der Kommissionen: BBlPropositions des commissions: FF
Frick Bruno (C, SZ), Berichterstatter: Hierzu habe ich keineBemerkungen. Es geht lediglich um eine reine Aufarbeitungdes geltenden Rechtes.
Angenommen – Adopté
Art. 139–141Anträge der Kommissionen: BBlPropositions des commissions: FF
Frick Bruno (C, SZ), Berichterstatter: Zu den Artikeln 139 bis141 habe ich keine Bemerkungen, die über die Erläuterun-gen des Bundesrates in der Botschaft hinausgehen.
Angenommen – Adopté
Art. 142Anträge der Kommissionen: BBlPropositions des commissions: FF
Frick Bruno (C, SZ), Berichterstatter: Artikel 142 bringt zu-erst einmal eine Klärung der Begriffe:Ordentliche Sessionen sind jene, die vierteljährlich – derzeitje drei Wochen lang – stattfinden. Sondersessionen sindjene, die zusätzlich eingeschoben werden, um einen grossenArbeitsanfall abzutragen. Ausserordentliche Sessionen, derdritte Typus, sind Sessionen, welche von einem Viertel derMitglieder beider Räte einberufen werden können. Sie findenstatt, wenn eine qualifizierte Zahl von National- oder – neu –auch Ständeräten aufgrund besonderer Umstände von ihremEinberufungsrecht Gebrauch machen. Letztmals ist eine sol-che ausserordentliche Session im Januar 1998 abgehaltenworden. Sie wurde von der SP-Fraktion aufgrund der wirt-schaftspolitischen Ereignisse verlangt.Nebst der Klärung der Begriffe enthält Artikel 142 auch einematerielle Änderung: Bisher stand das Einberufungsrecht nureinem Viertel der Nationalräte zu. Neu soll die Gleichheit derRechte auch für den Ständerat bestehen. Ein Viertel unseresRates – also zwölf Mitglieder – kann die Einberufung verlan-gen. Die Verfassungskommission traut uns diese Kompetenzzu.
Angenommen – Adopté
Art. 143Anträge der Kommissionen: BBlPropositions des commissions: FF
Frick Bruno (C, SZ), Berichterstatter: Artikel 143 strafft diebisherigen Verfassungsbestimmungen. Beide Präsidien wer-den in einer einzigen Bestimmung neu geregelt. Hingegenkönnen Sie sich veranschaulichen, zu welchen sprachlichen«Schönheiten» die konsequent auf beide Geschlechter bezo-genen Formulierungen im Text führen.Absatz 2 ist in der Meinung, dass diese Bestimmung auf Ge-setzesstufe geregelt werden soll, gestrichen worden. So hates der Nationalrat beschlossen, und wir schliessen uns sei-nem Beschluss an.
Koller Arnold, Bundesrat: Der Bundesrat mischt sich nicht indie inneren Angelegenheiten des Parlamentes ein. (Heiter-keit)
Angenommen – Adopté
Art. 144Anträge der Kommissionen: BBlPropositions des commissions: FF
Art. 159Antrag der KommissionAbs. 1Zustimmung zum Beschluss des NationalratesAbs. 2, 3Streichen
Antrag der GPK-SRAbs. 2Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Art. 159Proposition de la commissionAl. 1Adhérer à la décision du Conseil nationalAl. 2, 3Biffer
Proposition de la CdG-CEAl. 2Adhérer à la décision du Conseil national
Frick Bruno (C, SZ), Berichterstatter: Artikel 144 hat einensehr engen Zusammenhang zu Artikel 159. Ich schlage vor,dass wir die beiden zusammen behandeln, und zwar in fol-gender Reihenfolge, damit die Diskussion möglichst effizientstrukturiert ist: zuerst Artikel 144 Absätze 1 bis 3; dannArtikel 144 Absatz 4 zusammen mit Artikel 159 Absatz 2, wouns ja ein Antrag der GPK-SR vorliegt, und abschliessend dieAbsätze 1 und 3 von Artikel 159. So können wir sie sachlich«büscheln».Die Absätze 1 bis 3 von Artikel 144 regeln die Legislativkom-missionen. Ohne Diskussion haben wir den Absätzen 1 und2 zugestimmt; sie geben das geltende Recht wieder. InAbsatz 3 empfehlen wir Ihnen aufgrund des Antrages derStaatspolitischen Kommission, in die Verfassung aufzuneh-men, dass einzelne Befugnisse nicht rechtsetzender Art anKommissionen übertragen werden können. Das ist keinerechtspolitische Änderung, das ist Festschreibung der heutegelebten Wirklichkeit. Beispielsweise haben unsere BürosKompetenzen für Wahlen, und die Fachkommissionen, dieLegislativkommissionen, haben bestimmte Kompetenzen imRahmen der Leistungsaufträge des Bundesrates. Es soll nunauf Verfassungsstufe festgeschrieben werden, was heutebereits Recht ist.
Art. 144 Abs. 1–3 – Art. 144 al. 1–3Angenommen – Adopté
Art. 144 Abs. 4; 159 Abs. 2 – Art. 144 al. 4; 159 al. 2
Frick Bruno (C, SZ), Berichterstatter: Es geht bei diesen bei-den Bestimmungen einerseits um die Informationsrechte desParlamentes, andererseits um den Geheimhaltungsbereichdes Bundesrates und der Bundesverwaltung.Der Nationalrat ist inhaltlich der Staatspolitischen Kommis-sion gefolgt. Es geht um zwei Punkte:1. Die Kommissionen haben Anspruch auf alle Informatio-nen, die für ihre Arbeit zweckdienlich sind; allerdings könnenEinschränkungen im Gesetz festgelegt werden.2. Die Aufsichtskommissionen – das ist in Artikel 159 Ab-satz 2 geregelt – haben alle Einsichtsrechte; Geheimhal-tungspflichten können ihnen nicht entgegengehalten werden.Die Verfassungskommission ist dieser weiten Normierungaus folgenden Überlegungen nicht gefolgt:
9. März 1998 S 125 Bundesverfassung. Reform
Amtliches Bulletin der Bundesversammlung / Separatdruck
1. Es wäre eine Gewichtsverschiebung gegenüber dem heu-tigen Recht zugunsten des Parlamentes, wenn in Artikel 144Absatz 3 die Kommissionen alle Informationsrechte hättenund lediglich die Ausnahmen im Gesetz zu bezeichnen wä-ren. Das wäre quasi eine Umkehr der Beweislast in der Ge-setzgebung. Der Bundesrat müsste überall darlegen, warumdieses Informationsrecht nicht besteht. Das wäre eine rechts-politische Neuerung. Aus diesen Gründen haben wir sie mit10 zu 4 Stimmen gestrichen.Zu Artikel 159 Absatz 2 ist etwas Ähnliches zu sagen. Er sti-puliert gemäss Beschluss des Nationalrates, dass den Auf-sichtskommissionen Geheimhaltungspflichten nicht entge-gengehalten werden können. Das wäre nach dem heutigenRecht eine klare Verschiebung zugunsten der Aufsichtskom-missionen. Heute ist es so, dass Informations- und Aktenein-sichtsrechte im Gesetz sehr detailliert geregelt sind. Mangeht nach heutigem Verständnis davon aus, dass in allendiesen Bereichen, die ja Schnittstellen zwischen Parlamentund Bundesrat sind und häufig Reibungsflächen darstellen,im Einzelfall austariert und ausgehandelt werden soll, wieweit die Rechte des Parlamentes gehen und wie weit sie zu-gunsten des Bundesrates noch bestehen.Wenn wir nun die absolute Formulierung des Nationalrateswählen, ergibt sich eine Gewichtsverschiebung, die über dieNachführung hinausgeht; es wäre eine Verstärkung der Par-lamentsrechte. Wir haben uns entschlossen – das Stimmen-verhältnis in der Kommission war etwa 2 zu 1 –, bei der Fas-sung zu bleiben, wie wir sie Ihnen vorschlagen.Wir haben für die Rechte der Aufsichtskommissionen und derLegislativkommissionen eine neue Bestimmung in Artikel144 Absatz 4 eingefügt, welche beide Bereiche regelt. Sie re-gelt die Legislativkommissionen und die Untersuchungskom-missionen dergestalt, dass die Kommissionen «zur Erfüllungihrer Aufgaben über die vom Gesetz bezeichneten Aus-kunftsrechte, Einsichtsrechte und Untersuchungsbefug-nisse» verfügen. Wir sind damit der Fassung des KantonsBern gefolgt, der eine praktisch gleichlautende Bestimmungin seine neue Verfassung aufgenommen hat. Wir glauben,dass wir mit dieser Bestimmung das heutige Gleichgewichtaufrechterhalten. Wir sind aber der Ansicht, dass der ganzeBereich im Rahmen der Staatsleitungs- und Parlamentsre-form grundsätzlich überdacht werden muss. Wenn wir unsheute für diese Bestimmung entschieden haben, danndarum, weil wir die Aufarbeitung, die «mise à jour» als sol-che, verwirklichen wollen. Das heisst aber nicht, dass wir esauch im Rahmen der Staatsleitungs- und Parlamentsreformbei diesen beschränkten Rechten des Parlamentes bewen-den lassen wollen.Aus diesen Gründen bitte ich Sie, der neuen Fassung vonArtikel 144 Absatz 4 zuzustimmen. Dadurch wird nach Mei-nung der Mehrheit unserer Verfassungskommission auchArtikel 159 Absatz 2 überflüssig.Herr Bieri hat einen Antrag gestellt, der auch der Kommissionbereits vorlag und der vom Nationalrat übernommen wurde.Ich bitte darum, dass er ihn nun begründen kann.
Bieri Peter (C, ZG): Als derzeitiger Präsident der Geschäfts-prüfungskommission möchte ich mich einerseits zur Ober-aufsicht des Parlamentes äussern, wie sie in Artikel 159Absatz 1 dargestellt ist, und möchte anderseits die Interpre-tation unserer Kommission derjenigen des Bundesrates ge-genüberstellen. Ich möchte in einem zweiten Teil kurz zuArtikel 159 Absatz 2, wie er im Nationalrat beschlossen wor-den ist, Stellung nehmen.Zuerst zur generellen Oberaufsicht der Bundesversammlung:Die Vielschichtigkeit der staatlichen Aufgaben mit ihren gros-sen Auswirkungen auf den Staat selbst und auf seine Einrich-tungen bringt es mit sich, dass die GPK, wollen sie ihrem Auf-trag zur Oberaufsicht auch nur einigermassen gerecht wer-den, auf gesetzlich klar umschriebene Spielregeln angewie-sen sind. Diese Regeln müssten an drei Orten definiertwerden: Sie müssen erstens in der Bundesverfassung defi-niert werden: in Artikel 144 – dieser Artikel bestimmt die In-formationsrechte der Kommissionen – sowie, wie gesagt, inArtikel 159, der die Oberaufsicht des Parlamentes definiert.
Sie müssen zweitens im Geschäftsverkehrsgesetz definiertwerden. Die Revision dieses Gesetzes wird im Anschluss andie Reform der Bundesverfassung in Angriff genommen wer-den müssen; die Rechte der Kommissionen sind dort undwahrscheinlich auch, wie das gesagt wurde, im Rahmen derStaatsleitungsreform, wie sie vom Bundesrat angekündigtwurde, genau zu definieren.Die PUK PKB hält in ihrem Bericht richtigerweise fest, dassdie Oberaufsicht zwar ein Element der Staatsleitung, aberkein Führungsmittel der Bundesversammlung ist. So kanndie mit der Oberaufsicht betraute Kommission dem Bundes-rat mit ihren Empfehlungen Handlungsanstösse vermitteln;die Verantwortung für die Ausführung bleibt aber dem Bun-desrat überlassen.Die GPK teilt diese Auffassung. Für sie stellt sich vor allemdie Frage, ob sie, wie in der bisherigen Praxis, ihre Oberauf-sicht auch begleitend ausüben kann. Wird diese Frage be-jaht, so stellt sich die Frage, inwieweit die Oberaufsicht einAkteneinsichtsrecht in laufende Verfahren besitzt. Weiterwird zu klären sein, wie das Akteneinsichtsrecht durchge-setzt werden kann, wo allenfalls Grenzen bestehen und waszu beachten ist, damit die Oberaufsicht nicht in den Kompe-tenzbereich der Regierung vorstösst. Das ist ja dann auch dieFrage, die sich in Absatz 2 stellt.Zuerst zur Frage der begleitenden Kontrolle: Wir haben an-lässlich unseres diesjährigen Seminars der beiden GPKdiese Thematik nochmals eingehend behandelt, nicht zuletzt,weil der Bundesrat in seiner Botschaft zur Reform der Bun-desverfassung einmal mehr dahin tendiert, die Oberaufsichtallein auf die nachträgliche Kontrolle zu beschränken.Er hegt dabei Bedenken, dass sich die begleitende Kontrollezu faktischen Mitentscheiden in die dem Bundesrat vorbehal-tene Führung entwickeln würde, womit Verantwortlichkeitenverwischt und die gewaltenteilige Grundordnung der Verfas-sung gestört würden. Versteht man die Oberaufsicht derBundesversammlung jedoch so, wie sie die GPK in ihremLeitbild festgehalten hat, sind wir überzeugt, dass sich die be-gleitende Kontrolle zusammen mit der nachträglichen Kon-trolle als Instrument der Oberaufsicht eignet.Nachdem ich mich in der letzten Zeit eingehend mit dieserThematik befasst und auch die Erfahrungen der Vergangen-heit in meine Überlegungen mit einbezogen habe, denke ich,dass die beiden Ansichten bei dieser Auseinandersetzungnicht meilenweit auseinander liegen. Vielmehr gehen Bun-desrat und beide GPK aus verständlichen Gründen von eineranderen Seite an die Thematik heran. Die Praxis zeigt uns,dass bei einem von einem positiven Geist getragenen Ver-hältnis zwischen Bundesrat und beiden GPK die begleitendeKontrolle als Lernprozess verstanden wird. Denken Sie nuran Beispiele wie unsere Inspektionen betreffend die Perso-nalpolitik – als aktuelles Beispiel – oder diejenige über dieSRG, das BVG, die private Invalidenhilfe oder den National-strassenbau! All diese Inspektionen waren nie nur eine nach-trägliche Kontrolle, haben aber nicht im geringsten zuSchwierigkeiten im Verhältnis zwischen den Führungsverant-wortlichen und den Inspizierenden geführt.Ich bin froh, wenn der Bundesrat diese in der Vergangenheitin den allermeisten Fällen gut funktionierende Aufgabentei-lung zwischen ihm und den GPK in diesem Sinne weiterhinso handhaben will und wenn er die Interpretation vonArtikel 159 auch auf diese Art und Weise versteht.Zum eigentlichen Antrag, den ich im Namen der GPK bzw. imNamen unserer Kommission gestellt habe: Wir haben dar-über befunden und auch einen eindeutigen, d. h. einen ein-stimmigen Entscheid gefällt. Es geht dabei darum, inwieweitdie GPK Akteneinsicht nehmen können. Diese Anregung ent-stammt der PUK PKB. Sie verlangte in einer ihrer parlamen-tarischen Initiativen, dass die GPK in geeigneter Weise so-wohl Einblick in die Führungs- und Kontrolldaten der Depar-temente als auch in die Akten noch nicht abgeschlossenerVerfahren nehmen können. Damit sollten die Probleme in derVerwaltung frühzeitig erkannt und die Umsetzung ihrer Emp-fehlungen überprüft werden können.Die GPK sehen bezüglich der Aktenherausgabe einen Hand-lungsbedarf. Sie haben daher den Verfassungskommissio-
Constitution fédérale. Réforme 126 E 9 mars 1998
Bulletin officiel de l’Assemblée fédérale / Tiré à part
nen eine Stellungnahme mit entsprechenden Anträgen zu-kommen lassen. Die nationalrätliche Verfassungskommis-sion und dann der Nationalrat selbst stimmten diesem Antragzu. Sie halten in Artikel 159 Absatz 2 fest, dass den Auf-sichtskommissionen keine Geheimhaltungsgründe entge-gengehalten werden können. Das würde bedeuten, dass dieGPK selbst den Entscheid fällt, wann sie auf Akteneinsichtverzichten will. Das würde auch bedeuten, dass die GPK denabschliessenden Entscheid fällt, wann sie das Aktenein-sichtsrecht durchsetzen will. Die Kommission möchte abergleichzeitig gewährleisten, dass die Geheimhaltungsinteres-sen des Bundesrates nicht einfach leichthin übergangen wer-den können. Sie würde in der Ausführungsgesetzgebung si-cher auch das sogenannte Berner Modell prüfen. Danach er-stattet bei Verweigerung der Akteneinsichtsrechte die Exeku-tive Bericht. Sie legt die Gründe für die Verweigerung dar.Falls die GPK den Bericht und dessen Begründung nicht alsgenügend erachtet, kann sie weiterhin Einsicht in das Origi-naldossier verlangen. Sie hört dabei aber die Exekutivenochmals an. Diese obligatorische Anhörung soll gewährlei-sten, dass die GPK ihren Entscheid nach sorgfältiger Abwä-gung der auf dem Spiel stehenden Interessen trifft. Der letzteEntscheid jedoch liegt bei der GPK. In diesem Sinne ist unserAntrag zu Absatz 2 zu verstehen.Die GPK will in erster Linie einen konstruktiven, gegenseiti-gen Lernprozess zwischen Bundesrat und Parlament einlei-ten; dies im Hinblick auf eine optimale Aufgabenerfüllung. Inder Bundesverfassung soll deshalb nicht die Trennung, son-dern das Zusammenwirken der Staatsfunktionen ausdrück-lich betont werden. Eine funktions- und sachgerecht ausge-übte Oberaufsicht verwischt die Verantwortlichkeiten nichtund greift nicht in die Entscheidungs- und Aufsichtskompe-tenz des Bundesrates ein.In diesem Sinne ist auch unser Antrag zu Artikel 159Absatz 2 zu verstehen. Ich bitte Sie im Namen der GPK,Absatz 2, wie er vom Nationalrat beschlossen worden ist, zu-zustimmen.
Frick Bruno (C, SZ), Berichterstatter: Formell hat dieserAbsatz mit Artikel 144 nichts zu tun, aber materiell hängen diebeiden Bestimmungen schon zusammen. In Artikel 144Absatz 4 wird geregelt, dass die Kommissionen im Rahmendes Gesetzes über Untersuchungsbefugnisse verfügen. Dazusteht Artikel 159 gemäss Antrag der GPK-SR in einem Wider-spruch, weil die Geheimhaltungspflichten unbeschränkt dergesamten Kommission offenstehen würden.Ich meine, wir sollten die Diskussion abschliessend führenund nachher abstimmen, weil auch die Zustimmung zur Fas-sung der Kommission quasi ein Systementscheid ist.
Rhinow René (R, BL), Berichterstatter: Wenn es richtig ist,dass jetzt die Diskussion auch zu Artikel 159 geführt wird,dann möchte ich nur noch zwei Dinge sagen, die vielleicht et-was untergehen, wenn man den Verfassungstext nur liest. Esheisst hier «die Aufsichtskommissionen». Das heisst mit an-deren Worten, dass es am Gesetzgeber sein wird, zu bestim-men, wer alles Aufsichtskommissionen sind. Nach heutigemVerständnis sind dies Geschäftsprüfungskommissionen undFinanzkommissionen. Wenn man also hier diese weite Fas-sung nimmt, dann heisst das, wenn ich richtig gezählt habe,dass 76 Mitglieder beider Räte unbeschränkt Einsicht haben,nämlich nach Verfassungsvorschrift «die Aufsichtskommis-sionen». Ich weiss nicht, ob das wirklich der Wille war undauch der Wille der Geschäftsprüfungskommission ist, dassalle 76 Mitglieder beider Finanzkommissionen und beiderGeschäftsprüfungskommissionen letztlich dieses Recht ha-ben, und ob dem nichts entgegenzusetzen ist. Vielleicht kannuns Herr Bieri noch etwas näher Auskunft geben.Zum zweiten Punkt: Es heisst «den Aufsichtskommissio-nen». Das sind eben die gesamten Kommissionen. Wennschon – oder ist das in der Geschäftsprüfungskommissiondiskutiert worden? –, müsste man doch ergänzen «oder de-ren Delegationen». Denn es könnte ja sein, dass man diesesRecht nur einem eng begrenzten Kreis geben will, aber nicht
den Gesamtkommissionen beider Räte. Aber das ist mehreine Frage an Herrn Bieri.
Bieri Peter (C, ZG): Es ist so, dass die Geschäftsprüfungs-kommissionen und die Finanzkommissionen grundsätzlich inUnterkommissionen arbeiten, also in Subkommissionen bzw.bei der Geschäftsprüfungskommission in Sektionen. Es sinddiese Untergruppen, welche bei ihrer Arbeit Einsicht in dieAkten der Verwaltung und des Bundesrates nehmen wollen.In diesem Sinne müsste dieses Einsichtsrecht auch in derAusführungsgesetzgebung definiert werden. Aber wir kön-nen nicht auf der Stufe der Verfassung von Unterkommissio-nen und von Sektionen sprechen, sondern generell ist es dieKommission, die hier dieses Recht erhalten muss. Die Praxiszeigt auch, dass hier mit diesen Unterkommissionen gearbei-tet wird.Ich möchte Sie nach wie vor darauf aufmerksam machen,dass diese Idee letztendlich aus einer parlamentarischen In-itiative der PUK PKB stammt. Unser Antrag ist jetzt die ent-sprechende Umsetzung dazu.
Koller Arnold, Bundesrat: Der Bundesrat ist selbstverständ-lich einverstanden und findet es sogar sehr legitim, dass dieparlamentarischen Kommissionen in Artikel 144 nun aus-drücklich genannt werden, denn ihre Bedeutung als vorbera-tende Kommissionen ist zweifellos sehr gross. Der Bundes-rat ist auch mit dem neuen Absatz 4 einverstanden, wonachdie Kommissionen «zur Erfüllung ihrer Aufgaben über dievom Gesetz bezeichneten Auskunftsrechte, Einsichtsrechteund Untersuchungsbefugnisse» verfügen. Diese Formulie-rung hat Ihre Kommission, wie schon angeführt worden ist,aus der neuen Berner Verfassung übernommen.Auf Gesetzesstufe haben wir heute aus guten Gründen einsehr unterschiedliches, differenziertes, austariertes Systemvon Einsichtsrechten und Untersuchungsbefugnissen, jenach Art der Aufsichtskommissionen. Das System bestehtbekanntlich in einer Steigerung der Informationsrechte vonden Geschäftsprüfungs- und Finanzkommissionen über dieGeschäftsprüfungsdelegation und die Finanzdelegation biszur parlamentarischen Untersuchungskommission.An diesem System möchte der Bundesrat festhalten. Wennman nämlich wie der Nationalrat – allerdings nur mit einerStimme Unterschied – eine Formulierung beschliesst, wo-nach die Kommissionen Anspruch auf alle Informationen ha-ben, erweckt man Erwartungen, die nicht erfüllt werden kön-nen. Denken Sie beispielsweise an jenen jüngsten Fall, denwir mit dem Einbruch des Mossad hier in Bern hatten: Es gehtdoch nicht an, dass man über 70 Parlamentsmitgliedern alleDetails offenlegt! Deshalb haben wir und haben Sie bewusstdiese Geschäftsprüfungsdelegation geschaffen, der gegen-über es keinerlei Schranken der Auskunft gibt. Aber es wärefatal, wenn man in derartigen geheimen Angelegenheiten –wie etwa der Zusammenarbeit der Nachrichtendienste oderauch im militärischen Bereich – alle Details mehr als 70 Par-lamentsmitgliedern bekanntgeben müsste.Der Bundesrat ist daher der Meinung, dass das geltende ge-setzliche System mit einer Steigerung der Auskunfts-, Ein-sichts- und Untersuchungsrechte – von der GPK zur Ge-schäftsprüfungsdelegation, von der Finanzkommission zurFinanzdelegation, bis hin zur PUK – beibehalten werden soll.Das ist ein System, welches sich bewährt hat und welchesder Bundesrat beibehalten will. Die Formulierung in der Ver-fassung hat das heutige gesetzliche System zum Ausdruckzu bringen, so wie das Ihre Kommission in Artikel 144Absatz 4 getan hat. Wie Herr Frick zu Recht betont hat, istArtikel 159 «le revers de la médaille». Dort wird geregelt, wieweit diesen Kommissionen gegenüber Geheimhaltungs-pflichten bestehen können, welche nach Art der Aufsichts-kommission unterschiedlich weit gehen. Der Bundesratmöchte Sie daher dringend bitten, den Anträgen Ihrer Kom-mission zuzustimmen.Ich möchte vor allem gegenüber Herrn Bieri noch folgendesfesthalten: Die Oberaufsicht ist zweifellos ein wesentlichesElement der Gewaltenteilung. Sie ist politische Kontrolledurch das Parlament, welches Kritik äussert und Empfehlun-
9. März 1998 S 127 Bundesverfassung. Reform
Amtliches Bulletin der Bundesversammlung / Separatdruck
gen für künftiges Handeln abgibt. Es kann jedoch nicht an-stelle der beaufsichtigten Organe selber handeln oder derenEntscheide aufheben. Darin liegt der zentrale Unterschiedzwischen Oberaufsicht und Aufsicht. Oberaufsicht bedeutetPrüfung der Rechtmässigkeit und der Zweckmässigkeit desHandelns von Bundesrat und Verwaltung. Ich kann Ihnen üb-rigens versichern: Der Bundesrat hat alles Interesse an einereffizienten Oberaufsicht. Er bildet sich nicht ein, allein die ge-samte Verwaltung effizient überwachen zu können. Hier sindwir auf die Kooperation mit den Kommissionen angewiesen.Die Einsichts- und Untersuchungsrechte müssen aber stu-fengerecht – je nach Art der Kommission unterschiedlich –gehandhabt werden.Deshalb möchte ich Sie dringend bitten, hier dem Antrag Ih-rer Kommission zuzustimmen.
Art. 144 Abs. 4 – Art. 144 al. 4Angenommen – Adopté
Art. 159 Abs. 2 – Art. 159 al. 2
Abstimmung – VoteFür den Antrag der Kommission 30 StimmenFür den Antrag der GPK-SR 6 Stimmen
Art. 159 Abs. 1, 3 – Art. 159 al. 1, 3
Frick Bruno (C, SZ), Berichterstatter: Wenn wir den Antragder GPK abgelehnt haben, heisst das nicht, dass wir das Ge-schäftsprüfungsverständnis des Bundesrates teilen, wie es inder Verfassungsbotschaft dargelegt worden ist. Es scheint inder Tat, dass bei der Abfassung der Botschaft in diesemPunkt die Literatur und die Praxis der letzten zwanzig Jahrenicht zugänglich waren. Der Bundesrat schreibt nämlich,dass er die Oberaufsicht nur als nachträgliche Kontrolle ver-stehe. Das ist sie nicht – nicht im Sinne der ganzen Rechts-und Staatsrechtslehre, sie ist es auch nicht im Sinne der Pra-xis. Wir sind, das halte ich im Namen der Verfassungskom-mission unmissverständlich fest, der Überzeugung, dass dieOberaufsicht ebensosehr eine begleitende wie eine nach-trägliche ist. Nehmen Sie nur die Beispiele der letzten Jahre:Vereinatunnel, «Bahn 2000», die ganzen Bemühungen umdas Bundesgericht, Schweizerische Käseunion; das sind al-les begleitende Oberaufsichtsmassnahmen, die wir ausgeübthaben. Darauf verzichten wir nicht.Die Geschäftsprüfungskommission hatte angeregt, die Ver-fassung solle die begleitende Oberaufsicht festschreiben.Wir haben dem Wunsch nicht stattgegeben, weil sie selbst-verständlich ist und die Auffassung, wie sie in der Botschaftgeäussert wurde, keinen Bestand haben kann. Soviel zu Ab-satz 1.Zu Absatz 3 habe ich nur anzufügen, dass diese Bestim-mung ohnehin überflüssig ist. Eine Minderheit Forster will dieBestimmung in Artikel 161 Absatz 1 als Buchstabe gquaterübernehmen, aber wir haben niemanden in der Kommission,der beantragen würde, diese Bestimmung wie der National-rat in Artikel 159 aufzunehmen.
Koller Arnold, Bundesrat: Es ist hier nicht der Ort, eineGrundsatzdebatte über die begleitende oder nachträglicheOberaufsicht zu führen. Wir sind der Meinung, die nachträg-liche müsse die Regel bleiben; es kann aber auch Ausnah-men geben. Nach Auffassung des Bundesrates sollten wirdiese Probleme im Rahmen des Paketes «Staatsleitungsre-form» im Detail diskutieren und zu lösen versuchen.
Angenommen – Adopté
Art. 145, 146Anträge der Kommissionen: BBlPropositions des commissions: FF
Frick Bruno (C, SZ), Berichterstatter: Die Artikel 145 und 146kann ich gemeinsam begründen. Wie unser Kommissions-
präsident bereits ausgeführt hat, sollen die Fraktionen neuals gelebte Wirklichkeit auch in die Verfassung Eingang fin-den.In Artikel 146 nennen wir die Parlamentsdienste, welche derBundesversammlung zur Verfügung stehen. Sie sind derBundeskanzlei nur administrativ zugeordnet. In rechtlicherHinsicht nehmen wir eine Änderung vor, weil sie rechtlich derBundeskanzlei unterstehen; faktisch aber stehen sie bereitsseit vielen Jahren ausschliesslich uns zur Verfügung. Wirpassen also die Verfassung der Rechtswirklichkeit an.Bei Artikel 146 ist zu ergänzen, dass wir – wie der National-rat – die Bestimmung über eine Ombudsstelle ausdrücklichnicht in die Verfassung aufnehmen wollen, und zwar in derMeinung, dass diese Ombudsstelle auch ohne ausdrücklicheVerfassungsbestimmung machbar wäre. Diese Nichtauf-nahme ist kein qualifiziertes Schweigen; wir sind vielmehrder Meinung, dass die Ombudsstelle gegebenenfalls auchohne ausdrückliche Verfassungsgrundlage realisiert werdenkann.
Angenommen – Adopté
Art. 147–149Anträge der Kommissionen: BBlPropositions des commissions: FF
Frick Bruno (C, SZ), Berichterstatter: Diese Artikel geben nurdas geltende Recht wieder, ohne jegliche materielle Ände-rung.
Angenommen – Adopté
Art. 150, 151Anträge der Kommissionen: BBlPropositions des commissions: FF
Frick Bruno (C, SZ), Berichterstatter: Bei Artikel 150 habenwir – wie heute bereits mehrmals – diesen Vorbehalt anzu-bringen: Der Entscheid fällt über die Änderung, die wir in derAbstimmung über Artikel 153a vornehmen.Artikel 151 ist gegenüber dem Entwurf des Bundesratessprachlich gestrafft worden, enthält aber keine inhaltliche Än-derung. Wir haben aber auch eine kleine materielle Ände-rung vorgenommen, indem der Rat als Antragsgremium andie Bundesversammlung wegfällt. Er ist ja selber ein Teil derBundesversammlung. Die Nennung scheint uns da nichtmehr nötig, sondern im Gegenteil missverständlich zu sein.
Art. 150 Abs. 1, 2 – Art. 150 al. 1, 2Angenommen – Adopté
Art. 150 Abs. 3, 4 – Art. 150 al. 3, 4
Präsident: Die Absätze 3 und 4 von Artikel 150 werden bisnach der Abstimmung zu Artikel 153a zurückgestellt.
Verschoben – Renvoyé
Art. 151Angenommen – Adopté
Art. 152Anträge der Kommissionen: BBlPropositions des commissions: FF
Frick Bruno (C, SZ), Berichterstatter: Artikel 152 enthält einKernstück unseres parlamentarischen Selbstverständnisses:Das Instruktionsverbot entspricht dem heutigen Recht. Eswird inhaltlich keine Änderung vorgenommen.Wir bitten Sie, dem Entwurf des Bundesrates bzw. dem Be-schluss des Nationalrates zuzustimmen.
Angenommen – Adopté
Constitution fédérale. Réforme 128 E 9 mars 1998
Bulletin officiel de l’Assemblée fédérale / Tiré à part
Art. 153Anträge der Kommissionen: BBlPropositions des commissions: FF
Frick Bruno (C, SZ), Berichterstatter: Artikel 153 enthält einekleine materielle Änderung gegenüber dem Entwurf des Bun-desrates. Nach dem Bundesrat sollen Ratsmitglieder nur fürÄusserungen in den Räten und in den Kommissionen sowiein den Fraktionen nicht verantwortlich gemacht werden kön-nen. Wir haben das auf «in den Räten und in deren Organen»ausgedehnt; einerseits ist es sprachlich knapper gefasst, undzum zweiten gibt es auch Organe der Räte, beispielsweiseBüros oder Delegationen, die ebenfalls von der Immunität er-fasst sind.Die Meinung ist, dass die gesamte parlamentarische Tätig-keit davon erfasst ist und nicht bloss ein Teil.
Angenommen – Adopté
Präsident: Wir könnten nun zum 3. Abschnitt («Zuständig-keiten») übergehen. Zu Artikel 153a ist Ihnen soeben einRückweisungsantrag Beerli ausgeteilt worden. Ich schlagejedoch vor, hier die Beratungen abzubrechen und auf dieApril-Sondersession zu verschieben.
Büttiker Rolf (R, SO): Wir haben heute mit der Diskussionüber die Vorlage A2 begonnen; morgen geht es damit nichtweiter, die ganze Sache kommt erst in der April-Sonderses-sion wieder auf die Traktandenliste. Ich kann mich mit dieserÜbungsanlage schwer anfreunden, das muss ich Ihnen sa-gen, und ich bin damit auch nicht alleine.Normalerweise tagen wir am Montag etwas länger. VieleLeute haben sich jetzt auf die Bundesratswahlen vom näch-sten Mittwoch «eingeschossen», und darüber wird jetzt sehrviel diskutiert.Der Schlüsselartikel dieser Verfassungsrevision ist die ganzeGeschichte rund um die Kantonsklausel. Der Entscheidheute hat nicht direkt einen Bezug zum nächsten Mittwoch –wir können nichts mehr ändern –, aber für viele Leute hat erindirekt schon einen Bezug. Der Druck auf die Kantonsklau-sel ist in den letzten Wochen natürlich gewachsen.Bedenken Sie, was vor allem der Ständerat im Lauf der Zeitmit dieser Kantonsklausel gemacht hat: Wir haben zurückge-stellt, wir haben die Vorlage des Nationalrates sistiert, wir ha-ben auf die Verfassungsrevision verschoben, wir haben aufdie Staatsleitungsrevision verschoben – und heute verschie-ben wir diese Diskussion auf die Sondersession! Nach demMotto «Aus den Augen, aus dem Sinn» wird die Diskussionin den April verschoben, und dann kann es weitergehen. DieLeute hätten schon ein Interesse daran gehabt zu wissen,was der Ständerat – nachdem der Nationalrat die Klausel ge-strichen hat – dazu sagt, insbesondere zu einer Lockerung,wie sie beispielsweise Herr Danioth beantragt. Deshalb ist esfragwürdig, wenn man hier das Argument der Nachführungheranzieht – und beim Bistumsartikel ist man grosszügigüber die Nachführung hinausgegangen!Ich meine: Wenn wir heute hier abbrechen und die ganze Sa-che auf die April-Sondersession verschieben, stehen wir inbezug auf die Bundesratswahlen und in bezug auf die Kan-tonsklausel erneut schlecht da.Ich verzichte auf einen Ordnungsantrag, aber ich habe Ihnendas doch sagen wollen.
Präsident: Für das Programm ist das Büro zuständig; es ver-fügt leider nicht über die hellseherischen Fähigkeiten, die ihmHerr Büttiker gerne zuerkennen möchte. Ich stelle fest, dassdie Traktandenliste im Interesse einer beförderlichen Be-handlung der Verfassungsvorlage bereinigt wurde. Ur-sprünglich war vorgesehen, mit dem Entwurf A2 ohnehin erstin der April-Sondersession zu beginnen. Ich übernehme dieVerantwortung dafür, dass wir etwas vorwärtsgemacht ha-ben. Aber wenn Sie die Sitzung bis heute um Mitternacht fort-setzen wollen, steht dem nichts entgegen. – Ich stelle fest,dass kein Ordnungsantrag gestellt wird.
Die Beratung dieses Geschäftes wird unterbrochenLe débat sur cet objet est interrompu
30. April 1998 S 129 Bundesverfassung. Reform
Amtliches Bulletin der Bundesversammlung / Separatdruck
Dritte Sitzung – Troisième séance
Donnerstag, 30. April 1998Jeudi 30 avril 1998
08.00 h
Vorsitz – Présidence:Zimmerli Ulrich (V, BE)/Iten Andreas (R, ZG)
___________________________________________________________
96.091
Bundesverfassung.ReformConstitution fédérale.Réforme
Fortsetzung – Suite
___________________________________________________________
A2. Bundesbeschluss über eine nachgeführte Bundesverfas-sung (Art. 127–184) (Fortsetzung)A2. Arrêté fédéral relatif à une mise à jour de la Constitutionfédérale (art. 127–184) (suite)
Art. 153aAnträge der Kommissionen: BBlPropositions des commissions: FF
Antrag BeerliRückweisung an die Kommissionmit dem Auftrag, die folgende Gliederung zu prüfen:1. dem Referendum unterstehend:– Bundesgesetze;– Bundesbeschlüsse;2. nicht dem Referendum unterstehend:– einfache Bundesbeschlüsse.
Proposition BeerliRenvoi à la commissionavec le mandat d’examiner la structure suivante:1. sujets au référendum sont:– les lois fédérales;– les arrêtés fédéraux;2. ne sont pas sujets au référendum:– les arrêtés fédéraux simples.
Frick Bruno (C, SZ), Berichterstatter: Einleitend möchte ichmeiner Erwartung Ausdruck geben, dass wir heute die ge-samte Vorlage A bereinigen können, so dass wir mit Ab-schluss dieser Sondersession auch die Gesamtabstimmungüber die Vorlage A durchführen können und damit den erstengrossen Schritt zur Verfassungsrevision in unserem Rat ab-geschlossen haben.Artikel 153a regelt die Erlassformen auf Stufe Verfassung.Das war bisher nicht der Fall. Die Ausgangslage ist folgende:Heute herrscht eine verwirrliche Fülle von Erlassformen:Bundesgesetz, allgemeinverbindlicher Bundesbeschluss mitReferendum und ohne Referendum, dringlicher Bundesbe-schluss, von der Verfassung abgedeckt oder nicht, usw. – einwahres Füllhorn von Rechtsetzungsformen! Für Fachleute istdiese breite Ordnung durchaus zugänglich, für interessierteLaien und für Nichtjuristen ist sie schwer bis gar nicht ver-ständlich.
Die Verfassungskommissionen beider Räte haben parallel,jeweils in Kenntnis der Arbeit der anderen, daran gearbeitet,zuerst in den Subkommissionen, dann wurde das Ergebnisvon der Gesamtkommission verabschiedet. Das Produkt istder vorliegende Artikel 153a, Produkt einer intensiven Arbeit,bei der sehr viele Varianten und Möglichkeiten geprüft wur-den. Wir haben uns für folgendes System entschieden: ZweiKriterien sind massgebend, um die Erlassformen zu regeln.Das erste ist das Referendum. Es soll bereits aus der Erlass-form ersichtlich sein: Hat dieser Beschluss dem Referendumunterlegen oder nicht, bzw. kann das Referendum ergriffenwerden? Das zweite Kriterium ist die Trennung in rechtset-zende und nicht rechtsetzende Akte; nicht rechtsetzendesind Einzelakte oder Genehmigungen von Staatsverträgen.Auch hier soll klar sein, um welche Akte es sich handelt undob sie dem Referendum unterliegen. Wir schaffen also vierGefässe, die unter dem Oberbegriff «Erlasse» zusammenge-fasst sind. Zuerst wird bei den rechtsetzenden Erlassen unterschieden:Wer setzt das Recht, setzt es das Parlament, oder setzt esder Bundesrat? Wenn das Parlament das Recht setzt, sindes die Bundesgesetze, diese sind referendumsfähig.Das zweite Gefäss: Wenn das Parlament gesetzesergän-zende Bestimmungen erlässt – das sind heute Bundesbe-schlüsse, die nicht dem Referendum unterliegen –, bezeich-nen wir diese neu als Verordnungen. «Verordnung», daraufkomme ich noch zurück, ist ein neuer Begriff, er ist aber sach-lich der richtige. Der Vollständigkeit halber sind rechtset-zende Erlasse, die der Bundesrat oder das Bundesgericht er-lässt, ebenfalls zu nennen; sie sind das Korrelat zum zweitenGefäss.Bei den Gefässen drei und vier wird Recht angewendet: Esgeht um die Genehmigung von Staatsverträgen und Einzel-akte. Wenn sie dem Referendum unterliegen, werden sie alsBundesbeschluss, wenn sie nicht dem Referendum unterlie-gen, als einfacher Bundesbeschluss bezeichnet. Aufgrundder Art, wie sie in Artikel 153 zusammengefasst sind, ist er-stens immer leicht erkennbar, ob es sich grundsätzlich umGesetzgebung bzw. Rechtsetzung handelt oder nicht, und esist zweitens ersichtlich, ob ein referendumsfähiger oder einnicht referendumsfähiger Erlass vorliegt.Neu in diesem Zusammenhang ist nur der Begriff «Verord-nung», der auch für das Parlament Verwendung finden soll;der Nationalrat hat sogar den Begriff «Parlamentsverord-nung» gewählt. Dort, wo das Parlament, National- und Stän-derat, eine gesetzesergänzende Regelung erlässt, ist esdem Inhalt nach eine Verordnung. In einzelnen Kantonenwird dies als Dekret, in vielen als Verordnung des Kantons-rates oder Grossrates bezeichnet. Wir haben uns für denBegriff Verordnung entschieden, auch wenn er bisher nichtim Bundesrecht Platz fand, weil er ganz klar regelt: Wennder Bundesrat eine gesetzesergänzende oder vollziehendeRegelung erlässt, ist es – basierend auf einem Gesetz –eine Verordnung; wenn das Parlament aufgrund eines Ge-setzes – es gibt solche, beispielsweise die Regelung überdie Pensionskasse des Bundes – ergänzende Bestimmun-gen erlässt, ist es auch eine Verordnung. Somit wird immerklar erkennbar, ob ein Erlass selber Gesetz oder nur dessenErgänzung oder Vollzug ist.Der Nationalrat hat dieser Regelung ganz eindeutig zuge-stimmt; umstritten war nur die Frage, wie die Verordnungendes Parlamentes zu bezeichnen sind: Sind sie auf der StufeVerfassung als «Verordnungen» oder als «Parlamentsver-ordnungen» zu bezeichnen? Der Nationalrat hat sich für denBegriff «Parlamentsverordnung» entschieden; wir haben unsdagegen ausgesprochen, und zwar deshalb, weil die ande-ren Verordnungen – die Verordnungen des Bundesgerichtesund des Bundesrates – auf Verfassungsstufe auch nicht als«Bundesgerichtsverordnung» oder «Bundesratsverordnung»bezeichnet sind. In der Praxis wird sich dieser Begriff der Par-lamentsverordnung möglicherweise einbürgern.Nun hat Frau Beerli einen Rückweisungsantrag gestellt. Ichbitte sie, ihn zu begründen, damit ich anschliessend daraufantworten kann, bevor wir dann die Beratung fortsetzen unddarüber abstimmen.
Constitution fédérale. Réforme 130 E 30 avril 1998
Bulletin officiel de l’Assemblée fédérale / Tiré à part
Beerli Christine (R, BE): Erlauben Sie mir kurz zwei Vorbe-merkungen:1. Ich habe einen Rückweisungsantrag gestellt, weil ich nichtMitglied der Kommission bin und es deshalb als vermessenangesehen hätte, wenn ich Ihnen hier von aussen einen for-mulierten Antrag unterbreitet hätte. Mir ist jedoch klar, wie ichpersönlich den Verfassungsartikel formuliert haben möchte,und ich werde mir erlauben, Ihnen am Schluss eine solcheFassung vorzulesen.2. Ich glaube nicht, dass es richtig ist, heute zu sagen: Mankann auf diese Rückweisungsantrag nicht eingehen, weil unseine Rückweisung den Terminplan über den Haufen werfenwürde. Es ist gut möglich, dass sich die Kommission dieserFrage bis zur Junisession noch einmal annimmt und dass wirdie Schlussabstimmung über diesen Teil der Verfassungsre-vision im Juni vornehmen können. Ich glaube nicht, dass diesein grosses Problem darstellt – schon gar nicht, wenn mansieht, welche gewichtigen Differenzen im gesamten gesehenzwischen Nationalrat und Ständerat vorliegen. Diese eherkleine und eher formale Differenz kann auf jeden Fall in derZeit zwischen heute und der Junisession noch bereinigt wer-den.Wieso habe ich diesen Rückweisungsantrag eingereicht,wieso kann ich mich nicht mit der Version befreunden, wie sieuns von der Kommission unterbreitet wird? Für mich ist dieVersion der Kommission sehr kompliziert. Sie knüpft nichtnur durchgehend – was auch richtig wäre – am Kriterium derReferendumspflicht an, sondern sie geht auch durchgehenddavon aus, dass zwischen rechtsetzenden und nicht rechset-zenden Erlassen unterschieden werden muss. Dies ist ge-rade bei Beschlüssen der Bundesversammlung ohne Refe-rendum recht problematisch, denn heute werden der Unter-schied und die Grenze zwischen Rechtsetzung und soge-nannten Einzelakten immer fliessender. Sehr häufig werdenin der Praxis – wir sehen dies im täglichen Leben – keine ei-gentlichen Rechtssätze mehr erlassen, sondern diese Ein-zelbeschlüsse werden praktisch in Gesetzesform verpackt.Ich erinnere an Programme, an Zielartikel, an Ausgabenbe-schlüsse, an Anweisungen an die Verwaltung; es wird in die-sen Fällen ein Einzelbeschluss in Gesetzesform verpackt.Der Begriff des Rechtssatzes stammt ursprünglich aus demZivil- und Strafrecht – es werden Rechte und Pflichten desRechtsadressaten verbrieft –; er passt eigentlich nur auf dasVerhaltensrecht.Unbefriedigend ist für mich auch, dass das Erlassen von Ver-ordnungen, welches wirklich ein Akt ist, der von der Exeku-tive ausgeht, neu auf das Parlament ausgedehnt wird. Ichglaube, hier wird eine Neuerung eingeführt, die nicht üblichist und die im allgemeinen Leben – in der Praxis und bei unsallen – zu Verwirrungen führen wird.Ich schlage folgendes vor: Wir unterscheiden ganz klar nurzwischen Akten, die dem Referendum unterstehen, und sol-chen, die nicht dem Referendum unterstehen, und dann in-nerhalb derjenigen, die dem Referendum unterstehen, wie-derum zwischen rechtsetzenden und nicht rechtsetzenden –nämlich zwischen Bundesgesetz und Bundesbeschluss –;weiter belassen wir bei denjenigen Akten, die nicht dem Re-ferendum unterstehen, die Bezeichnung «einfacher Bundes-beschluss». Diese Regelung ist viel klarer, viel einfacher; sieunterscheidet im Bereich der Erlasse, die nicht dem Referen-dum unterstehen, nicht zwei weitere Erlassformen, sondernsie belässt es beim einfachen Bundesbeschluss. Sie nimmtden Begriff «Parlamentsverordnung», der bis heute nicht ge-braucht worden ist, nicht auf. Die Regelung ist klar, einfachund praktikabel.Ich möchte Ihnen kurz vorlesen, wie ich mir einen Artikel153a vorstelle: «Die Bundesversammlung erlässt referen-dumspflichtige Bestimmungen in der Form des Bundesgeset-zes oder des Bundesbeschlusses. Nicht referendumspflich-tige Bestimmungen ergehen in der Form des einfachen Bun-desbeschlusses.» Damit hätten wir die ganze Palette abge-deckt, hätten aber nicht eine unnötige Aufteilung bei dennicht referendumspflichtigen Bestimmungen.Ich bitte Sie, diesen Artikel der Kommission zurückzugeben,damit sie ihn unter Einbezug der Leitlinien, die ich aufgezeigt
habe, noch einmal überprüfen kann. Wie gesagt: Es gibtkeine Verzögerung; es ist ohne weiteres möglich, dass wir imJuni entscheiden, dann die Bereinigung vornehmen und dieSchlussabstimmung durchführen. Wir haben dann eine be-friedigende Lösung, eine Lösung, die auch der Praxis, wie wirsie bis heute leben, entspricht und die nicht unnötige neueKomplizierungen einbaut.
Frick Bruno (C, SZ), Berichterstatter: Ich kann dazu wie folgtStellung nehmen: Vorauszuschicken ist, dass Artikel 153adie Erlassformen der Bundesversammlung regelt und nichtjene des Bundesrates; diese sind bei den Kompetenzen desBundesrates angesiedelt. Nun sagt Frau Beerli zunächst fol-gendes: Es sei nur ein Kriterium anzuwenden, es sei nurnoch die Frage der Referendumsfähigkeit massgebend undnicht mehr die Frage, ob rechtsetzend oder nicht.Wir haben in der Kommission die Ideen, die Frau Beerli heuteunterbreitet hat, gründlich behandelt. Dabei haben wir ent-schieden, dass wir beide Unterscheidungen machen wollen;dies, weil sie mehrheitlich heute noch gängig und für den An-wender, auch für das Parlament, leicht verständlich ist. Es istklar, dass viele Erlasse Rechtsanwendung und Rechtset-zung enthalten. Dort geht das Kriterium der Rechtsetzungvor.Die Frage ist, ob Sie zurückweisen sollen. Genau jene Über-legungen und Argumente, die Frau Beerli angestellt hat, ha-ben wir in der Kommission sehr lange beraten. Wir erinnernuns an die intensive Beratung, an der auch der Kommissions-präsident teilgenommen hat und nach der wir uns zugunstender vorliegenden Fassung entschieden haben. Rückweisungan eine Kommission heisst ja, etwas Neues prüfen zu lassen.Das Modell, das Frau Beerli anregt, ist im Papier desBundesamtes für Justiz bereits enthalten. Es ist dasModell 1, das uns dort vorgeschlagen wird, genau mit denArgumenten, wie sie Frau Beerli jetzt vorträgt. Es ist ein Mo-dell, das wir bereits gründlich geprüft und dann verworfen ha-ben.Nachdem man von diesen Vorschlägen des Bundesamtesfür Justiz bereits Kenntnis hat und in der Kommission bereitsausführlich auch über den Vorschlag von Frau Beerli gespro-chen hat, macht es keinen Sinn, das Ganze an die Kommis-sion zurückzuweisen.Die Kommission hat bewusst den vorliegenden Entscheidgetroffen. Aus diesem Grund hätte es, so meine ich, auchmöglich sein müssen, heute einen Antrag vorzulegen undnicht einfach die Rückweisung zu verlangen. Die Kommis-sion kann gar keinen solchen Auftrag entgegennehmen. Siehat die Prüfung bereits gemacht und der anderen Lösungden Vorzug gegeben.Das zeitliche Element kommt hinzu; es ist jedoch nicht aus-schlaggebend. Nachdem die Kommission beraten und ent-schieden hat, macht es keinen Sinn, jetzt die ganz Übungnochmals um drei Monate zu verzögern. Es wäre die einzigeBestimmung, die wir heute nicht verabschieden könnten; daswürde dazu führen, dass wir in bezug auf die Behandlung derVorlage A wiederum drei Monate verlieren würden.Schliesslich ist beizufügen, dass der Vorschlag von FrauBeerli nur eine Auswirkung hätte: Er eliminiert den Begriff derVerordnung; das ist, glaube ich, auch ihr Hauptbestreben.Der Begriff der Verordnung für Erlasse der Bundesversamm-lung stört sie. Es ist in der Tat ein neuer rechtlicher Begriff, esist aber inhaltlich eben der richtige. Wenn das Parlament ge-stützt auf ein Gesetz ergänzende Bestimmungen erlässt,macht es dasselbe wie der Bundesrat und das Bundesge-richt, die auch gestützt auf ein Gesetz ergänzende Bestim-mungen erlassen; diese nennen wir dann Verordnung. Alsoist es konsequent, wenn wir das auf seiten des Parlamentesauch tun und sie als Verordnung bezeichnen.Ich bitte Sie aus diesen Gründen, darauf zu verzichten, dasGanze an die Kommission zurückzuweisen.
Rhinow René (R, BL): Ich weiche hier etwas vom Votum desBerichterstatters ab und bitte ihn um Nachsicht dafür. Ichmöchte zur zeitlichen Dimension eine kurze Anmerkung ein-fügen.
30. April 1998 S 131 Bundesverfassung. Reform
Amtliches Bulletin der Bundesversammlung / Separatdruck
Wir haben gestern zusammen mit Herrn Nationalrat Deissdie zeitlichen Probleme besprochen; es ist durchaus möglich,dass die Kommission diese Frage nochmals prüft, weil wir zuBeginn der Sommersession die Gesamtabstimmung immernoch durchführen können. Anders gesagt: Wir können in derSommersession diese Frage durchaus noch prüfen, wir ha-ben entsprechende Kommissionssitzungen anberaumt. Eswürde also aus zeitlichen Gründen nichts entgegenstehen;das ganze Verfahren würde dadurch nicht blockiert.Zur Sache selber möchte ich mich als Kommissionspräsidentnicht äussern; Herr Frick hat Ihnen die Meinung der Mehrheitdargelegt. Die Mitglieder der Kommission wissen, dass meinHerz für den Antrag Beerli schlägt und ich mit der von derKommission beschlossenen Fassung meine Mühe habe.Aber eben: Das hätte ich nur gesagt, wenn ich nicht Kommis-sionspräsident wäre ....
Koller Arnold, Bundesrat: Der Bundesrat ist hier in einer et-was besonderen Situation, weil dieser Artikel 153a im bun-desrätlichen Entwurf noch nicht enthalten war. Dem Bundes-rat war dann aber, als die Kommissionen dieses Problem derGesetzgebung von Rechtsformen aufgenommen haben, ansich klar – da stimmt auch Frau Beerli mit allen überein –,dass das heutige System recht unbefriedigend ist.Das war der Ausgangspunkt der Bemühungen der beiden Ver-fassungskommissionen, in enger Zusammenarbeit mit mei-nem Bundesamt für Justiz hier zu einem einfacheren und erst-mals geschlossenen System der Rechtsetzungsformen zukommen. Beim bisherigen Zustand befriedigt ja vor allem dasNebeneinander von Bundesgesetzen und allgemeinverbind-lichen referendumsfähigen Bundesbeschlüssen nicht, und esbefriedigt am bisherigen System auch nicht, dass anlässlichder Revision des Geschäftsverkehrsgesetzes 1962 der allge-meinverbindliche referendumsfähige Bundesbeschluss aufrechtsetzende Bestimmungen eingeschränkt wurde. Weil das geltende System somit zweifellos verbesserungsfä-hig und -würdig ist, hat der Bundesrat gegen diese Verbesse-rungen nichts einzuwenden.Die Frage, ob es sich lohnt, die Sache gemäss Antrag Beerlinoch einmal zu prüfen, müssen Sie entscheiden. Ich muss Ih-nen offen eingestehen, dass ich da an die Grenzen meinerKompetenz komme. Persönlich hatte ich nicht die nötige Zeit,die ganze Thematik zu verinnerlichen.
Frick Bruno (C, SZ), Berichterstatter: Ein letztes Wort zurzeitlichen Komponente: Natürlich können wir dies in unsererKommission vielleicht bis zum Sommer bewerkstelligen.Aber es ist ja nicht der Ständerat allein, der darüber entschei-det. Ich möchte daran erinnern, dass beide Kommissionenparallel und in Kontakt miteinander in Subkommissionen fürdiese Bestimmung mehrere Monate brauchten. Wenn wirwieder von vorne anfangen, muss auch der Nationalrat wie-der von vorne anfangen. Das bedingt eine zusätzliche Verzö-gerung. Aus diesem Grunde meine ich: Es gibt Lösungen, dietauglich sind. Die vorliegende der Kommission ist eine. Wennsie nach vielen Bemühungen entstanden ist und eineMehrheit gefunden hat, sollten wir einen Schlusspunktmachen und nicht ein Jahr später wieder von vorne begin-nen!
Abstimmung – VoteFür den Antrag der Kommission 22 StimmenFür den Antrag Beerli 13 Stimmen
Art. 130 Abs. 1 Bst. d; 131 Abs. 1 Bst. b, c, cbis; 150 Abs. 3, 4Art. 130 al. 1 let. d; 131 al. 1 let. b, c, cbis; 150 al. 3, 4
Präsident: Formal sind noch drei Bestimmungen anzupas-sen, die wir zurückgestellt haben. Es sind die Änderungenvorzunehmen, wie sie der Nationalrat bereits beschlossenhat.
Frick Bruno (C, SZ), Berichterstatter: Wir haben diese Be-stimmungen immer mit dem Hinweis zurückgestellt, dass der
Beschluss bei Artikel 153a auch der Entscheid über dieseBestimmungen sei.
Angenommen – Adopté
Art. 154Antrag der KommissionAbs. 1, 1bis, 2BBlAbs. 1terStreichen
Art. 154Proposition de la commissionAl. 1, 1bis, 2FFAl. 1terBiffer
Frick Bruno (C, SZ), Berichterstatter: Artikel 154 geht auf dieArbeiten der Staatspolitischen Kommissionen zurück undgibt erstmals in der Verfassung die Definition und Umschrei-bung der Bundesgesetze. Dies erfolgt in Absatz 1bis.Absatz 2 regelt danach die Möglichkeit, Rechtsetzungsbe-fugnisse auf das Parlament oder eben auf den Bundesrat zuübertragen. Absatz 1bis regelt, was Gegenstand eines Bun-desgesetzes sein muss. Genannt wird ein Katalog von sie-ben Bestimmungen, welche bereits heute geltendes Rechtsind; dieser Katalog entspricht der heutigen Lehre und Pra-xis, ist also reine Nachführung. Mit dem Wort «insbeson-dere» haben wir sichergestellt und auch zum Ausdruck gege-ben, dass wir einer Rechtsentwicklung nicht im Wege stehen.Absatz 1, die erstmalige Normierung des Gesetzesbegriffesund seiner Kriterien auf Verfassungsstufe, bringt drei wesent-liche Vorteile und Klärungen: Zum ersten wird erstmals klarund transparent gemacht, was Gegenstand eines Gesetzesist. Zum zweiten werden Garantien zur Demokratie und zumRechtsstaat gesetzt, weil daraus erkenntlich wird, was einGesetz ist, was in diese grundlegende Rechtsform zu kleidenist. Zum dritten wird leicht verständlich, welches die Trag-weite eines Referendums ist, weil nämlich dann bei all diesenGesetzen, die nach diesen Kriterien zu erlassen sind, klar ist,dass das Referendum möglich ist.Gegenüber der Fassung des Nationalrates hat unsere Kom-mission zwei Änderungen vorgenommen: Zum ersten wirdAbsatz 1ter gestrichen. Ein Antrag Vallender hat ihm in dernationalrätlichen Beratung zum Durchbruch verholfen. Waswill dieser Absatz 1ter, und warum haben wir ihn gestrichen?Es ist in der Tat so, dass rechtsetzende Verordnungen einerErmächtigung bedürfen, wenn das Parlament sie erlässt.Frau Vallender sagte nun, es brauche eine ausdrückliche Er-mächtigung in der Bundesverfassung oder in Bundesgeset-zen; eine stillschweigende genügt also nicht mehr.Wenn Absatz 1ter die besondere Ermächtigung des Parla-mentes verlangt, bedeutet das folgendes: Das Parlamentdarf die Kompetenz, rechtsetzende Erlasse in Vollzug oderErgänzung eines Bundesgesetzes zu beschliessen, nichtmehr stillschweigend ableiten. Es darf dies nur, wenn einebesondere, eine ausdrückliche Ermächtigung besteht. Damitwird klar, dass Absatz 1ter eigentlich eine Misstrauensbe-stimmung gegenüber National- und Ständerat ist. DiesesMisstrauen ist aber nicht nötig; das Parlament muss hier nichtzurückgebunden werden. National- und Ständerat haben bis-her nur sehr zurückhaltend von diesem «Verordnungsrecht»Gebrauch gemacht. Sie brauchen diese «Bremse» nicht,denn es ist bereits in Absatz 2 sachlich enthalten, was dieKompetenz des Parlamentes ist.In Absatz 2 streicht unsere Kommission den zweiten Satz,nämlich: «Die ermächtigende Bestimmung muss die Grund-züge der Regelung festlegen.» Dieser Satz ist an sich richtig,er ist aber im neuen System von National- und Ständeratüberflüssig geworden. Wenn wir in Absatz 1bis bereits denKatalog nennen, muss in Absatz 2 diese Regelung nicht wie-derholt werden.
Constitution fédérale. Réforme 132 E 30 avril 1998
Bulletin officiel de l’Assemblée fédérale / Tiré à part
Ich bitte Sie daher, der Fassung der Kommission zuzustim-men.
Angenommen – Adopté
Art. 155Anträge der Kommissionen: BBlPropositions des commissions: FF
Frick Bruno (C, SZ), Berichterstatter: Die dringliche Gesetz-gebung bedarf keiner Erläuterungen mehr. Es wird das heutegeltende Recht mit der neuen Terminologie übernommen,die wir bei Artikel 153a beschlossen haben.
Angenommen – Adopté
Art. 156Anträge der Kommissionen: BBlPropositions des commissions: FF
Art. 172 Abs. 1, 2Antrag der KommissionAbs. 1MehrheitZustimmung zum Beschluss des NationalratesMinderheit(Forster)BBl
Abs. 2BBl
Art. 172 al. 1, 2Proposition de la commissionAl. 1MajoritéAdhérer à la décision du Conseil nationalMinorité(Forster)FF
Al. 2FF
Präsident: Diese Bestimmungen werden gemeinsam disku-tiert, weil beide sachlich zusammengehören.
Frick Bruno (C, SZ), Berichterstatter: Ich bitte darum, dasswir die Absätze getrennt behandeln, weil sie nicht genau den-selben Stoff betreffen.Es geht in Artikel 156 um die Frage: Wer führt die Gestaltungder Beziehungen der Schweiz zum Ausland? Heute liegt dieKompetenz zur Gestaltung klar beim Bundesrat. Das Parla-ment hat dort eine Mitwirkungsmöglichkeit, wo es sie wahr-nehmen will. Das Parlament kann also Ziele in der Aussen-politik festlegen, aber es muss nicht.Heute liegt die Führungsrolle klar beim Bundesrat; überalldort, wo das Parlament den Bundesrat nicht bindet, ist er frei.Das Parlament nimmt heute Kenntnis von den Berichten desBundesrates, von seinen aussenpolitischen Zielen. Wenn wirnun das System ändern, wie es die Minderheit will – ich be-daure es, Frau Forster, dass ich die Begründung gegen IhrenAntrag anführen muss, bevor Sie ihn selber erklärt haben –,müsste das Parlament alle Ziele festlegen. Das ist ein ent-scheidender Systemwechsel. Heute kann das Parlament dieZiele festlegen, wo es will, aber es muss nicht. Neu müsstedas Parlament die Ziele in allen wichtigen Bereichen festle-gen. Diesen Systemwechsel hat unsere Kommission mitüberwiegender Mehrheit abgelehnt. Sie möchte die Füh-rungsrolle in der Aussenpolitik weiterhin beim Bundesrat be-lassen. Wir glauben auch, dass dieser Systemwechsel mitder Nachführung an sich nicht mehr vereinbar wäre. Es wäreauch ein wesentlicher Systemwechsel der rechtlichen Pflich-ten, weil nun das Parlament die aussenpolitische Führungs-rolle übernehmen müsste.
Aus diesen Gründen – ich habe die Antwort auf die Begrün-dung der Minderheit leider bereits im voraus geben müssen –bitte ich Sie, Artikel 156 Absatz 1 in der Fassung der Mehr-heit zu genehmigen.
Forster Erika (R, SG): Anfänglich wurde der Minderheitsan-trag, wie er auf der Fahne steht, von den verschiedenstenSeiten unterstützt. Die SPK und die APK beider Räte habensich in diesem Sinne ausgesprochen, ebenso die Mehrheitder Verfassungskommission des Nationalrates. Erst im Na-tionalrat ist der Antrag mit 86 zu 48 Stimmen abgelehnt wor-den.Die Bundesversammlung hat heute schon die Kompetenz,aussenpolitische Ziele festzulegen, nur hat sie davon in derRegel keinen Gebrauch gemacht. Insofern bewegt sich derMinderheitsantrag also durchaus im Rahmen der rechtlichenNachführung.Wir sind uns darüber im klaren, dass auf dem Gebiet der Aus-senpolitik keine starre Kompetenzaufteilung zwischen Bun-desrat und Bundesversammlung möglich ist, sondern dasses um parallele, sich überlappende Zuständigkeiten geht.Bundesrat und Parlament sind daher auf Kooperation undZusammenwirkung angewiesen.Ausdruck dieses neuen Verständnisses der Zusammenarbeitwar ja wohl die Präzisierung des Geschäftsverkehrsgesetzesdurch Artikel 47bis a, der nach Meinung des Bundesrates einrecht weitgehendes Mitwirkungsrecht beinhaltet. Der Bun-desrat sieht denn auch keinen weiteren Handlungsbedarf.Ich sehe das allerdings anders.Es ist doch eine unbestrittene Tatsache, dass die Aussenpo-litik je länger, je mehr in die Innenpolitik eingreift. Aussenpo-litik und Innenpolitik sind vielfach kaum mehr voneinander zutrennen und überlappen sich in vielen Bereichen. Währendwir als Parlament in der Innenpolitik den Gang der Dinge we-sentlich bestimmen, können wir in Sachen Aussenpolitik nuram Rande mitreden. Gewiss, wir werden konsultiert, abereine eigentliche Mitsprache ist uns verwehrt. Deshalb bedarfes – das ist meine tiefe Überzeugung – in Sachen Aussenpo-litik kompensatorischer Einflussmöglichkeiten des Parlamen-tes. Diese wären mit meinem Antrag gegeben.Sie haben gehört, dass die Mehrheit der Kommission nichtgrundsätzlich gegen eine vermehrte Mitwirkung des Parla-mentes in Sachen Aussenpolitik ist. Der Präsident hat ausge-führt, dass die Mehrheit der Kommission aber der Meinungist, dass das über die Nachführung hinausgeht.Um der Sache zu dienen und auch deshalb, weil diesesThema – davon gehe ich aus – in der Staatsleitungsreform,die ja nun beschlossene Sache ist, wieder aufgenommenwerden wird, ziehe ich meinen Minderheitsantrag zurück. Ichwerde dann aber darauf achten, dass diese Fragen in derStaatsleitungsreform in meinem Sinne geregelt werden.
Koller Arnold, Bundesrat: Ich möchte Frau Forster danken,dass sie den Minderheitsantrag zurückgezogen hat, weil sichdamit vor allem auch heikle Begriffsprobleme gestellt hätten.Es ist einfach nie ganz klar geworden, was mit diesen«grundlegenden Zielen der Aussenpolitik» gemeint war,nachdem schon im Kompetenzteil in Artikel 49 wichtige aus-senpolitische Ziele festgelegt sind.Ich möchte zuhanden des Protokolls festhalten, dass sich derBundesrat bewusst ist und daran interessiert ist, dass dasParlament an der Aussenpolitik vermehrt mitwirkt. Wir habendas auch in Artikel 47bis a des Geschäftsverkehrsgesetzesneuestens gesetzlich abgesichert. Der Bundesrat kann fürsich in Anspruch nehmen – auf jeden Fall in der letzten Zeit,vor allem seit der Ablehnung des EWR-Vertrages –, dass ersich um eine vermehrte und intensive Kontaktnahme und Mit-arbeit des Parlamentes im Bereich der Aussenpolitik bemühthat. Ich erinnere an die Botschaft vom 24. Februar 1993 überdas Folgeprogramm, wo wir unsere integrationspolitischenAbsichten dargelegt haben. 1995 hat der Bundesrat erneuteinen Zwischenbericht zur Integrationspolitik vorgelegt. Diesektoriellen Verhandlungen mit der EU werden in ständigerKonsultation und Abstimmung mit den AussenpolitischenKommissionen und den Bundesratsparteien geführt. Auch
30. April 1998 S 133 Bundesverfassung. Reform
Amtliches Bulletin der Bundesversammlung / Separatdruck
bei der Beteiligung an der Partnerschaft für den Frieden, dieals politische Massnahme nach der geltenden Verfassung indie Kompetenz des Bundesrates fällt, hat der Bundesratschon sehr frühzeitig den Kontakt mit den AussenpolitischenKommissionen gesucht und aufgenommen.Im übrigen sind wir selbstverständlich bereit, auch im Bereichder Staatsleitungsreform diese Probleme wieder mit Ihnen zubehandeln.
Frick Bruno (C, SZ), Berichterstatter: In Artikel 156 Absatz 2geht es um eine politisch sehr interessante Frage: Soll derBundesrat selber entscheiden, welche Staatsverträge er demParlament zur Genehmigung vorlegt, oder gibt es objektiveKriterien dafür? In der heutigen Praxis handhabt der Bundes-rat die Bestimmungen, die er selber entwickelt hat, recht frei.Der Bundesrat entscheidet immer im Einzelfall selber, ob essich um einen Staatsvertrag von untergeordneter Bedeutunghandelt – den der Bundesrat selber genehmigen kann – oderob er erhöhte Bedeutung hat, so dass die Zustimmung desParlamentes eingeholt werden muss.Die Kommissionsmehrheit ist wie der Nationalrat der Mei-nung, dass es objektive Kriterien dafür gibt, welche in einemGesetz zu normieren sind. Die Minderheit will das nicht; dieMinderheit will es weiterhin dem Ermessen und Belieben desBundesrates anheimstellen, ob das Parlament über einenStaatsvertrag in der Genehmigung befinden kann oder nicht.Das heutige System ist ein Zirkelschluss, weil der Bundesratimmer selber entscheidet, was wichtig ist, und dem Parla-ment nur nach seinem Gutdünken Staatsverträge zur Geneh-migung vorlegt. Die Mehrheit ist der Überzeugung, dass eshierfür objektive Kriterien braucht, welche der heutigen Lehreentsprechen. Diese deckt sich grösstenteils auch mit der Pra-xis des Bundesrates; wir unterstellen dem Bundesrat nicht,dass er missbräuchlich handelt, aber die Kommissionsmehr-heit ist der Meinung, dass diese objektiven Kriterien transpa-rent zu machen sind und nicht nur dem Belieben eines Bun-desamtes zugänglich sein dürfen. Eine rechtliche Neuerung,die über die Nachführung hinausgeht, ist das nicht. Bereitsnach heutigem Recht ist das möglich. Nach heutigem Rechtkönnten wir im Geschäftsverkehrsgesetz regeln, nach wel-chen Kriterien Staatsverträge dem Parlament vorzulegensind. Insofern geht die Mehrheit nicht über das geltendeRecht hinaus; sie sagt lediglich, dass man nun tun soll, wasman eigentlich schon seit einiger Zeit hätte tun müssen.
Inderkum Hansheiri (C, UR): Nach dem Willen der Mehrheitsollen nur solche völkerrechtlichen Verträge von der Geneh-migungspflicht der Bundesversammlung ausgenommensein, welche aufgrund von Gesetz oder völkerrechtlichemVertrag in den Zuständigkeitsbereich des Bundesrates fallen.Die Zuständigkeit des Bundesrates zur Genehmigung völker-rechtlicher Verträge soll zudem in einem eigens zu schaffen-den Gesetz geregelt werden.Demgegenüber schlägt Ihnen die Minderheit vor, bei der For-mulierung des Bundesrates zu bleiben; mit anderen Worten:Auch die Verfassung ist als Rechtsgrundlage zum Abschlussvon völkerrechtlichen Verträgen durch den Bundesrat zu be-trachten, ohne dass diese Verträge der Genehmigung durchdie Bundesversammlung bedürfen. Es entspricht – und diesist nicht unwichtig – der Praxis, dass seit 1987 drei Katego-rien von Verträgen im sogenannten vereinfachten Ab-schlussverfahren, d. h. ohne Genehmigung durch die Bun-desversammlung, geschlossen werden; nämlich erstens Ver-träge, welche der Schweiz nur Rechte, aber keine Verpflich-tungen bringen, und Verträge über die Vollziehung frühererVerträge; zweitens provisorische und dringliche Verträge unddrittens Verträge, zu deren Abschluss der Bundesrat auf-grund einer Ermächtigung, sei dies in einem Bundesgesetzoder sei dies in einem Staatsvertrag, zuständig ist.Hier muss ich nun dem Berichterstatter widersprechen:Diese Kriterien, auch wenn sie nicht in einem generell-ab-strakten Gesetz oder Erlass festgeschrieben sind, sind natür-lich auch objektiv. Diese Praxis wird, wenn auch mit gewis-sen Differenzierungen, gar als Verfassungsgewohnheits-recht bezeichnet. Ich gestatte mir, in diesem Zusammenhang
auf den Kommentar von Professor Schindler zu Artikel 85Ziffer 5 der Bundesverfassung zu verweisen.Zur Nachführung gehört auch, dass die Rechtsentwicklungnachgezeichnet, dass rechtliche Grauzonen erhellt, begriffli-che Inkohärenzen ausgeräumt und Streitfragen anhand derherrschenden Lehre und der gelebten Behördenpraxis nachMöglichkeit geklärt werden. Wenn es, mit anderen Worten,schon einer langjährigen und klaren Praxis entspricht, dassder Bundesrat gewisse Kategorien von Staatsverträgen vonsich aus, ohne Genehmigung durch die Bundesversamm-lung, abschliessen kann, wenn über die Art dieser Verträgeein allgemeiner Konsens besteht und wenn diese Praxis voneinem beachtlichen Teil der Lehre sogar als Verfassungsge-wohnheitsrecht bezeichnet wird, dann dürfte es zweifelsohnegerechtfertigt erscheinen, im Rahmen der Nachführung auchdie Verfassung als Rechtsgrundlage in Artikel 156 Absatz 2aufzunehmen; dies zumal dann, wenn man Artikel 172Absatz 2 in die Betrachtung einbezieht, was man ja tun muss.Danach kann der Bundesrat völkerrechtliche Verträge provi-sorisch anwenden und solche von geringer Tragweite selbstabschliessen, ohne dass diese Verträge eben der Genehmi-gung durch die Bundesversammlung bedürfen.Diese Kompetenz entspricht, wie erwähnt, einer gefestigtenPraxis und damit der Verfassungswirklichkeit. Ich meine da-her, dass diese Lösung den Vorzug verdient: Die Gefahr ei-ner Überdehnung besteht nicht, und die Lösung hat erst nochden Vorteil, dass auf den Erlass eines eigens zu schaffendenGesetzes verzichtet werden kann.
Rhinow René (R, BL): Ich darf das Votum des Berichterstat-ters kurz ergänzen. Herr Inderkum hat mit Recht darauf hin-gewiesen, dass es in diesem Bereich eine Praxis gebe. DiesePraxis ist unbestritten geblieben, das ist auch richtig. Ob sichdiese Praxis zu Gewohnheitsrecht verdichtet hat, darüberkönnte man unter Juristen streiten, doch möchte ich das hiernicht tun. Ich möchte Sie vielmehr darauf hinweisen, dass wirmit dem Anspruch antreten, eine Verfassung nachzuführen,und dabei gilt es eben auch, das ungeschriebene Verfas-sungsrecht zu positivieren, d. h. im Text zum Ausdruck zubringen.Nun ist es aber schwierig, solche Themen detailliert in dieVerfassung aufzunehmen. Mit der Formulierung der Kom-missionsmehrheit, das Gesetz dafür einzusetzen, kommenwir dem Anspruch der Nachführung besser nach als der Bun-desrat. Die Minderheit verweist einfach auf eine Praxis, dieüberdies – sagen wir es ehrlich – vor allem vom Bundesratselbst und seiner Direktion für Völkerrecht entwickelt wordenist. Im Bereich der Zuständigkeitsverteilung zwischen Bun-desversammlung und Bundesrat ist es nicht unproblema-tisch, wenn man einem Organ, nämlich dem Bundesrat, inder Praxis weiterhin zugesteht, seine Zuständigkeit selbst zudefinieren. Das tun wir aber, wenn wir wie bis anhin die Ver-fassungspraxis in diesem Sinne fortschreiben.Es handelt sich gewiss nicht um eine weltbewegende Ange-legenheit, aber mir scheint es im Sinne der Nachführung kon-sequent, wenn wir hier für die Kommissionsmehrheit und denNationalrat entscheiden.
Koller Arnold, Bundesrat: Es ist gut, dass wir uns hier mit die-sem Absatz 2 auseinandersetzen. Im Nationalrat ist er voll-ständig untergegangen, weil der Kampf um die Frage deraussenpolitischen Ziele derart dominiert hat.Es geht hier um die Zuständigkeit für die Genehmigung völ-kerrechtlicher Verträge. Der erste Satz von Absatz 2 hältden Grundsatz fest, wonach die Genehmigung solcher Ver-träge in die Zuständigkeit der Bundesversammlung fällt. Inder Regel erfolgt die Genehmigung zeitlich nach der Ver-tragsunterzeichnung und vor der Ratifikation durch den Bun-desrat. Die Genehmigung bedeutet ja die Ermächtigung zurRatifikation.Der zweite Satz von Absatz 2 enthält nun die Ausnahmenund damit diejenigen Fälle, in welchen der Bundesrat selberzuständig ist. Es handelt sich um drei Fälle:1. Die sogenannten Bagatellverträge, d. h. Verträge unterge-ordneter Bedeutung, wie beispielsweise solche mit rein ver-
Constitution fédérale. Réforme 134 E 30 avril 1998
Bulletin officiel de l’Assemblée fédérale / Tiré à part
waltungstechnischem Inhalt, welche keinen Verzicht aufRechte beinhalten und keine neuen Pflichten begründen.Solche Verträge werden der Bundesversammlung nachträg-lich im Rahmen des Geschäftsberichtes zur Kenntnis ge-bracht.2. Wenn es zur Wahrung wesentlicher schweizerischer Inter-essen erforderlich ist, kann der Bundesrat einen Staatsver-trag provisorisch anwenden. Die nachträgliche Genehmi-gung durch die Bundesversammlung bleibt aber vorbehalten.Es geht nicht um einen provisorischen Vertragsschluss, son-dern bloss um dessen Anwendung. Eine endgültige Bindungder Schweiz ist damit nicht verbunden, weil das Wiener Über-einkommen über das Recht der Verträge vorsieht, dass dieprovisorische Anwendung jederzeit formlos beendet werdenkann. Die Genehmigungskompetenz der Bundesversamm-lung wird hier deshalb nicht tangiert.3. In den weitaus meisten Fällen, in etwa 80 Prozent der bis-her durch den Bundesrat abgeschlossenen Abkommen, wirdder Bundesrat gesetzlich ermächtigt, einen bestimmtenStaatsvertrag abzuschliessen. Die Notwendigkeit der Entla-stung des Parlamentes hat zum häufigen Gebrauch dieserMöglichkeit geführt. Derartige Ermächtigungen kennen wirheute beispielsweise im Umweltschutzgesetz, im For-schungsgesetz, im Anag, wo wir die Kompetenz für Rückfüh-rungsabkommen haben, oder auch im Luftfahrtgesetz.Ihre Kommission beantragt nun, die verfassungsunmittelbareVertragsabschlusskompetenz des Bundesrates nicht in dienachgeführte Verfassung zu übernehmen und statt dessendie Fälle, in welchen der Bundesrat selbständige Staatsver-träge abschliessen kann, gesetzlich zu regeln. Da dies, wieausgeführt, bereits heute in der Vielzahl der vom Bundesratabgeschlossenen Staatsverträge der Fall ist – weil sie sichauf eine gesetzliche Ermächtigungsnorm stützen –, fändedies nur bei den restlichen etwa 20 Prozent der Verträge An-wendung. Betroffen wären primär die Bagatellverträge.Ich würde Ihnen daher empfehlen, dass Sie den Minderheits-antrag unterstützen. Nachdem diese Praxis bisher wirklich zukeinerlei Problemen Anlass gegeben hat, macht es wenigSinn, ein Gesetz zu schaffen, das wahrscheinlich immernoch das Risiko in sich trägt, für gewisse Fälle – gerade inder Aussenpolitik ist die Flexibilität besonders wichtig – keineabschliessende Regelung zu bringen.Das ist der Grund, weshalb Ihnen der Bundesrat empfiehlt,der Minderheit zuzustimmen.
Art. 156 Abs. 1; 172 Abs. 1 – Art. 156 al. 1; 172 al. 1
Präsident: Frau Forster hat den Minderheitsantrag zuArtikel 156 Absatz 1 zurückgezogen. Ich nehme an, das glei-che gilt für Artikel 172 Absatz 1.
Angenommen gemäss Antrag der MehrheitAdopté selon la proposition de la majorité
Art. 156 Abs. 2; 172 Abs. 2 – Art. 156 al. 2; 172 al. 2
Abstimmung – VoteFür den Antrag der Mehrheit 19 StimmenFür den Antrag der Minderheit 14 Stimmen
Art. 157Anträge der Kommissionen: BBlPropositions des commissions: FF
Art. 158Antrag der KommissionAbs. 1Zustimmung zum Beschluss des NationalratesAbs. 2BBl
Art. 158Proposition de la commissionAl. 1Adhérer à la décision du Conseil national
Al. 2FF
Frick Bruno (C, SZ), Berichterstatter: Ich möchte mich zu denArtikeln 157 bis 159 gesamthaft äussern. Die Artikel 157, Fi-nanzen, und 158, Wahlen, geben nur das geltende Rechtwieder. Ich brauche nichts beizufügen.Über Artikel 159, Oberaufsicht, haben wir bereits am 9. Märzdieses Jahres bei der Behandlung von Artikel 144 entschie-den.
Angenommen – Adopté
Art. 159aAnträge der Kommissionen: BBlPropositions des commissions: FF
Frick Bruno (C, SZ), Berichterstatter: Die Kommission hatsich in Zusammenarbeit mit der nationalrätlichen Kommis-sion entschieden, die Evaluation – auf deutsch die Überprü-fung der Wirksamkeit – in einem besonderen Artikel zu regelnund nicht bloss als Absatz 1 von Artikel 159 «Oberaufsicht»zu normieren.Der Grund ist folgender: Die Evaluation hat eine selbständigeBedeutung. Sie geht über die Oberaufsicht hinaus, weil näm-lich nicht nur Massnahmen des Bundesrates und der Bun-desverwaltung auf die Wirksamkeit überprüft werden, son-dern das Parlament auch eine Überprüfung der eigenenMassnahmen oder der Gesetzgebung an sich veranlassenkann. Es geht also um weit mehr als um die blosse Oberauf-sicht. Darum schlagen wir vor, einen eigenen Artikel dafür zusetzen.
Angenommen – Adopté
Art. 160Anträge der Kommissionen: BBlPropositions des commissions: FF
Frick Bruno (C, SZ), Berichterstatter: Artikel 160 «Beziehun-gen zwischen Bund und Kantonen» wird auf Antrag derStaatspolitischen Kommission geändert. Die Bundesver-sammlung beaufsichtigt nicht nur die Pflege der Beziehun-gen zwischen Bund und Kantonen, sondern sie sorgt aktivdafür. Das tun wir ja auch, indem wir in der Kommissionsar-beit dafür sorgen. Wir ergreifen auch gesetzgeberischeMassnahmen, damit diese Beziehungen gut funktionieren.Also deckt sich die sprachliche Änderung mit der heutigenRechtswirklichkeit.
Angenommen – Adopté
Art. 161Anträge der Kommissionen: BBlPropositions des commissions: FF
Frick Bruno (C, SZ), Berichterstatter: Ich möchte wiederumbitten, Artikel 161 absatzweise bzw. die Minderheitsanträgeeinzeln zu behandeln.Zuerst eine Erläuterung zu Absatz 1 Buchstabe c: Der Natio-nalrat will Buchstabe c streichen. Wir lassen ihn stehen undpassen ihn der Terminologie der Erlasse nach Artikel 153aan. Ausserdem geht es um den Unterschied zum normalenDringlichkeitsrecht gemäss Artikel 155. Aufgrund der Bestim-mung von Buchstabe c kann das Parlament nach unsererFassung Dringlichkeitsrecht erlassen, wo es die äussere Si-cherheit in besonderen Krisensituationen verlangt. Wenn esnach dem normalen Dringlichkeitsrecht ginge, müsste bereitsnach einem Jahr das Referendum möglich sein. Buchstabe cist also eine besondere Art von Dringlichkeitsrecht, das dieMöglichkeit bietet, eine Massnahme auf längere Zeit demReferendum zu entziehen. Wir haben uns in der Kommissiongesagt, dass ja nicht bei jeder internationalen Krise von An-fang an bereits beurteilt werden kann, wie lange sie dauert.Daher kann man Dringlichkeitsrecht im internationalen Rah-
30. April 1998 S 135 Bundesverfassung. Reform
Amtliches Bulletin der Bundesversammlung / Separatdruck
men nicht zwangsläufig nach einem Jahr dem Referendumunterstellen; vielmehr sollte es während der ganzen Krise derVerantwortung des Parlamentes anheimgestellt sein, ob esin Kraft bleibt oder nicht.Ein Abstimmungskampf über ein Dringlichkeitsrecht im inter-nationalen Verhältnis könnte für die Schweiz auch aussenpo-litisch unklug sein und Schaden anrichten. Wir wollten also inunserer Kommission mit – meiner Erinnerung nach – Ein-stimmigkeit dieses besondere Dringlichkeitsrecht regeln.Eine zweite Überlegung ist zu machen: Wozu führt das, wennwir Buchstabe c streichen? Das führt dazu, dass der Bundes-rat von seinem Dringlichkeitsrecht mehr Gebrauch macht,wie es in den Artikeln 172 und 173 vorgesehen ist. Alsowürde die Kompetenz einfach auf den Bundesrat verlagert.Der Bundesrat würde dann seinerseits das Notrecht anrufen.Dieses ist ja nach dem Antrag der Kommission der Genehmi-gung des Parlamentes entzogen. Die Fassung des National-rates ist unter diesem Gesichtspunkt eher ein Eigengoal, weiles das Parlament schwächt und Kompetenzen in Notsituatio-nen zusätzlich auf den Bundesrat verlagert.Ich habe zu den Buchstaben g, gbis und gter in Absatz 1nichts beizufügen. Wir schliessen uns diesen Änderungendes Nationalrates an. Buchstabe g ist bereits im Gesetzge-bungsbegriff von Artikel 154 enthalten. Die Buchstaben gbisund gter sind Ergänzungen, welche die StaatspolitischeKommission des Nationalrates zu Recht beantragt hat. Wirschliessen uns an.
Abs. 1 Einleitung, Bst. a–gterAl. 1 introduction, let. a–gterAngenommen – Adopté
Abs. 1 Bst. gquater – Al. 1 let. gquater
Frick Bruno (C, SZ), Berichterstatter: Ich bin bei der Minder-heit, werde aber die Mehrheitsmeinung loyal vertreten. Ichkann dies aber erst tun, wenn ich von Frau Forster gehörthabe, warum der Buchstabe gquater eingeführt werden soll.
Forster Erika (R, SG): Beide Räte haben in der Winterses-sion 1996 einer parlamentarischen Initiative der PUK PKBbetreffend den «Auftrag» Folge gegeben. Die Geschäftsprü-fungskommission hat sich ebenso klar und unmissverständ-lich für den Auftrag ausgesprochen. Im Rahmen des Regie-rungs- und Verwaltungsorganisationsgesetzes wurde derAuftrag, bezogen auf die Leitungsaufträge des Bundes, auchbereits eingeführt – wie Sie wissen, auch damals schon ge-gen den heftigen Widerstand des Bundesrates. Es handeltsich hier meines Erachtens, ähnlich wie bei Artikel 156, umein Gewaltenverständnis, nämlich um eine klare Zuweisungder Zuständigkeiten verbunden mit dem Kooperationsprinzip.Der rasche Rhythmus sowie das von uns ausdrücklich be-grüsste New Public Management gehen mit der Tatsacheeinher, dass sich das Parlament in Gesetzgebungsverfahrenmehr und mehr auf die Rahmenbedingungen beschränktbzw. beschränken muss. Dadurch entstehen zunehmendFreiräume für den Bundesrat und die Verwaltung. Das Instru-ment des Auftrages würde dem Parlament gewissermassenkompensatorisch Einflussmöglichkeiten zurückgeben – wohl-verstanden mit einem Instrument, das im Zuständigkeitsbe-reich des Bundesrates nur den Charakter einer Richtlinie hat,von der in begründeten Fällen abgewichen werden kann. Inallen anderen Fällen würde der Auftrag als gültige Weisunggelten. Der Auftrag ist deshalb für mich eine Chance, eineReform also, mit der Fehlentwicklungen in der Politik relativrasch und wirksam korrigiert werden könnten.Mit der vorgeschlagenen Verankerung würde verfassungs-mässig geklärt – und nicht vermischt, wie das da und dort be-hauptet wird –, dass die Bundesversammlung in die Zustän-digkeit des Bundesrates einwirken kann respektive wie weitsie einwirken kann. Während bekanntlich in Artikel 25 desGeschäftsreglementes unseres Rates klar umschrieben ist,was mit einer Motion verlangt werden kann, kennt der Natio-nalrat eben keine entsprechende Regelung. Dieser Mangelkönnte ein für allemal behoben und den unfruchtbaren Dis-
kussionen über formelle Zuständigkeiten ein Ende gesetztwerden.Oft wird auch argumentiert, dass mit dem vorgesehenen In-strument eine Umgehung der ordentlichen Gesetzgebungund damit der Volksrechte gegeben werde. Dem ist nicht so.Ein Auftrag kann vom Bundesrat ja keine Massnahme verlan-gen, die keine gesetzliche Grundlage hat. Fehlt diese, sokann, ja muss der Bundesrat die Ausführung des Auftragesmit gutem Grund ablehnen.Ich verstehe auch nicht, weshalb der Nationalrat den Auftragauf den Bereich der Oberaufsicht beschränken will. Die Be-schränkung des Auftrages auf den Bereich der Oberaufsichtwürde bedeuten, dass das Parlament lediglich nachträglichKorrekturen einbringen und auch nachträglich einwirkenkönnte. Eine prospektive Einflussnahme wäre nicht möglich.Der Beschluss des Nationalrates erfolgte meines Erachtensaus dem Bemühen heraus, einen Kompromiss zu finden; erscheint mir aber nicht durchdacht. Wir haben ihm zu Rechtnicht zugestimmt.Die Mehrheit der Kommission war auch hier nicht grundsätz-lich gegen das Instrument des Auftrages. Sie möchte aberdie Problematik der Zusammenarbeit zwischen den Gewal-ten im anstehenden Reformpaket «Staatsleitungsreform»angehen.Aufgrund der Vorgeschichte plagen mich allerdings Zweifel,ob uns seitens des Bundesrates in der StaatsleitungsreformVorschläge unterbreitet werden, die unser Anliegen aufneh-men. Der Bundesrat hat ja in der Kommission deutlich zu ver-stehen gegeben, dass er dem Vorschlag wenig Sympathieentgegenzubringen vermag.Deshalb bin ich der Auffassung, dass wir daran festhaltensollten, den Auftrag einzuführen; dies um so mehr, als dieAufnahme dieses Artikels in die Nachführung der Verfassungwohl kaum bewirkt, dass deswegen das ganze Projekt Bun-desverfassungsreform scheitern könnte.In diesem Sinne bitte ich Sie, dem Antrag der Minderheit zu-zustimmen.
Frick Bruno (C, SZ), Berichterstatter: Es geht eigentlich nurum die alte Streitfrage, ob das Parlament dem Bundesrat inseinem angestammten Bereich mehr oder minder verbindlichWeisungen erteilen kann. Das ist keine neue Frage, das isteine ganz alte Streitfrage.Nun wollen wir das entscheiden. Die Kommissionsminderheitwill normieren, dass der Bundesrat Aufträge entgegenneh-men muss, von denen er aber in begründeten Fällen abwei-chen kann. Das Parlament soll ihm Weisung erteilen können,in seinem Bereich zu handeln. Er kann aber abweichen, al-lerdings mit Begründungspflicht.Der Nationalrat will das im Grundsatz ebenfalls. Nachdemdarüber eine grosse Diskussion gewogt hatte, entschied ersich für die «weichgespülte» Fassung und und hat sein An-liegen bei der Oberaufsicht plaziert. In unserer Kommissionist der Antrag, dies bei der Oberaufsicht zu normieren, wie esder Nationalrat getan hat, mit überwiegendem Mehr zurück-gewiesen worden. Warum will die Mehrheit nicht, dass das inArtikel 161 Absatz 1 als selbständiger Buchstabe gquater ge-regelt wird?Erstens wird die Befürchtung des Bundesrates geteilt, esfinde ein Eingriff in seinen angestammten Kompetenzbereichstatt. Der Bundesrat erachtet die Begründungspflicht als zuschwerwiegend. Die Mehrheit bejaht dies und schliesst sichdem Bundesrat an.Zweitens sagt die Mehrheit weiter, heute sei der Auftrag imRegierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetz ausdrück-lich geregelt. Er soll aber vorderhand auf diesen Bereich be-schränkt bleiben. Für die übrigen Bereiche sei dies noch nichtzu entscheiden.Drittens sagt die Kommissionsmehrheit, im Geschäftsregle-ment des Ständerates sei zurzeit die Bestimmung enthalten,wonach das Parlament für den Bereich des Bundesrates nurEmpfehlungen – «recommandations» –, aber keine weiterge-henden Weisungen abgeben könne.Man möchte also diese Streitfrage zurzeit nicht entscheiden.Es sind auch Zweifel aufgekommen, ob Buchstabe gquater
Constitution fédérale. Réforme 136 E 30 avril 1998
Bulletin officiel de l’Assemblée fédérale / Tiré à part
mit der Nachführung noch vereinbar sei oder bereits darüberhinausgehe. Das sind die Gründe, warum sich die Mehrheitentschieden hat, den Buchstaben gquater – leider, sage ichpersönlich – nicht aufzunehmen.
Koller Arnold, Bundesrat: Der Bundesrat empfiehlt Ihnenhier ganz entschieden, der Mehrheit Ihrer Kommission zuzu-stimmen und den Minderheitsantrag abzulehnen.Zunächst möchte ich zum Formellen festhalten: Es ist jeder-mann klar und unbestritten, dass es sich hier um eine rechts-politische Neuerung handelt, die eindeutig weit über dieNachführung hinausgeht. Es ist zudem – auch das möchteich gleich von Anfang an klarstellen – nicht eine konsensfä-hige Neuerung, weil der Bundesrat entschieden dagegen ist.Sie müssen sich auch folgendes vorstellen: Es wäre schlichtnicht kommunizierbar, wenn ich allen Beteiligten an diesemNachführungsprozess zwar immer wieder erklären muss,dass wir uns strikt an das Nachführungskonzept halten – dasParlament hat höchstens bei sogenannten konsensfähigenNeuerungen Ausnahmen gemacht –, während Sie hier nunein Präjudiz einer wichtigen rechtspolitischen Neuerungschaffen würden, die nicht konsensfähig ist. Warum ist dieNeuerung nicht konsensfähig?1. Der Bundesrat ist der Meinung, dass der Auftrag ein in sichproblematisches Instrument ist, weil mit dem gleichen Begriffzwei ganz unterschiedliche Tatbestände bezeichnet werden.Dies ist generell keine gute Gesetzgebung. Sie unterscheidenzwar in bezug auf die Wirkung dieses Auftrages danach, obder Auftrag als verbindliche Weisung oder in der Zuständigkeitdes Bundesrates nur als Richtlinie wirken soll, von der be-gründet abgewichen werden darf. In der Wirkung ist der Auf-trag also im Zuständigkeitsbereich des Bundesrates und desParlamentes etwas ganz Verschiedenes; verschiedene Dingesoll man aber nicht mit dem gleichen Begriff bezeichnen.2. Der Bundesrat hat aber auch inhaltliche Bedenken. Wirsind überzeugt, dass ein solcher Auftrag, generell eingeführt,zu einer schwerwiegenden Vermischung der Kompetenzenzwischen Bundesrat und Bundesversammlung führen würde.Er scheint uns auch mit dem Legalitätsprinzip kaum verein-bar zu sein.Die Bundesversammlung muss die politischen Konzepte auf-grund des Legalitätsprinzips vor allem über Gesetze steuern,und ein Weisungsrecht ist eigentlich nur dort angebracht, wodie Gesetzgebung nicht wirkt. Dies ist beispielsweise aufdem Gebiete der inneren und äusseren Sicherheit der Fall,wo wir keine konkretisierende Gesetzgebung haben. Wir sinddurchaus bereit, die ganze Thematik im Rahmen der Staats-leitungsreform wiederaufzunehmen, denn auch der Bundes-rat ist an sich an einer Klärung der Frage von echten und un-echten Motionen interessiert. Die generelle Einführung dieses Instrumentes des Auftragesscheint uns dafür aber wirklich nicht der geeignete Weg zusein. Richtigerweise müsste nämlich klarer zwischen demZuständigkeitsbereich der Bundesversammlung und jenemdes Bundesrates unterschieden werden. Eine Differenzie-rung hätte auch hinsichtlich der Bezeichnung des Instrumen-tes zu erfolgen, wenn wir Missverständnisse vermeiden wol-len, vor allem aber hinsichtlich des Verfahrens.Wenn Sie meinen, im Zuständigkeitsbereich des Bundesra-tes sei das nur eine Richtlinie, so ist dazu zu sagen: In einemEinigungsprozess, wie er bei der Überweisung einer Motionvorgesehen ist, ist nachher der politische Druck auf den Bun-desrat so gross, dass er kaum mehr ausweichen kann. Ichglaube, es liegt im Interesse von niemandem, hier zu einerVermischung der Verantwortlichkeiten Anlass zu geben. Esist auch logisch nicht konsequent, dem Bundesrat beispiels-weise in Gesetzen Ermessensspielräume einzuräumen unddann über den Auftrag wieder direkt auf die Ausübung diesesErmessens Einfluss zu nehmen. Hingegen gebe ich gernezu: In jenen Bereichen, wo die Steuerung über die Gesetzge-bung nicht greift, sind wir bereit, das Problem im Rahmen derStaatsleitungsreform wiederaufzunehmen.Aus all diesen Gründen bitte ich Sie, der Mehrheit der Kom-mission zuzustimmen und den Minderheitsantrag abzuleh-nen.
Abstimmung – VoteFür den Antrag der Mehrheit 22 StimmenFür den Antrag der Minderheit 6 Stimmen
Abs. 1 Bst. h, i; 2, 3 – Al. 1 let. h, i; 2, 3Angenommen – Adopté
Art. 162Anträge der Kommissionen: BBlPropositions des commissions: FF
Frick Bruno (C, SZ), Berichterstatter: Sie haben vorhin be-kräftigt, dass es keine Einbrüche in die Kompetenz des Bun-desrates gibt. Also ist Artikel 162 um so mehr gerechtfertigt.
Angenommen – Adopté
Art. 163Antrag der KommissionAbs. 1, 2, 2bisBBl
Abs. 3MehrheitBBlMinderheit(Büttiker, Forster, Leumann)Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Antrag DaniothAbs. 3Die Landesgegenden, die kulturellen Regionen sowie die ge-sellschaftlichen Gruppierungen sollen im Bundesrat ange-messen vertreten sein.
Antrag AebyAbs. 3Von den sieben Mitgliedern des Bundesrates dürfen nur zweiaus demselben Kanton stammen.
Art. 163Proposition de la commissionAl. 1, 2, 2bisFF
Al. 3MajoritéFFMinorité(Büttiker, Forster, Leumann)Adhérer à la décision du Conseil national
Proposition DaniothAl. 3Les régions du pays, les régions culturelles, ainsi que lesgroupements sociaux doivent être représentés au Conseil fé-déral d’une manière équitable.
Proposition AebyAl. 3Des sept membres du Conseil fédéral, seuls deux d’entre euxpeuvent provenir du même canton.
Abs. 1, 2 – Al. 1, 2
Frick Bruno (C, SZ), Berichterstatter: Ich schlage vor, dasswir Artikel 163 absatzweise behandeln.Die Absätze 1 und 2 sind unbestritten; sie geben bisherigesRecht wieder. Gemäss dem unveränderten Absatz 1 bestehtder Bundesrat weiterhin aus sieben Mitgliedern. Bei Absatz 2haben wir die Wahl des Bundeskanzlers nicht mehr aufge-nommen. Diese Bestimmung soll herabgestuft und auf Ge-setzesebene geregelt werden.
Angenommen – Adopté
30. April 1998 S 137 Bundesverfassung. Reform
Amtliches Bulletin der Bundesversammlung / Separatdruck
Abs. 2bis – Al. 2bis
Frick Bruno (C, SZ), Berichterstatter: Es ist besser, wennHerr Büttiker zuerst den Antrag der Minderheit begründet,weil sie etwas will, das wir nicht wollen.
Büttiker Rolf (R, SO): In Absatz 2bis geht es um die Gesamt-erneuerungswahl des Bundesrates. Wir wissen nicht erst seitheute, dass die Bundesratswahlen in der heutigen Form nichtbefriedigen können. Die Bundesratswahlen und ihre Durch-führung sind auch kein Ruhmesblatt unserer Verfassungsge-schichte, vor allem werden im nachhinein immer Änderungs-vorschläge eingereicht. Bisher hat sich aber nichts bewegt,alles ist immer abgeblockt worden. Man darf etwas Selbst-kritik üben und ohne Übertreibung sagen: Vor allem der Stän-derat hat sich in der Bremserfunktion ausgetobt.Nun muss ich in bezug auf den Antrag der Minderheit zuArtikel 163 Absatz 2bis sagen, dass er – mit der Gesamter-neuerung des Bundesrates, die ja auch ausserordentlichstattfinden kann – zu radikal ist; das gebe ich gerne zu – wo-bei die Radikalen im Hinblick auf 1848 eine gute Rolle ge-spielt haben, je nachdem, mit welcher Brille man das an-schaut. Ich gebe auch zu, dass es einen Systemwechsel mitsich bringt, wenn man das einführt, und man vielleicht ander-seits dem Bundesrat auch die Kompetenz einräumen müsste,das Parlament aufzulösen. Ich gebe auch gerne zu, HerrBundesrat Koller, dass diese Bestimmung eindeutig über dieNachführung hinausgeht, weil sie einen ganzen System-wechsel und «Rattenschwanz» nach sich zieht. Ich zweifleauch nicht daran, dass diese Bestimmung mindestens fürden Bundesrat nicht akzeptabel ist, d. h. nicht konsensfähig,und auch in diesem Sinne über die Nachführung hinausgeht.Ich möchte dem Bundesrat keine schlaflosen Nächte berei-ten, und ich möchte, dass er mich nach wie vor ins Abendge-bet einschliesst.Aus all diesen Gründen – wobei ich in der Sache nach wie vorder Meinung bin, dass es bei den Bundesratswahlen etwasertragen könnte – ziehe ich diesen Antrag zurück und kon-zentriere die Kräfte auf Absatz 3.
Präsident: Der Rat nimmt von diesem nicht nachhaltigenRückzug Kenntnis.
Angenommen gemäss Antrag der MehrheitAdopté selon la proposition de la majorité
Abs. 3 – Al. 3
Frick Bruno (C, SZ), Berichterstatter: Nachdem die «Revolu-tion Büttiker» nicht stattfinden kann, gehen wir zur Kantons-klausel über. Seit einigen Jahren ist in jeder Bundesratswahldie Kantonsklausel das grosse Thema, erstmals – wie wiruns erinnern – bei der Wahl von Bundesrätin Dreifuss, dannwieder bei der jüngsten Wahl von Bundesrat Couchepin.Die Kommissionsmehrheit will bei der Kantonsklausel imRahmen der Nachführung bleiben. Der Nationalrat hat sie miteiner guten Mehrheit gestrichen.Es gibt zwei Bereiche, auf die eine Antwort zu finden ist. Dererste: Was ist Nachführung? Der zweite: Wie erreicht maneine rasche Änderung der Kantonsklausel, wenn man siewill? Ich gehe diesen beiden Fragen nach.Eine Streichung oder eine Änderung der Kantonsklausel, wiesie der Einzelantrag Aeby formuliert, geht über die Nachfüh-rung hinaus. Es ist ein wesentlicher Bestandteil des Schutzesder Kantone, insbesondere auch der kleinen vor dem Über-gewicht der grossen, wenn pro Kanton nur ein Bundesrat ge-wählt werden darf. Wenn auch Massnahmen ergriffen wur-den, die vielfach sogar als Missbrauch qualifiziert wordensind, um den Wohnsitz in den richtigen Kanton zu verlegen,so heisst das nicht, dass eine Änderung der Bestimmung mitder Nachführung vereinbar wäre. Sie ist es nach der überwie-genden Mehrheit der Kommission nicht. Es wäre eine we-sentliche rechtspolitische Änderung, die nicht im Rahmen derNachführung erfolgen darf, so wie wir auch andere Bestim-mungen zurückgebunden haben. Aus dieser Überlegung hat
der Nationalrat gestern ebenfalls den Bistumsartikel in derVerfassung belassen. Weil es über die Nachführung hinaus-ginge, soll Absatz 3 also nicht gestrichen werden.Zum zweiten: Was ist in zeitlicher Hinsicht die gute Lösung?Die Kommission kann Ihnen eine bessere Lösung anbieten,als sie der Streichungsantrag Büttiker will. Wie kann dieseBestimmung rasch geändert werden? Wenn wir sie ändernwollen – vorausgesetzt, Sie wollen das, was aber eine an-dere Frage ist –, dann muss ja die Änderung auf die Gesamt-erneuerungswahl des Bundesrates im Herbst 1999 in Krafttreten. Kann das mit dieser Streichung geschehen?Es gibt drei Varianten, um das zu tun, drei Schienen, die aufdie Aufhebung der Kantonsklausel hinführen. Ich möchte sieIhnen darlegen, ich möchte auch sagen, in welchem«Baustadium» sie sind und welches die schnellste Lösungist:Wir haben 1993 der parlamentarischen Initiative Schiesserbetreffend Streichung der Kantonsklausel (93.407) Folge ge-geben, aber mit der Behandlung noch zugewartet, bis dieVerfassungsrevision abgeschlossen ist. Sie ist also im An-fangsstadium. Sie ist noch nicht zur Norm geworden. Siebraucht, wenn wir sie nach der Verfassungsrevision wiederaufnehmen, sicher noch gegen zwei Jahre bis zur Volksab-stimmung, wonach sie erst in Kraft treten könnte. Also kannsie auf Herbst 1999 nicht rechtswirksam sein.Die zweite Schiene ist die Verfassungsreform. Sie kann imguten Fall im Laufe des Jahres 1999 von der Bundesver-sammlung verabschiedet werden. Es ist aber fraglich, ob dieAbstimmung noch im gleichen Jahr stattfinden kann. Eherdürfte die neue Verfassung im Jahre 2000 zur Abstimmungkommen. Es wird also auch wieder eher zu spät. Hinzukommt, dass eine Streichung mit dem Makel behaftet ist,dass wir damit über die Nachführung hinausgehen, die Vor-lage also belasten; sollte die Verfassung abgelehnt werden,stehen wir sowieso vor einem Scherbenhaufen. So wäreauch die Streichung gemäss Minderheit Büttiker nicht dieschnelle Lösung.Es gibt eine dritte Lösung: Der Nationalrat hat auf Anregungseiner Staatspolitischen Kommission die Aufhebung derKantonsklausel beschlossen. Diese parlamentarische Initia-tive (93.452, «Änderung der Wählbarkeitsvoraussetzungenfür den Bundesrat», AB 1995 S 970) lag uns im Jahr 1995vor, und wir haben Nichteintreten beschlossen. Damit ist dieVorlage an den Nationalrat zurückgegangen; der National-rat bzw. seine Staatspolitische Kommission wollte auchnoch die Verfassungsreform abwarten. Bis er über Festhal-ten an seiner Vorlage entscheidet, halten wir an Nichteintre-ten fest.Nun hat auf Anregung der Verfassungskommission die Prä-sidentin unserer Staatspolitischen Kommission, FrauSpoerry, einen Brief an die nationalrätliche StaatspolitischeKommission geschrieben, mit dem Inhalt, der Nationalratmöge – wenn er die Sache vorantreiben wolle – auf dieserSchiene weiterfahren. Beide Kommissionen stehen diesemVorgehen mehrheitlich positiv gegenüber. Wenn der Natio-nalrat nun an seiner parlamentarischen Initiative festhält,liegt sie bereits im Herbst 1998 wieder unserem Rat vor.Dann stellt sich uns bloss die Frage: Stimmen wir dem Ent-wurf zu, ja oder nein? Die Schlussabstimmung ist also bereitsim Herbst oder Winter 1998 möglich, und die Volksabstim-mung über die Verfassungsänderung kann bereits im Früh-jahr 1999, spätestens im Sommer 1999 stattfinden. Auf die-ser Schiene fährt der Schnellzug; er kommt vor den Gesamt-erneuerungswahlen des Bundesrates am Ziel an.Aus diesem Grunde empfiehlt Ihnen auch die Verfassungs-kommission, diesen Weg zu benutzen; er führt rascher ansZiel.Ein Weiterfahren auf der Schiene der Totalrevision blockierterstens die Verfassungsrevision – wir würden damit auf einHindernis auflaufen –, und zum zweiten führt es zeitlich nichtzum Ziel, weil der Weg viel länger ist.Aus diesen Gründen beantragt Ihnen die zahlenmässig satteMehrheit der Verfassungskommission, die Kantonsklauselhier nicht zu streichen, sondern sie im Rahmen der Nachfüh-rung zu belassen und den Zug auf der anderen Schiene fah-
Constitution fédérale. Réforme 138 E 30 avril 1998
Bulletin officiel de l’Assemblée fédérale / Tiré à part
ren zu lassen. Jener Zug kommt nämlich vor dem Herbst1999 ins Ziel und erreicht so das, was eine grosse Zahl vonMitgliedern unseres Rates ebenfalls will.
Spoerry Vreni (R, ZH): Ich kann weitgehend das Gleiche sa-gen wie mein Vorredner, Herr Frick. In der SPK und auch inunserem Rat bestehen materiell grosse Sympathien für denEntscheid des Nationalrates, die Kantonsklausel zu strei-chen. Ich möchte Sie daran erinnern, dass unser Rat vor vierJahren mit 16 zu 12 Stimmen beschlossen hat, der InitiativeSchiesser Folge zu geben. Diese Initiative verlangt ja be-kanntlich die Aufhebung der Kantonsklausel. Wie dargelegt,hat aber die Verfassungskommission jetzt mit grossem Mehrentschieden, diese Frage nicht in der Nachführung zu lösen.Man ist der Ansicht, dass die Streichung der Kantonsklauselim Rahmen der Nachführung eine brisante materielle Ände-rung wäre, hat doch die Kantonsklausel in der Verfassungschwergewichtige historische Gründe.Es wurde aber in unserer Kommission deutlich, dass wir be-reit wären, die Frage im Rahmen einer Partialrevision zu lö-sen, und ein solcher Entwurf liegt ja bei der SPK des Natio-nalrates. Wir haben deshalb der SPK des Nationalrates ei-nen Brief geschrieben, und ich gestatte mir, Ihnen diesenBrief vorzulesen: «Unsere Kommission (die SPK des Stände-rates) hat im Jahre 1995 die von Ihrer Kommission (der SPKdes Nationalrates) ausgearbeitete Vorlage 93.452 für einePartialrevision der Bundesverfassung zwecks Streichung derKantonsklausel als Kommission des Zweitrates vorberaten.Wir haben damals unserem Rat Nichteintreten beantragt,dies mehrheitlich nicht aus materiellen Gründen, sondernweil zum damaligen Zeitpunkt der Einbau dieses Anliegensim Rahmen einer umfassenden Vorlage ’Totalrevision Bun-desverfassung’ oder ’Regierungsreform’ zweckmässig er-schien.Das Konzept der Verfassungsreform, wie es heute mit denverschiedenen Paketen und der Nachführung vorliegt, warzum damaligen Zeitpunkt noch nicht klar ersichtlich. Die Ana-lyse der veränderten heutigen Situation führt uns dazu, diedamals gefällten Verfahrensentscheide zu überdenken. DieVerfassungskommission des Ständerates ist zum Schlussgekommen, dass die Revision der Kantonsklausel im Rah-men der Nachführung nicht opportun wäre. Die SPK desStänderates will zwar die Regierungs- und Staatsleitungsre-form nach Kräften vorantreiben, auch im besten Fall wirdaber deren Realisierung voraussichtlich noch einige Zeit aufsich warten lassen. Aus diesem Grunde wäre unsere Kom-mission (die SPK des Ständerates) heute bereit, auf eine Re-vision der Kantonsklausel in Form einer Partialrevision derBundesverfassung einzutreten. Da die Vorlage 93.452 imNationalrat hängig geblieben ist, möchten wir Sie einladen,die Beratung dieser Vorlage wiederaufzunehmen.»Wie Herr Frick schon ausgeführt hat, sind wir der Meinung,dass die Frage der Kantonsklausel im Rahmen einer Partial-revision rascher entschieden werden kann als im Rahmender Nachführung. Aus diesem Grunde wäre es aus der Sichtder SPK zweckmässig, sich heute gemäss Antrag der Mehr-heit bei Artikel 163 Absatz 3 dem Bundesrat anzuschliessen,d. h., vorläufig die Kantonsklausel in der nachgeführten Ver-fassung zu belassen und damit auch die Differenz gegenüberdem Nationalrat. Wir sind aber in der SPK entschlossen, diePartialrevision voranzutreiben.In diesem Sinne würde unsere Kommission es als sinnvollerachten, wenn über alle vorliegenden Abänderungsan-träge, den Antrag der Minderheit Büttiker, den Antrag Da-nioth und den Antrag Aeby, heute nicht materiell entschie-den würde.Sollte sich das Vorgehen im Rahmen der Partialrevision ent-gegen unseren Erwartungen verzögern und nicht zum Resul-tat führen, von dem wir heute ausgehen, sind alle Antragstel-ler frei, ihre Anliegen bei der nächsten Diskussion der Nach-führung in unserem Rat noch einmal zu deponieren. Wennwir jedoch gleichzeitig die Partialrevision verfolgen und imRahmen der Nachführung diese Anträge einbringen, schaf-fen wir Doppelspurigkeiten, die im Sinne einer effizientenRatsarbeit zu vermeiden sind.
Die SPK beantragt Ihnen deshalb, heute bei Artikel 163Absatz 3 dem Entwurf des Bundesrates zu folgen und demAntrag der Mehrheit zuzustimmen – dies mit der Präzisie-rung, dass es sich nicht um einen materiellen Entscheid ge-gen die Aufhebung der Kantonsklausel handelt, sonderndass es darum geht, das zweckmässigste formelle Vorgehenzu wählen und den materiellen Entscheid im Rahmen derPartialrevision zu treffen.
Präsident: Wir stehen angesichts des Votums vor einer nichtalltäglichen Ausgangslage. Ich versuche die Dinge nochmalsklarzustellen:Der Kommissionssprecher und die Präsidentin der SPK ma-chen darauf aufmerksam, dass mit Blick auf die hängige par-lamentarische Initiative 93.452 im Nationalrat die Kantons-klausel jetzt aus formalen Gründen gemäss Entwurf des Bun-desrates bestätigt werden und eine Differenz geschaffenwerden sollte.Unter diesen Umständen – falls Sie diesen formalen Ent-scheid fällen sollten – beantragt Frau Spoerry, die von derMehrheit abweichenden Anträge nicht zur Abstimmung zubringen.Andererseits scheint es mir unabdingbar zu sein, den Antrag-stellern das Wort zu geben, damit sie ihre Anträge wenig-stens begründen können. Denn diese Überlegungen müss-ten ja in die Beratungen des Nationalrates über die hängigeparlamentarische Initiative einfliessen können. Betreffendden Inhalt einer allfälligen neuen Bestimmung mit einer ande-ren Kantonsklausel ist nichts präjudiziert.Ich bitte die Antragsteller, auch zum geplanten VorgehenStellung zu nehmen.
Büttiker Rolf (R, SO): Ich kann im voraus sagen und werdees am Schluss noch begründen: Ich kann mich einem sol-chen Vorgehen anschliessen, falls die anderen Antragsteller,Herr Aeby und Herr Danioth, auch einverstanden sind, dasswir nur einen Vorgehensentscheid und keinen materiellenEntscheid fällen. Ich nehme die Gelegenheit gerne wahr,meine Haltung bzw. die Haltung der Minderheit zu dieserKantonsklausel darzulegen.Die Kantonsklausel ist ein alter Zopf, der bei Bundesratswah-len immer wieder die Wahl der besten Persönlichkeiten ver-hindert.Ich möchte einleitend ein paar Gedanken zur Bedeutung derKantonsklausel in der Vergangenheit äussern. Artikel 96Absatz 1 zweiter Satz der Bundesverfassung hält fest, dassnicht mehr als ein Mitglied des Bundesrates aus dem glei-chen Kanton stammen darf. Diese Bestimmung bedeuteteine Einschränkung des Kreises der Kandidatinnen und Kan-didaten, welche sich der Bundesversammlung zur Wahl stel-len können. Wiederholt wurden mit dieser Bestimmung vala-ble Kandidaturen für einen freiwerdenden Sitz im Bundesratverhindert. Dies ist um so bedauerlicher, als die Bestimmungheute nicht mehr dieselbe Bedeutung hat wie in den Anfän-gen des Bundesstaates, als sie Eingang in die Verfassungfand. Damals ging es darum, eine Dominanz der grossenKantone im Bundesstaat zu verhindern.Zwar ist es nach wie vor nicht wünschenswert, dass die Lan-desregierung aus Angehörigen weniger Kantone besteht. Diealten Konfliktlinien zwischen den Kantonen sind heute jedochweitgehend verschwunden. Die Bundesversammlung wirdzudem auch ohne formelle Vorschrift dafür besorgt sein,dass die Mitglieder des Bundesrates möglichst aus verschie-denen Kantonen stammen, so wie sie auch ohne irgendwel-che Vorschriften dafür sorgt, dass die verschiedenen Sprach-regionen vertreten sind.Der Bundesversammlung sollte genügend Spielraum gege-ben werden, damit sie die geeignete Persönlichkeit in die Re-gierung wählen kann. Die ersatzlose Streichung von Arti-kel 96 Absatz 1 zweiter Satz der geltenden Bundesverfas-sung stellt deshalb die beste Lösung dar.Die Kantonsklausel verhindert valable Kandidaturen bei Er-satzwahlen in den Bundesrat: Anlässlich der Ersatzwahl inden Bundesrat vom 3. bzw. 10. März 1993 hat sich einmalmehr gezeigt, dass Artikel 96 Absatz 1 zweiter Satz der Bun-
30. April 1998 S 139 Bundesverfassung. Reform
Amtliches Bulletin der Bundesversammlung / Separatdruck
desverfassung die Bundesversammlung in ihrer Wahlfreiheitunzweckmässig einschränkt, indem geeignete Persönlich-keiten aufgrund ihrer Kantonszugehörigkeit nicht wählbarsind.Schon bei früheren Ersatzwahlen in den Bundesrat wurdebeklagt, dass die sogenannte Kantonsklausel für die Wahlgeeigneter Kandidaten oder Kandidatinnen ein Hindernisdarstelle. So schied z. B. 1983 der St. Galler Hans Schmidals Kandidat für die Nachfolge von Bundesrat Ritschard aus,weil St. Gallen bereits durch Bundesrat Furgler vertreten war.Zehn Jahre zuvor musste der Solothurner Schürmann seineKandidatur kurzfristig zurückziehen, weil am gleichen Wahl-tag der Solothurner Ritschard gewählt wurde.Im März 1993 sind im Nationalrat nicht weniger als fünf par-lamentarische Initiativen eingereicht worden, welche die Lok-kerung bzw. die Abschaffung der Kantonsklausel verlangen.Die Initiative der LdU/EVP-Fraktion und die parlamentari-schen Initiativen von Nationalrat Wanner und Nationalrat Rufverlangen alle eine Lockerung der Kantonsklausel in demSinne, dass nicht mehr als zwei Mitglieder aus dem gleichenKanton gewählt werden dürfen; dies entspricht dem Inhaltdes heutigen Antrages Aeby. Die parlamentarische InitiativeHaller will das Problem mit einer Revision des Garantiegeset-zes angehen, während Nationalrat Ducret die ersatzloseStreichung von Artikel 96 Absatz 1 zweiter Satz der Bundes-verfassung verlangt.Zum Vorgehen: Die Staatspolitische Kommission des Natio-nalrates hörte die Initianten und Initiantinnen an ihrer Sitzungvom 15./16. April 1993 an. Das Anliegen fand in der Kommis-sion breite Unterstützung. Die Kommission war der Ansicht,dass das Problem jetzt angegangen und nicht mit dem Hin-weis auf eine mögliche Totalrevision der Bundesverfassungoder auf die geplante grundlegende Regierungsreform aufVerfassungsebene auf die lange Bank geschoben werdensollte.Das Argument, dass Artikel 96 der Bundesverfassung nichtisoliert, sondern im Rahmen einer Totalrevision der Verfas-sung geändert werden sollte, wurde bereits 1976 anlässlichder Beratung einer Kommissionsinitiative, welche die Aufhe-bung der Kantonsklausel forderte, vorgebracht. Weitsichtigsetzte sich der damalige Bundesrat Furgler für ein raschesVorgehen ein. Ich zitiere: «Wichtig ist, dass endlich einmalentschieden wird. Ein weiterer Aufschub erscheint dem Bun-desrat als unerträglich.» Trotz der Unterstützung durch denBundesrat fand die Kommission damals mit ihrem Antrag, dieKantonsklausel aufzuheben, bei der Ratsmehrheit kein Ge-hör.An ihrer Sitzung vom 9./10. September 1993 prüfte die Kom-mission verschiedene Lösungsvarianten. In einer Eventual-abstimmung gab sie der ersatzlosen Streichung von Arti-kel 96 Absatz 1 zweiter Satz mit 14 zu 2 Stimmen den Vor-zug gegenüber der Formulierung, wonach «in der Regel»nicht mehr als ein Mitglied aus dem gleichen Kanton stam-men darf. Sie beschloss mit 14 zu 0 Stimmen bei 2 Enthal-tungen einen Entwurf in diesem Sinne. Das ist der Entwurf,auf den Frau Spoerry Bezug genommen hat und der hängigist. Interessant ist noch folgendes: Der Bericht des EJPDvom Mai 1994 zeigt die Ergebnisse des Vernehmlassungs-verfahrens. 15 Kantone stimmten der Aufhebung der Kan-tonsklausel vorbehaltlos zu. 7 Kantone waren nicht einver-standen, nämlich die Kantone Uri, Obwalden, Graubünden,Waadt, Wallis, Neuenburg und Jura. 4 Kantone waren zwargrundsätzlich einverstanden, brachten aber Vorbehalte an:Lockerung statt Streichung der Kantonsklausel, Regelungim Zusammenhang mit der Regierungsreform und/oder mitder Totalrevision der Bundesverfassung.Im übrigen ist auch die SPK der Ansicht, dass Handlungsbe-darf besteht. An ihrer Sitzung vom 22./23. März 1993 bean-tragte die SPK Ihrem Rat ohne Gegenstimme, der parlamen-tarischen Initiative Schiesser auf Streichung der Kantons-klausel Folge zu geben. Der Ständerat folgte am 30. Septem-ber 1993 dem Antrag der Kommission, d. h., es wurde in demSinne Folge gegeben, dass im Rahmen einer Regierungsre-form auf Verfassungsebene eine Revision von Artikel 96 derBundesverfassung vorgenommen werden solle.
Die Beurteilung der Notwendigkeit einer Kantonsklausel ausheutiger Sicht: Heute präsentiert sich die Lage völlig anders.Der Bundesstaat blickt auf eine 150jährige Geschichte zu-rück, in deren Verlauf die Kantone alte Konfliktlinien über-wunden haben. Die Mitglieder des Bundesrates repräsentie-ren heute in erster Linie die Landesregierung und nicht ihrenHerkunftskanton. Kommt hinzu, dass in einer mobilen Gesell-schaft die Zuordnung einer Person zu einem Kanton oftmalsgar nicht mehr so einfach ist. Wir haben das bei der letztenBundesratswahl wieder erlebt, und es hat sich schon bei ver-schiedenen Ersatzwahlen in den Bundesrat gezeigt.Die Aufhebung der Kantonsklausel bedeutet nicht, dass demFöderalismusprinzip heute weniger Beachtung geschenktwürde. Allerdings wird dem Föderalismus kaum durch eineBestimmung wie die Kantonsklausel Nachachtung verschafftals vielmehr durch eine sinnvolle Kompetenzverteilung zwi-schen Bund und Kantonen. Im Verlaufe der Geschichte wur-den andere Kriterien für die Bundesratswahlen wichtig. Dazuzählen die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Partei, zu einerbestimmten Sprachregion oder neuerdings auch zu einembestimmten Geschlecht.Wahlkriterien mögen in einer bestimmten politischen und ge-sellschaftlichen Situation angebracht sein, zu einem späte-ren Zeitpunkt jedoch ihre Aktualität verlieren. Sie sollten des-halb nicht in die Verfassung aufgenommen werden. Sonstbesteht die Gefahr, dass ein veraltetes, aber verfassungs-mässig verankertes Wahlkriterium die Bundesversammlungdaran hindert, den aktuellen Bedürfnissen zu entsprechen.Der Bundesversammlung als vom Volk gewähltem Wahlor-gan des Bundesrates kommt die Verantwortung zu, die in ei-ner bestimmten Situation geeignete Person in die Regierungzu wählen. Dabei hat sie einerseits Kriterien der persönlichenQualifikation der Kandidatinnen und Kandidaten zu berück-sichtigen. Andererseits spielen auch Kriterien eine Rolle, diesich aus der aktuellen gesellschaftlichen und politischenLage ergeben. Diese Verantwortung kann die Bundesver-sammlung am besten wahrnehmen, wenn sie durch keineverfassungsmässigen Bestimmungen in ihrer Wahlfreiheiteingeschränkt wird. Die ihren Wählerinnen und Wählern ge-genüber verantwortlichen Mitglieder der Bundesversamm-lung werden es sicher unterlassen, einen Bundesrat zu wäh-len, der beispielsweise nur aus Angehörigen der Kantone Zü-rich, Bern und Waadt zusammengesetzt ist.Die Erfahrungen seit 1986 haben gezeigt, dass auch die Re-vision des Garantiegesetzes die Probleme nicht gelöst hat,die sich für die Bundesversammlung bei Bundesratswahlenaus der verfassungsmässigen Existenz der Kantonsklauselergeben.Eine Revision von Artikel 96 der Bundesversammlung istdeshalb Voraussetzung dafür, dass die Bundesversammlungihre Verantwortung wahrnehmen und die fähigsten Personenin den Bundesrat wählen kann.Ich komme zur Frage «Lockerung oder Streichung?»: EineFormulierung wie im Antrag Danioth, wonach die Landesge-genden, die kulturellen Regionen und die gesellschaftlichenGruppierungen im Bundesrat angemessen vertreten seinsollten, erachte ich als sehr schwammig, unklar definiert undgegenüber dem Volk als sehr erklärungsbedürftig. In derBundesverfassung sollte auf solche unklare Formulierungenverzichtet werden, da sie den Eindruck von Willkür weckenund in der praktischen Anwendung mehr Fragen aufwerfenals klären.Herr Danioth, gegen Zwischenlösungen irgendwelcher Arthat sich übrigens schon 1976 der damalige Bundesrat Furg-ler ausgesprochen, indem er den Nationalrat aufforderte, dieKantonsklausel ersatzlos zu streichen oder dann so beizube-halten, wie sie sei: «Bei realistischer Betrachtung gibt esnach Auffassung des Bundesrates nur zwei Wege, die poli-tisch als gangbar erscheinen: entweder die Wahlschrankeunverändert beizubehalten oder sie ersatzlos fallenzulassen.Zwischenlösungen hätten nach Auffassung des Bundesrateskaum Aussicht auf Erfolg.» Das gilt auch für den AntragAeby.Aus all diesen Gründen möchte ich Ihnen beliebt machen, dieKantonsklausel aus der Bundesverfassung zu entfernen. Ich
Constitution fédérale. Réforme 140 E 30 avril 1998
Bulletin officiel de l’Assemblée fédérale / Tiré à part
meine, dass der Weg, den die SPK im Interesse der Sachevorschlägt, der rascheste Weg ist, der am schnellsten zumZiele führt und die Revision der Bundesverfassung nicht zu-sätzlich belastet.Ich möchte Herrn Bundesrat Koller trotzdem auffordern, vorallem zum Vorgehen und zu diesem neuen Weg Stellung zunehmen. Es würde mich interessieren, was der Bundesrat zudiesem neuen Weg sagt. Denn das Argument, dass das An-liegen die Nachführung ritze, stimmt natürlich mit dem neuenVorgehen nicht mehr.Deshalb möchte ich Ihnen beliebt machen, dem Vorgehenzuzustimmen, das Herr Präsident Zimmerli skizziert hat,damit die ganze Sache zu deblockieren und dem Nationalratfür die Entfernung der Kantonsklausel grünes Licht zu ge-ben.
Danioth Hans (C, UR): Bei einzelnen Voten konnte ich micheines leichten Schmunzelns nicht erwehren. Vor allem habeich heute den Eindruck erhalten – ich weiss nicht, ob das al-len anderen gewöhnlichen Ständeratsmitgliedern, also Nicht-mitgliedern der Verfassungskommission und der SPK, auchso ergangen ist –, dass etwas viel Hektik und viel Taktik imSpiel ist, um Anträge, die seit Monaten auf dem Tisch lie-gen – mein Antrag wurde Anfang März eingereicht – irgend-wie auszumanövrieren, vor allem aber, um keine klare Stel-lung zu beziehen.Ich möchte den Satz an die Spitze stellen, den ich für denSchluss vorgesehen habe: Was wäre das für ein Land, dassich an der Jahrtausendwende nicht einmal auf die Regelneinigen kann, nach denen seine Regierung bestimmt wird?Das müssen wir uns fragen.Herr Frick, wenn Sie von den drei Schienen sprechen, diezum Ziel führen könnten, wäre es durchaus möglich, dasseine dieser Schienen dann eben auf ein Stumpengeleiseführt und uns nichts bringt. Ich bin dem Präsidenten unseresRates dankbar, dass er die Proportionen wiederhergestellthat und uns zumindest das Wort gewährt, damit wir unserePosition begründen können. Ich werde das kurz versuchen.Die kürzliche Bundesratswahl ist Grund genug, um einmalmehr Handlungsbedarf aufzuzeigen. Es ist bereits daraufhingewiesen worden, dass der Ständerat an der berühmtenund für mich unvergesslichen Genfer Session im Herbst1993 eine parlamentarische Initiative auf Streichung der Kan-tonsklausel relativ knapp mit 16 zu 12 Stimmen überwiesenhat. In dieser Vorlage ist die ersatzlose Streichung enthalten.Kollege Schiesser räumte ein – ich habe mich noch im Amt-lichen Bulletin vergewissert –, dass er mit dem Antrag aufStreichung eine Extremlösung gewählt habe. Er gehe indes-sen davon aus, dass es der Kommission unbenommen sei,eine weniger weit gehende Lösung anzustreben. Das ist jetztbald fünf Jahre her. Seither ging das Geschäft im Pingpong-Verfahren hin und her. Ich persönlich habe mich damals die-sem Antrag ziemlich energisch widersetzt und bin ehrenvollunterlegen.Ich habe darauf hingewiesen, die Kantonsklausel habe bis-her nicht verhindert, dass der Bundesrat tendenziell vorabnach machtpolitischen und wirtschaftlichen Überlegungender grossen Zentren und Städte zusammengesetzt werde.Ich möchte auch auf den Verfassungskommentar Fleiner/Giacometti hinweisen, in dem die Enstehungsgeschichte die-ser Kantonsklausel dargelegt ist. Gesagt wird dort, mit dieserKlausel habe man verhindern wollen, dass die grössten Kan-tone einen ausschlaggebenden Einfluss im Bundesrat er-langten, und eine Garantie schaffen wollen, dass die Bun-desratssitze nach Möglichkeit auf die verschiedenen Landes-gegenden verteilt würden. Das ist keine schwammige Formu-lierung, Herr Büttiker!Handlungsbedarf anerkannte in der Folge auch der Bundes-rat, der sagte, die Kantonsklausel müsse überprüft werden,der aber die Partialrevision nicht für den geeigneten Weg hielt.Der Nationalrat und in der Folge auch der Ständerat schlossensich dem an und gaben dies auf den Weg der Totalrevision,die wir heute haben, auch wenn es eine Nachführung ist. Jetztheisst es: «Rechtsumkehrt, vorwärts Marsch!» Dies müssenSie dann dem Volk erklären!
Wie wir bisher erfahren haben – ich habe das im Verlaufe derDebatte zur Verfassungsrevision sehr aufmerksam verfolgt –,sind über die Nachführung hinaus in Fragen, die nicht kontro-vers sind oder worüber ein breiter Konsens besteht, auch ge-wisse Reformschritte möglich. Worüber besteht ein breiterKonsens?Die Kommissionen sind sich darin uneinig, ob die Klausel bei-behalten oder tel quel gestrichen werden soll. Das sind dieExtrempositionen, die durch die unterschiedlichen, gegen-sätzlichen Beschlüsse im Nationalrat und in der Ständerats-kommission zum Ausdruck kommen. Dies betrifft aber nichtdie Reformbedürftigkeit; die scheint nun wirklich unbestrittenzu sein. Ich zitiere hier keinen Geringeren als den Präsiden-ten der Verfassungskommission. Es freut mich, Herrn Rhi-now zitieren zu dürfen. Im Amtlichen Bulletin der Genfer Ses-sion von 1993, Seite 734, können Sie das nachlesen, wo Siesagten: «Wir verbauen uns also keine andere Möglichkeit,und ich darf Sie versichern, dass auch in der Staatspoliti-schen Kommission einige Votanten zum Ausdruck gebrachthaben, dass für sie eine reine, ersatzlose Streichung nicht inFrage kommt.»Die Beibehaltung gewisser Kriterien für die Zusammenset-zung der Landesregierung nach schweizerischem Modell istdurchaus angezeigt. Die heutige starre Regelung mit derKantonsklausel, vorab in der Interpretation des Kantons-wohnsitzes für nicht dem Parlament angehörende Kandida-ten, ist nur auf dem Papier starr. Die Praxis zeigt, dass sie miteinem raschen Domizilwechsel jederzeit umgangen werdenkann. Damit wird aber dem inneren Sinn und Zweck der sei-nerzeitigen Verfassunggeber zuwidergehandelt.Ich stelle die Frage: Besteht nicht ein breiter Konsens dar-über, dass wir diesen der Würde eines nationalen Parlamen-tes abträglichen Missstand beseitigen sollten? Ein Bundes-rat – wie immer auch das Regierungssystem der Zukunftnach der Staatsleitungsreform aussehen mag – muss allemassgeblichen Kräfte in die Regierungsverantwortung ein-binden. Nur so können das föderalistische Einvernehmen undder soziale Friede gewahrt werden. Auf dieser Erkenntnis ba-siert nun mein Antrag. Er will ein Dreifaches garantieren:Anstelle der negativen Kantonsklausel sollen positive Krite-rien genannt werden. Innerhalb derselben soll der oder dieTüchtigste gewählt werden. Zu berücksichtigen sind die ver-schiedenen Landesgegenden, also die Kantone, sodann diekulturell-sprachlichen Gebiete und schliesslich die gesell-schaftlich-sozialen Kräfte. Die Kriterien sind Richtlinien undnicht Verbote. Es braucht, Herr Büttiker, hier nicht den Re-chenschieber. Aber es braucht gewisse ethische Normen,die der Verfassung sehr wohl anstehen.Man hat mich gefragt, wie viele Bundesräte es pro Kantonvertragen würde. Sicher wären zwei Mitglieder der Landesre-gierung aus ein und demselben Kanton als Ausnahme durch-aus möglich; doch sollte es eine Ausnahme sein. Herr Aebymöchte nun das Problem einfach mit der Erhöhung auf zweiSitze lösen und damit einen neuen Besitzstand kreieren, wasmeiner Auffassung genau entgegenläuft. Ich könnte mir aus-nahmsweise durchaus zwei Zürcher, zwei Berner, zweiWaadtländer oder zwei Genfer Bundesratsmitglieder vorstel-len oder – hören und staunen Sie! – vielleicht sogar einmalzwei Urner, nachdem wir bisher noch nie in dieser oberstenLandesbehörde vertreten waren. Doch Spass beiseite.Nachdem neben den Landesgegenden auch die kulturellenRegionen genannt sind, kann weiterhin gewährleistet wer-den, dass die Romandie und die ganze übrige lateinischeSchweiz auch in Zukunft angemessen vertreten sein werden.Das ist für mich ein absolutes Erfordernis. Der Begriff «ange-messene Berücksichtigung» ermöglicht auch eine zeitlicheStaffelung in der Berücksichtigung einzelner Regionen, sonstmüssten wir ja die Zahl der Bundesratsmitglieder auf 26 er-höhen, und das wäre nun doch zuviel.Die Erwähnung der gesellschaftlichen Gruppierungen soll dieWahl von Vertretern unterschiedlicher Altersstufen und Be-rufsgattungen ermöglichen. Warum nicht wieder einmal einGewerbetreibender oder ein aktiver Bauer wie Rudolf Min-ger? Mit der Erwähnung der beiden Geschlechter wäre diehängige Initiative zur Einführung einer Frauenquote im Kern-
30. April 1998 S 141 Bundesverfassung. Reform
Amtliches Bulletin der Bundesversammlung / Separatdruck
gehalt sinnvoll umgesetzt und könnte abgeschrieben wer-den. Die Formulierung ist schliesslich politisch neutral, zu-rückhaltend und beinhaltet keine Zementierung der soge-nannten Zauberformel.Die Reaktionen auf meinen Antrag haben mich ermutigt. Ichbin der Meinung, dass wir darüber diskutieren sollten. Insbe-sondere hat mich gefreut, dass der Staatsrechtslehrer undehemalige Ständerat Jean-François Aubert in einem Inter-view mit der Tessiner Zeitung «Giornale del Popolo» meineFormulierung positiv gewürdigt und unterstützt hat.Ich meine, dass wir nun im Rahmen dieser Verfassungsrevi-sion doch daran gehen sollten, eine mehrheitsfähige Lösungzu finden.Hinsichtlich der Frage, ob das Anliegen zur Entscheidungausgelagert wird, möchte ich nicht auf die Barrikaden gehen.Ich bin nur dagegen, dass man das Problem mit schönenFormulierungen auf die lange Bank schiebt.Die Wahl der Landesregierung soll aufgewertet werden, indemsich die Erwartungen und Hoffnungen möglichst vieler Men-schen in diesem Land verwirklichen lassen. Es sollen keineGesellschaftsspiele veranstaltet werden. Nicht Gerangel umKantonssitze und um Frauenquoten und – ich sage das deut-lich – auch keine Volksveranstaltungen sind gefragt, sonderndie in grösstmöglicher Freiheit wahrgenommene Verantwor-tung der Parlamentarierinnen und Parlamentarier, zum Wohleunseres Landes die bestmögliche Regierung zu wählen.
Aeby Pierre (S, FR): J’aimerais, avant de développer ma pro-position, qui d’ailleurs mérite beaucoup moins d’explicationsque les propositions de mes préopinants, étant donné qu’elleest beaucoup plus simple, aisément compréhensible, parlerde la situation dans laquelle nous nous trouvons.Nous sommes la deuxième Chambre. Le Conseil national asupprimé l’alinéa 3, c’est-à-dire ce qu’on appelle «la clausedes cantons». Nous avons aujourd’hui à décider soit de nousrallier au Conseil national, soit de maintenir notre décisioncomme le propose la majorité de notre commission, c’est-à-dire de préférer la version du Conseil fédéral qui inclut laclause cantonale pour les raisons que vous connaissez: miseà jour, etc. A mon sens, nous ne pouvons pas prendre d’autredécision. Nous pouvons, éventuellement, voter la propositionde minorité Büttiker et nous rallier à la décision du Conseilnational, ou voter la proposition Danioth, ou la mienne, maisil n’y a pas de «décision sous réserve», dans le sens où j’aicompris l’intervention de Mme Spoerry. Si nous décidons demaintenir la clause cantonale, elle est maintenue.En ce qui me concerne, et je n’ai pas peur de le dire, je suispartisan du maintien de cette clause cantonale. Donc, je par-tage le point de vue de la majorité de la commission, tel qu’ilest exprimé et tel qu’il figure sur le dépliant.Je considère que ce n’est pas par cet alinéa de la constitutionqu’on va réformer le fédéralisme. Si on veut réformer le fédé-ralisme, il y a des domaines beaucoup plus importants: il y atout le domaine fiscal où on ne touche pas aux obstacles denature fédéraliste; il y a tout le domaine de l’instruction publi-que, qui reste tabou et où la Suisse est encore très cantona-liste. Et là, on voudrait tout à coup que le Gouvernement denotre pays ne ressemble plus à son Parlement. Nous avonsun Parlement avec un Conseil national élu au système pro-portionnel pour pouvoir défendre les minorités. Nous avonsune deuxième Chambre, qui est la Chambre des cantons, quiest là pour défendre la structure fédéraliste. Et nous voulonsouvrir la porte, théoriquement, à un Conseil fédéral qui seraitcomposé de membres provenant des deux ou trois plusgrands cantons ou plus grands centres de décisions écono-miques, ou des centres où sont situés les médias.Parce que je crois que l’influence des médias dans ce débatn’est pas insignifiante et n’est pas innocente. Pourquoi est-cequ’on dit que l’élection au Conseil fédéral est insatisfaisante?C’est parce que depuis un certain nombre d’années elle faitl’objet dans les médias de vastes campagnes; parce que toutest filmé de A à Z; parce qu’on s’intéresse de façon très dé-taillée à la vie des candidats. On doit admettre, si l’on com-pare les campagnes d’il y a dix ou quinze ans avec celles quenous avons vécues ces dernières années, qu’il y a une très
grande influence des médias dans l’élection au Conseil fédé-ral, et il faut en prendre note. Et où sont concentrés les mé-dias dans notre pays? A Berne, à Zurich, à Genève et à Lau-sanne.Je prétends que supprimer la clause cantonale, c’est ouvrirune voie royale à la possibilité de voir le Conseil fédéral pres-que exclusivement composé de membres provenant de cesquatre cantons et de ces quatre centres, et je ne peux pasêtre d’accord avec cette solution.Je vous propose donc de soutenir la proposition de la majo-rité de la commission.Je ne m’oppose pas à ce qu’on réexamine cette question,mais alors cela signifie éventuellement un nouveau renvoi decette disposition à la commission. Cette dernière a pourtantclairement dit qu’elle ne veut pas d’un nouveau renvoi. Nousne pouvons pas voter présentement sous réserve de la re-prise de l’examen d’une initiative parlementaire. A mon avis,ça n’est pas défendable – il me semble d’ailleurs que le pré-sident de notre conseil y a fait allusion.J’en viens à ma proposition. Je l’ai déposée après avoir prisconnaissance de la proposition Danioth, qui est intéressanteet dont je partage tout à fait la philosophie. Je considèrenéanmoins qu’elle mérite d’être approfondie et qu’on ne peutpas voter une disposition assez vague finalement, même siles principes énumérés semblent clairs. Je considère quecette proposition n’est pas suffisante pour entreprendre unréexamen de la question de la composition du Conseil fédé-ral.Ma proposition, c’est le statu quo avec la possibilité d’une ex-ception, et d’une seule. Je voudrais bien qu’elle soit comprisedans ce sens et je ne suis pas sûr que M. Danioth l’ait com-prise. On ne peut pas avoir trois fois deux membres du Con-seil fédéral qui proviennent de trois cantons. Je crois que letexte est assez clair. En principe, c’est un conseiller fédéralpar canton, mais on peut faire une exception, et une seule,pour un canton et pas pour plusieurs. Je crois que ça doit êtrecompris dans ce sens-là et je ne voudrais pas qu’il y ait unmalentendu sur ce point.Par conséquent, je suis prêt – Mme Spoerry et M. Büttikerm’ont posé la question – s’il le faut à retirer ma propositiondans la mesure où, dans un vote préliminaire, la solution dela majorité l’emporte. Mais, si le Conseil rejette la propositionde majorité, ma proposition reste valable et je reprendrai laparole à ce moment-là pour la développer plus en détail.
Präsident: Es gibt nun zwei Möglichkeiten: Die eine bestehtdarin, aus formellen Gründen ohne weiteres der Mehrheit zu-zustimmen, eine Differenz zu schaffen und den Nationalratdamit einzuladen, sich uns anzuschliessen und gleichzeitigunverzüglich die Vorlage zur Abstimmung zu bringen, welchedie Kantonsklausel zum Gegenstand hat. Das würde heis-sen, dass heute nicht abgestimmt wird, dass die Antragstellerheute auf ihre Anträge verzichten, allerdings mit dem klarenHinweis darauf, dass die gleichen Anträge im Differenzberei-nigungsverfahren wieder eingebracht werden, wenn die Dif-ferenz nicht in unserem Sinn ausgeräumt wird. Ebenfallskönnen die Antragsteller ihre Anträge im Rahmen der sepa-raten Vorlage betreffend die Kantonsklausel wieder einbrin-gen, wenn diese Vorlage nicht ihren Wünschen entspricht.Die zweite Möglichkeit besteht darin, dass wir nun die Dis-kussion durchführen und Eventualabstimmungen vorneh-men. In einer ersten Abstimmung würde der Antrag Daniothdem Antrag Aeby gegenübergestellt; das Ergebnis würde derMehrheit gegenübergestellt, und dieses letzte Ergebnis demStreichungsantrag der Minderheit Büttiker.Ich beantrage Ihnen, den ersten Weg zu wählen.
Koller Arnold, Bundesrat: Der Bundesrat ist froh, wenn Siediese Frage der Elimination der Kantonsklausel als Sepa-ratum auf eine Teilrevision verweisen. Denn es ist ganz klar,dass die Elimination der Kantonsklausel im Rahmen derNachführung konzeptwidrig wäre.Es wäre eindeutig eine wichtige rechtspolitische Neuerung.Ihre kurze Diskussion, die Sie jetzt geführt haben, hat auchgezeigt, dass das eine Belastung in der Volksabstimmung
Constitution fédérale. Réforme 142 E 30 avril 1998
Bulletin officiel de l’Assemblée fédérale / Tiré à part
wäre. Die Frage des föderalen Gleichgewichtes stellt sichtrotz allem nach wie vor auch bei der Regierungsbildung. DerBundesrat hat seinerzeit gesagt, er möchte das Problem amliebsten im Rahmen des kommenden Paketes über dieStaatsleitungsreform angehen, weil dort auch die Fragen derZahl der Bundesräte und überhaupt der ganzen Organisationdes Bundesrates anstehen. Ich habe aber Verständnis, wennSie nicht länger warten wollen, denn bis die Staatsleitungsre-form realisiert werden kann, wird es doch noch einige Zeitdauern. Ich verstehe durchaus, dass man sich zum Zielnimmt, die Frage jetzt über die parlamentarische Initiative93.452 möglichst speditiv anzugehen und nicht die Staatslei-tungsreform abzuwarten.Das ist aber auch der Grund, Herr Büttiker, dass ich Ihnenjetzt noch keine Stellungnahme des Bundesrates zu dieserganzen Frage abgeben kann. Weil Sie aber vielleicht der Un-geduldigste sind, möchte ich einfach noch meinen heute ab-wesenden Landsmann Ständerat Carlo Schmid zitieren. Erhat in einem Bericht über die letzte Session geschrieben:«Die besten Bundesräte sind immer noch jene, die ihre Taug-lichkeit mangels Wahl nie unter Beweis stellen mussten.»(Heiterkeit) Spass beiseite, ich möchte damit nur auf eineshinweisen: Ich bin mir natürlich im klaren, dass der Ruf nachder besten und wägsten Person ebenfalls nach Eliminationder Kantonsklausel nie verklingen wird. Das weiss man auchaus Staaten mit Volkswahl. Man wird sich nie einig sein, werdie beste und wägste Person ist.
Schiesser Fritz (R, GL): Als Urheber der parlamentarischenInitiative erlaube ich mir zwei, drei Bemerkungen, nicht imSinne einer materiellen Diskussion. Ich kann mir vorstellen,dass die vom Präsidenten vorgeschlagene erste Variantedurchaus ein Weg ist, den man beschreiten kann.Ich bin doch etwas erstaunt über die Entwicklung, die sich inden letzten fünf Jahren abgespielt hat. Herr Danioth hat dieDebatte, die wir in Genf geführt haben, auszugsweise nach-gezeichnet. Sie haben in diesem Rat zweimal die Frist für dieBehandlung meiner parlamentarischen Initiative verlängernmüssen. Der Rat hat das jeweils gemacht. Dabei hat man ei-gentlich immer wieder betont, dass diese Frage in einemgrösseren Zusammenhang behandelt werden müsse, weilsie – das ist das Interessante – von ihrer Tragweite her nichtGegenstand einer einzelnen Vorlage sein könne. Hier hatsich offenbar ein erheblicher Sinneswandel ergeben. Offen-bar ist die Frage doch von einer solchen Tragweite, dass manjetzt im Rahmen dieses Nachführungsverfahrens und viel-leicht auch unter dem Eindruck der letzten Bundesratswahlerkannt hat, dass hier Handlungsbedarf gegeben ist unddass man einen Konsens darüber erzielt hat, dass auchdiese Frage Gegenstand einer einzelnen Vorlage sein kann.So jedenfalls habe ich die Diskussion und auch die Äusse-rung von Herrn Bundesrat Koller verstanden, nämlich dassman nicht mehr am Standpunkt festhält, dass das im Rah-men einer grösseren Vorlage geschehen müsse. Das ist fürmich eine Entwicklung, die doch bemerkenswert ist. Ich warauch froh über den Satz von Herrn Danioth, der sagte, dasser dagegen sei, dass man das Problem mit schönen Formu-lierungen – weiterhin – auf die lange Bank schiebe.Ich hoffe also als Initiant – ob das über meine parlamentari-sche Initiative geht oder über einen Weg, wie er vom Natio-nalrat eingeschlagen worden ist, ist gleichgültig –, dass indieser Frage dann, wenn wir der ersten Variante des Präsi-denten folgen, wirklich vorwärtsgemacht wird, dass wirklicheinmal eine Vorlage auf den Tisch kommt, wobei ich offen-lasse, wie sie inhaltlich aussieht. Diese Frage muss nun wirk-lich einmal einer Entscheidung zugeführt werden, Volk undStände müssen Stellung beziehen können. Die heutige De-batte ist für mich doch ein kleiner Höhepunkt. Aber der Be-weis muss noch erbracht werden.
Reimann Maximilian (V, AG): Ich möchte mich zum Verfah-ren äussern, möchte aber vorausschicken, dass ich mich zujenen Parlamentsmitgliedern und Staatsbürgern zähle, diegrosse Bedenken gegenüber einer ersatzlosen Streichungder Kantonsklausel angemeldet haben. Ich habe mich auch
im Rahmen der SPK entsprechend geäussert und engagiert.Eine ersatzlose Streichung kommt für mich überhaupt nichtin Frage. Das könnte zur Folge haben – Kollege Büttiker hatuns mathematische Beispiele vorgetragen –, dass zwei Zür-cher plus zwei Berner plus drei Waadtländer das Bundesrats-kollegium bilden würden. Mathematischen Rechenbeispielensind ja Tür und Tor geöffnet. Eine Streichung im Rahmen derVerfassungsreform kommt für mich aber auch aus Gründender Beachtung des Nachführungsprinzips nicht in Frage.Ob die von Frau Spoerry angetönte Lösung im Rahmen einerPartialrevision die bessere sei, möchte ich auch nachhaltigbezweifeln. Meines Erachtens müssen wir eine Lösung imRahmen der angelaufenen Staatsleitungsreform suchen, wozunächst doch die überaus wichtige, die fundamentale Fragegeklärt werden muss, wie viele Bundesräte wir in Zukunftüberhaupt haben werden. Sind es fünf plus einige Minister?Sind es sieben wie heute? Sind es neun oder noch eine an-dere Zahl? Falls wir uns für das Zwei-Ebenen-Regierungssy-stem entscheiden, stellt sich die Frage, was mit den Ministernpassiert, ob für sie ebenfalls irgendeine Kantonsklausel giltoder nicht.Im übrigen, Herr Büttiker, bin ich der Meinung, dass die Kan-tonsklausel nicht unbedingt ein alter Zopf ist. Nehmen Siedoch die letzten beiden Bundesratswahlen, wo die Kantons-klausel hineingespielt hat:Erster Fall: Die Matthey-Dreifuss-Wahl von 1993: Da wurdedoch mit Herrn Matthey problemlos ein valabler Kandidat ge-wählt; nur passte es der SP damals nicht, weshalb der Wirbelmit der fragwürdigen Verlegung der Schriften von Frau Drei-fuss nach Genf inszeniert wurde.Zweiter Fall: Die Wahl von Herrn Couchepin in diesem Jahr,wo mit Herrn Petitpierre ein zweiter Genfer im Alleingangseine Kandidatur angemeldet hatte: Sie sind mit mir einig,dass die Chancen von Herrn Petitpierre doch von Anfang anminim waren. Die Kantonsklausel hätte überhaupt nicht ge-ritzt werden müssen, wo immer Herr Petitpierre seinenWohnsitz gehabt hätte.Deshalb scheint mir der richtige Weg zu sein, es heute beimIst-Zustand bewenden zu lassen. Das entspricht auch demGebot der Nachführung. Zeitliche Dringlichkeit besteht mei-nes Erachtens nicht. Die Staatsleitungsreform ist der richtigeOrt, um das Problem in Ruhe, seriös und vor allem ganzheit-lich anzupacken. Das ist eine Frage von vielleicht zwei, dreiJahren. Dabei befürworte ich eine Lösung, die in Richtungder Ideen der Herren Danioth und Aeby geht.Wenn wir überhaupt ein Problem mit der Zusammensetzungdes Bundesrates haben, ist es doch wegen der Zauberfor-mel. Wenn ich etwas einen alten Zopf nennen würde, wäre esdiese Zauberformel. Aber um diese zu revidieren oder zu bre-chen, brauchen wir keine Verfassungsreform.
Plattner Gian-Reto (S, BS): Es mag Sie erstaunen, dass ichals Akademiker die Debatte nun doch zum Teil als etwas aka-demisch bezeichnen muss.Ich möchte zwei Dinge zum Verfahren sagen. Das eine ist:Die Argumentation von Frau Spoerry und Herrn Frick bezüg-lich des raschesten Weges zum Ziel hat mich nicht über-zeugt, im Gegenteil. Es hat mir bewiesen, dass wir eigentlichheute Herrn Büttiker folgen sollten. Es ist für mich nämlichnicht verständlich, wie man sagen kann: Wir haben einenWeg, der schon nächstes Jahr zum Ziel führt, und weil wirden haben, schreiben wir jetzt in die Verfassung noch etwasanderes hinein, das dann im Jahr darauf zur Abstimmungkommt. Das kommt mir vor, als hätte man logisch nicht ganzsauber gedacht. Wenn man ja willens ist, wie die Staatspoli-tische Kommission und Herr Frick, die Bestimmung im näch-sten Jahr zu ändern, dann sehe ich wirklich nicht ein, wes-halb man in einem Projekt, das diese Zeit überschreitet undein oder zwei Jahre später erst stehen soll, noch etwas ande-res hineinschreibt. Wenn dieser schnelle Weg wirklich zumZiel führt – das ist offenbar die Meinung –, ist es doch nurweise Voraussicht, dass man in dem Projekt, das ein, zweiJahre später fertig wird, schon das gleiche hineinschreibt wiedas, was man für nächstes Jahr anstrebt. Das ist das eine.Das andere betrifft den erwähnten akademischen Charakter
30. April 1998 S 143 Bundesverfassung. Reform
Amtliches Bulletin der Bundesversammlung / Separatdruck
der Diskussion: Mir scheint, de facto ist die Kantonsklauselbereits abgeschafft. Die Geschichte der letzten Bundesrats-wahlen zeigt, dass eine Person gewählt werden kann, auchwenn sie aufgrund der Kantonsklausel – in ihrer ursprüngli-chen, engen Fassung – eigentlich nicht wählbar wäre. Wirhaben eine Person, die in Bern domiziliert war, als VertreterinGenfs gewählt; dafür musste dann vier Jahre später jemand,der in Genf domiziliert war, seinen Wohnsitz nach Neuenburgverlegen. Er wäre also allenfalls als Neuenburger gewähltworden – aber gewählt hätte er werden können. Auch dieerstgenannte Kandidatin ist ja schliesslich gewählt gewor-den. So, denke ich, ist es de facto heute jedem überall mög-lich, seinen Wohnsitz – wenn es die Politik will – so zu verle-gen, dass die Kantonsklausel de facto gar keine Rolle mehrspielt. Etwas, was nur noch auf dem Papier steht, zu einemGrundsatz emporzustilisieren, der in der alltäglichen Politikjedesmal unterlaufen wird – einmal so, einmal anders –, dasscheint mir nicht logisch zu sein.Ich bin deshalb der Meinung, es sei heute Zeit, Herrn Büttikerund dem Nationalrat zu folgen und diese Klausel zu strei-chen. Das ist der allerschnellste Weg zum Ziel; er hat denVorteil, dass damit erst noch eine konsistente Politik auf denverschiedenen Schienen verfolgt werden kann, wie HerrFrick auch angekündigt hat. Ich würde mich gegen den er-sten Vorschlag des Präsidenten zur Wehr setzen.
Rhinow René (R, BL): Ich bedaure das Votum von HerrnPlattner; ich bedaure es ausserordentlich. Zum einen stimmtes nicht, dass die Kantonsklausel praktisch abgeschafft ist,Herr Kollege. Die umstrittenen Fälle bezogen sich auf Kandi-daturen, die eine besondere Kategorie darstellten. Sie warennämlich nicht Mitglieder des eidgenössischen oder eineskantonalen Parlamentes oder einer kantonalen Regierung.Deshalb musste auf den Wohnsitz abgestellt werden. Weildieses Wohnsitzkriterium nicht klar definiert ist, gab es dieseZweifelsfälle, gab es dieses unschöne Fragen nach der Ver-schiebung und Verlegung von Schriften. In allen anderen Fäl-len spielte aber die Kantonsklausel voll und ganz. Also kannman nicht sagen, die Diskussion sei akademisch.Zum zweiten geht es doch darum, dass wir uns nochmalsvergegenwärtigen müssen, dass wir im Rahmen der Nach-führung Probleme bekommen werden, wenn wir dieses An-liegen hier behandeln wollen. Ich weiss nicht, wie das Resul-tat aussehen wird. Aber Probleme werden nicht zu vermei-den sein, weil in dieser Frage gerade kein allgemeiner Kon-sens besteht.Als Präsident der Verfassungskommission muss ich Sienochmals darauf hinweisen: Unabhängig davon, ob das Herznun für die Aufhebung oder für eine mittlere Lösung schlägt –in beiden Fällen würden wir klar über dieses Kriterium desKonsenses hinausgehen, weil es in diesem Lande Regionengibt, die – wenn ich «noch» sage, ist es möglicherweise et-was provokativ, aber ich sage es trotzdem – noch nicht soweit sind, dass sie diesen Schritt tun können. Andere wollenihn tun oder hätten ihn schon längst tun wollen.In diesem Fall, meine ich auch, ist es der richtige Weg, einePartialrevision beförderlich an die Hand zu nehmen. In die-sem Rahmen können verschiedene Gesichtspunkte behan-delt werden, und es wird vor allem möglich sein, die neue Re-gelung bereits für die nächste Erneuerungswahl des Bundes-rates im Herbst 1999 in Kraft zu setzen. Eine solche Lösungist in diesem Fall deshalb sicher der geeignetere Weg.Ich trete auch dafür ein, zuerst über diese Frage abzustim-men und die Detailberatung erst nachher zu führen, falls sichkeine Mehrheit für das vorgeschlagene Vorgehen ergebensollte.
Präsident: Wir könnten nun die Diskussion zur Kantonsklau-sel weiterführen. Formal muss ich über die Anträge abstim-men lassen, solange sie aufrechterhalten bleiben. Wenn dieAnträge allerdings mit der von mir ausgeführten Begründungzurückgezogen würden, wäre die Sache in Sinne der Schaf-fung einer Differenz erledigt.Ich frage die Antragsteller an, ob sie bereit sind, zurzeit ihreAnträge zurückzuziehen.
Büttiker Rolf (R, SO): Ich habe es bereits gesagt: Ich bindazu bereit, weil ich überzeugt bin, dass die Partialrevisionder richtige Weg, der schnellere Weg ist und die Nachführungnicht belastet. Im anderen Fall greifen wir in der Nachführungein Problem auf, bei dem eindeutig nicht Konsens herrschtund die Nachführung bricht. Falls die beiden AntragstellerDanioth und Aeby ebenfalls zurzeit auf ihre Anträge verzich-ten bzw. sie in diesem Sinne des ersten Weges zurückzie-hen, hiesse dies Freigabe, also grünes Licht für den National-rat, jetzt diese Vorlage beförderlich zu behandeln, vorwärts-zumachen und eine Differenz zu schaffen. Die Differenz gibtuns ja die Möglichkeit und hält den Druck aufrecht, dass wirauch in einem späteren Zeitpunkt noch einmal darauf zurück-kommen können, wenn wir sehen, dass der Nationalrat nichtin unserem Sinne vorwärtsmacht. Deshalb bin ich für den er-sten Weg und bereit, meinen Antrag in diesem Sinne behan-deln zu lassen.
Danioth Hans (C, UR): Ich stelle fest, dass die Konsensfä-higkeit nicht so gross ist, wie ich sie als Optimist vor allemfür meinen heutigen Antrag angenommen habe. Ich stimmeder Zielsetzung und der Begründung der ersten Variantedurch unseren Präsidenten zu. Ich möchte zum Ausdruckbringen, dass ich den Antrag dermalen mit der Bitte zurück-ziehe, dass man, wenn er an irgendeine der Kommissionenzurückgeht, vom ersten vielleicht in den zweiten Gang über-schaltet und dann das Jahr 2000 erreicht, woran ich etwasZweifel hege.
Aeby Pierre (S, FR): Je vais suivre la sagesse de MM. Bütti-ker et Danioth, mais si je retire ma proposition, ça m’amèneà faire une précision, d’autant plus si ces propositions doiventêtre ensuite débattues en commission.Ma proposition ne s’oppose pas à la proposition Danioth: ellepeut très bien être acceptée en parallèle à la proposition Da-nioth. Elle donne une précision supplémentaire à la proposi-tion Danioth, et cela je l’aurais expliqué avant le vote si vousaviez poursuivi la procédure.Ceci étant dit, je suis d’accord avec ce que vous avez pré-senté comme étant la première variante et je retire ma propo-sition dans les mêmes conditions que mes préopinants.
Frick Bruno (C, SZ), Berichterstatter: Ich möchte den drei ei-nigen Antragstellern danken: Sie ebnen den Weg zur richti-gen Lösung. Es ist jetzt der Weg frei, der die Totalrevision alsNachführung nicht unnötig belastet und womit wir das eigeneKonzept nicht umstürzen. Betreffend die Weiterbehandlungist überhaupt nichts präjudiziert, aber wir haben den Weg ge-ebnet, damit es rasch und ohne Belastung der Totalrevisionvorwärtsgeht.Weiter zeichnet sich heute die Meinung ab – und das ist er-freulich –, dass eine Partialrevision der richtige Weg ist. Ichunterstütze diesen Weg und ziehe ihn der Staatsleitungsre-form vor. Jene wäre in Anbetracht unserer Bekenntnisse po-litisch nicht ganz redlich. Wir haben erklärt, das Problem lö-sen zu wollen; also gehen wir es rasch an, und lassen wirParlament und Volk abstimmen! Schieben wir es nicht immerwieder hinaus! Da gebe ich Herrn Schiesser recht. Er hat ne-ben sich hier im Ratssaal eine lange Bank stehen, aber ihmist sein Stuhl lieber als diese lange Bank.Ich habe festgestellt, dass diese Kantonsklausel materiellschon sehr umstritten ist. Wir dürfen uns heute – und für dieÖffentlichkeit gilt dasselbe – nicht der Illusion hingeben, dassdie Kantonsklausel leichthin gestrichen oder abgeändertwird. Wir haben eine harte Auseinandersetzung vor uns, unddiese wollen wir nächstes Jahr intensiv führen.
Angenommen gemäss Antrag der MehrheitAdopté selon la proposition de la majorité
Art. 164, 165Anträge der Kommissionen: BBlPropositions des commissions: FF
Angenommen – Adopté
Constitution fédérale. Réforme 144 E 30 avril 1998
Bulletin officiel de l’Assemblée fédérale / Tiré à part
Art. 166Anträge der Kommissionen: BBlPropositions des commissions: FF
Frick Bruno (C, SZ), Berichterstatter: Artikel 166 regelt dieAuslagerung von Verwaltungsausgaben an private Organisa-tionen, also neudeutsch das Outsourcing.Der Nationalrat hat zusammen mit dem Bundesrat folgendeLösung verabschiedet: Aufgaben können nur dann ausgela-gert werden, wenn sie konkret durch ein Gesetz zur Auslage-rung freigegeben werden. Unsere Kommission möchte aufAnregung der Staatspolitischen Kommission einen anderenWeg einschlagen; es soll nämlich eine allgemeine Bestim-mung geschaffen werden, gemäss welcher diese Aufgabenausgelagert werden können. Das ist mit Artikel 166 Absatz 3der Verfassung der Fall.Absatz 3 gibt die Generalkompetenz zur Auslagerung vonStaatsausgaben. Bundesrat und Nationalrat wollen dieseKompetenz nur im Einzelfall geben. Das ist natürlich von po-litischer Tragweite: Wenn Sie die Kompetenz nur im Einzel-fall geben, können Sie in jedem Fall das Referendum ergrei-fen. Wenn Sie der Lösung des Ständerates folgen, kann dasReferendum nicht mehr ergriffen werden, weil diese Auslage-rung durch einen einfachen Bundesbeschluss erfolgenwürde, der nicht dem Referendum untersteht.
Koller Arnold, Bundesrat: Ich stelle hier keinen Antrag, aberich mache Sie darauf aufmerksam, dass sich eine recht ge-wichtige politische Differenz zum Bundesrat und zum Natio-nalrat ergibt, wenn Sie jetzt Ihrer Kommission zustimmen.Das deswegen, weil die bisherige Praxis in jedem Fall – auchnach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung – ein formel-les Gesetz verlangt. Darüber gab es im Nationalrat einegrosse Debatte. Darauf möchte ich jetzt schon hingewiesenhaben.
Angenommen – Adopté
Art. 167Anträge der Kommissionen: BBlPropositions des commissions: FF
Frick Bruno (C, SZ), Berichterstatter: Artikel 167 beinhaltetzum einen eine materielle Änderung und zum andern einesprachliche Zusammenfassung der beiden Absätze.Bisher waren die Parlamentsdienste nach dem Buchstabender Verfassung dem Bundeskanzler und damit dem Bundes-rat unterstellt. Faktisch aber stehen die Parlamentsdiensteseit Jahrzehnten direkt unter dem unmittelbaren Einfluss undim Entscheidungsbereich der Bundesversammlung. Wennwir die Parlamentsdienste aus Artikel 167 und damit von derBundeskanzlei weglösen, vollziehen wir in der Verfassungdas, was seit Jahrzehnten Rechtswirklichkeit ist. Dies ist alsonur eine sachliche Anpassung ohne materiellrechtliche Än-derung.Wir bitten Sie, dem Beschluss des Nationalrates zu folgen.
Angenommen – Adopté
Art. 168–171Anträge der Kommissionen: BBlPropositions des commissions: FF
Frick Bruno (C, SZ), Berichterstatter: Ich möchte nur derVollständigkeit halber darauf hinweisen, dass Artikel 169jetzt der Terminologie von Artikel 153a angepasst ist.
Angenommen – Adopté
Art. 172 Abs. 3 – Art. 172 al. 3Anträge der Kommissionen: BBlPropositions des commissions: FF
Präsident: Die Absätze 1 und 2 von Artikel 172 sind zusam-men mit Artikel 156 behandelt worden.
Frick Bruno (C, SZ), Berichterstatter: Bei Absatz 3 haben wirnoch eine materielle Änderung zu begründen. Es geht umdas Notverordnungs- und Notverfügungsrecht des Bundes-rates. Der Nationalrat hat gegenüber dem Bundesrat zweiÄnderungen vorgenommen. Er normiert in Absatz 3 allge-mein das Notverordnungs- und Notverfügungsrecht. Nun hatder Nationalrat zwei Ergänzungen eingebaut: Erstens sindsolche Akte nachträglich von der Bundesversammlung zugenehmigen, und zweitens sind sie zu befristen.Die Begründung, die im Plenum des Nationalrates gegebenwurde, ist folgende: Es gehe darum, allfällige Missbräuchedes Bundesrates zu verhindern; es handle sich bei diesenNoterlassen um Eingriffe in Grundrechte der Bürger, Eingriffein die Sozialrechte, Eingriffe in die Wirtschaftsfreiheit usw.Diese seien vom Parlament zu genehmigen und zu befristen.Unsere Kommission ist für die Befristung, spricht sich abergegen die Genehmigungspflicht aus. Eine Befristung ist fürNotverfügungen und Notverordnungen sachlich angezeigt;eine Genehmigung ist aber nicht nötig, und zwar aus zweiGründen:1. In der Geschichte ist noch nie ein Missbrauch durch denBundesrat ruchbar geworden.2. Diese Notverfügungen und Notverordnungen betreffen dieBeziehungen zum Ausland. Wenn diese Notverfügungen ge-genüber dem Ausland im Parlament nochmals in aller Breiteauf dem «Marktplatz der Öffentlichkeit» diskutiert werden,dann kann das aus staatspolitischen Überlegungen für dieSchweiz sehr unklug und gefährlich sein.Aus diesen Zweckmässigkeitsüberlegungen sprechen wiruns nur für die Befristung der Noterlasse, aber gegen die Ge-nehmigungspflicht durch die Bundesversammlung aus.
Koller Arnold, Bundesrat: Wir sind Ihnen dankbar, wenn Siehier eine Differenz zum Nationalrat schaffen. Wir sind mitdem Antrag Ihrer Kommission, dass solche Notverordnungenzu befristen sind, einverstanden. Das Bundesgericht hat sichauch in jüngeren Entscheiden in dieser Richtung ausgespro-chen.Dagegen wäre eine Genehmigungspflicht, wie sie der Natio-nalrat beschlossen hat, in keiner Weise adäquat. Eine nach-trägliche Genehmigung solcher Notverordnungen würdenach unserer Auffassung die Berechenbarkeit und Glaub-würdigkeit solcher Notverordnungen schwer beeinträchtigen,weil deren Verbindlichkeit bis zum Moment der parlamentari-schen Genehmigung in der Schwebe bliebe. Wie aber bei-spielsweise ein Handelsverbot oder die Einfrierung vonBankkonten durchgesetzt werden könnte, solange dieserSchwebezustand anhalten würde, ist nicht zu sehen.Wir würden auch komplett die Möglichkeit verlieren, auf sichrasch ändernde Situationen adäquat zu reagieren. Ichmöchte Ihnen das anhand eines Beispiels zeigen: Der Bun-desrat hat am 3. Oktober 1994 eine Verordnung über Wirt-schaftsmassnahmen gegenüber Jugoslawien (Serbien undMontenegro) und anderen serbisch kontrollierten Gebietenerlassen, diese am 24. November 1995 teilsistiert, am4. März 1996 ganz sistiert und schliesslich am 15. Dezember1996 ausser Kraft gesetzt.Wo wir auf solche Notverordnungen angewiesen sind, müs-sen wir unbedingt einerseits Handlungsfähigkeit und Flexibi-lität, andererseits aber auch für alle betroffenen Parteien Be-rechenbarkeit haben. Das würde hinfällig, wenn diese Not-verordnungen jedesmal noch vom Parlament genehmigt wer-den müssten. Mit der Befristung hingegen bin ich einver-standen.
Angenommen – Adopté
Art. 173Anträge der Kommissionen: BBlPropositions des commissions: FF
Frick Bruno (C, SZ), Berichterstatter: Im vorangehenden Ar-tikel ging es um die Beziehungen zum Ausland, hier geht esum die äussere und innere Sicherheit.
30. April 1998 S 145 Bundesverfassung. Reform
Amtliches Bulletin der Bundesversammlung / Separatdruck
In Absatz 3 stellt sich wiederum die Frage der Noterlassedurch den Bundesrat. Da müssen wir das System durchhal-ten. Die Befristung durch den Bundesrat ist Pflicht, aber dieGenehmigung durch das Parlament entfällt.In Absatz 4, wo es um das Truppenaufgebot für den Aktiv-dienst geht, beantragt Ihnen unsere Kommission einstimmig,die Zahl 2000 zu streichen. Warum?Zum ersten: Was mit dem Begriff «Aktivdienst» zusammen-hängt, ist Sache des Gesetzes und nicht der Verfassung. Esmacht keinen grossen Sinn, auf Verfassungsstufe eine Zahlmit einem Begriff zu verknüpfen, der erst auf Gesetzesstufedefiniert wird.Zum zweiten: Die Zahl 2000 hat heute eine völlig andere Be-deutung als im Jahre 1848, als ein Aufgebot von 2000 Mannoder die Androhung eines solchen Aufgebotes genügte, umeinen unbotmässigen Kanton zur Räson zu zwingen. Heutehat diese Zahl eine völlig andere Bedeutung. Die Zahl von2000 Mann sagt wenig darüber aus, was diese Truppe aus-richten kann. Eine Truppe von 2000 Mann mit Panzern ist et-was völlig anderes als eine Hilfstruppe – Sanität, Genie –, diemit 2000 Mann in einem Katastrophenfall, vielleicht im Rah-men des Aktivdienstes, Hilfe leisten muss.Diese Zahl ist auf der Stufe des Militärgesetzes geregelt. Dortgehört sie hin, und deshalb wollen wir sie hier eliminieren. Ichhoffe, dass sich der Bundesrat dieser Änderung ebenfalls an-schliessen kann.
Koller Arnold, Bundesrat: Den letzten Wunsch kann ich ausGründen der Konsequenz nicht erfüllen. Ich stelle hier jedochauch keinen Antrag. Ich glaube, dieses Problem müssen wirdann bei der Differenzbereinigung erledigen.Im Nationalrat ist darüber auch wieder eine grosse Debattegeführt worden. Es scheint, dass es sich beim Truppenaufge-bot zur Aufrechterhaltung der inneren Ordnung um einensehr sensiblen Bereich handelt. Deshalb hat der Bundesrat –seiner Linie folgend, überall dort möglichst nah bei der Nach-führung zu bleiben, wo es um sehr sensible politische Berei-che geht – die Zahl unverändert belassen. Es ist ein Thema,das wir in der Differenzbereinigung nochmals angehen wer-den.
Angenommen – Adopté
Art. 174Anträge der Kommissionen: BBlPropositions des commissions: FF
Frick Bruno (C, SZ), Berichterstatter: Artikel 174 ändern wirzusammen mit dem Nationalrat nur in Absatz 4, wo wir alsKorrelat zu Artikel 160 wiederum «sorgen für» und nicht «wa-chen über» sagen.
Angenommen – Adopté
Art. 175Anträge der Kommissionen: BBlPropositions des commissions: FF
Angenommen – Adopté
Art. 176Antrag der KommissionAbs. 1–3BBlAbs. 4StreichenAntrag Brunner ChristianeAbs. 4Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Art. 176Proposition de la commissionAl. 1–3FF
Al. 4Biffer
Proposition Brunner ChristianeAl. 4Adhérer à la décision du Conseil national
Frick Bruno (C, SZ), Berichterstatter: In Artikel 176 fügt derNationalrat die Absätze 3 und 4 ein.Absatz 3 regelt, dass das Bundesgericht seine Verwaltungselber bestellt. Das ist bereits heute Rechtswirklichkeit. Es istalso nur eine Heraufstufung auf Verfassungsebene. Dage-gen haben wir nichts einzuwenden und schliessen uns an.Absatz 4 hat uns hingegen nicht überzeugt. Es ist wohl einegute und achtbare Idee, dass bei der Wahl der Richterinnenund Richter auf die Vertretung der Amtssprachen Rücksichtgenommen werden soll. Die Idee einer repräsentativen Ver-tretung der Sprachen und damit auch der Landesteile in derSchweiz ist richtig. Aus folgenden Gründen hat sich aber dieKommission praktisch einstimmig entschlossen, Absatz 4 zustreichen. Zum ersten ist diese Vertretung bereits heute Pra-xis. Es ist also nicht nötig, dies in der Verfassung nochmalszu normieren. Weiter stellt sich die Frage, warum von Spra-chen und nicht von Landesteilen die Rede ist, weil heute dieLandesteile vertreten sein sollen. Seit das Bundesgericht exi-stiert, ist es Praxis, dass immer drei, nach Möglichkeit sogaralle vier Sprachen – auch das Rätoromanische – vertretensind.Weil diese Bestimmung nur das Bundesgericht betrifft, wirftdies die grosse Frage auf: Geht es dabei um ein qualifiziertesSchweigen der Verfassung gegenüber anderen Gremien desBundes? Das war der Hauptgrund dafür, dass wir sagen:Diese Bestimmung deckt sich an sich mit der Realität; in ihrerFormulierung und in ihrer ausschliesslichen Normierungbeim Bundesgericht aber wirft sie mehr Fragen auf, als sielöst. Deshalb haben wir sie gestrichen.Frau Brunner stellt den Antrag, dem Nationalrat zu folgen. Esgibt gute Gründe dafür, aber nach der Wertung der Gründehat sich die Kommission aus den genannten Erwägungendoch für Streichung ausgesprochen.
Brunner Christiane (S, GE): L’actuel article 107 alinéa 1erde la constitution dispose que «les membres et les sup-pléants du Tribunal fédéral sont nommés par l’Assemblée fé-dérale, qui aura égard à ce que les trois langues officielles dela Confédération y soient représentées». La loi fédérale d’or-ganisation judiciaire est rédigée, finalement, comme une dis-position d’exécution de cette garantie constitutionnellepuisqu’elle reprend au niveau législatif le critère de la répar-tition linguistique.Le projet du Conseil fédéral, appuyé par la commission,s’écarte de la volonté du précédent constituant pour le motifque la prise en compte des langues officielles est suffisam-ment garantie au niveau législatif, d’une part, et dans la pra-tique actuelle, comme je viens de l’entendre, d’autre part. Al’instar du Conseil national, je ne partage pas cette positionet je plaide en faveur de l’inscription, au niveau constitution-nel, d’un critère de répartition linguistique applicable à lacomposition du Tribunal fédéral.Chaque fois que j’entre dans ce Parlement, il y a un symbolequi s’offre à nos regards, celui du monument qui représenteles trois Suisses. Alors, on peut interpréter les trois Suissesde toutes sortes de manières, mais si on actualise ce sym-bole, pour moi, il représente les trois aires linguistiques prin-cipales de la Suisse.Le projet du Conseil fédéral et la proposition de la commis-sion m’obligent à rappeler – je le regrette – que non seule-ment la Suisse est multiculturelle – ce qui me plaît –, maisqu’il me faut entrer dans le débat relatif à la hiérarchie desnormes, car la solution du Conseil fédéral conduit à contes-ter l’égalité, garantie au niveau constitutionnel, entre les dif-férentes langues et cultures du pays. Les langues officiellessont l’allemand, le français et l’italien, et leur énumération auniveau constitutionnel garantit une égalité entre elles, c’est-à-dire que la constitution garantit le droit pour les personnes
Constitution fédérale. Réforme 146 E 30 avril 1998
Bulletin officiel de l’Assemblée fédérale / Tiré à part
vivant dans notre pays de s’adresser aux autorités dansl’une des langues officielles et qu’elle leur garantit aussi ledroit de recevoir une réponse dans l’une de ces langues offi-cielles. Garantir au niveau constitutionnel le critère de la ré-partition linguistique signifie garantir à chaque justiciable ledroit de pouvoir s’adresser à un juge s’exprimant dans lamême langue, pour autant que cette langue soit une langueofficielle.J’aimerais dire que la langue est le bon critère, et ce n’est pasune question de régions. La langue ne se limite pas à un sim-ple critère d’expression. La langue est aussi le reflet de l’iden-tité des êtres humains puisqu’elle implique l’appartenance àune nation, à une culture, à une mentalité qui résultent de siè-cles d’histoire. Le critère de la langue est particulièrement im-portant pour les minorités, car leur reconnaître le droit des’exprimer et de se voir répondre dans leur langue conduit àleur conférer un statut d’égalité avec la majorité, et il impliqued’accepter et de reconnaître leur propre identité culturelle.Les particularités d’état d’esprit, de mentalité, de référencesculturelle et historique dues à l’usage d’une langue valentnon seulement pour les justiciables qui s’adressent au Tribu-nal fédéral, mais cela vaut également pour les juges qui sontappelés à statuer. Par exemple, il est patent qu’un juge alé-manique s’orientera plus volontiers sur la doctrine alle-mande, alors qu’un juge romand sera plus enclin à se rappro-cher des sources francophones. Ces affinités, ces sensibili-tés des juges résultant de leur appartenance à diverses cul-tures ne sont pas des détails. Au contraire, elles ont unegrande importance pour l’évolution de la jurisprudence duTribunal fédéral, de notre cour suprême. Et je rappelle, si be-soin est, que la loi fédérale d’organisation judiciaire disposeque les recours au Tribunal fédéral doivent être rédigés dansl’une des langues nationales, que la règle observée par tou-tes les juridictions fédérales, y compris le Tribunal fédéral, estque les recours soient instruits dans la langue utilisée parl’autorité de première instance. C’est une règle qui protègeles administrés, en particulier les administrés des minoritéslinguistiques.Au regard du principe incontesté de l’égalité érigée en normeconstitutionnelle entre les langues officielles, de l’égalité en-tre les différentes cultures du pays, les minorités doivent sevoir garantir, au niveau constitutionnel également, qu’elles nedevront pas à l’avenir se contenter de prendre acte de déci-sions d’un Tribunal fédéral qui pourrait être teinté d’une cul-ture et d’un état d’esprit germanophones. Renvoyer le critèrede la répartition linguistique au Tribunal fédéral au niveau lé-gislatif n’offrirait plus une telle garantie aux minorités, l’égalitéde traitement entre les justiciables pouvant être remise encause sans qu’il soit nécessaire d’obtenir la double majoritédu peuple et des cantons.En conclusion, ce n’est pas tellement par chauvinisme ro-mand, ni parce que je suis motivée par des préoccupationsdoctrinaires ou dogmatiques que je vous demande d’accep-ter ma proposition de vous rallier à la décision du Conseil na-tional. Mais c’est justement pour pouvoir, à l’avenir encore,regarder en rentrant dans le Palais du Parlement le monu-ment des trois Suisses en ayant la conviction qu’il représentebien le présent et l’avenir de notre pays avec ses trois com-posantes linguistiques principales, puisqu’il me plaît d’inter-préter le symbole des trois Suisses de cette manière.
Koller Arnold, Bundesrat: Auf der Fahne sehen Sie, dassauch der Bundesrat auf die Aufnahme dieser Bestimmung,die sich heute in Artikel 107 Absatz 1 zweiter Satz der Bun-desverfassung findet, verzichtet hat. Wir waren der Meinung,man sollte das vielleicht besser im Gesetz regeln. Wenn wires nur für das Bundesgericht regeln, könnte man sich fragen,warum man es beispielsweise nicht auch für den Bundesratregelt.Ich sehe, dass hier eine Sensibilität der Romandie besteht.Deshalb würde ich Ihnen vorschlagen, dass wir uns überalldort, wo wir politische Sensibilitäten feststellen, möglichst andie geltende Verfassung anlehnen; das wäre sicher klug.Ich empfehle Ihnen deshalb, dem Antrag Brunner Christianezuzustimmen.
Abs. 1–3 – Al. 1–3Angenommen – Adopté
Abs. 4 – Al. 4
Frick Bruno (C, SZ), Berichterstatter: Aufgrund des Votumsvon Herrn Bundesrat Koller möchte ich erwähnen, dass in derKommission ein Vertreter einer lateinischen Sprache dieStreichung begehrt hat. Es gibt offensichtlich auch unter denNichtdeutschsprachigen unterschiedliche Auffassungen.
Abstimmung – VoteFür den Antrag Brunner Christiane 18 StimmenFür den Antrag der Kommission 9 Stimmen
Art. 177–180Anträge der Kommissionen: BBlPropositions des commissions: FF
Frick Bruno (C, SZ), Berichterstatter: Gestatten Sie, dass ichdie Artikel 177 bis 180 gesamthaft erläutere. Es handelt sichum die letzten übriggebliebenen Bestimmungen. Die Artikel181ff. haben wir bereits am 9. März 1998 genehmigt.Zu den einzelnen Artikeln folgendes: Artikel 177 nennt inAbsatz 1 Litera b die Gemeindeautonomie ausdrücklich. ImEntwurf des Bundesrates war sie verklausuliert. Nun ist sieausdrücklich genannt. Der Nationalrat hat so beschlossen.Wir schliessen uns jenem Beschluss an.Zu Artikel 178 habe ich keine Bemerkungen. Das ist gelten-des Recht. Es liegen keine Änderungen vor.Zu Artikel 179: Hier wird die Bestimmung über die Bundesas-sisen gestrichen. Wir glauben, dass wir diese Bestimmungstreichen können, ohne das Konzept der Nachführung zuverletzen, zumal die Bundesassisen in der Verfassung zwargenannt, in der Rechtswirklichkeit jedoch ohne jede Bedeu-tung sind. Meines Wissens sind sie in den letzten 60 Jahrennie aufgeboten worden. Es ist auch nicht anzunehmen, dasssie in den nächsten Jahrzehnten aufgeboten werden. Ge-stützt auf die Rechtswirklichkeit und auf die einhellige Über-zeugung in der Kommission und auch im Nationalrat könnenwir Artikel 179 streichen.Zu Artikel 180: Es handelt sich hier lediglich um eine Anpas-sung der Terminologie an Artikel 153a.
Angenommen – Adopté
Präsident: Wir sind damit am Ende der Beratungen über denEntwurf A angelangt.
Gesamtabstimmung – Vote sur l’ensembleFür Annahme des Entwurfes 30 Stimmen
(Einstimmigkeit)
Abschreibung – Classement
Antrag des BundesratesAbschreiben der parlamentarischen Vorstössegemäss Brief an die eidgenössischen RäteProposition du Conseil fédéralClasser les interventions parlementairesselon lettre aux Chambres fédérales
Angenommen – Adopté
An den Nationalrat – Au Conseil national
17. Juni 1998 S 147 Bundesverfassung. Reform
Amtliches Bulletin der Bundesversammlung / Separatdruck
Siebente Sitzung – Septième séance
Mittwoch, 17. Juni 1998Mercredi 17 juin 1998
08.00 h
Vorsitz – Présidence: Zimmerli Ulrich (V, BE)
___________________________________________________________
96.091
Bundesverfassung.ReformConstitution fédérale.Réforme
Differenzen – DivergencesBeschluss des Nationalrates vom 8. Juni 1998Décision du Conseil national du 8 juin 1998
___________________________________________________________
A1. Bundesbeschluss über eine nachgeführte Bundes-verfassung (Titel, Art. 1–126, 185)A1. Arrêté fédéral relatif à une mise à jour de la Consti-tution fédérale (titre, art. 1–126, 185)
Rhinow René (R, BL), Berichterstatter: Heute beginnt dasDifferenzbereinigungsverfahren im Rahmen der Vorlage A1.Wir sind Erstrat bei der Präambel und den Artikeln 1 bis 126.Wir haben in diesem Bereich viele Differenzen abzutragenoder an Beschlüssen, die wir gefasst haben, festzuhalten.Bei der Beratung dieser ersten Hälfte der aktualisierten Ver-fassung sind rund 90 Differenzen entstanden. Davon ist etwadie Hälfte eher inhaltlicher, ein gutes Drittel eher redaktionel-ler und der Rest systematischer Natur.Ich erwähne die 15 wichtigsten Artikel oder Sachbereiche,bei denen inhaltliche Differenzen entstanden sind, stichwort-artig: Die Präambel, die Verankerung der Nachhaltigkeit, derArtikel über die individuelle und gesellschaftliche Verantwor-tung, das Diskriminierungsverbot und parallel dazu dasGleichstellungsgebot betreffend die Behinderten, der Artikelüber Kinder und Jugendliche im Grundrechtsteil der Verfas-sung, das Redaktionsgeheimnis, der unentgeltliche Grund-schulunterricht, die Entschädigungspflicht bei Eigentumsbe-schränkungen ausserhalb einer formellen oder materiellenEnteignung, das Streikrecht, der Städteartikel, der Ordensar-tikel, der Umweltschutzartikel, die Unterstützung mehrspra-chiger Kantone bei der Erfüllung spezifischer Aufgaben, derBistumsartikel und der bezahlte 1. August. Das sind die wich-tigsten Bestimmungen und Sachbereiche, bei denen sich dieRäte nicht einig sind.Daneben gibt es systematische Differenzen. In diesem Be-reich hat ein Verständigungsausschuss getagt, der sich ausden Präsidenten der Verfassungskommissionen und Sub-kommissionen beider Räte zusammengesetzt hat, ergänztdurch einige Mitglieder der Kommission des Nationalrates.Dieser Verständigungsausschuss hat zuhanden der beidenKommissionen Anträge formuliert, um das weitere Vorgehenzu erleichtern. Er beantragt, teilweise die Systematik desStänderates und teilweise diejenige des Nationalrates zuübernehmen.Die Kommission hat sich bei ihren Anträgen ans Plenumüberall an diese Empfehlungen gehalten, auch dort, wo sieLösungen des Nationalrates zu übernehmen hatte. Dement-sprechend beantragt sie Festhalten an der Systematik beiden Bestimmungen über Bundesstaat und Föderalismus,über den Standort der Bürgerrechte – anschliessend an die
Grundrechte –, bei der Integration der Amtssprachen in denSprachenartikel, bei der Umstellung von Umweltschutzartikelund Raumplanungsartikel, bei der Aufteilung des 4. Abschnit-tes in einen Abschnitt «Öffentliche Werke und Verkehr» undeinen Abschnitt «Energie und Kommunikation» sowie bei derReihenfolge der Wirtschaftsartikel, der Artikel 85 bis 98; dorthaben wir bekanntlich einige Umstellungen vorgenommen.Hingegen haben wir die nationalrätlichen Beschlüsse über-nommen bei der Verankerung des Verantwortlichkeitsartikelsim 1. Titel – nicht anschliessend an die Bürgerrechte – sowiebei der Aufteilung des Bildungsartikels in zwei Artikel. Sovielzu den systematischen Belangen.Wir haben zusätzlich Abklärungen vorgenommen bezüglichder Begriffe Stimmrecht, Wahlrecht, politische Rechte, Volks-rechte. Wir haben nun durchgängig eine einheitliche Begriffs-bildung gewählt, wobei der Terminus «politische Rechte»nun überall als Oberbegriff verwendet wird.Sachlich gesehen beantragen wir einige wichtige Differenzenzu bereinigen, indem wir uns dem Nationalrat angeschlossenhaben. Ich komme darauf zurück. In 15 Fällen hat die Kom-mission Kompromissvorschläge erarbeitet, welche eine An-näherung an die Version des Nationalrates bedeuten.Zustimmung zum Nationalrat beantragen wir insbesondere indrei Bereichen, nämlich bei der Anerkennung des Anspru-ches auf unentgeltlichen Grundschulunterricht – Artikel 16aim Grundrechtsteil –, bei der ausdrücklichen Gewährleistungdes Redaktionsgeheimnisses – in Artikel 14a – sowie bei Ar-tikel 51 Absatz 2: Danach haben die Kantone die von ihnenabgeschlossenen Verträge mit ausländischen Partnern demBund nicht mehr zur Genehmigung zu unterbreiten, sondernsie werden den Bund vor dem Abschluss von Verträgen nurnoch zu konsultieren haben.Kompromisse haben wir vorgenommen bei der Präambel,bei der Verankerung der Nachhaltigkeit, beim Diskriminie-rungsartikel, bei den Kinder- und Jugendrechten, bei der Ver-ankerung des Streikrechtes und bei den Sozialzielen. Hiersind wir auf eine mittlere Lösung eingeschwenkt, um im Rah-men des Differenzbereinigungsverfahrens den weiteren Fort-gang zu erleichtern.Zudem ist in zwei Fällen die Fahne nicht leicht zu lesen, undzwar weil die Beschlüsse des Nationalrates und des Stände-rates zumindest redaktionell zum Teil weit auseinander lie-gen. Wir unterbreiten deshalb Kompromissvorschläge undhaben dabei notgedrungen Textteile beider Fassungen über-nommen. Es betrifft dies die Präambel und Artikel 33 über dieSozialziele. Ich habe deshalb veranlasst, dass Sie neben dergewohnten Fahne auf separaten Blättern auch die vollständi-gen Textfassungen der Präambel und des Sozialzielartikelserhalten. Damit soll die Lesbarkeit, die Übersichtlichkeit fürunsere Beratungen verbessert werden.Ich muss Sie sodann noch darüber orientieren, dass die stän-derätliche Kommission in zwei Fällen Änderungen beschlos-sen hat, die bei diesem Stand des Verfahrens an sich nichtbehandelt werden können, weil keine Differenzen mehr zumNationalrat bestehen. Es handelt sich einerseits um eine er-weiterte Gesetzgebungskompetenz im Bereich der Berufsbil-dung, über die sogenannten Biga-Berufe hinaus, anderer-seits um die Aufnahme einer Zielbestimmung in die Verfas-sung im Bereich der Aussenwirtschaftspolitik.Wir sind hier der Meinung, dass wir den Entwurf nochmalsändern sollten, wir brauchen dafür aber die Zustimmung dernationalrätlichen Kommission. Dementsprechend haben wirdiese Vorschläge an die Verfassungskommission des Natio-nalrates weitergeleitet. Wenn sie ebenfalls dieser Meinungist, wird sie diese Artikel im Differenzbereinigungsverfahrennoch einbringen können.Das anspruchsvolle Unterfangen einer gleichzeitigen Be-handlung der Vorlage A in beiden Räten setzt voraus, dasswir nun im Differenzbereinigungsverfahren mit gutem Willenund mit dem Willen zur Verständigung an die Arbeit gehen,sonst wird schlussendlich alles auf eine Einigungskonferenzaufgeschoben, was – so meine ich – kein sinnvoller Wegwäre.Die Verfassungskommission Ihres Rates hat deshalb mit ih-ren differenzierten Lösungen – Festhalten bei einigen wichti-
Constitution fédérale. Réforme 148 E 17 juin 1998
Bulletin officiel de l’Assemblée fédérale / Tiré à part
gen Fragen, Entgegenkommen in anderen wichtigen Fra-gen – und mit Kompromisslösungen in doch recht beträchtli-cher Zahl diesen guten Willen an den Tag gelegt. Ich möchteSie im Namen der Kommission bitten, unseren Vorschlägenund Anträgen zuzustimmen.
TitelAntrag der KommissionFesthalten
TitreProposition de la commissionMaintenir
Rhinow René (R, BL), Berichterstatter: Ich äussere michzum Titel; hier beantragt Ihnen die Kommission Festhal-ten. Der Bundesbeschluss lautet nach unserer Version:«Bundesbeschluss über eine neue Bundesverfassung»,während Nationalrat wie Bundesrat von «Bundesbeschlussüber eine nachgeführte Bundesverfassung» sprechen. Wirsind nach wie vor der Meinung, dass unsere Version bes-ser ist und der Begriff der Nachführung wenig geeignet ist,als Titelbegriff in seiner doch nicht ganz klaren Bedeutungaufgenommen zu werden. Der Nationalrat hat im übrigendarüber nicht diskutiert; er hat davon nicht Kenntnis ge-nommen.Auch dies ist ein Grund, daran festzuhalten.
Merz Hans-Rudolf (R, AR): Als Nichtmitglied der Kommissionstelle ich einfach die Frage: Hat man geprüft, ob man derganzen Vorlage nicht auch den Namen «Bundesbeschlussüber die Reform der Bundesverfassung» geben könnte?Was wir vornehmen, ist ja eine Reform der Bundesverfas-sung. Das wäre vielleicht ein Kompromiss zwischen den bei-den Auffassungen.
Rhinow René (R, BL), Berichterstatter: Ich glaube, dass dasnicht unbedingt sinnvoll wäre, weil unter «Reform der Bun-desverfassung» auch die weiteren Vorlagen B und C ver-standen werden können. Hier geht es eigentlich um die Ak-tualisierung der geltenden Bundesverfassung, und in dennächsten Phasen geht es um die weiteren, substantiellen Re-formen. Wenn wir hier diesen Begriff aufnehmen, würden wirvielleicht Missverständnisse schaffen. Einen Anlass zu ei-nem Kompromiss sehe ich insofern noch nicht, als der Natio-nalrat diese Frage ja noch nicht diskutiert hat. Ich kann mirsehr gut vorstellen, dass er sich unserem Titel anschliessenwird.
Angenommen – Adopté
Präambel Abs. 2, 2a, 3, 4, 5, 5a, 5b, 6Antrag der KommissionAbs. 2Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates(die Änderung betrifft nur den französischen Text)
Abs. 2aMehrheitZustimmung zum Beschluss des NationalratesMinderheit(Gentil, Aeby, Cavadini Jean, Forster, Marty Dick)Streichen
Abs. 3.... erneuern und seinen Zusammenhalt zu festigen, um Frei-heit, Demokratie, Unabhängigkeit ....Abs. 4Zustimmung zum Beschluss des NationalratesAbs. 5FesthaltenAbs. 5a, 5bStreichenAbs. 6Festhalten
Préambule al. 2, 2a, 3, 4, 5, 5a, 5b, 6Proposition de la commissionAl. 2Maintenir
Al. 2aMajoritéAdhérer à la décision du Conseil nationalMinorité(Gentil, Aeby, Cavadini Jean, Forster, Marty Dick)Biffer
Al. 3Résolus à renouveler leur alliance et à raffermir leur cohésionpour renforcer ....Al. 4Adhérer à la décision du Conseil nationalAl. 5MaintenirAl. 5a, 5bBifferAl. 6Maintenir
Frick Bruno (C, SZ), Berichterstatter: Die Präambel ist aufder Fahne leicht verwirrlich dargestellt; sie ist in der Tat nichtleicht zu lesen, sie ist aber korrekt dargestellt, weil ja gemässunserem Brauch die Änderungen immer aufzuführen sind,damit die einzelnen Schritte in den Räten nachvollzogen wer-den können. Aus diesem Grund liegt Ihnen der vollständigeText der Präambel auf einem separaten Blatt vor.Ich möchte in drei Schritten erklären, wie wir zu unserer Lö-sung gekommen sind. Zuerst möchte ich ausführen, was derNationalrat geändert hat, dann möchte ich seine Änderungenwürdigen und schliesslich die Folgerungen der Kommissiondarlegen.1. Was hat der Nationalrat getan? Er hat die Präambel bela-den, wir meinen: sogar überladen. Er hat den Absatz 2a – «inder Verantwortung gegenüber der Schöpfung» – eingefügt.Darauf soll auch die Präambel Bezug nehmen, verlangt dieMehrheit des Nationalrates. In Absatz 3a hat er als zusätzli-che Werte neben Freiheit, Unabhängigkeit und Frieden auchdie Demokratie eingefügt. Er hat weiter das statische Wort«bewahren» durch das aktivere, kräftigere Verb «stärken»ersetzt.In Absatz 4 hat der Nationalrat das Wort «Toleranz» durchden rein deutschen Begriff «Rücksichtnahme» ersetzt. In Ab-satz 5 hat er sich der Formulierung «im Bewusstsein der ge-meinsamen Errungenschaften» entledigt, also die historischeVerpflichtung aus der Präambel gekippt. Schliesslich hat er inden Absätzen 5a und 5b Passagen aus der MuschgschenFormel aus den siebziger Jahren übernommen.2. Wie stellen wir uns zu den Änderungen des Nationalrates?Vorab gilt festzustellen, was der Kommissionspräsident er-wähnt hat: Der Nationalrat hat quasi in der Retorte beraten,ohne unsere Fassung überhaupt zu prüfen. Wir unsererseitshaben uns mit der Fassung des Nationalrates genau ausein-andergesetzt. Die Änderungen in den Absätzen 1 bis 4 erwei-sen sich nach unserer Beurteilung in der Tat als Verbesse-rungen, und zwar in bezug auf den Inhalt und auf die Spra-che. Hingegen ist die Implantation der Muschgschen Ele-mente – wenn ich sie so bezeichnen darf –, auch wenn sie fürsich eine sehr hohe Qualität haben, nicht sachgerecht. Er-stens handelt es sich um ein fremdes Element, der Sprach-fluss ist ein anderer, es ist kein einheitlicher Guss mehr.Zweitens bringen die Muschgschen Elemente eine Wieder-holung der Absätze 3 und 4 und führen dazu, dass die Prä-ambel nicht mehr überblickbar, nicht mehr konzis ist. Drittensglauben wir, dass die historische Verpflichtung, die wir in Ab-satz 5 normiert haben, durchaus ihre Berechtigung hat.3. Aus diesen Gründen bitten wir Sie, wie folgt zu entschei-den: Wir möchten die Verbesserungen in Absatz 4 überneh-men und schliessen uns auch der sprachlichen Verbesse-rung des Nationalrates in Absatz 3 an; wir haben sie aufgrundder Verbesserung des Nationalrates neu gefasst, inhaltlich
17. Juni 1998 S 149 Bundesverfassung. Reform
Amtliches Bulletin der Bundesversammlung / Separatdruck
die Änderungen des Nationalrates aber übernommen. Beiden Absätzen 5 und 6 bitten wir Sie, die Muschgschen Ele-mente nicht aufzunehmen und an unserer Fassung festzu-halten. Soweit ist sich die Kommission vollständig einig.Eine Differenz innerhalb der Kommission ergibt sich nur beiAbsatz 2: Die Mehrheit glaubt, dass die Verantwortung ge-genüber der Schöpfung durchaus in der Präambel Bestandhat; die Minderheit möchte darauf verzichten. In der Verfas-sungskommission wurde geltend gemacht, dass diese Ver-antwortung gegenüber der Schöpfung in der Anrufung Got-tes, in der Invocatio, bereits enthalten sei. Trotzdem erachtetes die Mehrheit als gerechtfertigt, die Verantwortung gegen-über der Schöpfung in dieses Kurzprogramm – die Präambelist ja ein Kurzprogramm: konzis, kurz, sprachlich prägnantgefasst – aufzunehmen.
Abs. 2 – Al. 2Angenommen – Adopté
Abs. 2a – Al. 2a
Präsident: Auf der Fahne fehlt beim Antrag der Mehrheit derHinweis auf Absatz 2a. Ich verweise Sie auf das separateBlatt, wo die vollständige Präambel aufgeführt ist.
Gentil Pierre-Alain (S, JU): Comme l’a dit tout à l’heureM. Frick, rapporteur, en présentant l’ensemble du préam-bule, nous avons eu, en commission, une discussion qui con-sistait à savoir si ce préambule devait à lui seul contenir pra-tiquement l’ensemble des éléments que l’on retrouve ulté-rieurement dans la constitution. Nous avons estimé qu’il yavait, dans la version du Conseil national, une tendance àaugmenter la longueur de ce préambule, sans que le contenului-même en soit considérablement enrichi.C’est la raison qui pousse la minorité de la commission àvous proposer de rejeter cet alinéa 2a qui, de son point devue, n’apporte rien au préambule. En effet, en mentionnant laresponsabilité envers la Création, on défend deux idées: lapremière rappelle que, s’il y a création, il y a créateur, maisl’invocation à Dieu Tout-Puissant, à l’alinéa 1er, contient déjàcette idée. La deuxième idée fait allusion aux responsabilitésqu’ont les citoyens envers le monde dans lequel ils vivent àl’égard des générations futures, ce qui est exprimé très clai-rement à l’alinéa 5.En conséquence, nous estimons que cet alinéa 2a n’apporteabsolument rien de nouveau et que, dans le fond, il ne cons-titue qu’une redite d’éléments mentionnés de manière plusramassée et plus incisive aux alinéas 1er et 5.Pour ces raisons, nous vous suggérons de biffer cet alinéa 2a.
Koller Arnold, Bundesrat: Über die Präambel lässt sich na-türlich trefflich streiten. Aber auch die Volksdiskussion hatgezeigt, dass für das Volk die Präambel vielleicht fast dasWichtigste ist, weil sie die Vision unseres Staates zum Aus-druck bringen soll.Aus dieser Sicht – ich habe es schon im Nationalrat gesagt –ist es wichtig, dass eine Präambel aus einem Guss geschrie-ben ist und auch im Stil und in der Wortführung eine gewisseHöhe einhält. Deshalb muss aus der Sicht des Bundesratesder Versuch des Nationalrates, die glänzende Formel vonMuschg aus dem Entwurf von 1977 mit jener unseres Ent-wurfs zu verbinden, als misslungen erachtet werden. DerText ist auch eindeutig zu lang. Deshalb würde ich im Zweifelfür eine möglichst kurze Fassung votieren.Aus den Gründen, die Herr Gentil genannt hat, würde ich beiAbsatz 2a eher dem Antrag der Minderheit zustimmen.
Abstimmung – VoteFür den Antrag der Minderheit 17 StimmenFür den Antrag der Mehrheit 14 Stimmen
Abs. 3 – Al. 3
Präsident: Dieser Absatz ist auf der Fahne als Absatz 3a be-zeichnet; massgebend ist das Beiblatt.
Angenommen – Adopté
Abs. 4, 5, 5a, 5b, 6 – Al. 4, 5, 5a, 5b, 6Angenommen – Adopté
Art. 1Antrag der KommissionFesthalten
Art. 1Proposition de la commissionMaintenir
Frick Bruno (C, SZ), Berichterstatter: Ich spreche zugleichzum 1. Titel und zu Titel und Inhalt von Artikel 1. Nach der Sit-zung des Nationalrates hat ein Verständigungsausschussbeider Verfassungskommissionen getagt. Dabei haben dieVertreter der nationalrätlichen Kommission erklärt, diese Dif-ferenz sei nicht bewusst geschaffen worden, sondern sierühre daher, dass der Nationalrat die Beschlüsse des Stän-derates gar nicht gewürdigt habe. Unser Präsident der Ver-fassungskommission hat gesagt, das sei kein böser Wille,aber ich stelle fest: Es ist vorsätzlich geschehen, offenbarvorsätzlich ohne bösen Willen. Wir hatten in der ersten Le-sung als Erstrat begründet, weshalb wir die Bezeichnung des1. Titels sowie den Titel und die Formulierung von Artikel 1geändert haben. Wiederholungen sind überflüssig.Wir bitten Sie einstimmig, an unserem Beschluss festzuhal-ten.
Angenommen – Adopté
Art. 2 Abs. 2, 2bis, 3, 4Antrag der KommissionAbs. 2MehrheitSie fördert nachhaltig die gemeinsame Wohlfahrt, den inne-ren Zusammenhalt und die kulturelle Vielfalt des Landes.Minderheit(Frick, Aeby)Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Abs. 2bisMehrheitStreichenMinderheit(Aeby)Zustimmung zum Beschluss des NationalratesAbs. 3FesthaltenAbs. 4Streichen
Art. 2 al. 2, 2bis, 3, 4Proposition de la commissionAl. 2MajoritéElle favorise de façon durable la prospérité commune. Elleencourage la cohésion interne et la diversité culturelle dupays.Minorité(Frick, Aeby)Adhérer à la décision du Conseil national
Al. 2bisMajoritéBifferMinorité(Aeby)Adhérer à la décision du Conseil national
Al. 3MaintenirAl. 4Biffer
Constitution fédérale. Réforme 150 E 17 juin 1998
Bulletin officiel de l’Assemblée fédérale / Tiré à part
Abs. 2 – Al. 2
Frick Bruno (C, SZ), Berichterstatter: Artikel 2 erfährt in Ab-satz 1 keine Änderung; ich leite gleich zu Absatz 2 über.In Absatz 2 wirft der Begriff der Nachhaltigkeit, den der Na-tionalrat eingeführt hat, Probleme auf. Was hat der National-rat getan? Er hat zum ersten die Reihenfolge der Begriffeumgestellt; damit haben wir keine Probleme. Er hat aber zu-sätzlich die Förderung der nachhaltigen Entwicklung alsStaatszweck in Absatz 2 aufgenommen. Mit der Nachhaltig-keit an sich hat unsere Verfassungskommission ebenfallskeine Probleme.Was verstehen wir unter Nachhaltigkeit? Nachhaltige Ent-wicklung bedeutet nach heutigem Verständnis die Pflicht,darauf zu achten, dass die Entwicklung unserer Gesellschaftharmonisch verläuft und dass wir auf das soziale und wirt-schaftliche Element und auf die Lebensgrundlagen Rücksichtnehmen. Eine nachhaltige Entwicklung ist kontrollierbar, siemacht keine zu grossen Sprünge, die zu Schäden führen undnachher grosse Korrekturen erfordern; der Mensch setzt sichselber Grenzen. Er legt viel mehr Wert auf eine langfristigharmonische Entwicklung als auf eine kurzfristige Maximie-rung und auf eine kurzfristige Optimierung von Wohlstandund materiellem Erfolg. Damit ist nachhaltige Entwicklungalso viel mehr als nur Erhaltung der natürlichen Lebens-grundlagen gemäss Absatz 3. Im weiteren Sinn fallen näm-lich unter den Begriff der Nachhaltigkeit auch ein auf Dauerausgeglichener Finanzhaushalt und auf Dauer finanzierbareSozialleistungen. So verstehen wir die Nachhaltigkeit in un-serer Kommission.Der Bundesrat, so liess er uns erklären, kann sich grundsätz-lich nicht nur mit der Nachhaltigkeit in der Verfassung, son-dern auch mit der Nachhaltigkeit, wie sie der Nationalrat nor-miert hat, anfreunden. Die Frage bleibt nur – darin unter-scheiden sich in Absatz 2 die Anträge der Mehrheit und derMinderheit –: Soll gemäss der Mehrheit das Adverb stehen,«der Bund fördert nachhaltig», oder soll die Förderung derNachhaltigkeit als separater Ausdruck normiert werden, wiees die Minderheit will?Die Mehrheit glaubt, dass das Adverb genügt. Ich gehöre derMinderheit an und möchte, deren Haltung ebenfalls kurz be-gründen, da es um keine substantielle Änderung geht. DieMinderheit glaubt, dass die Lösung des Nationalrates auszwei Gründen den Vorzug verdient:1. Der Begriff der nachhaltigen Entwicklung ist fester Be-standteil der schweizerischen Politik geworden. Er darfdarum auch in der Verfassung stehen.2. Der Nationalrat hat seinen Beschluss mit so überwiegen-der Mehrheit gefällt, dass wir glauben, auf eine weitere Diffe-renzbereinigung verzichten und der Fassung des Nationalra-tes zustimmen zu können, zumal ja inhaltlich kaum ein Unter-schied zur Fassung der Mehrheit auszumachen ist.
Aeby Pierre (S, FR): Quelques mots, à l’article 2 alinéa 2, àpropos des notions de «développement durable et de «pros-périté commune».Je ne sais pas ce qu’il en est du texte en allemand, mais enfrançais on peut très bien imaginer une prospérité communeimmédiate, contraire au principe du développement durable.Je ne sais pas si on peut dire la même chose en allemand.En fait, la transformation effectuée par la majorité de la com-mission – qui remplace la décision du Conseil national – neprend plus du tout le même sens. A la rigueur, j’aurais com-pris que notre commission reprenne l’article 2 du projet duConseil fédéral, un article 2 extrêmement traditionnel. L’ali-néa 1er préciserait le rôle fondamental de la Confédération;l’alinéa 2 contiendrait les notions de «cohésion interne» et«prospérité commune»; ça, c’est ce à quoi nous sommes ha-bitués. Dès l’instant où on admet le principe de compléter cetarticle – cela s’applique aussi bien à l’alinéa 2 qu’à l’alinéa2bis que nous allons traiter tout à l’heure –, il faut aller aubout du raisonnement. Le développement durable est unenotion non seulement environnementale, mais aussi socialeet économique, faut-il le rappeler? Il me paraît tout à fait inté-ressant, à cet article 2, de garder exactement le libellé voulu
par le Conseil national, c’est-à-dire, d’un côté, la prospéritécommune qui est un concept que nous connaissons bien et,de l’autre, le développement durable qui, en soi, n’a rien àvoir avec la prospérité commune comme telle; on ne peut pasle ramener à la simple expression «de façon durable, la pros-périté commune», ça ne veut en fait rien dire.En conséquence, je rejoins les propos de M. Frick et vous inviteà adhérer à la décision du Conseil national à l’article 2 alinéa 2.
Schmid Carlo (C, AI): Die Verfassung verdient es schon,dass man auch mit Details genau umgeht. Ich habe Ver-ständnis für die Kommissionsmehrheit, dass sie einen Kom-promiss sucht, um den Begriff der Nachhaltigkeit, den die na-tionalrätliche Fassung in Artikel 2 Absatz 2 eingefügt hat,nicht einfach unter den Tisch fallenzulassen, sondern ihn aufirgendeine Art und Weise retten will. Immerhin zwei Bemer-kungen dazu:Zur Begriffsbestimmung, welche Herr Frick für den Begriff«nachhaltig» nun geliefert hat – dass sie im normalen deut-schen Sprachgebrauch so nicht üblich sei, neu sei –: Der Be-griff «nachhaltig» ist eine alte schweizerische Militärformel,es wird nachhaltig unterstützt, es wird nachhaltig Widerstandgeleistet usw. Dann kann man aber «nachhaltig» mit «anhal-tend» ersetzen. Wenn das aber nicht die Meinung der Mehr-heit ist, wenn die Kommissionsmehrheit tatsächlich «nach-haltig» einfach als Adverb versteht, das den gesamten Be-griffshof der Entwicklung, der Erhaltung, der Regenerations-fähigkeit der natürlichen Lebensgrundlagen beinhalten soll,dann machen wir, so meine ich, ein Hendiadyoin. Wir brau-chen diesen Begriff nicht, denn wir haben ihn schon!Lesen Sie Artikel 2 Absatz 3, der Antrag der Kommission lau-tet auf Festhalten. An was halten wir fest? Wir hatten be-schlossen: gemäss Bundesrat. Lesen Sie die bundesrätlicheFassung: «Sie setzt sich ein für die dauerhafte Erhaltung dernatürlichen Lebensgrundlagen ....» Das ist bereits drin, undalles andere ist überflüssig und stiftet Verwirrung.Daher meine ich, sollte man grundsätzlich beim Entwurf desBundesrates bleiben. Wenn das der Comment dieses Hau-ses gestattet, so bin ich der Auffassung, dass wir in Artikel 2Absatz 2 beim Entwurf des Bundesrates bleiben sollten.
Frick Bruno (C, SZ), Berichterstatter: Aufgrund der Ausfüh-rungen von Herrn Schmid möchte ich für die Kommissionzwei Erklärungen nachliefern:1. Das Wort «nachhaltig» ist in der Tat, Herr Schmid, keinneues. Es fand sich von alters her in militärischen Dokumen-ten, es findet sich aber seit langem auch in der Forstgesetz-gebung. «Nachhaltig» hiess schon immer «langfristig wirk-sam, andauernd, ohne Unterbruch, stetig wirksam». Dies istder Begriff der Nachhaltigkeit, wie er sich traditionell entwik-kelt hat. Aber seit einigen Jahren ist der Begriff der Nachhal-tigkeit im politischen Leben mit klarem Inhalt angereichert,namentlich aufgrund der Konferenzen von Rio de Janeiround Kyoto. Er betrifft mehr als nur die natürlichen Lebens-grundlagen. Er umfasst die stetige, ausgewogene Entwick-lung der Wirtschaft, der Gesellschaft, des Staates an sich,auch seiner Finanzen und Sozialwerke. Das ist im wesentli-chen der Begriff, wie er heute gängig ist und dem sich auchdie Kommission in den Erklärungen aller ihrer Mitglieder, diesich geäussert haben, angeschlossen hat.2. Die zweite Bemerkung betrifft Ihren Hinweis auf Absatz 3:Der Begriff «dauerhafte Erhaltung der natürlichen Lebens-grundlagen» decke die Nachhaltigkeit ab. Ich glaube vorhinausgeführt zu haben, dass die politisch verstandene Nach-haltigkeit eben weit über die blosse Schonung der Umweltund der natürlichen Ressourcen hinausgeht, weil sie zusätz-lich auch das wirtschaftliche und kulturelle Leben und das ge-samte Staatswesen umfasst. Aus diesen Gründen sind wirzur Überzeugung gekommen, dass die Nachhaltigkeit mitAbsatz 3 nicht abgedeckt ist, sondern dass sich eine zusätz-liche Normierung rechtfertigt.
Koller Arnold, Bundesrat: Persönlich sehe ich hier eher einDilemma. Auf der einen Seite ist es tatsächlich so, wie aus-geführt worden ist: Das Prinzip der nachhaltigen Entwicklung
17. Juni 1998 S 151 Bundesverfassung. Reform
Amtliches Bulletin der Bundesversammlung / Separatdruck
ist seit den berühmten Konferenzen von Rio und Kyoto auchexpressis verbis Bestandteil unserer Bundespolitik gewor-den. Ich verweise auf das Strategiepapier «Nachhaltige Ent-wicklung in der Schweiz», veröffentlicht im Bundesblatt (BBl1997 III 1045–1057). Andererseits ist der Begriff «nachhal-tig» wahrscheinlich – aber da werde ich subjektiv – auch einModewort. Es will ja zum Ausdruck bringen, dass die Politikund unser Denken nicht kurzfristig, sondern mittel- und lang-fristig angelegt sein sollen. Das, würde ich meinen, hätten un-sere Verfassungsväter schon immer so verstanden. Deshalbneige ich rein intuitiv eher zur Auffassung, dass wir die Ver-fassung nicht mit einem solchen Modewort belasten sollten.Ich wäre daher eher für die ursprüngliche Fassung des Bun-desrates.Inhaltlich sind wir uns einig: Es ist eine Frage der Opportuni-tät, ob Sie dieses neue Wort hier aufnehmen wollen odernicht.
Abstimmung – Vote
Eventuell – A titre préliminaireFür den Antrag der Mehrheit 28 StimmenFür den Antrag der Minderheit 7 Stimmen
Definitiv – DéfinitivementFür den Antrag der Mehrheit 20 StimmenFür den Antrag Schmid Carlo 16 Stimmen
Abs. 2bis – Al. 2bis
Frick Bruno (C, SZ), Berichterstatter: Der Nationalrat hat inAbsatz 2bis mit 86 zu 54 Stimmen die Chancengleichheit alsStaatszweck eingeführt. Mit dem Bundesrat hat auch dieKommission Verständnis für das Anliegen. Wir haben unsaber von der konzisen Begründung des Bundesamtes für Ju-stiz überzeugen lassen, dass die Chancengleichheit nicht inden Artikel betreffend den Staatszweck gehört. Ich möchteIhnen diese Begründung zusammengefasst vortragen.Die Chancengleichheit ist zunächst bereits durch Absatz 1des Zweckartikels, der den Schutz der Freiheit, der Gleich-heit und der Rechte unserer Bürger vorsieht, umfassend ver-ankert. Zudem ist die Rechtsgleichheit der Menschen in derSchweiz konkret durch Artikel 7 der Verfassung gewährlei-stet. Auch Artikel 31 erinnert daran, dass die Grundrechte tat-sächlich verwirklicht werden müssten. Wir sind uns auchdurchaus einig, dass die Chancengleichheit in dem Sinne be-stehen muss, dass in unserem Land, das eine offene Gesell-schaft ist, allen Gelegenheit gegeben werden muss, sich auf-grund der eigenen Leistungen und Fähigkeiten zu entfalten.Auch die Möglichkeit eines diskriminierungsfreien Zugangszu den Bildungsinstitutionen muss gegeben sein. Aber derBegriff der Chancengleichheit ist auch vor dem Hintergrundzu sehen, dass wir mit unterschiedlichen Startchancen insLeben treten. Wir glauben, der Staat würde sich überneh-men, wenn er diese ungleichen Startchancen zusätzlichkompensieren wollte.Absatz 2bis würde unerfüllbare Erwartungen wecken. Wir bit-ten Sie, darauf zu verzichten. Die Kommission ist sich dies-bezüglich in der grossen Mehrheit einig; die Minderheit Aebybeantragt, dem Nationalrat zu folgen.
Aeby Pierre (S, FR): A mon avis, deux positions sont défen-dables dans le débat:1. la position de M. Schmid Carlo qui préfère en rester à unarticle 2 dépouillé et traditionnel. Cette position se défendtout à fait intellectuellement et dans cet exercice de réformede la constitution;2. l’autre position qui consiste à dire: «Faisons un pas vers leConseil national!» On est ici de toute façon dans un chapitredéclaratif. On vient de voir le préambule, on vient de voir plu-sieurs dispositions, il y en aura d’autres où on est vraimentdans une partie très générale où ces déclaratifs sont en par-tie politiques.Alors, dès l’instant où on a fait un pas vers la position du Con-seil national et qu’on a accepté l’alinéa 2 tel que proposé,
avec ces termes «de façon durable», ou en allemand «nach-haltig», je ne vois pas pourquoi on écarterait l’alinéa 2bis quiconsacre un principe fondamental de notre Etat de droit.Tous les principes de l’alinéa 2, on les retrouve concrétisésailleurs, aussi bien «la prospérité commune», que la notionde «développement durable», qui est tout de même là, que la«diversité culturelle» du pays. Toutes ces notions sont con-crétisées à d’autres endroits de la constitution.On a élargi l’article sur la non-discrimination. Je vous rap-pelle les discussions que nous avons eues sur les handica-pés, sur l’âge, etc.; on a parlé des enfants, à un endroit ou àun autre; on a parlé de l’école primaire gratuite, etc. Ce sonttous des éléments concrets d’un principe fondamental de no-tre Etat de droit, et c’est pour ça que l’article 2bis se justifie,dès l’instant où on n’en reste plus à la version initiale du Con-seil fédéral.Je ne crois pas qu’on puisse suivre les explications deM. Frick, car l’explication qu’il a donnée, il pourrait la donnerpour n’importe laquelle des notions figurant maintenant dansl’article 2. Il y a des répétitions, que j’ai eu l’occasion de si-gnaler, entre le préambule qui parle de «diversités culturel-les», d’«obligations envers les générations futures», etc., etpar exemple l’alinéa 2 déjà, où on n’hésite pas à reprendrede ces éléments qu’on retrouvera encore plus loin, dansd’autres dispositions de la constitution. Alors, si vraiment onveut faire un pas de rapprochement en direction du Conseilnational, votons cet alinéa 2bis.On maintient déjà notre décision concernant l’alinéa 4 quivise à favoriser la paix et à contribuer à un ordre juste dumonde. On peut estimer qu’il s’agit là d’une tâche fondamen-tale de la Suisse peut-être, mais extérieure à sa vie propre,extérieure à ce qui se passe au sein de nos frontières et onpeut justifier ici une attitude assez dure. On peut aussi expli-quer que nous n’ayons pas retenu l’alinéa 3, car le principede «la conservation durable des bases naturelles de la vie»est contenu déjà dans le préambule, je l’ai dit, et on le re-trouve dans un article très précis des chapitres sur la protec-tion de l’environnement et l’aménagement du territoire. Maisl’«égalité des chances» comme telle, qui est une notion ex-trêmement noble, c’est que chacun, à sa naissance, doitavoir les mêmes chances, et on l’a voulu, notamment pourles handicapés, en allant très loin. Et bien, on peut très bienl’exprimer ici à l’article 2.Je vous invite donc à adhérer à la décision du Conseil natio-nal et à accepter l’alinéa 2bis.
Koller Arnold, Bundesrat: Der Ansatzpunkt von Herrn Aebyleuchtet auch mir durchaus ein. Das war der Grund, weshalbder Bundesrat sich im Rahmen der Nachführung für einen indiesem Sinne traditionellen Zweckartikel entschieden hat.Das ist auch der Grund, weshalb ich Ihnen empfehle, diesenAbsatz 2bis nicht aufzunehmen.Das Prinzip der Chancengleichheit als politisches Prinzip istsicher unbestritten. Wir wollen alle, dass die Bürgerinnen undBürger in diesem Land Aufstiegschancen haben. Ich glaube,dieses Land hat das auch bewiesen durch den unentgeltli-chen Unterricht in den Primarschulen und durch den auch imVergleich mit dem Ausland recht liberalen Zugang zu denMittel- und Hochschulen, um ein sehr wichtiges Gebiet zunennen. Dieses Prinzip ist unbestritten. Aber wenn Sie die-sen Zweckartikel nun mit derartig politischen Aussagen über-laden, sehe ich eine gewisse Gefahr, dass man mit Blick aufdie Konkretisierung der klagbaren Rechte – Herr Aeby hatselber darauf hingewiesen – Versprechen in die Welt setzt,die wahrscheinlich nachher nur sehr schwer gehalten werdenkönnen.Ich will Ihnen das an einem Beispiel zeigen: Auch Ihre Kom-mission hat jetzt das klagbare Sozialrecht auf unentgeltlichenPrimarschulunterricht unbestritten in die Verfassung aufge-nommen. Wenn Sie dieses Prinzip der Chancengleichheit alsAuslegungshilfe dann mit dem klagbaren Recht auf unent-geltlichen Primarschulunterricht verbinden, stellen sich natür-lich eminent wichtige Fragen: Was muss der Staat beispiels-weise gegenüber den Ausländern im Primarschulunterricht
Constitution fédérale. Réforme 152 E 17 juin 1998
Bulletin officiel de l’Assemblée fédérale / Tiré à part
tun? Da öffnen sich auch für die Rechtsprechung der Ge-richte Tore, die meines Erachtens im Rahmen der Gesetzge-bung zu überprüfen sind.Herr Aeby, ich war beispielsweise sehr beeindruckt, als ichvon Appenzell nach Bern kam. Meine Kinder hatten einenNachteil: Sie hatten noch keinen Französischunterricht ge-nossen. Die Stadt Bern hat grosszügigerweise solchen Zuzü-gern zusätzliche Französischstunden angeboten. Das ist po-litisch sicher erwünscht. Aber wollen wir, dass derartigeMassnahmen über diesen Zweckartikel in Verbindung mitden klagbaren Rechten in die Hand des Richters gegebenwerden? Ist es nicht besser, wenn solche Fragen vom Ge-setzgeber auf der jeweiligen Stufe – Bund, Kantone und Ge-meinden – ad hoc entschieden werden? Das sind die Beden-ken, die ich gegenüber einer derartigen Öffnung diesesZweckartikels habe.
Abstimmung – VoteFür den Antrag der Mehrheit 28 StimmenFür den Antrag der Minderheit 4 Stimmen
Abs. 3, 4 – Al. 3, 4
Frick Bruno (C, SZ), Berichterstatter: Der Nationalrat hat Ab-satz 3 der Vorlage des Bundesrates aufgeteilt. Unsere Kom-mission ist einhellig der Ansicht, dass er aus zwei Gründenzusammenbleiben muss:1. Die Lebensgrundlagen und der Friede hängen in tieferemSinn durchaus zusammen.2. Die Aufzählung von drei Staatszwecken ist griffiger, klarerund übersichtlicher als eine Aufgliederung in vier Zwecke.
Angenommen – Adopté
Art. 3Antrag der KommissionFesthaltenProposition de la commissionMaintenir
Aeby Pierre (S, FR), rapporteur: Je m’exprime comme rap-porteur de la commission et je rappelle peut-être certaines re-marques que le président de la commission, M. Rhinow, a fai-tes d’entrée de cause. Il y a 90 divergences environ – cela aété dit – et la bonne moitié de celles-ci relève de la systéma-tique ou de la rédaction. Chaque fois que je serai appelé àm’exprimer par la suite comme rapporteur sur différents arti-cles, mes remarques seront extrêmement brèves concernantla systématique ou la rédaction. Je me bornerai, dans le fond,à apporter des commentaires là où nous avons des divergen-ces de fond, qu’elles soient importantes ou légères.Concernant l’article 3, ce n’est pas simple, car si l’on veutavoir une vue d’ensemble, il faut se reporter aussi d’embléeà notre article 34a et aux articles 36 et 37, ces articles verslesquels nous avons déplacé les alinéas 2 et 3 de la versiondu Conseil fédéral. Nous ne discutons donc ici en fait que del’alinéa 1er du Conseil fédéral, que notre Conseil a modifié,ce qui vous donne l’article 3: «Les cantons sont souverainsen tant que leur souveraineté n’est pas limitée par la Consti-tution fédérale, et comme tels, ils exercent tous les droits quine sont pas délégués à la Confédération.»Nous considérons toujours, en commission, que nous de-vons maintenir à la fois la systématique et la rédaction del’article 3 qui est le fondement de l’Etat fédéral. Les deuxautres alinéas, nous les maintenons aux articles 34a, 36 et37. C’est dire que nous ne nous rallions pas à la systémati-que du Conseil national qui a voulu réintégrer ces deux ali-néas que nous avions expédiés – si vous me passez l’ex-pression – dans un autre chapitre et qui, en plus, a voulu in-troduire à l’alinéa 2 l’adverbe «explicitement» qui paraît troprestrictif et inutile.La commission vous propose donc, sans opposition, demaintenir notre texte, et le Comité de médiation – formé desprésidents des six sous-commissions, les trois du Conseil
des Etats et les trois du Conseil national –, vous proposed’adopter notre systématique. En principe donc, il ne doit pasy avoir de contestation à l’article 3.
Angenommen – Adopté
Art. 3bAntrag der KommissionStreichenProposition de la commissionBiffer
Inderkum Hansheiri (C, UR), Berichterstatter: Vor substan-tiell gelichteten Reihen möchte ich Sie im Rahmen der Bera-tung von Artikel 3b darauf hinweisen, dass wir bei der erstenLesung im Januar mit zwei Anträgen unserer Kollegen SeilerBernhard und Onken konfrontiert waren, die das Prinzip derVerantwortung, wenn auch in unterschiedlicher Ausprägung,zum Ausdruck bringen wollten. Diese Anträge wurden abge-lehnt, nicht weil man prinzipiell dagegen war, sondern weildie Sache offensichtlich für eine konkrete Formulierung nochnicht reif war. Wir wussten ja, dass die nationalrätliche Kom-mission dem Plenum des Nationalrates einen entsprechen-den Artikel beantragen würde, so dass gesichert war, dasswir im Rahmen der Differenzbereinigung darauf zurückkom-men könnten.Im Gefolge der Beratung haben wir dann aber auf Antrag un-seres Kollegen Danioth mit 23 zu 5 Stimmen einen Artikel32e mit dem Marginale «Bürgerpflichten» angenommen. DerNationalrat hat dann mit 50 zu 28 Stimmen Artikel 3b be-schlossen, den Sie auf der Fahne haben.Unsere Kommission beantragt Ihnen nun, Artikel 3b gemässFassung Nationalrat zu streichen, hingegen einen auf demArtikel des Nationalrates aufbauenden Artikel 5a aufzuneh-men, mit dem Wortlaut: «Neben der Verantwortung für sichselber trägt jede Person nach ihren Kräften zur Bewältigungder Aufgaben in Staat und Gesellschaft bei.»Ich beantrage Ihnen also, der Kommission zuzustimmen.
Angenommen – Adopté
Art. 5aAntrag der KommissionMehrheitTitelVerantwortungWortlautNeben der Verantwortung für sich selber trägt jede Personnach ihren Kräften zur Bewältigung der Aufgaben in Staatund Gesellschaft bei.Minderheit(Aeby)TitelIndividuelle und gesellschaftliche VerantwortungWortlautJede Person soll ihre Fähigkeiten nach ihren Neigungen ent-falten und entwickeln können, damit sie ihre persönliche Ver-antwortung gegenüber anderen und der Gesellschaft vollum-fänglich wahrnehmen kann.
Antrag Marty DickTitelVerantwortungWortlautJede Person nimmt Verantwortung für sich selber wahr undträgt nach ihren Kräften zur Bewältigung der Aufgaben inStaat und Gesellschaft bei.
Art. 5aProposition de la commissionMajoritéTitreResponsabilité
17. Juni 1998 S 153 Bundesverfassung. Reform
Amtliches Bulletin der Bundesversammlung / Separatdruck
TexteResponsable d’elle-même, toute personne contribue selonses forces à l’accomplissement des tâches de l’Etat et de lasociété.
Minorité(Aeby)TitreResponsabilité individuelle et socialeTexteToute personne doit pouvoir mettre en oeuvre ses capacitésselon ses aspirations de manière à assumer pleinement saresponsabilité personnelle envers autrui et la société.
Proposition Marty DickTitreResponsabilitéTexteChaque personne est responsable d’elle-même et contribue,dans la mesure de ses possibilités, à la vie publique et so-ciale.
Inderkum Hansheiri (C, UR), Berichterstatter: Zum Minder-heitsantrag Aeby zu Artikel 5a gestatte ich mir den Hinweis,dass es der Mehrheit darum ging, in erster Linie die Verant-wortung in den Vordergrund zu stellen, die Verantwortungnicht nur im Sinne der Selbstverantwortung, sondern auchdie Verantwortung gegenüber dem Staat und der Gesell-schaft. Herr Aeby spricht auch von der Verantwortung, wobeidie Verantwortung zur Voraussetzung hat, dass jede Personihre Fähigkeiten nach ihren Neigungen entfalten und entwik-keln kann. Uns ging es, wie gesagt, in erster Linie darum, dieVerantwortung in den Mittelpunkt zu stellen.Natürlich ist es so, dass Verantwortung insbesondere gegen-über Staat und Gesellschaft nur übernehmen kann, wer auchüber einen entsprechenden Freiraum verfügt; aber nach un-serer Auffassung kommt dieser Freiraum im Begriff derSelbstverantwortung zum Ausdruck.Ich beantrage Ihnen, dem Antrag der Mehrheit zuzustimmen.
Aeby Pierre (S, FR): D’un point de vue esthétique, vous mepermettrez de faire la remarque suivante: je considère que laproposition de minorité, c’est-à-dire la mienne en l’occur-rence, n’est pas si mal réussie, que c’est une phrase qu’oncomprend assez aisément et qui fait un pas dans le sens duConseil national. Je considère que l’article 5a, voté sansgrande conviction par la majorité de notre commission, n’estpas à même d’éliminer une divergence. Si on prend la peinede se référer au texte de l’article 3b du Conseil national, on ad’abord le titre: «Responsabilité individuelle et sociale». Cetarticle est visiblement le résultat d’un compromis droite/gau-che au Conseil national. On a vraisemblablement fait un pasdans le sens des sensibilités de gauche avec l’alinéa 1er eton a fait un pas en direction des gens plus libéraux qui insis-tent beaucoup plus sur la responsabilité individuelle, par tra-dition, par goût philosophique aussi, avec l’alinéa 2.La version de la majorité de notre commission ne tient pascompte de cette dualité. J’ai la prétention, en une phrase,d’avoir précisément tenu compte de ces deux sensibilités. Lapremière partie de ma phrase dit que chacun «doit pouvoirmettre en oeuvre ses capacités» et «selon ses aspirations» –reconnaissance individuelle de pouvoir s’épanouir dans lasociété – et, en contrepartie, grâce à cet épanouissementpersonnel, on assume pleinement une responsabilité person-nelle, aussi bien envers ses contemporains qu’envers la so-ciété, pris comme corps abstrait vivant sur un territoiredonné.Je vous invite donc à soutenir ma proposition de minorité,pas seulement parce qu’à mon avis elle est mieux rédigée,mais aussi parce qu’elle a vraiment un sens dans l’optiqued’une solution de compromis avec le Conseil national.
Die Beratung dieses Geschäftes wird unterbrochenLe débat sur cet objet est interrompu
Constitution fédérale. Réforme 154 E 18 juin 1998
Bulletin officiel de l’Assemblée fédérale / Tiré à part
Achte Sitzung – Huitième séance
Donnerstag, 18. Juni 1998Jeudi 18 juin 1998
08.00 h
Vorsitz – Présidence: Zimmerli Ulrich (V, BE)
__________________________________________________________
96.091
Bundesverfassung.ReformConstitution fédérale.Réforme
Fortsetzung – Suite
__________________________________________________________
A1. Bundesbeschluss über eine nachgeführte Bundesverfas-sung (Titel, Art. 1–126, 185) (Fortsetzung)A1. Arrêté fédéral relatif à une mise à jour de la Constitutionfédérale (titre, art. 1–126, 185) (suite)
Cavadini Jean (L, NE): C’est au titre de président de la sous-commission de rédaction de langue française que j’interviensici en propos liminaires. La commission a repris la questionde la formulation non sexiste du projet de mise à jour de laConstitution fédérale. Ce principe pose des problèmes beau-coup plus difficiles aux francophones et aux italophones qu’ànos collègues alémaniques. Mais chaque fois qu’on a pu,sans léser la langue française, donner une double formula-tion, nous l’avons fait. Nous nous sommes interdit par contretoute création ridicule ou provocatrice qui aurait été contraireà l’esprit de cette même langue.Les travaux que nous avons conduits font l’objet d’un brefrapport à l’intention des Conseils. Nous remarquons, avec unléger sourire d’ailleurs, que ce rapport risque de poser quel-ques problèmes de traduction en allemand, mais à ce mo-ment-là notre responsabilité sera dégagée!Disons que nous avons tourné certaines propositions lourdeset insupportables par la fonction qu’elles définissent. Ainsi,nous évitons de répéter, comme on le fait assez aisément enallemand, «le président ou la présidente de la Confédéra-tion», «le vice-président ou la vice-présidente du Conseil fé-déral» pour parler simplement de «la fonction», «la prési-dence» ou «la vice-présidence». Par contre, nous avonsgardé les notions du masculin générique pour quelques ter-mes – «les réfugiés», «les étrangers» – sans recourir à desartifices que la langue française ne supporte que très malai-sément.Par contre, et ce sera l’ultime satisfaction que nous pouvonsdonner à celles et à ceux qui tiennent beaucoup à cette ap-proche non sexiste de la constitution, nous proposerons uneconsidérable création dans le terme de «la chancelière»,même si aujourd’hui une chancelière est la femme d’un chan-celier ou un coussin dont on réchauffe ses pieds. Dieu recon-naîtra les siens et les siennes! (Hilarité)
Präsident: Wir nehmen Kenntnis von dieser Erklärung undwarten gespannt auf diesen Bericht.
Art. 5a (Fortsetzung) – Art. 5a (suite)
Marty Dick (R, TI): La discussion d’hier a été intéressante etM. Aeby a eu le mérite de soulever le problème. Cela nous a
permis de constater que la proposition de la majorité de lacommission présentait certaines faiblesses dans sa rédac-tion. La proposition que je vous présente est une tentatived’améliorer le concept et la rédaction. Il n’y a pas grand-chose de plus à dire, si ce n’est qu’il me semble que ce libelléest plus clair du point de vue rédactionnel, et donc pourraittrouver un consensus plus grand.
Inderkum Hansheiri (C, UR), Berichterstatter: Ich glaube,Herr Marty hat es gesagt: Sein Antrag enthält keine materiel-len Änderungen, aber doch eine redaktionelle Verbesserung,so dass ich namens der Kommission sagen kann: Wir könn-ten uns diesem Antrag anschliessen.
Aeby Pierre (S, FR): Je remercie M. Marty de sa contributionà ce débat, mais si nous acceptons sa proposition nous n’al-lons pas accepter la même chose en allemand et en français.Le texte original est peut-être du français, mais la traductionallemande ne reflète pas la même chose. On parle en alle-mand des devoirs de chaque personne dans l’Etat et dans lasociété; en français, on dit simplement qu’il s’agit de contri-buer dans la mesure du possible à la vie publique et sociale.Ce sont deux textes fondamentalement différents à mesyeux. On ne peut pas se prononcer sur ces deux proposi-tions, il s’agit en fait de deux versions différentes, l’une formu-lée en allemand et l’autre en français, qui n’ont pas du tout lamême signification.Je profite de rappeler ici les deux arguments fondamentauxde la proposition de minorité: c’est la mise en oeuvre des ca-pacités de chaque personne, qui ne doit pas être entravée,de manière à parvenir à un épanouissement qui permettealors seulement à la société de demander à chaque per-sonne d’assumer pleinement ses responsabilités personnelleet sociale.Dans le sens du compromis que nous cherchons avec leConseil national, je vous invite à soutenir la proposition deminorité.
Rhinow René (R, BL), Berichterstatter: In der Tat – HerrAeby hat recht – gibt es hier eine gewisse Differenz zwischender deutschen und der französischen Fassung des AntragesMarty Dick.Der Passus «trägt nach ihren Kräften zur Bewältigung derAufgaben in Staat und Gesellschaft bei» ist auf der Fahne imbisherigen Antrag der Kommission nicht gleich übersetztworden wie jetzt im Antrag Marty Dick. Ich gehe davon aus,dass der deutsche Text massgebend ist und die Übersetzungins Französische entsprechend angepasst werden müsste.Das ist jedenfalls meine Interpretation aufgrund des Werde-ganges dieser Bestimmung.
Marty Dick (R, TI): On peut discuter très longuement sur ceproblème de traduction. Je pense que les traductions littéra-les sont apparemment meilleures, mais souvent trompeuses.Il y a certains concepts qui ne peuvent pas être traduits litté-ralement. Je suis d’accord de dire que la version allemandeest la version de base. Je précise que la traduction en fran-çais a été effectuée par le Service de traduction. Donc, ce li-bellé n’est pas seulement le fruit de ma fantaisie. Je proposeque le soin de résoudre le problème soit laissé à la Commis-sion de rédaction.
Koller Arnold, Bundesrat: Es handelt sich hier um einen Arti-kel über die individuelle und gesellschaftliche Verantwortung,der in den Kommissionen und jetzt in den Räten in die nach-geführte Verfassung eingebracht worden ist. Der Bundesratist noch von der klassisch-liberalen Auffassung ausgegan-gen, wonach jedem Menschen als Person die menschlicheWürde zukommt, dass er als Subjekt handlungsfähig ist unddafür und auch für die Gesellschaft, also für die soziale Seiteseines Wesens, die Verantwortung übernehmen kann. DerBundesrat wehrt sich aber nicht gegen eine solche neue Be-stimmung, denn es ist jetzt offenbar auch in der Uno ein ge-wisser Trend festzustellen, dass man sich bemüht, der Allge-meinen Erklärung der Menschenrechte allenfalls eine Allge-
18. Juni 1998 S 155 Bundesverfassung. Reform
Amtliches Bulletin der Bundesversammlung / Separatdruck
meine Erklärung der Menschenpflichten gegenüberzustellen.Deshalb wehren wir uns nicht gegen eine solche Bestim-mung.Wir überlassen Ihnen auch die Auswahl der Formulierung,denn auch verfassungsrechtlich haben wir hier internationalwenig Erfahrung. Ich würde meinen, im Zweifel sei die kürze-ste Formulierung die beste.
Präsident: Die Kommissionsmehrheit zieht ihren Antrag zu-gunsten des Antrages Marty Dick zurück.
Abstimmung – VoteFür den Antrag Marty Dick 33 StimmenFür den Antrag der Minderheit 3 Stimmen
Art. 4 Abs. 3Antrag der KommissionFesthalten
Art. 4 al. 3Proposition de la commissionMaintenir
Inderkum Hansheiri (C, UR), Berichterstatter: Wir habennoch eine kleine Differenz in Artikel 4 Absatz 3. Ich kann michhier aber kurz fassen. Wir hatten nebst den staatlichen Orga-nen und Privaten noch die Behörden aufgenommen; dies ausder Überlegung heraus, dass zwar wohl alle staatlichen Or-gane Behörden, nicht aber umgekehrt alle Behörden staatli-che Organe sind. Der Begriff der staatlichen Organe ist imRahmen von Artikel 4, der ja die Rechtsstaatlichkeit derSchweizerischen Eidgenossenschaft zum Ausdruck bringensoll, zu eng.Wir beantragen daher Festhalten an den Beschlüssen unse-res Rates.
Angenommen – Adopté
2. TitelAntrag der KommissionFesthalten
Titre 2Proposition de la commissionMaintenir
Angenommen – Adopté
Art. 7 Abs. 2–4Antrag der KommissionAbs. 2.... der Rasse, des Geschlechts, des Alters, der Sprache ....Abs. 3FesthaltenAbs. 4Das Gesetz sieht Massnahmen zur Beseitigung bestehenderBenachteiligungen der Behinderten vor.
Art. 7 al. 2–4Proposition de la commissionAl. 2.... de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue ....Al. 3MaintenirAl. 4La loi prévoit des mesures en vue de l’élimination des inéga-lités existantes touchant les personnes handicapées.
Abs. 2 – Al. 2
Inderkum Hansheiri (C, UR), Berichterstatter: Wir kommenjetzt zu Artikel 7 – nicht gerade zu einem Schicksalsartikel,aber doch zu einer der wichtigsten Differenzen. Ich würde Ih-nen eine absatzweise Behandlung beliebt machen.In Absatz 2 hat unser Rat in der ersten Lesung nach einer
längeren Diskussion den Antrag Spoerry mit 29 zu 14 Stim-men zum Beschluss erhoben und auf eine exemplarischeAufführung von Diskriminierungskriterien verzichtet. Der Na-tionalrat hat sich grundsätzlich für den Entwurf des Bundes-rates ausgesprochen, also für eine Anreicherung des Diskri-minierungsgrundsatzes mit Beispielen. Er hat diese Diskrimi-nierungskriterien jedoch mit «Lebensform» und bei der Be-hinderung mit «psychische Behinderung» ergänzt.Unsere Kommission beantragt Ihnen nun, bei Absatz 2 aufdie Linie des Nationalrates einzuschwenken, jedoch bei denDiskriminierungskriterien nach dem Geschlecht zusätzlichnoch das Alter zu erwähnen.Es gilt in diesem Zusammenhang folgendes zu bedenken: Jemehr mögliche Diskriminierungskriterien bzw. mögliche dis-kriminierte Gruppen aufgeführt werden, desto mehr kann derAnschein erweckt werden, dass diejenigen diskriminiert wer-den könnten, die nicht erwähnt sind. Daher muss nach Auf-fassung der Kommission zumindest das Alter ebenfalls auf-geführt werden. Man mag zwar dagegen einwenden, dassdas Alter keinen Abgrenzungswert habe. Das gleiche liessesich aber auch für die Sprache und das Geschlecht sagen.Ich beantrage Ihnen, bei Absatz 2 dem Antrag der Kommis-sion zuzustimmen.
Koller Arnold, Bundesrat: Ich danke Ihrer Kommission hiersehr für das Einlenken gegenüber den Fassungen von Bun-desrat und Nationalrat. Denn natürlich kann man juristisch ar-gumentieren und sagen, diese nicht abschliessende Aufzäh-lung von Diskriminierungskriterien sei juristisch nicht ent-scheidend. Aber es wäre gegenüber der geltenden Verfas-sung doch eine Verarmung, wenn wir auf die heuteaktuellsten Kriterien der Diskriminierung verzichten würden.Denn Sie wissen, schon Artikel 4 der geltenden Bundesver-fassung hat die damals wichtigsten Diskriminierungskriterienaufgeführt, nämlich die Vorrechte des Ortes, der Geburt, derFamilie oder der Person. Jetzt müssen wir diese Beispieleaktualisieren.Ich bin auch damit einverstanden, dass man das Alter nochzusätzlich in diesen Katalog aufnimmt.
Angenommen – Adopté
Abs. 3 – Al. 3
Inderkum Hansheiri (C, UR), Berichterstatter: Bei Absatz 3geht es um die Lex specialis der Gleichberechtigung vonMann und Frau. Der Nationalrat beschloss, dass der Gesetz-geber nicht nur für die rechtliche, sondern auch für die «tat-sächliche Gleichstellung» zu sorgen habe. Wenn wir aber dietatsächliche Gleichstellung in die Verfassung aufnähmen,würde der Verfassungsgeber unseres Erachtens in unzu-lässiger Weise in die gesellschaftlichen Verhältnisse eingrei-fen.Wir beantragen Ihnen, beim Beschluss des Ständerates zubleiben.
Koller Arnold, Bundesrat: Ich stimme zu.
Angenommen – Adopté
Abs. 4 – Al. 4
Inderkum Hansheiri (C, UR), Berichterstatter: In Absatz 4hat der Nationalrat beschlossen, folgendes in die Verfassungaufzunehmen: «Das Gesetz sorgt für die Gleichstellung derBehinderten, es sieht Massnahmen zum Ausgleich oder zurBeseitigung bestehender Benachteiligungen vor.» Diese For-mulierung geht nach Auffassung der Kommission über dieNachführung hinaus. Zwar werden dadurch keine direktenAnsprüche und auch keine Drittwirkung verankert wie bei Ab-satz 3, der Gleichstellung zwischen Mann und Frau; es wirddem Gesetzgeber aber doch ein Auftrag erteilt, für die Gleich-stellung der Behinderten zu sorgen.Nach Auffassung der Kommission leidet die Fassung desNationalrates insofern an einem Konstruktionsfehler, als
Constitution fédérale. Réforme 156 E 18 juin 1998
Bulletin officiel de l’Assemblée fédérale / Tiré à part
eben nicht gesagt wird, was unter Gleichstellung der Behin-derten zu verstehen ist. Man wird nicht ernsthaft bestreitenkönnen, dass zwischen der Gleichstellung der Geschlechterund der Gleichstellung der Behinderten ein Unterschied be-steht. Zweifelsohne gehört es aber zu den Aufgaben desStaates, durch seine Gesetzgebung Massnahmen zur Besei-tigung bestehender Benachteiligungen der Behinderten vor-zusehen. In der Kommission hat sich daher – wenn auch re-lativ knapp – die Auffassung durchgesetzt, es bestehe einverfassungsrechtlicher Handlungsbedarf, in der Nähe derGrundrechte eine Bestimmung aufzunehmen, wonach sichder Gesetzgeber für die Anliegen der Behinderten einzuset-zen hat. Der Antrag der Kommission für einen Absatz 4, wo-nach das Gesetz «Massnahmen zur Beseitigung bestehen-der Benachteiligungen der Behinderten» vorsieht, ist verhält-nismässig und gibt wohl das wieder, was vernünftigerweiseals Rechtsetzungsauftrag in eine Verfassung kommen soll.Wir dürfen allerdings nicht verkennen, dass es sich hier umeine rechtspolitische Neuerung handelt, wobei aber die Kom-mission insgesamt – es liegt ja kein Minderheitsantrag vor –davon ausgeht, dass auf der Ebene, die wir Ihnen hier bean-tragen, ein Konsens bestehen dürfte.
Brändli Christoffel (V, GR): Die Gleichstellungsfrage nimmtheute bei den Behindertenorganisationen eine sehr zentraleStellung ein. Das Ziel ist dabei klar: Man möchte rasch Mass-nahmen zur Beseitigung von bestehenden Benachteiligun-gen durchsetzen. Ich muss Ihnen auch sagen, dass diese Or-ganisationen gegenwärtig eine Initiative vorbereiten, um die-sem Anliegen zum Durchbruch zu verhelfen. Ich meine, dassdie Fassung des Nationalrates oder auch die Fassung desStänderates durchaus eine gute Grundlage darstellt, um hiereine Lösung für diese gegensätzlichen Standpunkte zu fin-den, weil eben die Gleichstellung angestrebt wird. Vor allemaber wird angestrebt, dass man auf gesetzgeberischemWege Benachteiligungen beseitigt. Dabei geht es – dasmöchte ich deutlich festhalten – nicht darum, Unmögliches zuverlangen, sondern das zu tun, was mit vernünftigem Auf-wand getan werden könnte. Es gibt sehr viele Möglichkeiten;deshalb sollte man dies eben anstreben.Ob in der Fassung des Nationalrates oder des Ständerates –in der Differenzbereinigung lassen sich die kleinen Uneben-heiten noch ausbügeln –: Absatz 4 stellt meines Erachtensdurchaus eine Brücke dar, um diese gegensätzlichen Stand-punkte zusammenzuführen. Wenn es zu diesem Thema ei-nen «runden Tisch» geben würde, dann würde man auchetwa zu einer solchen Lösung kommen.Ich möchte aber doch deutlich sagen: Entscheidend ist nichtdieser Verfassungsartikel, sondern dass der Gesetzgeberdann auch handelt und die Problematik rasch angeht.
Koller Arnold, Bundesrat: Zunächst ist aus der Sicht desKonzeptes der Nachführung ganz klar, dass die Aufführungder körperlichen, geistigen oder psychischen Behinderungals eines der heute sehr aktuellen Diskriminierungsmerkmalein Absatz 2 reine Nachführung ist.Demgegenüber geht Absatz 4 sowohl in der Fassung desNationalrates wie in derjenigen des Ständerates ganz klarüber die Nachführung hinaus. Dieser Gesetzgebungsauftragist neu. Er ist aber ein wichtiges politisches Signal an die Be-hinderten jeder Art, und der Bundesrat geht daher – offenbarmit Ihnen – von der Meinung aus, dass es sich hier um einekonsensfähige Neuerung handelt.Nicht konsensfähig wären sicher Vorschläge gewesen, wiesie im Nationalrat vorgetragen wurden und wie sie jetzt zumTeil auch in einer parlamentarischen Initiative Suter (95.418)im Nationalrat weitergeführt werden, wonach die Gleichstel-lung der Behinderten durch ein direktes Klagerecht, alsodurch eine unmittelbare Drittwirkung dieses Anspruchs, rea-lisiert werden sollte. Denn nach Auffassung des Bundesrateswäre eine solche unmittelbare Drittwirkung, wo ein Behinder-ter gegen die öffentliche Hand, aber möglicherweise sogarauch gegen Private klagen könnte, beispielsweise auf einebehindertengerechte Ausstattung von Bauten, sicher ein fal-scher Weg. Denn damit wären die Richter natürlich total
überfordert. Es muss eine Aufgabe der Gesetzgebung blei-ben, die Gleichstellung der Behinderten mit den übrigen Bür-gerinnen und Bürgern auf den Stufen Bund und Kantone tat-sächlich voranzutreiben.Insofern steht es dieser nachgeführten Verfassung sicher gutan, wenn Sie hier eine derartige konsensfähige Neuerungeinführen. Ob es dann schlussendlich Ihre Fassung ist oderjene des Nationalrates, scheint mir nicht so entscheidend zusein.
Angenommen – Adopté
Art. 9 Abs. 3Antrag der KommissionKinder und Jugendliche haben Anspruch auf besonderenSchutz ihrer Unversehrtheit und Entwicklung.
Art. 9 al. 3Proposition de la commissionLes enfants et les adolescents ont droit à une protection par-ticulière quant à leur intégrité et leur développement.
Art. 11aAntrag der KommissionStreichen
Art. 11aProposition de la commissionBiffer
Inderkum Hansheiri (C, UR), Berichterstatter: Die Kommis-sion beantragt Ihnen bei Artikel 9 einen neuen Absatz 3, denSie auf der Fahne haben. Es besteht ein Konnex zu Arti-kel 11a, der vom Nationalrat beschlossen wurde. Das ist einseparater Artikel mit dem Marginale «Rechte der Kinder undJugendlichen».Wir befinden uns ja bekanntlich bei den Grundrechten, undes ist aus der Sicht der Kommission nicht einzusehen, wasein justitiabler, d. h. beim Richter durchsetzbarer Anspruch«auf eine harmonische Entwicklung» von Kindern und Ju-gendlichen bedeuten sollte. Das ist nach unserer Auffassungverfassungsmässig so nicht legiferierbar. Daher schlagen wirIhnen in Artikel 9 einen Absatz 3 vor: «Kinder und Jugendli-che haben Anspruch auf besonderen Schutz ihrer Unver-sehrtheit und Entwicklung.» Diese Bestimmung wäre an sichrein verfassungsrechtlich gesehen nicht notwendig, denn wirhaben ja Artikel 9 Absatz 2, der für jeden Menschen, alsoauch für die Kinder und Jugendlichen, das Recht auf persön-liche Freiheit, zu der insbesondere die körperliche und gei-stige Unversehrtheit gehören, verbrieft. Auch der besondereSchutz der Entwicklung verbrieft an sich keine zusätzlichenAnsprüche. Seine Bedeutung besteht lediglich – aber immer-hin – darin, dass der Gesetzgeber beim Erlass neuer Ge-setze auf die besonderen Schutzbedürfnisse der Kinder undJugendlichen Rücksicht zu nehmen hat. Im übrigen möchteich in diesem Zusammenhang einfach noch darauf hinwei-sen, dass die Kinder und Jugendlichen auch noch in anderenBestimmungen erwähnt sind. Sie sind zumindest indirekt beider Präambel erwähnt, indem es dort heisst, es sei auf diekünftigen Generationen Rücksicht zu nehmen; sie sind beiden Sozialzielen erwähnt, in Artikel 81 usw.Ich beantrage Ihnen, der Kommission zuzustimmen.
Koller Arnold, Bundesrat: Ich ersuche Sie, Artikel 9 Absatz 3zuzustimmen. Ich habe ja Artikel 11a im Nationalrat vehe-ment bekämpft, weil er in diesem Katalog der klagbarenGrundrechte einfach keinen Platz hat. Er passt auch nicht indie ganze Systematik der Grundrechte. Grundrechte stehengrundsätzlich allen Menschen zu und nicht nur einer beson-deren Kategorie, also den Kindern und den Jugendlichen.Deshalb bin ich froh, dass man jetzt diese Lösung über Arti-kel 9 Absatz 3 gefunden hat, denn jetzt handelt es sich ein-fach um eine Konkretisierung des Rechtes auf persönlicheFreiheit, und damit sind – wie der Berichterstatter auch im Zu-sammenhang mit den Sozialzielen ausgeführt hat; dort ha-
18. Juni 1998 S 157 Bundesverfassung. Reform
Amtliches Bulletin der Bundesversammlung / Separatdruck
ben wir ja zwei Literae der Jugendpolitik gewidmet – die be-gründeten Anliegen der Jugendverbände genügend in dienachgeführte Verfassung eingeflossen.
Angenommen – Adopté
Art. 12Antrag der KommissionFesthalten
Art. 12Proposition de la commissionMaintenir
Inderkum Hansheiri (C, UR), Berichterstatter: Bei Artikel 12haben wir seinerzeit dem Entwurf des Bundesrates zuge-stimmt. Der Nationalrat hat beschlossen, diesen Artikel im Ti-tel und im Text zu ändern: «Recht auf Ehe und Familie», unddementsprechend heisst es im Text nun «Das Recht auf Eheund Familie ist gewährleistet».Wir beantragen Ihnen, bei der Fassung, die von unserem Ratbeschlossen worden ist, zu bleiben, und zwar mit folgenderBegründung: Anders als in Artikel 11, wo die Privatsphäre ge-schützt wird, handelt es sich bei Artikel 12 um eine soge-nannte Institutsgarantie, des Inhaltes, dass der Staat die In-strumente zur Verfügung stellt, dass sich zwei nicht gleichge-schlechtliche Personen verheiraten können. Die Fassungdes Nationalrates könnte zu falschen Erwartungen und Aus-legungen führen. Es könnte nicht ausgeschlossen werden,dass auch unverheiratete Paare daraus ein Recht auf Familieableiten würden, einschliesslich des Rechtes auf eine Adop-tion. Der Schutz des Familienlebens und der freien Wahl derLebensform ist durch Artikel 11 abgedeckt. Das Recht aufEhe dagegen beschränkt sich auf das Institut der Ehe unddarauf, im Rahmen einer Ehe auch Kinder haben zu können.
Angenommen – Adopté
Art. 14a Abs. 3Antrag der KommissionZustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Art. 14a al. 3Proposition de la commissionAdhérer à la décision du Conseil national
Inderkum Hansheiri (C, UR), Berichterstatter: Wir haben sei-nerzeit die Formulierung «Der Gesetzgeber bestimmt denUmfang des Redaktionsgeheimnisses» beschlossen. DerNationalrat beschloss die Formulierung: «Das Redaktionsge-heimnis ist gewährleistet.»Wir können feststellen, dass der Nationalrat unserem Kon-zept insofern gefolgt ist, als er der Ausgestaltung der Medi-enfreiheit in einem separaten Artikel zugestimmt hat. Wie be-reits bei der ersten Lesung ausgeführt wurde, ist aufgrunddes Entscheides Goodwin des Europäischen Gerichtshofesfür Menschenrechte sowie der neuesten Praxis des Bundes-gerichtes davon auszugehen, dass das Redaktionsgeheim-nis grundsätzlich gewährleistet ist, dass aber der Gesetzge-ber dieses grundsätzlich gewährleistete Recht des Journali-sten bzw. der Journalistin auf Schutz seiner bzw. ihrer Infor-mationsquelle relativieren bzw. einschränken kann.Die Möglichkeit des Gesetzgebers, den GrundrechtenSchranken entgegenzustellen, besteht für alle Grundrechteganz allgemein; ich verweise in diesem Zusammenhang aufArtikel 32. Die Fassung des Ständerates könnte insofern zuMissverständnissen Anlass geben, als der Gesetzgeber hierbeim Redaktionsgeheimnis punktuell ermächtigt würde, die-ses Grundrecht gleichsam nach seinem Belieben zu gewähr-leisten, einzuschränken oder zu verweigern.Daher beantragt Ihnen die Kommission, hier dem Nationalratzuzustimmen.Ich möchte aber klar darauf hinweisen, dass das Redaktions-geheimnis kein Freipass ist, sondern vernünftigen Beschrän-kungen zugänglich sein muss, wie dies auch vom Europäi-
schen Gerichtshof für Menschenrechte anerkannt wordenist.
Koller Arnold, Bundesrat: Ich danke Ihrer Kommission er-neut für das Einlenken. Nach dem Entscheid Goodwin desEuropäischen Gerichtshofes für Menschenrechte und nachzwei neueren Entscheiden des Bundesgerichtes vom 4. No-vember 1997, die bisher nicht publiziert wurden, wäre esnicht angegangen, das Redaktionsgeheimnis einfach in dieDisposition des Gesetzgebers zu stellen. Im übrigen ist klar,dass auch das Redaktionsgeheimnis den allgemeinenSchranken von Artikel 32 unterliegt. Ich darf auch festhalten,dass diese verfassungsrechtliche Gestaltung auch mit demneuen Medienstrafrecht, das wir letztes Jahr erlassen haben,vollständig in Übereinstimmung steht.
Angenommen – Adopté
Art. 16Antrag der KommissionZustimmung zum Beschluss des NationalratesProposition de la commissionAdhérer à la décision du Conseil national
Angenommen – Adopté
Art. 16aAntrag der KommissionZustimmung zum Beschluss des Nationalrates(die Änderung betrifft nur den französischen Text)
Art. 16aProposition de la commissionTitreDroit à un enseignement de baseTexteLe droit à un enseignement de base suffisant ....
Inderkum Hansheiri (C, UR), Berichterstatter: Hier gibt esmateriell keine Differenzen, es gibt aber insofern eine Diffe-renz, als wir beantragen, bei Artikel 16a, beim Anspruch aufden Grundschulunterricht, dem Nationalrat zu folgen, unddas hat dann entsprechende Konsequenzen für die Reihen-folge der Artikel.Hierzu kurz einige Ausführungen: Wie bereits erwähnt, bean-tragen wir Ihnen, bei Artikel 16a dem Nationalrat zuzustim-men. Ich darf darauf hinweisen, dass der Verfassungsent-wurf des Bundesrates die Pflicht der Kantone, für ausrei-chenden Grundschulunterricht zu sorgen, in Artikel 78 veran-kert hat. Wir haben dann beschlossen, diese Pflicht beiArtikel 57a aufzunehmen, und wir beantragen Ihnen nun,dem Nationalrat zu folgen. Es macht nach unserer MeinungSinn, den Anspruch auf Grundschulunterricht bei den Grund-rechten unterzubringen. Grundschulunterricht ist gleichbe-deutend mit obligatorischer Schulzeit, und was als ausrei-chender obligatorischer Grundschulunterricht gilt, wird dem-zufolge durch die Kantone festgelegt.
Koller Arnold, Bundesrat: Der Bundesrat ist einverstanden,dass der Anspruch auf ausreichenden und unentgeltlichenGrundschulunterricht als eines der wenigen klagbaren So-zialrechte hier aufgenommen wird. Es ist in Lehre und Recht-sprechung anerkannt, dass der Anspruch auf unentgeltli-chen, ausreichenden Grundschulunterricht ein direkt einklag-bares Sozialrecht darstellt.Ich möchte noch einmal darauf hinweisen, dass sich aus die-sem Recht kein Anspruch ableiten lässt, eine Privatschuleunentgeltlich zu besuchen. Dies ist nur in jenen seltenen Fäl-len möglich, in denen eine Gemeinde beschliesst, keine öf-fentliche Schule zu führen und diese Aufgabe einer Privat-schule zu übertragen.
Angenommen – Adopté
Constitution fédérale. Réforme 158 E 18 juin 1998
Bulletin officiel de l’Assemblée fédérale / Tiré à part
Art. 17aAntrag der KommissionZustimmung zum Beschluss des NationalratesProposition de la commissionAdhérer à la décision du Conseil national
Inderkum Hansheiri (C, UR), Berichterstatter: Bei Artikel 17ahaben wir, wie ich bereits erwähnt habe, keine Änderungen.Diese Neunumerierung ergibt sich, weil wir Artikel 16 gestri-chen haben. Aber materiell bleiben wir bei der ursprünglichenFassung: «Die Freiheit der Kunst ist gewährleistet.»
Angenommen – Adopté
Art. 18 Abs. 3Antrag der KommissionFesthalten
Art. 18 al. 3Proposition de la commissionMaintenir
Inderkum Hansheiri (C, UR), Berichterstatter: Bei Artikel 18haben wir eine Differenz bei Absatz 3. Wir haben seinerzeitdem Bundesrat zugestimmt; der Nationalrat hat Absatz 3 ge-strichen.Worum geht es hier? Es geht um die Möglichkeit, Versamm-lungen und Kundgebungen auf öffentlichem Grund von einerBewilligung abhängig zu machen. Nun gibt es zwei Betrach-tungsweisen: Die sogenannte Sachenrechtstheorie geht da-von aus, dass eine Bewilligungspflicht aufgrund der Hoheitdes Gemeinwesens über den öffentlichen Grund und Bodenauch ohne ausdrückliche gesetzliche Grundlage eingeführtwerden kann. Demgegenüber muss nach der Grundrechts-theorie die Bewilligungspflicht auf einer gesetzlichen Grund-lage beruhen. Das Bundesgericht tendiert nun offenbar inseiner neueren Rechtsprechung dazu, von seiner bisherigenPraxis – eben von der sogenannten Fiskustheorie oder Sa-chenrechtstheorie – zugunsten der Grundrechtstheorie abzu-weichen. Aufgrund dieser Tendenz in der Praxis des Bundes-gerichtes und aufgrund der Lehre hat der Nationalrat be-schlossen, Absatz 3 zu streichen.Unsere Kommission beantragt Ihnen, am Beschluss desStänderates festzuhalten. Wir würden mit einer Streichungeher Unsicherheit denn Klarheit schaffen. Insbesonderesollte durch eine Streichung von Absatz 3 nicht der Eindruckerweckt werden, es würde am Status quo etwas geändert.
Koller Arnold, Bundesrat: Nachdem das Bundesgerichtseine Praxis noch nicht geändert hat, sondern eher erste Zei-chen ausgesendet hat, es überlege sich eine Praxisände-rung, stehen Sie als Verfassunggeber natürlich über demBundesgericht. Wir haben ja selber auch diese Fassung vor-geschlagen, und deshalb gibt es keinen zwingenden Grund,Absatz 3 zu streichen.
Angenommen – Adopté
Art. 22 Abs. 2Antrag der KommissionFesthalten
Art. 22 al. 2Proposition de la commissionMaintenir
Marty Dick (R, TI), rapporteur: Cet article traite de la garantiede la propriété. L’article 22 du projet du Conseil fédéral re-prend en fait les principes constitutionnels actuellement envigueur pour ce qui concerne la garantie de la propriété,c’est-à-dire que la propriété est garantie; une pleine indem-nité est due en cas d’expropriation; et dans le cas d’une res-triction qui restreint de telle façon l’usage et la jouissance dela propriété qu’elle correspond à une expropriation maté-rielle, dans ce cas aussi, une indemnité est due.
Le Conseil national, d’une façon, je dirais, surprenante et inat-tendue, a complété cet article 22 en disant que «les autresrestrictions à la propriété donnent lieu – aussi – à une com-pensation appropriée». Cette proposition est certainement in-téressante, mais va bien au-delà de ce qu’est une mise à jouret constitue un changement très important par rapport à ce quise passe actuellement. Actuellement, nous avons donc leprincipe de la pleine indemnité en cas d’expropriation. Maispour les autres restrictions, il n’y a pas d’indemnité. Ce prin-cipe du tout ou rien est en fait adouci par l’article 5 de la loisur l’aménagement du territoire, qui permet aux cantons deprévoir des solutions plus flexibles et des compensations se-lon l’intensité de la restriction de la propriété. Mais si nous sui-vons la décision du Conseil national, nous changeons com-plètement le système actuel. Cela pourrait avoir des consé-quences financières qui sont difficilement calculables maisqui seraient très importantes, et l’on risquerait surtout de blo-quer tout un travail d’aménagement du territoire.Bref, la décision du Conseil national va bien au-delà de lamise à jour de la constitution.Votre commission vous recommande, à l’unanimité, de main-tenir la décision de notre Conseil.
Koller Arnold, Bundesrat: Ich habe im Namen des Bundes-rates den Nachsatz bei der Eigentumsgarantie – «Für andereEigentumsbeschränkungen ist ein angemessener Ausgleichvorzunehmen» – schon im Nationalrat bekämpft, dort aller-dings ohne Erfolg. Ich möchte hier nicht verlängern und aufdie Begründung dort verweisen. Es handelt sich ganz klar umeine rechtspolitische Neuerung, zudem in einem sehr sensi-blen verfassungsrechtlichen Bereich.Ich bin Ihnen daher dankbar, wenn Sie an Ihrer Fassung unddamit an der Fassung des Bundesrates festhalten.
Angenommen – Adopté
Art. 24 Abs. 3, 4Antrag der KommissionMehrheitAbs. 3Streik und Aussperrung sind nur zulässig, wenn sie Arbeits-beziehungen betreffen, verhältnismässig sind, von Arbeit-nehmer- oder Arbeitgeberorganisationen getragen werdenund wenn keine Verpflichtungen entgegenstehen, den Ar-beitsfrieden zu wahren oder Schlichtungsverhandlungen zuführen.Abs. 4Das Gesetz kann bestimmten Kategorien von Personen denStreik verbieten.
Minderheit I(Aeby, Gentil)Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Minderheit II(Reimann, Cavadini Jean, Cottier, Leumann, Spoerry)Festhalten
Minderheit III(Marty Dick, Inderkum)Abs. 3Streik und Aussperrung sind nur zulässig, wenn sie Arbeits-beziehungen betreffen und keine Verpflichtungen entgegen-stehen, den Arbeitsfrieden zu wahren oder Schlichtungsver-handlungen zu führen.Abs. 4Das Gesetz kann bestimmten Kategorien von Personen denStreik verbieten.
Antrag InderkumAbs. 3Streik und Aussperrung sind zulässig, wenn sie Arbeitsbezie-hungen betreffen, verhältnismässig sind und keine Verpflich-tungen entgegenstehen, den Arbeitsfrieden zu wahren oderSchlichtungsverhandlungen zu führen.
18. Juni 1998 S 159 Bundesverfassung. Reform
Amtliches Bulletin der Bundesversammlung / Separatdruck
Abs. 4Das Gesetz kann bestimmten Kategorien von Personen denStreik verbieten.
Art. 24 al. 3, 4Proposition de la commissionMajoritéAl. 3La grève et le lock-out ne sont licites que s’ils se rapportentaux relations de travail, qu’ils sont adaptés aux circonstan-ces, qu’ils sont soutenus par des organisations d’employeursou de travailleurs et que s’ils sont conformes aux obligationsde préserver la paix du travail ou de recourir à une concilia-tion.Al. 4La loi peut interdire le recours à la grève à certaines catégo-ries de personnes.Minorité I(Aeby, Gentil)Adhérer à la décision du Conseil national
Minorité II(Reimann, Cavadini Jean, Cottier, Leumann, Spoerry)Maintenir
Minorité III(Marty Dick, Inderkum)Al. 3La grève et le lock-out ne sont licites que s’ils se rapportentaux relations de travail et que s’ils sont conformes aux obli-gations de préserver la paix du travail ou de recourir à uneconciliation.Al. 4La loi peut interdire le recours à la grève à certaines catégo-ries de personnes.
Proposition InderkumAl. 3La grève et le lock-out sont licites quand ils se rapportent auxrelations de travail, ils sont adaptés aux circonstances et con-formes aux obligations de préserver la paix du travail ou derecourir à une conciliation.Al. 4La loi peut interdire le recours à la grève à certaines catégo-ries de personnes.
Rhinow René (R, BL), Berichterstatter: Die Kommission hatnach dem Beschluss des Nationalrates und unserem Be-schluss aus der ersten Runde, auf die Aufnahme von Streikund Aussperrung zu verzichten, eine ausführliche Diskussiongeführt. Wir haben, gestützt auf Anträge aus unserer Mitte,diesen Passus, der schon das letzte Mal als Minderheitsan-trag vorlag (Minderheit Marty Dick), ergänzt, und zwar ge-stützt auf die Lehre und auf die heutige Rechtsprechung. Zu-sätzlich sind nämlich das Kriterium der Verhältnismässigkeitund das Kriterium, dass Streik und Aussperrung von Arbeit-nehmer- oder Arbeitgeberorganisationen getragen werdenmüssen, eingefügt worden. Es handelt sich also bei der Fas-sung der Mehrheit um eine ergänzte Version der Fassung derMinderheit III, die bereits in der ersten Beratung unseres Ra-tes eine Minderheit war. Wir meinen, dass wir in der Mehr-heitsfassung damit die geltende Rechtslage korrekt zumAusdruck gebracht haben.Nun kann man über Einzelheiten diskutieren. Man kann bei-spielsweise einwenden, der Begriff «Arbeitgeberorga-nisation» sei nicht hundertprozentig korrekt, man kann sa-gen, eigentlich handle es sich um tariffähige Organisationen– jedenfalls auf Arbeitnehmerseite –, aber im geltendenRecht werden diese Voraussetzungen grundsätzlich aner-kannt.Ich möchte Sie deshalb bitten, im Sinne des Kompromisses –also Verzicht auf die ausdrückliche Verankerung der Formu-lierung «Recht auf ....», Erwähnung des geltenden Rechtesbei den Schranken – der Mehrheit zu folgen.
Brunner Christiane (S, GE): Je m’exprime au nom de la mi-norité I (Aeby). Je suis soulagée que la majorité de la com-mission de notre Conseil soit revenue sur la mauvaise déci-sion que nous avions prise lors de notre première délibéra-tion sur cet article. Je ne veux pas développer encore unefois l’importance que revêt l’ancrage du droit de grève dansla constitution pour les organisations de travailleuses et detravailleurs et pour les travailleuses et les travailleurs eux-mêmes.Toutefois, je ne peux pas me rallier à la proposition de la ma-jorité de notre commission.La majorité a apporté deux amendements au texte proposépar le Conseil fédéral et adopté par le Conseil national. D’unepart, la version de la majorité ne fait plus état d’un droit degrève et d’un droit de lock-out, mais elle se contente de sti-puler les conditions qui doivent être remplies pour que lagrève et le lock-out soient licites. C’est une manière de nepas prendre position sur la question controversée de savoirsi le droit de grève représente effectivement un droit collectifou non.Personnellement, j’estime qu’il s’agit là d’une argutie qui nechange strictement rien au fond de la question. Car, si lagrève et le lock-out sont licites, nécessairement ils consti-tuent bel et bien un droit. Je trouverais donc plus honnête etplus simple de le déclarer ainsi, plutôt que de recourir à cegenre de circonlocution qu’on utilise de peur d’appeler unchat un chat. Qui plus est, cette formulation négative «Lagrève et le lock-out ne sont licites que ....» détonne dans cechapitre 1er entièrement dédié aux droits fondamentaux. Laversion du Conseil fédéral – que je défends depuis le début –est meilleure parce qu’elle reste dans la logique des libertéset des droits fondamentaux de cette série d’articles et qu’elleexprime clairement la notion de droit collectif.La majorité de la commission propose ensuite d’ajouter desconditions supplémentaires pour que la grève et le lock-outsoient licites, à savoir qu’ils soient adaptés aux circonstanceset qu’ils soient soutenus par des organisations d’employeursou de travailleurs. Je suis un peu étonnée des craintes quisemblent habiter la majorité de la commission. Nous avonsen Suisse une tradition et une culture de négociations entrepartenaires sociaux et aussi une culture de modération dansles conflits qui fait que la grève est utilisée uniquement endernier ressort, lorsque tous les autres moyens ont échoué.Ce ne sont pas les arguties juridiques d’un article constitu-tionnel qui décideront les travailleuses et les travailleurs à dé-clencher une grève ou à y renoncer. Les éléments décisifsresteront toujours les situations auxquelles les gens sont con-frontés dans le monde du travail, et notamment aussi la pré-sence ou l’absence d’un dialogue entre partenaires sociaux.Je ne pense pas que la constitution soit le bon endroit pourrégler toutes les questions de détail concernant les limitesposées au droit de grève, surtout une constitution mise à jourque l’on voulait par ailleurs aussi lisible que possible.Quel décalage par exemple entre cet article sur la liberté syn-dicale, auquel on se croit obligé d’ajouter un garde-fou aprèsl’autre, et la simplicité lapidaire de l’article sur la liberté éco-nomique!Les limites au droit de grève sont posées, d’une part, dansl’article 32 de la constitution, comme pour les autres droitsfondamentaux, d’autre part, dans les dispositions du droitcollectif du travail et dans les lois sur le statut des fonction-naires. Les conditions posées dans la version du Conseil fé-déral, adoptées par le Conseil national, constituent des limi-tes spécifiques qui méritent, elles, d’être réglées dans notreloi fondamentale. Les conditions ajoutées par la commissionsont superfétatoires et inutilement limitatives. Il n’est pas di-gne de notre constitution de comprendre par exemple uneclause aussi vague et aussi peu claire que celle qui prévoitqu’une grève doit être «adaptée aux circonstances».Si une grève éclate, c’est qu’il y a un conflit avec évidemmentdeux opinions divergentes, celle des employeurs estimantqu’il est légitime d’imposer leur diktat et celle des travailleu-ses et des travailleurs concernés qui estiment légitime de re-courir à des moyens de lutte pour s’opposer à la pression pa-tronale.
Constitution fédérale. Réforme 160 E 18 juin 1998
Bulletin officiel de l’Assemblée fédérale / Tiré à part
Et pour parler de l’actualité: dans le cadre des négociationsde la convention collective de l’industrie des machines, lesemployeurs veulent imposer une durée annuelle du temps detravail et une flexibilité totale. Mais ils refusent de discuter encontrepartie d’une réduction suffisante de la durée annuelledu travail. Si, dans cette situation de conflit, mon syndicat ap-pelait les travailleuses et les travailleurs à utiliser des moyenscollectifs de lutte, cette mesure serait-elle «adaptée aux cir-constances» ou non? Du point de vue des travailleuses etdes travailleurs concernés, certainement. Du point de vuedes patrons, probablement pas.Quant à la deuxième condition introduite, que la grève et lelock-out doivent être soutenus par les organisations d’em-ployeurs et de travailleurs, laissez-moi vous dire qu’elle estparticulièrement absurde. Apparemment, on a voulu instituerune symétrie, une égalité de traitement entre employeurs ettravailleurs, comme si d’ailleurs les deux groupes se bat-taient à armes égales.Il est tout à fait logique et pas contesté qu’une grève doit êtresoutenue par une organisation de travailleuses et de tra-vailleurs, car il faut pouvoir négocier au nom des personnesen grève et, bien sûr, mettre fin à une grève.Mais on sombre dans le ridicule lorsqu’on stipule que le lock-out doit être soutenu par une organisation d’employeurs. Lelock-out, c’est-à-dire la fermeture de la porte d’une entrepriseaux travailleuses et aux travailleurs, est un instrument de ri-poste. Il sert d’ailleurs à briser une grève ou un mouvementde protestation. En ce sens-là, ce n’est évidemment pas uninstrument qui doit être soutenu par une organisation d’em-ployeurs. Il n’est d’ailleurs jamais utilisé en Suisse depuis desdécennies, mais il pourrait l’être individuellement par chaqueentreprise.Ce sont là les raisons qui m’amènent à vous inviter à soutenirfermement la proposition de minorité I – donc le projet duConseil fédéral –, car elle est la seule qui nous donne à la foisl’affirmation d’un droit et qui pose, à nos yeux, des limites quisont justes. Il n’y a aucune raison de s’éloigner du projet duConseil fédéral en la matière.Je vous invite à soutenir la proposition de minorité I.
Reimann Maximilian (V, AG): Ich bitte Sie namens einer star-ken Minderheit II, in welcher Mitglieder aller bürgerlichenFraktionen vertreten sind, an unserem ursprünglichen Be-schluss festzuhalten. Dieser Entscheid ist seinerzeit mit ei-nem recht deutlichen Mehr von 24 zu 16 Stimmen zustandegekommen und besagt, das Streikrecht gehöre nicht in un-sere Verfassung hinein. Das Streikrecht und die Aussperrungwaren bis heute kein geschriebenes Verfassungsrecht; dassteht ausser Zweifel. Es ist aber auch umstritten – um nichtzu sagen: höchst umstritten –, ob dem Streikrecht wirklich un-geschriebener Verfassungscharakter zukommt.Da wir in der Nachführungsphase stehen und die Vorlage imBlick auf die Volksabstimmung nicht mit unnötigen Hürdengefährden sollten, ist es wohl die weiseste Lösung, auf unse-rer ursprünglichen Linie zu verbleiben und den Streik nicht imZug dieser Verfassungsreform auf Verfassungsstufe zu re-geln. Es bleibt den Anhängern einer verfassungsmässigenRegelung des Streikrechts aber unbenommen, ihr Ziel imRahmen einer Partialrevision oder in Form einer Variante an-zuvisieren. Wir beschreiten in analogen Fällen ja ähnlicheWege; ich denke an die Kantonsklausel bei der Bundesrats-wahl oder auch an den Bistumsartikel.Grundsätzlich meinen wir also, man sollte es beim Ist-Zu-stand belassen und den Streik nicht verfassungsmässig auf-werten. Die abschreckenden Streikbeispiele in unserenNachbarländern mit Rückwirkungen auch auf die Schweizsprechen doch für sich: Der Pilotenstreik der Air France imVorfeld der Fussball-WM – um nur ein einziges Beispiel auf-zugreifen – wäre im Sinne der Kommissionsmehrheit völligverfassungskonform. Wollen wir das? Wollen Sie solche ver-fassungsmässig garantierten Zustände wirklich auch beiuns? Soviel zur materiellen Seite.Abschliessend aber auch noch eine Bemerkung zum politi-schen Werdegang dieser Materie bzw. zur Frage, wie die
bürgerliche Mehrheit in unserem Land einmal mehr aus denAngeln gehoben werden soll: Gegen den ursprünglichen Be-schluss des Ständerates – er kam mit 24 zu 16 Stimmen zu-stande, ich wiederhole es – haben Linke und Gewerkschaf-ten sofort mit der Drohung aufgewartet, gegen die ganze Vor-lage die Neinparole zu beschliessen, falls der Ständerat nichtzurückkrebse. Wie reagiert man bürgerlicherseits? Man gibtnach und kommt den Forderungen von links auf halbemWege entgegen.So geschehen auch hier: Die Anträge der Mehrheit, der Min-derheit III und nun auch der Einzelantrag Inderkum sind dochlebendiges Zeugnis für dieses Prozedere. Dass die KollegenAeby und Gentil – soeben eloquent vertreten durch KolleginBrunner Christiane – an der Maximalforderung von Bundes-rat und Nationalrat festhalten, versteht sich von selbst. Abermit Nachführung hat diese «Vollvariante» nichts mehr ge-meinsam, und sie würde sich in der Volksabstimmung mitgrösster Wahrscheinlichkeit auch als unbezwingbare Hürdeerweisen.Ich bitte Sie also: Halten Sie an unserer ursprünglichen Ver-sion fest! Sie entspricht dem Ist-Zustand und erfüllt das Ge-bot der Nachführung am besten. Wünsche und Forderungen,die weiter gehen, sind sicher diskussionswürdig; sie mögenaber in Form einer Variante oder auf dem Weg einer Partial-revision weiterverfolgt und somit dem Souverän gesondertzur Stellungnahme unterbreitet werden.
Marty Dick (R, TI): La proposition de minorité III exprime lavolonté de trouver une solution de conciliation.Il n’est pas pensable de ne rien dire dans la constitution quantau droit de grève: ce droit existe, c’est un droit constitutionnelnon écrit. Dans la mesure où vous ne dites rien, comme levoudrait la minorité II, vous laissez une liberté complète auTribunal fédéral. Je crois que c’est même une provocation dene rien dire, alors que les restructurations, on l’a déjà dit, fontque des milliers de personnes perdent leur travail. Décider enplus aujourd’hui que le droit de grève, constitutionnellement,ce n’est pas un sujet de discussion est une provocation in-utile.C’est aussi tout à fait faux, je dirais même ridicule, de penserque, si nous avons eu tellement peu de grèves dans notrepays jusqu’à présent, c’est parce que ce droit n’était pas ins-crit dans la constitution. Il est de même faux et ridicule depenser que, dès lors qu’on règlemente ce droit dans la cons-titution, il y aura plus de grèves dans notre pays. Non, c’estsimplement regarder la réalité en face, et la proposition deminorité III essaye d’être une proposition de conciliation entreceux qui ne veulent rien du tout et ceux qui veulent en revenirau projet du Conseil fédéral.M. Inderkum, qui fait partie de la minorité III, nous soumetmaintenant une nouvelle proposition qui améliore celle de laminorité III. Je me rallie par conséquent à la propositionInderkum.
Inderkum Hansheiri (C, UR): Ich danke Herrn Kollege Marty,dass er sich meinem Antrag anschliesst. Wir dürfen wohlohne Übertreibung feststellen, dass wir es bei diesem Artikel24 nun wirklich mit einem der Schicksalsartikel zu tun haben.Wenn wir die Position des Nationalrates betrachten und denAntrag der Minderheit II, soeben vorgetragen von KollegeReimann, so müssen wir doch feststellen, dass wir weit aus-einander sind. Wir müssen in dieser Frage zu einem Konsensfinden – nicht zu einem billigen Kompromiss, Herr KollegeReimann, sondern wirklich zu einem Konsens, zu dem wirstehen können. Der modifizierte Antrag der Minderheit III istvon diesem ehrlichen Willen getragen, zu einem verantwor-tungsvollen Konsens zu kommen. Die rechtlichen Argumentesind auf dem Tisch, sie sind uns immer wieder überzeugenddargelegt worden. Es ist nun einmal so, dass der Streik, obwir es wollen oder nicht, zum Ordre public des Arbeitsver-tragsrechtes gehört. Wie gesagt, wir sollten uns jetzt in dieserFrage – ich meine: möglichst schnell – einigen können. Viel-leicht könnte dieser modifizierte Antrag hierzu einen Beitragleisten.
18. Juni 1998 S 161 Bundesverfassung. Reform
Amtliches Bulletin der Bundesversammlung / Separatdruck
Forster Erika (R, SG): In der Januarsession 1998 gehörte ichzu denjenigen, welche die Verankerung des Streikrechtes inder Verfassung im Sinne eines Grundrechtes abgelehnt ha-ben. Ich war und bin im Grunde genommen auch heute nochder Auffassung, dass mit der Streichung der Absätze 3 und 4dem Nachführungsauftrag am besten Nachachtung ver-schafft würde, denn am Ist-Zustand würde sich nichts än-dern. Streik und Aussperrung würden bei einer Weglassungkeineswegs verboten. Es würde sich, wie Kollege Rhinowhier in der Januarsession ausführte, nicht um ein qualifizier-tes Schweigen handeln, und es würde keinesfalls bedeuten,dass wir hinter die geltende Ordnung zurücktreten möchten.Nur würde der Rechtsprechung Gelegenheit gegeben, an-hand konkreter, strittiger Fälle das zu regeln, was heute um-stritten ist.Wenn sich indessen im Nationalrat und nun auch in unsererKommission die Auffassung abzeichnet, dass mit der Strei-chung der Absätze 3 und 4 ein noch unglücklicheres Signalgesetzt würde als mit der ausdrücklichen Erwähnung vonStreik und Aussperrung in der Verfassung, so finde ich, dassman wenigstens versuchen sollte:1. der gegenwärtigen Rechtswirklichkeit so nahe als möglichzu kommen;2. diese so präzise wie möglich auszudrücken;3. einen nachfolgenden Gesetzgebungsprozess über dasStreikrecht unnötig werden zu lassen.Wenn man in diesem Sinn einen Kompromiss sucht, welcherfür alle Seiten annehmbar ist – das, Kollege Reimann, hat miteinem Kniefall der bürgerlichen Mitglieder der Kommissionnichts zu tun –, so hat sich die Formulierung in der Verfas-sung an unbestrittene Grundsätze zu halten, welche die heu-tige Situation wiedergeben. Das ist der Kommissionsmehr-heit mit dem vorliegenden Antrag gelungen. Er enthält fol-gende vier Elemente, welche bereits in der heutigen Rechts-wirklichkeit gelebt werden:1. Der Streik und dessen Gegenstück, die Aussperrung, sinddie Ultima ratio, also die Ausnahme und damit nicht einGrundrecht im positiven Sinn. Deshalb ist die Nur-Formulie-rung wichtig. Natürlich, Kollege Inderkum, könnte man das«nur» im Text auch weglassen, ohne dass als Folge dieserAuslassung materiell etwas geändert würde, so wie Sie dasin Ihrem Antrag tun. Das «nur» hat aber eine psychologischeBedeutung, und deshalb möchte ich mit der Mehrheit daranfesthalten.2. Streik und Aussperrung müssen Arbeitsbeziehungen be-treffen. Ein politischer Streik ist demnach nicht zulässig.3. Ein Streik muss von Arbeitnehmer- und Arbeitgeberorga-nisationen getragen werden. Dies bedeutet, dass normaler-weise eine gesamtarbeitsvertragliche Regelung Vorausset-zung für einen Streik ist. Für die Einhaltung der vertraglichenVerpflichtungen sowie Ausrufung und Durchführung einesStreiks auf demokratischer Basis müssen tariffähige Organi-sationen – Arbeitgeber oder deren Organisationen einerseitsund eine oder mehrere Arbeitnehmerorganisationen anderer-seits – garantieren.Der Begriff «Arbeitnehmerorganisation» ist weit gefasst zuverstehen. Das kann auch eine Betriebskommission sein. Ar-beitgeber- und Arbeitnehmerorganisationen braucht es inder Regel aber auch, um ein Ende des Arbeitskampfes her-beizuführen, indem professionell verhandelt wird. Wir ma-chen somit mit der Formulierung der Kommissionsmehrheitdeutlich, dass wir wilde Streiks nicht dulden wollen. Sie ge-hören nicht zur heutigen Rechtswirklichkeit in dem Sinn,dass sie legal wären. Wir möchten hier keine Missverständ-nisse aufkommen lassen. In diesem Sinne kommt auch derSozialpartnerschaft die ihr gebührende Beachtung zu. DieseRegelung ist vor allem auch für die kleinen und mittleren Un-ternehmungen wichtig, wo oft keine gesamtarbeitsvertragli-chen Regelungen und nicht einmal Arbeitnehmervertretun-gen bestehen, oder für Fälle, in denen ein Streikbeschlussnicht im Rahmen eines demokratischen Prozesses zustandekommt oder fremdgelenkt ist, wie etwa im Fall Gasser be-hauptet wurde. Die Befürchtung in KMU-Kreisen, dass mitder ausdrücklichen Erwähnung der Arbeitnehmerorganisa-tionen den Gewerkschaften in die Hände gearbeitet würde,
kann ich nicht teilen, ist doch eine Arbeitnehmerorganisationnicht in jedem Fall eine grössere oder kleinere, überbetrieb-lich wirkende Gewerkschaftsorganisation. Es kann – wie er-wähnt – auch eine Betriebskommission sein. Hingegen gingedie Anerkennung von De-facto-Gemeinschaften von Arbeit-nehmern und Ad-hoc-Koalitionen ausserhalb des gewerk-schaftlichen Rahmens eindeutig über den heutigen Standder Lehre hinaus. Die Erwähnung der Arbeitnehmerorgani-sationen ist also deshalb wichtig, weil sich sonst ein weitesFeld von Interpretationen über die Zulässigkeit von Streiksauftun würde.Aus Gründen der Klarheit hätte mir persönlich der Begriff «ta-riffähige Organisationen» im Verfassungstext besser gefallenals die jetzt vorliegende Formulierung. Denn erstens ist jederArbeitnehmer tariffähig, braucht also nicht Mitglied einer Ar-beitnehmerorganisation zu sein, und zweitens ist in der Lehreund Praxis der Begriff der tariffähigen Arbeitnehmerorganisa-tionen ausreichend geklärt. Ich kann aber mit der Formulie-rung der Mehrheit leben.Der vierte und letzte Punkt betrifft die Anforderung der Ver-hältnismässigkeit: Es ist dies ebenfalls ein Stichwort, dasHerr Bundesrat Koller in seinem Votum am Schluss der na-tionalrätlichen Debatte – nach heutiger bundesgerichtlicherPraxis – als Voraussetzung für einen Streik erwähnt hat. DasErfordernis der Verhältnismässigkeit schliesst die Wesent-lichkeit von Differenzen sowie – nach meiner Auffassung –ein demokratisches Zustandekommen eines Streikbeschlus-ses ein. Zum Streik soll also nicht wegen eines momentanenÄrgers als Ultima ratio gegriffen werden können. Kollege In-derkum hat die Verhältnismässigkeit ja in seinem eben ein-gereichten Antrag mit eingeschlossen. Das zeigt, dass dieseanscheinend eine Mehrheit findet.Mit diesen präzisen Formulierungen kann ich mit der Erwäh-nung von Streik und Aussperrung in der Verfassung leben.Es kann uns dann niemand vorwerfen, dass wir Blindekuhspielen. Es kann uns auch niemand sagen, wir seien bei derNachführung über Lehre und Rechtsprechung hinausgegan-gen, und man kann uns, Frau Kollegin Brunner – guten Willenvorausgesetzt –, vor allem nicht vorwerfen, dass wir durchvage Formulierungen Interpretationen zulassen würden, dieneuen Konfliktstoff mit sich brächten.Ich bitte Sie, im Interesse einer möglichst unverfälschtenNachführung dem Antrag der Mehrheit der Kommission zu-zustimmen.
Koller Arnold, Bundesrat: Bei Artikel 24, wo wir ausdrücklichdie Koalitionsfreiheit und als ein Instrument der Koalitionsfrei-heit Streik und Aussperrung regeln, handelt es sich zweifel-los um eine sehr wichtige Differenz zwischen den beiden Rä-ten – und das in einem politisch sehr sensiblen Bereich. Des-halb bin ich natürlich der Mehrheit Ihrer Kommission sehrdankbar, dass sie sich jetzt in der zweiten Runde doch inRichtung Bundesrat und Nationalrat bewegt hat, wenn auchnoch gewichtige Unterschiede bestehen, auf die ich nachhereingehen möchte.Zunächst aber zum Festhalten am Streichungsantrag: HerrMarty hat zu Recht gesagt: Ein Streichen dieses Passus überAussperrung und Streik wäre ein Abdanken des Verfassung-gebers gegenüber den Gerichten. Man kann doch nicht stän-dig sagen, die Gerichte würden zu mächtig, sie würden im-mer mehr politische Fragen entscheiden, und dann gleichzei-tig in einem Moment, wo wir die Verfassung nachführen, hin-gehen und gleichsam so tun, als ob es Streik und Aus-sperrung in unserem Land nicht gäbe. Ich habe im National-rat den etwas harten Ausdruck gebraucht: Wir dürfen dochnicht Blindekuh spielen vor einem Faktum, das tatsächlichbesteht.Das Bundesgericht hat in einem Entscheid aus dem Jahr1985 ganz klar gesagt, es gehe nicht an – wie das die Vorin-stanz gemacht hatte – zu sagen, das Streikrecht, ja, dasRecht auf kollektive Arbeitskampfmassnahmen habe nochkeinen Eingang in das schweizerische Arbeitsrecht gefun-den. Es gibt mehrere Bundesgerichtsentscheide und nochmehr Entscheide unterer Instanzen, wo sich die Gerichteständig mit der Rechtmässigkeit von Streik und Aussperrung
Constitution fédérale. Réforme 162 E 18 juin 1998
Bulletin officiel de l’Assemblée fédérale / Tiré à part
auseinandersetzen mussten. Sonst müssten Sie den Antragstellen, man müsse Streik und Aussperrung verbieten. Aberdas will vernünftigerweise niemand, denn wir möchten janicht, dass der Staat in die Regelung der Arbeitskonflikte ein-greift, sondern man hat die Regelung der Arbeitsbeziehun-gen und damit auch der möglichen Konflikte ganz bewusstüber den Weg der Koalitionsfreiheit und der Tarifautonomieden Sozialpartnern überlassen. Also müssen wir hierzu Stel-lung nehmen.Ich möchte Sie daher dringend bitten, den Streichungsantragabzulehnen. Das wäre wirklich ein Abdanken des Verfas-sunggebers vor der Rechtswirklichkeit.Wenn man sich dafür entscheidet, diese Fragen hier in dernachgeführten Verfassung zu regeln, dann gibt es einmal dieMöglichkeit, die der Bundesrat und der Nationalrat Ihnen vor-geschlagen haben, wo man ausdrücklich anerkennt, dass essich hier um ein Recht auf Streik und Aussperrung handelt.Ich will aber auch hier, weil es sich um einen derartig sensi-blen Bereich handelt, vollständige Transparenz. Die Begrün-dung, weshalb der Bundesrat das vorgeschlagen hat, war fol-gende: Wir haben zwar ausdrücklich anerkannt, was dasBundesgericht im gleichen Entscheid auch gesagt hat, dasses die Frage offenlässt, ob es sich hier um ein Grundrecht aufVerfassungsstufe handle.Wir waren der Meinung, dass es Aufgabe der Nachführungder Bundesverfassung sei, derartige offengelassenen Fra-gen zu klären. Weil die überwiegende Mehrheit in der Lehredavon ausgeht, dass es sich um ein Verfassungsrecht han-delt, haben wir Ihnen diese Klärung vorgeschlagen.Wir sind hier im Differenzbereinigungsverfahren. Sie möch-ten offenbar nicht so weit gehen, sondern möchten bei die-sem Stand der bundesgerichtlichen Rechtsprechung bleiben,wo offengelassen ist, ob das ein Verfassungsrecht, ein ei-genständiges Grundrecht sei. Damit kann der Bundesrat imRahmen des Differenzbereinigungsverfahrens sicher auchleben, weil es dem Bundesrat wichtig scheint, dass wir – ichwünschte mir wirklich: heute – zu einer konsensfähigen Lö-sung kommen.Wenn jetzt diese Frage des Streikrechtes noch ein paarmal –wie die Romands so schön sagen – die «navette» macht,vom Ständerat zum Nationalrat, so wird das Problem zumSchicksalsartikel hochstilisiert. Deshalb haben wir wirklich al-les Interesse daran, heute eine Formulierung zu finden, diedann auch im Nationalrat akzeptiert wird. Deshalb gebe ichhier im Namen des Bundesrates das Einverständnis, dassman diese Frage des Verfassungsrechtes offenlässt, wie dasauch das Bundesgericht gemacht hat. Damit verfolgen wir –das sei immerhin noch gesagt – anders als bei anderen The-men eine sehr strikte, eher restriktive Auffassung des Nach-führungskonzeptes.Nachdem dies gesagt ist, müssen wir nun die einzelnen For-mulierungsvorschläge miteinander vergleichen. Ich gebe ge-genüber der Mehrheit und damit ihrer Wortführerin, Frau For-ster, zu, dass diese Voraussetzungen, wie sie im Antrag derMehrheit enthalten sind, sich klassischerweise auch in denarbeitsrechtlichen Lehrbüchern finden und auch im genann-ten Entscheid des Bundesgerichtes.Uns ist bei näherer Analyse aufgefallen, dass eine dieserVoraussetzungen für die Rechtmässigkeit eines Streiks odereiner Aussperrung zu eng gefasst ist. Die Lehrbücher spre-chen zwar immer von den Organisationen, vor allem im Zu-sammenhang mit dem Streikrecht. Es ist heute aber auchklar und unbestritten – wenn Sie eine Firma wie die Novartisnehmen –, dass nicht nur eine Arbeitgeberorganisation, son-dern auch eine einzelne Firma dieses Recht hat. Insofern istdieses Kriterium der Arbeitgeberorganisation einfach zu eng.Hingegen stimme ich mit Ihnen vollständig überein, dasswilde Streiks anerkanntermassen unzulässig und unrecht-mässig sind; das haben wir in der Botschaft auch ausdrück-lich festgehalten. Aber dieses Kriterium, dass die Arbeitge-berorganisation der Träger einer Aussperrung sein muss, isteindeutig zu eng, und deshalb sollte es nach Meinung desBundesrates nicht in die Verfassung aufgenommen werden.Diese Fassung hat aus Sicht des Bundesrates einen weite-ren Mangel: Es geht um das Wort «nur», das für den Natio-
nalrat natürlich ein Reizwort sein wird. Sie haben selber ge-sagt, dass dieses «nur» keinerlei rechtliche Bedeutung hat,sondern von rein psychologischer Bedeutung ist, und es wirdnatürlich für den Nationalrat ein Reizwort sein. Das ist derGrund, warum ich die Minderheit III in der bereinigten Fas-sung gemäss Einzelantrag Inderkum als die klar beste Lö-sung sehe, und ich bin überzeugt: Wenn Sie heute dem An-trag Inderkum zustimmen, dann haben wir dieses Problemgelöst; ich bin überzeugt, dass der Nationalrat dann auch zu-stimmen wird.Es ist ganz entscheidend, Frau Forster, dass der Antrag In-derkum das Verhältnismässigkeitsprinzip aufgenommen hat.Dieses Prinzip spielt auch in der bundesgerichtlichen Recht-sprechung zur Rechtmässigkeit von Streik und Aussperrungeine ausserordentlich wichtige Rolle. Wir haben vielleicht denFehler gemacht, dass wir das Verhältnismässigkeitsprinzip inunserer Formulierung nicht ausdrücklich genannt haben, weilwir von der Vorstellung ausgingen, es gelte ja allgemein imRecht. Ich habe die Sache überprüft; in den Einleitungsarti-keln ist es nur für das staatliche Handeln vorgeschrieben.Deshalb haben wir sicher allen Grund, dieses Verhältnismäs-sigkeitsprinzip hier ausdrücklich zu nennen. Im genanntenBundesgerichtsentscheid war die Verhältnismässigkeit sehrentscheidend: Das Bundesgericht hat dort festgehalten, derStreik sei übereilt beschlossen worden, ohne dass der Ver-handlungsweg ausgeschöpft worden sei; er sei daher nichtrechtmässig, und die fristlosen Entlassungen seien grund-sätzlich begründet. Dem Verhältnismässigkeitsprinzipkommt damit eine ganz zentrale Bedeutung zu.Aus all diesen Gründen bin ich überzeugt, dass Sie der Sa-che wirklich einen grossen Dienst tun, wenn Sie heute eineFormulierung beschliessen, die dann auch im Nationalrat Be-stand haben wird; das wird bei der Formulierung gemäss An-trag Inderkum sicher der Fall sein. Die einzigen beiden Unter-schiede betreffen ja dieses Wörtchen «nur» und die Arbeit-nehmer- und Arbeitgeberorganisationen, die nicht genanntwerden.
Aeby Pierre (S, FR): Monsieur le Conseiller fédéral, excu-sez-moi de reprendre la parole après que vous vous soyezexprimé, mais vous nous avez donné maintenant une inter-prétation assez nouvelle de la part du Conseil fédéral qui,jusqu’à présent, a défendu sa disposition initiale.Celle-ci consistait à parler d’un droit de grève – un droit fon-damental – et de lock-out qui avait son corollaire à l’alinéa 4qui disait tout à fait normalement: «La loi peut régler l’exer-cice de ces droits et interdire le recours à la grève à certainescatégories de personnes.» Nous faisons ici presque du tra-vail de commission, mais compte tenu de cette nouvelle in-terprétation la question se pose, ou en tout cas elle se poserade façon très précise à la commission du Conseil national, desavoir si, dans la proposition de majorité ou de minorité IIImodifiée par la proposition Inderkum, l’alinéa 4 a encore unejustification.A mon avis, l’alinéa 4 n’a plus de raison d’être parce qu’onparle dans les deux texte d’obligation de préserver la paix dutravail. On n’a plus la notion très forte de droit. Une obligationde préserver la paix du travail peut être contractuelle ou lé-gale. Cette nouvelle interprétation que vous donnez mainte-nant à propos du droit de grève qu’on n’est plus obligé de re-prendre comme notion dans la constitution pose incontesta-blement le problème de l’alinéa 4 qu’il faudrait, à mon avis,biffer, mais je ne fais pas de proposition ici. Je laisse le soinà l’administration et à la commission du Conseil national,pour le cas où nous adopterions la proposition de majorité oude minorité III, d’examiner cette question de façon approfon-die.
Rhinow René (R, BL), Berichterstatter: Ich möchte dochnoch kurz auf die verschiedenen Minderheitsanträge undauch auf die Ausführungen von Herrn Bundesrat Koller ein-gehen.Es war unser Anliegen, dem Nachführungsauftrag gerecht zuwerden. Wir haben versucht, das ohne politische Demonstra-
18. Juni 1998 S 163 Bundesverfassung. Reform
Amtliches Bulletin der Bundesversammlung / Separatdruck
tion zu tun, ohne die Gelegenheit zu benützen, anhand die-ses Artikels auf der einen oder anderen Seite Positionen mar-kieren zu wollen.Wenn ich nun die Anträge der verschiedenen Minderheitennäher betrachte, komme ich zum Schluss oder habe zumin-dest die Vermutung, dass sich sowohl die Minderheit I (Aeby)als auch die Minderheit II (Reimann) weniger um Nachfüh-rung bemühen denn um das Markieren einer politischen Po-sition.Der Minderheit I muss ich sagen, dass die Lösung der Kom-missionsmehrheit davon ausgeht, dass Streik und Aussper-rung in diesem Land unter gewissen Voraussetzungen zu-lässig sind. Wenn wir hier von den Schranken sprechen, set-zen wir voraus, dass es diese Zulässigkeit gibt, was ich imNamen der Kommissionsmehrheit auch klar festhaltenmöchte.Uneinigkeit in der Lehre besteht heute darin, woraus diesesRecht abgeleitet wird; Herr Bundesrat Koller hat zu Rechtdarauf hingewiesen. Die einen sagen, es leite sich aus derKoalitionsfreiheit ab, die anderen, es könne anderen Verfas-sungsbestimmungen betreffend die Arbeit entnommen wer-den, Dritte sagen, es sei nur auf gesetzlicher Stufe gewähr-leistet. Wir lassen diese Frage bewusst offen, weil sie auchheute offen ist. Deshalb fahren wir korrekt auf dem Geleiseder Nachführung, anerkennen aber, dass es diese Zulässig-keit im Grundsatz gibt. Man kann der Kommissionsmehrheitnicht vorwerfen, sie würde nur Schranken regeln und offen-lassen, ob es in diesem Land überhaupt Streik und Aussper-rung geben könne.Der Minderheit II möchte ich sagen – auch hier kann ich michHerrn Bundesrat Koller anschliessen –: Sie verhindern denStreik nicht, wenn Sie nichts sagen. Sie lassen nur zusätzlichalle Kriterien offen und überlassen es dem Gericht, sie dannim Einzelfall festzulegen. Sie tun auch nichts für die Rechts-sicherheit, wenn Sie alles offenlassen und erst nach gehab-tem Streik dann post festum beim Bundesgericht feststellenmüssen, was zulässig war oder was nicht.Wir versuchen, hier Klarheit zu schaffen, ohne auch nur ei-nen Schritt von dem abzuweichen, was heute bereits gelten-des Recht ist. Wir haben auch nicht einfach «der Linkennachgegeben»; das muss ich ganz klar unterstreichen. Wirhaben uns bemüht, jenseits dieser politisch aufgeladenenStellungnahmen dem Nachführungsauftrag gerecht zu wer-den.Was die Minderheit III (Marty Dick) angeht, so ist vor allemeine wichtige Differenz zur Mehrheit vorhanden: Das «nur» –das gebe ich zu – ist nicht eine rechtliche Differenz, sonderneine politisch-psychologische. Die wichtigere Differenz zurMinderheit III – auch in der Fassung von Herrn Inderkum, derdie Verhältnismässigkeit jetzt aufnimmt – ist die, dass hiervon den tariffähigen Organisationen nicht die Rede ist. Dasist der wesentliche Unterschied, auf den Herr Bundesrat Kol-ler, wenn ich richtig zugehört habe, nicht hingewiesen hat. Esgeht nicht nur um die Arbeitgeberorganisationen, sondern esgeht ja – was den Streik angeht – vor allem um die Arbeitneh-merorganisationen.Ich stimme auch der Auffassung zu – ich unterstreiche das imNamen der Kommission –, dass der wilde Streik in unseremLand verboten ist. Die Mehrheit der Kommission möchte justdieses Verbot in ihre Fassung aufnehmen. Denn das Verbotdes wilden Streiks fehlt im Antrag der Minderheit III. Jetztkann man sicher zu Recht sagen, dieses gelte weiterhin auf-grund von Lehre und Rechtsprechung. Aber warum regelnwir denn drei Voraussetzungen und sagen just von dieservierten nichts, schweigen diesbezüglich? Zumindest der un-befangene Leser könnte aufgrund der Fassung der Minder-heit III meinen, dass über die Zulässigkeit von Streik undAussperrung ein abschliessender Katalog geschaffen wor-den sei und die tariffähigen Organisationen bewusst nichtaufgenommen worden seien. Aber das wollen wir ja nicht.Und das ist ja auch nicht die Meinung von Herrn Inderkumund von Herrn Marty, aber ohne diese Vorkenntnisse könnteman auf diese Idee kommen. Deshalb sehe ich nicht ein,weshalb wir die Schranke der tariffähigen Organisation nichtaufnehmen können.
In der Fassung der Mehrheit der Kommission ist allerdingsnicht von tariffähigen Organisationen, sondern von «Arbeit-nehmer- oder Arbeitgeberorganisationen» die Rede. Esstimmt: Eine kleine Unebenheit in der Mehrheitsfassung istdie, dass ein einzelner Arbeitgeber auch tariffähig sein kann.Es braucht nicht eine zusätzliche Organisation. Für denStreik braucht es aber eine Arbeitnehmerorganisation. Ur-sprünglich haben wir in der Kommission eine Fassung disku-tiert, die den Begriff der tariffähigen Organisation verwendethat, aber wir haben diesen Begriff auf Rat der Verwaltung fal-lenlassen. Hinterher bereue ich, dass wir die Formulierung«tariffähige Organisationen» nicht aufgenommen haben.Dann hätten wir diese terminologischen Unebenheiten berei-nigen können.Ich möchte Sie als Kommissionspräsident bitten, trotzdemdem Antrag der Mehrheit der Kommission oder allenfalls demAntrag der Minderheit III – mit der Ergänzung «von tariffähi-gen Organisationen» – zuzustimmen und sowohl den Antragder Minderheit I als auch den Antrag der Minderheit II im Rah-men dieses Differenzbereinigungsverfahrens abzulehnen, imInteresse der Nachführung der Verfassung und unter Ver-zicht auf politische Demonstrationen.
Brunner Christiane (S, GE): Je vous prie de m’excuser de re-prendre la parole maintenant, mais il y a deux points qui m’in-terpellent:1. D’une part, la traduction de «verhältnismässig» en fran-çais. «Verhältnismässig», c’est en quelque sorte «proportion-nel»; une grève doit être proportionnelle. Mais en français,c’est traduit par «doit être adapté aux circonstances». (Re-marque intermédiaire Cavadini Jean: «Proportionnée».)«Proportionnée», mais ce n’est pas adapté aux circonstan-ces. Tout à l’heure, je n’ai lu que le texte français. C’est avecla proposition Inderkum et l’explication de M. le conseiller fé-déral que j’ai compris que «verhältnismässig» ne correspon-dait pas. La traduction correcte est «proportionnée», commele dit très justement M. Cavadini. La grève doit être propor-tionnée. Toute la jurisprudence et la doctrine a toujours ad-mis que la grève devait être proportionnée, les moyens col-lectifs de lutte proportionnés. Déjà là, il y a à mon avis uneerreur de traduction en français, et une erreur qui n’est pasde détail.2. Par rapport à la proposition de minorité III et à la proposi-tion de la majorité, malgré les explications de Mme Forster etde M. le conseiller fédéral, on ne peut pas dire qu’une orga-nisation de travailleurs «tariffähig» – c’est d’ailleurs un termeutilisé en Allemagne, qui n’existe pas dans notre pays – peutêtre une commission d’entreprise. Vous ne pouvez pas éten-dre la notion d’organisation à une commission d’entreprisepar exemple ou un petit groupe, à une représentation de tra-vailleurs ou travailleuses dans une entreprise. Ce seraitd’ailleurs contraire à ce qui a été admis jusqu’à présent par ladoctrine en Suisse à juste titre, c’est-à-dire qu’une grève de-vait être portée par une organisation de travailleurs pour pou-voir négocier ou pour pouvoir y mettre fin et pour pouvoir ymettre en quelque sorte aussi l’avoir en main.Il y a donc ce problème là. En outre, la majorité de la commis-sion introduit vraiment quelque chose d’absurde, je l’ai déjàdit tout à l’heure: on ne peut pas introduire la notion de sou-tien «par une organisation d’employeurs». Un conflit collectifpeut surgir dans une entreprise. La discussion va se faire, dela part du syndicat, avec la direction de l’entreprise. Un lock-out («Aussperrung»), il n’y a pas besoin non plus qu’une or-ganisation d’employeurs le soutienne. C’est une décisiond’une entreprise, un instrument de riposte, qui n’est pas uti-lisé certes, mais un instrument de riposte contre les tra-vailleurs qui se mettent en grève dans l’entreprise. Il n’y a pasbesoin de la bénédiction d’une association d’employeurs,surtout s’il n’y a peut-être pas d’association d’employeursdans la branche en question.C’est une absurdité qu’on introduirait dans la constitution. Jedois dire que ou bien on reprend le tout en commission, et onregarde de manière plus différenciée les choses, ou alorsdans tous les cas il faudrait adopter la proposition Inderkum,
Constitution fédérale. Réforme 164 E 18 juin 1998
Bulletin officiel de l’Assemblée fédérale / Tiré à part
qui ne contient pas toutes ces erreurs et tous ces illogismes,en adaptant toutefois le texte français à l’expression exacte«verhältnismässig».
Koller Arnold, Bundesrat: Ich nehme noch kurz zu drei Pro-blemen Stellung:1. Eine Bemerkung zu jenen, die gesagt haben, wir würdennun von unserer Position abrücken: Ich habe Ihnen ganztransparent gemacht, was der Hintergrund unseres Entwur-fes war. Wir waren der Meinung, dass im Rahmen der Nach-führung auch offene Fragen geklärt werden sollten. Ichnehme zur Kenntnis und befürworte sogar, dass jetzt im Rah-men der Differenzbereinigung in einem so sensiblen Bereicheine eher restriktive Auffassung der Nachführung Platz greift.Deshalb verzichtet der Bundesrat auf seine ursprünglicheFassung und sucht heute einen möglichst tragfähigen Kom-promiss.2. Zum Antrag der Mehrheit: Ich bin überzeugt, dass er we-gen des unschönen Wörtchens «nur», und weil der Begriff«Arbeitgeberorganisation» einfach zu eng ist, im Nationalratnicht konsensfähig ist. Wir sollten nicht etwas aufnehmen,was eindeutig zu eng ist. Demgegenüber bin ich überzeugt,dass der Antrag der Minderheit III in der Fassung von HerrnInderkum im Nationalrat mehrheitsfähig sein wird, und ichwerde im Nationalrat auch dafür kämpfen, dass er in dernächsten Runde durchgeht.3. Auf Absatz 4 können wir nicht verzichten, denn es gibtwichtige Bereiche, wo im eminenten öffentlichen Interesseein Streikverbot bestehen muss.
Präsident: Der Antrag der Minderheit III ist zugunsten desAntrages Inderkum zurückgezogen worden.
Erste Eventualabstimmung – Premier vote préliminaireFür den Antrag Inderkum 22 StimmenFür den Antrag der Mehrheit 17 Stimmen
Zweite Eventualabstimmung – Deuxième vote préliminaireFür den Antrag Inderkum 32 StimmenFür den Antrag der Minderheit I 4 Stimmen
Definitiv – DéfinitivementFür den Antrag Inderkum 23 StimmenFür den Antrag der Minderheit II 15 Stimmen
Art. 27 Abs. 2Antrag der KommissionZustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Art. 27 al. 2Proposition de la commissionAdhérer à la décision du Conseil national
Marty Dick (R, TI), rapporteur: Il s’agit ici des droits des per-sonnes privées de liberté. Il y a une petite divergence à l’ali-néa 2.L’alinéa 2 deuxième phrase dispose que la personne quis’est vue privée de sa liberté «doit être mise en état de fairevaloir ses droits». Le Conseil national a ajouté une autrephrase: «Notamment elle a le droit de faire informer ses pro-ches parents.»Nous estimons que la différence n’est pas importante et sur-tout qu’elle ne mérite pas une divergence. Néanmoins, nouspensons que la version du Conseil national n’est pas trèsheureuse parce qu’on peut peut-être imaginer que le fait defaire avertir immédiatement un médecin est tout aussi impor-tant.Mais dans l’esprit de conciliation qui caractérise notre com-mission et avec la volonté de ne pas créer de divergencesinutiles, nous vous proposons d’adhérer à la décision duConseil national.
Angenommen – Adopté
Art. 30Antrag der KommissionTitelGarantie der politischen RechteAbs. 1Die politischen Rechte sind gewährleistet.Abs. 2Die Garantie der politischen Rechte schützt ....
Art. 30Proposition de la commissionTitreGarantie des droits politiquesAl. 1Les droits politiques sont garantis.Al. 2La garantie des droits politiques protège la libre formation de....
Aeby Pierre (S, FR), rapporteur: Nous entrons ici dans unepartie où nous aurons, surtout par la suite, passablement dedivergences de systématique. Comme je l’ai dit hier – je pré-fère le répéter aujourd’hui –, je n’insisterai pas sur ces diver-gences de systématique, notamment lorsque nous seronsdans la série des articles 32a et suivants, qui tous se rappor-tent aux articles 45 et suivants de la version du Conseil natio-nal, ce qui oblige chacun à une certaine gymnastique pourpouvoir avoir le texte chaque fois sous les yeux.En ce qui concerne l’article 30 «Garantie des droits politi-ques», il n’y a rien à signaler de particulier. C’est une adap-tation rédactionnelle qui résulte de ce que nous dirons plusloin, à l’article 32a notamment, ainsi qu’aux articles 32c et32d.
Angenommen – Adopté
Kapitel 1a TitelAntrag der KommissionBürgerrecht und politische Rechte
Chapitre 1a titreProposition de la commissionNationalité, droit de cité et droits politiques
Angenommen – Adopté
Art. 32aAntrag der KommissionTitelBürgerrechteAbs. 1FesthaltenAbs. 2.... benachteiligt werden. Ausgenommen sind Vorschriftenüber die politischen Rechte in Bürgergemeinden und Korpo-rationen sowie über den Mitanteil an deren Vermögen, es seidenn, die kantonale Gesetzgebung sieht etwas anderes vor.
Art. 32aProposition de la commissionTitreNationalité et droit de citéAl. 1MaintenirAl. 2Nul ne doit être privilégié ou désavantagé en raison de sondroit de cité. Il est possible de déroger à ce principe pour ré-gler les droits politiques dans les bourgeoisies et les corpora-tions ainsi que la participation aux biens de ces dernières sila législation cantonale n’en dispose pas autrement.
Aeby Pierre (S, FR), rapporteur: C’est en fait ici, d’après ledocument que j’ai reçu, que commence mon rapport au nomde la commission. Mais c’est volontiers que j’ai rapporté surl’article 30 de façon tout à fait spontanée.
18. Juni 1998 S 165 Bundesverfassung. Reform
Amtliches Bulletin der Bundesversammlung / Separatdruck
En ce qui concerne l’article 32a «Nationalité et droit de cité»,le Comité de médiation s’est rallié sans difficulté, après unecourte discussion, à la systématique de notre Conseil, si bienque nous maintenons celle-ci, bien qu’elle ait été écartéedans un premier temps par le Conseil national.A l’alinéa 1er, nous maintenons notre décision. A l’alinéa 2,nous avons une meilleure formulation, notamment concer-nant la capacité des cantons de règlementer les corporationset les bourgeoisies.
Angenommen – Adopté
Art. 32bAntrag der KommissionFesthalten
Art. 32bProposition de la commissionMaintenir
Aeby Pierre (S, FR), rapporteur: A l’article 32b, nous mainte-nons également notre formulation qui est meilleure, à notresens. Je signale simplement que, dans le texte français, nousavons choisi une formulation neutre, celle de «personnesétrangères».
Angenommen – Adopté
Art. 32cAntrag der KommissionTitelAusübung der politischen RechteAbs. 1Der Bund regelt die Ausübung der politischen Rechte in eid-genössischen, die Kantone diejenigen in kantonalen undkommunalen Angelegenheiten.Abs. 2Die politischen Rechte werden am Wohnsitz ausgeübt ....Abs. 3Niemand darf in mehr als einem Kanton die politischenRechte ausüben.Abs. 4Festhalten
Art. 32cProposition de la commissionTitreExercice des droits politiquesAl. 1La Confédération règle l’exercice des droits politiques au ni-veau fédéral; les cantons règlent ces droits aux niveaux can-tonal et communal.Al. 2Les citoyens exercent les droits politiques au lieu de leur do-micile ....Al. 3Nul ne peut exercer ses droits politiques dans plus d’un can-ton.Al. 4Maintenir
Aeby Pierre (S, FR), rapporteur: Ici, le titre change. «Exer-cice des droits politiques». Il change également dans le texteen allemand, c’est le fameux «Oberbegriff» de «Bürger-rechte». Je fais juste une remarque à propos de l’alinéa 2 del’article 32c: dans le texte en français, nous changeons éga-lement un peu la formulation pour éviter de nouveau la ques-tion de la problématique des sexes. Je vous proposed’ailleurs de ne plus signaler toutes les modifications en lan-gue française qui résultent des explications données par leprésident de la Commission de rédaction de langue fran-çaise, M. Cavadini Jean, en ouverture de séance.
Angenommen – Adopté
Art. 32dAntrag der KommissionAbs. 1FesthaltenAbs. 2Der Bund erlässt Vorschriften über die Rechte und Pflichtender Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer, nament-lich über die Ausübung der politischen Rechte im Bund, dieErfüllung der Wehrpflicht und die Unterstützung.Abs. 2bisFesthalten
Art. 32dProposition de la commissionAl. 1MaintenirAl. 2La Confédération édicte des dispositions sur les droits et lesdevoirs des Suisses de l’étranger, notamment sur l’exercicedes droits politiques au niveau fédéral, l’accomplissementdes obligations militaires et l’octroi de l’aide sociale.Al. 2bisMaintenir
Aeby Pierre (S, FR), rapporteur: Ici, de nouveau, la com-mission vous propose, après avoir réexaminé cette question,de maintenir la décision de notre Conseil. Je rappelle qu’ellese distingue de la décision du Conseil national, que voustrouvez à l’article 48, par le fait qu’elle impose à la Con-fédération d’édicter des dispositions sur les droits et devoirsdes Suisses de l’étranger, et non pas seulement la «Kann-Vorschrift» telle que l’a laissée passer le Conseil national.En résumé, pour l’article 32d: maintien et, de nouveau, utili-sation de l’«Oberbegriff» non pas de «Bürgerrechte», commeje l’ai dit tout à l’heure, mais de «politische Rechte», en fran-çais, «des droits politiques».
Angenommen – Adopté
Art. 32eAntrag der KommissionZustimmung zum Beschluss des NationalratesProposition de la commissionAdhérer à la décision du Conseil national
Aeby Pierre (S, FR), rapporteur: L’article 32e a été réglé toutà l’heure par notre discussion sur l’article 5a. En discutant surcet article 5a, nous avons également admis que celui-ci soitdéplacé où il l’a été.
Angenommen – Adopté
Art. 33 Abs. 1aa, 1a, 1, 1bis, 1terAntrag der KommissionAbs. 1aa, 1aStreichenAbs. 1Bund und Kantone setzen sich in Ergänzung zu persönlicherVerantwortung und privater Initiative dafür ein, dass:a. Streichen....e. Festhalten....Abs. 1bisSie setzen sich dafür ein, dass jede Person gegen die wirt-schaftlichen Folgen von Alter, Invalidität, Krankheit, Unfall,Arbeitslosigkeit, Mutterschaft, Verwaisung oder Verwitwunggesichert ist.Abs. 1terBund und Kantone streben die Sozialziele im Rahmen ihrerverfassungsmässigen Zuständigkeiten und ihrer verfügbarenMittel an.
Constitution fédérale. Réforme 166 E 18 juin 1998
Bulletin officiel de l’Assemblée fédérale / Tiré à part
Art. 33 al. 1aa, 1a, 1, 1bis, 1terProposition de la commissionAl. 1aa, 1aBifferAl. 1La Confédération et les cantons s’engagent, en complémentde la responsabilité individuelle et de l’initiative privée, à ceque:a. Biffer....e. Maintenir....Al. 1bisIls s’engagent à ce que toute personne soit assurée contreles conséquences économiques de l’âge, de l’invalidité, de lamaladie, de l’accident, du chômage, de la maternité, de lacondition d’orphelin ou du veuvage.Al. 1terLa Confédération et les cantons s’engagent en faveur desbuts sociaux dans le cadre de leurs compétences constitu-tionnelles et des moyens disponibles.
Aeby Pierre (S, FR), rapporteur: La commission n’a pas eu àvoter sur la proposition de compromis que nous vous présen-tons. Je vous invite à prendre la feuille qui vous a été distri-buée séparément pour que vous puissiez avoir sous les yeuxl’ensemble de l’article 33 qui nous a beaucoup occupé dansles discussions précédentes. Il semble que nous nous ache-minons aujourd’hui vers une solution de compromis qui seraacceptée par le Conseil national.Je passe en revue les différents points importants de cet ar-ticle.Nous biffons l’alinéa 1aa introduit par le Conseil national, carnous avons déjà traité cette question à l’article 5a.Nous biffons également l’alinéa 1a, car nous le retrouvonsformulé de façon plus claire et plus précise aux alinéas 1biset 1ter. L’alinéa 1er fixe l’engagement de la Confédération etdes cantons en complément de la responsabilité individuelleet de l’initiative privée. La lettre a est biffée. La seule diver-gence qui risque peut-être de faire difficulté avec le Conseilnational, c’est la disposition prévoyant que «toute personneait part à la sécurité sociale», parce qu’elle disparaît. Notrecommission considère que cette question est reprise à la let-tre bbis qui dispose que les familles en tant que communau-tés d’adultes et d’enfants sont protégées et encouragées,ainsi que lorsqu’on fixe très clairement que chacun a le droit(al. 1bis) à ce qu’il soit assuré «contre les conséquences éco-nomiques de l’âge, de l’invalidité, de la maladie, de l’accident,du chômage, de la maternité, de la condition d’orphelin et duveuvage». C’est en fait ici que nous retrouvons la notion desécurité sociale, qui n’est dès lors plus reprise telle que déci-dée par le Conseil national.Ensuite, l’alinéa 1er est suivi par les alinéas 1bis et 1ter oùnous reprenons le début de l’article décidé par le Conseil na-tional. Nous en avons suffisamment discuté lors du premierdébat.L’alinéa 2 reste en l’état; il n’est pas contesté non plus.Je vous invite, avec notre commission qui l’a fait à l’unani-mité, à adopter cet article dans sa présente version.
Abs. 1aa, 1a – Al. 1aa, 1aAngenommen – Adopté
Abs. 1 – Al. 1
Koller Arnold, Bundesrat: Zur Streichung von Absatz 1 Literaa: Sowohl der Bundesrat wie der Nationalrat hatten das Prin-zip verankert, dass jede Person an der sozialen Sicherheitteilhat. Das sollte unseres Erachtens beibehalten werden,denn dieser Artikel richtet sich ja nicht nur an den Bund, son-dern er richtet sich auch an die Kantone. Insofern muss na-türlich die öffentliche Fürsorge neben den Sozialversicherun-gen mit abgedeckt sein.Deshalb wäre ich Ihnen dankbar – wenn ich ausnahmsweiseeinmal vom Antragsrecht Gebrauch machen darf –, wenn Sie
Litera a doch beibehalten würden. Im übrigen bin ich mit IhrerFassung einverstanden.
Abstimmung – VoteFür den Antrag der Kommission 11 StimmenFür den Antrag des Bundesrates 9 Stimmen
Abs. 1bis, 1ter – Al. 1bis, 1terAngenommen – Adopté
3. TitelAntrag der KommissionZustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Titre 3Proposition de la commissionAdhérer à la décision du Conseil national
Aeby Pierre (S, FR), rapporteur: Le Conseil national a sim-plement voulu inclure les communes dans le titre. Nous noussommes ralliés à cette solution. Nous n’y voyons pas d’obs-tacle, d’autant plus que les communes, tout au long de nosdébats, se sont battues pour être mieux reconnues dans laconstitution.
Angenommen – Adopté
Art. 34Antrag der KommissionFesthalten
Art. 34Proposition de la commissionMaintenir
Angenommen – Adopté
Art. 34aAntrag der KommissionAbs. 1FesthaltenAbs. 2Er übernimmt diejenigen Aufgaben, ....
Art. 34aProposition de la commissionAl. 1MaintenirAl. 2Elle assume les tâches qui réclament une règlementationuniforme.
Aeby Pierre (S, FR), rapporteur: Nous avons ici une diver-gence, notamment concernant l’alinéa 2 où nous proposonsle maintien de notre version, en ce sens que nous souhaitonsque la compétence de la Confédération de s’occuper des tâ-ches qui réclament une règlementation uniforme doit être ex-primée de façon positive. Nous renonçons au «ne .... que»,au «nur» en allemand, pour dire que la Confédération, elle,assume les tâches qui réclament une règlementation uni-forme.A cet article, nous maintenons notre version et nous ne sui-vons pas ici la systématique du Conseil national.
Angenommen – Adopté
Art. 35aAntrag der KommissionAbs. 1, 2FesthaltenAbs. 3Streitigkeiten zwischen Kantonen oder zwischen Kantonenund dem Bund werden nach Möglichkeit durch Verhandlungund Vermittlung beigelegt.
18. Juni 1998 S 167 Bundesverfassung. Reform
Amtliches Bulletin der Bundesversammlung / Separatdruck
Art. 35aProposition de la commissionAl. 1, 2MaintenirAl. 3Les différends entre les cantons ou entre les cantons et laConfédération sont, autant que possible, réglés par la négo-ciation ou par la médiation.
Aeby Pierre (S, FR), rapporteur: Nous maintenons la section2a qui change la systématique du projet du Conseil fédéral età laquelle le Conseil national ne s’est pas rallié, mais nousconsidérons tout de même que cette amélioration doit êtremaintenue.
Angenommen – Adopté
Art. 37 Abs. 1, 3Antrag der KommissionFesthalten
Art. 37 al. 1, 3Proposition de la commissionMaintenir
Aeby Pierre (S, FR), rapporteur: A l’article 37, les divergen-ces sont plutôt d’ordre rédactionnel. Nous vous proposons demaintenir la décision de notre Conseil.
Angenommen – Adopté
Art. 41Antrag der KommissionMehrheitFesthaltenMinderheit(Aeby)Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Antrag Loretan WillyAbs. 1, 2Zustimmung zum Beschluss des NationalratesAbs. 3Der Bund nimmt Rücksicht auf die besondere Situation derStädte sowie der Agglomerationen und Berggebiete.
Art. 41Proposition de la commissionMajoritéMaintenirMinorité(Aeby)Adhérer à la décision du Conseil national
Proposition Loretan WillyAl. 1, 2Adhérer à la décision du Conseil nationalAl. 3La Confédération prend en considération la situation particu-lière des villes ainsi que des agglomérations urbaines et desrégions de montagne.
Aeby Pierre (S, FR), rapporteur: Je m’exprimerai ici commerapporteur de la commission qui a considéré qu’elle devaitmaintenir sa formulation initiale, c’est-à-dire, à l’alinéa 1er, lacompétence des cantons de déterminer l’organisation etl’autonomie des communes; à l’alinéa 2, une nouveauté,mais qui entre dans la notion de réforme et de mise à jour,consistant dans le fait que «dans l’accomplissement de sestâches, la Confédération prend en considération les intérêtsparticuliers des communes, dans les agglomérations urbai-nes et les régions de montagne tout spécialement». Je rap-pelle que nous avons eu tout un débat où il a été décidé, pluspar opportunité politique que par raisonnement systémati-que, de faire une seule sphère avec, d’une part, les agglomé-
rations urbaines et, d’autre part, les régions de montagne.Cette formulation avait obtenu une assez large majorité ausein de notre Conseil – 31 voix contre 8.Le Conseil national, quant à lui, est revenu à une propositionque j’avais d’ailleurs moi-même déposée dans les travaux dela sous-commission, tout au début de nos travaux, et qui con-siste, notamment à l’alinéa 3, à dire exactement ce que l’onveut, c’est-à-dire que dans notre pays les villes et les agglo-mérations urbaines peuvent constituer des entités sociales,politiques et culturelles qui méritent une attention particulièreà la fois des cantons et de la Confédération, pas d’une façongénérale, mais sous l’angle de l’organisation de la commune.Ici, vous l’aurez remarqué, je parle en tant que porte-parolede la minorité qui défend la version du Conseil national. Il esten effet artificiel de vouloir intégrer dans l’article 41, tout àcoup, les régions de montagne, non pas que l’on ne veuillepas tenir compte des régions de montagne – on les retrouved’ailleurs dans bien d’autres dispositions de la constitution,notamment dans toute la politique structurelle de la Confédé-ration –, mais celles-ci, comme telles, n’ont simplement pasgrand-chose à voir avec la structure communale. Il y a peut-être une imprécision à l’alinéa 3 qui a pu effrayer certaines oucertains d’entre vous, c’est que quand on dit que «la Confé-dération et les cantons prennent en considération la situationparticulière des villes et des agglomérations urbaines», ils’agit naturellement de leurs villes et de leurs agglomérationsurbaines et non pas de toutes les villes ou agglomérations ur-baines de la Suisse. Peut-être bien aurait-il fallu dire ici «leursvilles et agglomérations urbaines», de manière à être trèsclair.C’est une question de structure, c’est une question d’éche-lonnement du pouvoir politique dans notre pays et, en cesens, je serais assez heureux si nous pouvions nous rallier àl’article 41 dans la version du Conseil national.
Loretan Willy (R, AG): Der neue Gemeinde- und Städtearti-kel steht – so oder so, ob in der Fassung des Ständeratesoder jener des Nationalrates –; das ist als erfreuliche Tatsa-che festzuhalten. Beide Fassungen entsprechen in denGrundzügen unseren Vorstellungen. Ich habe mich – zu-sammen mit der Kommission unseres Rates – schon in derersten Runde für die Schaffung eines solchen Artikels einge-setzt.Wir sind im Differenzbereinigungsverfahren und müssen unsdaher bemühen, dass sich die Räte aufeinander zu bewe-gen. Daher mein Antrag: Er kombiniert und optimiert die bei-den Varianten zu einer Formulierung, die mir in beiden Rätenmehrheitsfähig zu sein scheint oder es werden könnte.Die Fassung des Nationalrates ist in ihrer Gesamtheit und inder Gliederung in drei Absätze – im Gegensatz zur Gliede-rung in zwei Absätze in der Fassung des Ständerates – klarerund weniger verschachtelt.Zu den einzelne Absätzen: In Absatz 1 wird in beiden Varian-ten – Ständerat und Nationalrat – die Gemeindeautonomiefestgeschrieben. In der Fassung des Nationalrates wird sievon Bundesrechts wegen gewährleistet; allerdings werdenfür die genauere Ausgestaltung die Kantone in die Pflicht ge-nommen bzw. wird ihnen die genauere Ausgestaltung dieserGemeindeautonomie, bezogen auf ihre besonderen Verhält-nisse, überlassen. In der Fassung des Ständerates ist, genaugesehen, eine Festlegung von Bundesrechts wegen nichtvorhanden. Die Kantone werden über eine Muss-Bestim-mung verpflichtet, die Autonomie der Gemeinden zu definie-ren. Ich ziehe hier die Fassung des Nationalrates vor, dassnämlich die Gemeinden ihre Autonomie von Bundesrechtswegen haben, aber deren Definition – wie gesagt – durch dieKantone vorzunehmen ist.In Absatz 2, so vorhanden nur in der Fassung des National-rates, werden die Gemeinden in einer Formulierung explizitgenannt und herausgehoben, die eigentlich besser läuft alsder Einbezug der Gemeinden in Absatz 2 gemäss Ständerat.Ich weiss von verschiedenen Kollegen und Kolleginnen, dassWert darauf gelegt wird, insbesondere von Vertretern vonKantonen mit vielen kleinen Gemeinden – dazu gehört auchder Kanton Aargau –, dass die Gemeinden in einem eigenen
Constitution fédérale. Réforme 168 E 18 juin 1998
Bulletin officiel de l’Assemblée fédérale / Tiré à part
Absatz explizit als solche erwähnt werden – obschon Städte,rechtlich gesehen, ebenfalls Gemeinden sind.Zum bedeutungsvollen Absatz 3: Die nationalrätliche Fas-sung zählt hier Sonderfälle im Bereich der Kommunen auf,nämlich die Städte mit ihren besonderen Problemen – die wirin der ersten Runde hier im Rat breit erörtert haben – und dieAgglomerationen im Bereich von Städten. Nicht erwähnt sindin der Fassung des Nationalrates, wohl aber in unserer Fas-sung, die Berggebiete. Trotz den Bedenken von KollegeAeby, die Berggebiete seien ohnehin bereits Objekt verschie-denster Gesetzgebungen, muss ich sagen, dass die Auf-nahme der Berggebiete in den Katalog, der vorschreibt, essei hier besondere Rücksicht zu nehmen, politisch und psy-chologisch von Bedeutung ist.Deshalb ziehe ich hier die Fassung des Ständerates vor,möchte aber die Erwähnung der Berggebiete in die Formulie-rung des Nationalrates übertragen und damit den Katalogdes Nationalrates mit den Berggebieten ergänzen, nebst denStädten und Agglomerationen.Was ich aber in der Fassung des Nationalrates weglassenmöchte, ist der Hinweis auf die Kantone. Bei uns fehlen dieKantone in der Einleitung zu Absatz 2. Die Konferenz derKantonsregierungen wehrt sich gegen die Einbindung derKantone in die Pflicht, auf die besondere Situation derStädte, Agglomerationen und Berggebiete Rücksicht zu neh-men. Es sei ihre Sache zu bestimmen, wie sie das machenwollten. Dass sie ihre Pflichten vernachlässigen wollen, istdamit nicht gesagt.Ich verstehe diese Vorbehalte der Kantone und beantragedaher, das Wort «Kantone» am Anfang von Absatz 3 derFassung des Nationalrates wegzulassen. Wir wollen in derneuen Verfassung des Bundes keine Frontstellung zwischenKantonen einerseits und Städten und Gemeinden anderer-seits heraufbeschwören. Es empfiehlt sich daher, die Kan-tone wegzulassen.Ich bitte Sie, meinem Vermittlungsantrag zuzustimmen. Ichglaube, dass wir so die Brücke für den Handschlag mit demNationalrat bauen können.
Uhlmann Hans (V, TG): Sie mögen sich erinnern: Ich bin beider ersten Beratung auf den Entwurf des Bundesrates einge-schwenkt. Ich war damals der Meinung, dass das besser sei,als wenn besondere Aufgaben für Agglomerationen, Städteund Berggebiete genannt werden. Nun, die Abstimmung istdann so verlaufen, wie wir wissen. Nun glaube ich, der AntragLoretan Willy ist richtig. Seine Überlegungen sind mehrheits-fähig, wenn den Kantonen nicht eine besondere Vorschriftgemacht wird. Es ist im Abschnitt zu den Gemeinden diktiert,deshalb könnte ich mich im Sinne des Antrages Loretan Willymit Bezug auf Absatz 1 und 2 dem Nationalrat anschliessen.Mit Bezug auf Absatz 3 würde ich mich auch Herrn Loretananschliessen. Es ist ein kleiner Unterschied. In der Fassungunseres Rates steht (Abs. 2): «Der Bund nimmt bei der Erfül-lung seiner Aufgaben Rücksicht auf die Anliegen ....» Der Na-tionalrat schreibt (Abs. 3): «.... Rücksicht auf die besondereSituation der Städte und der Agglomerationen», und jetztnennt der Antrag Loretan Willy auch die Berggebiete.Anliegen zu haben ist ja schön und recht. Man kann auchWünsche haben. Aber ich glaube, der Bund hat Rücksicht zunehmen auf die besonderen Situationen. Deshalb scheint mirder Antrag Loretan Willy richtig zu sein.Ich stimme ihm zu und bitte Sie, dies ebenfalls zu tun.
Koller Arnold, Bundesrat: Es ist richtig, wie Herr Loretan ge-sagt hat: Wir haben nun hier einen Gemeinde- und Städtear-tikel, und das ist im Rahmen der nachgeführten Verfassungdoch eine wichtige Neuerung; das wollen wir zunächst fest-halten.Andererseits zeigt die Vorgeschichte dieses Artikels, dass essich um einen sehr sensiblen Bereich handelt. Das haben vorallem die Gespräche mit den Vertretern der Kantone gezeigt:Die Konferenz der Kantonsregierungen hat immer gesagt, siekönnte mit der Fassung des Ständerates leben. Hingegenhatte sie Bedenken gegenüber der Fassung des Nationalra-tes, vor allem bei Absatz 2, wo festgehalten ist: «Der Bund be-
achtet bei seinem Handeln die möglichen Auswirkungen aufdie Gemeinden.» Hier befürchten die Kantone, dass der Bundplötzlich über die Köpfe der Kantone hinweg Direktkontaktemit den Gemeinden suchen könnte; das ist der sensible Punkt.Andererseits ist aber insofern ein Durchbruch gelungen, alsjetzt auch die Konferenz der Kantonsregierungen eine ge-meinsame Arbeitsgruppe mit den Städten eingerichtet hat,um die besondere Situation der Städte auch in ihrer Politikkünftig berücksichtigen zu können.Das sind die Gründe, weshalb ich Ihnen in diesem Stadiumdes Verfahrens eher empfehle, bei Ihrer Meinung zu bleiben.Was den Antrag Loretan Willy betrifft, gebe ich zu, dass erdas grösste Übel der Fassung des Nationalrates ausmerzt,indem er die Kantone weglässt. Denn es geht nicht an, dasswir hier den Kantonen noch vorschreiben, was sie gegenüberden Gemeinden zu tun hätten; in diesem Sinn ist er sicher einFortschritt. Aber der Antrag hat den Nachteil, dass er sichsonst dem Nationalrat anschliesst.Weil es eine sehr sensible Materie ist, empfehle ich Ihneneher, an Ihrem Beschluss festzuhalten.
Abstimmung – Vote
Eventuell – A titre préliminaireFür den Antrag Loretan Willy 20 StimmenFür den Antrag der Minderheit 5 Stimmen
Definitiv – DéfinitivementFür den Antrag der Mehrheit 13 StimmenFür den Antrag Loretan Willy 13 Stimmen
Mit Stichentscheid des Präsidentenwird der Antrag der Mehrheit angenommenAvec la voix prépondérante du présidentla proposition de la majorité est adoptée
Art. 43 Abs. 2Antrag der KommissionZustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Art. 43 al. 2Proposition de la commissionAdhérer à la décision du Conseil national
Aeby Pierre (S, FR), rapporteur: Ici, il s’agit plutôt d’une di-vergence rédactionnelle. Le cas couvert par l’alinéa 2 con-cerne l’intervention de la Confédération lorsque l’ordre d’uncanton est troublé. Dans la version du Conseil fédéral onajoutait «.... est troublé .... par un danger émanant d’un autrecanton». Nous considérons qu’il n’a y pas besoin d’apporterce genre de précision sur la provenance du danger, et que laConfédération intervient lorsque l’ordre d’un canton est trou-blé. Peu importe d’où vient le danger. Il peut venir du cantonlui-même, là où la Confédération intervient, simplementparce que ses forces de police et d’ordre public ne sont plussuffisantes.Donc ici, nous vous proposons d’adhérer à la décision duConseil national.
Angenommen – Adopté
Art. 44 Abs. 2Antrag der KommissionZustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Art. 44 al. 2Proposition de la commissionAdhérer à la décision du Conseil national
Angenommen – Adopté
Art. 45–48Antrag der KommissionFesthalten
18. Juni 1998 S 169 Bundesverfassung. Reform
Amtliches Bulletin der Bundesversammlung / Separatdruck
Art. 45–48Proposition de la commissionMaintenir
Aeby Pierre (S, FR), rapporteur: Jusqu’à l’article 48 inclusi-vement, il n’y a que des divergences de nature systématique.Il n’y a pas de remarques.
Angenommen – Adopté
Art. 49 Abs. 2Antrag der KommissionFesthalten
Art. 49 al. 2Proposition de la commissionMaintenir
Aeby Pierre (S, FR), rapporteur: Nous avons, en premièredélibération, ajouté la notion de «préservation du milieu natu-rel» dans le programme d’engagement de la Suisse en ma-tière de droit international et dans sa politique étrangère. Jerappelle que le projet du Conseil fédéral parlait des «effortsentrepris (par la Confédération) pour promouvoir le respectdes droits de l’homme, la démocratie et la coexistence paci-fique des peuples». Nous avons ajouté à cette trilogie «lapréservation du milieu naturel», sous-entendu sur l’ensem-ble de la planète et même dans l’univers, au besoin. Le Con-seil national ne s’est pas rallié à notre façon de voir les cho-ses.Nous vous proposons de maintenir cette notion de préserva-tion du milieu naturel, notamment en attendant, peut-être, laliquidation des divergences aussi sur l’emplacement final dela notion de «Nachhaltigkeit», de développement durable. LeConseil national l’a ancrée à l’article 2, nous l’avons dans lechapitre sur l’aménagement du territoire et sur la protectionde l’environnement. Il y a une certaine incertitude.Je vous propose, au nom de la commission unanime, demaintenir notre décision.
Angenommen – Adopté
Art. 50 Abs. 3Antrag der KommissionFesthalten
Art. 50 al. 3Proposition de la commissionMaintenir
Aeby Pierre (S, FR), rapporteur: La divergence est plutôt ré-dactionnelle. Mais, comme on l’a tout de même dit lorsqu’ona commencé cet exercice, il s’agit de faire de notre constitu-tion non seulement un texte qui reflète la réalité constitution-nelle actuelle, mais également un texte rédigé si possible defaçon simple et cohérente.Nous vous proposons de maintenir la divergence car il est in-contestable que ce qui est dit ici, à l’article 50 alinéa 3 quenous biffons, est déjà contenu intégralement dans l’article 37.Donc, maintenons cette divergence à l’article 50.
Angenommen – Adopté
Art. 51 Abs. 2Antrag der KommissionZustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Art. 51 al. 2Proposition de la commissionAdhérer à la décision du Conseil national
Aeby Pierre (S, FR), rapporteur: Une fois n’est pas coutume,la commission, sans opposition, vous propose de vous rallierà la décision du Conseil national et de préciser, à la fin del’alinéa 2 qui concerne les relations des cantons avec l’étran-
ger – c’est le titre global de l’article 51 –, d’écrire noir surblanc la phrase «Avant de conclure les traités, les cantonsdoivent informer la Confédération.»Nous n’avons pas de problème philosophique particulier ànous rallier à la décision du Conseil national.
Angenommen – Adopté
Art. 52Antrag der KommissionFesthalten
Art. 52Proposition de la commissionMaintenir
Aeby Pierre (S, FR), rapporteur: L’article 52 concerne lesdons et les distinctions octroyés par des autorités étrangères.Le Conseil national a maintenu la version du Conseil fédéralqui interdit, je le rappelle, l’acceptation, la possession dedons ou de distinctions octroyés par un gouvernement étran-ger, considérant notamment que ceci est incompatible avecl’exercice d’une fonction au sein d’une autorité fédérale, d’unparlement ou d’un gouvernement cantonal et avec la fonctiond’agent de la Confédération.Nous avons estimé que cette disposition était largement cou-verte, en ce qui concerne notamment les forces de police, lesforces des douanes et d’autres secteurs dans notre adminis-tration, par les dispositions ordinaires des différentes lois etrèglements qui règlent les statuts des catégories de fonction-naires, et qu’une telle disposition était en somme peu dignede figurer dans une constitution, dans la charte fondamentaled’une nation. Nous l’avons donc biffée.La commission unanime vous propose de maintenir ce pointde vue et de biffer cet article sur les cadeaux et les distinc-tions dans cette constitution mise à jour.
Angenommen – Adopté
2. Abschnitt TitelAntrag der KommissionFesthalten
Section 2 titreProposition de la commissionMaintenir
Aeby Pierre (S, FR), rapporteur: Je veux juste signaler que,dans le titre de la section 2, «Sécurité, défense nationale,protection civile», le Conseil national a ajouté la paix, avecl’idée que la paix était l’objectif général, l’objectif fondamentalde toute activité de sécurité, de défense nationale et de pro-tection civile. Notre commission n’a pas été d’une même sen-sibilité et, en fait, pour une raison plutôt technique, considé-rant qu’il s’agit ici de régler des compétences, a estimé peut-être de façon un peu rigoureusement juridique qu’il n’y avaitpas compétence de paix. S’il y a des compétences en termesde sécurité, de défense nationale, de protection civile, la paixne se laisse pas traiter sur un même plan et nécessite un en-gagement qui ne peut se régler par des compétences. On nepeut pas légiférer en disant: «Il y aura la paix.»C’est dans ce sens que la commission n’a pas souhaité sous-crire à ce qui est un peu déclaratif ici, il faut bien le dire, soitla mention de la paix dans le titre de la section 2.
Angenommen – Adopté
Art. 54 Abs. 1Antrag der KommissionMehrheitDie Schweiz hat eine Armee. Diese ist grundsätzlich nachdem Milizprinzip organisiert.Minderheit(Aeby)Festhalten
Constitution fédérale. Réforme 170 E 18 juin 1998
Bulletin officiel de l’Assemblée fédérale / Tiré à part
Art. 54 al. 1Proposition de la commissionMajoritéLa Suisse a une armée. Celle-ci est organisée selon le prin-cipe de l’armée de milice.Minorité(Aeby)Maintenir
Aeby Pierre (S, FR), rapporteur: Je vais essayer de rapporterde façon extrêmement objective.La version du Conseil fédéral à l’article 54 porte le titre «Ar-mée», et l’alinéa 1er stipule: «La Suisse a une armée de mi-lice.» Les premiers débats dans notre sous-commission etégalement en commission plénière nous ont amenés à biffercet alinéa. Pourquoi le biffer? D’abord, parce que dire que laSuisse a une armée de milice peut empêcher la profession-nalisation de certains secteurs de cette armée, professionna-lisation qui est précisément en cours aujourd’hui, et d’autantplus qu’il n’y avait pas de disposition de ce type dans la cons-titution actuelle. Donc, nous avons biffé l’alinéa 1er.En fait, et de façon assez claire, l’alinéa 2, selon lequel «l’ar-mée contribue à prévenir la guerre et à maintenir la paix; elleassure la défense du pays et de sa population; elle apporteson soutien aux autorités civiles lorsqu’elles doivent faireface à une grave menace pesant sur la sécurité intérieure ouà d’autres situations d’exceptions ....», est suffisant pour con-sacrer le principe d’une armée et on peut se poser la questionde savoir s’il faut y intégrer des questions de structures et lanotion de «milice».La commission, en deuxième lecture, s’est ralliée au Conseilnational qui, lui, tout en modifiant la version initiale du Conseilfédéral, a maintenu la phrase: «La Suisse a une armée. Celle-ci est organisée selon le principe de l’armée de milice.» Je vouslaisse le soin de juger de cette proposition faite à l’alinéa 1er.Quant à moi, comme porte-parole de la minorité maintenant,je considère que, ou bien on supprime l’alinéa 1er ou alors,si on veut le maintenir, il suffit de dire que «l’armée suisse estorganisée selon le principe de l’armée de milice». Je ne com-prends pas très bien le sens de ces deux phrases, je ne com-prends pas très bien non plus quel besoin nous avonsaujourd’hui de faire une phrase de cinq mots en français pourdire: «La Suisse a une armée.» Je considère cette déclara-tion comme superfétatoire, compte tenu notamment des dé-bats politiques passés, anciens, aujourd’hui réglés, que nousavons déjà eus dans ce pays à ce propos.Je vous invite, au nom de la minorité, à maintenir notre ver-sion initiale, soit biffer l’alinéa 1er. La majorité de la commis-sion vous propose de vous rallier à la décision du Conseil na-tional et de maintenir l’alinéa 1er dans une forme modifiée.
Wicki Franz (C, LU): Ich kann mich kurz fassen, ich muss nurfür die Mehrheit sprechen.In der Mehrheit sind wir der Auffassung, dass – wenn wirdazu stehen – der Verfassung die Aussage, die Schweizhabe eine Armee, gut ansteht. Das wird im ersten Satz zumAusdruck gebracht. Im zweiten Satz sagen wir, wie die Ar-mee organisiert ist. Diesbezüglich haben wir den Grundsatzdes Milizprinzips festgelegt. Wir sagen, unsere Armee seigrundsätzlich nach dem Milizprinzip organisiert, was aus-drücklich bedeutet, dass man gewisse Teile und Truppengat-tungen der Armee von diesem Milizprinzip ausnehmen kann.Das ist der Sinn unserer Bestimmung.Ich bitte Sie, der Mehrheit zuzustimmen.
Koller Arnold, Bundesrat: Der Bundesrat ist – das wird HerrnAeby nicht überraschen – vor allem gegen den Streichungs-antrag der Minderheit. Die Armee ist ein Teil unseres Staatesund verdient daher auch, in der nachgeführten Verfassungfestgehalten zu werden.Welche Fassung sich schliesslich im Differenzbereinigungs-verfahren als die bessere herausstellen wird, möchte ich of-fenlassen. Es lohnt sich schon, noch einmal über die staats-politische Bedeutung unserer Milizarmee nachzudenken. Ichfürchte, der Ausdruck «grundsätzlich» zeigt ein wenig, dass
wir uns irgendwie in einem schleichenden Prozess weg vonder Milizarmee hin zu einer Berufsarmee befinden. Wäre esdeshalb nicht vielleicht doch besser, wenn von Verfassungwegen ein klarer Volks- und Ständeentscheid gefällt würde?Aber ich stelle keinen Antrag; ich möchte diese Frage nur an-getönt haben.
Abstimmung – VoteFür den Antrag der Mehrheit 24 StimmenFür den Antrag der Minderheit 2 Stimmen
Art. 57aAntrag der KommissionAbs. 1FesthaltenAbs. 2.... und untersteht staatlicher Aufsicht. An ....Abs. 3–5Streichen
Art. 57aProposition de la commissionAl. 1MaintenirAl. 2.... et placé sous la surveillance des autorités publiques ....Al. 3–5Biffer
Art. 57abisAntrag der KommissionTitelBerufsbildung und HochschulenAbs. 1Die Gesetzgebung über die Berufsbildung in Industrie, Ge-werbe, Handel, Landwirtschaft und Hausdienst ist Sache desBundes.Abs. 2Der Bund betreibt technische Hochschulen; er kann weitereHochschulen und andere höhere Bildungsanstalten errich-ten, betreiben oder unterstützen. Er kann die Unterstützungdavon abhängig machen, dass die Koordination sicherge-stellt ist.
Art. 57abisProposition de la commissionTitreFormation professionnelle et hautes écolesAl. 1La législation sur la formation professionnelle préparant auxmétiers de l’industrie, des arts et métiers, du commerce, del’agriculture et du service de maison relève de la compétencede la Confédération.Al. 2La Confédération gère les hautes écoles techniques; ellepeut créer ou soutenir d’autres hautes écoles et d’autres éta-blissements d’enseignement supérieur. Elle peut subordon-ner son soutien à l’existence d’une coordination.
Aeby Pierre (S, FR), rapporteur: Pour la compréhension del’article 57a et de l’article 57abis, il est impératif de se reporterà l’article 78 du projet du Conseil fédéral et de la version duConseil national. Je vais essayer de résumer brièvement lespropositions de la commission. Nous avons ici cherché uncompromis en ce sens que nous acceptons que l’on traite dela formation professionnelle dans ce domaine, juste aprèsl’instruction publique. Je prends les deux articles.Nous avons un premier article 57a. Nous maintenons notreversion à l’alinéa 1er. Cet article 57a alinéa 1er correspond àl’article 78 alinéa 1er du projet du Conseil fédéral, et il semaintient. A l’alinéa 2, qui correspond à l’article 78 alinéa 2,nous faisons une proposition de compromis en ce sens quenous acceptons ici le principe du «Grundschulunterricht».En ce qui concerne l’article 57a alinéa 5, qui correspond àl’article 78 alinéa 5, nous nous rallions à la décision du Con-
18. Juni 1998 S 171 Bundesverfassung. Reform
Amtliches Bulletin der Bundesversammlung / Separatdruck
seil national. Cela paraît assez évident dans la mesure oùnous avons repris avant cette disposition.Nous maintenons en revanche – cela me paraît être le pointessentiel – la mention expresse à l’article 57abis alinéa 2 deshautes écoles techniques, que le Conseil national avait bif-fée.
Angenommen – Adopté
Art. 57b, 57c, 57d, 57eAntrag der KommissionFesthalten
Art. 57b, 57c, 57d, 57eProposition de la commissionMaintenir
Angenommen – Adopté
Art. 57fAntrag der KommissionAbs. 1Der Bund fördert den Sport, insbesondere die Ausbildung.Abs. 1bisEr betreibt eine Sportschule.Abs. 2Festhalten
Art. 57fProposition de la commissionAl. 1La Confédération encourage le sport, en particulier la forma-tion.Al. 1bisElle gère une école de sport.Al. 2Maintenir
Aeby Pierre (S, FR), rapporteur: Ici, les divergences quenous constatons avec le Conseil national sont plutôt rédac-tionnelles, et encore, elles ne s’apprécient pas forcément dela même façon en français ou en allemand. Nous proposonsde nous rallier, même si nous le faisons avec un certain re-gret, à la décision du Conseil national, que vous trouvez àl’article 82, pour l’alinéa 1er («La Confédération encourage lesport, en particulier la formation»), et pour l’alinéa 1bis («Ellegère une école de sport»).Par contre, nous proposons de maintenir l’alinéa 2 que leConseil national avait biffé: «Elle peut édicter des disposi-tions sur la pratique du sport par les jeunes et déclarer obli-gatoire l’enseignement du sport dans les écoles.»
Präsident: Wegen der anderen Systematik hat der National-rat diese Diskussion bei Artikel 82 geführt; wir behandelndasselbe mit Artikel 57f.
Angenommen – Adopté
Art. 57gAntrag der KommissionFesthalten
Antrag DaniothAbs. 2.... unterstützen sowie Kunst und Musik insbesondere im Be-reich der Ausbildung fördern.
Art. 57gProposition de la commissionMaintenir
Proposition DaniothAl. 2.... un intérêt national et encourager l’expression artistique etmusicale, en particulier au travers de la formation.
Aeby Pierre (S, FR), rapporteur: Vous avez souhaité inter-rompre le débat sur la constitution à 11 h 30. Dans ce sens,je n’ai qu’une seule phrase à dire: la commission a considéréqu’aussi bien la proposition Danioth que d’autres propositionsqui ont été faites, de même que la proposition du Conseil na-tional d’étendre les compétences de la Confédération en ma-tière de musique et d’autres activités artistiques, sont en faitune atteinte portée à la compétence des cantons. C’est pourne pas porter atteinte à la compétence des cantons en la ma-tière, compétence claire et expresse, et compte tenu de lasensibilité de cette question que la commission, même s’il estextrêmement sympathique de vouloir soutenir ce genre d’ac-tivités, n’a pas voulu se rallier et maintient sa position.
Danioth Hans (C, UR): Ich möchte Ihnen ein zwar scheinbarkleines, in der Wirkung aber grosses Anliegen unterbreitenund Sie bitten, diesbezüglich die gleiche Grosszügigkeit wal-ten zu lassen, wie Sie das heute morgen in anderen Berei-chen gemacht haben.Ich möchte den vom Nationalrat – übrigens mit Namensauf-ruf – in Artikel 83 Absatz 2 des bundesrätlichen Entwurfes an-genommenen Zusatz in unsere Fassung aufnehmen. Ich be-antrage Ihnen, in Artikel 57g Absatz 2 – er lautet: «Der Bundkann kulturelle Bestrebungen von gesamtschweizerischemInteresse unterstützen» – aufzunehmen: «.... sowie Kunstund Musik insbesondere im Bereich der Ausbildung fördern.»Dieser Zusatz entspricht einem seinerzeitigen Antrag Oster-mann und wurde, wie gesagt, vom Nationalrat unverändertangenommen.Unter dem Titel «Bildung, Forschung und Kultur» habenbeide Räte diverse Bestimmungen aufgenommen, die sichzurzeit entweder in der ganzen Verfassung verstreut befin-den oder dem gelebten Recht, sprich vor allem der Kulturför-derung, entsprechen. Die Möglichkeit zur Förderung derKunst und vor allem der Musik im Bereich der Ausbildungfestzuschreiben macht, zumal es eine blosse Kann-Vorschriftist, von der Sache her hinsichtlich Zuständigkeit und nicht zu-letzt im Hinblick auf die Akzeptanz der ganzen Verfassungs-vorlage in der Öffentlichkeit durchaus Sinn.1. Zur Notwendigkeit der Förderung von Musik und Gesang:Die Verfassungskommissionen haben zu Recht verschie-dene andere Förderungsmassnahmen aufgenommen, diezum Teil über das bisherige geschriebene Verfassungsrechthinausgehen. Dies gilt insbesondere für den Sport, wo eineallgemeine Sportförderung zur Bundesaufgabe erhoben unddamit über den eingeschränkten Artikel 27quinquies der gel-tenden Bundesverfassung hinausgegangen wird. Ich binselbstverständlich nicht dagegen, ja ich begrüsse dies sogar,denn damit wird die heute geltende Wirklichkeit festgeschrie-ben. Sport beherrscht als wichtigste Nebensache, oder abund zu auch als wichtigste Sache, unser Leben. Das bewei-sen die heutigen Ereignisse.Aber was dem einen recht ist, soll dem anderen billig sein. Dadie Bildungshoheit nach wie vor bei den Kantonen verbleibensoll – und daran möchte ich selbstverständlich nicht rütteln,Herr Aeby –, bezieht sich die vom Nationalrat beschlosseneFörderung vorab auf jene Bereiche der Ausbildung, wo derBund zuständig ist, also auf das ganze Berufsbildungswe-sen, aber zum Teil auch auf die höheren Schulen und dieUniversitäten.Eine Signalwirkung auch auf andere Ausbildungsbereiche istdurchaus zulässig und erwünscht. Längst wurde der grosseWert einer Ausbildung in musischen Fächern für die Persön-lichkeitsbildung der Jugend erkannt. Die kulturelle Bedeu-tung der Musik mit ihrer täglichen Präsenz ist gewaltig. Sportund Musik sind die beiden Gebiete, die unsere Jugend ammeisten faszinieren. Aber während die Förderung des Sportsals eine Aufgabe des Bundes mit grosszügigen Mitteln rech-nen kann, fristen die Belange der Musik ein vergleichsweisekärgliches Dasein. Erst vor kurzem ist der Einflussbereichvon «Jugend+Sport» auf die 10- bis 14jährigen Kinder aus-gedehnt worden. Damals hat unser Kommissionssprecher inAussicht gestellt, dieses Ungleichgewicht würde bei nächsterGelegenheit korrigiert.
Constitution fédérale. Réforme 172 E 18 juin 1998
Bulletin officiel de l’Assemblée fédérale / Tiré à part
Beim Musizieren, vor allem beim aktiven Musizieren, werdenbeide Hemisphären des Gehirns beansprucht. Das ist wichtigfür die Ausbalancierung der Persönlichkeit. Schulversuchemit erweitertem Schulunterricht in der Schweiz – ich verweiseauf diverse Nationalfondsprojekte – und viele weitere wissen-schaftliche Untersuchungen im Ausland haben bewiesen,dass guter Musikunterricht in den Schulen die Entfaltung derPersönlichkeit positiv beeinflusst.Die Kinder, die Jugend wird intellektuell wacher, und sozialeund emotionale Fähigkeiten werden geschult, was für diePrävention gegen Gewalt und Drogen wichtig ist. Es wäredeshalb ein Akt nicht nur der Gerechtigkeit, sondern auch derKlugheit, die Musik in der Verfassung dem Sport wenigstensin der Form eines klaren Bekenntnisses gleichzustellen. Da-mit wird vor allem eine ideelle und nicht so sehr eine finanzi-elle Verankerung von neuen Leistungen bezweckt. KlagbareAnsprüche sind ja nicht zu befürchten. Diesbezüglich sindauch von der Haltung der Musiklobby her keine Befürchtun-gen am Platz.Ich kann Ihnen versichern: Auch die nächste Auflage desParlamentarier-Liederbüchleins wird ohne jegliche Inan-spruchnahme von Bundesmitteln erfolgen. (Heiterkeit)2. Herr Bundesrat Koller hat im Nationalrat Bedenken geäus-sert, dass der Antrag und somit der Beschluss über das gel-tende Recht hinausgehe. Heute morgen, genau als die Uhrneun schlug, sehr geehrter Herr Justizminister, haben Siedas gleiche zum Gesetzgebungsauftrag für die Beseitigungvon Benachteiligungen der Behinderten eingeräumt. Dasgehe ebenfalls über das geschriebene Recht hinaus. Dannhaben Sie aber Ihr Plazet dazu gegeben mit der ausdrückli-chen Begründung, es handle sich um eine konsensfähigeNeuerung.Einmal mehr: Was dem einen recht ist, ist dem anderen billig.Oder sind Sie, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, etwader Auffassung, die Förderung des Schul- und Volksgesan-ges sei nicht konsensfähig? Erachten wir es als eine guteEntwicklung, dass viele Jugendliche sich allein mit dem Kon-sum von lautem Hardrock und dergleichen begnügen? Sindwir etwa der Meinung, im Volk wünsche man nicht auch diePflege der schönen Volkslieder in Schulen und Vereinen – ei-nes Kulturgutes, an dem alle Kantone und Sprachregionenteilhaben? Ich denke etwa an die «Liedergrossmacht» Bernoder daran, dass beispielsweise auch mein eigener Kantonüber eine grosse Vielfalt musikalischen Schaffens verfügt.3. Die Akzeptanz habe ich bereits angesprochen: Die staats-politische Klugheit gebietet es, hier einer grossen Volks-gruppe Verständnis entgegenzubringen. Auf dieses Signalwartet eine beträchtliche Musikgemeinde von 245 000 Mit-gliedern, die in der «Koordination Musikerziehung Schweiz»als Dachorgan zusammengeschlossen ist. Wenn nur jedeund jeder zweite dieser Gemeinde an die Urne geht – und siesind ja wie die Schützen, Turner und Schwinger und alle an-deren vorbildliche Stimmbürgerinnen und Stimmbürger –,dann haben Sie, sehr geehrter Herr Justizminister, die Ab-stimmung über die neue Verfassung schon halb gerettet.
Koller Arnold, Bundesrat: Angesichts dieses Hohelieds aufMusik und Kunst ist es tatsächlich schwierig, das Konzeptdurchzuhalten. Aber ich muss aus Transparenzgründen fol-gendes festhalten: Der Bundesrat hat sich bei der Präsenta-tion der Verfassungsrevision streng an dieses Konzept derNachführung gehalten und es auch überall transparent ge-macht. Zu dieser Transparenz gehört es, darauf hinzuwei-sen, dass der Beschluss des Nationalrates und jetzt auch derAntrag Danioth über diese reine Nachführung hinausgehen.Was ich aus Transparenzgründen auch sagen muss: DasVolk hat zweimal Kulturartikel abgelehnt. Das ist das Di-lemma.Aber das Konzept der konsensfähigen Neuerung hat nichtder Bundesrat eingeführt, das ist das Werk des Parlamentes,welches in dieser Frage über dem Bundesrat steht. Wir ha-ben unsere Aufgabe getreulich erfüllt, und es ist daher nun anIhnen zu entscheiden, ob hier eine konsensfähige Neuerungvorliegt.
Abs. 1, 3 – Al. 1, 3Angenommen – Adopté
Abs. 2 – Al. 2
Abstimmung – VoteFür den Antrag Danioth 21 StimmenFür den Antrag der Kommission 10 Stimmen
Die Beratung dieses Geschäftes wird unterbrochenLe débat sur cet objet est interrompu
21. September 1998 S 173 Bundesverfassung. Reform
Amtliches Bulletin der Bundesversammlung / Separatdruck
96.091
Bundesverfassung.ReformConstitution fédérale.Réforme
Fortsetzung – Suite
___________________________________________________________
A1. Bundesbeschluss über eine nachgeführte Bundes-verfassung (Titel, Art. 1–126, 185)A1. Arrêté fédéral relatif à une mise à jour de la Consti-tution fédérale (titre, art. 1–126, 185)
Rhinow René (R, BL), Berichterstatter: Gestatten Sie mir,dass ich zu Beginn unserer Debatte kurz rekapituliere, wo wireigentlich stehen.Der Ständerat hat am Anfang dieses Jahres als Erstrat denTeil A1 durchberaten, d. h. die Präambel und die Artikel 1 bis126. Das sind, wie Sie wissen, die Bestimmungen über dieEidgenossenschaft im allgemeinen, die Grundrechte, dieBürgerrechte, die Sozialziele, die Bestimmungen über dasVerhältnis von Bund und Kantonen sowie der lange Katalogder Bundeskompetenzen bis und mit Finanzordnung. DerNationalrat hat umgekehrt mit dem Teil A2 begonnen, d. h.mit den Volksrechten, den Bundesbehörden und den Revi-sionsbestimmungen. In einer zweiten Phase haben wir die-sen Teil A2 als Zweitrat beraten, umgekehrt hat der National-rat als Zweitrat seine Beschlüsse zum Teil A1 gefasst.Wir stehen heute im Differenzbereinigungsverfahren, das wirin der Sommersession begonnen haben, und zwar mit demTeil A1. Wir sind in der Sommersession bis und mit Artikel57g gelangt, allwo unser geschätzter Kollege Danioth mit sei-nem «musischen Antrag» einen erfolgreichen vorläufigenSchlusspunkt gesetzt hat.Wir führen die Beratungen also mit Artikel 57h fort. Dazu ver-fügen wir über die gleichen Fahnen wie in der Sommerses-sion. Eine ist überschrieben mit «A1 Teil 1, Titel und Ingressbis Artikel 95», und eine zweite mit «A1 Teil 2, Artikel 96 bis126, 185 und Schlussbestimmungen».Der Nationalrat seinerseits hat den Teil A2 im Rahmen desersten Umgangs der Differenzbereinigung in der Sommer-session bereits behandelt. Deshalb sehen wir vor, dass wirmorgen unsererseits diese Differenzbereinigung fortführen.Dafür haben Sie vor Sessionsbeginn eine separate Fahne imFormat A4 erhalten. Da der Nationalrat seinerseits am Mitt-woch die Differenzbereinigung von A1 mit Artikel 57g – denwir bereits behandelt haben – wiederaufnimmt, wird Ihre Ver-fassungskommission am Donnerstag der zweiten Sessions-woche zusammentreten mit dem Ziel, in der dritten Wocheam Mittwoch weitere Differenzen im Bereich A1 zu behan-deln. Wir haben die Absicht, die Beratungen der neuen Bun-desverfassung bis Ende Wintersession zu einem Abschlusszu bringen.Es sprechen verschiedene Gründe für dieses Vorgehen:1. Einmal kann eine so umfangreiche und vielfältige Vorlagewie eine neue Bundesverfassung an Kohärenz nicht gewin-nen, sondern höchstens verlieren, wenn ihre Beratung zeit-lich zu sehr in die Länge gezogen wird.2. Wir sollten aber auch Raum schaffen für andere wichtigeGeschäfte und deshalb bestrebt sein, diese Vorlage A zügigzu Ende zu bringen.3. Der vielleicht wichtigste Grund besteht darin, dass wir eineAbstimmung durch Volk und Stände über diese Vorlage Awohl mit Vorteil in der ersten Hälfte des nächsten Jahres vor-sehen sollten. Das zweite Halbjahr ist wegen der bevorste-henden Wahlen für einen derartigen Urnengang wohl kaumbesonders geeignet, und eine Verschiebung bis ins Jahr2000 wäre der Sache sicher nicht angemessen.
Um die Beratungen bis Ende Wintersession abschliessen zukönnen, sind wir also auf einen straffen Zeitplan angewiesen.Wir zählen dabei auf das Verständnis aller Ratsmitglieder,insbesondere der Mitglieder der Verfassungskommission.Unser Vorgehen bedeutet aber, dass wir die Differenzberei-nigung bei der Justizreform – Vorlage C – in diesem Jahrwahrscheinlich nicht werden abschliessen können und dassdiese zu Beginn des nächsten Jahres fortgesetzt werdenmuss.Das mag bedauerlich sein, hat aber auch Vorzüge: Es führtzu einer klaren Trennung zwischen den verschiedenen Vor-lagen A und C und könnte damit dazu beitragen, dass dieÖffentlichkeit die unterschiedliche Natur und den unter-schiedlichen Gehalt der verschiedenen Teile der Verfas-sungsreform besser erkennt.Zusammengefasst: Wir werden alles daransetzen, die Vor-lage A bis Ende nächster Session bis und mit Schlussabstim-mung zu bereinigen und die Vorlage C so weit wie möglichunter Dach zu bringen, aber wahrscheinlich nicht mehr in die-sem Jahr.Über das Schicksal der Vorlage B – Reform der Volksrech-te – können wir heute noch nichts sagen, weil der National-rat hier Erstrat ist und wir im Plenum ohnehin erst zum Zugekommen, wenn der Nationalrat seine Beschlüsse gefassthat.So weit zum Zwischenstand. Wir werden die Beratung in glei-cher Weise fortführen, wie wir das in unserem Rat gewohntsind. Herr Aeby als Berichterstatter und Präsident der Sub-kommission, die hier zuständig war, wird die restlichen Diffe-renzen der Vorlage A1 weiterbehandeln. Morgen wird unsHerr Frick durch die Vorlage A2 führen.
Art. 57hAntrag der KommissionAbs. 1Festhalten
Abs. 1bisMehrheitAblehnung des Antrages der MinderheitMinderheit(Aeby, Bloetzer, Paupe)Der Bund unterstützt die mehrsprachigen Kantone bei der Er-füllung ihrer besonderen Aufgaben. (vgl. Art. 83a Abs. 1bisgemäss Nationalrat)
Abs. 2Die Kantone bestimmen ihre Amtssprachen. Sie beachtendabei die herkömmliche sprachliche Zusammensetzung derGebiete und nehmen Rücksicht auf die angestammtensprachlichen Minderheiten.Abs. 3, 4Festhalten
Art. 57hProposition de la commissionAl. 1Maintenir
Al. 1bisMajoritéRejeter la proposition de la minoritéMinorité(Aeby, Bloetzer, Paupe)La Confédération soutient les cantons plurilingues dansl’exécution de leurs tâches particulières. (voir art. 83a al. 1bisselon Conseil national)Al. 2Les cantons déterminent leurs langues officielles. Ce faisant,ils veillent à la répartition territoriale traditionnelle des lan-gues et prennent en considération les minorités linguistiquesautochtones.Al. 3, 4Maintenir
Constitution fédérale. Réforme 174 E 21 septembre 1998
Bulletin officiel de l’Assemblée fédérale / Tiré à part
Aeby Pierre (S, FR), rapporteur: Permettez-moi de rappelerque votre commission a quelque peu changé la systématiquede ce projet et que vous trouvez, à partir de l’article 83 du pro-jet du Conseil fédéral ou du Conseil national, les dispositionsqui correspondent d’une façon générale à celles de cette par-tie que nous allons maintenant examiner.Je rappellerai ainsi que, dans notre version, l’article 83 duprojet du Conseil fédéral et du Conseil national est devenuchez nous l’article 57g «Culture» et l’article 57h «Langue».Nous avons donc divisé cet article 83 qui parlait de la cultureet des langues en deux articles séparés, et votre commissionvous propose de maintenir cette division.Il s’agit maintenant d’examiner l’article 57h sur les langues.Ici, votre commission, à l’unanimité, a décidé de maintenirpour l’essentiel la version qui avait été la sienne, considérantnotamment que le principe de territorialité était exprimé entermes plus clairs dans sa version. En revanche, elle aadopté à l’alinéa 2 la formulation du Conseil national quevous trouvez à l’article 83 du projet du Conseil fédéral; au lieude «tiennent compte des minorités linguistiques», nousavons maintenant dans le texte: «prennent en considérationles minorités linguistiques».Pour le reste, il y a une proposition de majorité et une propo-sition de minorité qui vont nous occuper quelque temps. Ellesconcernent le soutien éventuel de la Confédération aux can-tons plurilingues. Il s’agit de l’alinéa 1bis qui, pour nous, estnouveau dans cette disposition.Le Conseil national, après un débat en plénum assez bref, aapprouvé sans aucune opposition cet alinéa 1bis qui prévoit:«La Confédération soutient les cantons plurilingues dansl’exécution de leurs tâches particulières.» C’est une déclara-tion d’intention, une reconnaissance surtout de cequ’apportent à la Suisse les cantons plurilingues comme leValais, les Grisons, Berne, le Tessin ou Fribourg. Ce sont descantons qui font un effort particulier, aussi bien sous l’angledes dépenses administratives que sous celui de la formationscolaire, pour ne citer que deux domaines, pour conserversur leur territoire deux ou plusieurs de nos langues nationa-les. En conséquence, il a paru juste au Conseil national dereprendre cette disposition et d’admettre que la Confé-dération pouvait soutenir ces cantons sous une forme ousous une autre. Il n’est pas question ici forcément de subven-tions.La commission a toutefois rejeté la solution du Conseil natio-nal par 5 voix contre 3 – je répète: une commission de 21membres a rejeté cette solution par 5 voix contre 3! C’estpour cette raison que je me permets, comme rapporteur, devous présenter à la fois la proposition de la majorité de lacommission qui considère que c’est là un élément déclaratifinutile – ces cinq membres donc –, et celle des trois membresde la minorité qui, eux, au contraire, considèrent qu’il s’agit làd’un geste de générosité et de reconnaissance de l’effortfourni par ces cinq cantons, notamment pour maintenir surleur territoire la coexistence de plusieurs langues.Je vous invite, après le débat, à trancher selon votre cons-cience dans cette affaire.
Paupe Pierre (C, JU): Il est bien connu que la langueconstitue l’essentiel de l’identité d’un pays, d’un canton oud’une région. Même si le Jura n’est pas un grand canton plu-rilingue puisqu’il ne compte qu’une seule commune de lan-gue allemande, Ederswiler, je suis sensible au fait que l’ondoive appuyer le respect de la langue dans chacun de noscantons.C’est la raison pour laquelle je soutiens la proposition de mi-norité ainsi que la version décidée par le Conseil national. Ilest bien connu que nous devons toujours, dans ce pays toutparticulièrement, faire en sorte de respecter le maintien deslangues non seulement sur le plan territorial, mais sur le plande leur importance dans le débat public, dans le débat popu-laire. Je considère que ce serait un appauvrissement si onn’avait pas une ligne qui soit une incitation, même si elle nereprésente pas un appui financier important, à maintenir etconserver dans toutes les régions ces langues qui consti-tuent l’essentiel des identités de nos cantons.
Koller Arnold, Bundesrat: Der Bundesrat und der Nationalratgingen bisher davon aus, dass die Bestimmungen zum Spra-chenrecht strikt nach ihrem Normgehalt in die verschiedenenVerfassungsteile aufgeteilt werden sollten. Wir sind der Über-zeugung, dass wir damit eine wesentliche Verbesserung derDarstellung des heute in der Schweiz geltenden Sprachen-rechtes erreichen können, die grundrechtlichen Aspekte,also die Sprachenfreiheit, in Artikel 15, die kompetenziellenAspekte hier in Artikel 57h und die organisationsrechtlicheSeite in Artikel 136. Da nun aber genau besehen der Gehaltvon Artikel 136 auch einen kompetenziellen Aspekt hat,scheint mir die Lösung Ihrer Kommission durchaus vertretbarzu sein, hier in Artikel 57h Artikel 136 zu integrieren. Sodannbegrüsse ich die ausführliche Umschreibung des Territoriali-tätsprinzips, wie sie der Nationalrat beschlossen hat; sielehnt sich eng an die bundesgerichtliche Rechtsprechung derletzten Jahre an. Ich ziehe sie der ursprünglichen ständerät-lichen Fassung vor, weil sie präzisiert, mit welchen Mittelnder Sprachfrieden zu wahren ist.Nun hat Ihre Kommission wie der Nationalrat kleine, aberwichtige Ergänzungen beschlossen, die mir eine Zustim-mung zu Ihrer Fassung erleichtern. Ihre Kommission schlägtnämlich vor, von der «herkömmlichen sprachlichen Zusam-mensetzung» und von «angestammten sprachlichen Minder-heiten» zu sprechen und übernimmt damit die Kernpunkteder bundesgerichtlichen Rechtsprechung zu dieser heiklenFrage. Dies ist sicher ein Schritt in die richtige Richtung, undich möchte Ihnen daher empfehlen, der Mehrheit Ihrer Kom-mission zuzustimmen.Der Nationalrat hat mit ganz knappem Mehr, mit 81 zu 77Stimmen, beschlossen, dem Bund die Kompetenz zur Förde-rung der mehrsprachigen Kantone neu ausdrücklich einzu-räumen. Es ist unbestritten, dass diese mehrsprachigen Kan-tone mit ihrer Brückenfunktion auf dem Gebiet der SprachenSonderleistungen erbringen und besondere Aufgaben erfül-len.Im Interesse einer konsequenten Nachführung – Sie wissen,dass das mein Ceterum censeo ist – möchte ich Sie aber bit-ten, der Mehrheit der Kommission zuzustimmen, denn eshandelt sich hier eben doch um eine materielle Neuerung, diedie Minderheit vorschlägt.
Abs. 1–4 – Al. 1–4Angenommen – Adopté
Abs. 1bis – Al. 1bis
Abstimmung – VoteFür den Antrag der Minderheit 18 StimmenFür den Antrag der Mehrheit 15 Stimmen
Art. 57iAntrag der KommissionFesthaltenProposition de la commissionMaintenir
Aeby Pierre (S, FR), rapporteur: A l’article 57i, il s’agit d’unedifférence systématique. C’est ce que j’ai expliqué au débutet vous trouvez la version correspondante à l’article 83 de laversion du Conseil fédéral et du Conseil national.C’est peut-être le lieu, pour moi, de vous rappeler qu’il existe,entre la commission du Conseil national et celle de notreConseil, un Comité de médiation concernant notamment lesquestions de systématique. Ce Comité de médiation n’aaucun droit de faire des propositions au plénum, mais il faitdes propositions en commission, chaque membre dans sacommission respective. Aujourd’hui, en rapportant, je signa-lerai simplement les articles où le Comité de médiation duConseil national n’est pas d’accord de se rallier à notre Con-seil, parce que, pour la très grande majorité des articles, leComité de médiation, pour la systématique, a décidé de serallier à celle de notre Conseil, systématique qui n’appelleaucune opposition de la part du Conseil fédéral. Alors, l’arti-cle 57i, qui prévoit de maintenir la décision de notre Conseil,
21. September 1998 S 175 Bundesverfassung. Reform
Amtliches Bulletin der Bundesversammlung / Separatdruck
fait uniquement référence à la systématique, et il y en aurapar la suite plusieurs autres qui feront également uniquementréférence à cette systématique.
Angenommen – Adopté
3. Abschnitt Titel, Art. 57kAntrag der KommissionFesthalten
Section 3 titre, art. 57kProposition de la commissionMaintenir
Aeby Pierre (S, FR), rapporteur: La section 3, dans la versiondu Conseil fédéral et du Conseil national, porte le titre «Amé-nagement du territoire et environnement», ce dernier élé-ment étant en deuxième position.Au contraire, le Conseil des Etats a décidé d’inverser cet or-dre, notamment du fait qu’il a introduit un article 57k «déve-loppement durable» et qu’ensuite, il a placé l’article 57l «pro-tection de l’environnement» avant l’article 58 «aménagementdu territoire». Nous n’avons pas voulu ainsi donner la pri-mauté à un service par rapport à un autre, ou à un office parrapport à un autre, ni même à un département par rapport àun autre, d’autant plus qu’aujourd’hui, les services qui s’oc-cupent de la mise en application de ces principes constitu-tionnels sont réunis dans un même département.En revanche, nous avons voulu insister sur le fait que le dé-veloppement durable est un principe de base que la constitu-tion doit concrétiser non seulement dans le préambule oudans les premiers articles, mais aussi dans cette section 3.C’est la raison pour laquelle, en commission, nous n’avonsplus discuté très longtemps de ces questions. Je vous pro-pose de maintenir le titre de la section 3.A l’article 57k aussi, maintien de notre systématique et de laphrase qui concrétise le principe du développement durableet l’explique, étant donné que c’est un terme très souvent uti-lisé. De l’avis de la commission, il n’est pas inutile, dans unexercice de ce genre, d’expliquer un peu ce qu’on entend pardéveloppement durable. Et c’est à cet endroit qu’il faut lefaire, en tête de la section 3.
Angenommen – Adopté
Die Beratung dieses Geschäftes wird unterbrochenLe débat sur cet objet est interrompu
96.091
Bundesverfassung.ReformConstitution fédérale.Réforme
Fortsetzung – Suite
__________________________________________________________
Art. 57l, 59Antrag der KommissionFesthaltenProposition de la commissionMaintenir
Aeby Pierre (S, FR), rapporteur: Toujours dans notre systé-matique, après l’article 57k, nous enchaînons avec l’article57l «protection de l’environnement», qui est toujours, pourl’instant, l’article 59 du projet du Conseil fédéral et selon ladécision du Conseil national. En ce qui concerne la systéma-tique, comme je l’ai dit tout à l’heure, le Comité de médiationest d’avis que le Conseil national va se rallier à la systémati-que de notre Conseil. En revanche, en ce qui concerne lesalinéas 2 et 3, votés par le Conseil national, on peut considé-rer qu’il s’agit là d’un dérapage qui s’est produit lors des déli-bérations et qui mettrait en cause les principes juridiquesque nous appliquons en matière de protection de l’environ-nement depuis des années dans notre pays. En plus d’en-traîner de graves conséquences juridiques, il est certain queles modifications décidées à l’article 59 par le Conseil natio-nal auraient des répercussions négatives sur l’accomplisse-ment par l’Etat de ses tâches en matière de protection del’environnement, mais aussi, à sa suite, en matière d’aména-gement du territoire – tâches importantes et reconnuescomme telles par le peuple et les cantons à de nombreusesoccasions.S’agissant de l’article 59, l’option prise par le Conseil nationalva dans une très mauvaise direction. Indéniablement, la po-litique de protection de l’environnement a besoin, pour êtreefficace, de la collaboration de l’économie. C’est le principede coopération qui existe aujourd’hui dans notre constitutionà ce propos. Etant donné que cette version préconisée par leConseil national pose de manière presque absolue le prin-cipe de la compatibilité économique, des pans entiers et es-sentiels de la stratégie suisse en la matière menaceraient des’écrouler. En effet, la prévention et la réduction des chargesexcessives sur l’environnement doivent pouvoir se faire indé-pendamment des contingences, des entreprises et des con-sidérations économiques.C’est pour ces raisons que la commission, après une brèvediscussion, vous propose de maintenir votre version de l’arti-cle 57l et de rejeter l’article 59 tel que décidé par le Conseilnational, d’autant plus que, semble-t-il, même si ce n’est pasforcément fondamental dans ce type de débat, en séance decommission le Conseil national est déjà revenu sur cet article59 d’après les renseignements que j’ai à ce propos.
Schmid Carlo (C, AI): Ich hatte eigentlich nicht vor, in diesenGottesdienst der formellen Diskussion einzusteigen. Es gehtja primär um die systematische Ordnung der ganzen Veran-staltung. Dagegen habe ich auch nichts einzuwenden. Aberdie Bemerkungen von Kollege Aeby zu Artikel 59 – wenn ichsie in meinem begrenzten Verständnispotential für die fran-zösische Sprache richtig verstanden habe – führen dazu,dass ich doch noch etwas sagen muss: Wenn das, was derNationalrat in Artikel 59 neu hineingeschrieben hat, einekomplett neue Ausrichtung der Umweltschutzpolitik sein soll,dann bitte ich Sie, diesen Satz doch einmal umgekehrt zu le-sen. Ich meine, das, was der Nationalrat beschlossen hat,stimme, denn das Umgekehrte würde heissen: «Er sorgt im
Constitution fédérale. Réforme 176 E 21 septembre 1998
Bulletin officiel de l’Assemblée fédérale / Tiré à part
Rahmen der Vorsorge dafür, dass solche Einwirkungen ver-mieden werden, auch wenn dies unmöglich und wirtschaftlichuntragbar ist.» So aberrant kann unsere Verfassung ja nichtsein!Ich bin nach wie vor der Auffassung: Wenn bestritten wird,dass das, was der Nationalrat da beschlossen hat, stimmt,dann muss man dem Nationalrat explizit folgen – denn wennes wirklich so ist, wie Herr Aeby sagt, dann würde das ja heis-sen: Fiat natura et pereat homo. So weit sind wir meines Er-achtens noch nicht. Ich bin der Auffassung, dass der Natio-nalrat in der Sache selbst recht hat – in der Systematik nicht,aber in der Sache schon.Deshalb stelle ich Ihnen den Antrag, bei Absatz 2 dem Natio-nalrat zu folgen.
Rhinow René (R, BL), Berichterstatter: Nur ein kurzes Wortdazu: Herr Aeby hat die Gründe für die Kommission klar dar-gelegt. Auf der Fahne finden Sie keine Anträge einer Minder-heit.Der Stein des Anstosses ist nicht das Wort «möglich». Es istein allgemeiner Grundsatz der Rechtsordnung, dass Unmög-liches nicht verlangt werden kann. Stein des Anstosses istvielmehr, dass die Einwirkungen nicht generell und – überdas Verhältnismässigkeitsprinzip hinausgehend – für alleFälle an die wirtschaftliche Tragbarkeit gebunden sein dür-fen. Wenn wir diese Schranke so generell, wie sie hier formu-liert ist, in die Verfassung aufnehmen, krempeln wir das gel-tende Umweltschutzrecht tendenziell um. Dies würde demGebot der Nachführung widersprechen. Wenn man das tunwollte – was ich nicht tue –, dann sicher nicht im Rahmen derNachführung der Verfassung. Dass im Einzelfall die wirt-schaftliche Tragbarkeit in Abwägungsprozessen eine grosseRolle spielt, ist unbestritten; das sieht auch das Umwelt-schutzgesetz vor.Ich bitte Sie, hier der Kommission zu folgen.
Koller Arnold, Bundesrat: Ich ersuche Sie ebenfalls, derKommission zuzustimmen, an Ihren ursprünglichen Be-schlüssen festzuhalten und die Neuformulierungen des Na-tionalrates abzulehnen. Es ist zwar richtig, dass auch im Be-reich der Vorsorge das Verhältnismässigkeitsprinzip gilt, wiees in Artikel 4 der neuen Verfassung ausdrücklich festgehal-ten ist. Wenn aber nur dieses Verhältnismässigkeitsprinzipgemeint ist, dann müssen wir es hier wie anderswo nichtausdrücklich aufführen, weil das Verhältnismässigkeitsprin-zip generell, bei der gesamten staatlichen Tätigkeit, gilt.Wenn Sie aber mit der wirtschaftlichen Tragbarkeit der Vor-sorge ganz neue Ausdrücke einbringen, dann stellt sich na-türlich zu Recht sofort die Frage – und das wird richtiger-weise auch entsprechend interpretiert –, ob man hier überdas Erfordernis der Verhältnismässigkeit hinausgehen will,und zwar zu Lasten des heute geltenden Umweltschutzrech-tes. Das wäre natürlich gegenüber dem heute geltendenVerfassungsrecht ein ganz klarer Rückschritt; im Rahmen ei-ner Nachführung – das hat der Bundesrat immer gesagt – istes nicht akzeptierbar, hinter das heute geltende Recht zu-rückzugehen.Damit solche Interpretationsprobleme überhaupt nicht auf-kommen, bitte ich Sie, festzuhalten und diese vieldeutigeNeuformulierung des Nationalrates abzulehnen.
Schmid Carlo (C, AI): Nachdem Herr Rhinow über den Be-griff des Möglichen und auch zur wirtschaftlichen Tragbarkeitgesprochen hat und Herr Bundesrat Koller zum Verhältnis-mässigkeitsprinzip das Erforderliche gesagt hat, kann ichden Antrag zurückziehen. Es war mir aber ein Anliegen, dasin den Materialien zu haben, denn sonst wäre unter Umstän-den der Rat Gefahr gelaufen, hier eine negative Norm zuschaffen, wonach die wirtschaftliche Tragbarkeit in Zukunftgar nicht mehr ausdrücklich hätte berücksichtigt werden dür-fen. Ich bin für diese Erklärungen zuhanden des Protokollsdankbar.In diesem Sinne kann ich meinen Antrag zurückziehen.
Angenommen – Adopté
Art. 60 Abs. 1, 4Antrag der KommissionFesthalten
Art. 60 al. 1, 4Proposition de la commissionMaintenir
Aeby Pierre (S, FR), rapporteur: L’article 60 nous a préoc-cupé lors des débats. Cette question de l’eau et de la distinc-tion des compétences entre la Confédération et les cantonsa donné lieu à passablement de discussions.Sur la base d’une proposition Rhyner notamment, nous avi-ons repris tout ce travail en commission. Ce n’est que lorsd’un deuxième débat que nous avons finalement décidé demodifier – pour faire un pas dans le sens des cantons – aussibien l’alinéa 1er pour dire très clairement que «la Confédéra-tion pourvoit à l’utilisation rationnelle des ressources eneau», mais dans les limites de sa compétence, que l’alinéa 4qui reprend cette notion de limitation de la compétence de laConfédération.Le Conseil national n’a visiblement pas prêté une grande at-tention à toutes les sensibilités cantonales qui étaient là-der-rière.La solution que nous avions retenue en première délibéra-tion, qui était déjà une solution de compromis qui ne donnaitpas entière satisfaction à certains représentants de cantonsriches en eau et qui exploitent notamment l’énergie hydro-électrique, doit à mon sens – c’est aussi l’avis de la commis-sion, à l’unanimité – être maintenue.C’est d’ailleurs la raison pour laquelle la commission vouspropose de maintenir la première décision de votre Conseil,qui avait été prise après mûre réflexion et un très large débat,aussi bien à l’alinéa 1er qu’à l’alinéa 4.
Angenommen – Adopté
Art. 63Antrag der KommissionZustimmung zum Beschluss des NationalratesProposition de la commissionAdhérer à la décision du Conseil national
Aeby Pierre (S, FR), rapporteur: En première délibération,nous avions biffé la deuxième partie de la phrase, celle quidit: «.... notamment à la sauvegarde de la diversité des espè-ces de poissons, de mammifères sauvages et d’oiseaux.»Notre argumentation était que ces éléments sont déjà conte-nus dans l’article 62 alinéas 2 à 4, et qu’il s’agissait d’une ré-pétition. Il semble néanmoins que ça ait déclenché le réveilde sensibilités au Conseil national, que ça ait donné lieu à undébat, en tout cas en commission, assez riche. On a soup-çonné le Conseil des Etats d’avoir une intention politique ca-chée en biffant ce deuxième élément de phrase. Il est vraiaussi que depuis nous avons admis, mon Dieu, en plusieursendroits des concessions de nature rédactionnelle, pourautant que ces concessions soient faites dans l’esprit de lamise à jour. Et tant pis si la rigueur juridique est un peu moin-dre.La commission vous propose de vous rallier à la décision duConseil national, donc au projet du Conseil fédéral, pour nepas traîner plus avant une divergence qui n’est somme touteque rédactionnelle, compte tenu de ce qu’on trouve à l’arti-cle 62.
Angenommen – Adopté
4. Abschnitt TitelAntrag der KommissionFesthalten
Section 4 titreProposition de la commissionMaintenir
21. September 1998 S 177 Bundesverfassung. Reform
Amtliches Bulletin der Bundesversammlung / Separatdruck
Aeby Pierre (S, FR), rapporteur: Notre Conseil a divisé lasection 4 en deux parties bien distinctes, considérant que lestravaux publics et les transports – c’est la première partie,c’est notre section 4 – pouvaient fort bien constituer un corpshomogène et indépendant, qu’il ne fallait pas forcément en-chaîner avec l’énergie et les communications, qui pouvaienttrès bien faire l’objet d’une section indépendante. C’étaitaussi notre façon de marquer l’importance de tout ce qui con-cerne l’énergie et les communications.Je vous propose de maintenir cette systématique et d’avoircette dualité: «Section 4: Travaux publics et transports» et«Section 4a: Energie et communications».Le Conseil fédéral s’est déjà rallié à cette systématique et leComité de médiation que nous avons avec le Conseil natio-nal va aussi faire la proposition de se rallier à cette subdivi-sion de la section 4 en deux parties.
Angenommen – Adopté
Art. 71Antrag der KommissionFesthaltenProposition de la commissionMaintenir
Aeby Pierre (S, FR), rapporteur: La divergence entre le Con-seil national et notre Conseil est importante: c’est la questiondes téléfériques.Le Conseil national a souhaité introduire les téléfériquesdans la compétence de la Confédération. Nous avons prispar prudence l’avis de la Conférence des gouvernementscantonaux, qui nous a fait connaître son opposition totale aufait de faire de cette compétence aujourd’hui cantonale unecompétence fédérale. En pratique, ça n’est pas fondamental,car les législations en matière d’aménagement du territoire etde protection de l’environnement – qu’il s’agisse de la légis-lation forestière, sur la protection des paysages et des sites,sur la protection de l’eau – suffisent pour que l’on ne puissevioler le droit fédéral en construisant un téléférique.Il s’agit là d’un aspect plus psychologique, et, en consé-quence, votre commission vous propose de maintenir votredécision prise en première délibération, considérant qu’il estinutile de déclarer la guerre aux cantons pour une telle ques-tion.
Angenommen – Adopté
Art. 72Antrag der KommissionFesthalten
Antrag OnkenZustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Art. 72Proposition de la commissionMaintenir
Proposition OnkenAdhérer à la décision du Conseil national
Aeby Pierre (S, FR), rapporteur: Lors du premier débat con-cernant l’article 72, nous avions considéré que la premièrephrase de l’alinéa 1er était largement suffisante: «La Confé-dération fixe les principes applicables aux réseaux de che-mins et de sentiers pédestres.» En ce qui concerne «l’amé-nagement et l’entretien de ces réseaux» qui «relèvent de lacompétence des cantons», il nous avait semblé que cetteprécision était tout à fait inutile et qu’elle allait de soi.En ce qui concerne l’alinéa 2, la divergence est plutôt rédac-tionnelle. Il s’agit d’une différence de systématique. En re-vanche, la phrase concernant le remplacement des cheminset sentiers que la Confédération serait obligée de supprimertombe dans la version de notre Conseil.
Les débats en commission n’ont pas été extrêmement richessur cet objet. Notre commission a tout de même décidé deproposer de maintenir la décision de notre Conseil, considé-rant que:1. par simplification, nous pouvions sans autre biffer ladeuxième phrase de l’alinéa 1er et l’alinéa 3;2. selon la maxime «de minimis non curat praetor», le faitd’être trop précis concernant les sentiers pédestres et lesaménagements de ces sentiers dans une Constitution fédé-rale était quelque chose qui serait incompréhensible d’iciquelques années;3. nous sommes dans un chapitre qui traite des travaux pu-blics et des transports, et ces sentiers pédestres ont peu àvoir avec les problèmes de transport, de pendularisme et toutce qui en découle concernant l’organisation de la mobilitédans notre pays.C’est la raison pour laquelle notre commission vous proposede maintenir notre décision et de ne pas nous rallier à la ver-sion du Conseil national.
Onken Thomas (S, TG): Ich schicke voraus, dass ich immerein Befürworter einer sehr offenen und grosszügigen Inter-pretation der Nachführung gewesen bin und mich damals,noch als Mitglied der Kommission, entsprechend ausgespro-chen habe und dass ich auch hier bei den Abstimmungen im-mer für diese generösere Interpretation der Nachführung ein-getreten bin. Allerdings bin ich damit sehr oft unterlegen, weilsich der Bundesrat und unsere Kommission sehr dezidiert füreine doch vergleichsweise restriktive Auslegung der Nach-führung ausgesprochen haben, mit den bekannten Argumen-ten, die hier nicht wiederholt werden müssen. Vielleicht istdas ja auch eine gute Lösung, die dem wichtigen Anliegendieser Verfassungsnachführung schliesslich zum Erfolg ver-helfen wird.Aber warum soll dieser Grundsatz nun gerade bei dieser Ver-fassungsbestimmung keine Gültigkeit haben? Warum soll erzumindest derart markant geritzt werden? Unsere Kommis-sion, meine ich, geht mit dieser Bestimmung von Artikel 72ziemlich unsanft um. Sie ändert sie deutlich ab und weicht ih-ren Inhalt auf. Das finde ich nicht richtig. Wir haben es zwarin der ersten Beratung so entschieden. Aber nun, nachdemder Nationalrat mit 68 zu 37 Stimmen beschlossen hat, ander ursprünglichen bundesrätlichen Formulierung festzuhal-ten, und wir in einem Differenzbereinigungsverfahren sind,verstehe ich nicht, warum man in Prestige machen und ander ständerätlichen Lösung festhalten will.Ich schlage Ihnen vor – um das vorwegzunehmen –, dass wirauf den Entwurf des Bundesrates zurückgehen, dass wir alsodem Nationalrat folgen und damit eine Differenz aus der Weltschaffen.Worum geht es? Es geht um die Fuss- und Wanderwege.Dazu ist erst einmal zu sagen: Es geht um eine Bestimmung,die durch eine Volksinitiative in die Verfassung getragen wor-den ist, und zwar durch ein sehr klares Volksmehr. Das ge-bietet, meine ich, allein schon einen gewissen Respekt vor ei-ner Bestimmung, die zudem auch neueren Datums ist.Warum sie also abändern? Der Bundesrat war gut beraten,uns eine Formulierung vorzuschlagen, die nahe bei der heutegeltenden bleibt und ihre wesentlichen Grundsätze erneutzum Tragen bringt.Die Kommission schlägt uns nun vor, konsequent bei der Lö-sung zu bleiben, die wir in der ersten Beratungsrunde ange-nommen haben. Dabei geht es um zwei Eingriffe in Artikel 72:1. In der ständerätlichen Fassung fehlt der Satz: «Für Anlageund Erhaltung dieser Netze sind die Kantone zuständig.»Dieser explizite Satz ist nicht mehr enthalten, er taucht nurnoch indirekt in Absatz 2 auf, wo es heisst: «Der Bund kannMassnahmen der Kantone zur Anlage und Erhaltung dieserNetze unterstützen und koordinieren.»Das heisst: Die Kantone sind zuständig, der Bund kann koor-dinierend und unterstützend eingreifen. Aber der eigentliche,unmittelbare Satz über die Zuständigkeit, der ja auch eine ArtAuftrag beinhaltet, wird gestrichen. Ich bedaure dies, kanndamit aber einigermassen leben; mit der Streichung des Ab-satzes 3 hingegen nicht.
Constitution fédérale. Réforme 178 E 21 septembre 1998
Bulletin officiel de l’Assemblée fédérale / Tiré à part
Absatz 3 lautet im bundesrätlichen Entwurf: «Der Bundnimmt bei der Erfüllung seiner Aufgaben Rücksicht auf Fuss-und Wanderwegnetze, und er ersetzt Wege, die er aufhebenmuss.»Dieser Satz soll ganz gestrichen werden. Warum? Er enthältdoch im Grunde genommen einen wesentlichen Grundsatz. Esgeht um die Erfüllung von Bundesaufgaben, bei denen mitun-ter auch in die Substanz dieses Wanderwegnetzes eingegrif-fen werden muss. Es geht darum, festzuhalten, dass dort, woes unabdingbar ist, dass ein Weg aufgehoben wird, für Ersatzgesorgt werden muss. Das, meine ich, ist ein klarer Auftrag,wie er heute in der Verfassung steht. Das sollte so bleiben.Wir haben mit dieser Bestimmung nur gute Erfahrungen ge-macht. Gestützt auf diese Verfassungsbestimmung ist in die-sem Land viel bewirkt worden, nicht nur an Erschliessung,sondern auch an Koordination, an kantonsgrenzenüber-schreitender Vereinheitlichung des Wanderwegnetzes. Des-halb meine ich: Wir sollten bei der an sich bewährten Bestim-mung bleiben. Wie diese zu interpretieren ist, ist ohnehin Ge-genstand der Beratungen über den neuen Finanzausgleich.Wir dürfen bei der Nachführung nicht eine derart gewichtigeÄnderung vornehmen. Dies geht weit über die Nachführunghinaus. Ich schlage Ihnen vor, dass wir bei der bundesrätli-chen Formulierung bleiben, uns dem Nationalrat anschlies-sen und damit diese Differenz aus dem Weg räumen.Vielleicht könnte der Präsident über die Absätze 1 und 2 so-wie 3 gesondert abstimmen lassen, so, wie das in der Kom-mission der Fall war. Denn man kann sich bei den Absätzen1 und 2 vielleicht der ständerätlichen Lösung anschliessen,Absatz 3 aber durchaus im Verfassungstext behalten. Ichglaube sogar, dass dies ein vernünftiger Kompromiss wäre.Lieber wäre mir jedoch, wenn man ganz auf den Entwurf desBundesrates zurückginge.
Rhinow René (R, BL), Berichterstatter: Ich möchte nur fest-halten, dass es nicht die Meinung der Kommission war, indieser Sache eine Abschwächung zu bewirken, also vom Tu-gendpfad der Nachführung auch nur ein Jota abzuweichen.Die wesentlichen Bestandteile sind übernommen. Die Grund-satzkompetenz des Bundes ist unbestritten.Es ergibt sich bereits aus der Natur einer Grundsatzkompe-tenz, wenn sie sich auf Fuss- und Wanderwegnetze bezieht,dass die Anlage und Erhaltung der Netze selbst nicht in dieseKompetenz fallen. Die Kantone sind und bleiben zuständig.Wie Herr Onken auch eingeräumt hat, wird dieser Grundsatzin Absatz 2 aufgenommen, indem der Bund – die Förde-rungskompetenz ist die zweite substantielle Sache hier –Massnahmen der Kantone zur Anlage und Erhaltung dieserNetze unterstützen und koordinieren kann.Der Streit, der jetzt offenbar entbrannt ist, besteht in derFrage, ob Absatz 3 verfassungswürdig ist. Darüber kann mansicher geteilter Meinung sein. Für die Kommission war esnicht ganz einleuchtend, dass die Rücksichtnahme auf jedeskleine Fussweglein nun wirklich ein zentrales Verfassungs-anliegen sein soll. Darüber kann man wirklich streiten, auchwenn man nichts am heutigen Rechtszustand ändern will.Eine Herabstufung gewisser Verfassungsnormen auf Geset-zesebene haben wir im Interesse einer gewissen Einheitlich-keit der Verfassung und der Reduktion des Verfassungstex-tes auf die wirklich wichtigeren Bestimmungen noch undnoch vorgenommen.Es ist an Ihnen zu beurteilen, ob Sie diesen Absatz 3 als ver-fassungswürdig ansehen. Wenn ja, lassen Sie ihn drin. DieKommission war der Meinung – ohne substantiell etwas än-dern zu wollen –, er sei nicht verfassungswürdig. Aber wir be-zweckten keine Änderung des Rechtszustandes. Ich möchtedas nochmals betonen.
Koller Arnold, Bundesrat: Es geht hier offensichtlich nicht ummaterielle Differenzen. Aus der Sicht des Bundesrates gehtes vor allem um eine Differenzbereinigung. Deshalb möchteich Sie bitten, dem Nationalrat und damit dem Antrag Onkenzuzustimmen.Warum? Der Artikel über die Fuss- und Wanderwege ist übereine Volksinitiative in die Verfassung hineingekommen. Wir
haben uns generell immer daran gehalten, dass wir bei neue-ren Artikeln – seien sie über Volksinitiativen oder über Parla-mentsvorschläge in die Verfassung aufgenommen worden –am Text möglichst wenig ändern sollten. Wir sollten solcheArtikel, die jüngst Gegenstand einer Volksabstimmung undeiner Ständeabstimmung waren und die eindeutig angenom-men worden sind, möglichst unverändert in die neue Verfas-sung übernehmen. Wir haben das beispielsweise beim äs-thetisch zweifellos auch nicht schönen Artikel über die Fort-pflanzungs- und Gentechnologie, beim Alpenschutzartikelund bei vielen anderen neuen Artikeln so gehalten. Weil jüng-ste Volksentscheide dahinterstehen, wollten wir möglichstnicht an den Formulierungen «herumdoktern». Rein juristischhätte Ihre Formulierung sicher vieles für sich, aber wir solltenuns an das Prinzip halten, dass wir bei jungen Artikeln mög-lichst wenig ändern.Weil wir jetzt im Differenzbereinigungsverfahren sind und derNationalrat den Vorteil hat, dass er näher am Text dieserVolksinitiative bleibt, möchte ich Sie bitten, dem Nationalratund damit dem Antrag Onken zuzustimmen.
Abs. 1, 2 – Al. 1, 2
Abstimmung – VoteFür den Antrag der Kommission 24 StimmenFür den Antrag Onken 12 Stimmen
Abs. 3 – Al. 3
Abstimmung – VoteFür den Antrag der Kommission 24 StimmenFür den Antrag Onken 12 Stimmen
Abschnitt 4a TitelAntrag der KommissionFesthalten
Section 4a titreProposition de la commissionMaintenir
Präsident: Die Überschrift über Abschnitt 4a ist bereits be-reinigt.
Angenommen – Adopté
Art. 75
Rhinow René (R, BL), Berichterstatter: Artikel 75 steht ansich nicht mehr zur Diskussion. Es gibt hier keine Differenz.Aber die Verfassungskommission des Nationalrates hat be-schlossen, auf diesen Artikel zurückzukommen. Damit beiArtikeln, die keine Differenz mehr aufweisen, ein solchesRückkommen möglich ist, müssen beide zuständigen Kom-missionen zustimmen. Die ständerätliche Kommission hatdiesen Antrag noch nicht behandelt. Ich möchte Sie einfachdarüber ins Bild setzen, dass wir darüber beraten werden.Die Kommission des Nationalrates möchte wieder auf die ur-sprüngliche Formulierung des Bundesrates zurückkommen,die da lautete, das «Post- und Fernmeldewesen» sei Sachedes Bundes, und nicht – wie wir beschlossen haben – die«Gesetzgebung über das Post- und Fernmeldewesen» seiSache des Bundes. Sie werden wahrscheinlich später nochmit dieser Frage konfrontiert werden.
Art. 76 Abs. 2Antrag der KommissionFesthalten
Antrag PlattnerZustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Art. 76 al. 2Proposition de la commissionMaintenir
21. September 1998 S 179 Bundesverfassung. Reform
Amtliches Bulletin der Bundesversammlung / Separatdruck
Proposition PlattnerAdhérer à la décision du Conseil national
Aeby Pierre (S, FR), rapporteur: A l’article 76 alinéa 2, il y aune divergence entre la version du Conseil national et la nô-tre qui correspond à la version du projet du Conseil fédéral.Le Conseil national a ajouté, à l’alinéa 2, la notion de «forma-tion» («Bildung»): «La radio et la télévision contribuent au dé-veloppement de la culture et de la formation ....» Notre com-mission a considéré que la «formation» ou la «libre forma-tion» étaient incluses dans la notion générale de culture.C’est la raison pour laquelle nous vous proposons de main-tenir notre décision.
Plattner Gian-Reto (S, BS): Ich bitte Sie, dem Beschluss desNationalrates zuzustimmen. Meine wesentliche Motivationfür diesen Antrag ist die folgende: Ich glaube, dass die Bil-dung in den Auftrag an Radio und Fernsehen gehört. Wieschon im Nationalrat richtigerweise bemerkt wurde, sitzenSchulkinder heute erfahrungsgemäss mehr Stunden vor demFernseher als vor dem Lehrer. Damit ist eines klar: Wennman, vor allem in der Jugendarbeit, Bildung vermitteln will, istes sehr sinnvoll, diese auch im Auftrag an die Fernsehanstal-ten festzuhalten.Es ist nicht so, dass das Fernsehen keine bildenden Sendun-gen böte. Aber es ist in den letzten Jahren immer wieder fest-zustellen gewesen, dass unter dem Druck der Konkurrenzund der Notwendigkeit zur Verkürzung und einfachen Dar-stellung von Sachverhalten gerade die Bildungssendungengelitten haben. Es ist auch typisch, dass vor einigen Jahrendie SRG-Abteilung, die diesen Auftrag hatte, ohne Ersatzaufgelöst worden ist.Der Vorschlag, die Bildung in diesen Artikel hineinzunehmen,stammt nicht von sozialdemokratischer Seite, sondern wurdeim Nationalrat von Frau Langenberger und Herrn Tschoppeingebracht. Ich hoffe, dass Sie sich auch im Interesse derBereinigung von Differenzen entschliessen können, dem Be-schluss des Nationalrates zuzustimmen.Ich gebe zwar zu, dass die sprachliche Formulierung, die derNationalrat gewählt hat, nicht absolut optimal ist. «Entfaltungder Bildung» – da muss man sich zuerst ein Bild machen,was das genau heissen soll. Aber der wesentliche Punktscheint mir doch zu sein, dass die Bildung im Auftrag an dieMedien verankert wird.Ich bitte Sie, dem Beschluss des Nationalrates zu folgen.
Simmen Rosemarie (C, SO): Ich möchte Sie ebenfalls sehrbitten, hier dem Beschluss des Nationalrates zuzustimmen,und zwar auch aus folgendem Grund:Es geht nicht nur um Kinder – obwohl das sehr wichtig ist,und, wie Herr Plattner richtig gesagt hat, Kinder auch in derSchweiz sehr viel Zeit vor dem Fernseher verbringen –, son-dern es geht um unsere ganze Gesellschaft, die je länger, jemehr zu einer Freizeitgesellschaft wird und sich wesentlichüber die modernen elektronischen Medien informiert. Hiergeht es einfach nicht an, dass sich eines der Leitmedien un-serer Zeit, nämlich das Fernsehen, aus dem Bildungsauftragausklinkt – handle es sich um berufliche Weiterbildung,handle es sich um persönliche Weiterbildung. In einer Zeit, inder gesellschaftliche Probleme ausserordentlich komplexsind, ist es unbedingt nötig, dass hier sämtliche Medien andiesem Strick ziehen. Ich denke, dass es gerade auch Sacheder konzessionierten Medien – z. B. des konzessioniertenFernsehens – ist, hier ihren Beitrag zu leisten. Das mag nichtzu einer Einschaltquote von 50 Prozent führen, aber geradesolche Sektoren, die ausserordentlich wichtig sind, gehörenin ein modernes Medium.Ich bitte Sie deshalb ebenfalls, hier dem Beschluss des Na-tionalrates zuzustimmen.
Rhinow René (R, BL), Berichterstatter: Ich wäre – schon vonBerufes wegen – der letzte, der sich nicht für Bildung enga-gieren würde. Ich habe auch viel Verständnis für das Anlie-gen. Ich bedaure nur, dass diejenigen, die sich jetzt für die-sen Antrag einsetzen, nicht mit einer neuen Formulierung
aufwarten. Denn wir können mit gutem Gewissen nicht in dieVerfassung schreiben, es solle die Bildung «entfaltet» wer-den. Wenn schon, wäre Bildung «zu fördern», oder das Fern-sehen hätte «zur Bildung beizutragen». Man kann in diesemBereich einiges tun, aber die Bildung «entfalten» kann manbeim besten Willen nicht. Wenn wir keine Differenz schaffen,ist es schwierig, der Redaktionskommission eine solcheFrage auf Verfassungsstufe zu überlassen.Deshalb zögere ich etwas, hier klein beizugeben; denn in derKommission war dieses Moment, die Frage der Formulie-rung, für unsere Haltung mitentscheidend. Ich bedaure also,dass diejenigen, die die Bildung aufnehmen wollen, nicht miteiner besseren Formulierung aufwarten, die es manchemleichter gemacht hätte, diesem Antrag zuzustimmen.
Plattner Gian-Reto (S, BS): Wenn wirklich die sprachlicheUnebenheit, die ich auch sehe, das Problem sein sollte, dannmeine ich, dass man auf den Ausdruck, den schon der Bun-desrat gebraucht hat, zurückgehen könnte, nämlich auf denAusdruck «kulturelle Entfaltung» statt «Entfaltung von Kul-tur». Man könnte also formulieren: «Radio und Fernsehentragen zur kulturellen Entfaltung, zur Bildung, zur freien Mei-nungsbildung und zur Unterhaltung bei.» Den doppelten Ge-brauch des Wortes «Bildung» kann die Redaktionskommis-sion sicher noch verbessern. Das wäre ein klarer Entscheid,der wenigstens verhindern würde, dass wir einen Verfas-sungsinhalt aus sprachlichen Gründen wegliessen.
Präsident: Da wir hier keine Kommissionssitzung durchfüh-ren können, mache ich Ihnen beliebt, die Beratung von Arti-kel 76 bis morgen früh um 8 Uhr auszusetzen. Herr Plattnerhat so die Möglichkeit, einen schriftlichen Antrag einzurei-chen. Wir beginnen dann morgen mit Artikel 76. – Sie sinddamit einverstanden.
Verschoben – Renvoyé
Art. 77Antrag der KommissionFesthaltenProposition de la commissionMaintenir
Angenommen – Adopté
5. Abschnitt Titel, Art. 78, 79, 80–83Antrag der KommissionFesthalten
Section 5 titre, art. 78, 79, 80–83Proposition de la commissionMaintenir
Art. 78a, 79a, 83aAntrag der KommissionStreichenProposition de la commissionBiffer
Präsident: Der 5. Abschnitt ist ebenfalls umgebaut worden.Die Artikel 78 bis 83a sind durch die Artikel 57a ff. ersetztworden. Wir haben darüber nicht mehr zu befinden.
Angenommen – Adopté
Art. 84Antrag der KommissionAbs. 1–3MehrheitFesthaltenMinderheit(Inderkum, Forster, Frick, Marty Dick, Paupe, Rhinow,Spoerry)Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Constitution fédérale. Réforme 180 E 21 septembre 1998
Bulletin officiel de l’Assemblée fédérale / Tiré à part
Abs. 4Streichen
Art. 84Proposition de la commissionAl. 1–3MajoritéMaintenirMinorité(Inderkum, Forster, Frick, Marty Dick, Paupe, Rhinow,Spoerry)Adhérer à la décision du Conseil national
Al. 4Biffer
Aeby Pierre (S, FR), rapporteur: En atteignant cet article 84qui traite de l’Eglise et de l’Etat, nous arrivons à une disposi-tion où, je crois, nous avons déjà très largement discuté. Encommission aussi, nous avons refait tout le débat lors de l’éli-mination de ces divergences, et c’est vrai qu’il y a eu deschangements de point de vue d’un camp vers un autre. Le ré-sultat a été extrêmement serré: 8 voix contre 7 pour le main-tien de notre décision – c’est-à-dire pour biffer la compétencede la Confédération en ce qui concerne la création d’évê-chés – je dis création pour éviter le terme d’érection qui n’estpeut-être pas le plus adéquat à utiliser dans cet alinéa 3.Donc faut-il, oui ou non, biffer cet alinéa 3? C’est toute laquestion que la commission s’est posée, sans trouver vérita-blement de réponse. Il semble qu’une majorité soit convain-cue que cet alinéa 3, juridiquement, n’a aucune raison d’êtredans un article qui traite des relations entre l’Eglise et l’Etat.Mais il y a une forte minorité, dans la commission, qui consi-dère que les sensibilités sont telles encore aujourd’hui, en re-lation avec la question des évêchés, que ce serait une petitefolie que de vouloir, sous un exercice de réforme de la cons-titution qui se veut une simple mise à jour, biffer purement etsimplement cet alinéa 3.Voilà, en gros, les opinions qui se sont confrontées. Je croisqu’ici chacun a l’opinion qui lui vient des réalités socioécono-miques qu’il vit chez lui, dans son canton, dans son parti,parmi ses proches, dans des discussions parfois intermina-bles avec les milieux catholiques, avec les milieux réformés,avec des professeurs d’université et des théologiens.Si bien qu’au nom de la majorité de la commission, je ne peuxque vous proposer, en l’état, de maintenir votre décision, touten attirant votre attention sur les remous que cette diver-gence pourrait continuer à créer et les obstacles que celapourrait entraîner dans l’optique d’un large consensus con-cernant la réforme de la constitution sur laquelle le peuple etles cantons suisses auront à voter l’année prochaine.
Inderkum Hansheiri (C, UR): Herr Aeby hat die Ausgangs-lage dargelegt und insbesondere darauf hingewiesen, dassin der Kommission die Beschlussfassung zuhanden des heu-tigen Plenums sehr knapp ausgefallen sei.Wenn wir im Rahmen der Nachführung Artikel 84 beraten,müssen wir uns davor hüten, unsere Blicke ausschliesslichauf Absatz 3 zu richten. Artikel 84 – bzw. Artikel 50 der beste-henden Verfassung – ist nicht einfach der Bistumsartikel,sondern enthält nur, aber selbstverständlich immerhin einenBistumsabsatz.Absatz 1 von Artikel 84 ist zwar an sich überflüssig, denn dieZuständigkeit betreffend das Verhältnis von Kirche und Staatliegt aufgrund der allgemeinen Zuständigkeitsordnung beiden Kantonen. Absatz 1 hat aber den Zweck, Absatz 2 glei-chermassen einzuleiten. Dieser entspricht inhaltlich Artikel 50Absatz 2 der geltenden Verfassung und hat die Wahrung desöffentlichen Friedens zwischen den Angehörigen der ver-schiedenen Religionsgemeinschaften zum Gegenstand. Ergibt dem Bund eine subsidiäre Kompetenz zur Ergreifungentsprechender Massnahmen. Aus diesem Grunde ist Ab-satz 2, obwohl an sich nicht zwingend, so doch von einer be-stimmten rechtlichen Relevanz und vor allem von politischerBedeutung.
Zu Absatz 3: Von der Sache her – dies kann nicht genügendbetont werden – gehört diese Bestimmung ohne Zweifel nichtin die Verfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft,denn sie enthält zum einen eine Beschränkung der Glau-bens- und Gewissensfreiheit, und sie diskriminiert zum ande-ren im wesentlichen nur eine Konfession, nämlich die rö-misch-katholische. Absatz 3 widerspricht sodann offensicht-lich verschiedenen internationalen Verträgen, insbesonderedem Uno-Pakt II sowie der EMRK, beide punkto Religions-freiheit und Diskriminierungsverbot.Dessenungeachtet können wir nach meiner Auffassungdiese Bestimmung im Rahmen der Nachführung nicht ein-fach streichen, und zwar deshalb, weil eine Streichung einematerielle Änderung bedeuten würde und weil kein Konsensdarüber besteht, dass eine Streichung tatsächlich erfolgensoll. Eine Streichung würde mit Sicherheit nicht zu unter-schätzende, vorab von Emotionen getragene Widerständeauslösen, die in Kumulation mit anderen Kräften die Revisi-onsvorlage gefährden könnten.Gestatten Sie mir abschliessend eine persönliche Bemer-kung: Obwohl ich Ihnen beantrage, diesen Artikel und insbe-sondere Absatz 3 im Rahmen der Nachführung nicht zu strei-chen, möchte ich klar darauf hinweisen, dass der Bistumsab-satz so bald wie möglich aus der Verfassung der Schweize-rischen Eidgenossenschaft verschwinden muss. Aus diesemGrunde postuliere ich, dass die parlamentarische InitiativeHuber, welcher wir am 12. Juli 1975 Folge gegeben haben,die aber offenbar mit Blick auf die Reform der Verfassung si-stiert wurde, wiederaufgenommen wird, so dass im Rahmeneiner Partialrevision über diese Frage abgestimmt werdenkann.
Cottier Anton (C, FR): Je demande que l’on vote séparémentsur chaque alinéa de cette disposition. En effet, sur certains,je partage l’avis exprimé par M. Inderkum. Je m’exprime doncexclusivement sur l’alinéa 3 où je soutiens la majorité de lacommission.La minorité de la commission s’oppose à l’abolition de l’alinéasur les évêchés bien qu’elle dise par la bouche de son porte-parole, M. Inderkum, que sur le fond cette disposition est con-traire à la constitution, voire qu’elle viole la liberté de cons-cience et de religion. En outre – cela est notamment ressortides débats en commission –, elle estime que cette suppres-sion de l’alinéa 3 ne serait pas couverte par la mise à jour. Jene partage pas cette avis.La mise à jour est en effet admise lorsque, entre autres critè-res, un projet ou une disposition a fait l’objet d’un vote parle-mentaire antérieur. La mise à jour est aussi admise lorsquela doctrine dominante opte en faveur d’un projet ou d’une so-lution. En l’état, la suppression de l’alinéa sur les évêchés quifut introduit à une période très virulente du Kulturkampf est unvieux postulat parlementaire. Déjà en 1964, il y a donc plusde 34 ans de cela, M. Ackermann, conseiller national radical,l’avait demandée et son postulat fut accepté. Seulement huitans après, en 1972, une motion fut adoptée, à l’unanimité,par les Chambres, qui demandait la suppression de la dispo-sition incriminée. Ensuite, à partir de 1994, les interventionsparlementaires se succèdent à un rythme soutenu. En 1994,le Conseil fédéral en répondant à une interpellation Leubapropose d’abroger cet article. Je passe sur l’initiative parle-mentaire que nous avons traitée ici.Au vu de ces nombreux votes parlementaires, tous favora-bles – certains même à l’unanimité – à la suppression decette disposition, la proposition de la majorité de la commis-sion à l’alinéa 3 répond pleinement aux conditions d’une miseà jour. Cela est d’autant plus vrai que, selon des avis autori-sés la disposition sur les évêchés est contraire aux droits del’homme, notamment à la Convention des droits de l’hommeet au Pacte ONU II. Il n’y pas de doute à ce sujet.Notre ancien collègue M. Jean-François Aubert de Neuchâ-tel, cet éminent constitutionnaliste, qualifiait dans sa pre-mière édition de son «Traité du droit constitutionnel suisse»cet article de franchement discriminatoire. Ce qui retient cer-tains de biffer cet article – je respecte aussi cet avis –, ce sontdes motifs d’ordre tactique. «La nouvelle constitution passe-
21. September 1998 S 181 Bundesverfassung. Reform
Amtliches Bulletin der Bundesversammlung / Separatdruck
rait mieux devant le peuple, sans cette abolition!» dit-on. Est-ce suffisant pour justifier la présence dans la nouvelle cons-titution d’une disposition franchement discriminatoire? Je nele pense pas. Une nouvelle constitution qui contiendrait desdispositions discriminatoires ne mériterait guère notre sou-tien.Je vous invite dès lors à soutenir à l’alinéa 3 la propositionnon discriminatoire de la majorité de la commission.
Koller Arnold, Bundesrat: Sie kennen die ganze Problematikdieses Artikels, ich muss darauf nicht mehr im einzelnen zu-rückkommen.Immerhin haben die vielen öffentlichen Stellungnahmen ganzklar gezeigt, dass es staatspolitisch ein Fehler wäre, auf dieAbsätze 1 und 2 zu verzichten. Denn damit würden wir viel-leicht rechtlich nichts aufgeben, wir würden aber staatspoli-tisch das ganze Verhältnis von Kirche und Staat aus der Ver-fassung herausnehmen, was alle Religionen und alle Religi-onsangehörigen offensichtlich als Nachteil empfinden wür-den. Ich möchte Sie daher bitten, auf jeden Fall den Absätzen1 und 2 klar zuzustimmen.Nun komme ich zum sogenannten Bistumsartikel, zur Vor-schrift, dass die Errichtung neuer Bistümer der Genehmigungdurch den Bund bedarf. Es ist unbestritten, dass dieserAbsatz 3 sowohl unter dem Gesichtspunkt unserer Verfas-sung – also grundrechtlich – wie auch unter dem Gesichts-punkt mehrerer internationaler Verträge, die wir abgeschlos-sen haben, eindeutig problematisch ist. Denn er verstösst ge-gen die Religionsfreiheit, die wir in unserer eigenen Verfas-sung verankert haben. Weil er vor allem die katholischeKonfession betrifft, ist er auch diskriminierend und verstösstdaher gegen das Diskriminierungsverbot sowohl unsererVerfassung als auch gegen die Diskriminierungsverbote bei-spielsweise der Europäischen Menschenrechtskonventionoder des Uno-Paktes über die bürgerlichen Rechte. DieserArtikel muss sicher einmal aus der Bundesverfassung her-ausgenommen werden.Sie haben auch das Instrument dazu: Sie haben vor etwazwei Jahren die Initiative ihres ehemaligen Mitgliedes, HerrnHubers, die auf Streichung dieses Absatzes 3 lautet, ange-nommen. Allerdings, und das war für mich natürlich – HerrCottier – signifikant: Dieser Initiative Huber wurde nur mit 16zu 14 Stimmen Folge gegeben. Das zeigt dem Bundesrat, wieheikel dieser Vorschlag ist, auch wenn er juristisch noch sobegründet ist. Kommt dazu, dass sich die Situation, seit derInitiative Huber Folge gegeben wurde, nicht verbessert hat.Durch die Vorkommnisse im Bistum Chur ist dieses ganzeProblem in unserem Volk wieder sehr emotionell geworden.Ich habe feststellen müssen, dass nicht nur Angehörige an-derer Konfessionen, sondern auch mehrere Angehörige derkatholischen Konfession ausdrücklich wünschen, dass die-ser Artikel im Rahmen der Nachführung nicht gestrichenwird. Ich bin deshalb der Überzeugung, dass es ein Gebotder politischen Klugheit ist, diese Nachführungsvorlage nichtmit der Streichung dieses Artikels zu belasten. Das müssenwir – ähnlich wie die Kantonsklausel, wir werden morgen dar-auf zu sprechen kommen – in einer separaten Vorlage, in ei-ner klassischen Teilrevision, an die Hand nehmen. Dennwenn Sie mehrere derartig emotionelle Belastungen in derVorlage belassen, dann laufen Sie Gefahr, dass schon derStart für diese Verfassungsreform scheitert.Wenn nämlich diese Nachführung scheitert, dann braucht esnicht viel Phantasie, um sich auszurechnen, dass auch alleReformpakete gescheitert sind, weil dann die Systematik desganzen Prozesses nicht mehr stimmt. Deshalb bitte ich Sieals ein Gebot der politischen Klugheit, diesen Absatz 3 – beialler Problematik, die er in sich birgt – in der Verfassung zubelassen, weil er immerhin geltendes Recht ist.Schliesslich noch ein Wort zu Absatz 4, den der Nationalrateingefügt hat: Ich bitte Sie, Absatz 4 zu streichen. Er ist näm-lich vollständig überflüssig, denn in Artikel 32 wird klar ge-sagt, welches die Voraussetzungen für Grundrechtsein-schränkungen sind; deshalb müssen wir das nicht bei diesemspeziellen Artikel noch einmal ausdrücklich festhalten. Arti-kel 32 der Verfassung gilt auch hier.
In diesem Sinne bitte ich Sie, der Vorlage des Bundesratesmit den drei Absätzen, so, wie wir Ihnen das vorgeschlagenhaben, zuzustimmen.
Abs. 1 – Al. 1
Abstimmung – VoteFür den Antrag der Minderheit 26 StimmenFür den Antrag der Mehrheit 8 Stimmen
Abs. 2 – Al. 2
Abstimmung – VoteFür den Antrag der Minderheit 27 StimmenFür den Antrag der Mehrheit 4 Stimmen
Abs. 3 – Al. 3
Abstimmung – VoteFür den Antrag der Mehrheit 19 StimmenFür den Antrag der Minderheit 19 Stimmen
Präsident: Angesichts des Umstandes, dass es zu vermei-den gilt, die Nachführung der Bundesverfassung mit einersolch brisanten Frage zu belasten, gebe ich meine Stimmeder Minderheit.
Mit Stichentscheid des Präsidentenwird der Antrag der Minderheit angenommenAvec la voix prépondérante du présidentla proposition de la minorité est adoptée
Abs. 4 – Al. 4Angenommen – Adopté
Art. 85Antrag der KommissionAbs. 1, 2, 2terZustimmung zum Beschluss des NationalratesAbs. 3.... der Wirtschaftsfreiheit, insbesondere auch Massnahmen,die ....
Art. 85Proposition de la commissionAl. 1, 2, 2terAdhérer à la décision du Conseil nationalAl. 3.... économique, notamment également les mesures mena-çant la concurrence, prévues ....
Aeby Pierre (S, FR), rapporteur: Nous entrons ici dans lasection 6 qui traite de l’économie. A l’article 85, la différencequi subsiste entre la version du Conseil national et la nôtretient à l’alinéa 3.A cet alinéa, la commission a voulu que les dérogations auprincipe de la liberté économique, prévues par la constitutionou fondées sur des droits régaliens cantonaux, soient préci-sées et qu’on intègre notamment les mesures menaçant laconcurrence. En effet, les dérogations au principe de la li-berté économique peuvent être nombreuses. Il a semblé quede mentionner très précisément qu’il s’agit ici avant tout desmesures qui menacent la concurrence était judicieux.En ce sens, la commission vous propose de maintenir, à l’ali-néa 3, son point de vue de la première délibération, avec lerajout de l’adverbe «également»: «.... notamment égalementles mesures menaçant la concurrence ....», ceci dans l’opti-que de faire un petit pas en direction de la version du Conseilnational.
Angenommen – Adopté
Art. 88a, 90Antrag der KommissionFesthalten
Constitution fédérale. Réforme 182 E 21 septembre 1998
Bulletin officiel de l’Assemblée fédérale / Tiré à part
Proposition de la commissionMaintenir
Aeby Pierre (S, FR), rapporteur: Je peux me limiter à une re-marque très rapide. Notre commission considère que la dis-position à l’article 88a «Banques et assurances» qui rem-place l’article 90 du projet du Conseil fédéral, doit se trouverimmédiatement après l’article 88 «protection des consomma-teurs». Ensuite, on enchaîne avec l’article 89 «politique mo-nétaire», et l’article 90, dans notre version, est biffé. Il s’agitlà simplement d’une différence de systématique, et le Comitéde médiation des deux Conseils propose de garder la systé-matique de notre Conseil, c’est-à-dire de maintenir.
Angenommen – Adopté
Art. 92, 94aAntrag der KommissionFesthaltenProposition de la commissionMaintenir
Aeby Pierre (S, FR), rapporteur: Les remarques en ce quiconcerne la systématique sont les mêmes que celles que jeviens de faire. Il n’en demeure pas moins qu’il y a une diver-gence de contenu assez importante à l’article 92 alinéa 2 se-lon le projet du Conseil fédéral, qui est pour nous l’article 94a.Nous avons biffé l’alinéa 2 qui est la clause du besoin pourles cafés-restaurants dans les cantons. Nous avons assorti lasuppression de cet alinéa à la disposition transitoire à l’arti-cle 185 chiffre 5a, de manière à donner dix ans aux quelquesrares cantons qui connaissent encore cette clause. Noussommes ici à la frontière, il est vrai, d’une mise à jour, d’une«Nachführung». Néanmoins, la commission a souhaité main-tenir. Compte tenu de la nouvelle loi sur le marché intérieur,des traités internationaux signés par la Suisse, la clause dubesoin n’a plus sa raison d’être et les impératifs de maintiende l’ordre public et de la santé de la jeunesse, de la luttecontre l’alcoolisme, etc., on les obtient aujourd’hui par tout unarsenal législatif. La clause du besoin est donc inutile dans cesens.Si bien que, avec l’adoucissement de la disposition transi-toire que j’ai citée tout à l’heure, la commission vous proposede maintenir cette divergence et de supprimer, dans notreConstitution fédérale, la clause du besoin.
Koller Arnold, Bundesrat: Es geht bei der wirtschaftspoliti-schen Bedürfnisklausel im Gastgewerbe wirklich um eineFrage, die im Ständerat diskutiert werden muss. Wenn Sie –wie Herr Aeby das zu Recht ausgeführt hat – dies in die Über-gangsbestimmung nehmen, dann führen Sie zwei Neuerun-gen ein: Es dürfen ab sofort alle Kantone keine neuen Be-dürfnisklauseln mehr einführen; jene Kantone, die die Be-dürfnisklausel noch haben, müssen sie innert zehn Jahrenabschaffen. Wenn das eine konsensfähige Neuerung ist – ichweiss, dass der Trend in mehreren Kantonen in diese Rich-tung gegangen ist –, dann sperre ich mich nicht dagegen.Aber es entspricht noch nicht dem heute geltenden Recht inallen Kantonen und sollte daher wirklich eine konsensfähigeNeuerung sein.
Angenommen – Adopté
Art. 93 Abs. 2Antrag der KommissionZustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Art. 93 al. 2Proposition de la commissionAdhérer à la décision du Conseil national
Rhinow René (R, BL), Berichterstatter: Ich darf Sie hier dar-auf hinweisen, dass die Kommission bei der Durchsicht imRahmen der Differenzbereinigung eine Ergänzung von Ab-satz 1 beschlossen hat, weil es als Mangel empfunden wor-
den ist, dass der internationale Handel und quasi die «Philo-sophie» der schweizerischen Aussenwirtschaftspolitik, dieHaltung unseres Landes gegenüber dem internationalenHandel, nirgends Aufnahme gefunden haben.Wir haben deshalb in der Kommission beschlossen, Ab-satz 1 mit einem zweiten Satz zu ergänzen. Dieser lautet:«Er (der Bund) setzt sich ein für die Entwicklung des interna-tionalen Handels und der Wirtschaftsbeziehungen.»Da hier keine Differenz vorliegt, haben wir der nationalrätli-chen Kommission den Antrag gestellt, auf diesen Absatz 1zurückzukommen. Die nationalrätliche Kommission hat indieser Sache noch keinen Entscheid gefällt. Deshalb ist dieSache auch für uns noch nicht spruchreif. Ich wollte Sie ein-fach darüber ins Bild setzen: Wenn die nationalrätliche Kom-mission einverstanden ist, werden wir beim nächsten Um-gang über diese Formulierung sprechen.
Angenommen – Adopté
Art. 95 TitelAntrag der KommissionFesthalten
Art. 95 titreProposition de la commissionMaintenir
Aeby Pierre (S, FR), rapporteur: Ici, il ne s’agit que d’intro-duire la notion de «politique agricole» au lieu de celle d’«agri-culture». Cela correspond d’ailleurs à la terminologie utiliséedans l’ensemble du chapitre où l’on parle de «politique struc-turelle», de «politique économique», etc.
Angenommen – Adopté
Die Beratung dieses Geschäftes wird unterbrochenLe débat sur cet objet est interrompu
22. September 1998 S 183 Bundesverfassung. Reform
Amtliches Bulletin der Bundesversammlung / Separatdruck
Zweite Sitzung – Deuxième séance
Dienstag, 22. September 1998Mardi 22 septembre 1998
08.00 h
Vorsitz – Présidence:Zimmerli Ulrich (V, BE)/Iten Andreas (R, ZG)
___________________________________________________________
96.091
Bundesverfassung.ReformConstitution fédérale.Réforme
Fortsetzung – Suite
___________________________________________________________
A1. Bundesbeschluss über eine nachgeführte Bundesverfas-sung (Titel, Art. 1–126, 185) (Fortsetzung)A1. Arrêté fédéral relatif à une mise à jour de la Constitutionfédérale (titre, art. 1–126, 185) (suite)
Art. 76 Abs. 2Neuer Antrag Plattner.... tragen zur Bildung und kulturellen Entfaltung, zur freien ....
Art. 76 al. 2Nouvelle proposition Plattner.... contribuent à la formation et au développement de la cul-ture, à la libre ....
Plattner Gian-Reto (S, BS): Sie erinnern sich: Wir haben ge-stern über die Einführung eines Bildungsauftrages für Radiound Fernsehen gesprochen und scheiterten an einer sprach-lichen Unebenheit. Ich habe nun versucht, einen neuen An-trag zu formulieren, der sprachlich etwas eleganter ist. Es istmir zwar kein fünffüssiger Jambus gelungen, aber doch min-destens ein Heptameter – zwar keine klassische Form, aberimmerhin.Ich lese den Antrag vor: «Radio und Fernsehen tragen zurBildung und kulturellen Entfaltung, zur freien Meinungsbil-dung und zur Unterhaltung bei.»Ich bitte Sie, diesem Antrag zu folgen, damit dem Nationalratinhaltlich zu entsprechen und die Differenz zu bereinigen. Esbleibt dann nur noch eine redaktionelle Differenz, die der Na-tionalrat zweifellos so akzeptieren wird.
Aeby Pierre (S, FR), rapporteur: La commission n’a évidem-ment pas pu se prononcer sur cette formulation. Mais vousavez entendu hier M. Rhinow, président de la commission,exprimer, au nom de la commission, l’avis que c’est surtoutla rédaction maladroite qui avait, dans un premier temps,poussé la commission, sans grande discussion et sans vote,à ne pas vouloir se rallier à la décision du Conseil national. Ilsemble, à mon sens, en tout cas en ce qui concerne le texteallemand – parce qu’il y a moins de problèmes pour le textefrançais – que la proposition Plattner reflète assez exacte-ment la discussion d’hier et qu’elle est susceptible de nouspermettre de nous rallier à la décision du Conseil nationalsur cet article 76 alinéa 2, et d’éliminer une divergence. Celame paraît quand même intéressant dans le processus encours.
Koller Arnold, Bundesrat: Ich kann dieser neuen Formulie-rung zustimmen, zumal ja allen klar ist, dass es sich hier ma-teriell nicht um eine wesentliche Neuerung handelt, denn eswar schon bisher unbestritten, dass die Bildung in der kultu-rellen Entfaltung mit enthalten ist. Aber wir heben sie jetzt zuRecht mehr hervor, und in diesem Sinne stimme ich zu.
Präsident: Zuhanden des Protokolls und der Redaktions-kommission möchte ich festhalten, dass es nach demKomma «zur freien» und nicht «zum freien» heissen muss.
Angenommen – Adopté
Art. 97Antrag der KommissionAbs. 1Zustimmung zum Beschluss des NationalratesAbs. 4Festhalten
Art. 97Proposition de la commissionAl. 1Adhérer à la décision du Conseil nationalAl. 4Maintenir
Aeby Pierre (S, FR), rapporteur: Brièvement, l’article 97 estl’article tel qu’il a été approuvé assez récemment par le peu-ple, lors de la votation populaire du 7 mars 1993, mais quin’est pas encore en vigueur. Le fait qu’il soit suspendu résulted’une disposition transitoire. Il est évident qu’aussi bien leConseil fédéral que les commissions ont abordé cet articleavec la plus grande réserve.Au stade où nous en sommes, il y a deux divergences. Unedivergence que l’on peut considérer, certes, grâce à un cer-tain effort, de nature plutôt rédactionnelle à l’alinéa 1er, etcomme une divergence de contenu à l’alinéa 4.A l’alinéa 1er, le projet du Conseil fédéral parle des jeux dehasard, loteries y comprises. Même si la formulation n’estpas des plus élégantes, cela signifie bien que les loteries sontun type particulier de jeux de hasard et qu’on a éprouvé le be-soin, à juste titre, de les mentionner expressément. Dans laformulation du Conseil national, on parle des jeux de hasardet des loteries. Un esprit mal tourné pourrait en conclure queles loteries ne sont pas des jeux de hasard.Mais enfin, votre commission n’a pas voulu se livrer à cegenre d’exercice sémantique et a décidé, par gain de paix enquelque sorte, de vous proposer de vous rallier à la décisiondu Conseil national.En revanche, à l’alinéa 4, il est apparu clairement à la com-mission qu’elle ne peut pas proposer d’adhérer à la décisiondu Conseil national, car on y précise que les autorisations enmatière de loteries relèvent de la compétence des cantons.Cela signifierait que, si un jour la Confédération entend légi-férer pour des motifs potentiels d’intérêt public ou de législa-tion fédérale uniforme en la matière – ce qui n’est pas son in-tention à l’heure actuelle, mais qui peut être une probabilité –,on ne pourrait le faire sans une modification de la constitu-tion. De l’avis de la commission, cela va beaucoup trop loin,et elle vous propose de maintenir l’alinéa 4 selon le projet duConseil fédéral: «L’admission des appareils à sous servantaux jeux d’adresse qui permettent de réaliser un gain relèvede la compétence des cantons.» Pour le reste, la commissionpropose que l’on reste muet en qui concerne la compétencedes cantons en matière de loteries, de façon à ne pas rendrela tâche trop difficile en vue d’une législation fédéraleaujourd’hui hypothétique, mais peut-être souhaitable un jour.Donc, maintien de votre décision à l’alinéa 4.
Koller Arnold, Bundesrat: Ich bin Ihnen sehr dankbar, dassSie bei Absatz 4 am Entwurf des Bundesrates festhalten. Esgibt keinen Grund, hier eine kantonale Kompetenz auf Geset-zesstufe, an der wir auch nicht «rütteln» wollen, plötzlich aufVerfassungsstufe hinaufzuheben.
Constitution fédérale. Réforme 184 E 22 septembre 1998
Bulletin officiel de l’Assemblée fédérale / Tiré à part
Im Sinne der Differenzbereinigung kann ich jetzt auch Ab-satz 1 zustimmen, vor allem wenn ausdrücklich festgehaltenist, dass auch die Lotterien Glücksspiele sind. In beiden Fäl-len ist ja die Entscheidung über den Gewinn aleatorisch, unddas macht das Wesen der Glücksspiele aus.In diesem Sinne kann ich mich mit den Anträgen der Kom-mission einverstanden erklären.
Angenommen – Adopté
Art. 99 Abs. 1Antrag der KommissionZustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Art. 99 al. 1Proposition de la commissionAdhérer à la décision du Conseil national
Aeby Pierre (S, FR), rapporteur: En ce qui concerne l’alinéa1er de l’article 99 («Encouragement de la construction de lo-gements et de l’accession à la propriété»), la commissionvous propose de vous rallier à la décision du Conseil natio-nal, qui est plus précis et qui reprend la terminologie généra-lement utilisée dans d’autres lois en la matière, ainsi quedans des ordonnances et des textes légaux cantonaux. Onparle donc de «l’activité de maîtres d’ouvrage et d’organisa-tions s’occupant de la construction de logements d’utilité pu-blique».Votre commission vous propose de vous rallier à la décisiondu Conseil national concernant cette modification rédaction-nelle.
Angenommen – Adopté
Art. 100 Abs. 1Antrag der KommissionFesthalten
Art. 100 al. 1Proposition de la commissionMaintenir
Aeby Pierre (S, FR), rapporteur: Dans l’article 100 («Bail àloyer»), le Conseil national a jugé utile d’introduire un élé-ment de phrase parlant de «l’annulabilité des congés abu-sifs». Cette «annulabilité des congés abusifs» est une notionque nous n’avons pas pu éclaircir en commission. Cette pré-cision nous a paru superfétatoire dans la mesure où, quandon dit, comme le projet du Conseil fédéral, que «la Confédé-ration édicte des dispositions contre les abus en matière debail à loyer, notamment contre les loyers et les congés abu-sifs», on englobe bien naturellement toutes les questionsd’annulabilité des congés et de prolongation du bail pour unedurée déterminée.En conséquence, nous vous proposons de rester fidèle autexte du projet du Conseil fédéral et de maintenir notre déci-sion à l’article 100.
Angenommen – Adopté
Art. 101Antrag der KommissionAbs. 1 Bst. abisStreichenAbs. 3Festhalten
Antrag LeumannAbs. 1 Bst. abisZustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Antrag BüttikerAbs. 3Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Art. 101Proposition de la commissionAl. 1 let. abisBifferAl. 3Maintenir
Proposition LeumannAl. 1 let. abisAdhérer à la décision du Conseil national
Proposition BüttikerAl. 3Adhérer à la décision du Conseil national
Aeby Pierre (S, FR), rapporteur: Comme rapporteur de lacommission, je ne vais pas refaire ici un long commentairesur la question de l’interdiction du travail des enfants. Je rap-pellerai simplement que l’opinion dominante de notre Con-seil, jusqu’à ce jour, a été que l’interdiction générale du travaildes enfants était une évidence dans notre pays, que cela dé-coulait de tous les textes internationaux et de toutes les con-ventions internationales signées et ratifiées à ce jour par laSuisse, que cela résultait de plusieurs lois – loi sur le travail,etc. – de notre ordre législatif, et, en conséquence, qu’iln’était pas nécessaire d’ancrer formellement l’interdiction dutravail des enfants dans une constitution de la fin du XXe siè-cle.En commission, nous n’avons pas refait un long débat: levote, sur une commission de 21 membres, a été de 6 voixcontre 2. Le résultat est donc assez peu représentatif. Enconséquence, au nom des huit personnes qui se sont expri-mées ce jour-là, je vous propose de maintenir notre décisionà l’alinéa 1er lettre abis.
Leumann Helen (R, LU): Auch ich muss mich nicht sehrlange und ausführlich äussern. Wir haben in der ersten Bera-tung ja bereits des längeren über das Verbot der Kinderarbeitin der Verfassung diskutiert. Wir sind uns alle einig – auch derBundesrat, glaube ich –, dass dem grundsätzlich nichts ent-gegensteht, haben wir doch bei uns das Verbot der Kinderar-beit geregelt, haben wir es doch auch im Arbeitsgesetz ein-gebaut. Es wurde mehrheitlich diskutiert, dass man im Falle,dass das Verbot der Kinderarbeit in die Verfassung aufge-nommen würde, hineininterpretieren könnte, wir hätten etwaszu korrigieren. Dem ist ja bei weitem nicht so.Nun hat aber der Nationalrat dieses Verbot der Kinderarbeitin die Verfassung aufgenommen. Wir haben hier eine Diffe-renz. Es ist eigentlich unseres Rates unwürdig, wenn wir ineinem längeren Differenzbereinigungsverfahren immer wie-der den Ball hin- und zurückschieben – für oder gegen Verbotder Kinderarbeit.Deshalb möchte ich Sie bitten, dem Nationalrat zu folgen unddas Verbot der Kinderarbeit in die Verfassung aufzunehmen.
Wicki Franz (C, LU): Frau Kollegin Leumann, es tut mir leid,dass wir gegeneinander sprechen müssen. Aber wenn wirnun das Verbot der Kinderarbeit auf Verfassungsebene he-ben, setzen wir ein falsches Signal. Wir haben in derSchweiz – das wurde auch in unserer Kommission von vie-len Mitgliedern betont – kein Problem der Kinderarbeit, wiedies in verschiedenen Ländern der Fall ist. Ein Regelungs-bedarf besteht bei uns nicht. Wir müssen also diese Sachenicht auf die Ebene der Verfassung heben.Dazu kommt, dass wir Ausnahmen machen müssten, wennwir es so in die Verfassung schrieben, wie es der Nationalratvorschlägt. Diese Ausnahmen in einem Gesetz festzulegenwäre sehr schwierig. Ich darf beispielsweise auf unsereLandwirtschaftsbetriebe hinweisen. Ein Kind, das in der Um-gebung eines Landwirtschaftsbetriebes aufwächst, wird au-tomatisch in die Arbeit mit einbezogen. Hier eine Regelungzu treffen in bezug darauf, ob das nun Arbeit ist oder nicht,wäre sehr schwierig. Ein Kind, das in der Umgebung einesLandwirtschaftsbetriebes aufwächst, hilft mit, hilft arbeiten,das ist ein Bestandteil der gesamten Erziehung. Es wäre ge-
22. September 1998 S 185 Bundesverfassung. Reform
Amtliches Bulletin der Bundesversammlung / Separatdruck
rade gegenüber dem bäuerlichen Teil der Bevölkerung einganz falsches Signal, wenn wir in der Verfassung ausdrück-lich das Verbot der Kinderarbeit festhalten würden.
Koller Arnold, Bundesrat: Materiell sind wir uns alle im kla-ren: Das Verbot der Kinderarbeit ist Teil der geltendenschweizerischen Rechtsordnung. Es finden sich sowohl indem für die Schweiz verbindlichen internationalen Recht alsauch im internen Recht entsprechende Vorschriften. Übri-gens hat gerade gestern der Bundesrat beschlossen, einemIAO-Abkommen über Kinderarbeit beizutreten, wo das Min-destalter für Kinderarbeit ausdrücklich auf 15 Jahre festge-legt wird. In der gestrigen Pressemitteilung hat der Bundesratausdrücklich erklärt, dass wir das als Zeichen der Solidaritätmit der internationalen Gemeinschaft im Kampf gegen dieweltweite Kinderarbeit machen. Denn landesintern ist dieKinderarbeit kein Problem mehr, weil wir in unserem nationa-len Recht – im Arbeitsgesetz, im Heimarbeitsgesetz – längstdie entsprechenden Vorschriften haben, so dass es letztlichwirklich um die Opportunität dieses Signals geht. Weltweit istdie Kinderarbeit ein Problem, landesintern ist sie aber sicherkeines mehr. Deshalb ist der Bundesrat nach wie vor der Mei-nung, wir sollten hier eigentlich nicht so tun, als ob es nocheines wäre. Wenn wir dieses Verbot, das im internen und iminternationalen Recht bekräftigt ist, auf Verfassungsstufe he-ben, geben wir das Zeichen, dass das in unserem eigenenLand noch ein Problem sein könnte.Das ist die politische Überlegung, weshalb wir Ihnen Festhal-ten empfehlen.
Abs. 1 Bst. abis – Al. 1 let. abis
Abstimmung – VoteFür den Antrag der Kommission 22 StimmenFür den Antrag Leumann 18 Stimmen
Abs. 3 – Al. 3
Aeby Pierre (S, FR), rapporteur: L’alinéa 3 se rapporte à laquestion du 1er août, jour de la fête nationale férié.Le Conseil national a décidé d’ajouter que «le 1er août, jourde la fête nationale, est payé et assimilé à un dimanche dupoint de vue du droit du travail.» C’est cette question du 1eraoût jour payé qui, aujourd’hui, fait la divergence entre notreConseil et le Conseil national.La commission a décidé de maintenir sa position, qui estcelle de la version du Conseil fédéral, et de ne pas assimilerle 1er août à un jour férié payé, mais simplement à un diman-che, c’est-à-dire non payé.
Büttiker Rolf (R, SO): Ich bitte Sie, dem Nationalrat zu folgenund die unschöne Diskussion über die Bezahlung des 1. Au-gust, unseres Bundesfeiertages, hier und heute zu beenden.Es geht ausschliesslich um die Regelung der Bezahlung. Esist zuzugeben – Herr Bundesrat Koller wird mir sicher bei-pflichten –, dass es «verfassungskosmetisch» unschön ist,wenn wir auch noch die Bezahlung des 1. August in der nach-geführten Verfassung regeln, und dies erst noch mit demAusdruck «arbeitsrechtlich bezahlt». Vielleicht nimmt die Re-daktionskommission noch eine Umformulierung vor. Aber imGrundsatz möchte ich die Bezahlung jetzt klar regeln. Die Be-zahlung des 1. August ist zwar bereits heute in einer Verord-nung geregelt: Im neuen Arbeitsgesetz, über welches wirzwar noch abstimmen müssen, ist die Bezahlung nicht zwin-gend vorgeschrieben. Ob es aber genügt, die Stellung unse-res Bundesfeiertages nur in einer Verordnung zu regeln, isteine andere Frage; doch die ewigen diesbezüglichen Diskus-sionen, bei allen passenden und unpassenden Gelegenhei-ten, machen viele Leute in diesem Lande misstrauisch.Deshalb muss der Verfassungsgeber jetzt endlich Klarheitschaffen. Der reine Wortlaut von Artikel 116bis der heutigenBundesverfassung enthält keine explizite Antwort auf dieFrage der Lohnzahlungspflicht. Aber der Kommentar vonProfessor Paul Richli zu Artikel 116bis der Bundesverfas-sung ist eindeutig: «Die Materialien sprechen deutlich für
eine volle Lohnzahlungspflicht der Arbeitgeber.» Auch derBundesrat hat sich in der Botschaft dieser Haltung ange-schlossen, wenn er schreibt, er teile die Auffassung, dass einarbeitsfreier Bundesfeiertag nur unter Lohnzahlungspflichteingeführt werden könne. Herr Bundesrat Koller hat sich imNationalrat auch in diesem Sinne geäussert. Fazit:1. Die Lohnzahlungspflicht für den 1. August hat heute Gel-tung (Verordnung!). Wir sind im Nachführungsbereich derBundesverfassung und müssen deshalb in dieser emotiona-len Frage, ob uns das passt oder nicht, der heutigen Rege-lung zum Durchbruch verhelfen.2. Der Bundesrat hat sich immer für die Lohnzahlungspflichtder Arbeitgeber für den 1. August ausgesprochen. Ich hoffe,dass das so bleibt.3. Bei der Volksabstimmung von 1993 über die 1.-August-In-itiative der Schweizer Demokraten hat niemand die Lohnzah-lungspflicht bestritten. Eine heutige Infragestellung dieserPflicht verstösst gegen Treu und Glauben.4. Das Festschreiben der Bezahlung des Bundesfeiertageshat auch nach meiner Meinung nicht Verfassungsrang. Aberwenn wir die Vorgeschichte dieses umstrittenen Punkteskennen, kommen wir zum Schluss, dass wir jetzt endlichKlarheit schaffen, Missverständnisse ausräumen und ge-mäss Nationalrat eine Regelung treffen sollten; wobei ich zu-geben muss, dass die gewählte Formulierung nicht unbe-dingt das Gelbe vom Ei ist.
Wicki Franz (C, LU): Ich möchte gerade beim letzten Satzmeines Vorredners anknüpfen: Das Gelbe vom Ei ist dieseFormulierung in keiner Art und Weise.1. Ich bitte Sie, festzuhalten und dem Antrag der Kommissionzu folgen, um hier eine Differenz zu schaffen; denn der For-mulierung – hier rede ich als Ersatzmitglied der Redaktions-kommission von der Formulierung – kann man nicht zustim-men. In unserer Kommission wurde auch darüber diskutiert.Ein Mitglied hat zu dieser Formulierung sogar gesagt, siestamme aus dem Tierbuch. Mit dieser Formulierung kannnachher niemand etwas anfangen. Die Redaktionskommis-sion kann das Wort «arbeitsrechtlich» nicht durch ein ande-res, «besseres» Wort ersetzen; das geht nicht.Ich bitte Sie schon aus diesen formellen, redaktionellenGründen, die Differenz aufrechtzuerhalten.2. Zum Materiellen: Ich bin der Auffassung, dass wir tatsäch-lich über die Nachführung hinausgehen, wenn wir das nun inder Verfassung festschreiben. Wir geben hier auf Verfas-sungsebene viel mehr, als heute tatsächlich Praxis ist.Wir haben hier einen Punkt, mit dem wir unsere Nachführungnicht belasten sollten. Wenn sich allenfalls in der Differenz-bereinigung eine bessere Formulierung für den Grundgedan-ken ergibt, den Herr Büttiker vorhin geäussert hat, werden wiruns in der Kommission sicher auch finden können.Ich empfehle Ihnen Festhalten gemäss Antrag der Kommis-sion.
Plattner Gian-Reto (S, BS): Ich wehre mich gegen die Aus-sage meines Vorredners, wonach wir mit dieser Bestimmungdie Nachführung belasten. Der heutige Text ist auch in die-sem Rat immer klar so verstanden worden, dass dieser vonoben verordnete freie Tag ein bezahlter Tag sein soll.Ich hatte das Vergnügen, Berichterstatter der vorberatendenKommission zu sein, und habe damals deutlich gesagt, dassauch der Rat diesen Text so interpretiert. Wir haben das soakzeptiert. Ich glaube eher, dass jene, die nun – aus meinesErachtens durchsichtigen Gründen – die Formulierung vagehalten wollen, um diesen von oben verordneten freien Tag al-lenfalls nicht bezahlen zu müssen, die Nachführung strapa-zieren, indem sie versuchen, etwas, das schon einmal klarbeschlossen worden ist, wieder anders zu interpretieren.Ich bitte Sie wie Herr Büttiker, dem Nationalrat zu folgen unddamit die geltende Interpretation dieses Verfassungstextesein für allemal klarzustellen, damit die unnötigen Diskussio-nen über die Bezahlung des 1. August endlich aufhören.
Koller Arnold, Bundesrat: Es wäre sicher eleganter gewe-sen, wenn wir die Frage der Bezahlung des 1. August in ei-
Constitution fédérale. Réforme 186 E 22 septembre 1998
Bulletin officiel de l’Assemblée fédérale / Tiré à part
nem formellen Gesetz geregelt hätten. Aber nachdem Sie –aus welchen Gründen auch immer – alle Chancen verpassthaben, also sowohl die Chance des Bundesfeiertagsgeset-zes als auch jene der ersten und zweiten Arbeitsgesetzrevi-sion, dies im Gesetz klar zu regeln, ist der Bundesrat auchder Meinung, wir sollten die Frage jetzt auf Verfassungsstufeklar regeln. Es ist ein Akt von Treu und Glauben. Der Bundes-rat hat im Vorfeld der damaligen Abstimmung entsprechendeZusagen gemacht. Wir sollten daher diese Frage nun ein fürallemal entscheiden, und ich empfehle Ihnen daher, dem Na-tionalrat zuzustimmen.Was die Formulierung anbelangt, könnte man sie vielleichtdoch der Redaktionskommission überlassen. Der Grundsatz-entscheid sollte aber jetzt gefällt werden.
Abstimmung – VoteFür den Antrag der Kommission 23 StimmenFür den Antrag Büttiker 15 Stimmen
Wicki Franz (C, LU): Ich möchte noch eine Erklärung abge-ben. Es war nicht eine Kommissionsmehrheit, die dies bean-tragt hat, sondern die einstimmige Kommission.
Art. 104 Abs. 1 Bst. bAntrag der KommissionFesthalten
Art. 104 al. 1 let. bProposition de la commissionMaintenir
Aeby Pierre (S, FR), rapporteur: Concernant l’article 104 quitraite de la prévoyance professionnelle et notamment du 2epilier, la commission vous propose de maintenir votre déci-sion, donc de soutenir le projet du Conseil fédéral à l’alinéa1er lettre b. C’est la seule divergence qui subsiste dans cettedisposition.Le Conseil national, il est vrai, a adopté une version qui sup-prime la possibilité pour la législation de prévoir des excep-tions à l’obligation pour les salariés de disposer d’une pré-voyance professionnelle, c’est-à-dire d’un 2e pilier. Le Con-seil fédéral en prévoyant la lettre b de l’alinéa 1er et notreConseil en l’adoptant ont voulu indiquer clairement que l’obli-gation du 2e pilier n’était pas aussi absolue que l’obligationde l’AVS par exemple. Nous reconnaissons ainsi que, dansdes cas de travail à temps partiel, de travail de courte duréeet également lors de la conclusion de certains contrats pourdes travailleurs à l’étranger, mais liés à une entreprise enSuisse, on pouvait prévoir des exceptions au principe géné-ral du 2e pilier.Ce sont ces considérations qui font que la commission, àl’unanimité, propose de maintenir la décision de notre Con-seil.
Angenommen – Adopté
Art. 106Antrag der KommissionTitelFesthaltenAbs. 1Bedürftige werden von ihrem Wohnkanton unterstützt. DerBund regelt ....Abs. 2Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Art. 106Proposition de la commissionTitreMaintenirAl. 1Les indigents sont assistés par leur canton de domicile. LaConfédération règle ....Al. 2Adhérer à la décision du Conseil national
Aeby Pierre (S, FR), rapporteur: A l’article 106, le dépliantporte la mention «Maintenir» pour le titre. Notre commissionse rallie en fait à la systématique et à la nouvelle rédaction del’article 106 du Conseil national sauf, et c’est une divergencede taille, en ce qui concerne le titre, ainsi que, dans le texteplus particulièrement, en ce qui concerne les «personnesdans le besoin».La commission n’a pas voulu utiliser les termes de «person-nes dans le besoin», car cette notion pouvait faire penser quele principe du minimum existentiel garanti était ancré dans laconstitution. Or, à l’article 10, notre Conseil n’a pas voulu decette notion.C’est pour cette raison que la commission vous propose demaintenir la divergence en ce qui concerne le titre et de reve-nir au terme d’«indigents» plutôt que d’en rester à la versiondu Conseil national, qui parle de «personnes dans le be-soin».
Koller Arnold, Bundesrat: Ich unterstütze den Antrag derKommission.
Angenommen – Adopté
Art. 109 Abs. 3Antrag der KommissionStreichen
Art. 109 al. 3Proposition de la commissionBiffer
Aeby Pierre (S, FR), rapporteur: La divergence à l’article 109(«Protection de la santé») réside uniquement dans le nouvelalinéa 3 introduit par le Conseil national. Le Conseil nationalsouhaite que la Confédération puisse édicter des disposi-tions sur la formation et la formation continue pour les profes-sions médicales académiques.Après un examen approfondi de cette question, la commis-sion a constaté que la Confédération peut déjà agir concer-nant la réglementation des professions médicales, notam-ment aux articles 31bis et 33; qu’en outre, en ce qui concerneles professions médicales, la loi fédérale sur le marché inté-rieur était désormais un frein à un caractère trop cantonalistedes dispositions cantonales en la matière. Enfin, nous avonsestimé qu’ici nous étions loin d’une simple mise à jour, d’une«Nachführung».La commission vous propose en conséquence de biffer cenouvel alinéa 3 introduit par le Conseil national.
Koller Arnold, Bundesrat: Ich unterstütze den Antrag derKommission.
Angenommen – Adopté
Art. 111a TitelAntrag der KommissionZustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Art. 111a titreProposition de la commissionAdhérer à la décision du Conseil national
Aeby Pierre (S, FR), rapporteur: La commission vous pro-pose de vous rallier au titre selon la décision du Conseil na-tional, qui nous permet de bien distinguer, d’une part, la pro-création médicalement assistée et le génie génétique dans ledomaine humain, c’est l’article 111, et, d’autre part, le géniegénétique dans le domaine non humain, c’est l’article 111a.Cette clarté peut être saluée, et c’est en ce sens que nousvous proposons de vous rallier à la version du Conseil natio-nal.
Angenommen – Adopté
22. September 1998 S 187 Bundesverfassung. Reform
Amtliches Bulletin der Bundesversammlung / Separatdruck
Art. 117 TitelAntrag der KommissionHaushaltführung1)
Art. 117 titreProposition de la commissionGestion des finances1)
Präsident: Hier wird zusätzlich auf die Fussnote («Mit Über-gangsbestimmung», «Assorti d’une disposition transitoire»)verwiesen.
Angenommen – Adopté
Art. 118 Abs. 1bisAntrag der KommissionStreichen
Antrag PlattnerZustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Art. 118 al. 1bisProposition de la commissionBiffer
Proposition PlattnerAdhérer à la décision du Conseil national
Aeby Pierre (S, FR), rapporteur: L’article 118 est importantdans la Constitution fédérale puisqu’il traite des principes ré-gissant l’imposition. Les principes retenus à l’alinéa 1er par leConseil fédéral sont «la qualité de contribuable, l’objet del’impôt et son mode de calcul». Ils doivent être à leur tour dé-finis par la loi elle-même. En fait, le principe de la légalité del’imposition est fixé à l’alinéa 1er.Le Conseil national a ajouté un alinéa 1bis qui élève au rangconstitutionnel les principes habituels de l’imposition à sa-voir: «l’universalité, l’égalité de traitement et la capacité éco-nomique». Trois principes dont la législation tient compte detoute façon, mais trois principes que le Conseil national avoulu fixer dans la constitution comme étant fondamentauxde l’exercice de la souveraineté fiscale dans notre pays. No-tre commission n’a pas pu se rallier à cette façon de voir leschoses et a considéré que ce serait par trop surcharger letexte de la constitution que d’insérer cet alinéa 1bis.La commission vous propose en conséquence de maintenirvotre décision, donc de soutenir le projet du Conseil fédéralqui est plus cliniquement neutre que la décision du Conseilnational.
Plattner Gian-Reto (S, BS): Beim Antrag, dem Nationalrat zufolgen und den Absatz 1bis einzufügen, geht es ja um dieFrage, ob die wesentlichen Grundsätze, welche die Recht-sprechung in Anwendung der direkten Steuern entwickelthat, auf Verfassungsebene gehoben werden sollen. Daswäre mir ein Anliegen. Nachdem ich den Antrag eingereichthatte, musste ich mir aber – mit einem gewissen Recht – sa-gen lassen, dass für gewisse Steuern, die wir erheben, derdritte Grundsatz, nämlich jener der wirtschaftlichen Lei-stungsfähigkeit, etwas problematisch ist. Ist eine proportio-nale Steuer wie die Mehrwertsteuer eine Steuer, die auf diewirtschaftliche Leistungsfähigkeit Rücksicht nimmt? Mankann argumentieren, dass sie es tut. Wer mehr konsumiert,zahlt auch mehr. Es ist keine Kopfsteuer. Wir sind es aber ge-wohnt, unter der Beachtung der wirtschaftlichen Leistungsfä-higkeit einen überproportionalen Steuertarif, also einen pro-gressiven, zu verstehen.Ich bleibe dabei, dass es gut wäre, wenn wir diese über dieJahrzehnte entwickelten Grundsätze, die auch sehr wesent-lich sind, insbesondere bezüglich des Gleichheitsartikels derBundesverfassung, in die Verfassung nehmen könnten. Ichsehe aber ein, dass die nationalrätliche Formulierung zu un-vollkommen ist, um ihr einfach zu folgen. Ich ziehe es des-halb vor, zum Beschluss des Nationalrates eine Differenz zuschaffen, indem ich mich nicht mehr dagegen wehre, dass
die Bestimmung gestrichen wird. Ich hoffe aber, dass der Na-tionalrat in der Differenzbereinigung die Chance ergreifenund sich überlegen wird, wie er die Grundsätze – vor allembezüglich der direkten Steuern – am richtigen Ort einbringenkann.In diesem Sinne ziehe ich meinen Antrag zurück. Das sollaber nicht heissen, dass ich das Anliegen aufgegeben habe.
Rhinow René (R, BL): Ich danke Herrn Plattner für denRückzug seines Vorstosses.Ich möchte die Ausführungen von Herrn Aeby kurz ergänzen:Für die Kommission war nicht primär die Frage der Überla-stung des Verfassungstextes massgeblich, sondern die Ein-sicht, dass diese Grundsätze der Besteuerung für die direk-ten Steuern entwickelt worden sind; in dieser Hinsicht sindsie auch unbestritten. Aber sie passen schlechthin nicht zuden indirekten Steuern, nicht zur Mehrwertsteuer, zur Stem-pelsteuer, zur Verrechnungssteuer usw. Deshalb erschien esuns nicht zweckmässig, diese Grundsätze in der vorgeschla-genen allgemeinen Form aufzunehmen. Es waren also sach-haltige Gründe massgeblich, wie sie auch Herr Plattner er-wähnt hat.Ob die Differenz dazu führt, dass nun eine neue Formulie-rung gesucht wird, möchte ich offenlassen. Ich sehe abernicht recht, wie man diese Grundsätze durch blosse Neufor-mulierung für alle Steuern als anwendbar erklären kann.Wir müssen damit leben, dass es weiterhin gewisse Grund-sätze gibt, die von Lehre und Rechtsprechung entwickeltwerden und als Teilgehalt von Artikel 4 (nach heutiger Ver-fassung) gelten, ohne dass sie in der Verfassung ausdrück-lich zum Ausdruck gebracht werden.
Präsident: Herr Plattner hat seinen Antrag zurückgezogen.
Angenommen gemäss Antrag der KommissionAdopté selon la proposition de la commission
Art. 185 Ziff. 5aAntrag der KommissionFesthalten
Art. 185 ch. 5aProposition de la commissionMaintenir
Präsident: Über Ziffer 5a haben wir gestern im Zusammen-hang mit der Bedürfnisklausel entschieden.
Angenommen – Adopté
Art. 185 Ziff. 8aAntrag der KommissionTitelÜbergangsbestimmung zu Art. 117 («Haushaltführung»)Abs. 1Die Ausgabenüberschüsse in der Finanzrechnung des Bun-des sind durch Einsparungen zu verringern, bis der Rech-nungsausgleich im wesentlichen erreicht ist.Abs. 2Der Ausgabenüberschuss darf im Rechnungsjahr 1999 5 Mil-liarden Franken und im Rechnungsjahr 2000 2,5 MilliardenFranken nicht überschreiten; im Rechnungsjahr 2001 musser auf höchstens 2 Prozent der Einnahmen abgebaut sein.Abs. 3Wenn es die Wirtschaftslage erfordert, kann die Mehrheit derMitglieder beider Räte die Fristen nach Absatz 2 durch eineVerordnung um insgesamt höchstens zwei Jahre erstrecken.Abs. 4Bundesversammlung und Bundesrat berücksichtigen dieVorgaben nach Absatz 2 bei der Erstellung des Voranschla-ges und des mehrjährigen Finanzplans sowie bei der Be-handlung aller Vorlagen mit finanziellen Auswirkungen.Abs. 5Der Bundesrat nutzt beim Vollzug des Voranschlages diesich bietenden Sparmöglichkeiten. Dazu kann er bereits be-
Constitution fédérale. Réforme 188 E 22 septembre 1998
Bulletin officiel de l’Assemblée fédérale / Tiré à part
willigte Verpflichtungs- und Zahlungskredite sperren. Gesetz-liche Ansprüche und im Einzelfall rechtskräftig zugesicherteLeistungen bleiben vorbehalten.Abs. 6Werden die Vorgaben nach Absatz 2 verfehlt, so legt derBundesrat fest, welcher Betrag zusätzlich eingespart werdenmuss. Zu diesem Zweck:a. beschliesst er zusätzliche Einsparungen in seiner Zustän-digkeit;b. beantragt er der Bundesversammlung die für zusätzlicheEinsparungen notwendigen Änderungen von Gesetzen.Abs. 7Der Bundesrat bemisst den Gesamtbetrag der zusätzlichenEinsparungen so, dass die Vorgaben mit höchstens zweijäh-riger Verspätung erreicht werden können. Die Einsparungensollen sowohl bei den Leistungen an Dritte als auch im bun-deseigenen Bereich vorgenommen werden.Abs. 8Die eidgenössischen Räte beschliessen über die Anträgedes Bundesrates in derselben Session und setzen ihren Er-lass nach Artikel 155 der Bundesverfassung in Kraft; sie sindan den Betrag der Sparvorgaben des Bundesrates nach Ab-satz 6 gebunden.Abs. 9Übersteigt der Ausgabenüberschuss in einem späterenRechnungsjahr erneut 2 Prozent der Einnahmen, so ist er imjeweils folgenden Rechnungsjahr auf diesen Zielwert abzu-bauen. Wenn die Wirtschaftslage es erfordert, kann die Bun-desversammlung die Frist durch eine Verordnung um höch-stens zwei Jahre erstrecken. Im übrigen richtet sich das Vor-gehen nach den Absätzen 4–8.Abs. 10Diese Übergangsbestimmung gilt so lange, bis sie durch ver-fassungsrechtliche Massnahmen zur Defizit- und Verschul-densbegrenzung abgelöst wird.
Art. 185 ch. 8aProposition de la commissionTitreDispositions transitoire ad art. 117 («Gestion des finances»)Al. 1Les excédents de dépenses enregistrés dans le compte fi-nancier de la Confédération sont réduits par des économiesjusqu’à ce que l’équilibre des comptes soit pour l’essentiel at-teint.Al. 2L’excédent de dépenses comptabilisé au terme de l’exercice1999 ne doit pas dépasser 5 milliards de francs et au termede l’exercice 2000, 2,5 milliards de francs; au terme de l’exer-cice 2001, il doit avoir été ramené à un montant n’excédantpas 2 pour cent des recettes.Al. 3Si la situation économique l’exige, la majorité des membresdes deux Conseils peut, par une ordonnance, proroger lesdélais mentionnés à l’alinéa 2 de deux ans au plus.Al. 4L’Assemblée fédérale et le Conseil fédéral tiennent comptedes objectifs mentionnés à l’alinéa 2 lors de l’établissementdu budget et du plan financier pluriannuel, ainsi que lors del’examen de tout projet impliquant des engagements finan-ciers.Al. 5Le Conseil fédéral utilise les possibilités d’économies qui seprésentent lors de l’application du budget. A cet effet, il peutbloquer des crédits d’engagement ou des crédits de paie-ment déjà autorisés. Les prétentions fondées sur des dispo-sitions légales et, dans des cas d’espèce, les prestations for-mellement garanties sont réservées.Al. 6Si les objectifs mentionnées à l’alinéa 2 ne sont pas atteints,le Conseil fédéral fixe le montant supplémentaire qu’il s’agirad’économiser. A cet effet:a. il décide des économies supplémentaires qui sont de sonressort;b. il propose à l’Assemblée fédérale les modifications de lois.
Al. 7Le Conseil fédéral fixe le montant total des économies sup-plémentaires de sorte que les objectifs soient atteints au plustard deux ans après l’expiration des délais fixés à l’alinéa 2.Les mesures d’économies s’appliquant tant aux prestationsversées à des tiers qu’au domaine propre de la Confédéra-tion.Al. 8Les deux Conseils se prononcent sur les propositions duConseil fédéral durant la même session et font entrer en vi-gueur l’acte édicté en suivant la procédure prévue à l’article155 de la constitution; ils sont liés par le montant des écono-mies fixé par le Conseil fédéral en vertu de l’alinéa 6.Al. 9Si l’excédent de dépenses dépasse à nouveau 2 pour centdes recettes, le montant excédentaire devra être ramené à cetaux au cours de l’exercice suivant. Si la conjoncture écono-mique l’exige, l’Assemblée fédérale peut proroger le délai dedeux ans au plus par le biais d’une ordonnance. Au reste, laprocédure prévue aux alinéas 4 à 8 est applicable.Al. 10La présente disposition transitoire reste en vigueur jusqu’à cequ’elle soit remplacée par des mesures de droit constitution-nel visant à limiter le déficit et l’endettement.
Aeby Pierre (S, FR), rapporteur: C’est évidemment l’«objectifbudgétaire 2001» qui ne pouvait pas figurer dans le projetavant la dernière votation populaire. On retrouve ici le textetrès récemment voté le 7 juin dernier.
Präsident: Ich weise den Rat darauf hin, dass in Absatz 8der deutschen Fassung das fünfte Wort, «nicht», zu strei-chen ist. Das ist ein redaktionelles Versehen.
Angenommen – Adopté
Art. 185 Ziff. 9Antrag der KommissionFesthalten
Art. 185 ch. 9Proposition de la commissionMaintenir
Aeby Pierre (S, FR), rapporteur: Ce chiffre 9 n’est pas unequestion fondamentale. Mais notre commission a estimé quele handicap était déjà suffisamment grand que notre Etatcentral n’ait pas un régime fiscal et de garantie de recettesimportantes au-delà de 2006, pour les raisons politiques quevous connaissez – nous allons de régime transitoire en ré-gime transitoire – et qu’il était tout à fait inutile d’insister en-core sur ce handicap, avec l’expression «au plus tard»/«längstens». Nous avons biffé cette expression, nous con-tentant de dire: «L’impôt fédéral direct peut être prélevéjusqu’à la fin de 2006.» Il n’y a vraiment pas besoin de direencore «au plus tard». Le Conseil national ne s’est pas ralliéà notre décision. Il faut dire qu’il n’a pas voulu prendre con-naissance des résultats avant sa première délibération.Nous vous proposons en conséquence de maintenir notredécision. Les commentaires que je viens de faire sontd’ailleurs également valables pour ce qui concerne la taxesur la valeur ajoutée, où l’on retrouve la même correction(art. 185 disp. trans. ch. 10 al. 4).
Angenommen – Adopté
Art. 185 Ziff. 10 Abs. 4Antrag der KommissionFesthalten
Art. 185 ch. 10 al. 4Proposition de la commissionMaintenir
Angenommen – Adopté
22. September 1998 S 189 Bundesverfassung. Reform
Amtliches Bulletin der Bundesversammlung / Separatdruck
Ziff. II Abs. 2 Ziff. 2aAntrag der KommissionZustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Ch. II al. 2 ch. 2aProposition de la commissionAdhérer à la décision du Conseil national
Aeby Pierre (S, FR), rapporteur: C’est dans la logique de nosdécisions: Nous devons biffer le chiffre 2a en relation avec cequi est en fait l’article 32d de notre projet, où nous avons re-noncé à évoquer la question des liens particuliers des Suis-ses de l’étranger avec leur patrie et celle du soutien apportéaux institutions par la Confédération.Pour être logiques avec nous-mêmes, nous devons mainte-nant biffer cette disposition transitoire, contrairement à la pro-position de maintenir mentionnée dans le dépliant.
Angenommen – Adopté
Ziff. IIIAntrag der KommissionFesthalten
Ch. IIIProposition de la commissionMaintenir
Aeby Pierre (S, FR), rapporteur: Au chiffre III, il s’agit d’unedivergence de nature rédactionnelle. La rédaction adoptéepar notre Conseil est meilleure et plus concise. Elle est tout àfait claire. Nous vous proposons de la maintenir.
Angenommen – Adopté
A2. Bundesbeschluss über eine nachgeführte Bundes-verfassung (Art. 127–184)A2. Arrêté fédéral relatif à une mise à jour de la Consti-tution fédérale (art. 127–184)
Frick Bruno (C, SZ), Berichterstatter: Einige kurze Worte, umuns in dieser Vorlage zu situieren: Die Vorlage A2 – umfas-send die Artikel 127 bis 184 – wurde vom Nationalrat als Erst-rat in der Januarsession 1998 behandelt. Wir haben in unse-rem Rat am 30. April 1998 darüber beschlossen. In der Som-mersession behandelte der Nationalrat als erster die Diffe-renzen. Mit unserer heutigen Beratung ist die erste Rundeder Differenzbereinigung abgeschlossen.1. Zur Fahne, die Sie nun vor sich haben, erläutere ich Ihnenfolgendes: Der Nationalrat hat in der ersten Differenzbereini-gung praktisch integral an seinen Beschlüssen der ersten Le-sung festgehalten. Das ist ungewöhnlich und wird auch demSinn des Differenzbereinigungsverfahrens nicht gerecht. Zu-rückzuführen ist dieses Vorgehen darauf, dass die Verfas-sungskommission des Nationalrates aufgrund der Zeitpla-nung und des gedrängten Programmes ihre Beschlüsse zurDifferenzbereinigung bereits gefasst hatte, bevor unser Ratdie erste Lesung formell abschloss. Unsere Änderungen wur-den von der Verfassungskommission des Nationalrates nichtmehr extensiv gewürdigt. Eingebracht werden konnten nurnoch einige Anregungen, die in einer Aussprache einer Koor-dinationsgruppe der Subkommissions- und Kommissions-präsidenten behandelt wurden.Inzwischen hat der Nationalrat seine Arbeitsweise den effek-tiven Erfordernissen angepasst und verbessert. Wir könnenalso davon ausgehen, dass unsere heutigen Beschlüsse«ins Ohr» des Nationalrates gehen und nicht nur auf demnationalrätlichen Schreibtisch oder im Papierkorb landenwerden. Insofern ist die Beratung auf einen besseren Weggelangt.2. Inhaltlich bestehen zehn Differenzen. Wenn wir die Ange-legenheit rein zahlenmässig betrachten, stellen wir fest, dassder Ständerat auf rund der Hälfte der Differenzen beharren
will. In vier Punkten geben wir nach, und einmal, in einemwichtigen Punkt, jenem der Kommissionsrechte, suchen wireine neue Lösung.
Art. 127Antrag der KommissionZustimmung zum Beschluss des NationalratesProposition de la commissionAdhérer à la décision du Conseil national
Frick Bruno (C, SZ), Berichterstatter: Sie ersehen aus derFahne, dass wir uns dem Nationalrat anschliessen. Was istgeschehen?In Absprache mit unserer Kommission hat die Kommissiondes Nationalrates bzw. der Nationalrat lediglich die Begriffegeklärt. Als Oberbegriff der Mitwirkungsrechte des Volkeswird nun «politische Rechte» verwendet. Das ist eine Be-griffsänderung, die sich an die heutige Rechtsprechung undjuristische Lehre anlehnt, sich aber ohne jede inhaltliche Än-derung gestaltet.Die Verfassungskommission unseres Rates schliesst sichder Fassung des Nationalrates einstimmig an.
Angenommen – Adopté
Art. 144 Abs. 4Antrag der KommissionZur Erfüllung ihrer Aufgaben stehen den Kommissionen Aus-kunftsrechte, Einsichtsrechte und Untersuchungsbefugnissezu. Deren Umfang wird durch das Gesetz geregelt.
Art. 144 al. 4Proposition de la commissionAfin de pouvoir accomplir leurs tâches, les commissions dis-posent du droit d’obtenir des renseignements, de consulterdes documents et de mener des enquêtes. La loi déterminel’étendue de ces droits.
Frick Bruno (C, SZ), Berichterstatter: Artikel 144 sollten wirmit einem Seitenblick auf Artikel 159 Absatz 2 betrachten. Ichschlage Ihnen vor, beide Bestimmungen gleichzeitig zu bera-ten.Es geht in diesen Bestimmungen um die Rechte der parla-mentarischen Kommissionen. Betroffen sind die Kommissio-nen allgemein, also sowohl die gesetzgebenden Kommissio-nen als auch die Aufsichtskommissionen (Geschäftsprü-fungskommissionen und Finanzkommissionen).Der Nationalrat hat Artikel 144 Absatz 4 absolut gefasst: «DieKommissionen haben Anspruch auf alle Informationen ....»Ausnahmen vom absoluten Einsichts- und Auskunftsrechtwären durch das Gesetz zu umschreiben. Das Gesetz müss-te also in der Folge einen Ausnahmekatalog setzen, und alleRechte, die nicht ausdrücklich ausgenommen wären, stün-den den Kommissionen zu.Der Ständerat seinerseits verlangte in der ersten Lesungeine positive Aufzählung: Nur jene Rechte, die ausdrücklichgewährt sind, sollten den Kommissionen zustehen.Nachdem der Nationalrat an seinem Beschluss festgehaltenhat, unterbreiten wir Ihnen einen Vermittlungsvorschlag, derauf Vorarbeiten des Eidgenössischen Justiz- und Polizeide-partementes zurückgeht.Wir beantragen Ihnen, das Gesetz nicht auf einen positivenoder einen negativen Katalog zu beschränken, sondern all-gemein die Rechte der Kommissionen zu umschreiben. Dasentspricht der heutigen Regelung. Der Inhalt der Kommis-sionsrechte soll also dem Gesetz entnommen werden, seies durch ausdrückliche Regelung, sei es durch Interpreta-tion.Damit braucht es keinen Positiv- oder Negativkatalog mehr.Wo steht unsere Lösung? Unsere Lösung ist ein Vermitt-lungsvorschlag; sie steht in der Mitte zwischen den bisheri-gen Lösungen von Nationalrat und Ständerat. Aber unsereLösung hat zugegebenermassen «den Kopf» zum Ständeratgewandt. Wenn wir diese Lösung in Artikel 144 Absatz 4 tref-fen, wird in der Konsequenz Artikel 159 Absatz 2 gegen-
Constitution fédérale. Réforme 190 E 22 septembre 1998
Bulletin officiel de l’Assemblée fédérale / Tiré à part
standslos, weil nämlich bei Artikel 144 auch die Aufsichts-kommissionen, also die Geschäftsprüfungskommissionenund die Finanzkommissionen, genannt werden.Im Sinne unserer einstimmigen Kommission bitte ich Sie umZustimmung. Ich möchte es aber nicht unterlassen, Herr Prä-sident, Sie zu bitten, dass Sie auch den Präsidenten derGPK, unseren Kollegen Peter Bieri, zu Wort kommen lassen,nachdem die GPK in der letzten Runde eigene Anträge ein-gebracht hat.
Bieri Peter (C, ZG): Ich habe mich am 9. März dieses Jahresbei der ersten Auseinandersetzung im Rat zum Thema «Ak-teneinsichtsrechte» als Präsident der Geschäftsprüfungs-kommission geäussert und dort die Meinung unserer Kom-mission dargelegt. Es muss, wie bereits gesagt wurde, fest-gehalten werden, dass Artikel 144 und 159 gemeinsam be-trachtet werden müssen. Unser Rat hat damals Artikel 159Absatz 2 – das uneingeschränkte Akteneinsichtsrecht derKontrollkommissionen auf der Stufe der Verfassung und indieser allgemeinverbindlichen Formulierung – abgelehnt undist damit dem Beschluss des Nationalrates und der Meinungseiner GPK nicht gefolgt. In der Zwischenzeit haben die Ver-fassungskommissionen eine Lösung gesucht, die es erlaubt,auf der Stufe der Verfassung die Frage der Hilfsmittel unsererKommissionen zu lösen.Da zwischen Artikel 144 und 159 ein thematischer Konnex be-steht, der auch vom Bundesrat und von der Verfassungskom-mission bei der ersten Debatte bestätigt wurde, will ich hierdie Überlegungen unserer Kommission zum Ausdruck brin-gen.Parlament und Bundesrat sind sich darüber einig, dass dieInformationsrechte der parlamentarischen Kommissionen indie neue Bundesverfassung aufgenommen werden müssen.Es stellt sich heute allerdings die Frage, wie weit die Bezeich-nung und Umschreibung der Informationsrechte auf Verfas-sungsstufe gehen sollen und was der Gesetzgeber selbst re-geln kann.Die Bundesversammlung und deren Organe, also die Kom-missionen und Delegationen – was insbesondere bei denGPK von erheblicher Bedeutung ist – sowie entsprechendeArbeitsgruppen, verfügen bereits heute von Verfassung we-gen über jene Informationsrechte, die sie zur sachgerechtenErfüllung der ihnen übertragenen Aufgaben benötigen; diesallerdings als ungeschriebenes Verfassungsrecht. Eine fürdie Wahrnehmung der jeweiligen Aufgabe hinreichende In-formationsgrundlage ist in diesem Sinne ein immanenter Be-standteil dieser Aufgabe.Die GPK beider Räte sind deshalb bei Artikel 144 des Verfas-sungsentwurfes für die Formulierung eingetreten, wonachdie Kommissionen Anspruch auf alle Informationen haben,die zur Erfüllung ihrer Aufgaben geeignet und erforderlichsind. Es wird Aufgabe des Gesetzgebers sein, sowohl dieAufgaben als auch die Informationsrechte zu konkretisieren.Die vom Nationalrat beschlossene Lösung zu Artikel 144 Ab-satz 4 will den Gesetzgeber verpflichten, diese Konkretisie-rung im Gesetz negativ, d. h. durch die Bezeichnung derGrenzen der Informationsrechte, vorzunehmen. Die Kommis-sion des Ständerates schlägt dagegen vor, den Umfang derInformationsrechte im Gesetz positiv zu umschreiben.Obschon die Formulierung des Nationalrates dem oben ge-schilderten Verständnis der GPK an sich näherkommt, kannsicher auch die GPK mit der neuen Formulierung der stände-rätlichen Verfassungskommission leben. Sie ist auf jedenFall der bisherigen Formulierung des Ständerates vorzuzie-hen, die vortäuscht, die Kommissionen hätten nur von Geset-zes wegen und nicht von Verfassung wegen einen Anspruchauf Informationen.Bei Artikel 159 des Verfassungsentwurfes geht es um dieFrage, ob die Informationsrechte jener Kommissionen, diedie Aufgabe der Oberaufsicht wahrnehmen, speziell geregeltwerden sollen. Tatsächlich benötigen die Aufsichtskommis-sionen entsprechend ihren Aufgaben andere Informationenals eine Kommission, die mit der Vorberatung einer Geset-zesvorlage betraut ist. Der Natur des Kontrollauftrages ent-sprechend können die Aufsichtskommissionen auch nicht
ohne weiteres mit der Unterstützung der Informationsträger,nämlich der Unterstützung der Kontrollierten, rechnen.Die GPK beider Räte haben in diesem Jahr ihre Erfahrungenim Umgang mit den ihnen zustehenden Informationsrechtenausgewertet und sich mit der Frage auseinandergesetzt, obihre Informationsrechte neu geregelt werden müssen. Anlasszu dieser vertieften Überprüfung bildete neben der aktuellenVerfassungsdiskussion auch eine parlamentarische Initiativeder PUK PKB, die verlangt, dass die GPK in geeigneterWeise Einblick sowohl in die Führungs- wie auch in die Kon-trolldaten der Departemente und in die Akten noch nicht ab-geschlossener Verfahren nehmen können.Die GPK beider Räte haben anlässlich ihrer Plenarsitzungenim August bzw. September 1998 den Grundsatzbeschlussgefasst, dass den GPK in Fragen der Akteneinsicht mehrKompetenzen einzuräumen sind. Bis heute haben die GPKkeine Möglichkeit, ihr Akteneinsichtsrecht gegenüber demBundesrat mit rechtlichen Mitteln durchzusetzen. Anlass zueiner rechtlichen Durchsetzung hätte in der Vergangenheitzwar nicht sehr oft bestanden, zumal die GPK ihr Aktenein-sichtsrecht mit Zurückhaltung ausübten und der Bundesratihnen die Akteneinsicht in den meisten Fällen gewährte. Al-lerdings gab es auch Situationen, in denen der Bundesrat aufder Verweigerung der Aktenherausgabe beharrte und dieWahrnehmung der Oberaufsichtsfunktion erschwerte odergar verunmöglichte.Die GPK sind der Auffassung, dass der Kontrolleur und nichtder Kontrollierte bestimmen können muss, in welche Akten erEinsicht nehmen kann. Allerdings muss gewährleistet sein,dass eine Akteneinsichtnahme in geeigneter Weise erfolgenkann, d. h., eine Einsichtnahme muss auch die Geheimhal-tungsinteressen des Kontrollierten berücksichtigen. Um denbesonderen Interessen Rechnung zu tragen, die bei der Ein-sichtnahme in vertrauliche Akten betroffen sind, hat bei-spielsweise der Gesetzgeber im Kanton Bern von einem di-rekten Einsichtsrecht abgesehen und statt dessen ein mehr-stufiges Verfahren gewählt. Neben einem solchen Verfahrenkann sich die GPK des Ständerates auch eine Regelung vor-stellen, gemäss welcher sich die GPK mit einem gewissenQuorum gegen die vom Bundesrat bestrittene Akteneinsichtbehaupten müssen oder nur einzelne Mitglieder der GPK indie Originaldossiers Einblick nehmen können.Die GPK sind sich darüber einig, dass es für die Neuregelungdes Akteneinsichtsverfahrens keiner Verfassungsänderungbedarf. Eine detaillierte Regelung, die den GPK eine Durch-setzungsmöglichkeit des Akteneinsichtsrechtes auf geeig-nete Art und Weise erlaubt, kann in adäquater Weise so-wieso nur auf Gesetzesstufe erfolgen. Die Revision des Ge-schäftsverkehrsgesetzes wird dem Parlament Gelegenheitzu einer Beurteilung dieser Frage geben.Angesichts dieser Ausführungen kann die GPK des Stände-rates deshalb auf einen Antrag zu Artikel 159 Absatz 2, wieich ihn das letzte Mal gestellt habe, verzichten und den Vor-schlag der Kommission des Ständerates in dem Sinn gut-heissen, dass eine weiter gehende Diskussion der Aktenein-sichtsrechte der GPK auf die Totalrevision des Geschäftsver-kehrsgesetzes verschoben wird.
Koller Arnold, Bundesrat: Ich bitte Sie, dem Kompromissan-trag, wie er jetzt von Ihrer Kommission entwickelt worden ist,zuzustimmen, denn die vertiefte Auseinandersetzung mit die-sen Problemen hat zwei Dinge ergeben. Auf der einen Seiteist es richtig, dass wir erstmals diese Einsichts- und Informa-tionsrechte als Grundprinzip in der Verfassung festhalten; aufder anderen Seite sind die konkreten Einsichts- und Informa-tionsrechte in der heutigen Gesetzgebung mit gutem Grundsehr unterschiedlich ausgestaltet. Das Votum von Herrn Bierihat das bestätigt. Das beginnt bei den gewöhnlichen Kom-missionen, nimmt dann zu bei den Geschäftsprüfungskom-missionen, bei der Geschäftsprüfungsdelegation und bei derFinanzdelegation bis zur parlamentarischen Untersuchungs-kommission. Deshalb ist es sicher richtig, wenn der genaueInhalt dieser Rechte auf Gesetzesstufe und nicht auf Verfas-sungsstufe festgelegt wird.
22. September 1998 S 191 Bundesverfassung. Reform
Amtliches Bulletin der Bundesversammlung / Separatdruck
Deshalb hoffe ich, dass dieser Kompromissantrag auch eineChance im Nationalrat hat.
Angenommen – Adopté
Art. 146Antrag der KommissionZustimmung zum Beschluss des NationalratesProposition de la commissionAdhérer à la décision du Conseil national
Frick Bruno (C, SZ), Berichterstatter: Die Verfassungskom-mission schliesst sich dem Nationalrat an. Der Nationalrathat hier analog zu unserem neuen Artikel 144 Absatz 4 eineLösung getroffen, wonach der Beizug von Dienststellen derBundesverwaltung durch das Gesetz umschrieben wird,ohne dass von Verfassung wegen eine Vermutung für odergegen den Beizug der Verwaltung besteht.
Angenommen – Adopté
Art. 153a Abs. 1Antrag der KommissionFesthalten
Art. 153a al. 1Proposition de la commissionMaintenir
Frick Bruno (C, SZ), Berichterstatter: Hier geht es nur um dieFrage der Terminologie. Wenn die Bundesversammlung eineVerordnung erlässt, ist diese nach dem Willen unseres Ratesauf Stufe der Verfassung als «Verordnung» zu bezeichnen.Der Nationalrat möchte eine solche Verordnung als «Parla-mentsverordnung» bezeichnet wissen.Wir möchten aus zwei Gründen festhalten: Erstens werdenauf Stufe Verfassung Verordnungen nie nach dem Absenderbezeichnet. Wir reden auch nicht von Bundesratsverordnun-gen, von Bundesgerichtsverordnungen, sondern nur vonVerordnungen allgemein. Welcher Sprachgebrauch des Be-griffes sich in der Lehre später einbürgern wird, bleibt offen.Zweitens wird in der Regel der Begriff «Parlament» auf Ver-fassungsstufe nicht gebraucht, insbesondere dort nicht, woes um Kompetenzen geht. Eine Ausnahme besteht nur in Ar-tikel 146, wo man von Parlamentsdiensten, die beigezogenwerden können, spricht. In aller Regel wird der Begriff jedochnicht gebraucht.Wir bitten Sie, im Sinne einer klaren Begrifflichkeit auf Stufeder Verfassung bei unserer Lösung zu bleiben.
Angenommen – Adopté
Art. 154 Abs. 1ter, 2Antrag der KommissionFesthalten
Art. 154 al. 1ter, 2Proposition de la commissionMaintenir
Frick Bruno (C, SZ), Berichterstatter: Ich möchte Absatz 1terund Absatz 2 gemeinsam beraten. Die Abstimmung kannnachher getrennt erfolgen.Es ist eine Angelegenheit, die einiger Erläuterungen bedarf.Ich möchte sie in der gebotenen Kürze geben. Es geht um dieFrage, wann Bundesrat und Bundesversammlung die Kom-petenz haben, eine Verordnung zu erlassen, die das Gesetzergänzt. Es geht also nicht um eine Vollzugsverordnung,sondern um die Ergänzung des Gesetzes, um die nähereUmschreibung der Rechte und Pflichten, die Konkretisierungdessen, was ein Gesetz im Grundsatz bereits festschreibt.Da ist folgendes vorauszuschicken: Was in ein Gesetz ge-hört, ist in Absatz 1bis bereits geregelt. Es sind dies alle wich-
tigen rechtsetzenden Bestimmungen. Der Katalog ist sodannin den Buchstaben a bis f konkretisiert.Das Bundesgesetz kann die Kompetenz zur gesetzesergän-zenden Verordnung dem Bundesrat, der Bundesversamm-lung oder auch dem Bundesgericht erteilen, und zwar kanndiese Ermächtigung eine ausdrückliche oder eine still-schweigende sein. Das Bundesgericht hat dazu auch einefeste Praxis entwickelt, die weiterhin gelten wird. Selbstver-ständlich gilt diese Kompetenz nicht, soweit sie durch dieBundesverfassung ausdrücklich ausgeschlossen ist. Dies al-les ist in Absatz 2 der Fassung des Ständerates geregelt,nämlich dass die gesetzesergänzenden Verordnungen mög-lich sind, soweit sie nicht durch die Bundesverfassung aus-geschlossen sind. Den zweiten Satz, den der Bundesrat inAbsatz 2 noch normiert hat, nämlich dass die ermächtigendeBestimmung die Grundzüge der Regelung festlegen muss,ist heute nicht mehr nötig, weil wir – entgegen dem Bundes-rat – in Absatz 1bis bereits positiv umschrieben haben, wasalles ins Gesetz gehört. Insofern ist also der letzte Satz vonAbsatz 2 gemäss dem Entwurf des Bundesrates eine unnö-tige Wiederholung. Wir möchten ihn weglassen, so, wie wires bereits im ersten Durchgang beschlossen haben. So vielzu Absatz 2.Nun ist Absatz 1ter zu behandeln: Der Nationalrat hat dieseneingefügt, und zwar mit dem Wortlaut: «Grundlage von Par-lamentsverordnungen sind besondere Ermächtigungen derBundesverfassung oder Bundesgesetze.» Nun, was soll da-mit gesagt werden?Wenn damit eine allgemeine Regel bekräftigt wird, dass auchdie Bundesversammlung eine Ermächtigung braucht, umeine gesetzesergänzende Verordnung zu erlassen, dannsagt diese Bestimmung nichts Neues. Dann ist sie überflüs-sig und kann weggelassen werden. Sie ist aber in ihrersprachlichen Formulierung missverständlich. Missverständ-nis eins: Nach dem Wortlaut sollen für die Bundesversamm-lung engere Schranken gelten als für den Bundesrat. Manspricht ja von «besonderen Ermächtigungen». Das deutetdarauf hin, dass eine höhere Anforderung erfüllt sein müsste,um das Parlament zu einer gesetzesergänzenden Verord-nung zu ermächtigen. Das ergibt sich aus dem Wortlaut.Nach den Beratungen im Nationalrat aber soll das nicht derFall sein.Missverständnis zwei ist die Frage: Kann ohne die Bestim-mung von Absatz 1ter das Referendum unterlaufen werden?Nein, lautet die klare Antwort; das Referendum kann durchStreichung dieser Bestimmung nicht unterlaufen werden.Zum einen, weil Verordnungen vom Bundesgericht immerüberprüft werden können; zum anderen, weil der Gesetzes-begriff in Absatz 1bis klar ist und regelt, was im Gesetz selbergeregelt werden muss. Die Befürchtung, wonach die Strei-chung dieser Bestimmung das Referendum aushöhlenkönnte, ist also absolut unrichtig.Wir erkennen im Ergebnis, dass dieser Absatz 1ter mehrQuelle von Missverständnissen und Unklarheiten ist, als erKlarheit bringt. Wenn er nur die allgemeine Regel wiederho-len soll – und darauf deuten die Beratungen des Nationalra-tes hin –, dann ist er überflüssig und wird mit Vorteil gestri-chen.Aus diesen Gründen beantragt Ihnen die Kommission ein-stimmig, bei Absatz 1ter und Absatz 2 an den Beschlüssenunseres Rates festzuhalten.
Angenommen – Adopté
Art. 159Antrag der KommissionAbs. 2Festhalten
Abs. 3MehrheitFesthaltenMinderheit(Frick, Büttiker, Reimann)Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Constitution fédérale. Réforme 192 E 22 septembre 1998
Bulletin officiel de l’Assemblée fédérale / Tiré à part
Art. 159Proposition de la commissionAl. 2Maintenir
Al. 3MajoritéMaintenirMinorité(Frick, Büttiker, Reimann)Adhérer à la décision du Conseil national
Abs. 2 – Al. 2
Frick Bruno (C, SZ), Berichterstatter: Über Artikel 159 Ab-satz 2 haben wir die Beratung bereits geführt (vgl. Art. 144).Ich bitte Sie, formell noch der Streichung zuzustimmen.
Angenommen – Adopté
Abs. 3 – Al. 3
Frick Bruno (C, SZ), Berichterstatter: Das ist die einzige Be-stimmung, bei der sich unsere Kommission nicht auf einengemeinsamen Nenner einigen konnte. Die Mehrheit möchtedas Instrument des Auftrages der Bundesversammlung anden Bundesrat aus dem Verfassungsentwurf streichen. DieMinderheit möchte ihn einführen – gemäss dem Beschlussdes Nationalrates. Sie sehen, dass ich die Minderheit ver-trete.Es ist im Rahmen der Differenzbereinigung aber zulässig,dass ich zuerst sachlich die Gründe der Kommissionsmehr-heit darlege, dass ich dann ebenso sachlich die Gründe derKommissionsminderheit anführe und dass ich dann erkläre,in welche Richtung mein Herzblut fliesst.Warum möchten der Bundesrat und die Mehrheit unsererKommission das Instrument des Auftrages auf Verfassungs-stufe nicht normieren? Es sind drei Gründe:Zum ersten befürchten der Bundesrat und die Mehrheit derKommission einen Eingriff in das delikate Gleichgewicht derGewaltentrennung. Es wird die Befürchtung geäussert, dassdamit das Parlament auch im Bereich, der dem Bundesratübertragen ist, ein Übergewicht erhalte.Zum zweiten wird geltend gemacht, dass «der Auftrag» ter-minologisch kein glücklicher Wurf sei. Das Wort «Auftrag»hat verschiedenste Bedeutungen, und zwar nicht nur um-gangssprachlich, sondern auch rechtlich. Der Begriff «Auf-trag», wie wir ihn im Regierungs- und Verwaltungsorganisa-tionsgesetz eingeführt haben, entspricht in der Tat nicht ganzdem Begriff «Auftrag», wie er in Absatz 3 normiert wird.Darum wird er als Quelle von Unklarheiten und Missver-ständnissen betrachtet.Zum dritten anerkennt der Bundesrat durchaus das Manko,dass das Parlament nur im Rahmen der GesetzgebungRichtlinien aufstellen kann, dass es aber dort, wo ein Bereichdem Bundesrat übertragen ist, kaum verbindliche Leitliniengeben kann – verbindlich im Sinne einer absoluten Verbind-lichkeit oder auch eine schwächere Verbindlichkeit in demSinne, dass der Bundesrat Abweichungen von den Leitliniendes Parlamentes begründen muss. Herr Bundesrat Koller hatin der Kommission ausgeführt, dass er dieses Manko im Rah-men der Staatsleitungsreform beheben wolle. Er hat auchbereits Ideen skizziert, wie die Mitwirkung des Parlamentesin diesem Bereich verbessert werden könnte.Diese drei Gründe haben die Mehrheit der Kommission über-zeugt, an der Streichung festzuhalten und Herrn BundesratKoller bzw. dem Entwurf des Bundesrates zuzustimmen.Nun wechsle ich den Kittel und sage, weshalb sich die Min-derheit für die Einführung des Instrumentes des Auftragesausspricht:1. Wir sind mit dem Nationalrat der Ansicht, dass mit diesemInstrument kein neues Recht geschaffen, sondern nur aufVerfassungsstufe festgehalten wird, was schon bisher Gel-tung hatte und lediglich umstritten war. Erinnern wir uns: Bis1986 durfte das Parlament auch im übertragenen Bereich
des Bundesrates Motionen erlassen. Der Nationalrat tut dasgemäss seinem Geschäftsreglement weiterhin, der Stände-rat hat darauf verzichtet und macht nur noch von der Empfeh-lung Gebrauch. Mit der Einführung des Instrumentes desAuftrages würde die alte Streitfrage endlich auf Verfassungs-stufe klar entschieden.2. Die Minderheit macht geltend, dass das Instrument desAuftrages bereits an verschiedenen Orten, auch im neuenRegierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetz, Einganggefunden hat. Dort dürfen wir Richtlinien vorgeben, die derBundesrat zu übernehmen hat und von denen er nur unterAngabe einer Begründung abweichen kann.3. Der Ständerat kennt bereits heute das Instrument derEmpfehlung an den Bundesrat. Gemäss Artikel 31 Absatz 3des Geschäftsreglementes hat der Bundesrat zu begründen,warum er einer unserer Empfehlungen nicht folgt. Insofernist also der Auftrag, wie er auf Verfassungsstufe festge-schrieben werden soll, nichts anderes als die heutige Emp-fehlung des Ständerates, allerdings mit Zustimmung beiderKammern. Wir vermögen darin keine Neuerung zu erken-nen, zumal der Nationalrat ja im übertragenen Bereich nachseinem Reglement motionieren kann. Es ist streng genom-men eine Klärung der heutigen Situation mit einer anderenUmschreibung; inhaltlich entsteht kein neues Recht des Par-lamentes.Zum Verhältnis von Ständerat und Nationalrat: Das Instru-ment des Auftrages hat im Nationalrat eine erdrückendeMehrheit gefunden. Die Kommission hat sich mit 22 zu 1Stimmen dafür ausgesprochen; das Plenum des Nationalra-tes ist seiner Kommission ohne Gegenantrag gefolgt. In derDiskussion war zu spüren, dass der Auftrag im Bewusstseindes Nationalrates einen sehr hohen Stellenwert hat.Aus diesen Gründen bin ich persönlich der Überzeugung,dass wir dem Nationalrat entgegenkommen und uns ihm an-schliessen müssen.
Forster Erika (R, SG): Ursprünglich habe ich mich dafür ein-gesetzt, dass das Instrument des Auftrages unter dem Rand-titel «Weitere Aufgaben der Bundesversammlung» einge-führt wird. Der Ständerat ist meinem Antrag leider nicht ge-folgt. Der Nationalrat indessen hat bereits zum zweiten Malentschieden, das Instrument des Auftrages aufzunehmen, al-lerdings unter dem Randtitel «Oberaufsicht», also in Artikel159. Da auch mir daran gelegen ist, keine weiteren Differen-zen zu schaffen, kann ich dem nationalrätlichen Beschlusszustimmen; dies in der Absicht, eine klare Zuweisung der Zu-ständigkeiten herbeizuführen, verbunden mit dem Koopera-tionsprinzip.Mit der vorgeschlagenen Verankerung würde – dies wurdeauch von meinem Vorredner betont – verfassungsmässig ge-klärt, dass die Bundesversammlung auf die Zuständigkeitendes Bundesrates einwirken kann bzw. wie weit sie einwirkenkann. Es würden also lediglich umstrittene Fragen geklärt.Während das Geschäftsreglement des Ständerates bekannt-lich in Artikel 25 klar umschreibt, was mit einer Motion ver-langt werden kann, kennt der Nationalrat keine entspre-chende Regelung. Dieser Mangel könnte ein für allemal be-hoben werden, und es könnte den unfruchtbaren Diskussio-nen ein Ende gesetzt werden.Die Tatsache, dass ungelöste Probleme bestehen, wird vomBundesrat nicht bestritten. Er will aber – so hat Herr Bundes-rat Koller im Nationalrat argumentiert – die Frage im Rahmender Staatsleitungsreform angehen und sie damit in einen en-geren Zusammenhang stellen. Das will auch die Mehrheit derKommission. Ob wir dannzumal zu einer besseren Lösungfinden, möchte ich bezweifeln.Nachdem auch davon auszugehen ist, dass die Aufnahmedieser Bestimmung in die Nachführung wohl kaum das Risikoin sich birgt, dass deshalb das Projekt Totalrevision Bundes-verfassung scheitern könnte, unterstütze ich den Antrag derMinderheit Frick.
Bloetzer Peter (C, VS): Ich beantrage Ihnen, der Mehrheitzuzustimmen und damit an unserer bisherigen Position fest-zuhalten.
22. September 1998 S 193 Bundesverfassung. Reform
Amtliches Bulletin der Bundesversammlung / Separatdruck
Die Einführung des Begriffes des Auftrages gemäss dem Be-schluss des Nationalrates und dem Antrag der Minderheitwäre zweifelsohne ein Eingriff in den sehr sensiblen Bereichder Gewaltentrennung. Ich bin der Meinung, dass es falschist, im Rahmen der Nachführung der Bundesverfassung ei-nen solchen Schritt zu tun. Wir sind ja alle mit dem Ruf nachmehr Handlungsfähigkeit des Staates konfrontiert; alles ruftnach Führungskraft. Mit der Einführung dieses Begriffes unddes Rechtes der Bundesversammlung zu Aufträgen an dieExekutive in deren Kompetenzbereich würden zweifelsohneFührungskraft und Handlungsfähigkeit geschwächt.Ich gebe zu, dass in diesem Bereich – wie das der Bundesratin der Kommission auch gesagt hat – ein gewisses Mankobesteht, dass Bedarf nach Klärung besteht. Aber ich bin derMeinung, dass mit der Fassung, mit der wir konfrontiert sind,keine Klärung vorgenommen wird, sondern dass die Verwi-schung der Grenzen und der Abgrenzung der Kompetenzenund damit die Unklarheit noch grösser werden.Aus diesem Grund beantrage ich Ihnen, festzuhalten, in derMeinung, dass es richtig ist, in der Staatsleitungsreformhierzu eine Klärung vorzunehmen und allenfalls mit dem Be-griff der Resolution oder mit einem anderen geeigneten Be-griff dem Bedarf nach politischer Steuerung durch die Bun-desversammlung auch im Bereich der Exekutive nachzu-kommen.
Rhinow René (R, BL): Wenn ich mich als Kommissionsprä-sident noch kurz äussere, dann nicht, weil Herr Frick sichnicht redlich Mühe gegeben hätte, die Auffassung der Mehr-heit korrekt wiederzugeben – leider kann er aber die Blumenwegen Abwesenheit nicht direkt entgegennehmen. Ich meldemich, weil sowohl aus Gründen, welche die Mehrheit vorge-tragen hat, als auch aus der Sicht der Minderheit einiges da-für spricht, hier weiterhin zumindest eine Differenz zum Na-tionalrat zu erhalten.Anlass dazu gibt folgende Situation: Für die Mehrheit sprichtzweifelsohne, dass dieses Instrument des Auftrages, wie esim Verfassungsentwurf formuliert ist, eine Neuerung darstellt.Man kann gewiss nicht sagen, es handle sich tel quel um gel-tendes Recht. Wir haben aber auch in anderen BereichenNeuerungen eingeführt. Man könnte sich aber auch auf denStandpunkt stellen, es vertrage durchaus diese Neuerung,das Parlament brauche ein solches Instrument, um im wach-senden Zuständigkeitsbereich des Bundesrates gewisseWeisungen erteilen zu können. Die Mehrheit sträubt sich ge-gen diesen Schritt im Rahmen der Nachführung. Die Minder-heit weist zu Recht darauf hin, dass ein solches Instrumentan sich nötig wäre.So oder so meine ich, dass mit dieser Formulierung – FrauForster hat darauf hingewiesen – im Rahmen der Oberauf-sicht eine Klärung nicht unbedingt herbeigeführt werdenkann, weil einerseits nicht ganz klar ist, wo die Grenzen die-ses neuen Instrumentes im Rahmen der Oberaufsicht wirk-lich zu ziehen sind. Andererseits gibt der Begriff des Auftra-ges zu Missverständnissen und Auslegungsproblemen An-lass. Auch diesbezüglich ist die Lösung nicht unbedingt über-zeugend.Dazu kommt noch ein anderes Problem: Auch wenn mansich in der Substanz mit einem solchen Instrument einver-standen erklären kann, leuchtet es nicht ganz ein, warum hiervon allen Instrumenten der Bundesversammlung nur geradeder Auftrag geregelt wird. Wir haben nach geltendem Verfas-sungsrecht und in der neuen Verfassung keine Bestimmung,welche die Instrumente des Parlamentes regelt, also die Mo-tion, das Postulat usw. Warum soll denn nur ein einzelnes In-strument in die neue Bundesverfassung aufgenommen wer-den? Oder ist der Auftrag hier nicht als Instrument zu verste-hen – auch das wurde schon gesagt –, sondern bloss alsOberbegriff für die Möglichkeiten und Gestaltungsinstru-mente der Bundesversammlung? Das Gesetz müsste dannkonkret sagen und definieren, wie diese Instrumente zu ge-stalten und zu benennen sind.Das sind Fragen, denen man meines Erachtens jetzt nochnachgehen müsste. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dassdie Weisheit des Nationalrates eine Lösung findet, ähnlich je-
ner, die wir bei den Einsichtsrechten der Kommissionen ge-funden haben. So könnte man dem Sinne nach sagen, derGesetzgeber bestimme die Instrumente der Bundesver-sammlung. Dabei würde klar, dass der Bundesrat hier ausGründen der Gewaltenteilung keine Einwendung machendarf, sondern dass es am Gesetzgeber ist, Instrumente desParlamentes zu bezeichnen.In diese Richtung – so meine ich – könnte eine vermittelndeLösung gehen. Wir haben sie in der Kommission noch nichtgefunden oder besprochen. Aber mit dem Festhalten ge-mäss Antrag der Mehrheit könnte man im Nationalrat einesolche Lösung finden, der sich dann möglicherweise auchder Bundesrat anschliessen würde.Ich bitte Sie aus diesen Gründen, gemäss dem Antrag derMehrheit an unserem Beschluss festzuhalten.
Koller Arnold, Bundesrat: Der Bundesrat ersucht Sie drin-gend, hier der Mehrheit Ihrer Kommission zuzustimmen. DieGründe sind im wesentlichen von Herrn Frick schon aufge-führt worden. Wir sind der Meinung, dass dieser neue Begriff«Auftrag» eine schlechte Begrifflichkeit ist, und die Verfas-sung sollte sich durch klare Begriffe auszeichnen. Denn mitdem Begriff «Auftrag» werden unbestrittenerweise zwei ganzverschiedene Dinge bezeichnet. Im Zuständigkeitsbereichdes Parlamentes sollen die Aufträge verbindlich sein, im Zu-ständigkeitsbereich des Bundesrates sollen sie dagegen, wiehier in Artikel 159 Absatz 3 gesagt wird, nur die Funktion ei-ner Richtlinie haben, von der in begründeten Fällen abgewi-chen werden darf. Nun sollte man in einem derartig sensiblenBereich wie dem Verhältnis der Gewalten, wo es um dieKompetenzabgrenzung zwischen Legislative und Exekutivegeht, mit klaren Begriffen arbeiten und nicht mit Begriffen, dieeigentlich nur zu Verwirrung und zu Missverständnissen füh-ren müssen.Der zweite Grund ist ein materieller. Wir sind der Überzeu-gung, dass das Parlament die politische Steuerung in ersterLinie über die Rechtsetzung und die Budgethoheit vollziehensoll. Ich habe aber anerkannt, dass es gewisse Bereichestaatlicher Tätigkeit gibt, wo diese politische Steuerung durchdas Parlament über Rechtsetzung und Budgethoheit nichtausreichend ist. Es ist vor allem an die Gebiete zu denken,wo konkurrierende Kompetenzen zwischen diesen beidenGewalten bestehen, beispielsweise im Bereich der Aussen-politik oder der äusseren oder inneren Sicherheit. Hierzuwerden wir Ihnen im Rahmen der Staatsleitungsreform neueVorschläge machen. Der Bundesrat wird aller Voraussichtnach noch in diesem Herbst dieses neue ReformpaketStaatsleitungsreform in die Vernehmlassung geben. Dortwerden wir ein neues parlamentarisches Instrument, die so-genannte Resolution, vorschlagen, die die Lücke, wo wederGesetzgebung noch Budgethoheit eine angemesseneSteuerung der politischen Prozesse durch das Parlament er-möglicht, füllt.Aus all diesen Gründen möchte ich Sie bitten, hier der Mehr-heit der Kommission zuzustimmen.Es kommt noch ein anderer Grund dazu: Wir haben uns jetztgenerell im Rahmen der Nachführung an das Prinzip gehal-ten, dass Neuerungen, die wir einführen, konsensfähig seinsollten. Hier, beim Auftrag, handelt es sich aus der Sicht desBundesrates auf jeden Fall eindeutig nicht um eine konsens-fähige Neuerung. Ich glaube, es wäre doch einigermassenangemessen, wenn Sie sich hier um eine – auch aus derSicht des Bundesrates – konsensfähige Neuerung bemühenwürden. Ich nehme den Gedanken des Präsidenten IhrerKommission gerne in die andere Kammer mit.
Abstimmung – VoteFür den Antrag der Mehrheit 31 StimmenFür den Antrag der Minderheit 7 Stimmen
Constitution fédérale. Réforme 194 E 22 septembre 1998
Bulletin officiel de l’Assemblée fédérale / Tiré à part
___________________________________________________________
Begrüssung – Bienvenue
Le président: Avant de continuer les débats, j’ai le plaisir desaluer à la tribune la présence de M. Miguel Angel Martinez,président de l’Union interparlementaire, qui passe quelquesheures à Berne pour discuter du nouveau siège que cette or-ganisation envisage de construire à Genève avec l’appui dela FIPOI. M. Martinez sera reçu tout à l’heure par le présidentde la Confédération. M. Martinez est bien connu de tous ceuxqui s’occupent de politique étrangère dans notre Conseil. Ilavait présidé l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Eu-rope, et le Parlement l’avait reçu officiellement le 16 mars1995. Nous lui souhaitons une cordiale bienvenue et l’assu-rons de l’attachement de l’Assemblée fédérale suisse àl’Union interparlementaire dont elle est membre depuis 107ans. Soyez le bienvenu! (Applaudissements)___________________________________________________________
Art. 161 Abs. 1 Bst. cAntrag der KommissionFesthalten
Art. 161 al. 1 let. cProposition de la commissionMaintenir
Präsident: In Artikel 161 ist der Entscheid bereits durch den-jenigen in Artikel 153a präjudiziert.
Angenommen – Adopté
Art. 166 Abs. 3Antrag der KommissionZustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Art. 166 al. 3Proposition de la commissionAdhérer à la décision du Conseil national
Frick Bruno (C, SZ), Berichterstatter: Die Differenz zum Na-tionalrat besteht in Artikel 166 Absatz 3. Es geht um die De-legation von Verwaltungsaufgaben an Dritte.Zwei Lösungen haben zur Diskussion gestanden, jene desStänderates sowie jene des Nationalrates. Der Ständeratwollte eine generelle Kompetenz des Bundesrates im Regie-rungs- und Verwaltungsorganisationsgesetz normieren, vonder der Bundesrat jeweils im Einzelfall hätte Gebrauch ma-chen können.Der Nationalrat hingegen will keine generelle Kompetenz desBundesrates, sondern in jedem einzelnen Sachbereich undGesetz soll die Kompetenz erteilt oder verweigert werden.Das ist eine eminent politische Frage: Soll die Diskussion nureinmal oder bei jedem Sachbereich von neuem geführt wer-den können? Unsere Kommission schlägt vor, der national-rätlichen Lösung zuzustimmen, weil sie näher bei der heuti-gen Regelung liegt. Dies geschieht auch im Sinn eines Ent-gegenkommens an den anderen Rat.
Angenommen – Adopté
Art. 172 Abs. 3Antrag der KommissionFesthalten
Art. 172 al. 3Proposition de la commissionMaintenir
Art. 173Antrag der KommissionAbs. 3Er kann, unmittelbar gestützt auf diesen Artikel, Verordnun-gen und Verfügungen erlassen, um eingetretenen oder un-
mittelbar drohenden schweren Störungen der öffentlichenOrdnung und inneren oder äusseren Sicherheit zu begeg-nen. Solche Verordnungen sind zu befristen.(1. und 2. Satz = Nationalrat; 3. Satz = streichen)Abs. 4Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Art. 173Proposition de la commissionAl. 3Il peut s’appuyer directement sur cet article pour édicter desordonnances et prendre des décisions, en vue de parer à destroubles existants ou imminents menaçant gravement la sé-curité extérieure ou la sûreté intérieure et l’ordre public. Cesordonnances doivent être limitées dans le temps.(1ère et 2e phrases = Conseil national; 3e phrase = biffer)Al. 4Adhérer à la décision du Conseil national
Frick Bruno (C, SZ), Berichterstatter: Ich möchte Artikel 172Absatz 3 und Artikel 173 Absätze 3 und 4 zusammen erläu-tern, weil deren Inhalt den gleichen Sachverhalt betrifft. Inbeiden Artikeln geht es um das Notverordnungsrecht desBundesrates: Artikel 172 betrifft die Beziehungen zum Aus-land und Artikel 173 die Bereiche der äusseren und innerenSicherheit.Der Nationalrat möchte, dass solche Verordnungen des Bun-desrates vom Parlament zu genehmigen und zugleich zu be-fristen sind. Die Befristung ist in unserem Sinn und liegt auchinnerhalb der Praxis des Bundesgerichtes. Insofern sind wiruns einig.Die Frage aber ist, ob das Parlament nachträglich Notverord-nungen des Bundesrates genehmigen soll. Wir lehnen dasab und bitten Sie, aus folgenden Überlegungen an unsererFassung festzuhalten:Zum ersten: Beim Notverordnungsrecht – und ich habe dieMarginalien zitiert – geht es ja wesentlich um Beziehungenzum Ausland. Wir erachten es als nicht klug, wenn dieserganze Bereich im Parlament, auf dem Marktplatz der Öffent-lichkeit, abgehandelt wird. Es gibt sehr viele Bereiche, wo derBundesrat solche Notverordnungen erlassen musste, die Be-ziehungen zum Ausland betreffen und nicht in aller Öffent-lichkeit und im Detail diskutiert werden sollen. Das ist die er-ste Überlegung.Zum zweiten: Die Bundesversammlung wird durch solcheNotverordnungen des Bundesrates in ihren Rechten nichtbeschnitten. Die Bundesversammlung hat es jederzeit in derHand, eine Bestimmung zu erlassen, die anders als jene desBundesrates lautet und damit vorgeht.Zum dritten: Solche Notverordnungen sind ja immer zu befri-sten. Beispielsweise hat das Bundesgericht die Notverord-nung des Bundesrates über das Waffenerwerbsverbot fürTürken in der Schweiz, die vor zwei Jahren erlassen wurde,überprüft und auch die Frage der Dauer zum Gegenstandseiner Überprüfung erklärt. Insofern ist keine Befürchtung amPlatz, dass «überlanges» Recht durch den Bundesrat Gesetzwürde.Zum vierten: Eine solche Notverordnung ist immer auch derKontrolle der Rechtssicherheit überlassen, weil sie beimBundesgericht immer angefochten werden kann. Der Bun-desrat agiert also nicht im unkontrollierten Raum, sondern ineinem recht kontrollierten. Aber diese Beschlüsse werdenzweckmässigerweise nicht noch einmal im Parlament disku-tiert. Die Mitwirkungsrechte des Parlamentes sind andere,und sie sind angemessen.Aus diesem Grund bitten wir Sie, in den Artikeln 172 und 173inhaltlich daran festzuhalten, dass wir auf die Genehmigungsolcher Notverordnungen verzichten.Eine Änderung ergibt sich lediglich in Artikel 173 Absatz 3.Wir schliessen uns im ersten Satz dem Nationalrat an. DerNationalrat definiert dort die «ausserordentlichen Um-stände». Der Ständerat hatte «ausserordentliche Umstände»lediglich als Generalklausel normiert, während der National-rat diese umschreiben will. Wir schliessen uns dieser Um-
22. September 1998 S 195 Bundesverfassung. Reform
Amtliches Bulletin der Bundesversammlung / Separatdruck
schreibung an, wollen allerdings bei Artikel 173 Absatz 3 dieGenehmigung durch das Parlament wiederum streichen.
Koller Arnold, Bundesrat: Ich bin um die Anträge Ihrer Kom-mission sehr dankbar. Der Befristung dieser Verordnungenkann der Bundesrat ohne weiteres zustimmen. Das ent-spricht ja auch der neueren bundesgerichtlichen Rechtspre-chung. Dagegen würde eine nachträgliche Genehmigungeindeutig übers Ziel hinausschiessen, und wir würden vor al-lem im Bereiche der Aussenpolitik unsere Handlungsfähig-keit verlieren. Ich stimme daher zu.
Art. 172 Abs. 3; 173 Abs. 3 – Art. 172 al. 3; 173 al. 3Angenommen – Adopté
Art. 173 Abs. 4 – Art. 173 al. 4
Frick Bruno (C, SZ), Berichterstatter: Hier schliessen wir unsdem Nationalrat an. Sie erinnern sich, dass unser Rat in derersten Beratung als Bedingung für die Einberufung der Bun-desversammlung zwar die zeitliche Dauer des Aktivdienstesvon mehr als drei Wochen als Bestimmung aufnahm, dasswir aber die Truppenzahl strichen. Wir hatten dies aus derÜberlegung heraus getan, dass die Anzahl der «Beine», dieZahl der Personen, ja nichts über die Stärke der Truppe aus-sagt: 500 Mann Panzertruppen sind etwas ganz anderes als500 Mann Betreuungstruppen.Es handelt sich aber – das ist zuzugeben – um einen politischsehr heiklen Bereich. In breiten Kreisen unserer Bevölkerungbestehen Befürchtungen, dass ohne zahlenmässige Be-schränkung in der Verfassung leichter Truppen in grosserAnzahl mobilisiert werden könnten, auch wenn es um die in-nere Sicherheit geht. Darum scheinen uns die 4000 Perso-nen gemäss Beschluss des Nationalrates ein Kompromiss zusein, der den politischen Befindlichkeiten der Schweiz ange-messen Rechnung trägt.Wir beantragen Ihnen, dem Nationalrat zuzustimmen.
Angenommen – Adopté
Art. 174 Abs. 3Antrag der KommissionEr kann gegen Verträge der Kantone unter sich und mit demAusland Einsprache erheben.(Folge des Beschlusses der Räte zu Art. 51 Abs. 2)
Art. 174 al. 3Proposition de la commissionIl peut élever une réclamation contre les conventions que lescantons ont conclues entre eux et avec l’étranger.(Conséquence de la décision des Conseils à l’art. 51 al. 2)
Frick Bruno (C, SZ), Berichterstatter: Diese Differenz ist le-diglich die Folge des bereits gefassten Beschlusses zu Arti-kel 51 Absatz 2.
Angenommen – Adopté
An den Nationalrat – Au Conseil national
Constitution fédérale. Réforme 196 E 1er octobre 1998
Bulletin officiel de l’Assemblée fédérale / Tiré à part
Achte Sitzung – Huitième séance
Donnerstag, 1. Oktober 1998Jeudi 1er octobre 1998
08.00 h
Vorsitz – Présidence: Zimmerli Ulrich (V, BE)
__________________________________________________________
96.091
Bundesverfassung.ReformConstitution fédérale.Réforme
Differenzen – Divergences
__________________________________________________________
C. Bundesbeschluss über die Reform der JustizC. Arrêté fédéral relatif à la réforme de la justice
Präsident: Wir kommen zu den Differenzen betreffend Ent-wurf C. Der Nationalrat hat am 25. Juni 1998 entschieden,unser Rat bereits am vergangenen 5. März.
Art. 114 Abs. 3Antrag der KommissionMehrheitZustimmung zum Beschluss des NationalratesMinderheit(Marty Dick, Danioth, Frick, Saudan)Festhalten
Art. 114 al. 3Proposition de la commissionMajoritéAdhérer à la décision du Conseil nationalMinorité(Marty Dick, Danioth, Frick, Saudan)Maintenir
Wicki Franz (C, LU), Berichterstatter: Die Kommission hatsich mit den Differenzen zu den Beschlüssen des Nationalra-tes eingehend auseinandergesetzt. Sie ersehen aus derFahne, dass die Mehrheit Ihnen beantragt, in einem Punkt –Artikel 114 – dem Nationalrat zuzustimmen und in zwei we-sentlichen Bestimmungen an der vom Ständerat beschlosse-nen Fassung festzuhalten, nämlich bei der Überprüfung vonBundesgesetzen und bei den Zugangsbestimmungen zumBundesgericht. Die übrigen Differenzen sind nicht eigentlichmaterieller Art. Ich schlage Ihnen vor, dass wir sofort zur Be-ratung der einzelnen Bestimmungen übergehen.Zu Artikel 114 Absatz 3: In der ersten Beratung hat der Stän-derat diese Bestimmung auf Antrag der Verfassungskommis-sion gestrichen. Wir hatten es als sachwidrig betrachtet, indie neue Justizvorlage eine besondere Subventionsbestim-mung aufzunehmen. Wir betonten aber, dass mit dem Weg-lassen von Absatz 3 zurzeit keine Streichung von Subventio-nen erfolge.Ihre Kommission hat nun mit 8 zu 4 Stimmen entschieden,dem Nationalrat zuzustimmen, also von einer Streichung ab-zusehen.
Ausschlaggebend für diesen Entscheid sind politische Grün-de. Im Hintergrund steht nämlich folgendes: Im Rahmen desFinanzausgleichsprojektes war ursprünglich vorgesehen, dieBereiche Anstalten, Straf- und Massnahmenvollzug sowieErziehung vollständig zu kantonalisieren. Die Diskussionenergaben aber, dass eine solche Kantonalisierung nicht mehrin Frage kommen kann. Im Rahmen des «runden Tisches»ist jedoch vorgesehen, Subventionsbeiträge zu senken. Die-ser Beitrag zur Erreichung des Sparziels wurde mit den Kan-tonen ausgehandelt.Sie sehen, dass wir einen Minderheitsantrag Marty Dick ha-ben. Ich bitte Sie meinerseits, der Mehrheit der Kommissionzuzustimmen.
Marty Dick (R, TI): Ce sujet a déjà été soulevé à différentesreprises. Il s’agit, selon l’avis de la minorité de la commission,d’établir une règle claire dans une constitution moderne quine doit plus prévoir, en tant que charte fondamentale, l’attri-bution de subventions. La proposition de la majorité est unefois de plus dictée par des considérations purement politi-ques, alors que nous estimons que l’attribution de subven-tions doit être prévue dans le cadre de lois fédérales, et pasdans le cadre de la constitution, comme c’est le cas pour latotalité des autres subventions.Je ne crois pas que les cantons vont se révolter, parce quecela n’est pas prévu dans la constitution. C’est pour une rai-son de cohérence que l’on établit un texte nouveau de laconstitution, qui ne peut plus être le cadre pour prévoir l’attri-bution de subventions.Le fait d’adopter la proposition de la minorité ne constituepas nécessairement un changement dans l’attitude de laConfédération quant aux subventions des établissementspénitenciers. Il s’agit d’aborder le problème de la répartitionentre la Confédération et les cantons dans le cadre qui est lesien, qui est celui de la nouvelle péréquation financière entreles cantons, et surtout, au niveau de lois fédérales. Si déjàon se donne la peine de faire une nouvelle constitution, quenous la fassions au moins moderne, cohérente et que nousne prévoyions pas ici et là encore des mesures de subven-tion.C’est dans cet esprit que la minorité de la commission pro-pose de maintenir, c’est-à-dire de biffer l’alinéa 3 du projet duConseil fédéral.
Koller Arnold, Bundesrat: Es geht hier mehr um ein verfas-sungsästhetisches als um ein materielles Problem. Als Siediesen Absatz 3 in der ersten Runde gestrichen haben, woll-ten Sie ja nicht die Bundeskompetenz aufheben, sondern Siewollten sie einfach auf der Stufe des Gesetzes und nichtmehr auf Verfassungsstufe festgehalten haben.Der Nationalrat hat in der ersten Runde anders entschieden,da flossen eben doch materielle Überlegungen mit hinein.Wenn man diesen Absatz 3 hier streicht, könnte das so aus-gelegt werden – hat man im Nationalrat befürchtet –, dasssich der Bund aus diesem Aufgabenbereich zurückzieht. ImRahmen des Finanzausgleichs gab es tatsächlich auch ein-mal ein entsprechendes Projekt. Dagegen haben sich dieKantone gewehrt. Im Rahmen des Stabilisierungsprogrammshaben wir auf diesem Gebiet am «runden Tisch» auch einenBeitrag geleistet, indem wir die Subventionssätze entspre-chend reduzieren.Da wir uns aber im Differenzbereinigungsverfahren befindenund um nicht den Eindruck aufkommen zu lassen, wir würdenuns aus diesem Aufgabengebiet total zurückziehen, möchteich Sie bitten, der Mehrheit der Kommission zuzustimmen.
Abstimmung – VoteFür den Antrag der Mehrheit 26 StimmenFür den Antrag der Minderheit 8 Stimmen
Art. 177 Abs. 4Antrag der KommissionAkte der Bundesversammlung und des Bundesrates könnenbeim Bundesgericht nicht angefochten werden. Ausnahmenbestimmt das Gesetz.
1. Oktober 1998 S 197 Bundesverfassung. Reform
Amtliches Bulletin der Bundesversammlung / Separatdruck
Art. 177 al. 4Proposition de la commissionLes actes de l’Assemblée fédérale et du Conseil fédéral nepeuvent pas être portés devant le Tribunal fédéral. Les ex-ceptions sont déterminées par la loi.
Wicki Franz (C, LU), Berichterstatter: Artikel 177 regelt die Zu-ständigkeiten des Bundesgerichtes. Bei Absatz 4 besteht eineDifferenz zum Nationalrat. Es geht um die Anfechtbarkeit derAkte der Bundesversammlung und des Bundesrates. Wir ha-ben diese Bestimmung in der Kommission noch einmal einge-hend diskutiert und uns insbesondere mit dem Begriff «Akte»auseinandergesetzt. Am Begriff «Akte» hängt vieles. Gemässder bundesrätlichen Botschaft umfasst der Begriff «Akte» nichtnur individuell-konkrete Anordnungen, sondern namentlichauch generell-abstrakte Regelungen, also Bundesratsverord-nungen und rechtsetzende Parlamentsbeschlüsse.Das Problem bei diesen Akten der Bundesversammlung unddes Bundesrates liegt aber darin, dass gewisse Entscheidein den Anwendungsbereich von Artikel 6 Ziffer 1 der Europäi-schen Menschenrechtskonvention (EMRK) fallen könnenund deshalb der gerichtlichen Beurteilung unterliegen müs-sen. Die EMRK verlangt nämlich in Artikel 6 Ziffer 1, dass fürzivilrechtliche Ansprüche und Verpflichtungen sowie fürStrafsachen der umfassende Zugang zu einem unabhängi-gen Gericht gegeben sein muss.Die logische Folge davon ist an sich die, dass Entscheide, dieMenschenrechtsgarantien beschränken, nicht in die Kompe-tenz von Bundesrat und Bundesversammlung zu legen sind.Wird dieser Grundsatz beachtet – so besagt es auch die Bot-schaft –, so bietet die Unanfechtbarkeit von bundesrätlichenAkten und von solchen der Bundesversammlung keine Pro-bleme. Gemäss der heutigen Gesetzgebung gibt es aberdurchaus Akte der Bundesversammlung und des Bundesra-tes, die überprüfbar sind und vom Bundesgericht untersuchtwerden müssen, beispielsweise die atomrechtlichen Bewilli-gungen und die bundesrätlichen Verordnungen.Der Antrag, den Ihnen die Kommission heute unterbreitet,bedeutet in der Sache selbst keine eigentliche Differenz zumNationalrat. Wir betonen mit dieser Formulierung die soge-nannte Regelvermutung für die Nichtanfechtbarkeit. Das Par-lament hat aber jederzeit die Möglichkeit – so sagen wir es –,im Gesetz Ausnahmen zu bestimmen.Ich bitte Sie namens der Kommission um Zustimmung.
Koller Arnold, Bundesrat: Der Bundesrat kann sich diesemneuen Antrag Ihrer Kommission anschliessen. Aus Gewal-tenteilungsgründen ist es richtig, dass Akte der Bundesver-sammlung und des Bundesrates grundsätzlich nicht der Be-schwerde an das Bundesgericht unterliegen. Das ist die Re-gel und wird in Artikel 177 Absatz 4 erster Satz gemäss An-trag Ihrer Kommission festgehalten.Diese Regel gilt übrigens schon heute. Eine Ausnahme bil-den erstinstanzliche Verfügungen des Bundesrates auf demGebiet des Dienstverhältnisses von Bundespersonal.Die genannte Ausnahme zeigt, dass es Bereiche gebenkann, in denen der Bundesrat oder die BundesversammlungEntscheide treffen, die wegen Artikel 6 Absatz 1 der EMRKgerichtlich überprüfbar sein müssen. Andere Beispiele findensich etwa im Atomrecht, wo de lege lata der Bundesrat bzw.die Bundesversammlung bedeutende Verfügungskompeten-zen besitzen, wobei Rechte gemäss EMRK tangiert sein kön-nen. Das ist heute auch noch auf dem Gebiet der Kranken-versicherung der Fall, wo der Bundesrat Entscheide über dieSpitallisten zu treffen hat.Aus all diesen Gründen möchte ich Sie bitten, dem AntragIhrer Kommission zuzustimmen.
Angenommen – Adopté
Art. 178Antrag der KommissionMehrheitAbs. 1, 2, 4Festhalten
Abs. 3Festhalten(die Änderung betrifft nur den französischen Text)
Minderheit(Frick, Paupe, Reimann, Schallberger)Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Art. 178Proposition de la commissionMajoritéAl. 1, 2, 4MaintenirAl. 3Il décide dans quelle mesure la loi fédérale doit être appli-quée.
Minorité(Frick, Paupe, Reimann, Schallberger)Adhérer à la décision du Conseil national
Wicki Franz (C, LU), Berichterstatter: Artikel 178, «Normen-kontrolle» bzw. «Überprüfung von Bundesgesetzen»: DieseBestimmung ist einer der beiden Schlüsselartikel der Justiz-reform. Im konkreten Anwendungsfall soll das Bundesgerichtdie Möglichkeit haben zu prüfen, ob Bundesgesetze mit denverfassungsmässigen Rechten und mit dem Völkerrechtübereinstimmen.Unser Rat hat am 5. März 1998 mit dem Stimmenverhältnisvon 3 zu 2 dieser beschränkten Verfassungsgerichtsbarkeitzugestimmt. Der Nationalrat hat diese Bestimmung mit 87 zu39 Stimmen abgelehnt. Aufgrund dieser Ausgangslagewurde in Ihrer Verfassungskommission nochmals die Grund-satzfrage gestellt, ob wir diese Verfassungsgerichtsbarkeitim Sinne der Vorlage wollen oder nicht. Formulierungsfragenstellten wir auf die Seite. Schliesslich entschied Ihre Kommis-sion mit 10 zu 2 Stimmen klar, am Ergebnis der ersten Bera-tung festzuhalten und sich nicht dem nationalrätlichen Neinanzuschliessen.Ich möchte hier nicht erneut alle Gründe anführen, welche fürdie bundesrätliche Vorlage sprechen. Zwei Gründe sind je-doch nochmals hervorzuheben, die klar für die Einführungder beschränkten Verfassungsgerichtsbarkeit sprechen unddie auch in Ihrer Kommission betont wurden:1. Die Mehrheit Ihrer Kommission betrachtet es insbeson-dere als föderalistisches Anliegen, dass die Verfassungsge-richtsbarkeit eingeführt wird. Heute können sich die Kantonenicht wehren, wenn der Bundesgesetzgeber ihre verfas-sungsrechtlichen Zuständigkeiten missachtet. Dadurch ent-steht ein Ungleichgewicht gegenüber dem Bund, denn derBund kann sich das Recht herausnehmen, Kompetenzüber-schreitungen der Kantone anzufechten. Die Kantone habenumgekehrt aber keine Möglichkeit, gegen den Bund vorzuge-hen, wenn er in die Kompetenzen der Kantone eingreift. Eswurde betont, gerade dieses föderalistische Argument müss-te den Ständerat eigentlich dazu veranlassen, dem Bundes-rat zu folgen und an seinem früheren Beschluss festzuhalten.2. Der Reformdruck ergibt sich aber auch aus der EMRK. DieStrassburger Instanzen – und seit einiger Zeit auch das Bun-desgericht selber – können prüfen, ob Bundesgesetze mitder EMRK vereinbar sind. Die EMRK ist damit vor Missach-tung durch den Bundesgesetzgeber geschützt, nicht aber dieuns näherliegende Bundesverfassung. Es kann nicht befrie-digen, dass wir als Bürgerinnen und Bürger ein Bundesge-setz wegen Verletzung der EMRK in Strassburg anfechtenkönnen, dass wir aber dann, wenn dieses gleiche Bundesge-setz unsere eigene Bundesverfassung verletzt, nichts tunkönnen. Dies ist ein Widerspruch in der heutigen Rechtslage,der praktisch dazu geführt hat, dass das Bundesgericht aufstillem Wege eine gewisse Verfassungsgerichtsbarkeit imBereich der EMRK eingeführt hat, um zu versuchen, diesenWiderspruch zu lösen.Dies nur zwei Argumente für das Ja zur beschränkten Verfas-sungsgerichtsbarkeit und somit zum Festhalten an unseremersten Beschluss.
Constitution fédérale. Réforme 198 E 1er octobre 1998
Bulletin officiel de l’Assemblée fédérale / Tiré à part
Ich bitte Sie, dem Antrag der klaren Mehrheit Ihrer Kommis-sion ebenfalls zuzustimmen.
Frick Bruno (C, SZ): Zuerst eine Vorbemerkung zur Fahne:Wir leben in diesen Tagen der Unklarheiten, wie nun Mehr-und Minderheiten in Kommissionen zustande gekommensind und wer tatsächlich dazugehört. Der Minderheit gehörengemäss Fahne vier Personen an; Herr Wicki hat aber von 10zu 2 Stimmen gesprochen. Die Verhältnisse waren so, dassan der formellen Abstimmung, die am späteren Abend statt-fand, bereits zwei Mitglieder, die an der Beratung teilgenom-men hatten, nicht mehr teilnehmen konnten. Hinzu kommt,dass die Verfassungskommission entschieden hat, dass min-destens zwei weitere Ständeräte, die ebenfalls gegen dieVerfassungsgerichtsbarkeit sind, nicht auf der Fahne aufge-führt werden dürfen, weil sie an der Beratung zu diesemTraktandum nicht selber teilnehmen konnten. Tatsächlich er-gäbe sich also, wenn man die ganze Kommission ansieht,eine Minderheit von mindestens sechs Mitgliedern der Kom-mission. Es besteht also keine «erdrückende Mehrheit» fürdie Verfassungsgerichtsbarkeit.Zur inhaltlichen Debatte: Wir haben sie in unserem Rat am5. März 1998 gründlich geführt; der Nationalrat hat dies am25. Juni 1998 getan. Die Argumente sind bekannt, an ihnenändert sich nichts. Inhaltlich liegen keine neuen Argumenteund Erkenntnisse vor.Zusammengefasst sind es drei Argumente, die die Minder-heit dazu führen, die Verfassungsgerichtsbarkeit des Bun-desgerichtes nicht in die Verfassung aufnehmen zu wollen:1. Das demokratische Argument, weil nach unserem Demo-kratieverständnis der Volkswille über den Gerichten steht.Das Volk soll entscheiden, nicht die Gerichte.2. Wir wollen keine Verpolitisierung des Bundesgerichtes.Das Bundesgericht würde mit der Einführung der Verfas-sungsgerichtsbarkeit zu einer entscheidenden politischen In-stanz.3. Die Verfassungsgerichtsbarkeit bringt keine Entlastung,sondern eine wesentliche Mehrbelastung des Bundesgerich-tes, weil künftig jeder aufmerksame Anwalt auch die Frageder Verfassungswidrigkeit eines Gesetzes aufwerfen muss.In der Tat – das ist zuzugeben – besteht ein Konfliktpunkt, denHerr Wicki dargelegt hat, nämlich im Bereich der EMRK, wodas Bundesgericht bereits heute eine beschränkte Verfas-sungsgerichtsbarkeit in Anspruch nimmt. Um nicht nachhervom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte inStrassburg gerügt zu werden, wird die Rüge bereits in Lau-sanne vorgezogen entgegengenommen. Das ist aber ein be-schränkter Systemfehler, der heute vorliegt. Es lohnt sichnicht, den kleinen Fehler gegen einen grossen einzutauschen!Wo stehen wir am heutigen Tag? Wir sind im ersten Durch-gang der Differenzbereinigung. Unser Rat hat am 5. März1998 der Verfassungsgerichtsbarkeit recht knapp zuge-stimmt, nämlich nur mit 19 zu 14 Stimmen, was etwa 57 Pro-zent der Stimmenden entspricht.Der Nationalrat hat die Verfassungsgerichtsbarkeit mit er-drückender Mehrheit abgelehnt, nämlich mit 87 zu 39 Stim-men, also mit über 70 Prozent. Der Nationalrat wird seineMeinung in dieser gewichtigen Frage nicht ändern. EineKehrtwendung ist in keiner Weise absehbar, sie wäre auchfür niemanden nachvollziehbar.Nun ist Beharrlichkeit oft eine Tugend; hier aber starr festzu-halten gefährdet die ganze Justizvorlage. Es wäre falsch,wenn unser Rat auf kurze Zeit recht haben wollte; recht be-kommen wird er am Ende ohnehin nicht.Die Verfassungsgerichtsbarkeit ist auch nicht nötig. Die Vor-lage der Justizreform enthält genügend Substanz. Siebraucht den «Bleifuss» der Verfassungsgerichtsbarkeit nicht,sie wird mit dieser Verfassungsgerichtsbarkeit nicht über dieRunden kommen und vor Volk und Ständen mit Bestimmtheitkeine Mehrheit finden.Aus diesen Gründen ist es besser, wenn wir uns bereitsheute der Einsicht nicht mehr verschliessen und die Verfas-sungsgerichtsbarkeit ablehnen. Wir verschaffen ihr so die nö-tige Akzeptanz. Wenn unser Rat beharrt, bauen wir grosseWiderstände gegen die ganze neue Justizvorlage auf.
Aus diesen Gründen bitte ich Sie im Namen der Minderheit,die einen erheblichen Teil der Kommission umfasst, nichtmehr zuzuwarten, sondern sich bereits heute dem National-rat anzuschliessen, um nicht die ganze Vorlage unnötig zugefährden.
Inderkum Hansheiri (C, UR): Herr Frick hat zu Recht gesagt,die Auslegeordnung sei da; es seien praktisch keine neuenArgumente mehr vorhanden. Ich möchte dem grundsätzlichzustimmen, aber doch darauf hinweisen, dass nach meinerAuffassung ein Argument in der letzten Debatte – ich habedas Amtliche Bulletin nochmals aufmerksam durchgelesen –zu kurz gekommen ist: Es ist das Prinzip der Gewaltentei-lung.Herr Schmid hat zwar vom Element der «checks and balan-ces» gesprochen. Er würde aber – wenn ich ihn richtig ver-standen habe – die Verfassungsgerichtsbarkeit nur in einemrein parlamentarischen System gelten lassen, und zwar alsSchutz des Volkes gegen die praktisch keinen Schranken un-terliegende Freiheit der Volksvertreter.Aber auch bei unserem System der repräsentativen Demo-kratie mit direktdemokratischen Elementen macht die Verfas-sungsgerichtsbarkeit in der Form der konkreten Normenkon-trolle Sinn; ja, sie ist sogar gerechtfertigt, und zwar insbeson-dere aufgrund des Gewaltenteilungsprinzips. Es dürfte wohlunbestritten sein, dass sich alle Staatsgewalten an die Ver-fassung zu halten haben und dass diese insbesondere füruns, das Parlament als Legislative, gilt.Es stellt sich nun die Frage, ob es wirklich so abwegig, sofalsch, so systemfremd oder – um mit Herrn Schmid zu spre-chen – sogar so fatal sei, eine ebenfalls staatliche Gewalt, diezumindest mittelbar auch durch das Volk legitimiert ist, indoch recht zurückhaltender Art und Weise darüber entschei-den zu lassen, ob ein Bundesgesetz verfassungsmässigeRechte verletze oder nicht. Ich meine nein, im Gegenteil: Esist von der Sache her sogar gerechtfertigt. Es geht nicht umeine abstrakte Normenkontrolle, und geprüft wird nicht, obder Anwendungsakt mit der Verfassung schlechthin überein-stimmt, sondern nur, ob verfassungsmässiges Recht oderVölkerrecht verletzt wird.Daher beantrage ich Ihnen, der Mehrheit zuzustimmen.
Aeby Pierre (S, FR): La question se pose en ces termes, defaçon très claire et très limpide: voulons-nous un Tribunal fé-déral qui vienne nous dire que la façon dont nous avons, parexemple, transposé l’initiative des Alpes dans notre législa-tion viole la constitution, sur la base d’un cas d’applicationconcret? Voulons-nous peut-être un jour, comme cela s’estpassé en Allemagne, d’un Tribunal fédéral qui vienne nousdire que la future législation sur l’interruption de grossesseviole plusieurs articles de notre constitution sur le droit à lavie, la dignité humaine, etc.? Voulons-nous d’un Tribunal fé-déral qui vienne peut-être un jour nous dire que la retraite desfemmes à 64 ans est contraire au principe de l’égalité dessexes? C’est ça le contrôle de la constitutionnalité des lois, àmes yeux. C’est donner au Tribunal fédéral la compétence depasser par-dessus les consensus politiques du moment, d’in-tervenir très concrètement dans les décisions politiques. Etceci dans un pays qui connaît à la fois l’initiative populaire etle référendum, donc dans un pays où la norme légale peutavoir été influencée directement par le peuple; peuple qui atoujours raison, mais qui n’est pas forcément toujours cohé-rent, de même que le Parlement n’est pas forcément toujourscohérent. Mais est-ce que des juges sont prêts à prendre encompte, à un moment donné, les implications politiques, leséventuels blocages d’une décision prise dans l’abstrait? Cesont ces arguments qui, après bien des hésitations, m’ontamené à soutenir la proposition de minorité défendue parM. Frick.Nous avons en plus, et ce sera mon dernier argument, unecertaine tradition, certaines sensibilités dans notre pays, et jem’étonne d’avoir entendu plusieurs fois le Conseil fédéralnous dire: «Attention! Lors de cet exercice, ne mettons pas lepeuple ou les cantons de mauvaise humeur. Tâchons detrouver des solutions qui favorisent un consensus le plus
1. Oktober 1998 S 199 Bundesverfassung. Reform
Amtliches Bulletin der Bundesversammlung / Separatdruck
large possible.» Ici, nous faisons fausse route, nous bascu-lons dans une forme de technocratie juridique, avec le seulargument, auquel je suis sensible: que notre Tribunal fédéraldécide lui, sinon c’est Strasbourg qui décidera; et nous nevoulons pas qu’un tribunal étranger décide chez nous. Dansce raisonnement, il y a à la fois un peu trop d’orgueil et surtoutune vision bien trop théorique des décisions, parfois difficiles,que le monde politique est appelé à prendre dans la «gouver-nance» d’un pays.Je me méfie de cette nouvelle compétence qu’on donneraitau Tribunal fédéral, et je vous propose de soutenir la propo-sition de minorité.
Rhinow René (R, BL), Berichterstatter: Gestatten Sie mir,dass ich als Kommissionspräsident doch nochmals auf denKerngehalt dieses spezifisch helvetischen und massge-schneiderten Modells der Verfassungsgerichtsbarkeit ein-gehe. Es wäre zwar reizvoll, auf die Argumente – namentlichvon Herrn Frick – im einzelnen einzugehen; ich tue es nicht.Es wäre reizvoll, Herrn Frick in Erinnerung zu rufen, dass dieVerfassungskommission 21 Mitglieder umfasst und dass da-mit das Anwachsen der Minderheit von vier Mitgliedern aufsechs noch keinen Erdrutsch bedeutet. Es wäre reizvoll,Herrn Frick in Erinnerung zu rufen, dass der Nationalrat aus200 Mitgliedern besteht und dass auch eine Mehrheit, dievon 87 Ratsmitgliedern gebildet wird, noch nicht so umwer-fend ist. Aber ich tue es nicht.Ich möchte auf die Elemente zurückkommen, die mir sehr amHerzen liegen, und zuerst nochmals zu diesem plakativenVorwurf Stellung nehmen, es gehe hier um das Verhältnisvon Volk und Richter. Wir wissen doch ganz genau, dass mitdem fakultativen Referendum auf Bundesebene die weitausüberwiegende Anzahl unserer Gesetze vom Parlament ohnewirkliche Beteiligung des Volkes verabschiedet werden. Wirwissen, dass das Nichtergreifen eines Referendums nichtreal als Zustimmung des Volkes zum ganzen Gesetz geltenkann. Das lesen wir höchstens in veralteten Lehrbüchern.Wir wissen auch, dass in den relativ wenigen Fällen, in denendas Volk tatsächlich an der Urne entscheidet, in der prakti-schen politischen Auseinandersetzung nicht um den Aspektder Verfassungsmässigkeit einer einzelnen Bestimmung ge-rungen wird, sondern um die politischen Anliegen dieses Ge-setzes. Damit sind gerade diejenigen Bestimmungen, diespäter im Anwendungsfall grundrechtlich heikel und im nach-hinein überprüfungsbedürftig werden könnten, kaum je vomVolk bewusst angenommen und entschieden worden. Esdürfte also, wenn wir praktisch und nicht rein theoretischüberlegen, nach menschlichem Ermessen und aller prakti-schen Vernunft gemäss kaum je vorkommen, dass das Bun-desgericht einer Gesetzesbestimmung die Anwendung ver-sagen wird, die wirklich vom Volk bewusst und tatsächlich soangenommen worden ist und in ihrer konkreten Ausgestal-tung so gewollt war.Bei dieser Sachlage kann man doch nicht im Ernst davonsprechen, mit der Verfassungsgerichtsbarkeit werde derRichter über das Volk gesetzt. Wenn jemand kontrolliertwird – ich hätte das eigentlich gerne von den Gegnern diesesInstrumentes gehört –, dann sind es wir Parlamentarier undParlamentarierinnen. Aber dann bitte ich, das auch so zusagen und nicht das Volk als fiktive Grösse vorzuschiebenund als Argument gegen die Verfassungsgerichtbarkeit zuverwenden.Nun aber zu den eigentlichen Anliegen: Worum geht esdenn? Es geht doch in erster Linie darum, die Freiheit derMenschen in diesem Lande besser zu schützen, die Freiheitder einzelnen, aber auch die Freiheit der Minderheiten in ih-rer verfassungsrechtlich geschützten Position.Wir wissen – Herr Wicki hat darauf hingewiesen –, dass dasBundesgericht in seiner jüngeren Praxis die Verfassungsge-richtsbarkeit gegenüber dem Gesetzgeber bei all denjenigenGrundrechten eingeführt hat, die in der EMRK verankert unddamit auch für die Schweiz verbindlich sind. Diese Praxis giltunangefochten und zu Recht, denn sie verhindert die unmög-liche und unwürdige Situation, dass ein Schweizer seinRecht in Strassburg suchen muss, weil es dem Bundesge-
richt in Lausanne verwehrt ist, die Prüfung des Gesetzes sel-ber vorzunehmen.Für zwei in unserer Wert- und Rechtsordnung grundlegendeRechte, die Handels- und Gewerbefreiheit und die Eigen-tumsgarantie, gilt diese Praxis aber nicht, weil diese Rechtein der EMRK nicht verankert sind. Mit dem Verzicht auf dieEinführung der Verfassungsgerichtsbarkeit ist gerade beidiesen Freiheitsrechten eine Überprüfung weiterhin nichtmöglich. Ich frage deshalb insbesondere diejenigen skepti-schen Kolleginnen und Kollegen in unserem Rat an, welchendie Wirtschaft und das Eigentum besonders am Herzen lie-gen: Wollen Sie das wirklich? Denn darum geht es real. Er-streckt sich Ihr Freiheitsbedürfnis nicht auf Wirtschaft und Ei-gentum? Erachten Sie hier die Allmacht des Gesetzgebersals absolut unbedenklich? Wollen Sie diesen Rechtsschutzbewusst ausklammern? Ist Ihnen diese Konsequenz be-wusst?Ich wende mich aber auch mit einer Frage an Kollegen undKolleginnen, die sich in der neuen Verfassung stark für denAusbau des Schutzes vor Diskriminierung eingesetzt ha-ben – etwa wegen des Alters, der Lebensform oder einer Be-hinderung. Sie haben sich auch für die Rechte von Jugendli-chen, für das Redaktionsgeheimnis, für das Streikrecht ein-gesetzt. Wollen Sie denn diese Garantien nur vor dem kanto-nalen Zugriff abschirmen? Wollen Sie diese wirklich derfreien Disposition durch den Bundesgesetzgeber aussetzen?Denn auch hier genügte der Schutz ohne die EMRK nicht. Ja,ich frage: Warum denn dieser vehemente Einsatz für die Än-derung und Neugestaltung der Verfassung in diesen Berei-chen, wenn Sie nicht bereit sind, auch den entsprechendenRechtsschutz einzurichten?Schliesslich eine letzte Frage an all diejenigen – ich glaube,es sind sehr viele in diesem Rat –, welchen die kantonale Au-tonomie am Herzen liegt: Mit der Verfassungsgerichtsbarkeitgeben wir den Kantonen ein wirkungsvolles Instrument in dieHände, ihre Autonomie gegen Übergriffe des Bundesgesetz-gebers zu schützen. Wollen Sie, die hier skeptisch sind, wirk-lich darauf verzichten? Wie wollen Sie das Ihren Behörden inden Kantonen erklären, die schon lange auf eine Verbesse-rung ihrer Rechte gegenüber dem Bund warten?Nein, wenn wir den Schutz aller Menschenrechte ernst neh-men, gerade auch in unserem Land, wenn wir klassische undneuere Freiheitsanliegen gleichermassen ernst nehmen wol-len, gerade auch gegenüber dem Bund, wenn wir die kanto-nale Autonomie gegen Übergriffe, gerade auch des Bundes,schützen wollen, gibt es für uns keinen anderen Weg als dieZustimmung zu Artikel 178.
Schmid Carlo (C, AI): Ich möchte zu einem Punkt des Vo-tums von Kollege Rhinow Stellung nehmen. Im übrigen binich mit Herrn Frick und Herrn Inderkum einverstanden. Es istalles gesagt.Ich wehre mich gegen die Aussage von Herrn Rhinow, dasses in der Schweiz dreierlei Sorten von Gesetzen gebe: Ge-setze, die nur die Bundesversammlung angenommen hat;Gesetze, die zwar das Volk durch Referendum angenommenhat, aber ohne darüber nachzudenken, ob sie verfassungs-mässig sind; Gesetze, die das Volk angenommen hat und beidenen es sich zudem überlegt hat, ob sie verfassungsmässigsind. Nur mit Bezug auf diese letzte Kategorie ist Herr Rhi-now der Auffassung, dass dort eine Antinomie zwischenVolksrecht und Richterrecht entstehen könnte.Herr Rhinow, das mag in akademischen Zirkeln ein gängigerTopos sein, aber es ist nicht die heutige Verfassungslage. Esist auch nicht die zukünftige Verfassungslage. Das Volkdurch solche Diskussionen irgendwo als eine virtuelle Veran-staltung verflüchtigen zu wollen ist nicht in Ordnung, auchnicht in einem akademischen Diskurs.Ich bin nach wie vor der Auffassung, dass unsere ganze po-litische Verfassung in der Schweiz wesentlich darauf beruht,dass wir das Volk als solches ernst nehmen; dass wir es na-türlich nicht personifizieren, so naiv ist wirklich niemand. Aberes ist die Resultante von Hunderttausenden von individuellenInteressenausprägungen. Das zur Beliebigkeit einer Mei-nung von drei, fünf oder sieben Einzelpersonen in ein Ver-
Constitution fédérale. Réforme 200 E 1er octobre 1998
Bulletin officiel de l’Assemblée fédérale / Tiré à part
hältnis setzen zu wollen – ich sage das in voller Schärfe – istmeines Erachtens ein Unding. Wenn wir noch die einzigenauf dieser Welt sein sollten, die das als Unding betrachten,dürften wir darauf sogar noch stolz sein.Ich glaube nicht – und ich durfte das seinerzeit Frau Stände-rätin Josi Meier in diesem Rat auch sagen –, dass das Volkin gleicher Art und Weise Fehler macht, wie ein Gericht siemachen kann. Frau Meier wies mich damals darauf hin, dassim Dritten Reich auch kein Verfassungsgericht bestandenhabe. Ich wies Frau Meier darauf hin, dass die Ermächti-gungsgesetze nun wirklich nicht vom deutschen Volk erlas-sen worden waren, dass aber sehr wohl prominente undgrossartige deutsche Juristen Wegbereiter des fürchterlich-sten Unrechtes gewesen waren, das wir in diesem Jahrtau-send erlebt haben.Ich will natürlich nicht gegen die Juristen ankämpfen – ich binauch einer. Aber man sollte nicht glauben, die Gerechtigkeitkomme von der Juristerei.
Frick Bruno (C, SZ): Herr Rhinow hat die Fragen am Schlussakademisch in den Raum geworfen. Ich möchte darauf einepraktische Antwort geben:Das Argument des Volkswillens, der über den Gerichten ste-hen soll, darf nicht einfach negiert werden. Nehmen Sie dieBeispiele praktisch. Wir führen vehemente Abstimmungs-kämpfe durch, beispielsweise über das AHV-Alter 64/65. DasVolk hat mit klarer Mehrheit entschieden, dass es diese Re-gelung will. Wir haben gestern intensive Diskussionen überdie Mehrwertsteuer geführt. Es ist möglich, dass das Volknach einem Referendum darüber entscheiden muss. EinigeThemen werden dabei Gegenstand des Abstimmungskamp-fes sein.Wenn das Volk in Kenntnis der Sachlage die politischen Fra-gen entschieden hat, ist es nicht richtig, dass sie im nachhin-ein vom Bundesgericht nochmals überprüft werden. Das Bun-desgericht hat nicht die blosse Freiheit oder Möglichkeit zukorrigieren; es müsste korrigieren. Wenn das Bundesgerichtdas AHV-Alter 64/65 als Verstoss gegen den Rechtsgleich-heitsgrundsatz erachten würde, dann müsste es das korrigie-ren. Damit setzen wir das Bundesgericht direkt über die de-mokratische Instanz des Volkes als bisher letzte Instanz.Ich glaube, wir sind mit dem Vertrauen ins Volk bisher gut ge-fahren. Unser Volk hat richtig entschieden. Es geht nicht umeinen Selbstschutz des Parlamentes. Das ist der Grund,warum ich das Wort ergriffen habe. Es geht darum, dassschliesslich das Volk das letzte Wort hat, und dabei soll esauch künftig bleiben.
Wicki Franz (C, LU), Berichterstatter: Zu verschiedenen Ar-gumenten möchte ich noch kurz etwas sagen:Zum Argument, dass die beschränkte Verfassungsgerichts-barkeit keine Entlastung des Bundesgerichtes bringe, son-dern eine Mehrbelastung: Ich habe die Frage der Mehrbela-stung in der Kommission gestellt, und die Verwaltung hat siedann auch eingehend beantwortet. Sie hat uns erklärt, mangebe zu, dass der Ausbau der Verfassungsgerichtsbarkeit zueiner gewissen Mehrarbeit führen würde.Es gibt aber auch Argumente, die zeigen, dass das nichtüberschätzt werden darf. Zum einen sind wenige Bestim-mungen in Bundesgesetzen bekannt, die möglicherweise ge-gen verwaltungsmässige Rechte verstossen, denn die Ver-fassungskonformität der Gesetze wird ja jeweils überprüft.Sie können das jeweils in den Botschaften nachlesen. Eskönnte allenfalls Bestimmungen geben, die später verfas-sungswidrig würden; aber es ist nicht anzunehmen, dass wirals Parlament bewusst gegen verfassungsmässige Rechteverstossen.Zum Argument, dass die Einführung der beschränkten Ver-fassungsgerichtsbarkeit eine gewisse Präventivwirkunghabe: Dieses Argument scheint mir wichtig. Das Parlamentwird der Frage, ob eine Bestimmung eines Bundesgesetzesallenfalls als verfassungswidrig zu bezeichnen sei, sorgfälti-ger nachgehen.Es ist im übrigen festzuhalten, dass nur Private die Verletzungverfassungsmässiger Rechte geltend machen können. Sie
können sich dabei nicht auf das ganze Verfassungsrecht be-rufen, sondern sie müssen konkret geltend machen, dass siein ihren verfassungsmässigen Rechten, in den Grundrechten,verletzt sind. Wenn die Rüge vorgebracht wird, dass das an-gewendete Bundesgesetz verfassungsmässige Rechte oderVölkerrecht verletze – und zwar bloss routinemässig, ohnedass das vor Bundesgericht substantiell begründet würde –,könnte bereits nach den allgemeinen Bestimmungen desheutigen Bundesrechtspflegegesetzes das vereinfachte Ver-fahren angewendet werden. Wenn eine Klage offensichtlichunbegründet ist, kann das Bundesgericht sie abweisen.Es ist also nicht von der Hand zu weisen, dass es zu einer ge-wissen Mehrbelastung kommen könnte. Wenn man aber be-denkt, was die Verfassungsgerichtsbarkeit an rechtsstaatli-chem Gewinn bringt, dann darf man diese allfällige Mehrbe-lastung nicht überbetonen.Noch ein Letztes zum Argument «Demokratie gegen Volks-wille»: Hier scheint mir, dass wir als Parlamentarier nicht nurdie eigene Position verteidigen dürfen. Wir müssen auch dieRechtsstellung der Bürgerinnen und Bürger vertreten. Wirmüssen unseren Mitbürgern doch das Recht geben, dasBundesgericht anrufen zu können, wenn wir hier im Parla-ment einmal einen Fehler gemacht haben. Wir müssen dasVolk ernst nehmen, und wenn wir das Volk ernst nehmen,müssen wir ihm die Möglichkeit geben, die dritte Gewalt, dieJustiz, anzurufen.Ich bitte Sie deshalb, dem Antrag der Mehrheit der Kommis-sion zuzustimmen.
Schiesser Fritz (R, GL): Das Votum von Herrn Schmid hatmich veranlasst, hier doch noch eine kurze Bemerkung zumachen. Herr Schmid und ich gehen von zwei unterschiedli-chen Verfassungsverständnissen aus. Herr Schmid, wir kom-men aus zwei Kantonen, die durchaus miteinander vergleich-bar sind. Wir vertreten hier zwei Kantone, welche die unmit-telbarste Form der direkten Demokratie noch beibehalten ha-ben.Die entscheidende Frage, die sich in diesem Zusammen-hang stellt, ist: Wer ist denn letztlich Garant der Verfassung?Garant der Verfassung in diesem Lande sind Volk undStände. Wenn Ihre Argumentation und auch diejenige vonHerrn Kollege Frick richtig ist, dass auf dem Weg der einfa-chen Gesetzgebung die Verfassung – materiell, nicht for-mell – abgeändert werden kann, dann wird dieser Grundsatzdurchbrochen, und es sind nicht mehr Volk und Stände, dieletztlich darüber entscheiden, was in diesem Land Verfas-sungsrecht ist. Die Position, die von Ihnen und von HerrnFrick vertreten wird, führt einfach dazu, dass das, was vonVolk und Ständen entschieden worden ist, auf dem Weg dereinfachen Gesetzgebung, also durch einen Beschluss desVolkes, abgeändert werden kann.Als Vertreter eines kleinen Kantons kann ich diese Auffas-sung politisch nicht teilen, ich kann sie aber auch rechtlichnicht teilen. Es stellt sich für mich die entscheidende Frage:Wer schützt die Verfassung? Da muss ich sagen: Das kannnicht nur ein Teil des Souveräns sein. Unter diesen Umstän-den und wenn ich sehe – Herr Rhinow hat darauf hingewie-sen –, in welch breitem Umfang wir die vorfrageweise Nor-menkontrolle aufgrund der Europäischen Menschenrechts-konvention bereits eingeführt haben, kann ich nicht einse-hen, warum man sich gegen diese relativ eingeschränkteErweiterung, die jetzt noch zu machen wäre, derart zur Wehrsetzt.Eine zweite Feststellung: Wir haben uns offenbar damit ab-gefunden, dass wir auf kantonaler Ebene eine Verfassungs-gerichtsbarkeit durch das Bundesgericht haben. Aber das,was jetzt an die Wand gemalt wird, ist doch auf kantonalerEbene nicht eingetreten. Es kann doch keine Rede davonsein, dass auf kantonaler Ebene durch Entscheide des Bun-desgerichtes im Bereich der Verfassungsgerichtsbarkeit der-artige Unzulänglichkeiten entstanden wären, dass wir dieseEntscheide nicht auch auf eidgenössischer Ebene ertragenkönnten.Zu Herrn Frick: Herr Frick hat gesagt, politische Fragen wür-den vom Volk entschieden, und dann sollten nicht ein paar
1. Oktober 1998 S 201 Bundesverfassung. Reform
Amtliches Bulletin der Bundesversammlung / Separatdruck
Richter die entsprechenden Fragen politisch noch einmalentscheiden. Ich meine, das sei ein unrichtiges Verständnisder Verfassungsgerichtsbarkeit. Der Massstab der Verfas-sungsgerichtsbarkeit muss ein rechtlicher sein und nicht einpolitischer. Natürlich haben Urteile im Bereich der Verfas-sungsgerichtsbarkeit auch immer eine politische Bedeutung.Wie aber die neue Lösung auszusehen hat, das entscheidetnach wie vor der Gesetzgeber bzw. der Verfassunggeber indiesem Land.Wir könnten die Diskussion wahrscheinlich noch sehr viellänger weiterführen. Es ist für mich eine Grundsatzfrage, wel-chen Stellenwert wir dem Schutz des obersten Gesetzes, derVerfassung, in diesem Staat einräumen. Für mich gibt es die-sen Schutz durch die Verfassungsgerichtsbarkeit, und das istkeine Antinomie zur Demokratie. Es geht darum, dass wirdem obersten Willen von Volk und Ständen mit diesem In-strument auch in den Bereichen der Handels- und Gewerbe-freiheit und der Eigentumsgarantie zum Durchbruch verhel-fen.Ich bitte Sie, der Kommissionsmehrheit zu folgen.
Rhinow René (R, BL), Berichterstatter: Herr Schmid hatmich falsch verstanden, oder ich habe mich nicht klar ausge-drückt.Ich habe nicht drei Volkskategorien begründet, und ich ha-be – so meine ich – auch nicht akademisch argumentiert, imGegenteil. Gestatten Sie mir, diesen Vorwurf umzukehren;Sie waren sehr, sehr akademisch. Ich habe nur gesagt, dassbei Gesetzen, bei denen das Referendum nicht ergriffenwird, kein realer Volkswille bestehe, welcher sich von A bis Zauf alle Bestimmungen dieses Gesetzes erstrecke. Wennman das bestreitet, ist man doch sehr akademisch.Wir rechnen in unserer Demokratie zwar solche Parlaments-entscheide dem Volk zu, aber real gesehen hat doch einfachkein Teil des Volkes opponiert, und deshalb wurde das Refe-rendum auch nicht ergriffen. Und man kann schon gar nichtsagen, das Volk habe in einem solchen Fall die Verfassungs-mässigkeit beurteilt. Das war meine Aussage – und nur das,Herr Schmid.Zu Herrn Frick: Ja, das Bundesgericht wird vielleicht einmalin die Pflicht genommen, sich zu solchen Beschlüssen, dieSie erwähnt haben, zu äussern. Aber das kann es heuteschon tun. Wir sind uns darüber einig, dass das Bundesge-richt auch Bestimmungen von Bundesgesetzen in den Erwä-gungen überprüfen darf, aber es hat sie im Ergebnis anzu-wenden. Mit der neuen Lösung beschliessen wir aber aucheinen Absatz 3, den Sie nicht erwähnt haben. Dort heisst es:«Es (das Bundesgericht) entscheidet, inwieweit das Bundes-gesetz .... anzuwenden ist.» Das heisst, dass das Bundesge-richt nicht verpflichtet ist, eine solche Gesetzesbestimmungnicht anzuwenden. Es kann sehr wohl zum Schluss kommen,dass in einer derartigen Frage zwar rechtliche Argumente ge-gen die Lösung bestünden, dass es aber dem Bundesge-setzgeber Zeit gebe, die Frage nach seinem Willen und nachseinen zeitlichen Vorstellungen zu lösen. Dabei kann es dasGesetz trotzdem weiterhin anwenden. Die Konsequenz, dieSie als zwingend beschrieben haben, trifft also nicht zu.
Koller Arnold, Bundesrat: Wir führten über das Grundsatz-problem der Ausdehnung der konkreten Normenkontrolle aufBundesgesetze im Bereich des Schutzes der verfassungs-mässigen Rechte der Bürgerinnen und Bürger und des Völ-kerrechtes – und nur darum geht es – schon das erste Maleine sehr gründliche Diskussion. Einige Aspekte sind jetztnoch einmal herausgearbeitet worden. Ich kann mich des-halb auch kurz fassen.Ich möchte Sie dringend bitten, an Ihrem Beschluss festzu-halten und der Mehrheit Ihrer Kommission zuzustimmen. DerBundesrat ist überzeugt, dass wir das den Kantonen – HerrWicki hat hier zu Recht darauf hingewiesen – schuldig sind,die damit in einem wichtigen Punkt die Gleichstellung mitdem Bund erfahren. Denn die Kantone sollen sich, wie dasder Bund im umgekehrten Fall ja schon seit langem tun kann,gegen eine kompetenzwidrige Gesetzgebung des Bundes-gesetzgebers wehren können.
Herr Schiesser hat vorhin zu Recht ausgeführt: Die Einfüh-rung dieser konkreten Verfassungsgerichtsbarkeit wird aucheine massgebliche Stärkung des Föderalismus nach sich zie-hen, weil der eigentliche Verfassunggeber eben Volk undStände sind und wir heute keinerlei Garantie dafür haben,dass der Bundesgesetzgeber die Grundwerte der Verfas-sung bei der einfachen Gesetzgebung dann auch tatsächlichbeachtet. Ich darf Sie daran erinnern: In der Vernehmlassunghat sich ein einziger Kanton gegen die Verfassungsgerichts-barkeit ausgesprochen; alle Kantonsregierungen mit einereinzigen Ausnahme haben sich für die Verfassungsgerichts-barkeit ausgesprochen.Wir sind die Einführung der Verfassungsgerichtsbarkeit aberauch unserem Volk schuldig, unseren Bürgerinnen und Bür-gern, welche die Verfassungsgerichtsbarkeit offensichtlichwünschen. Ich habe es im Nationalrat gesagt und wiederholees hier: Die Schweiz wäre nicht das freiheitliche Land, das sieheute ist, wenn wir 1874 nicht die Verfassungsgerichtsbarkeitgegenüber den Kantonen eingeführt hätten. Jetzt haben wirdie Verfassung etwa 140mal geändert, und diese Verfas-sungsänderungen hatten meistens zusätzliche Kompeten-zen für den Bund zur Folge. Was noch im letzten Jahrhundertgegenüber den Kantonen billig war, muss heute gegenüberdem Bund recht sein.Mit dieser Justizreform machen wir keine Nachführung mehr.Das ist der erste systematische Reformteil. Wir wollen hier –und das beinhaltet natürlich auch politisch mehr Risiken alsdie Nachführung – im Bereich der Justizverfassung eine Or-ganisation für das nächste Jahrhundert schaffen. Es ist dochschon heute unwürdig, dass unsere Bürgerinnen und Bürger,wenn sie sich gegen die Anwendung eines Bundesgesetzeswehren wollen, das sie für grundrechtswidrig halten, sichzwar auf die EMRK-Rechte – die, mit Ausnahme der Eigen-tumsgarantie und der Handels- und Gewerbefreiheit, wie dasHerr Rhinow ausgeführt hat, weitestgehend mit den verfas-sungsmässigen Rechten in unserer Bundesverfassung über-einstimmen – berufen können, nicht aber auf die uns näherliegende Bundesverfassung. Man muss kein Prophet sein:Dieser Trend zur Anrufung des Strassburger Gerichtshofeswird ganz unabhängig von der EU-Frage zunehmen.Ich bin überzeugt, dass Sie sich viel schneller erneut mit die-ser Frage werden auseinandersetzen müssen, als das denGegnern lieb sein wird, wenn Sie heute die Verfassungsge-richtsbarkeit ablehnen. Deren Einführung ist im nächstenJahrhundert unausweichlich, und zwar schon sehr bald, undwir möchten doch eine Verfassung für das nächste Jahrhun-dert schaffen.Ein letzter Gedanke: Man sagt, man müsse das Volk vor denRichtern schützen. Geben wir doch endlich dem Volk dieChance, tatsächlich darüber abzustimmen, ob es wirklich vorden Verfassungsrichtern geschützt werden will! Meine Erfah-rung ist eine total andere. In der Volksdiskussion haben sichüber 80 Prozent der Bürgerinnen und Bürger, die Stellung ge-nommen haben – es waren mehrere tausend –, klar für dieVerfassungsgerichtsbarkeit ausgesprochen, weil sie das alseine schwerwiegende Rechtsschutzlücke im Bund empfin-den. Also schützen wir doch das Volk nicht vor sich selber! Ge-ben wir ihm endlich die Chance, sich darüber auszusprechen.Halten Sie an Ihrem Beschluss fest!
Abstimmung – VoteFür den Antrag der Mehrheit 26 StimmenFür den Antrag der Minderheit 11 Stimmen
Art. 178aAntrag der KommissionAbs. 1, 1bis, 2, 2bisFesthaltenAbs. 3Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Art. 178aProposition de la commissionAl. 1, 1bis, 2, 2bisMaintenir
Constitution fédérale. Réforme 202 E 1er octobre 1998
Bulletin officiel de l’Assemblée fédérale / Tiré à part
Al. 3Adhérer à la décision du Conseil national
Wicki Franz (C, LU), Berichterstatter: In Artikel 178a geht esum den Zugang zum Bundesgericht. Hier beantragt Ihnen dieKommission einstimmig, am Beschluss unseres Rates fest-zuhalten. Die Fassung, wie sie der Ständerat am 5. März1998 klar gutgeheissen hat, war das Ergebnis einer langenDiskussion, auch mit Exponenten der nationalrätlichen Ver-fassungskommission. Die von unserem Rat beschlosseneLösung statuiert den Grundsatz, dass der Zugang zum Bun-desgericht bei grundlegenden Rechtsfragen immer gewähr-leistet werden soll. Die Ausnahmen sind auf Gesetzesstufezu regeln.Unserer Kommission schien es insbesondere wichtig, die Be-stimmung in Absatz 2bis in der von uns beschlossenen For-mulierung beizubehalten. Wir betrachten diese als wesent-lich besser, weil sie als objektives Kriterium die «grundsätzli-che Bedeutung» verwendet. Hingegen nimmt die Bestim-mung des Nationalrates auch auf subjektive KriterienRücksicht, indem auf die sogenannte «untergeordnete Trag-weite» hingewiesen wird. Die Frage der offenkundig unbe-gründeten oder aussichtslosen Beschwerde, die der Natio-nalrat bereits auf Verfassungsstufe regeln will, kann durch-aus auf Gesetzesstufe aufgenommen werden.Namens Ihrer Kommission bitte ich Sie daher, an unseremfrüheren Beschluss festzuhalten.
Angenommen – Adopté
Art. 180Antrag der KommissionZustimmung zum Beschluss des NationalratesProposition de la commissionAdhérer à la décision du Conseil national
Angenommen – Adopté
Ziff. IIIAntrag der KommissionFesthalten
Ch. IIIProposition de la commissionMaintenir
Wicki Franz (C, LU), Berichterstatter: Bei Ziffer III gibt es einekleine Differenz formeller Art. Unser Rat hatte seinerzeit aufVorschlag der Verwaltung eine Formulierung verabschiedet,welche die Anpassung von Volksinitiativen etwas einfacherumschreibt. Die Formulierung unterscheidet nicht wie jenedes Nationalrates in zwei Absätzen, ob die Verfassungsän-derung vor oder nach Inkrafttreten der Vorlage C von Volkund Ständen angenommen wurde. In beiden Fällen soll aberdie Bundesversammlung die Verfassungsänderung formellan die neue Bundesverfassung anpassen. Inhaltlich gibt esalso keinen Unterschied. Die Version des Ständerates istaber wesentlich einfacher abgefasst.Wir beantragen Ihnen daher einstimmig, an unserem Be-schluss festzuhalten.
Angenommen – Adopté
An den Nationalrat – Au Conseil national
7. Oktober 1998 S 203 Bundesverfassung. Reform
Amtliches Bulletin der Bundesversammlung / Separatdruck
96.091
Bundesverfassung.ReformConstitution fédérale.Réforme
Differenzen – Divergences
___________________________________________________________
A1. Bundesbeschluss über eine neue Bundesverfas-sung (Titel, Art. 1–126, 185)A1. Arrêté fédéral relatif à une mise à jour de la Consti-tution fédérale (titre, art. 1–126, 185)
PräambelAntrag der KommissionAbs. 2aFesthaltenAbs. 3, 5Zustimmung zum Beschluss des NationalratesAbs. 5aFesthalten
PréambuleProposition de la commissionAl. 2aMaintenirAl. 3, 5Adhérer à la décision du Conseil nationalAl. 5aMaintenir
Rhinow René (R, BL), Berichterstatter: Wie Sie der Fahneentnehmen können, befinden wir uns nun in der zweitenRunde des Differenzbereinigungsverfahrens und damit in derdritten Runde insgesamt. Wir werden also in diesem Bereichder Verfassung, von der Präambel bis zu Artikel 57g, dasletzte Mal in diesem Differenzbereinigungsverfahren zuWorte und zum Beschluss kommen. Es ist absehbar, dass eseine Einigungskonferenz geben wird, die voraussichtlichEnde der zweiten Woche der Wintersession stattfinden wird.Von den rund 25 Differenzen in diesem Bereich haben wir dieHälfte in der Kommission bereinigt, bei der anderen Hälftebeantragen wir Festhalten, und zwar, wie wir meinen, aus gu-ten Gründen.Die Berichterstattung ist wie immer auf die Sprecher der ver-schiedenen Subkommissionen aufgeteilt, wobei ich HerrnAeby auf seinen Wunsch hin vertreten werde, weil er an derKommissionssitzung nicht anwesend sein konnte.
Frick Bruno (C, SZ), Berichterstatter: In der Präambel wirdangestrebt, die Leitideen komprimiert und schlank aufzuzäh-len, also das ideelle Dach darzustellen, unter dem wir «imTrockenen» die Verfassung schaffen. Sie soll die wesentli-chen Elemente dieses ideellen Daches wiedergeben, abersie soll nicht einzelne Bestimmungen der Verfassung wieder-holen bzw. vorwegnehmen.In diesem Sinne haben wir in der Kommission wie folgt – ein-stimmig – beschlossen:Wir möchten bei Absatz 5 nachgeben und uns dem Be-schluss des Nationalrates anschliessen. Es ist eine sprachli-che Straffung, die lediglich in der deutschen Fassung erfolgt,nicht aber in der französischen; der französische Text ist be-reits vorher «rund» gewesen und daher nicht zu korrigieren.Zwei Differenzen möchten wir dagegen bestehenlassen:In Absatz 2a möchte der Nationalrat den Passus «In der Ver-antwortung gegenüber der Schöpfung» einfügen. Wir möch-ten diesen Passus aus folgenden Gründen nicht aufnehmen:
Wir glauben, dass er in einem gewissen Sinne eine Wieder-holung der Anrufung Gottes darstellt und dass er die Vorweg-nahme von Artikel 2 ist, der Bestimmung über die Nachhaltig-keit. Dort werden wir dem Beschluss des Nationalrates zu-stimmen. Im Bestreben, die Bestimmung knapp zu halten,möchten wir diesen Absatz streichen. Er hat in seiner Aus-sage in der französischen Fassung insbesondere auch dieKommissionsmitglieder welscher Zunge gestört.Den Absatz 5a möchten wir ebenfalls weglassen. DieseKlausel ist eine Anleihe aus der Präambel von Herrn Muschg.Die Muschgsche Fassung ist eine sprachlich durchaus sehrschöne und inhaltlich wertvolle Schöpfung, aber sie beruhtauf einem anderen Konzept. Ein Element aus der PräambelMuschgs in unsere Präambel hinüberzunehmen, bedeuteteinmal, dass die Präambel lange wird; sie soll aber konzis,knapp bleiben. Es ist aber vor allem so, dass die PräambelMuschgs stilistisch ganz anders ist. Während unsere Präam-bel sehr nüchterne Anknüpfungen enthält – «im Willen», «imBewusstsein» usw. –, ist der Einschub aus der MuschgschenPräambel sprachlich ein ganz anderer. Er ist nicht bloss einAppell an den Staat allgemein, sondern er enthält sogar ei-nen individuellen Appell an den Bürger. Die MuschgscheFassung passt in der Sprache und im Aufbau nicht in unserePräambel – so wertvoll sie auch ist.Wir haben uns nun einmal für die Version entschieden, dieuns Herr Bundesrat Koller und sein Departement vorgelegthaben. Das Ganze soll nicht ein Flickwerk werden, indemeinzelne Elemente, die sprachlich anders sind, in unsere Prä-ambel hinübergenommen werden.Die Verfassungskommission bittet Sie einstimmig, ihrem An-trag zu folgen.
Angenommen – Adopté
Art. 2Antrag der KommissionAbs. 2Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Abs. 2bisMehrheitFesthaltenMinderheit(Gentil)Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Art. 2Proposition de la commissionAl. 2Adhérer à la décision du Conseil national
Al. 2bisMajoritéMaintenirMinorité(Gentil)Adhérer à la décision du Conseil national
Abs. 2 – Al. 2
Frick Bruno (C, SZ), Berichterstatter: Es geht in Artikel 2 umzwei Differenzen, die ich Ihnen darzulegen habe. Sie habeneinen gewissen Zusammenhang.Vorerst geht es in Absatz 2 um die Frage der Nachhaltigkeit:Soll die nachhaltige Entwicklung als Staatszweck derSchweizerischen Eidgenossenschaft aufgenommen wer-den? Der Nationalrat hatte sich dafür entschieden, im Sinneeiner umfassenden Nachhaltigkeit, die nicht nur das ökologi-sche, sondern auch das ökonomische, das soziale und daskulturelle Element enthält. Nachdem sich unser Rat ur-sprünglich dagegen ausgesprochen hatte, sind wir in der er-sten Differenzbereinigung teilweise dem Nationalrat gefolgtund haben die Nachhaltigkeit als Adverb eingefügt: «Sie»,d. h. die Eidgenossenschaft, «fördert nachhaltig ....»
Constitution fédérale. Réforme 204 E 7 octobre 1998
Bulletin officiel de l’Assemblée fédérale / Tiré à part
In der zweiten Differenzbereinigung schliesst sich unsereKommission mit 11 zu 1 Stimmen dem Nationalrat an, undzwar haben wir ein Konzept vor Augen: Wir sind bereit, dieNachhaltigkeit als Staatszweck aufzunehmen, möchten aberausdrücklich an der Nachhaltigkeit festhalten, wie wir sie inArtikel 57k für die Raumplanungs- und die Umweltschutzge-setzgebung vorgesehen haben. Der Nationalrat hat nun inseinen Beschlüssen, die er vorgestern gefasst hat, diesesKonzept bereits vorweg gutgeheissen, indem er sich bei Arti-kel 57k unserem Beschluss angeschlossen hat. In diesemSinne bitten wir Sie, dem Nationalrat entgegenzukommen.Absatz 2bis hingegen möchten wir Ihnen – im deutlichen Ver-hältnis von 13 zu 2 Stimmen – zur Streichung vorschlagen.Wir fragen uns, ob die Sorge der Eidgenossenschaft für dieChancengleichheit als Staatszweck normiert werden soll. Wirmöchten davon absehen; nicht etwa, weil die Chancengleich-heit nicht Aufgabe der Eidgenossenschaft wäre. Aber wirmüssen uns vor Augen halten, dass wir bei den Staatszwek-ken nur jene Zwecke aufgeführt haben, welche die Gesamt-heit der Eidgenossenschaft betreffen und welche nichtRechte oder Chancen einzelner Personen untereinander re-geln wollen. Die Pflichten des Staates gegenüber den einzel-nen werden in späteren Teilen der Verfassung geregelt; na-mentlich ist es auch Aufgabe der Sozialziele, die wir jetzt ein-gefügt haben, für die Chancengleichheit zu sorgen. Ichmöchte also klarstellen, dass wir uns in keiner Weise gegendie Gewährleistung der Chancengleichheit durch den Bundaussprechen, sondern dass sie bei den Sozialzielen sinnge-mäss enthalten sein muss; dort haben wir sie ja aufgenom-men.Zusammengefasst: Wir möchten uns also im wichtigen Punktder Nachhaltigkeit dem Nationalrat anschliessen; aber denebenfalls wichtigen Punkt der Chancengleichheit möchtenwir namentlich aus systematischen Gründen im Rahmen derSozialziele sinngemäss verwirklicht wissen.
Angenommen – Adopté
Abs. 2bis – Al. 2bis
Gentil Pierre-Alain (S, JU): A cet alinéa également, je vouspropose de vous rallier à la décision du Conseil national. Lerapporteur de notre commission a dit tout à l’heure avec per-tinence qu’il n’était pas possible de demander à l’Etat d’assu-rer la pleine et totale égalité des chances. Ce serait un butidéal et probablement difficile à atteindre et à mettre, dansune forme aussi absolue, à l’article 2 de notre constitution.Mais j’attire votre attention sur un certain nombre d’éléments.Le premier est que la formulation retenue par le Conseil na-tional n’est pas une formulation absolue. On dit très claire-ment: «Elle veille à garantir une égalité des chances aussigrande que possible entre les citoyens.» Il n’est donc pasposé une égalité des chances en absolu, mais un but auquelon doit tendre. Cela me semble tout à fait compatible avecune formulation constitutionnelle.Il n’est pas soutenable de dire, comme l’a prétendu tout àl’heure le rapporteur de notre commission, que l’égalité deschances doit être confinée simplement aux articles qui traitentdes problèmes sociaux. C’est un but général et il me paraîtqu’il y a entre l’alinéa 1er – l’idée de la prospérité commune,du développement durable – et cette égalité des chances unlien qui montre bien qu’on souhaite faire passer dans cetarticle 2 un souffle et un certain nombre de grands principes.C’est la raison pour laquelle je vous propose en ce domaineégalement, et à cet alinéa également, de vous rallier à la dé-cision du Conseil national et d’inscrire tout au début de laconstitution le principe de l’égalité des chances dans la for-mulation nuancée du Conseil national.
Koller Arnold, Bundesrat: Ich beantrage Ihnen, bei Ab-satz 2bis der Mehrheit der Kommission zuzustimmen und da-mit den Gedanken der Chancengleichheit nicht als eigenenBundeszweck zu statuieren.Warum? Der Begriff der Chancengleichheit ist ein sehr schil-lernder Begriff. Er enthält einerseits Aspekte und Komponen-
ten, die bereits durch Absatz 1 des Zweckartikels (Art. 2),dann durch die Freiheitsrechte, die Sozialziele und vor allemauch durch das Prinzip der Rechtsgleichheit sowie durch dasin sehr modernisierter Form festgehaltene Diskriminierungs-verbot umschrieben sind. Andererseits kann man den Begriffder Chancengleichheit auch leicht missverstehen. Es istnämlich ein Faktum, dass wir alle mit unterschiedlichen Start-chancen ins Leben treten. Wenn man nun aber den Begriffder Chancengleichheit so interpretiert, dass der Staat dieseungleichen Startchancen durchwegs kompensieren müsste,würde sich der Staat eindeutig übernehmen.Diese Möglichkeit einer Fehl- oder Missdeutung des politi-schen Begriffes der Chancengleichheit bewegt uns, Ihnen zuempfehlen, ihn nicht als eigenständigen Bundeszweck aufzu-nehmen und daher der Mehrheit der Kommission zuzustim-men.
Abstimmung – VoteFür den Antrag der Mehrheit 27 StimmenFür den Antrag der Minderheit 4 Stimmen
Art. 4 Abs. 3Antrag der KommissionZustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Art. 4 al. 3Proposition de la commissionAdhérer à la décision du Conseil national
Inderkum Hansheiri (C, UR), Berichterstatter: Bei Artikel 4Absatz 3 haben wir eine Differenz betreffend die Behörden.Artikel 4 umschreibt die Rechtsstaatlichkeit unseres Bundes-staates Schweiz. Absatz 3 verpflichtet die Instanzen desStaates und die Privaten zum Handeln nach Treu und Glau-ben. Wir müssen heute etwas ernüchtert feststellen, dass derVersuch offensichtlich gescheitert ist, den Nationalrat davonzu überzeugen, dass zwar wohl alle staatlichen Organe Be-hörden, nicht aber alle Behörden staatliche Organe sind. DerNationalrat hat durch Stimmenmehrheit «erkannt», der Ober-begriff der staatlichen Organe genüge.Im Interesse der Differenzbereinigung haben wir uns dazudurchgerungen, Zustimmung zum Nationalrat zu beantragen.
Angenommen – Adopté
Art. 5aAntrag der KommissionFesthalten
Antrag AebyTitel, Abs. 1Zustimmung zum Beschluss des NationalratesAbs. 2Festhalten
Art. 5aProposition de la commissionMaintenir
Proposition AebyTitre, al. 1Adhérer à la décision du Conseil nationalAl. 2Maintenir
Inderkum Hansheiri (C, UR), Berichterstatter: Bei Artikel 5aist uns der Nationalrat in der Systematik insofern gefolgt, alser seinen Verantwortlichkeitsartikel jetzt ebenfalls in Arti-kel 5a verankert und nicht, wie ursprünglich vorgesehen, inArtikel 3b.Ich darf kurz in Erinnerung rufen, was aus unserer Sicht derSinn dieser Bestimmung ist: Es geht darum, in der Verfas-sung aufzuzeigen, dass die Menschen, die in diesem Staateleben, insbesondere die Bürgerinnen und Bürger, eben nichtnur Rechte haben, sondern auch Pflichten und dass zu die-
7. Oktober 1998 S 205 Bundesverfassung. Reform
Amtliches Bulletin der Bundesversammlung / Separatdruck
sen Pflichten in erster Linie die gleichermassen vorgegebenePflicht zur Selbstverantwortung zählt.Die Kommission beantragt Festhalten; die Fassung desStänderates verdient den Vorzug, weil sie einfach und klar istund sich auf die Verantwortung beschränkt. Die Fassung desNationalrates erscheint uns etwas langatmig, etwas üppig,und sie ist vor allem inhaltlich etwas slalomartig: In Absatz 1wird auf die Fähigkeiten jeder Person hingewiesen, sich nachihren Neigungen entfalten und entwickeln zu können; in Ab-satz 2 ist dann zwar von Verantwortung die Rede, aber dieswird wieder auf «im Rahmen ihrer Fähigkeiten» einge-schränkt.Ich beantrage Ihnen namens der Kommission, an unsererFassung festzuhalten.
Aeby Pierre (S, FR): Ces premiers articles sont des articlesessentiellement déclaratifs, et parfois, un simple mot peut dé-clencher des sensibilités fort diverses.Pour ma part, ça a été dit souvent dans nos travaux de com-mission ou de sous-commission, je crois que les quatrepoints essentiels qui caractérisent notre Etat sont que laSuisse est un Etat de droit, la Suisse est un Etat démocrati-que, et enfin, la Suisse est un Etat libéral et la Suisse est unEtat social, tout à la fois. C’est cette dualité du libéral et dusocial qui, souvent, dans les diverses dispositions, peut nousopposer suivant nos sensibilités.Ici, à l’article 5a que nous avons admis dans son principe, ils’agit de bien préciser cette dualité libérale et sociale, et ceci,en premier lieu, en reprenant le titre adopté par le Conseil na-tional. Le titre me paraît fondamental. Le titre adopté par no-tre Conseil parle de «Responsabilité», celui du Conseil natio-nal est plus précis, il mentionne d’une part la «responsabilitéindividuelle» et d’autre part la «responsabilité sociale» de l’in-dividu. Ça me paraît juste.Je ne vous dirai pas que le Conseil national, dans les travauxauxquels il s’est livré, est arrivé à une formulation extraordi-naire. C’est vrai que l’alinéa 2 du Conseil national est difficileà comprendre, est un peu lourd. C’est dans cet esprit que jevous propose de faire un pas en direction du Conseil nationalde manière à permettre, avant que nous ne nous retrouvionsen Comité de médiation, à l’administration de plancher en-core une fois sur cet article 5a.J’ai parlé du titre, et l’alinéa 1er du Conseil national me paraîttout à fait acceptable. En prenant comme alinéa 2 l’alinéa uni-que de l’article 5a tel que notre Conseil l’a approuvé jusqu’àaujourd’hui, et qui demande à chacun de contribuer «selonses forces à l’accomplissement des tâches de l’Etat et de lasociété», on reflète en cela la deuxième partie de la respon-sabilité qu’on trouve dans le titre, c’est-à-dire la responsabi-lité sociale. Il me semble qu’en opérant ce compromis, on faitun pas en direction du Conseil national et qu’on peut légitime-ment nourrir l’espoir de voir encore quelques améliorationsrédactionnelles de cet article 5a qui n’est pas sans impor-tance dans toute cette constellation de la Constitution fédé-rale.J’espère que vous pourrez partager cet avis et soutenir maproposition de compromis.
Koller Arnold, Bundesrat: Die Frage, ob den Grundrechtender Bürgerinnen und Bürger auch eine Verpflichtung in derVerfassung gegenüberzustellen sei, und zwar keine beson-dere wie die Wehrpflicht, sondern eine allgemeine Pflicht derpersönlichen Verantwortung des einzelnen gegenüber derGesellschaft, hat offenbar schon die Urväter unserer Verfas-sung beschäftigt. Man hat sich damals dagegen entschieden,und dabei ist es bis heute geblieben. Der Bundesrat hat Ih-nen daher hier auch keine Vorschläge unterbreitet, aber wiropponieren dem Ansinnen nicht, weil ein Trend und ein Be-dürfnis festzustellen sind, nicht nur die Rechte der Bürger inder Verfassung darzustellen, sondern auch eine Verpflich-tung gegenüber der Gesellschaft und dem Staat festzuhal-ten.Wenn man aber von diesem Prinzip ausgeht, scheint demBundesrat die Formulierung Ihres Rates doch besser zu sein.Ich habe vor allem Mühe mit dem ersten Absatz gemäss Na-
tionalrat; denn er gibt noch einmal die individualistischeGrundhaltung wieder, und diese ist eigentlich durch die per-sönliche Freiheit und andere Grundrechte abgedeckt. Waswir hier statuieren wollen, ist die Verantwortung jeder Persongegenüber Staat und Gesellschaft. Deshalb scheint mir dieständerätliche Fassung sowohl den Vorteil der Kürze wie dender Sachadäquanz zu haben.Ich sehe natürlich ein, dass Herr Aeby versucht, in der Diffe-renzbereinigung einen Kompromiss herbeizuführen. Aberangesichts meiner inhaltlichen Bedenken empfehle ich Ih-nen, an Ihrem Beschluss festzuhalten.
Aeby Pierre (S, FR): Oui, Monsieur le Conseiller fédéral,vous m’avez quasiment convaincu. Si je vous suis, il paraîttout aussi important, et là vous avez abondé dans mon sens,que le titre de l’article 5a doive être «Responsabilité indivi-duelle et sociale», et ensuite reprendre la version décidée parnotre Conseil. Dans ce sens, je peux modifier ma proposition,d’entente avec le Conseil fédéral, et je demande simplementque le titre soit celui décidé par le Conseil national; pour lereste, nous pouvons maintenir notre version.
Präsident: Was die Formulierung der Bestimmung betrifft,schliesst sich Herr Aeby nunmehr der Kommission an undzieht seinen Antrag zurück. Er hält aber an einer anderenÜberschrift fest. Er möchte statt «Verantwortung» «Individu-elle und gesellschaftliche Verantwortung».
Inderkum Hansheiri (C, UR), Berichterstatter: Selbstver-ständlich kann ich mich nicht namens der Kommission äus-sern; aber ich glaube: Wenn es nur noch um den Titel geht,können wir diese kleine Brücke schlagen. Ich persönlichkönnte mich insofern anschliessen; ich sehe, dass auch un-ser Kommissionspräsident nickt.
Titel – TitreAngenommen gemäss Antrag AebyAdopté selon la proposition Aeby
Abs. 1, 2 – Al. 1, 2Angenommen gemäss Antrag der KommissionAdopté selon la proposition de la commission
Art. 7 Abs. 3Antrag der KommissionMehrheitFesthaltenMinderheit(Gentil)Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Art. 7 al. 3Proposition de la commissionMajoritéMaintenirMinorité(Gentil)Adhérer à la décision du Conseil national
Inderkum Hansheiri (C, UR), Berichterstatter: Bei Artikel 7Absatz 3 beantragt Ihnen die Mehrheit, an unserer Fassungfestzuhalten, wogegen die Minderheit Gentil dem Nationalratfolgen will.Ich darf Ihnen kurz den Standpunkt der Mehrheit begründen:Dem Beschluss des Nationalrates liegt offensichtlich die Mei-nung zugrunde, dass in der Verfassung expressis verbis zumAusdruck gebracht werden solle, dass die rechtliche Gleich-stellung eben nicht genüge, sondern dass der Gesetzgeberdie erforderlichen Normen zu schaffen habe, die es ermög-lichten, dass in der sozialen Wirklichkeit die tatsächlicheGleichstellung erreicht werden könne. Es gibt in der Tat auchin der Lehre solche Auffassungen. Insbesondere ist daraufhinzuweisen, dass auch das Bundesgericht in mehreren Ent-scheiden diesen Begriff der tatsächlichen Gleichstellung ver-wendet.
Constitution fédérale. Réforme 206 E 7 octobre 1998
Bulletin officiel de l’Assemblée fédérale / Tiré à part
Das Bundesgericht hat aber andererseits deutlich gesagt, diegesetzgeberischen und allenfalls anderen Massnahmendürften nicht so weit gehen, dass sie in Widerspruch zum Ge-bot der Gleichbehandlung gerieten. Etwas pointiert formuliertkönnte man sagen: Gleichberechtigung als Chancengleich-heit ja, Gleichmacherei im Sinne einer ergebnisorientiertenGleichheit nein.Die Mehrheit der Kommission ist der Meinung, dass die Dif-ferenzierung zwischen rechtlicher und tatsächlicher Gleich-stellung nicht erforderlich sei. Der Begriff der rechtlichenGleichstellung ist – obwohl, wie erwähnt, in der Lehre undRechtsprechung bekannt – zu wenig kompakt, hat zu wenigKonturen und ist zu wenig gefestigt. Es kommt hinzu, dassauch im Gleichstellungsgesetz die rechtliche Gleichheit exi-stiert, aber dort eben im Sinne einer tatsächlichen Gleichstel-lung. Daher könnte diese Differenzierung in rechtliche undtatsächliche Gleichstellung nach Auffassung der Mehrheit zuInterpretationsproblemen führen.Deshalb beantragt Ihnen die Mehrheit, am einfachen Begriffder Gleichstellung festzuhalten.
Gentil Pierre-Alain (S, JU): Comme vient de le dire le rappor-teur de la commission, chacun est d’accord sur le principe del’égalité en droit et en principe. Où les choses se compliquentnaturellement, c’est dans les faits. Et la version du Conseilnational me paraît meilleure que la nôtre à cet égard, dans lamesure où elle insiste sur l’égalité des droits en fait et qu’ellele mentionne de manière expresse. Nous savons tous qu’il ya un certain nombre de domaines dans lesquels l’égalité desdroits est restée théorique, qu’il s’agisse de salaire ou de for-mation, par exemple. Il me paraît meilleur d’aller jusqu’aubout de la pensée et d’insister sur l’idée que l’égalité desdroits ne doit pas demeurer un principe, mais se traduire ef-fectivement dans les faits.C’est la raison pour laquelle je vous propose, au nom de laminorité de la commission, de vous rallier à la décision duConseil national.
Brunner Christiane (S, GE): Je vous invite à soutenir la pro-position de minorité Gentil. A l’origine de la discussion surl’égalité entre hommes et femmes, avant l’adoption de l’arti-cle constitutionnel en 1981, nous avons mené cette discus-sion. A l’époque, on parlait de l’égalité de droits. C’était com-préhensible dans la mesure où il y avait encore des inégalitéscriantes au niveau de certaines lois comme, par exemple, lesdispositions relatives au droit matrimonial. Mais c’est uneconception défensive de l’égalité: il fallait que les femmespuissent rattraper la distance qui les séparait des hommes auniveau des droits. De cette conception défensive, on estpassé aujourd’hui, et de manière unanime, à une conceptionpositive, active de l’égalité. On ne peut se contenter d’élimi-ner les discriminations formelles, on doit promouvoir l’égalitédans la réalité de la vie quotidienne.Cela signifie que l’on doit prendre éventuellement temporai-rement des mesures pour favoriser la partie désavantagée,pour favoriser les femmes et pour leur donner les mêmeschances, lorsque cela se révèle nécessaire.C’est abondamment pratiqué d’ailleurs, mais il faut encore leconsacrer dans notre constitution, en suivant en cela ce quiest aussi prévu dans la loi fédérale du 24 mars 1995 surl’égalité entre femmes et hommes, puisque dans cette loi onstipule clairement à l’article 1er que: «La présente loi a pourbut de promouvoir dans les faits l’égalité entre femmes ethommes.» Et en même temps, à l’article 3 alinéa 3, on pré-cise que: «Ne constituent pas une discrimination les mesuresappropriées visant à promouvoir dans les faits l’égalité entrefemmes et hommes.» Ainsi que le rapporteur l’a dit, des ar-rêts du Tribunal fédéral confirment cette interprétation de l’ar-ticle actuel de la constitution. Donc, inscrire dans la constitu-tion que le législateur veille à garantir l’égalité en droit etl’égalité en fait, cela fait partie d’une simple mise à jour de laconstitution, et ce n’est pas, dans ce sens, un élément nou-veau.Je vous rappelle également que la Convention des NationsUnies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination
à l’égard des femmes, que nous avons ratifiée récemment,stipule explicitement que les mesures positives, celles qui vi-sent justement l’égalité en fait, ne constituent pas une discri-mination. Dans la mesure où c’est clairement une «Nach-führung», c’est l’inscription dans notre constitution de l’éga-lité en droit et en fait entre les hommes et les femmes.Je vous invite à soutenir la proposition de la minorité de lacommission.
Koller Arnold, Bundesrat: Ich würde am liebsten an dasletzte Argument von Frau Brunner anknüpfen: Machen wirhier doch wirklich eine Nachführung der Bundesverfassung,und halten wir uns im Differenzbereinigungsverfahren –nachdem die Frage strittig ist – an den geltenden Text derVerfassung, der ja noch nicht so alt ist; er stammt aus demJahre 1981. Dort lautet der Text ganz klar, tout court: «DasGesetz sorgt für ihre Gleichstellung ....» In Artikel 4 Absatz 2wird also diese – eher zu Missverständnissen Anlass ge-bende – Differenzierung zwischen rechtlicher und tatsächli-cher Gleichstellung nicht gemacht.Dabei bin ich mit Frau Brunner einverstanden: Der Auftrag,für die Gleichstellung zu sorgen, will natürlich nicht nur zumAusdruck bringen, dass die rein rechtliche Gleichbehandlunganzustreben sei, also vor allem die Eliminierung formalrecht-licher Unterscheidungen bzw. Diskriminierungen, sonderndarüber hinaus auch, dass die tatsächliche Gleichbehand-lung angestrebt werde, so, wie wir das im Gleichstellungsge-setz gemacht haben.Es geht jetzt aber um das Differenzbereinigungsverfahren.Wir sehen, dass diese neuen Begriffe nur Anlass zu Diskus-sionen und Kontroversen geben. Deshalb möchte ich Sie bit-ten, beim Urtext des Faust zu bleiben, und das ist der Text,den der Ständerat beschlossen hat.Ich bitte Sie also, an Ihrem Beschluss festzuhalten.
Abstimmung – VoteFür den Antrag der Mehrheit 29 StimmenFür den Antrag der Minderheit 4 Stimmen
Art. 9 Abs. 3Antrag der KommissionZustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Art. 9 al. 3Proposition de la commissionAdhérer à la décision du Conseil national
Art. 9aAntrag der KommissionTitelSchutz der Kinder und JugendlichenWortlautKinder und Jugendliche haben Anspruch auf besonderenSchutz ihrer Unversehrtheit und Entwicklung. Sie üben ihreRechte im Rahmen ihrer Urteilsfähigkeit aus.
Art. 9aProposition de la commissionTitreProtection des enfants et des jeunesTexteLes enfants et les adolescents ont droit à une protection par-ticulière quant à leur intégrité et leur développement. Ils exer-cent leurs droits dans la mesure où ils sont capables de dis-cernement.
Art. 11aAntrag der KommissionFesthaltenProposition de la commissionMaintenir
Inderkum Hansheiri (C, UR), Berichterstatter: Darf ich Siekurz an die Vorgeschichte erinnern: Der Bundesrat wolltebeim Artikel 9 («Recht auf Leben und auf persönliche Frei-
7. Oktober 1998 S 207 Bundesverfassung. Reform
Amtliches Bulletin der Bundesversammlung / Separatdruck
heit») keiner bestimmten gesellschaftlichen Gruppe ein Son-derrecht einräumen. Der Nationalrat beschloss dann einenseparaten Artikel 11a («Rechte der Kinder und Jugendli-chen»). Unser Rat hat in der letzten Session bei Artikel 9 ei-nen Absatz 3 aufgenommen, mit folgendem Inhalt: «Kinderund Jugendliche haben Anspruch auf besonderen Schutz ih-rer Unversehrtheit und Entwicklung.» Der Nationalrat hält anseinem Beschluss fest.Unsere Kommission beantragt Ihnen nun, dem Nationalratinsofern zu folgen, als ein separater Artikel mit dem Titel«Schutz der Kinder und Jugendlichen» geschaffen wird, die-sen Artikel aber nicht – wie vom Nationalrat beschlossen –als Artikel 11a aufzunehmen, sondern als Artikel 9a. DieKommission beantragt dies in der Meinung, dass die Bestim-mung im unmittelbaren Anschluss an Artikel 9 besser plaziertist, wobei selbstverständlich auch andere Argumente in die-ser Beziehung gehört werden könnten.Inhaltlich ist Artikel 9 mit dem von uns beschlossenen Ab-satz 3 von Artikel 9 identisch, allerdings ergänzt mit demSatz: «Sie (die Kinder und Jugendlichen) üben ihre Rechteim Rahmen ihrer Urteilsfähigkeit aus.» Zu diesem zweitenSatz möchte ich festhalten, dass er an sich überflüssig wäre;dies ergibt sich klar aus dem Zivilgesetzbuch. Es steht abernach unserer Auffassung der Absicht, diesen Satz noch an-zufügen, nichts im Wege.Der erste Satz von Artikel 9a entspricht, wie gesagt, unseremletzten Beschluss. Ich möchte der Klarheit halber noch auffolgendes hinweisen: Wenn es heisst, dass Kinder und Ju-gendliche Anspruch auf besonderen Schutz hätten, ist diesselbstverständlich keine Einschränkung – die Formulierunghat offenbar zu diesem Missverständnis Anlass gegeben –,sondern es soll im Gegenteil damit herausgestrichen werden,dass die gesellschaftliche Gruppe «Kinder und Jugendliche»Anspruch auf einen ganz besonderen Schutz hat.Wir könnten uns keinesfalls dem Beschluss des Nationalra-tes anschliessen und ein Recht auf «eine harmonische Ent-wicklung» aufnehmen. Bei diesem Begriff handelt es sichnach unserer Auffassung um einen schwammigen, unbe-stimmten Rechtsbegriff, der zu verschiedenen Interpretatio-nen Anlass geben und auch in Konflikt mit den Pflichten, aberauch den Rechten der Eltern geraten könnte.
Cavadini Jean (L, NE): Il y a de ces batailles perduesd’avance qu’il ne faut pas livrer. Néanmoins, à l’article 9adeuxième phrase, qui pourrait constituer, sur le plan rédac-tionnel, un deuxième alinéa, il faut admettre que le sentimentde la commission a été modifié. Plusieurs pressions ont étéexercées de la part des organisations de jeunesse, qui ontfait là leur travail, pour insérer la notion que je donne en fran-çais: «Ils – les enfants et les adolescents – exercent leursdroits dans la mesure où ils sont capables de discernement.»La commission était, dans un premier temps, très partagée,puis elle a décidé, dans sa majorité, d’accepter de prendre encompte cette notion. Je ne pense pas que ce soit une bonneproposition, parce que je ne suis pas sûr que nous soyons làface à du droit normatif.Alors, Monsieur le Conseiller fédéral, simplement pour latranquillité de ma conscience et pour la qualité de notre tra-vail, pouvez-vous nous donner l’assurance que ces droitsdes enfants et des adolescents sont des notions qui sont bienconnues, bien maîtrisées et qu’elles sont véritablement appli-cables dans leur norme? Et qui détermine cette capacité dediscernement? Comment estime-t-on cette capacité, afin quece ne soit pas simplement une déclaration rhétorique? Ici,manifestement, on a voulu faire plaisir aux groupes de pres-sion, mais un plaisir de niveau constitutionnel peut coûter unprix très élevé.Je reste persuadé qu’on aurait pu faire l’économie de cettedeuxième phrase, mais puisqu’il s’agit là d’une notion quivient d’être inscrite par notre commission dans le texte, jesouhaiterais avoir l’assurance qu’elle est au moins appli-cable.
Leumann Helen (R, LU): Es ist richtig, dass dieser zweiteSatz nicht unbedingt in der Verfassung stehen müsste. Es ist
aber auch richtig, dass es niemandem weh tut, wenn er in derVerfassung steht, zumal wir ja gemäss Zivilrecht diese Aus-sage bereits gesetzlich festgeschrieben haben. Im übrigenweise ich auch darauf hin, dass sich die Jugendorganisatio-nen grösste Mühe gegeben haben, einen Kinderschutzartikelin die Verfassung einzubringen; andere Organisationen ha-ben das für ihre Belange ebenfalls getan. Man ist also an vie-len Orten irgendwelchen Organisationen entgegengekom-men.Es steht uns allen gut an, wenn wir zum Schutz der Kinderauch ganz explizit in der Verfassung Stellung nehmen unddiesen Schutz in der Verfassung verankern.
Cavadini Jean (L, NE): Je propose formellement de scinderl’article 9a en deux alinéas: alinéa 1er – «Les enfants et lesadolescents ont droit à une protection particulière quant àleur intégrité et à leur développement», ce qui en commissionn’a posé aucun problème particulier, tant il est vrai que noussommes acquis à cette notion; alinéa 2 – «Ils exercent leursdroits dans la mesure où ils sont capables de discernement».Sur ce point, j’ai fait part de mes doutes. J’attends la réponsede M. Koller, conseiller fédéral, pour me déterminer plusavant.
Rhinow René (R, BL), Berichterstatter: Ich persönlich kannmich diesem Antrag sehr wohl anschliessen. In der Kommis-sion haben wir nicht darüber gesprochen. Der Systematik derVerfassung und auch der Fassung des Nationalrates würdees entsprechen, einen zweiten Absatz zu machen. Allerdingsmüssen wir natürlich sehen, dass mit einem separaten Ab-satz die Bedeutung dieser an sich etwas deklaratorisch wir-kenden Bestimmung noch mehr hervorgehoben wird. Aberredaktionell kann ich mich durchaus anschliessen.Und wenn wir schon bei der Redaktion sind, stellt sich nochein anderes Problem, das wir in der Kommission nicht gese-hen haben: Der Titel wurde nämlich mit der Einleitung«Schutz» der Kinder und Jugendlichen übernommen. DerNationalrat spricht von «Rechten» der Kinder und Jugendli-chen. Wir haben jetzt inhaltlich beides: In einem Absatz 1geht es um den «Schutz» und in einem Absatz 2 um die«Rechte».Ich möchte Ihnen eigentlich beliebt machen, dass wir den Ti-tel «Kinder und Jugendliche» wählen.
Koller Arnold, Bundesrat: Ich kann mich damit einverstandenerklären, dass Sie für die «Rechte der Kinder und Jugendli-chen» einen eigenen Artikel schaffen. Dieses «plaisir» – umdie Terminologie von Herrn Cavadini aufzunehmen – kannich Ihnen machen. Es ist damit zwar ein «sacrificium intellec-tus» verbunden, weil die Eingliederung in Artikel 9, die Sie ur-sprünglich vorgesehen hatten, systematisch zweifellos diebessere Lösung gewesen wäre. Aber wir machen hier Politikund nicht reine Rechtslehre.Wirkliche Probleme habe ich nun aber mit dem zweiten Satz,von dem ich befürchte, dass er nicht nur ein «plaisir» wäre,sondern kontraproduktiv sein könnte. Ich befürchte das auf-grund einer Bemerkung von Professor Jörg Paul Müller. Erschreibt in seiner Einleitung zu den Grundrechten folgendes:«Die Frage, wieweit Minderjährige Träger von Grundrechtensind, lässt sich nicht generell durch Festlegung einer be-stimmten Grundrechtsmündigkeit beantworten, sondern istfür jede Grundrechtsposition als materielles Rechtsproblembesonders zu untersuchen.» Ich glaube, das ist unbestrittenund klar. Aber jetzt kommt die Ausführung, die mir Sorgemacht: «Im Bereich der persönlichen Freiheit» – und da be-wegen wir uns hier – «dürfte in der Regel unbestritten sein,dass auch Minderjährige und Entmündigte – auch Urteilsun-fähige – Rechtsträger sind.» Mit diesem zweiten Satz relati-vieren wir eigentlich die unbestrittene Lehre, dass Rechtsträ-ger der persönlichen Freiheit auch Unmündige und Urteilun-fähige sind.Dieser zweite Satz macht uns nur Probleme und bringt unsüberhaupt nicht weiter. Deshalb würde ich Ihnen empfehlen,ihn zu streichen.
Constitution fédérale. Réforme 208 E 7 octobre 1998
Bulletin officiel de l’Assemblée fédérale / Tiré à part
Aeby Pierre (S, FR): Je suis désolé de prendre la parole justeavant le vote, mais j’ai été un peu pris de court par la propo-sition du président de la commission.Dans ce chapitre, nous parlons soit de protection, «Schutz»,soit de liberté, «Freiheit». Il me semble erroné d’éviter enfrançais aussi bien la notion de «droit» que celle de «protec-tion»; il faut prendre une des deux. Autrement, on a un titrequi ne ressemble pas à tous les autres titres de ce chapitresur les droits fondamentaux. On n’est pas obligé d’utiliser leterme de «droit».Dans le dépliant en français, on parle de «droit des enfants»,on ne parle pas de «protection». Dans ce que nous avonsreçu, le titre en français est clair, c’est le «droit».Je crois que de ne mettre ni «droit» ni «protection», c’est uneproposition qui est contraire à la structure de ce chapitre. Ilfaut l’une des deux notions. Quant à moi, je propose de main-tenir la notion de «droit». Je crois que c’est dans ce sens quel’on voulait introduire dans la constitution un article sur les en-fants et les adolescents.
Cavadini Jean (L, NE): Entre «jeunes» et «adolescents»,veut-on introduire une différence? On passe subitement del’adolescence à la jeunesse. On peut rester jeune longtemps,Monsieur le Président, vous en êtes un bon exemple, maisenfin ce n’est pas la notion recherchée ici!
Danioth Hans (C, UR): Ich möchte Ihnen doch vorschlagen,zuerst über den Inhalt dieses Artikels 9a abzustimmen unddas Marginale nachher festzulegen oder die Festlegung derKompetenz der Redaktionskommission zu übergeben. Dererste und der zweite Satz haben nicht völlig den gleichen In-halt; das zum Redaktionellen.Ich habe erhebliche Bedenken in bezug auf den zweitenSatz; er enthält einigen Sprengstoff. Sie erinnern sich an dieBehandlung der Kinderrechtskonvention. Wenn Herr Bun-desrat Koller schon erklärt, die Rechtsfähigkeit von Kindernund anderen Personen, die nicht selber handeln könnten, seihier in Frage gestellt, dann ist die Ausübung dieser Rechtenoch mehr in Frage gestellt. Von daher habe ich erheblicheBedenken.Ich möchte Ihnen vorschlagen, zuerst den Inhalt des Artikelsfestzulegen und dann den Antrag Rhinow oder den Antragder Kommission zu behandeln. Ich könnte mit beidem leben.
Rhinow René (R, BL), Berichterstatter: Der erste Satz vonArtikel 9a ist unbestritten; es geht um den zweiten Satz oderneu um Absatz 2. Ich beantrage Ihnen, bei der Fassung derKommission zu bleiben. Es besteht ein gewisses Missver-ständnis, jedenfalls wenn ich den Passus meines geschätz-ten Kollegen und Freundes Jörg Paul Müller – nach dem Zitatvon Herrn Bundesrat Koller – richtig verstanden habe. DieRechtsträgerschaft ist selbstverständlich nicht an die Urteils-fähigkeit gebunden; dies trifft nur für die Handlungsfähigkeitzu. Hier geht es darum, dass die Ausübung von Rechten imRahmen der Urteilsfähigkeit erfolgt. Das schliesst nicht aus,dass sich bei der persönlichen Freiheit die Rechtsträger-schaft auch auf Urteilsunfähige beziehen kann.Ich meine also, dass wir guten Gewissens zu diesem zweitenSatz stehen können – wenn wir der Terminologie des Zivilge-setzbuches folgen, wo in Artikel 11 Absatz 1 klar gesagt wird,«rechtsfähig ist jedermann», und wo die Handlungsfähigkeitan die Urteilsfähigkeit und die Mündigkeit gebunden wird.
Wicki Franz (C, LU): Mit gutem Gewissen können wir aberauch den zweiten Satz von Artikel 9a streichen. Wenn wirhier nämlich den Satz «Sie üben ihre Rechte im Rahmenihrer Urteilsfähigkeit aus» einfügen, dann sagen wir etwasderart Selbstverständliches, dass wir dies dann eigentlichbei jeder Bestimmung der Bundesverfassung schreibenmüssten.Das schafft nur Verwirrung, und daher kann ich mich durch-aus dem Antrag des Bundesrates anschliessen.
Leumann Helen (R, LU): Die Worte von Kollege Rhinow be-ruhigen mich: Wir täten hier nichts Unrechtes.
Ich möchte Sie aber daran erinnern, dass wir uns im Diffe-renzbereinigungsverfahren befinden. Der Nationalrat hat inArtikel 11a Absatz 2 genau diesen Satz eingefügt und auchdaran festgehalten. Er hat ihn richtig modifiziert, indem ernicht mehr von «ihren Rechten im Rahmen ihrer Fähigkei-ten» spricht, sondern von «ihren Rechten im Rahmen ihrerUrteilsfähigkeit». Wir haben diesen Satz als zweiten Satz vonArtikel 9a vom Nationalrat übernommen.Wenn wir den Artikel jetzt so verabschieden, kann ich mir vor-stellen, dass sich der Nationalrat beim ersten Satz uns an-schliesst. Wir schliessen uns dann dem Nationalrat im zwei-ten Satz an, so dass wir einen fertigen Artikel haben.Ich möchte Sie deshalb bitten, an unserer Version festzuhalten.
Koller Arnold, Bundesrat: Wir sollten daraus keine riesigeStreitfrage machen, aber ich bin einfach überzeugt, dass die-ser zweite Satz von Artikel 9a, selbst wenn man ihn so aus-legt wie Herr Rhinow, mehr Probleme aufgibt als löst. Die all-gemeinen Lehren genügen hier; es ist eine Selbstverständ-lichkeit, und wir sollten eine Selbstverständlichkeit nicht aus-drücklich nennen, sonst kommen sofort weitere Probleme,zum Beispiel: Wie ist es mit der Konsensfähigkeit?Ich sehe nicht ein, warum man ein derartiges Detailproblem,eine rechtliche Selbstverständlichkeit, in die Verfassung auf-nehmen will.
Reimann Maximilian (V, AG): Ich danke Ihnen, dass Sie mirdas Wort doch noch gewährt haben. Vor mir steht meistenseine Kamera, und deshalb können Sie meine Hand kaum se-hen.Ich möchte Sie bitten, in dieser Frage dem Bundesrat zu fol-gen. Wir haben uns in der Kommission wirklich intensiv mitdiesem Problem befasst. Dieser zweite Satz von Artikel 9a istin der Tat überflüssig. In die Verfassung gehören meines Er-achtens nur elementare Dinge, die wirklich nötig sind, abernichts Überflüssiges.Wenn wir jetzt auch noch vom Bundesrat zu hören bekom-men, dass es sich sogar kontraproduktiv für die Kinder undJugendlichen auswirken könnte, wenn wir den Satz so ste-henliessen, dann müssen wir ihn streichen. Es wäre verfehlt,den Jugendorganisationen gegenüber eine falsche Gestemachen zu wollen und ihn stehenzulassen.Nach den Erläuterungen von Bundesrat Koller müssen wirdiesen Satz streichen, und ich bitte Sie, dies zu tun.
Art. 9 Abs. 3 – Art. 9 al. 3Angenommen – Adopté
Art. 9a Wortlaut – Art. 9a texte
Präsident: Der Bundesrat beantragt, den zweiten Satz zustreichen.
Abstimmung – VoteFür den Antrag des Bundesrates 23 StimmenFür den Antrag der Kommission 12 Stimmen
Art. 9a Titel – Art. 9a titre
Aeby Pierre (S, FR): Après notre discussion, je maintiensqu’il faut garder le terme de «protection des enfants» commela commission le propose.
Präsident: Ich schlage Ihnen vor, dass wir die definitive For-mulierung des französischen Titels der Redaktionskommis-sion überlassen.
Cavadini Jean (L, NE): Monsieur le Président, je vous remer-cie de votre proposition; la Commission de rédaction s’enoccupera.
Angenommen – Adopté
Art. 11aAngenommen – Adopté
7. Oktober 1998 S 209 Bundesverfassung. Reform
Amtliches Bulletin der Bundesversammlung / Separatdruck
Art. 12Antrag der KommissionFesthaltenProposition de la commissionMaintenir
Inderkum Hansheiri (C, UR), Berichterstatter: Ich gebe mei-ner Hoffnung Ausdruck, dass sich die Kommissionssitzungnicht fortsetzt. Alle Anträge, die hier gestellt worden sind, ka-men von Mitgliedern der Verfassungskommission!Zu Artikel 12: Hier haben wir eine Differenz bezüglich desRechtes auf Familie. Wir beantragen, an unserem Beschlussfestzuhalten, also: Artikel 12 mit dem Titel «Recht auf Ehe»und dem Wortlaut: «Das Recht auf Ehe ist gewährleistet».Ich möchte nochmals darauf hinweisen, dass es sich bei Ar-tikel 12 um eine sogenannte Institutsgarantie handelt, undzwar mit dem Inhalt, dass der Staat die Instrumente zur Ver-fügung stellt, damit zwei nicht gleichgeschlechtliche Perso-nen heiraten können.Wenn wir hier dem Nationalrat folgen würden, könnte darausnoch weit mehr abgeleitet werden, zum Beispiel das Rechtfür gleichgeschlechtliche Paare auf Kinder, das Recht aufAdoption, auf Eispende oder auf In-vitro-Fertilisation oderdas Recht auf ein gemeinsames Familienleben im Alters-heim.Diese Ansprüche wollen wir nicht verankern, weil es eben nurum eine Institutsgarantie der Ehe geht.Ich beantrage Ihnen, an unserem Beschluss festzuhalten.
Angenommen – Adopté
Art. 18 Abs. 3Antrag der KommissionZustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Art. 18 al. 3Proposition de la commissionAdhérer à la décision du Conseil national
Inderkum Hansheiri (C, UR), Berichterstatter: Absatz 3 hatzum Inhalt: «Versammlungen und Kundgebungen auf öffent-lichem Grund können von einer Bewilligung abhängig ge-macht werden.» Wir wollten diesen Absatz aufnehmen bzw.an ihm festhalten. Der Nationalrat will ihn streichen und hältan der Streichung fest.Wir beantragen Ihnen, hier im Sinne einer Differenzbereini-gung dem Nationalrat zu folgen.Ich möchte aber klar auf folgendes hinweisen: Wenn wir hierim fortgeschrittenen Stadium der Beratungen dem National-rat folgen, darf dadurch nicht das Missverständnis entstehen,es sei unzulässig, für Versammlungen und Kundgebungenauf öffentlichem Grund eine Bewilligung zu verlangen. Sol-che Bewilligungen sind weiterhin möglich, müssen aber aufeiner gesetzlichen Grundlage beruhen – dies auch gemässArtikel 11 Absatz 3 EMRK.Ich möchte zuhanden des Protokolls und der Materialien klardarauf hinweisen, dass aus der Tatsache, dass dieser Ab-satz 3 jetzt gestrichen wird, nicht geschlossen werden kann,solche Kundgebungen und Versammlungen bräuchten ins-künftig keine Bewilligung mehr.
Angenommen – Adopté
Art. 24 Abs. 3Antrag der KommissionZustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Art. 24 al. 3Proposition de la commissionAdhérer à la décision du Conseil national
Inderkum Hansheiri (C, UR), Berichterstatter: Hier kommenwir – wie schon wiederholt zum Ausdruck gebracht wurde –zu einem der «Schicksalsartikel» dieser Nachführung. Siekennen die Vorgeschichte: Wir hatten gehofft, mit unserem
Beschluss anlässlich der letzten Session dem Nationalrateine Brücke zu bauen. Dieser Brückenschlag ist beinahe ge-lungen. Der Nationalrat hat nun aber noch beschlossen, denAusdruck «verhältnismässig» aus unserer Fassung heraus-zunehmen. Ich möchte hier klar in Erinnerung rufen, dass ge-mäss einhelliger Lehre – so kann man sagen – für einenStreik vier Voraussetzungen gegeben sein müssen: Erstensmuss der Streik die Ultima ratio sein, zweitens muss er Ar-beitsbeziehungen betreffen – es gibt also keinen politischenStreik –, drittens muss er von Arbeitnehmer- oder Ad-hoc-Or-ganisationen getragen sein, und schliesslich muss er verhält-nismässig sein.Wir befinden uns hier in einem eigentlichen Spannungsfeld:Einerseits geht es darum, dass wir eine sachlich korrekteFormulierung finden, in welcher die erwähnten vier Elementenach Möglichkeit enthalten sind; auf der anderen Seite müs-sen wir – die beiden Räte – uns im Hinblick auf eine Bereini-gung aufeinander zubewegen.Für eine sachlich korrekte Formulierung müssten wir eigent-lich an unserem Beschluss festhalten, ja für eine solche hät-ten wir eigentlich auch das Element aufnehmen müssen,dass ein Streik von entsprechenden Organisationen getra-gen sein muss. Sie wissen, weshalb wir letzteres nicht getanhaben: weil es eben gewisse Schwierigkeiten gab oder gibt,dies in einer Verfassung in generell-abstrakter Form adäquatfestzuhalten.Wenn wir nun den Ausdruck «verhältnismässig» ebenfallsherausnehmen, dann geht es nicht darum – darauf möchteich ganz klar hinweisen, ähnlich, wie ich es vorhin getanhabe –, dass wir an der heutigen Praxis, an der gefestigtenLehre etwas ändern möchten, sondern darum, dass wir diesePraxis, im Gegenteil, festigen wollen, dass eben alle erwähn-ten Elemente erfüllt sein müssen.Was nun insbesondere den Verhältnismässigkeitsgrundsatzanbetrifft, so kann man festhalten, dass der Begriff der Ver-hältnismässigkeit sinngemäss in Absatz 2 enthalten ist. Ichkann mir vorstellen, dass Herr Bundesrat Koller hierzu auchnoch Stellung nehmen wird.Ich beantrage Ihnen im Namen der Kommission, sich in die-sem Punkte dem Nationalrat anzuschliessen.
Rhinow René (R, BL), Berichterstatter: Gestatten Sie mir,angesichts der doch grossen Tragweite dieses Artikels zuunterstreichen, was der Berichterstatter bereits hervorgeho-ben hat.Wir verzichten auf die besondere Erwähnung des Erforder-nisses der Verhältnismässigkeit, weil die wichtige Schrankeder Ultima ratio, des letzten Mittels, welches das Streikrechtdarstellen muss, in der Verfassung bereits zum Ausdruckkommt mit dem Verweis auf die Schlichtungsverhandlungen,auf das Verhältnismässigkeitsprinzip, und weil der Gedankeder schonenden Rechtsausübung der Verfassung an sichdurchgängig zugrunde liegt. Deshalb ist es auch vertretbar,dass wir das hier nicht noch einmal besonders hervorheben.Aber der Grundsatz der Verhältnismässigkeit bleibt gültigund entspricht der heutigen Rechtslage.Wir nehmen auch eine weitere, heute geltende Schranke desStreikrechtes nicht wörtlich auf, nämlich das Verbot des wil-den Streiks. Wir nehmen es nicht auf, weil sich, wie wir gese-hen haben, redaktionelle Probleme stellen – Herr Inderkumhat darauf hingewiesen –, und auch, weil wir im Rahmen deszweiten Umganges der Differenzbereinigung eine solcheTextergänzung nicht mehr vornehmen sollten.Wir ändern damit aber, und ich möchte das ganz dick unter-streichen, gar nichts an der geltenden Rechtslage, an dengeltenden Voraussetzungen des Streikrechtes. Wir führenstrikt nach, drehen das Rad weder zurück noch nach vorne.Damit kann – davon bin ich überzeugt – dem verfassungs-rechtlichen Streikrecht, wie wir es formuliert haben, wederder Vorwurf des Rückschrittes noch der Vorwurf der uner-wünschten Öffnung gemacht werden.
Koller Arnold, Bundesrat: Die kontroversen Beratungen zuArtikel 24 der neuen Verfassung haben gezeigt, dass wir mitdiesem sogenannten Schicksalsartikel nur eine Chance ha-
Constitution fédérale. Réforme 210 E 7 octobre 1998
Bulletin officiel de l’Assemblée fédérale / Tiré à part
ben, wenn wir uns streng an das Nachführungskonzept hal-ten. Das heisst, dass wir sowohl die Konzeption wie die ein-zelnen Elemente der bundesgerichtlichen Praxis zur Zuläs-sigkeit von Streiks und Aussperrungen übernehmen. MitKonzeption meine ich vor allem die Einbettung in diesen Ar-tikel 24, d. h. die Einbettung in die Koalitionsfreiheit. Dadurchist auch klar gegeben, dass es sich immer um dem Gesamt-arbeitsvertrag zugängliche Gegenstände handeln muss, da-mit beispielsweise der politische, aber auch der wilde Streikgrundsätzlich ausgeschlossen sind.Was die Weglassung des Wörtchens «verhältnismässig» inbezug auf Ihre bisherige Formulierung betrifft, so hat eineAnalyse der Bundesgerichtsentscheide ergeben, dass dasBundesgericht auf dem Gebot der Verhältnismässigkeit im-mer sehr insistiert. Das hat auch dazu geführt, dass das Bun-desgericht in drei von vier Fällen konkrete Streikfälle für un-rechtmässig erklärt hat, weil dieses Verhältnismässigkeits-prinzip nicht gewahrt war. Wenn man aber die Entscheide imDetail analysiert, dann kommt man zum Schluss, dass es umdas Verhältnismässigkeitsprinzip in der Konkretisierung derUltima ratio ging, d. h., dass ein Streikbeschluss eben nichtübereilt – also ohne Gespräche oder Verhandlungen, wäh-rend laufender Verhandlungen oder vor Erschöpfung desVerhandlungsweges – gefasst werden kann, sondern nur beiPattsituationen, eben als Ultima ratio. Dieser Gedanke ist jabereits in Absatz 2 ausdrücklich festgehalten, indem dortsteht: «Streitigkeiten sind nach Möglichkeit durch Verhand-lung oder Vermittlung beizulegen.»Das ist der Grund, warum der Bundesrat der Meinung ist,dass wir im Sinne der Nachführung der Verfassung auf das«verhältnismässig» in Absatz 3 verzichten können, weil essinngemäss bereits in Absatz 2 enthalten ist.
Angenommen – Adopté
Art. 32a Abs. 1Antrag der KommissionFesthalten
Art. 32a al. 1Proposition de la commissionMaintenir
Rhinow René (R, BL), Berichterstatter: Bei Artikel 32a bean-tragt Ihnen die Kommission Festhalten, weil wir das dreifacheBürgerrecht zum Ausdruck bringen wollen, wie wir das be-reits zweimal beschlossen haben.Die Formulierung des Nationalrates geht auf die Fassungvon 1848 zurück und vermittelt eigentlich ein falsches Bildder gegenwärtigen Rechtslage. Sie knüpft nur beim Kantons-bürgerrecht an, ohne das letztlich entscheidende Gemeinde-bürgerrecht zu erwähnen. Wir wissen alle, dass es letztlichdie Bürgergemeinden sind, welche den eigentlichen Einbür-gerungsakt vornehmen.Wir bitten Sie, an unserem Beschluss festzuhalten.
Angenommen – Adopté
Art. 32c Abs. 2Antrag der KommissionZustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Art. 32c al. 2Proposition de la commissionAdhérer à la décision du Conseil national
Rhinow René (R, BL), Berichterstatter: Bei Artikel 32c gehtes nur um den französischen Text. Wir schliessen uns hierdem Nationalrat an.
Angenommen – Adopté
Art. 32dAntrag der KommissionZustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Proposition de la commissionAdhérer à la décision du Conseil national
Rhinow René (R, BL), Berichterstatter: Beim Artikel über dieAuslandschweizerinnen und Auslandschweizer besteht dieeigentliche Differenz zwischen der Fassung unseres Ratesund derjenigen des Nationalrates darin, dass wir den Passus,wonach der Bund Organisationen der Auslandschweizer un-terstützen kann, nicht in die Verfassung aufnehmen bzw.nicht in der Verfassung belassen, sondern auf die Gesetzes-stufe herabsetzen wollten. Für diese Herabstufung spricht ei-gentlich, dass ein Subventionstatbestand nicht in die Verfas-sung gehört. Wir wollten aber diese Rechtsgrundlage nichtabschaffen, sondern, wie gesagt, auf das Gesetz verschie-ben. Der Nationalrat insistiert aber bei Absatz 1, dass dieseUnterstützungsgrundlage in der Verfassung bleibt.Es ist kein «Schicksalsartikel», wir schliessen uns hier demNationalrat an.Ich gehe noch auf Absatz 2 ein; hier will der Nationalrat denexemplifikativen Katalog der Bereiche, über die der BundVorschriften erlassen kann oder soll, auf das Gebiet der So-zialversicherungen erweitern. Das entspricht an sich der heu-tigen Rechtslage, allerdings sagt die Verfassung bis heutenichts darüber aus.Wir können uns auch hier dem Nationalrat anschliessen.
Büttiker Rolf (R, SO): Ich möchte zu Artikel 32d Absatz 2 kei-nen Antrag stellen. Aber ich habe schon etwas gestaunt,dass im Differenzbereinigungsverfahren am Schluss plötzlichnoch die Sozialversicherungen hineingeschmuggelt werden.Herr Rhinow hat es bereits angetönt. Aber ich möchte sichersein, dass in bezug auf Absatz 1 keine neuen Subventions-tatbestände bzw. Sozialversicherungstatbestände geschaf-fen werden. Ich möchte Herrn Bundesrat Koller fragen:1. Geht das sicher nicht über die Nachführung hinaus, undkommt hier nicht im Differenzbereinigungsverfahren amSchluss noch etwas Neues hinein, das über die Nachführunghinausgeht?2. Werden hier neue Subventionstatbestände geschaffen? Inder Kommission ist diese Frage bereits gestellt worden, wo-bei sie dort von der Verwaltung nicht sehr überzeugend be-antwortet werden konnte.3. Ich habe schon etwas gestaunt, dass man in bezug aufden Sozialversicherungstatbestand bei den Auslandschwei-zerinnen und Auslandschweizern zusätzlich explizit eine Ver-fassungsgrundlage schaffen will, was die Gefahr in sich birgt,dass neue Ansprüche, neue Forderungen, neue Wünsche anden Bund herangetragen werden. Ich habe hier gewisse Be-fürchtungen, und ich möchte Herrn Bundesrat Koller bitten,diese Befürchtungen auszuräumen.
Koller Arnold, Bundesrat: Ich kann Herrn Büttiker beruhigen:Es ist ganz klar, dass der Zugang der Auslandschweizer zuden Sozialversicherungen der Konkretisierung durch das Ge-setz bedarf. Wir haben gerade eine Vorlage in der Vernehm-lassung, die von den Auslandschweizern offenbar nicht sehrgut aufgenommen worden ist, weil es darin gewisse Ein-schränkungen gegenüber dem geltenden Recht gibt.Wie Sie das dann schlussendlich entscheiden, ist Ihre Sa-che, aber Sie dürfen letztlich aus dieser Verfassungsbestim-mung keinerlei Hinweise auf eine Ausdehnung entnehmen.Die Konkretisierung erfolgt vielmehr auf der Stufe der einfa-chen Gesetzgebung.
Angenommen – Adopté
Art. 33Antrag der KommissionAbs. 1aa, 1a, 1 Einleitung, 1bis, 1terFesthaltenAbs. 1 Bst. a, eZustimmung zum Beschluss des Nationalrates
7. Oktober 1998 S 211 Bundesverfassung. Reform
Amtliches Bulletin der Bundesversammlung / Separatdruck
Art. 33Proposition de la commissionAl. 1aa, 1a, 1 introduction, 1bis, 1terMaintenirAl. 1 let. a, eAdhérer à la décision du Conseil national
Rhinow René (R, BL), Berichterstatter: Hier beantragen wirIhnen einerseits, festzuhalten, andererseits aber, dem Natio-nalrat zu folgen.Festhalten betrifft die Systematik, die Reihenfolge der Bestim-mungen, wie wir sie bereits in der ersten Lesung beschlossenhaben. Sie können diese Systematik nachvollziehen, wennSie sich die Seiten 9 und 10 der Fahne vor Augen führen, be-ginnend mit Absatz 1 in der mittleren Kolonne «Ständerat»:«Bund und Kantone setzen sich .... dafür ein, dass ....» Beidieser Systematik haben wir die bessere Wahl getroffen. Wirhaben insbesondere grosse Mühe mit dem einleitenden Ab-satz des Nationalrates, Artikel 33 Absatz 1aa, der lautet: «Pri-vate Initiative und persönliche Verantwortung bilden eineGrundlage sozialen Handelns.» Es war uns in der Kommis-sion nach wie vor nicht klar, was namentlich unter «sozialemHandeln» zu verstehen sei. Gemäss Amtlichem Bulletin bzw.Protokoll ist im Nationalrat und auch in der Kommission dar-über gar nicht mehr diskutiert worden, sondern der Nationalrathat hier stillschweigend Festhalten beschlossen.Wichtig war dem Nationalrat aber, dass im Katalog der sozia-len Ziele in Absatz 1 Buchstabe a der Passus, wonach jedePerson an der sozialen Sicherheit teilhat, wieder eingefügtwird. Wichtig war dem Nationalrat bei Absatz 1 Buchstabe e,dass die Aus- und Weiterbildung ebenfalls erwähnt werden.Wir haben uns hier dem Nationalrat gefügt und beantragenIhnen, bei Absatz 1 Buchstaben a und e dem Nationalrat zufolgen, nicht aber bei der Systematik und beim einleitendenAbsatz (Abs. 1aa).
Koller Arnold, Bundesrat: Ich bin dafür dankbar, dass Sie beiden materiellen Anliegen dem Nationalrat entgegenkommen,also sowohl in Absatz 1 Litera a als auch in Absatz 1 Litera e.Ich bin auch der Meinung, dass bei der Systematik und beider Einleitung Ihre Formulierung die bessere ist.
Angenommen – Adopté
Art. 34a Abs. 2Antrag der KommissionFesthalten
Art. 34a al. 2Proposition de la commissionMaintenir
Rhinow René (R, BL), Berichterstatter: Hier liegt nur in Ab-satz 2 eine Differenz vor, indem der Nationalrat auf der For-mulierung beharrt: «Der Bund beachtet den Grundsatz derSubsidiarität.» Wir haben diesen Grundsatz ausgedeutscht,indem wir formuliert haben: «Er übernimmt diejenigen Aufga-ben, die einer einheitlichen Regelung bedürfen.» Wir bean-tragen Ihnen Festhalten, weil es uns auch in der Diskussionin der Kommission nicht gelungen ist, den Grundsatz derSubsidiarität etwas klarer zu fassen. Wir meinen, dass zwardie Idee und die Philosophie des Bundesstaates durchausmit Subsidiarität zu tun haben, dass aber diese Idee so unbe-stimmt und vage ist, dass daraus keine Verfassungsnorm ge-macht werden soll.Nun ist im Nationalrat teilweise auch gesagt worden, es gehebei dieser Subsidiarität nicht nur um die Aufgabenverteilung,es gehe auch darum, wie bei der Umsetzung die Autonomieder Kantone gewahrt bleibe. Aber gerade auch bei der Um-setzung des Bundesrechtes bringt Artikel 37 die Idee derSubsidiarität mehrfach zum Ausdruck. Wenn Sie die einzel-nen Absätze lesen, dann stellen Sie fest, dass die Gestal-tungsfreiheit der Kantone gewahrt bleiben soll, dass die Res-sourcen der Kantone gewahrt bleiben sollen, dass sie primärdas Bundesrecht umsetzen sollen usw.
Wir meinen also, dass wir mit diesen beiden Bestimmungen,Artikel 34a Absatz 2 und Artikel 37, bereits zum Ausdruck ge-bracht haben, was Subsidiarität im Verhältnis von Bund undKantonen bedeutet.
Angenommen – Adopté
Art. 37 Abs. 3Antrag der Kommission.... die mit der Umsetzung des Bundesrechtes verbunden ist....
Art. 37 al. 3Proposition de la commission.... qu’entraîne la mise en oeuvre du droit fédéral ....
Rhinow René (R, BL), Berichterstatter: Bei Artikel 37 liegenwir nicht weit auseinander; wir schliessen uns dem National-rat grundsätzlich an. Der Nationalrat macht in Absatz 3 eineVerknüpfung zwischen dem ersten und dem zweiten Satz.Diese Verknüpfung kommt im Begriff «indem er den Kanto-nen ausreichende Finanzierungsquellen belässt» zum Aus-druck. Wir finden diese Differenz zu wenig wichtig, als dasswir deshalb insistieren wollten.Hingegen möchten wir redaktionell durchsetzen, was wir be-reits an anderer Stelle beschlossen haben, nämlich nur von«Umsetzung» und nicht von «Umsetzung und Vollzug» zusprechen.Mit dieser kleinen Ausnahme schliessen wir uns dem Natio-nalrat an.
Angenommen – Adopté
Art. 41Antrag der KommissionAbs. 1, 2Zustimmung zum Beschluss des NationalratesAbs. 3Der Bund nimmt dabei Rücksicht auf die besondere Situationder Städte und der Agglomerationen sowie der Berggebiete.
Art. 41Proposition de la commissionAl. 1, 2Adhérer à la décision du Conseil nationalAl. 3.... des villes, des agglomérations urbaines et des régions demontagne.
Rhinow René (R, BL), Berichterstatter: Ich äussere mich zuallen drei Absätzen, denn sie hängen innerlich zusammen.Wir haben lange über die Formulierung von Artikel 41 disku-tiert, namentlich über den berühmten «Städteartikel». Wirschliessen uns bei den beiden ersten Absätzen dem Natio-nalrat an, bei Absatz 3 grundsätzlich auch, nehmen dort al-lerdings zwei wichtige Änderungen vor.Die Konferenz der Kantonsregierungen (KdK) legte unsnahe, bei unserer Fassung zu bleiben. Allerdings müssen wiruns vergegenwärtigen, dass wir uns in der letzten Runde derDifferenzbereinigung befinden und dass wir nur dort jeweilsFesthalten beschlossen haben, wo es wirklich um eine sub-stantielle, wichtige Differenz ging, und das ist hier nicht derFall.Die Befürchtungen der KdK schienen uns zum Teil übertrie-ben, und zum Teil – ich sage es Ihnen offen – konnten wir sieauch nicht nachvollziehen. In Absatz 1 ist die Formulierung,die Gemeindeautonomie sei nach Massgabe des kantonalenRechtes gewährleistet, für uns mit dem gleichen Inhalt verse-hen wie die ursprüngliche Formulierung, die Kantone würdendie Organisation der Gemeinden und deren Autonomie be-stimmen. Denn es sind nach wie vor die Kantone, welcheüber die Gemeindeautonomie entscheiden, neu aber – dasist ein Vorteil für die Kantone – gewährleistet die Bundesver-fassung genau diese Autonomie der Kantone bezüglich derGemeindeautonomie. Darin kann kein substantielles Abrük-
Constitution fédérale. Réforme 212 E 7 octobre 1998
Bulletin officiel de l’Assemblée fédérale / Tiré à part
ken von der kantonalen Zuständigkeit erblickt werden, wiedas zum Teil gesagt worden ist. Auch künftig werden diediesbezüglichen Unterschiede, etwa zwischen der Stadt Ba-sel und den Verhältnissen in den Gemeinden Graubündens,bestehenbleiben und nicht durch die Verfassungsrevisioneingeebnet.In Absatz 2 sind Formulierungsunterschiede vorhanden, dieebenfalls nicht weltbewegend sind. Ich zeige sie kurz auf:In der ständerätlichen Fassung heisst es «der Bund nimmt ....Rücksicht», in der nationalrätlichen Fassung «der Bund be-achtet». In der ständerätlichen Fassung heisst es, der Bundnehme Rücksicht «bei der Erfüllung seiner Aufgaben», in dernationalrätlichen «bei seinem Handeln». In der ständerätli-chen Fassung heisst es «nimmt .... Rücksicht auf die Anlie-gen der Gemeinden» und in der nationalrätlichen «beachtetbei seinem Handeln die möglichen Auswirkungen auf die Ge-meinden». Diese Unterschiede bedeuten weiss Gott keineTrendumkehr, sondern beide Formulierungen sagen imGrunde genommen dasselbe aus.Die einzige wichtige Differenz ist die, dass der letzte Teilsatzdes Ständerates «insbesondere in städtischen Agglomeratio-nen» im Nationalrat zu einem Absatz 3 geworden ist; und wirübernehmen nun neu diese Gliederung, so dass die Agglo-merationen in Absatz 3 besonders verankert werden. Nun:Was ändern wir? Wir kommen in einem Punkt der Befürch-tung der KdK entgegen. Absatz 3 soll keine besondere undneue Bundeskompetenz sein – nämlich sich der Situation derStädte und Agglomerationen anzunehmen; sondern dieseRücksichtnahme ist an die Erfüllung der Bundesaufgabengebunden. Deshalb haben wir eingefügt, dass der Bund «da-bei» Rücksicht auf die besondere Situation der Städte nimmt.«Dabei» heisst: bei seinem Handeln. Nur dann, wenn er zu-ständig ist, wenn er Bundesaufgaben erfüllt, soll er auch aufdie besondere Situation der Städte und der AgglomerationenRücksicht nehmen. Da dies ein sehr wichtiges Anliegen derKdK ist, möchte ich Sie bitten, die Fassung der Kommissionzu übernehmen und nicht dem Antrag Aeby zuzustimmen.Die zweite Differenz besteht darin, dass wir die Berggebietewiederaufgenommen haben. Es war ein Anliegen dieses Ra-tes, die Berggebiete hier zu erwähnen. Wir haben dies be-reits zweimal zum Ausdruck gebracht, und es schien unsrichtig, dass wir auch in der dritten Runde diesen Wunschdes Rates respektieren.
Aeby Pierre (S, FR): Il y a encore beaucoup de monde quin’a pas vraiment compris le sens de cet article. Rédigécomme il l’est selon la proposition de la commission, villesplus agglomérations urbaines plus régions de montagne,c’est toute la Suisse, ça ne veut plus rien dire! Aujourd’hui, ily a en Suisse 4,5 millions de personnes qui vivent dans desagglomérations clairement définies. Ces 4,5 millions d’habi-tants vivent dans 800 communes, sur environ 3000. Ensem-ble, ils forment un peu moins de 50 agglomérations. En fait,il y en a 48 et je vais les énumérer: Baden, Bellinzone,Bienne, Brig-Visp, Brugg, Buchs, Burgdorf, Chiasso-Mendri-sio, Coire, Frauenfeld, Fribourg, Heerbrugg-Altstätten, Inter-laken, Kreuzlingen, La Chaux-de-Fonds, Lausanne, Lenz-bourg, Locarno, Lugano, Monthey, Neuchâtel, Olten, Pfäf-fikon, Rapperswil, Romanshorn, Sierre, Sion, Stans, Thoune,Vevey, Wetzikon, Winterthour, Yverdon-les-Bains, Zofingenet Zoug. Il y a encore les grandes, une dizaine: Berne, Zurich,Aarau, etc., que je n’énumère pas, car ce sont les plus gran-des.Pourquoi en sommes-nous arrivés là dans les délibérations –et le Conseil national est arrivé à la conclusion qu’il fallait unarticle particulier qui reconnaisse les agglomérations urbai-nes? C’est parce que tant au point de vue social, tant au pointde vue des courants culturels, tant au point de vue de l’orga-nisation des transports et de la mobilité dans notre pays, en-fin quant au domaine de la communication en général, cesendroits où vivent aujourd’hui une majorité de Suisses ont unrôle particulier à jouer.Les régions de montagne sont mentionnées à l’article 126 dela constitution. Cet article contient les dispositions relatives àla politique structurelle du pays, à la politique de régionalisa-
tion. Ce que nous voulons dire ici, c’est que, parmi les 3000communes de notre pays, il y en a 800 qui ont une situationparticulière, en ce sens qu’elles appartiennent à une agglo-mération, et que si on ne dit rien dans la constitution, on netient pas compte de ce phénomène. Nous manifestons à l’oc-casion de ce débat une espèce d’aversion antivilles qui estun peu viscérale à l’histoire de la Suisse, et qui est à monsens une erreur. Je regrette que la Conférence des gouver-nements cantonaux n’ait pas compris l’enjeu. Il ne s’agit pasde dépasser les cantons.Prenons l’article 41: son alinéa 1er consacre la garantie del’autonomie communale, ce qui est juste et ce que nousavons voulu dans le cadre de cet exercice de réforme. A l’ali-néa 2, nous demandons à la Confédération de tenir comptede l’incidence de ses décisions sur les communes. A l’ali-néa 3, nous disons en substance: «Attention, il y a en Suisse3000 communes, mais dans celles-ci il y en a 800 qui regrou-pent 4,5 millions d’habitants aujourd’hui, et ces 800 commu-nes ont un contexte particulier d’agglomération. Il est temps,dans ce pays, de tenir compte des problèmes des agglomé-rations.»C’est dans ce sens que je vous invite à vous rallier à la déci-sion du Conseil national, qui n’est autre que la version initialede la sous-commission de notre Conseil qui a préparé ce dé-bat. Donc, l’idée et le travail initial sur cet article 41 émanentde la sous-commission de notre Conseil. Je n’ai rien contreles régions de montagne, je viens d’un canton où il est ques-tion des régions de montagne et où on les défend, mais cequi est visé en l’espèce, ici, c’est tout à fait autre chose. Et ilest faux, en termes de système et de rédaction de la consti-tution, d’ajouter les régions de montagne à l’alinéa 3, ou ilfaudrait alors le biffer parce qu’on ne saurait pas commentl’utiliser. En y ajoutant les régions de montagne, on enve-loppe l’ensemble du territoire suisse, et c’est précisément cequ’on ne veut pas.
Loretan Willy (R, AG): Wir sind bei diesem Städte- und Ge-meindeartikel nun wirklich beim «letzten Gefecht». Man solltees kurz machen. Ich kann Herrn Aeby bestätigen, dass er dieAgglomerationen der Schweiz richtig aufgezählt hat. Ichhabe natürlich Freude, dass er am Schluss sogar noch meineliebe Vaterstadt Zofingen erwähnt hat. Ich möchte ihm dafürdanken. Spass beiseite!Bei dieser Differenz geht es ja wirklich um relativ wenig. Ichhabe im übrigen Freude, dass die Kommission mit einer Aus-nahme genau die Formulierung vorschlägt, die ich am 18.Juni 1998, in der ersten Runde der Differenzbereinigung, alsKompromissvorschlag eingebracht habe (AB 1998 S 703)und die dann durch Stichentscheid unseres sehr verehrtenHerrn Ratspräsidenten abgelehnt worden ist.Die Differenz besteht im Wort «dabei» in Artikel 41 Absatz 3.Herr Rhinow hat die Bedeutung dieses zusätzlich eingefüg-ten Wortes erläutert. Ich kann mich dem absolut anschlies-sen. Ich begreife den Unwillen von Herrn Aeby in bezug aufdie Berggebiete ein wenig. Indessen steckt doch mehr dahin-ter als nur die Anzahl der Gemeinden. Es geht hier um diekleinen Gemeinden. Im Berggebiet haben wir ja viel mehrkleinere Gemeinden und Kleinstgemeinden als in den übri-gen Landesteilen. Es ist also auch von politisch-psychologi-scher Bedeutung, dass wir dem wohlüberlegten Antrag derKommission zustimmen. Ich bin überzeugt, dass sich der Na-tionalrat – nachdem wir ihm bei den Absätzen 1 und 2 nach-gegeben haben – unserem Absatz 3 anschliessen wird, so-fern wir ihn so beschliessen, wie ihn die Kommission bean-tragt.Ich bitte Sie also, dem Antrag der Kommission zuzustimmen.
Schmid Carlo (C, AI): Als Vertreter eines Land- und Berg-kantons möchte ich Sie doch darauf aufmerksam machen,dass ich die Philosophie von Herrn Aeby in einem Punkt nichtteilen kann – nämlich dort, wo er uns auf Artikel 126 der Bun-desverfassung verweist. Nach meinen Unterlagen betrifft Ar-tikel 126 den Finanzausgleich und lautet: «Der Bund fördertden Finanzausgleich unter den Kantonen. Er berücksichtigtbei der Gewährung von Bundesbeiträgen die Finanzkraft der
7. Oktober 1998 S 213 Bundesverfassung. Reform
Amtliches Bulletin der Bundesversammlung / Separatdruck
Kantone und die Berggebiete.» Darum, Herr Aeby, geht esbei Artikel 41 gerade nicht.Wir müssen von der Vorstellung der Geldverteilerei Abschiednehmen, die etwa folgende ist: Das Armenhaus der Schweizwird vom starken Wirtschaftsraum des Mittellandes via Sub-ventionen finanziert. Solange das möglich ist, sollen dieseMenschen dort oben leben. Aber ein Eigenleben im Sinne ei-ner staatlichen Selbständigkeit ist ihnen ohnehin mit der Zeitabzusprechen. Wir geben Almosen, damit sie mit ihren «Sen-nenchutteli» herumlaufen können. Aber dann hat sich daslangsam einmal.Das ist in etwa die Vorstellung, die eben doch unterschwelligherrscht.Artikel 41 hat eine ganz andere Bedeutung, er ist der eigent-liche Gemeindeartikel; Artikel 126 ist der Finanzausgleichs-artikel. Beim Gemeindeartikel machen wir etwas Neues. Er-stens sagen wir erstmals ausdrücklich etwas über die Ge-meinde – mit Ausnahme des Zivilschutzes; das war ein Aus-rutscher. Es gibt Gemeinden, und sie werden von der Ver-fassung anerkannt. Zweitens – das ist wichtig – sagen wir inAbsatz 2, dass der Bund bei seinem Handeln die möglichenAuswirkungen auf die Gemeinden beachtet. Das ist in dieserForm auch neu.Jetzt frage ich mich, Herr Aeby, folgendes: Warum können inAbsatz 3 die Gemeinden der Berggebiete nicht auch genanntwerden, wenn man schon damit beginnt, das zu explizieren?Für den Bund gilt es natürlich, in seiner Legiferierung auf diespezifischen Probleme der Städte und der AgglomerationenRücksicht zu nehmen, aber meines Erachtens auch auf diespezifischen Probleme der Gemeinden in den Berggebieten.Während es typische Probleme von Städten und Agglomera-tionsgemeinden sind, wie sie mit sozialen Problemen, mitGesundheits- und Investitionslasten zu Rande kommen, gibtes natürlich ähnliche Bereiche in den Berggebieten nicht.Aber es gibt andere: Es gibt den Bereich der komplettenÜberforderung im institutionellen Bereich.Kann der Bund nicht zum Beispiel darauf Rücksicht nehmen,dass in der Landes- und Regionalplanung Berggebiete einekomplett andere Ausgangslage haben als Zentren? Kann derBund nicht darauf Rücksicht nehmen, dass es in den Berg-und Randgebieten eine völlig andere Siedlungsstruktur gibtals im Mittelland? Hätte der Bund das seinerzeit beim Erlassdes Raumplanungsgesetzes getan, dann hätten wir in denBerggebieten, wo es die Streusiedlungen gibt, nicht derartigeProbleme mit der Umsetzung dieses Gesetzes. Das sindÜberlegungen, die legitimerweise hier eben auch einfliessendürfen.Der Bund hat die Probleme der Gemeinden, die eben je nachLage unterschiedlich sind oder sein können, angemessen zuberücksichtigen. Wenn Sie in Absatz 3 die Städte und Agglo-merationen nennen, die Berggebiete aber ausklammern,dann ist das eine sogenannte negative Norm. Dann sagenSie, bei all diesen Dingen habe der Bund auf die Berggebietekeine Rücksicht zu nehmen, es genüge, wenn er Geld aus-schütte – nicht wahr: Almosen; Armenhaus –, und damit habees sich; der Rest sei uninteressant.Das ist eine völlig falsche Optik, es sei denn, das sei der po-litische Wille, dann muss man aber offen darüber diskutieren.Wenn man aber die Berggebiete in ihrer Art erhalten will,dann kann es nicht genügen, auf Artikel 126 zu verweisenund ein paar Franken zu schicken, sondern man muss be-reits in der Legiferierung auf Bundesebene auf die spezifi-schen Probleme der Berggebiete Rücksicht nehmen.Darum bin ich der Auffassung, die vorliegende Fassung derKommission in Artikel 41 Absätze 1, 2 und 3 sei beinahe op-timal.Ich bitte Sie daher, der Kommission zu folgen.
Aeby Pierre (S, FR): J’aimerais rapidement répondre àM. Schmid, dont je partage presque le nonante pour cent duraisonnement. J’aimerais prendre son raisonnement et lecontinuer. Non, je n’ai pas dit qu’il suffisait d’envoyer del’argent aux régions de montagne. Mais j’ai dit qu’il y a desproblèmes: par exemple, intégration de la population étran-gère, construction d’infrastructures culturelles, politique de
santé publique et de toxicomanie, transports. Il y a des pro-blèmes que les communes d’agglomération doivent réglercomme communes, et que les communes de régions demontagne ne doivent pas régler comme communes. C’est entant que communes: il y a des questions qui regardent typi-quement l’agglomération comme composition de communes,et qui ne se poseront jamais comme problèmes dans les ré-gions de montagne. C’est comme ça que j’entends cet alinéa,et c’est pour ça que je défends la version du Conseil national.
Koller Arnold, Bundesrat: Sie ersehen aus der Fahne, dassArtikel 41 eine gewisse Entwicklung durchgemacht hat. Ein-mal haben wir schon – allerdings im Sinne der strikten Nach-führung – einen ersten Schritt getan, indem wir das Prinzipder Gewährleistung der von den Kantonen bestimmten Ge-meindeautonomie durch den Bund ausdrücklich festgehal-ten haben. Dann kam der Wunsch nach einem eigenenStädteartikel auf, und das erklärt die Entwicklung dieses Ar-tikels.Ich habe nie ein Hehl daraus gemacht, dass mir eigentlichIhre Formulierung am besten gefallen hätte. Es wäre dieschlankste Fassung gewesen, und sie hätte auch der geleb-ten Verfassungswirklichkeit entsprochen. Aber jetzt geht esum das Differenzbereinigungsverfahren, und es ist wichtig,nochmals festzuhalten, dass es sich bei diesem Artikel wirk-lich um eine Nachführung im Sinne der heute gelebten Ver-fassungswirklichkeit handelt.Deshalb können wir auch die Befürchtungen der KdK zer-streuen. Die KdK hat ja befürchtet, dass wir mit der Fassungdes Nationalrates bei Absatz 1 die Gemeindeautonomie zueinem Bundesrechtsinstitut erheben würden. Das ist klarnicht der Fall. Wir wollen hier keine Neuerung einführen, son-dern es ist festzuhalten, dass nach geltendem Recht undauch nach der neuen Formulierung des Nationalrates dieKantone darüber entscheiden, ob und in welchem Umfangden Gemeinden Autonomie eingeräumt wird. Der Bund ge-währt den Gemeinden nur im Bereich der kantonal einge-räumten Gemeindeautonomie Rechtsschutz. Das ist auchnach der Fassung des Nationalrates eindeutig der Fall undsoll hier zuhanden der Materialien und zur Beruhigung derKdK ausdrücklich festgehalten werden.Im Differenzbereinigungsverfahren muss man immerhin an-erkennen, dass der Nationalrat Ihnen und dem Bundesratentgegengekommen ist, indem in Absatz 3 jetzt nicht mehr indie Autonomie der Kantone eingegriffen wird. Das war natür-lich in unserem föderalistischen Staat mehr als ein Schön-heitsfehler. Ich habe deshalb ein gewisses Verständnis da-für, dass Ihre Kommission bereit ist, im übrigen jetzt dem Na-tionalrat entgegenzukommen.Ich bin allerdings auch der Meinung, dass es falsch wäre, hiernur die Situation der Städte und der Agglomerationen zu nen-nen. Natürlich ist der Bund schon früher, rein historisch, imSinne der gelebten Verfassungswirklichkeit vor allem zumSchutze der Berggebiete tätig geworden und – wie HerrSchmid richtig ausgeführt hat – nicht nur auf dem Gebietedes Finanzausgleiches und auch nicht nur im Sinne derStrukturpolitik, bei der nicht nur auf die Berggebiete, sonderngenerell auf bedrohte Landesteile abgestellt wird. Es wäre,auch nach Auffassung des Bundesrates, eine «Verkürzung»der gelebten Verfassungswirklichkeit, wenn Sie hier dieBerggebiete streichen würden.Herr Aeby hat natürlich recht: In neuester Zeit haben wir beiunserer Gesetzgebung vor allem auf die besonderen Pro-bleme der Agglomerationen Rücksicht genommen, wenn Siean die Verkehrspolitik denken, wenn Sie an die Drogenpolitikdenken, um nur einige wenige Beispiele zu nennen. Aberdas ist wirklich kein Grund, um hier die Berggebiete heraus-zunehmen. Im übrigen bin ich kein spezialisierter Regional-politiker, aber hinter Ihre Aussage, die von Ihnen genannten48 Agglomerationen hätten jetzt schon den Segen des Bun-desrechtes, möchte ich doch ein Fragezeichen gesetzt ha-ben.
Abs. 1, 2 – Al. 1, 2Angenommen – Adopté
Constitution fédérale. Réforme 214 E 7 octobre 1998
Bulletin officiel de l’Assemblée fédérale / Tiré à part
Abs. 3 – Al. 3
Präsident: Herr Aeby beantragt Zustimmung zum Beschlussdes Nationalrates.
Abstimmung – VoteFür den Antrag der Kommission 32 StimmenFür den Antrag Aeby 3 Stimmen
Art. 57abis Abs. 1Antrag der KommissionZustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Art. 57abis al. 1Proposition de la commissionAdhérer à la décision du Conseil national
Rhinow René (R, BL), Berichterstatter: Bei dieser letzten Be-stimmung, die wir zu bereinigen haben, geht es um eine ma-terielle Änderung. Beide Verfassungskommissionen habenbeschlossen, das Thema Berufsbildung nochmals auf dieTraktandenliste zu setzen, obwohl nach dem ersten Durch-gang keine Differenz zwischen den beiden Räten mehr be-standen hat.Es geht um eine Ausdehnung der Zuständigkeit des Bundesim Bereich der Berufsbildung über die klassischen Biga-Be-rufe hinaus.Das System der Berufsbildung geht, wie Sie alle wissen, voneiner Aufgabenteilung zwischen Bund, Kantonen und Berufs-organisationen aus. Der Bund regelt gemäss Artikel 57abisAbsatz 1 die berufliche Ausbildung in Industrie, Gewerbe,Handel, Landwirtschaft und Hausdienst. Das haben wir auchin der Fassung, die Sie der Fahne entnehmen können, soverankert. Die Kantone sind dabei mit wesentlichen Vollzugs-aufgaben betraut; ich denke etwa an die Organisation desberuflichen Unterrichtes, an die Ausbildung der Lehrmeister.Andere Bereiche der Berufsbildung, also namentlich die Be-rufe in Erziehung, Gesundheit – soziale Berufe – und Kunst,fallen in die Zuständigkeit der Kantone. Die Berufsverbändewerden unter anderem für die Festlegung der Berufsbildungund die Organisation der Prüfungen mit einbezogen.Ein Hauptproblem unserer heutigen Berufsbildung liegt darin,die Kohärenz des gesamten Systems herzustellen bzw. zubewahren. Nun haben sich die Kantone mit dieser Koordina-tion grosse Mühe gegeben, und zwar seit Beginn diesesJahrhunderts. Die Probleme haben jedoch zugenommen.Die interkantonale Vereinbarung von 1993 über die Anerken-nung von Ausbildungsabschlüssen ist ein Zeichen der teil-weise erfolgreichen Bemühungen auf kantonaler Ebene.Eine umfassendere Bundeskompetenz drängt sich aber ausverschiedenen Gründen auf: zum Beispiel mit Blick auf dieAnerkennung von Ausbildungsabschlüssen im Ausland – einThema, das ich Ihnen nicht mehr ausbreiten muss. Die Auf-gabenteilung hat aber auch immer wieder zu Abgrenzungs-problemen geführt, weil sich die Berufsbilder im Laufe derJahre verändert haben und weiter verändern werden. Ichkann Ihnen ein Beispiel nennen: Der Beruf der Arztgehilfinwurde ursprünglich als Krankenpflegeberuf verstanden; erwurde von den Kantonen geregelt. Heute geht man davonaus, dass hier kaufmännisch-organisatorische Elementeüberwiegen, so dass sich eine Unterstellung unter das Be-rufsbildungsgesetz des Bundes rechtfertigt.Ähnliche Probleme stellen sich bei anderen Berufsbildungen.Anfang dieses Jahrhunderts wurden Teile der Berufsbildungdem Bund übertragen, weil man einen einheitlichen Wirt-schaftsraum Schweiz in bezug auf mobile Arbeitskräfte ein-richten wollte. Man wollte bewusst Qualifikationen landesweitanerkennen, und zwar Qualifikationen mit materiell gleich ho-hen Anforderungen in der ganzen Schweiz. Diese immernoch gültige, ja heute erst recht gültige Idee erfordert eineAusdehnung dieser Bundeskompetenz.Die Anregung – das darf ich Ihnen sagen – ist nicht imSchosse der Kommission geboren worden, sondern siewurde von aussen an uns herangetragen, aus dem Kreis derKantone und auch aus dem Kreis der Bundesverwaltung. Wir
überschreiten – dessen sind wir uns bewusst – die Grenzeneiner eng verstandenen Nachführung der Verfassung. Eshandelt sich auch hier um eine rechtspolitische Neuerung,die wir kritisch darauf hin prüfen müssen, ob sie konsensfähigist.Die Kantone sind natürlich in erster Linie von dieser Auswei-tung betroffen, und wir haben auch das Gespräch mit denKantonen gesucht. Sie haben gegen diese umfassende Bun-deskompetenz keine grundsätzlichen Einwände geäussert.Auch die Arbeiten am Projekt «Neuer Finanzausgleich zwi-schen Bund und Kantonen» haben schliesslich zur Einsichtgeführt, dass der Bund eine solche umfassende Kompetenzhaben sollte.Wir dürfen also davon ausgehen, dass dieser Konsens gege-ben ist, wobei ich gleich auf eine kleine Einschränkung ein-gehen werde.Schliesslich ein weiterer Vorteil dieser neuen Regelung: DieRevisionsarbeiten am Berufsbildungsgesetz sind angelau-fen, und es wäre nicht sehr zweckmässig, wenn nach An-nahme der Verfassung gleich eine Teilrevision im Kompe-tenzbereich des Bundes vorgenommen werden müsste. Wirkönnen also diesem Bedürfnis mit der Totalrevision der Ver-fassung gerecht werden.Zur kleinen Einschränkung: Den Kantonen liegt es am Her-zen – ich möchte das sehr ernst nehmen –, dass diese ansich umfassende Bundeskompetenz kein Freipass für einedetaillierte Bundesregelung aller Teilaspekte und Einzelhei-ten in diesem Bereich der Berufsbildung wird. Den Kantonensoll und muss hier ein recht grosser Gestaltungsspielraumerhalten bleiben. Erweiterung der Bundeskompetenz bedeu-tet also nicht Wegnahme der kantonalen Autonomie überalldort, wo die Kantone in der Tat bis heute ihre Autonomiewahrgenommen haben. Es wird beispielsweise spezifischeBerufe geben, die sinnvollerweise von den Kantonen gere-gelt werden sollen; ich nenne als Beispiel etwa Spezialberufein der Uhrenindustrie.Es wird also – der Philosophie unseres Föderalismus ge-mäss – darum gehen, dass Bund und Kantone zusammen-wirken, dass den Kantonen gemäss Artikel 37 der neuen Ver-fassung ein wichtiger Autonomiebereich belassen wird.Ich meine, dass mit dieser Zusicherung den Bedenken derKantone, die sich, wie gesagt, nicht auf den Grundsatz bezie-hen, Rechnung getragen wird.
Koller Arnold, Bundesrat: Nach den einlässlichen Ausfüh-rungen von Herrn Rhinow kann ich mich kurz fassen.Es handelt sich hier eindeutig um eine gewisse rechtspoliti-sche Neuerung, die aber konsensfähig ist. Die Schweizeri-sche Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren hat mirgeschrieben: «Wir opponieren einer Neufassung des Berufs-bildungsartikels, der dem Bund die Gesetzgebungskompe-tenz für den ganzen Bereich der beruflichen Ausbildung er-teilt, nicht.» Das war natürlich entscheidend wichtig. Sie hät-ten zwar lieber eine andere Formulierung gehabt, die die Ko-ordination im einzelnen festgelegt hätte, aber nach denErklärungen des Präsidenten Ihrer Kommission bin ich über-zeugt, dass die Kantone mit dieser Formulierung leben kön-nen. Die Zeit drängt.Deshalb möchte ich Ihnen empfehlen, hier zuzustimmen.
Angenommen – Adopté
An den Nationalrat – Au Conseil national
1. Dezember 1998 S 215 Bundesverfassung. Reform
Amtliches Bulletin der Bundesversammlung / Separatdruck
Zweite Sitzung – Deuxième séance
Dienstag, 1. Dezember 1998Mardi 1er décembre 1998
08.00 h
Vorsitz – Présidence: Rhinow René (R, BL)
___________________________________________________________
96.091
Bundesverfassung.ReformConstitution fédérale.Réforme
Differenzen – Divergences
Beschluss des Nationalrates vom 30. November 1998Décision du Conseil national du 30 novembre 1998
___________________________________________________________
A1. Bundesbeschluss über eine neue Bundesverfas-sung (Titel, Art. 1–126, 185)A1. Arrêté fédéral relatif à une mise à jour de la Consti-tution fédérale (titre, art. 1–126, 185)
Art. 57hAntrag der KommissionAbs. 1bis, 3bisZustimmung zum Beschluss des NationalratesAbs. 2Festhalten
Art. 57hProposition de la commissionAl. 1bis, 3bisAdhérer à la décision du Conseil nationalAl. 2Maintenir
Aeby Pierre (S, FR), rapporteur: Il n’est peut-être pas inutile,au départ de l’examen de ces divergences, de rappeler unpeu la systématique et le programme qui nous attend durantcette session. Aujourd’hui, nous allons éliminer – tel est levoeu en tout cas de la commission, unanime – quelques di-vergences relatives au projet A1 partie 2, c’est-à-dire de l’ar-ticle 57h à l’article 126 et les dispositions transitoires. Dansune semaine, nous serons appelés à nous pencher sur les di-vergences portant sur le projet A2, c’est-à-dire de l’article 127à l’article 184. Le vendredi 11 décembre aura lieu la Confé-rence de conciliation entre les Commissions de la révisionconstitutionnelle du Conseil national et de notre Conseil. En-suite, le mardi 15 décembre, nous serons appelés à nousprononcer sur les propositions de cette Conférence de conci-liation, étant entendu que la volonté du Conseil fédéral etcelle des Commissions de la révision constitutionnelle et desBureaux est que nous puissions passer ce projet A en vota-tion finale le vendredi 18 décembre, dernier jour de sessionde l’année 1998. Tout a été mis en oeuvre, aussi bien par no-tre Bureau que par le Bureau du Conseil national, pour quenous puissions tenir ce programme ambitieux.En ce qui concerne ce projet A1 partie 2, soit les articles 57het suivants, nous nous sommes ralliés environ sur le 50 pourcent des divergences que nous avons constatées au Conseilnational.
Pour ce qui concerne l’article 57h, nous nous sommes ralliésà la nouvelle systématique. Vous constatez que l’alinéa 1bisdevient l’alinéa 3bis. Votre commission n’a pas opposé sonveto à ce changement de systématique.En revanche, et c’est un point important à signaler, nousavons maintenu la version de notre Conseil à l’alinéa 2. Notrerédaction élimine l’élément de phrase suivant: «Afin de pré-server la paix des langues»; en allemand: «Zur Wahrung desSprachfriedens». Cet élément de phrase n’est pas dans laversion de notre Conseil, car la commission considère, àl’unanimité, qu’à la fin de ce siècle il est quasiment incongrude parler de maintien de la paix des langues dans une Suisseen plein processus d’intégration européenne. Nous considé-rons que nous avons, à ce stade, à maintenir notre version età ne pas donner à penser que la paix des langues est unsouci dans notre pays. Peut-être que la Conférence de con-ciliation trouvera une autre formule parlant d’«harmonie entreles communautés linguistiques» ou quelque chose d’autre;peut-être aussi que nous arriverons à faire accepter notrepoint de vue par la Conférence de conciliation.En l’état, votre commission vous propose, en éliminant la no-tion de «paix des langues», de maintenir la décision de notreConseil à l’alinéa 2.
Angenommen – Adopté
Art. 57kAntrag der KommissionFesthaltenProposition de la commissionMaintenir
Aeby Pierre (S, FR), rapporteur: L’article 57k, qui ouvre lasection consacrée à l’aménagement du territoire et à la pro-tection de l’environnement, est chapeauté par cette disposi-tion sur le développement durable, «Nachhaltigkeit». Notrecommission souhaite maintenir cette divergence, considé-rant en effet que le développement durable et sa définition,telle qu’elle figure sur le dépliant, appartiennent bel et bien àce chapitre et que c’est tout à fait important de disposer, dansla Constitution fédérale, d’une définition du développementdurable.Les définitions du développement durable sont nombreuses.C’est encore un terme qui reste flou. La commission proposede maintenir cette définition, qui deviendra désormais offi-cielle à l’occasion de cet exercice de mise à jour de la cons-titution, en tête du chapitre consacré à l’aménagement du ter-ritoire, et de ne pas adhérer à la décision du Conseil nationalqui, sous un autre libellé, veut ancrer le développement du-rable à l’article 2 alinéa 2, ce que nous avons rejeté de façoncatégorique et sans opposition.Maintien donc de notre décision à l’article 57k.
Angenommen – Adopté
Art. 71Antrag der KommissionZustimmung zum Beschluss des NationalratesProposition de la commissionAdhérer à la décision du Conseil national
Aeby Pierre (S, FR), rapporteur: A l’article 71, nous noussommes ralliés à la décision du Conseil national qui, danscet article consacré au transport ferroviaire, à la navigationet à l’aviation, avait introduit les téléphériques, «die Seilbah-nen».Nous avons modifié notre point de vue parce qu’avant tout, laConférence des gouvernements cantonaux qui, au départdes délibérations, en avait fait une question de principe, s’estralliée à la décision du Conseil national, après avoir examinél’ensemble de la question. Elle a considéré que c’était finale-ment un avantage d’intégrer également les téléphériquesdans le champ de compétence très large de la Confédérationen la matière, et que le risque qui avait été perçu au départcomme très concret de voir la Confédération empiéter sur
Constitution fédérale. Réforme 216 E 1er décembre 1998
Bulletin officiel de l’Assemblée fédérale / Tiré à part
des compétences traditionnelles des cantons, notamment enmatière d’installations touristiques pour les champs de ski –c’est ce qui avait fait peur aux gouvernements cantonauxdans un premier temps – était plus qu’hypothétique. En effet,la législation fédérale et les législations cantonales mettentdéjà suffisamment de conditions-cadres à l’octroi de tellesconcessions et à la construction ou à la modernisation de tel-les installations. Si bien que le système, ici, au contraire, peutse traduire par un avantage de voir la Confédération globale-ment compétente pour toute cette question des transportspar rail, par câble ou dans les airs.
Angenommen – Adopté
Art. 72 Abs. 3Antrag der KommissionZustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Art. 72 al. 3Proposition de la commissionAdhérer à la décision du Conseil national
Aeby Pierre (S, FR), rapporteur: L’article 72 marque la vic-toire des défenseurs des chemins et des sentiers pédestresdans notre Conseil, puisque nous nous rallions à la décisiondu Conseil national. Nous acceptons par conséquent d’intro-duire dans la constitution l’alinéa 3 du projet du Conseil fédé-ral, considérant que cette question, qui est d’une importancemineure juridiquement, peut revêtir une importance psycho-logique extrêmement importante, au moment du vote du peu-ple et des cantons sur la mise à jour de la Constitution fédé-rale, et qu’il est peut-être inutile ici de faire trop de juridisme.Il est politiquement habile de reprendre l’article 72 dans laversion sur laquelle le peuple, il n’y a pas si longtemps, a étéamené à se prononcer.Votre commission vous propose ici également de vous rallierà la décision du Conseil national.
Angenommen – Adopté
Art. 75 Abs. 1Antrag der Kommission(Übereinstimmender Antrag beider Kommissionen gemässArt. 16 Abs. 3 GVG)Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Art. 75 al. 1Proposition de la commission(Proposition d’un commun accord des deux commissions se-lon l’art. 16 al. 3 LREC)Adhérer au projet du Conseil fédéral
Aeby Pierre (S, FR), rapporteur: L’article 75 a suivi une pro-cédure particulière, puisque c’est suite à la proposition d’uncommun accord des deux commissions, et alors qu’il n’yavait pas de divergence au départ, qu’il a été revu et quenous en revenons à la version du projet du Conseil fédéral.Ici aussi, l’importance est plus politique que juridique. Le pro-jet du Conseil fédéral dispose: «Les services postaux et lestélécommunications relèvent de la compétence de la Confé-dération.»Nous avions, dans un premier temps, évoqué la législationsur les services postaux. On a vu dans cette modification unevolonté de camoufler un désir de privatisation totale de cessecteurs. C’est pour cela que, d’un commun accord entre lesdeux commissions, nous en sommes maintenant revenus àla version initiale du Conseil fédéral. Cette version d’ailleursn’exclut absolument pas la possibilité de concessionner cegenre de service public.La commission vous propose de vous rallier à cette décisioncommune des deux commissions et d’éliminer ainsi cettepseudo-divergence.
Angenommen – Adopté
Art. 85 Abs. 3Antrag der KommissionFesthalten
Art. 85 al. 3Proposition de la commissionMaintenir
Aeby Pierre (S, FR), rapporteur: Si nous maintenons la diver-gence aussi bien en commission qu’au plénum, c’est quenous avons eu largement l’occasion de débattre de façontrès concrète de l’élément de phrase qui mentionne la con-currence. Une grande majorité de notre Conseil tient par-dessus tout à voir figurer ici cette référence à la concurrenceet aux mesures qui peuvent menacer cette concurrence. Il ya là la volonté d’affirmer que la concurrence reste en principe,dans notre pays, la règle du marché.C’est dans ce sens que la commission vous propose, sansopposition, de maintenir votre décision.
Angenommen – Adopté
Art. 95Antrag der KommissionZustimmung zum Beschluss des NationalratesProposition de la commissionAdhérer à la décision du Conseil national
Aeby Pierre (S, FR), rapporteur: A l’article 95, il s’agit d’unedivergence pour les esthètes: est-ce que le titre doit être«Agriculture» ou «Politique agricole»? Nous avons décidé,pour ne pas continuer à traîner avec nous ce boulet et cettedivergence supplémentaire, de nous rallier au titre décidé parle Conseil national, «Agriculture», et non pas à celui de notreConseil «Politique agricole», pour des raisons d’ailleurs quela commission n’a pas comprises; mais il n’est pas toujoursindispensable de tout comprendre dans un exercice tel quecelui que nous menons depuis plus d’une année!
Angenommen – Adopté
Art. 100 Abs. 1Antrag der KommissionFesthalten
Art. 100 al. 1Proposition de la commissionMaintenir
Aeby Pierre (S, FR), rapporteur: A l’article 100, nous mainte-nons la divergence concernant le bail à loyer, considérantque la formulation du Conseil national, qui parle de «l’annu-labilité des congés abusifs», est extrêmement complexe, etqu’il est difficile de se rendre compte de ce qu’elle recouvreexactement. Nous considérons que dans la version de notreConseil, qui parle des «abus en matière de bail à loyer, no-tamment contre les loyers et les congés abusifs», cette no-tion de «congés abusifs» englobe tout à fait la notion «d’an-nulabilité des congés abusifs», et que l’effet juridique n’estabsolument pas différent, suivant que l’on retient la versiondu Conseil national ou celle de notre Conseil. En conséquence, notre version étant beaucoup plus compré-hensible, nous vous proposons de la maintenir, et ceci sansopposition en commission.
Angenommen – Adopté
Art. 101Antrag der KommissionAbs. 1 Bst. abisMehrheitFesthaltenMinderheit(Leumann, Aeby, Frick, Gentil, Respini, Saudan, Schüle)Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
1. Dezember 1998 S 217 Bundesverfassung. Reform
Amtliches Bulletin der Bundesversammlung / Separatdruck
Abs. 3MehrheitFesthaltenMinderheit(Gentil, Aeby, Büttiker, Respini)Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Art. 101Proposition de la commissionAl. 1 let. abisMajoritéMaintenirMinorité(Leumann, Aeby, Frick, Gentil, Respini, Saudan, Schüle)Adhérer à la décision du Conseil national
Al. 3MajoritéMaintenirMinorité(Gentil, Aeby, Büttiker, Respini)Adhérer à la décision du Conseil national
Abs. 1 Bst. abis – Al. 1 let. abis
Aeby Pierre (S, FR), rapporteur: La majorité de la commis-sion considère que le fait que la Suisse ait adhéré à tous lestextes internationaux en matière de protection de l’enfancenous dispense d’inscrire expressément l’interdiction du tra-vail des enfants dans la constitution.En outre, l’interdiction du travail des enfants peut être malcomprise et pourrait empêcher des enfants d’une famille agri-cole, les enfants d’un épicier, les enfants d’un cordonnier,etc., de temps à autre de donner un coup de main à leurs pa-rents. Dans ce sens, la majorité souhaite biffer cette lettreabis, alors même que l’interdiction du travail des enfantss’adresse évidemment à une interdiction dans le cadre de lalégislation ordinaire sur le travail. Mais c’est la crainte quecette interdiction soit différemment comprise, c’est devant lamontée aussi de mouvements de défense des enfants que lamajorité de la commission craint des abus suite à l’inscriptionde cette disposition.La commission a cherché d’autres formulations qui soient àmême de concilier les propositions de la majorité et de la mi-norité. Toutes ces tentatives de formulation se sont avéréespires et ont échoué.En conséquence, la commission arrive devant vous très par-tagée, comme vous le constatez d’après le dépliant.
Leumann Helen (R, LU): Ich kann mich sehr kurz fassen,denn die Argumente liegen eigentlich schon auf dem Tisch,seit wir mit der Beratung der Bundesverfassung begonnenhaben. Sie haben sich bei keiner von beiden Seiten geän-dert. Ich möchte nur noch einmal bestätigen, was Herr Aebygesagt hat, nämlich: dass wir das Verbot der Kinderarbeit inunserem Rechtswesen ja geregelt haben und dass es sichhierbei nicht um ein Verbot im Sinne von Mithilfe im Haushaltoder zu Hause auf dem Hof oder so handeln kann, sondernum ein grundsätzliches Verbot der Kinderarbeit.Ich möchte vor allen Dingen darauf hinweisen, dass der Na-tionalrat diesem Verbot der Kinderarbeit mit 102 zu 38 Stim-men sehr deutlich zugestimmt hat. Es ist eine Differenz, diewir jetzt eliminieren könnten. Wir waren in der Kommissioneine starke Minderheit.Ohne dass ich jetzt noch einmal die ganzen Argumente wie-derhole, meine ich, wir sollten uns dem Beschluss des Natio-nalrates anschliessen.
Forster Erika (R, SG): Ich bitte Sie, an der Differenz festzu-halten. Heraufstufen macht im Rahmen der Nachführungmeines Erachtens nur dort Sinn, wo es um neue, moderneProbleme geht. Deshalb haben wir beispielsweise den Da-tenschutz von der Stufe der einfachen Gesetzgebung aufVerfassungsstufe gehoben. Aber Kinderarbeit ist in unserem
Land doch kein Problem; es denkt kein Mensch daran, in denFabriken je wieder Kinderarbeit einzuführen!Während der Zeit, als die Kinderarbeit auch in unserem Landüblich war, gab es keinen Verfassungsartikel; jetzt möchteman einen Verfassungsartikel einfügen. Ich denke, wir habendieses Problem über die Gesetzgebung gelöst. Für mich istes ein falsches Signal, wenn wir jetzt das Verbot der Kinder-arbeit in die Verfassung einfügen.Ich bitte Sie deshalb, die Mehrheit zu unterstützen und an un-serem Beschluss festzuhalten.
Schallberger Peter-Josef (C, NW): Ich bin sehr dankbar fürdas Votum, das wir soeben gehört haben. Wir haben unswährend der Beratungen über die nachgeführte Verfassungsorgfältig überlegt, was unter Nachführung zeitgemäss for-muliert werden soll. Wir haben es vermieden, umstrittene Ar-tikel zu ändern, zu streichen oder neu beizufügen. So habenwir die Aufhebung der Kantonsklausel auf eine separate Vor-lage verwiesen und ebenso die Streichung des Bistumsarti-kels gemäss Antrag der Staatspolitischen Kommission in dieVernehmlassung gegeben, ohne diesen Artikel aus unseremEntwurf zu streichen.Hier beantragt nun eine Kommissionsminderheit einen völligneuen Buchstaben abis, der bei einem nicht unbedeutendenTeil unseres Stimmvolkes Ängste und Vorbehalte auslösenkann. Die Bauernfamilien und viele kleine Gewerbebetriebesind in «Stosszeiten» auf die Mithilfe auch ihrer Kinder drin-gend angewiesen. Beteuerungen, es sei nicht die Verunmög-lichung dieser Mithilfe gemeint, genügen mir nicht. Eine re-striktivere Auslegung ist durch eine Heraufstufung diesesProblems durchaus zu befürchten.Ich bitte Sie daher dringend, von einer solchen Ergänzungdurch einen Buchstaben abis abzusehen.
Danioth Hans (C, UR): Ich möchte das Votum meines Nach-barn unterstützen und ergänzen. Vor allem aber möchte icheine Frage stellen, die noch nicht beantwortet wurde.Man argumentiert damit, dass das Verbot der Kinderarbeit inder Verfassung verankert werden soll. Von der Notwendig-keit eines derartigen Verbotes bin ich bisher nicht überzeugtworden. Niemand in diesem Land wird ernstlich an eine ex-zessive Kinderarbeit denken. Diese Bestimmung in der abso-luten und apodiktischen Form, wie sie auf der Fahne steht,könnte natürlich zu Missverständnissen und anderslauten-den Interpretationen führen, wie dies Herr Schallberger völligzu Recht dargelegt hat.Zu meiner Frage: Wir haben noch eine Differenz bei den er-sten Artikeln, bei Artikel 9a, wo wir unter «Schutz der Kinderund Jugendlichen» festhielten: «Kinder und Jugendliche ha-ben Anspruch auf besonderen Schutz ihrer Unversehrtheitund Entwicklung.» Der Nationalrat ging in Artikel 11a nochweiter. Dort heisst es unter dem Titel «Rechte der Kinder undJugendlichen»: «Die Kinder und Jugendlichen haben An-spruch auf eine harmonische Entwicklung und auf denSchutz, den ihre Situation als Minderjährige erfordert.»Irgendeine diesbezügliche Version wird wohl zum Beschlusserhoben werden. Deckt diese umfassende Bestimmung nichtauch das berechtigte Anliegen ab, dass man die Kinder nichtzu unzumutbarer, ihrer Entwicklung zuwiderlaufender Arbeitanhalten soll?Dann wäre diese Ergänzung in Artikel 101 Absatz 1 Buch-stabe abis schon deshalb überflüssig. Um so mehr glaubeich, dass wir von solchen Experimenten absehen sollten.
Aeby Pierre (S, FR): Je m’exprime ici à titre personnel, et nonpas comme rapporteur. C’est l’intervention de M. Danioth quim’y pousse.Il est faux de dire qu’en Suisse aujourd’hui nous n’avons pasbesoin d’une disposition dans la constitution sur l’interdictiondu travail des enfants. C’est faux! L’évolution sociale le mon-tre: aujourd’hui, la crise économique fait que on exige de plusen plus des enfants qu’ils travaillent à la sortie de l’école. Cen’est pas seulement chez les enfants d’indépendants ou depetits indépendants, pas forcément chez les enfants de fa-
Constitution fédérale. Réforme 218 E 1er décembre 1998
Bulletin officiel de l’Assemblée fédérale / Tiré à part
milles d’agriculteurs, qu’il y a les plus grands risques, maisaussi du côté des familles de salariés où on demande de plusen plus aux enfants de faire un travail supplémentaire le sa-medi, parfois le dimanche, pendant les jours de congé, parceque le budget de la famille se restreint. Chacun de nous con-naît des exemples. On peut discuter de la façon dont les en-fants sont élevés et de ce qu’on exige des enfants en dehorsdes temps scolaires dans certaines familles.Il est faux de dire ici que le risque n’existe pas, ou n’existeplus, ou n’existera plus jamais dans notre pays. Ça n’est pasvrai, ça dépend fortement de l’évolution de la situation éco-nomique.
Koller Arnold, Bundesrat: Bei Artikel 101, bei der Frage desVerbotes der Kinderarbeit, geht es eindeutig um eine politi-sche Zweckmässigkeitsfrage. Es geht nämlich allein um dieFrage, ob wir eine Kompetenz, die der Bund schon aufgrundvon Absatz 1 Litera a hat und übrigens auch benutzt hat – dasVerbot der Kinderarbeit gilt heute schon in der Schweiz –, jetztauf Verfassungsstufe heben wollen. Das ist die politischeWertungs- und Zweckmässigkeitsfrage, die Sie zu entschei-den haben.Der Ständerat und der Bundesrat sind bisher der Meinunggewesen, dass das nicht opportun sei, und zwar aus derÜberlegung heraus, dass wir dieses Verbot der Kinderarbeitschon heute haben und eigentlich ein falsches Signal gebenwürden – als ob das Verbot der Kinderarbeit in der Schweizheute ein grosses Problem wäre. Das ist die eine Argumen-tation gewesen.Die andere Argumentation haben Sie soeben von HerrnAeby gehört: Es gibt Leute, die befürchten, dass das Problembei uns wieder aktuell werden könnte. Das ist die Frage, dieSie zu entscheiden haben.Ich möchte aber vor allem auf folgendes hinweisen: Der Bun-desrat hat am 21. September 1998 einen Bericht verabschie-det, in dem er dem Parlament die Genehmigung des Über-einkommens Nr. 138 über das Mindestalter für die Zulassungder Beschäftigung beantragt. Dieses Übereinkommen ist imJahre 1973 von der Internationalen Arbeitskonferenz ange-nommen worden. Es legt das Mindestalter für alle Arten vonArbeit grundsätzlich bei 15 Jahren fest, sieht aber für leich-tere Arbeiten ein tieferes, nämlich 13 Jahre, und für gefährli-che Arbeiten ein höheres Mindestalter, nämlich 18 Jahre,vor. Der Bundesrat schlägt dem Parlament vor, das Überein-kommen in allen Wirtschaftsbereichen, d. h. auch in derLandwirtschaft, in den Gärtnereien, in der Fischerei und inden privaten Haushaltungen, anzuwenden, jedoch reine Fa-milienbetriebe, auf die das Arbeitsgesetz nicht anwendbarist, von diesem Geltungsbereich auszunehmen.Der Schweizerische Bauernverband hat sich in der Vernehm-lassung zur Genehmigung dieses Abkommens und auchzum grundsätzlichen Einbezug der Landwirtschaft positiv ge-äussert, allerdings im Wissen darum, dass Familienbetriebeausgenommen sind, wie ich soeben ausgeführt habe.Arbeiten, die von Kindern in allgemeinbildenden und berufs-bildenden Schulen und in anderen Ausbildungsstätten aus-geführt werden, sowie Arbeiten, die von Kindern im Alter vonmindestens 14 Jahren im Rahmen einer Lehre in Betriebenausgeführt werden, fallen nicht in den Geltungsbereich die-ses Abkommens. Ebenfalls nicht erfasst werden Gelegen-heitsarbeiten zur Aufbesserung des Taschengelds, also Ba-bysitten, sporadischer Verkauf von Zeitungen und ähnlicheNebenerwerbstätigkeiten.Ich glaube, Sie werden dieses Abkommen demnächst bera-ten. Das zeigt Ihnen noch einmal, dass wir das Verbot derKinderarbeit schon haben, und zwar in einer differenzierten,austarierten Art und Weise.Ich möchte einfach noch festgehalten haben: Wenn sich derNationalrat und die Minderheit Leumann durchsetzen, dannist es sicher zweckmässig, dass man zuhanden der Materia-lien festhält, dass das Verbot der Kinderarbeit im Sinne die-ses Abkommens zu verstehen ist; das wäre wichtig. Im übri-gen ist es, wie gesagt, ein Zweckmässigkeits-, ein Wertungs-entscheid, den Sie zu treffen haben.
Abstimmung – VoteFür den Antrag der Mehrheit 28 StimmenFür den Antrag der Minderheit 14 Stimmen
Abs. 3 – Al. 3
Aeby Pierre (S, FR), rapporteur: Dans le projet du Conseil fé-déral, le 1er août est assimilé à un dimanche. Dans la versiondu Conseil national, il est assimilé à un dimanche, mais ré-munéré. Comme rapporteur, je peux être très bref. Tous lesarguments ont été avancés sur ce point. Les opinions au seinde la commission étaient faites, ce qui nous vaut une propo-sition de minorité qui demande d’adhérer à la décision duConseil national.
Büttiker Rolf (R, SO): Ich möchte Ihnen beliebt machen, sichhier dem Nationalrat anzuschliessen und dieses unwürdige«Schauspiel» um den 1. August – die Bezahlung des Lohnsan diesem Tag und die entsprechende Formulierung in derVerfassung – zu beenden. Wir sind uns in der Sache selbsteigentlich einig, dass der 1. August bezahlt werden muss unddass eine Lohnzahlungspflicht besteht.In Artikel 116bis Absatz 1 der geltenden Bundesverfassungheisst es: «Der 1. August ist in der ganzen Eidgenossen-schaft Bundesfeiertag.» Absatz 2 lautet: «Er ist arbeitsrecht-lich den Sonntagen gleichgestellt. Einzelheiten regelt dasGesetz.» Nur ist es bisher durch das Gesetz zu keiner Rege-lung gekommen. Das Bundesfeiertagsgesetz ist im Parla-ment gescheitert, und eine Regelung der Sonntagsarbeit imArbeitsgesetz ist ebenfalls gescheitert.Somit gilt vorläufig – wenn ich dies richtig sehe, Herr Bundes-rat – die Verordnung von 1994; dort ist in Artikel 1 Absatz 3klar geregelt, dass für den arbeitsfreien Bundesfeiertag volleLohnzahlungspflicht durch den Arbeitgeber besteht. DieseVerordnung ist derzeit immer noch in Kraft.Wir befinden uns im Bereich der Nachführung der Bundes-verfassung. Auch im Abstimmungskampf betreffend Arti-kel 116bis der Bundesverfassung ist allen klar gewesen,dass dieser Bundesfeiertag bezahlt werden muss und dasseine Lohnzahlungspflicht besteht. Weil vorläufig keine Rege-lung besteht, hat der Nationalrat mit deutlichen Mehrheitenauch dies in der Verfassung stipuliert. Eine explizite Rege-lung auf Verfassungsstufe hätte den Vorteil, dass dieseFrage rasch und direkt geklärt werden könnte.Ich muss Ihnen zugestehen, dass zwei Punkte etwas stos-send sind:1. Man kann sich wirklich fragen, ob die Regelung betreffenddie Lohnzahlung an einem Feiertag in die Verfassung gehört.2. Es ist bis anhin nicht gelungen – weder im Nationalrat nochim Ständerat –, eine klare Formulierung zu finden, die denTatbestand sauber regelt. Auch in der Kommission hat mansich eigentlich nicht an der Sache gestossen, sondern an derFormulierung.Ich möchte Ihnen beantragen, das «Schauspiel» zu beendenund mit der Frage der Lohnzahlung am 1. August nicht in dieEinigungskonferenz zu gehen, sondern sich jetzt dem Natio-nalrat bzw. der Minderheit Gentil anzuschliessen und dieseDifferenz zu bereinigen.
Koller Arnold, Bundesrat: Ich möchte Sie auch dringend bit-ten, dem Nationalrat zuzustimmen.Das Prinzip der Lohnzahlungspflicht für den 1. August solltenicht mehr umstritten sein. Leider hat aber der Gesetzgeberwirklich alle Möglichkeiten verpasst, das Prinzip der Lohn-zahlung am 1. August in den geeigneten Gesetzen aufzuneh-men; ich denke an das Bundesfeiertagsgesetz und an die er-ste und zweite Arbeitsgesetzrevision. Man hat jede möglicheChance, das auf einer angemessenen Hierarchiestufe zu re-geln, vorbeigehen lassen.Ich bin überzeugt: Das ist jetzt eine Frage der Glaubwürdig-keit, auf jeden Fall für den Bundesrat. Der damalige Innenmi-nister, Herr Cotti, hat seinerzeit, vor der Abstimmung, klar ge-sagt, dass der 1. August ein bezahlter Feiertag sein soll. Jetztmüssen wir diese Verpflichtung tatsächlich erfüllen.
1. Dezember 1998 S 219 Bundesverfassung. Reform
Amtliches Bulletin der Bundesversammlung / Separatdruck
Zuhanden der Materialien soll auch klar festgehalten sein,dass keinerlei Zahlungspflicht für den Staat besteht. DieZahlungspflicht, und zwar die volle Lohnzahlungspflicht, be-trifft natürlich den Arbeitgeber. Er ist der Adressat dieserVerpflichtung. Wenn wir das in den Materialien ausdrücklichso festhalten, haben wir dieses – ich möchte fast sagen: lei-dige – Problem betreffend den 1. August endlich vom Tisch.
Abstimmung – VoteFür den Antrag der Mehrheit 22 StimmenFür den Antrag der Minderheit 15 Stimmen
Art. 118 Abs. 1bisAntrag der KommissionZustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Art. 118 al. 1bisProposition de la commissionAdhérer à la décision du Conseil national
Aeby Pierre (S, FR), rapporteur: Dans cette disposition, leConseil national avait introduit le respect par la loi des princi-pes de l’universalité, de l’égalité de traitement et de la capa-cité économique. Dans un premier temps, notre Conseil avaitrefusé de se rallier à cette décision, considérant que ces prin-cipes étaient tous trois tout à fait valables pour les impôts di-rects, mais qu’ils pouvaient nous occasionner certaines diffi-cultés en matière d’imposition indirecte: par exemple, com-ment respecter la capacité économique concernant la TVA,etc.?Lors d’un nouvel examen de cette disposition, nous avonstrouvé la formulation suivante: «Dans la mesure où la naturede l’impôt le permet, les principes de l’universalité, de l’éga-lité de traitement et de la capacité économique doivent, enparticulier, être respectés.»La commission considère que c’est là une formulation sus-ceptible de mettre les deux Conseils d’accord. Elle vous pro-pose donc de l’adopter afin que, très vraisemblablement, ellepuisse à son tour être adoptée par le Conseil national. Ainsi,une divergence serait éliminée.
Angenommen – Adopté
Ziff. II Abs. 2 Ziff. 2aAntrag der KommissionZustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Ch. II al. 2 ch. 2aProposition de la commissionAdhérer à la décision du Conseil national
Aeby Pierre (S, FR), rapporteur: Nous n’avons pas le choixde faire autre chose que d’adhérer à la décision du Conseilnational, puisque nous nous sommes ralliés au maintien decette disposition, article 45bis alinéa 1er, dans le texte de laConstitution fédérale. Notre Conseil avait, au départ, biffé cetalinéa qui s’était retrouvé dans les dispositions transitoirespour permettre à la Confédération, pendant un délai qui de-vait être, sauf erreur, de dix ans – ou qui n’a pas été fixé –,d’abandonner petit à petit ce renforcement des liens ainsique la politique qu’elle peut avoir à cet égard.Or, cet alinéa est maintenu et figure encore et toujours dansla Constitution fédérale. Nous n’avons donc plus à en traiterdans les dispositions transitoires. C’est quelque chose detout à fait logique du point de vue de la systématique que denous rallier à cet endroit au fait de biffer l’alinéa 2a de l’article2 au chiffre II des dispositions transitoires.
Angenommen – Adopté
Die Beratung dieses Geschäftes wird unterbrochenLe débat sur cet objet est interrompu
Constitution fédérale. Réforme 220 E 8 décembre 1998
Bulletin officiel de l’Assemblée fédérale / Tiré à part
Sechste Sitzung – Sixième séance
Dienstag, 8. Dezember 1998Mardi 8 décembre 1998
08.00 h
Vorsitz – Présidence: Rhinow René (R, BL)
__________________________________________________________
96.091
Bundesverfassung.ReformConstitution fédérale.Réforme
Fortsetzung – Suite
__________________________________________________________
A2. Bundesbeschluss über eine neue Bundesverfas-sung (Art. 127–184)A2. Arrêté fédéral relatif à une mise à jour de la Consti-tution fédérale (art. 127–184)
Art. 154 Abs. 2Antrag der KommissionFesthalten
Art. 154 al. 2Proposition de la commissionMaintenir
Frick Bruno (C, SZ), Berichterstatter: In der Tat stehen wir inder letzten Runde der Differenzbereinigung. Die Vorlage A2behandeln wir als Zweitrat, und was jetzt als Differenz beste-henbleibt, gelangt zur Bereinigung in die Einigungskonferenzvom nächsten Freitag morgen.In Artikel 154 Absatz 2 finden wir die erste von drei noch zubehandelnden Differenzen. Bei Absatz 2 geht es nur um denNachsatz. Es ist unbestritten, dass Rechtsetzungsbefug-nisse auf den Bundesrat, die Bundesversammlung oder dasBundesgericht übertragen werden können, wenn sie im Ge-setz vorgesehen sind. Es geht hier um die Rechtsetzungsbe-fugnisse, nicht um die blossen Vollzugsverordnungen.Gemäss Absatz 1bis müssen alle wichtigen rechtsetzendenBestimmungen im Gesetz enthalten sein. Das Gesetz stecktalso das Feld ab. Nach Auffassung unseres Rates in den er-sten beiden Lesungen soll das genügen. Innerhalb der Eck-punkte des Gesetzes können der Bundesrat oder das Bun-desgericht weiter Recht setzen, sofern sie die Kompetenzdazu erhalten.Der Nationalrat seinerseits sagt aber: Nein, das genügt nicht,es braucht etwas mehr – das meint dieser Nachsatz. Der Na-tionalrat verlangt: Dort, wo das Gesetz die Rechtsetzungs-kompetenz an Bundesversammlung, Bundesrat oder Bun-desgericht weitergibt, wo also diese Organe ergänzendeRechtsnormen erlassen können, muss das Gesetz nicht nurdie Kompetenz enthalten, sondern gleichzeitig die Grund-sätze der Verordnung regeln. Das ist wesentlich mehr.Ich möchte das anhand eines Beispieles erklären. Wir habenvorletzte Session das Archivierungsgesetz verabschiedet.Dieses schreibt vor, dass das Bundesgericht die Archivie-rung der eigenen Akten regelt; damit hat es sich.Wenn wir nun dem Nationalrat folgen wollten, müsste dasBundesgesetz zusätzlich die Grundzüge festlegen, wie dasBundesgericht seine Archivierung in den Grundzügen regeln
soll. Es müsste also nicht nur die Kompetenz dazu geben,sondern die wesentlichen Punkte umschreiben. Das scheintuns nicht nötig, und zwar aus zwei Gründen:1. Wir glauben, dass die allgemeinen Eckwerte im Gesetz,die nach Artikel 154 Absatz 1bis ohnehin verlangt werden,genügen. Es braucht keine zusätzlichen Eckpunkte im Ge-setz, diese gehören in die Verordnung.2. Im Einzelfall würde eine solche Bestimmung mehr Unklar-heiten schaffen und Fragen aufwerfen, als sie regeln könnte.Aus diesen Gründen beantragt die Kommission mit 8 zu3 Stimmen Festhalten an unserem Beschluss. Wir möchtenüber diesen nicht unwesentlichen Punkt in der Einigungskon-ferenz mit den Nationalräten diskutieren und dort eine Lö-sung finden. Wir glauben, dass unsere Lösung sachlich dierichtige ist.
Koller Arnold, Bundesrat: Ich bin auch zur Überzeugung ge-kommen, dass vom ganzen neuen Konzept her Ihre Lösungdie bessere ist, und unterstütze daher den Antrag Ihrer Kom-mission.
Angenommen – Adopté
Art. 159 Abs. 2Antrag der KommissionDen vom Gesetz vorgesehenen besonderen Delegationenvon Aufsichtskommissionen können keine Geheimhaltungs-pflichten entgegengehalten werden.
Art. 159 al. 2Proposition de la commissionL’obligation de maintenir le secret ne constitue pas un motifqui peut être opposé aux délégations particulières des com-missions de contrôle prévues par la loi.
Frick Bruno (C, SZ), Berichterstatter: Es geht hier um einewesentliche Bestimmung: um die Reibungsflächen zwischendem Parlament einerseits und dem Bundesrat anderseits,nämlich um die Frage, wie weit die Einsichts- und Auskunfts-rechte der Aufsichtskommissionen – das sind heute die Ge-schäftsprüfungs- und die Finanzkommissionen – gegenüberdem Bundesrat gehen.Der Nationalrat verlangt folgendes: Er stipuliert ein umfas-sendes Einsichtsrecht für alle Aufsichtskommissionen oderderen Delegationen, also auch für die Sektionen dieser Kom-missionen.Der Ständerat regelte die ganze Materie der Einsicht undAuskunft in Artikel 144, der heute nicht mehr strittig ist. Nachunserem Beschluss soll das Gesetz im Einzelfall die Geheim-haltungspflichten regeln; es soll also festlegen, welche Kom-mission welche Einsichts- und Auskunftsrechte hat. Auf StufeBundesverfassung braucht es nach unserer Auffassungkeine absolute Normierung zugunsten des Parlamentes, undes braucht auch keine Beweislastregel. Das, was unser Ratverabschiedet hat, entspricht dem heutigen Recht.Der Beschluss des Nationalrates ist demgegenüber eine Er-weiterung. Der Nationalrat sagt in Absatz 2 klar: «Den Auf-sichtskommissionen oder deren Delegationen können Ge-heimhaltungspflichten nicht entgegengehalten werden.» Dasist eine absolute Regelung auf Verfassungsstufe, der sich dieGesetzgebung nicht verschliessen kann.Unsere Kommission beantragt eine neue Fassung. Materiellsind wir klar gegen den Beschluss des Nationalrates. Wirwollen, dass in der Regel durch das Gesetz austariert wird,nicht dass qua Bundesverfassung absolute Einsichtsrechtebestimmt werden. Mit unserem Antrag, wonach lediglich be-sonderen Delegationen der Aufsichtskommissionen keineGeheimhaltungspflichten entgegengehalten werden können,nehmen wir als Kompromiss das heutige Recht auf: Bereitsheute müssen sich die Geschäftsprüfungsdelegation und dieFinanzdelegation in der Regel keine Geheimhaltungspflich-ten entgegenhalten lassen. Das soll im Sinne einer Kompro-misslösung auf Stufe Verfassung geregelt werden. Aber dastotale Einsichtsrecht soll weiterhin nicht für alle Aufsichts-kommissionen oder sogar für ihre Sektionen gelten.
8. Dezember 1998 S 221 Bundesverfassung. Reform
Amtliches Bulletin der Bundesversammlung / Separatdruck
Die Regelung nach Absatz 2 gilt nicht für die PUK. Für diePUK haben wir im Geschäftsverkehrsgesetz eingehende Re-gelungen getroffen. Diese fallen unter die Grundnorm von Ar-tikel 144 der neuen Bundesverfassung. Diese Bestimmungist, wie erwähnt, nicht mehr umstritten.Unsere Kommission bittet Sie einstimmig, unserem Antragzu folgen.
Bieri Peter (C, ZG): Als Präsident der Geschäftsprüfungs-kommission habe ich im Verlauf der Diskussion über die Ar-tikel 159 und 144 wiederholt zur Thematik der Aktenein-sichtsrechte gesprochen. Ich will nicht noch einmal wiederho-len, welche zentrale Bedeutung ein gut ausgebautes Akten-einsichtsrecht für eine erfolgreiche Arbeit der Aufsichtskom-missionen hat.Artikel 159 Absatz 2 soll gewährleisten, dass die Aufsichts-kommissionen die ihnen übertragene Oberaufsicht auch tat-sächlich ausüben können. Die Oberaufsicht muss sich im Be-darfsfall durchsetzen, auch wenn Geheimhaltungsinteressengeltend gemacht werden. Der Kontrollierende, nicht der Kon-trollierte, soll letztlich bestimmen können, welche Informatio-nen er benötigt, um die in der Verfassung verankerte Auf-gabe der Oberaufsicht sachgerecht wahrzunehmen. Im Ver-lauf der Beratung dieses Absatzes wurde im Ständerat dieBefürchtung laut, dass je nach Anzahl und Zusammenset-zung dieser Aufsichtskommissionen ein zu grosser Teil desParlamentes in vertrauliche bzw. geheime Informationen Ein-sicht nehmen könnte. Dieser Befürchtung wird im neuen An-trag unserer Verfassungskommission dadurch begegnet,dass sich nur die vom Gesetz vorgesehenen besonderen De-legationen von Aufsichtskommissionen gegen die geltendgemachte Geheimhaltung durchsetzen können.Bei der Fassung unserer Verfassungskommission ist der Be-griff der Delegationen interpretationsbedürftig, wenngleichjetzt Herr Frick ganz klar sagte, mit dem Begriff der Delega-tionen seien die heute bestehenden Delegationen gemeint.Wenn wir die bestehende Delegation der Geschäftsprüfungs-kommissionen meinen, müssen wir zur Kenntnis nehmen,dass sich diese Delegation primär mit den Fragen desStaatsschutzes beschäftigt. Sollte allein diese Delegation ge-meint sein, wie dies jetzt ausgeführt wurde, entspräche diesganz einfach der heutigen Situation; das hat Herr Frick so er-klärt. Dann kann man sich natürlich fragen, ob es überhaupteinen Grund gibt, hier etwas zusätzlich in die Verfassung zuschreiben.In diesem Sinne könnte man sich auch fragen, ob man kon-sequenterweise diesen Absatz 2 nicht gerade gänzlich weg-lassen könnte. Oder wenn man weiter geht, kann man sichfragen, ob «Delegationen» weitere Unterkommissionen sind,die unter Umständen bei Bedarf vertiefte Akteneinsichts-rechte in Anspruch nehmen dürfen. Dem könnte ich aus derSicht der GPK zustimmen, arbeiten wir doch in der GPK-SRprimär in Untergruppen mit drei bis vier Personen – in derGPK-NR sind es je fünf bis sechs Personen –, die bei Inspek-tionen vertiefte Einsicht in bestimmte Bereiche benötigen, umihrem Auftrag gerecht zu werden.Ich stimme mit der Meinung unserer Verfassungskommis-sion überein, dass in der nationalrätlichen Fassung mit demBegriff «Aufsichtskommissionen oder deren Delegationen»die vollzählige Aufsichtskommission gemeint ist und der Be-griff «oder» auch «und» bedeutet. Wir haben in früheren Be-ratungen in diesem Rat diese breite Einsichtnahme abge-lehnt.Ich bin der Meinung, dass die Lösung letztlich auf der Ge-setzgebungsstufe getroffen werden muss, sprich: bei der Re-vision des Geschäftsverkehrsgesetzes. Es kann ja nicht Sinnmachen, dass wir uns auf der Verfassungsstufe schon fastauf der Reglements- oder Verordnungsstufe bewegen. DerAntrag der Verfassungskommission weist denn auch auf dasGesetz hin, weil die Sache auf Verfassungsstufe offensicht-lich nicht abschliessend umschrieben werden kann.In der heutigen Praxis, die sich nicht schlecht bewährt hat,die aber gesetzlich besser verankert werden muss, werdendie Kontrollarbeiten primär von Sektionen und kleinen Ar-beitsgruppen wahrgenommen. Sie beschaffen die notwendi-
gen Unterlagen, sie sehen Akten ein, und sie führen Befra-gungen durch. Nach bisheriger Erfahrung könnte demnachdie Oberaufsicht sichergestellt werden, wenn bei Bedarfauch Ausschüsse oder gegebenenfalls Sektionen der GPKdie ihnen zustehenden Informationsrechte im Einzelfalldurchsetzen könnten. Ein Durchsetzungsrecht der Gesamt-kommission auf Einsichtnahme bildet dafür nicht eine not-wendige Voraussetzung.Meine Schlussfolgerung: Versteht die Kommission unter demBegriff «Delegationen» mehr, als wir unter dem Begriff derheutigen Geschäftsprüfungsdelegation verstehen – nämlicheine Unterkommission im Sinne der heutigen Sektionen –,dann kann ich mich mit ihrem Antrag einverstanden erklären.Nun, Herr Frick hat hier doch eher Einschränkungen darge-legt. Versteht die Kommission darunter also nur die heutigeGeschäftsprüfungsdelegation, so sei zumindest die Frage er-laubt, ob der heutige Zustand nicht genügend wäre und Ab-satz 2 demzufolge konsequenterweise gestrichen werdenkönnte.Zur Sicht der Geschäftsprüfungskommission: Wir sind mitdiesem Vorgehen auch nicht glücklich, weil wir zu Beginn derDiskussion eine andere Meinung vertreten haben, von derwir eigentlich nicht abgerückt sind. Hingegen müssen wir zu-geben, dass wir diesbezüglich nie ganz die richtige Formulie-rung gefunden haben.In diesem Sinne möchte ich der Einigungskonferenz zu be-denken geben, dass hier wirklich noch das Ei des Kolumbusgefunden werden muss, damit wir eine in sich konsistente Lö-sung haben.
Frick Bruno (C, SZ), Berichterstatter: Ich möchte namens derKommission die Fragen beantworten, die Herr Bieri gestellthat.Auf die erste Frage, ob es diesen Absatz 2 überhauptbraucht, müssen wir antworten: Inhaltlich braucht es ihnnicht; Artikel 144 würde genügen. Nachdem aber der Natio-nalrat diesem Anliegen – den Aufsichtskommissionen – einebesondere Bedeutung zumisst, wollen wir im Sinne einesEntgegenkommens auch bei Artikel 159 («Oberaufsicht»)klarstellen, wie es sich mit den Aufsichtskommissionen ver-hält.Inhaltlich geht es uns darum, dass nicht jede Aufsichtskom-mission und schon gar nicht deren Subkommissionen unein-geschränkt von sich aus Auskunft verlangen und umfas-sende Einsicht nehmen können. Es soll eine Hürde beste-hen. Heute besteht die Hürde insofern, als einerseits die Ge-schäftsprüfungsdelegation und andererseits die Finanzdele-gation eingesetzt sind. Selbstverständlich ist es künftig demGesetz überlassen, weitere Delegationen zu schaffen, wel-che die umfassende Einsicht wahrnehmen können. Esbraucht aber im voraus eine besondere gesetzliche Rege-lung und nicht eine allgemeine Kompetenz, wie sie der Natio-nalrat festgelegt hat. Das ist die Absicht und der tiefere Sinndieser Bestimmung: Dort, wo es in die Tiefen der Geheimhal-tung und der schützenswerten Interessen der Verwaltungund des Bundesrates geht, soll eine Hürde eingebaut sein.Aber wie sie in Zukunft ausgestaltet wird, entscheiden wirnicht jetzt, sondern da lassen wir über das Gesetz alle Mög-lichkeiten offen. Heute bestehen als ordentliche Delegatio-nen – das ist zuzugeben, Herr Bieri – lediglich die Geschäfts-prüfungsdelegation und die Finanzdelegation. Es ist offen, imRahmen einer neuen Regelung auch andere Delegationenvorzusehen, welche das Einsichtsrecht wahrnehmen kön-nen – auch für Inspektionen.
Koller Arnold, Bundesrat: Ihr Rat hat anlässlich der letztenLesung zu Recht entschieden, dass für die verfassungsrecht-liche Stellung der Kommissionen Artikel 144 der neuen Ver-fassung genügt, denn dieser hält ganz klar fest, dass denKommissionen die zur Erfüllung ihrer Aufgaben nötigen Aus-kunfts- und Einsichtsrechte sowie Untersuchungsbefugnissezustehen und dass der Umfang dieser Rechte im Geschäfts-verkehrsgesetz geregelt wird. Das Geschäftsverkehrsgesetzkennt denn auch in den Artikeln 47ff. eine sehr austarierteOrdnung, beginnend bei den Legislativkommissionen, wei-
Constitution fédérale. Réforme 222 E 8 décembre 1998
Bulletin officiel de l’Assemblée fédérale / Tiré à part
tergehend bei den Aufsichtskommissionen – den Geschäfts-prüfungs- und den Finanzkommissionen – und noch einmalweitergehend bei den Delegationen der Geschäftsprüfungs-und der Finanzkommissionen. Die umfassendsten Kompe-tenzen sind dann in den Artikeln 55ff. für die parlamentari-schen Untersuchungskommissionen enthalten. Diese ge-setzliche Ordnung macht durchaus Sinn und hat sich be-währt. Wir hätten uns daher wie der Ständerat mit Artikel 144der neuen Verfassung zufriedengegeben.Nun beantragt die Kommission – im Bemühen, hier vor derEinigungskonferenz dem Nationalrat doch etwas entgegen-zukommen – einen neu formulierten Absatz 2 von Artikel 159:«Den vom Gesetz vorgesehenen besonderen Delegationenvon Aufsichtskommissionen können keine Geheimhaltungs-pflichten entgegengehalten werden.»Wenn ich das am geltenden Gesetzestext messe – vor alleman Artikel 47quinquies des Geschäftsverkehrsgesetzes, wodie Kompetenzen der Geschäftsprüfungsdelegation geregeltsind –, dann trifft es zwar zu, dass Absatz 4 von Arti-kel 47quinquies sehr umfassende Rechte einräumt: «Die Ge-schäftsprüfungsdelegation hat das Recht, nach Anhören desBundesrates, ungeachtet des Amtsgeheimnisses oder desmilitärischen Geheimnisses, von Behörden des Bundes, derKantone und von Privatpersonen die Herausgabe von Aktenzu verlangen sowie Beamte des Bundes und Privatpersonenals Auskunftspersonen oder als Zeugen einzuvernehmen.»Insofern besteht tatsächlich Deckungsgleichheit. Der Bun-desrat möchte dagegen zuhanden der Materialien ausdrück-lich auch auf Absatz 5 von Artikel 47quinquies hingewiesenhaben, welcher explizit festhält: «Die Befugnisse der Ge-schäftsprüfungsdelegation erstrecken sich nicht auf Aktenhängiger Geschäfte, die der unmittelbaren Meinungsbildungdes Bundesrates dienen.» Das ist der wichtige Vorbehalt zu-gunsten des Mitberichtsverfahrens; daran möchte und mussder Bundesrat festhalten. Das muss ich hier ganz klar zu denAkten und zu den Materialien geben. Denn wenn Sie diesenVorbehalt des Mitberichtsverfahrens nicht anerkennen, führtdas dazu, dass sowohl die Effizienz wie die Transparenz derMeinungsbildung im Bundesrat schwer leiden.Was wäre die Folge, wenn man dieses Mitberichtsverfahrennicht mehr schützen würde? Dann würden wir nicht mehrfrisch von der Leber weg Mitberichte zu Anträgen der ande-ren Departemente verfassen und damit auch für die Nach-welt den ganzen Meinungsbildungsprozess offenlegen, son-dern wir würden einander telefonieren, wir würden das allesausserhalb des schriftlichen Mitberichtsverfahrens machen.Das wäre aber ein grosser Nachteil für die Effizienz der bun-desrätlichen Beratungen, und es wäre ein grosser Nachteilfür die Transparenz wichtiger Entscheidungen, die auch derspäteren Geschichtsschreibung dient.Deshalb möchte ich hier zuhanden der Materialien ausdrück-lich den Vorbehalt von Artikel 47quinquies Absatz 5 des Ge-schäftsverkehrsgesetzes festgehalten haben, für den Fall,dass Sie dem Vermittlungsantrag Ihrer Kommission – der ansich, wie gesagt, nicht nötig wäre – zustimmen.
Angenommen – Adopté
Art. 159bAntrag der KommissionZustimmung zum Beschluss des NationalratesProposition de la commissionAdhérer à la décision du Conseil national
Frick Bruno (C, SZ), Berichterstatter: Bevor ich zur letztenDifferenz komme, darf ich zuhanden des Bundesrates fest-halten, dass es auch der Meinung der Kommission ent-spricht, dass die laufenden Mitberichte nicht offenzulegensind.Zu Artikel 159 Absatz 3 bzw. Artikel 159b: Es geht um den«Auftrag» der Bundesversammlung an den Bundesrat, überden wir in der Kommission und im Rat intensiv diskutiert ha-ben. Der Nationalrat schlägt eine neue Fassung vor. Diesestellt klar, was bisher die Meinung der Mehrheit des Natio-
nalrates war, was aber wenig deutlich gesagt wurde. DerNationalrat hat dieser Fassung – mit 96 zu 30 Stimmen –überwältigend deutlich zugestimmt, unsere Verfassungs-kommission schliesst sich nach gründlicher Diskussion ein-hellig der nationalrätlichen Version an. Zwei Dinge werdenklargestellt:1. So, wie er jetzt in der Verfassung steht, ist der «Auftrag»der Oberbegriff für die Instrumente bzw. die Vorstösse vonNational- und Ständerat. Einzelheiten sind im Geschäftsver-kehrsgesetz zu regeln.2. Nach wie vor kann das Parlament auf den Zuständigkeits-bereich des Bundesrates einwirken; es kann nicht über denBundesrat bestimmen, aber auf ihn einwirken. Wir tun dasbereits heute mit der Empfehlung; der Nationalrat kennt indiesem Bereich zusätzlich das Instrument der Motion. Inso-fern ist Artikel 159b nichts anderes als heutiges Recht. Erlässt aber die künftige Entwicklung offen, beispielsweise fürden Fall, dass man das neue Instrument der Resolution derRäte einführen wollte. Es geht um den Sammelbegriff, um dieallgemeine Bestimmung über die Vorstösse der Bundesver-sammlung. Klar gesagt wird, dass die Räte dem BundesratAufträge erteilen und auf seinen angestammten Wirkungsbe-reich einwirken, ihn aber nicht determinieren können.
Koller Arnold, Bundesrat: Ich will gerne anerkennen, dassman sich in der Frage der Aufträge um einen Kompromissbemüht hat, denn der Bundesrat hat den Beschluss des Na-tionalrates, der den Auftrag in einem zweifachen Sinn einfüh-ren wollte – einerseits als bindende Weisung im Kompetenz-bereich des Parlamentes und andererseits als Richtlinie imKompetenzbereich des Bundesrates –, immer konsequentabgelehnt.Mit dieser neuen Formulierung bemühen Sie sich zweifellosum einen Kompromiss. Ich möchte Ihnen aber nicht verheh-len, dass der Bundesrat damit immer noch wenig glücklichist. Sie fordern von uns eigentlich nach wie vor ein doppeltes«sacrificium intellectus»:Erstens sind wir nämlich der Meinung, dass dieses wichtigeund delikate Verhältnis zwischen Legislative und Exekutivegrundsätzlich in der Verfassung gelöst werden sollte. Des-halb haben wir Ihnen im Rahmen der «Staatsleitungsre-form», die jetzt in der Vernehmlassung ist, auch ein entspre-chendes neues Institut vorgeschlagen. Das ist der erstePunkt, den wir eigentlich gerne anders geregelt hätten.Das zweite «sacrificium intellectus» besteht einfach darin,dass der Begriff «Auftrag» jetzt in einem neuen Sinn verwen-det wird: Denn hier erscheint er jetzt als Oberbegriff für alleparlamentarischen Instrumente, die dann nachher der Kon-kretisierung durch die Gesetzgebung bedürfen.Aber ich sehe natürlich ein, dass in diesem Stadium des Ver-fahrens kaum mehr eine adäquate Lösung gefunden werdenkann. Wir werden im Rahmen der «Staatsleitungsreform»Gelegenheit haben, auf diese sehr heikle Materie zurückzu-kommen.
Angenommen – Adopté
Varianten – Variantes
Art. 33Antrag der KommissionMehrheitAblehnung des Antrages der Minderheit
Minderheit(Gentil, Aeby)Abs. 1Bund und Kantone treffen Massnahmen, damit:a. bis f.: Gemäss Haupttextg. jede Person gegen die wirtschaftlichen Folgen von Alter,Invalidität, Krankheit, Unfall, Arbeitslosigkeit, Mutterschaft,Verwaisung oder Verwitwung gesichert ist. (= Abs. 1bisHaupttext)
8. Dezember 1998 S 223 Bundesverfassung. Reform
Amtliches Bulletin der Bundesversammlung / Separatdruck
Abs. 2Wer staatliche Aufgaben wahrnimmt, ist zur Verwirklichungder Sozialziele verpflichtet.
Art. 33Proposition de la commissionMajoritéRejeter la proposition de la minorité
Minorité(Gentil, Aeby)Al. 1La Confédération et les cantons prennent des mesures afinque:a. à f.: Selon texte principalg. toute personne soit assurée contre les conséquences éco-nomiques de l’âge, de l’invalidité, de la maladie, de l’accident,du chômage, de la maternité, de la condition d’orphelin ou duveuvage. (= al. 1bis du texte principal)Al. 2Quiconque assume des tâches dans le cadre de l’Etat est te-nue d’oeuvre en faveur de la réalisation des objectifs sociaux.
Gentil Pierre-Alain (S, JU): Vous avez reçu une documenta-tion complète qui rappelle le principe de ces variantes, raisonqui fait que je ne vais pas m’étendre trop longtemps sur cethistorique. J’aimerais simplement souligner qu’à la fin del’année dernière, en décembre 1997, nous avons modifié laloi sur les rapports entre les Conseils pour introduire la pos-sibilité théorique de présenter des variantes. Le 13 novembre1998, les Bureaux des deux Conseils ont formalisé les rè-gles: ils ont notamment indiqué qu’il était possible de présen-ter une variante par article, et ils ont précisé également quela présentation d’une variante devant le corps électoral re-quérait l’aval des deux Conseils.La minorité de la commission vous propose en conséquence,en s’appuyant sur cette réglementation, deux variantes. Cesvariantes concernent l’article 33, qui a trait aux buts sociauxde l’Etat, et l’article 85 qui traite du développement durable etde la répartition des biens et des revenus. Dans la conceptionque nous avons arrêtée à la fin de l’année dernière, le rôledes variantes est de présenter aux citoyens une alternativedans des domaines où le consensus a été difficile à trouverau niveau des Chambres fédérales, ou dans des domaines àpropos desquels on peut constater que des orientations poli-tiques très fortement divergentes sont présentes.Nous considérons que, dans les deux articles que je viensd’évoquer – l’article 33 et l’article 85 –, ces conditions sontréunies. Il y a eu, soit ici dans notre Conseil, soit au Conseilnational, des débats extrêmement fournis sur la portée et lerôle de l’Etat dans le domaine social, et notamment sur leprincipe de la responsabilité individuelle dans ce domaine-là.Le Parlement est divisé, et les solutions que nous avons re-tenues à l’article 33 sont celles de la majorité, et non des so-lutions de consensus. On peut en dire autant pour ce qui pré-vaut en matière de développement durable, à propos de l’im-portance qu’il convient de donner à cette notion dans la nou-velle constitution.Enfin, le rôle redistributeur de l’Etat en matière d’avoirs et derevenus constitue lui aussi un domaine dans lequel les avissont extrêmement partagés et les opinions parfois très tran-chées. La proposition de minorité, en présentant des variantes, neconstitue donc pas une demande de rouvrir la discussion surles articles 33 et 85 puisque à ce sujet les décisions ont étéprises et les divergences ont été éliminées entre les deuxChambres; mais nous requérons l’accord du Conseil desEtats sur la possibilité de présenter au corps électorald’autres formulations aux articles 33 et 85, comme variantes.La discussion précédant la votation populaire sur la nouvelleconstitution pourra ainsi porter non seulement sur le projetqui aura obtenu l’aval de la majorité des membres des Cham-bres, mais également sur des variantes, c’est-à-dire sur despropositions alternatives qui portent sur des points à propos
desquels la minorité du Parlement n’a pas réussi à convain-cre la majorité.Nous avons donc deux propositions de minorité. Il y en avaitune troisième, présentée par M. Aeby, qui portait sur la com-position du Conseil des Etats. M. Aeby a retiré cette proposi-tion lors de la dernière séance de la Commission de la révi-sion constitutionnelle, ce qui fait qu’il en reste deux.En résumé, vous l’aurez compris, il ne s’agit pas de rouvrir ladiscussion sur des sujets à propos desquels nous avons lon-guement débattu, mais d’obtenir de la part de notre Conseil,et ensuite du Conseil national qui se prononcera sur cette af-faire demain matin, la possibilité de présenter au corps élec-toral des variantes sur deux points précis en même tempsque le projet «officiel», si vous me passez l’expression.Je vous remercie de soutenir la proposition de minorité quipermettra d’élargir le débat précédant la votation sur le projetde constitution mise à jour.
Frick Bruno (C, SZ), Berichterstatter: Die Verfassungskom-mission hat beide Varianten mit allen gegen zwei Stimmenverworfen, und ich möchte das in zwei Teilen begründen, zu-erst mit verfahrensrechtlichen und dann mit den materiellenArgumenten.1. Es geht hier um Varianten. Wir haben bei der Festlegungder Varianten zwei wesentliche Punkte herausgeschält: DieVariante darf erstens die freie Willensbildung der Bürgerin-nen und Bürger nicht beeinflussen und zweitens nicht zen-trale Punkte der Verfassung beschneiden.Ziffer 23 des Berichtes der nationalrätlichen Kommission zurentsprechenden parlamentarischen Initiative hielt fest – ichzitiere sinngemäss –, dass die Möglichkeit von Variantendann ausgeschlossen werden muss, wenn anzunehmen ist,dass eine erhebliche Anzahl von Bürgerinnen oder Bürgernihre Zustimmung zur Verfassung oder ihre Ablehnung derVerfassung vom Inhalt dieser Variante abhängig macht,wenn also anzunehmen ist, dass aufgrund einer Varianteeine erhebliche Zahl von Bürgern, die sonst der Totalrevisionzustimmen würde, aufgrund dieser Einzelbestimmung dasGanze ablehnen würde. Es darf sich also, mit anderen Wor-ten, nicht um eine zentrale Bestimmung handeln, welche dieWillensbildung der Bürgerinnen und Bürger wesentlich be-einflusst. Die beiden Minderheitsanträge aber betreffen – Siewerden es aus dem zweiten Teil meiner Begründung sehen –doch fundamentale Punkte unseres Staatsverständnisses.2. Zur materiellen Begründung: Der erste Punkt betrifft dieVariante zu Artikel 33. Entscheidend ist Absatz 2: «Wer staat-liche Aufgaben wahrnimmt, ist zur Verwirklichung der Sozial-ziele verpflichtet.» Da wird im Bereich der Sozialziele etwasWesentliches eingeschoben. Bisher gingen wir vom Grund-satz der Subsidiarität aus: Der Staat soll eingreifen, wo es pri-vate Organisationen oder der Betroffene selber nicht tun kön-nen. Nun wird diese Subsidiarität eliminiert, und das ist einwesentlich neues Konzept: Der Staat direkt soll die Sozial-ziele unter Umgehung der Subsidiarität verwirklichen. So istdas zu verstehen, so wurde der Antrag in der nationalrätli-chen Kommission begründet. Das ist ein wesentlicher Ein-bruch in die Sozialziele, in unser Staatsbewusstsein.Der zweite Punkt betrifft Artikel 85 Absatz 2a. Hier wird mitder Variante ebenfalls eine entscheidende inhaltliche Neue-rung angestrebt: Sie normiert, dass Bund und Kantone u. a.eine gerechte Einkommens- und Vermögensverteilung an-streben. Das ist ein direkter Auftrag an Bund und Kantone,stärker für eine Umverteilung des Vermögens tätig zu sein,als es bereits heute der Fall ist. Das ist ein wesentlicher Ein-bruch in unser bisheriges Staatsverständnis.Sowohl aus dem verfahrensrechtlichen Grund, der die freieWillensbildung betrifft, als auch aus materiellen Gründenbitte ich Sie im Namen der überwiegenden Mehrheit derKommission, die beiden Varianten abzulehnen.
Koller Arnold, Bundesrat: In Ergänzung zu den Ausführun-gen Ihres Berichterstatters darf ich aus bundesrätlicher Sichtvielleicht doch kurz an die Vorgeschichte dieser Varianten er-innern: Die Möglichkeit von Varianten hatte das Parlament imJahre 1987 selber vorgesehen, indem es dem Bundesrat die-
Constitution fédérale. Réforme 224 E 8 décembre 1998
Bulletin officiel de l’Assemblée fédérale / Tiré à part
sen Nachführungsauftrag gegeben hat, aber dann beifügte,der Bundesrat habe die Freiheit, auch graduelle – also ein-zelne – materielle Reformvorschläge in Form von Variantenzu präsentieren. Der Bundesrat hat das dann in der Ver-nehmlassungsvorlage 1995 auch gemacht. Er hat dort vierVarianten vorgeschlagen, wovon eine erste Gebietsverände-rungen betraf, eine weitere das Öffentlichkeitsprinzip in derVerwaltung, eine dritte die Mitwirkung der Kantone an derAussenpolitik und die vierte das Redaktionsgeheimnis. Wennwir jetzt von diesen vier damals zur Diskussion gestellten Va-rianten des Bundesrates ausgehen, dann können wir heutefolgendes feststellen:Die erste Variante, wonach eine Gebietsveränderung zwi-schen den Kantonen – wie wir das zum letzten Mal im Fallevon Vellerat hatten – nur noch dem fakultativen Referendumunterstehen soll, haben Sie als konsensfähige Neuerung indie neue Bundesverfassung aufgenommen; insofern ist die-ses Anliegen erfüllt.Betreffend die Frage der Einführung des Öffentlichkeitsprin-zips in der Verwaltung hat der Bundesrat Motionen entge-gengenommen und ist zurzeit dabei, das Öffentlichkeitsprin-zip auf dem Gesetzgebungswege einzuführen, weil wir dazukeiner besonderen Verfassungsgrundlage bedürfen.Drittens ist die Mitwirkung der Kantone an der Aussenpolitikjetzt ausdrücklich auch in der neuen Verfassung geregelt.Viertens haben wir aufgrund des berühmten EntscheidesGoodwin des Europäischen Gerichtshofes für Menschen-rechte in Strassburg das Redaktionsgeheimnis in Artikel 14aAbsatz 3 und im neuen Medienstrafrecht realisiert.Sie sehen, die ursprünglichen Varianten des Bundesratessind heute alle erfüllt oder auf dem Wege der Erfüllung. DerBundesrat hat daher in der Botschaft auf Varianten über-haupt verzichtet. Zu Beginn dieses Jahres haben Sie dann –das war verständlich – die Verfahrensmöglichkeit von Varian-ten wieder ausdrücklich vorgesehen. Aber nach Auffassungdes Bundesrates haben Sie weise entschieden, sehr heikleProbleme, die ja für Varianten auch in Frage gekommen wä-ren, «ad separatum» in Teilrevisionen zu verweisen. Das giltsowohl für die Frage der Kantonsklausel bei der Bundesrats-wahl – diesbezüglich haben Sie eine mögliche Variante «adseparatum» in eine Teilrevision verwiesen, über die bereitsim Februar 1999 abgestimmt wird – als auch für die heikleFrage des Bistumsartikels. Auch diesen Artikel haben Sie«ad separatum» verwiesen, und der Bundesrat hat soebenauf Wunsch Ihrer Staatspolitischen Kommission die entspre-chende Vernehmlassung eröffnet.Per saldo scheint das dem Bundesrat das gute Vorgehen zusein. Ich kann mich daher den Anträgen Ihrer Kommissionanschliessen.
Abstimmung – VoteFür den Antrag der Mehrheit 31 StimmenFür den Antrag der Minderheit 5 Stimmen
Art. 85 Abs. 2aAntrag der KommissionMehrheitAblehnung des Antrages der Minderheit
Minderheit(Gentil, Aeby)Sie betreiben eine insbesondere auf Nachhaltigkeit und Voll-beschäftigung ausgerichtete Wirtschaftspolitik und strebeneine gerechte Einkommens- und Vermögensverteilung an.
Art. 85 al. 2aProposition de la commissionMajoritéRejeter la proposition de la minorité
Minorité(Gentil, Aeby)Ils mènent notamment une politique économique axée sur ladurabilité et le plein emploi et oeuvrent en faveur d’une répar-tition équitable des revenus et des avoirs.
Abstimmung – VoteFür den Antrag der Mehrheit 30 StimmenFür den Antrag der Minderheit 5 Stimmen
An den Nationalrat – Au Conseil national
15. Dezember 1998 S 225 Bundesverfassung. Reform
Amtliches Bulletin der Bundesversammlung / Separatdruck
96.091
Bundesverfassung.ReformConstitution fédérale.Réforme
Differenzen – Divergences
Antrag der Einigungskonferenz vom 11. Dezember 1998Proposition de la Conférence de conciliation du 11 décembre 1998
Beschluss des Nationalrates vom 14. Dezember 1998Décision du Conseil national du 14 décembre 1998
___________________________________________________________
Präsident: Letzten Freitag hat die Einigungskonferenz ge-tagt. Sie beantragt beiden Räten mit 25 zu 0 Stimmen, ihreAnträge gutzuheissen. Gemäss Artikel 20 des Geschäftsver-kehrsgesetzes ist die Diskussion gesamthaft zu führen, undder Beschluss ist gesamthaft zu fassen. Der Nationalrat hatgestern den Anträgen der Einigungskonferenz oppositions-los zugestimmt.
A1. Bundesbeschluss über eine neue Bundesverfas-sung (Titel, Art. 1–126, 185)A1. Arrêté fédéral relatif à une mise à jour de la Consti-tution fédérale (titre, art. 1–126, 185)
A2. Bundesbeschluss über eine neue Bundesverfas-sung (Art. 127–184)A2. Arrêté fédéral relatif à une mise à jour de la Consti-tution fédérale (art. 127–184)
Präambel Abs. 2a, 5a; Art. 2 Abs. 2bis; Art. 7 Abs. 3; 12;32a Abs. 1; 57h Abs. 2; 100 Abs. 1; 101 Abs. 3Antrag der EinigungskonferenzZustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Préambule al. 2a, 5a; art. 2 al. 2bis; art. 7 al. 3; 12; 32aal. 1; 57h al. 2; 100 al. 1; 101 al. 3Proposition de la Conférence de conciliationAdhérer à la décision du Conseil national
Art. 9aAntrag der EinigungskonferenzAbs. 1Kinder und Jugendliche haben Anspruch auf besonderenSchutz ihrer Unversehrtheit und auf Förderung ihrer Entwick-lung.Abs. 2Sie üben ihre Rechte im Rahmen ihrer Urteilsfähigkeit aus.
Art. 9aProposition de la Conférence de conciliationAl. 1Les enfants et les adolescents ont droit à la protection parti-culière de leur intégrité et à l’encouragement de leur dévelop-pement.Al. 2Ils exercent eux-mêmes leurs droits dans la mesure où ilssont capables de discernement.
Art. 34a Abs. 2; 85 Abs. 3; 154 Abs. 2; 159 Abs. 2Antrag der EinigungskonferenzZustimmung zum Beschluss des Ständerates
Art. 34a al. 2; 85 al. 3; 154 al. 2; 159 al. 2Proposition de la Conférence de conciliationAdhérer à la décision du Conseil des Etats
Frick Bruno (C, SZ), Berichterstatter: Zu Beginn des Jubilä-umsjahres 1998 – am ersten Tag der Januarsession – habenwir mit der Beratung der neuen Bundesverfassung begon-nen, und am letzten Sessionstag in diesem Jubiläumsjahrgelangt sie in die Schlussabstimmung – gleichsam als Ge-schenk des Parlamentes an Volk und Stände, die darüberabstimmen, ob sie dieses Geschenk annehmen möchten.Das Ergebnis der Einigungskonferenz ist das Produkt einerzweieinhalbstündigen Beratung, die letzten Freitagmorgengeführt wurde. Ich kann das Ergebnis wie folgt charakterisie-ren: Alle Seiten mussten zurückstecken und einiges schluk-ken, sowohl die beiden Räte als auch die politischen Expo-nenten. Am Schluss konnte jedoch jeder die Einigungskonfe-renz erhobenen Hauptes verlassen.In den materiell wichtigen Punkten haben weder ein Rat nocheine bestimmte politische Richtung dominiert. Das Ergebnisberuht auf einer ausgewogenen Symmetrie des Nachge-bens. Das hat dazu geführt, dass die Einigungskonferenzdem Ergebnis mit 25 zu 0 Stimmen ohne Enthaltungen zuge-stimmt hat.In der Tat waren es kaum mehr die politisch bedeutsamstenDifferenzen, welche in die Einigungskonferenz gelangten.Beispielsweise wurden das Streikrecht, der Bistumsartikeloder die Kantonsklausel vorher auf andere Weise bereinigtoder aus der Totalrevision herausgelöst. Damit war die Eini-gungskonferenz politisch bereits wesentlich entschärft.Trotzdem blieben 14 Differenzen, und jede dieser Differen-zen war es vorher den Räten dreimal wert gewesen, an ihremjeweiligen Beschluss festzuhalten. Also können wir davonausgehen, dass kaum jemand gerne auf das verzichtet,woran er dreimal ausdrücklich festgehalten hat.Die Differenzen sind von unterschiedlicher Bedeutung. Ei-nige sind rechtlich von grosser Tragweite, beispielsweise dieGesetzgebungskompetenz in Artikel 154 oder die Geheim-haltungsregelung in Artikel 159. Andere sind politisch von ei-niger Bedeutung, etwa Artikel 9a über den Kinderschutz oderdie Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen in Arti-kel 34a. Eine grössere Zahl aber ist von untergeordneter Be-deutung, teilweise hat sie nur redaktionellen Charakter.Sechs Differenzen waren politisch und rechtlich von einigerBedeutung, wie sich in der Diskussion herausgestellt hat. Essind dies Artikel 2 über die Chancengleichheit, Artikel 7 überdie Gleichstellung, Artikel 9a über den Kinderschutz, Arti-kel 34a über die Zusammenarbeit zwischen Bund und Kanto-nen, Artikel 154 über die Rechtsetzungskompetenz sowie Ar-tikel 159 über die Geheimhaltungsrechte bzw. die Einsichts-rechte des Parlamentes.In diesen sechs wesentlichen Diskussionspunkten obsiegteder Ständerat dreimal, der Nationalrat zweimal. Beim Kinder-schutzartikel hat die Einigungskonferenz eine neue Fassungbeschlossen, welche aber näher bei der Fassung des Stän-derates als bei jener des Nationalrates liegt.In qualitativer Hinsicht hat der Ständerat seine wichtigen An-liegen über wesentliche Strecken durchsetzen können. Mankann von einer ausgewogenen Lösung sprechen. Kein Rathat wesentliche Abstriche machen müssen, jedenfalls nichtgrössere als der andere.Zu den einzelnen Ergebnissen der Einigungskonferenz: – Beider Präambel schliesst sich die Einigungskonferenz bei bei-den Differenzen der Fassung des Nationalrates an. UnsereVertreter in der Einigungskonferenz haben das ohne Begei-sterung getan. Wir hätten uns stilistisch einen schöneren An-fang der Bundesverfassung gewünscht. Das war im Rahmender Gesamteinigung nicht möglich. Wir bitten Sie, hier Nach-giebigkeit vor Schönheit walten zu lassen.– In Artikel 2 Absatz 2bis betreffend die Chancengleichheitschliessen wir uns ebenfalls dem Nationalrat an, erwähnenaber nochmals, dass dieser Zweckartikel nicht direkt an-wendbar ist, was die Annahme durch den Ständerat erleich-tert.– In Artikel 7 geht es um die Gleichstellung: Der Ständerathat nur die Gleichstellung an sich normieren wollen, währendder Nationalrat – wir schliessen uns dieser Lösung an – aus-drücklich von rechtlicher und tatsächlicher Gleichstellungspricht. Was bedeutet das? Es bedeutet nichts anderes, als
Constitution fédérale. Réforme 226 E 15 décembre 1998
Bulletin officiel de l’Assemblée fédérale / Tiré à part
dass die heutige Praxis des Bundesgerichtes weitergeführtwerden soll, denn das Bundesgericht hat bereits in einigenUrteilen festgestellt, dass schon Artikel 4 Absatz 2 der gelten-den Bundesverfassung neben der rechtlichen die tatsächli-che Gleichstellung enthält. Rechtlich schaffen wir nichtsNeues; wir fahren mit der heutigen Praxis des Bundesgerich-tes fort. Sie ist auch kein Aufruf zur absoluten Gleichmache-rei, insbesondere kein Aufruf und kein Blankoscheck für Quo-tenfestlegungen.– Artikel 9a ist wohl – nicht für den Nationalrat, aber für unse-ren Rat – die politisch heikelste Bestimmung. Der Nationalrathat einen Anspruch auf harmonische Entwicklung normiert,während der Ständerat lediglich den besonderen Schutz derUnversehrtheit und Entwicklung in die Verfassung aufneh-men wollte. Es ist ein wesentlicher Unterschied, ob wir denAnspruch auf Entwicklung oder nur den Anspruch auf denSchutz normieren.Nun hat die Einigungskonferenz einer neuen Lösung denVorzug gegeben. Titel und Absatz 1 sind in der Fassung desStänderates gehalten; das ist die inhaltliche Norm. Im Sinneeines Kompromisses haben auch unsere Vertreter mehrheit-lich zugestimmt, dass Absatz 2 als Verfahrensregel aufge-nommen wird. Absatz 2 schafft den Anspruch, dass Kinderihre Rechte selber durchsetzen können, soweit sie urteilsfä-hig sind. Was soll diese Bestimmung? Sie ist nichts anderesals die Heraufstufung der entsprechenden Bestimmungendes Schweizerischen Zivilgesetzbuches (ZGB) als politischerKompromiss. Was heute im ZGB an mehreren Stellen aus-drücklich oder stillschweigend enthalten ist, nämlich dassKinder ihre Rechte selber durchsetzen können, soweit sie ur-teilsfähig sind, soll auf Verfassungsstufe gehoben werden.Keinesfalls soll Absatz 2 ein Keil sein, den die Verfassungzwischen Eltern und Kinder treibt.– Artikel 12 normiert das Recht auf Familie in der Fassungdes Nationalrates. Unter «Familie» verstehen auch wir dieheute gängigen Familienformen, nämlich Eltern und Kinderim gemeinsamen Zusammenleben. Mit dieser Art von Rechtauf Familie haben wir kein Problem, und in diesem Sinnestimmen wir der Fassung des Nationalrates zu.– Artikel 32a ist lediglich eine redaktionelle Differenz ohnejede inhaltliche Tragweite. Hier schliessen wir uns dem Na-tionalrat an.– In Artikel 34a hat bezüglich der Zusammenarbeit von Bundund Kantonen die Fassung des Ständerates obsiegt, die sichebenfalls für die Subsidiarität ausspricht, diese aber nichtnur als blossen Begriff in die Verfassung setzt, sonderngleich bestimmt, was Subsidiarität ist: Nur die Aufgaben,welche einer einheitlichen Regelung in der ganzen Eidge-nossenschaft bedürfen, werden dem Bund übertragen. Mitder Fassung des Ständerates gewinnt die Verfassung eini-ges an Klarheit.– Der Sprachenartikel, Artikel 57h, hat bis zur letzten Lesungim Nationalrat eine Entwicklung durchgemacht. Auch wirglauben, dass der Abschluss im letzten Durchgang des Na-tionalrates gelungen ist; aus diesem Grund schliessen wiruns an. Es ist dies die Fassung, die wir sinngemäss gewollthaben, die aber erst jetzt klar und gut formuliert ist.– In Artikel 85 Absatz 3 hat sich der Nationalrat in der Frage,wann Abweichungen von der Wirtschaftsfreiheit zulässigsind, dem Ständerat angeschlossen. Ich brauche diesen Ar-tikel nicht weiter zu erläutern.– In Artikel 100 Absatz 1 sprechen wir uns dafür aus, dass dieAnfechtbarkeit missbräuchlicher Kündigungen auf Verfas-sungsstufe geregelt ist. Wir haben das vorher nicht als nötigerachtet. Der Nationalrat hat es ausdrücklich so festgehalten.Es ist bereits heute geltendes Recht, und darum schliessenwir uns an.– In Artikel 101 Absatz 3 soll der 1. August entsprechend derFassung des Nationalrates nun halt wohl oder übel als «be-zahlt» normiert sein. Dass er bezahlt sein sollte, war auch inunserem Rat die Meinung, doch hielten wir es sachlich nichtfür nötig, es ausdrücklich zu schreiben.– Bei den letzten beiden Differenzen in den Artikeln 154 und159 hat sich die Einigungskonferenz für die Fassung unseresRates ausgesprochen. Es sind zwei Bestimmungen von er-
heblicher rechtlicher Tragweite: die Frage der Delegation vonRechtsetzungskompetenzen und die Frage, wie weit die Ein-sicht der parlamentarischen Kommissionen in den Geheim-haltungsbereich des Bundesrates gehen soll. In diesen bei-den wichtigen Bestimmungen hat sich der Nationalrat unse-rer ständerätlichen Fassung angeschlossen.Wie ich Ihnen gesagt habe, bittet Sie die Einigungskonferenzmit 25 zu 0 Stimmen, dieser Lösung zuzustimmen. Eine Ge-samtwürdigung, die die Ergebnisse nicht nur quantitativ, son-dern vor allem auch qualitativ analysiert, muss zum Schlusskommen, dass sich unser Rat in vielen wesentlichen Berei-chen durchgesetzt hat. Das Ergebnis ist ausgewogen. DieMöglichkeit für unseren Rat besteht lediglich in der vollstän-digen Annahme oder in der Ablehnung des Gesamtergebnis-ses.Wir bitten Sie zuzustimmen.
Koller Arnold, Bundesrat: Die Einigungskonferenz hat im er-freulichen Willen, zu einem Kompromiss und damit auch zurBeendigung dieses bedeutenden Werkes zu kommen, einenEinigungsvorschlag unterbreitet, der einstimmig angenom-men worden ist. Auch der Bundesrat kann all diesen Lö-sungsvorschlägen zustimmen.Ich möchte einzig bei Artikel 9a Absatz 2 noch festhalten,dass damit keinerlei neue Rechte in der Verfassung festge-schrieben werden, sondern dass mit diesem Absatz 2, derfesthält, dass die Kinder und Jugendlichen ihre höchst per-sönlichen Rechte im Rahmen ihrer Urteilsfähigkeit ausüben,auf das sehr austarierte positive Recht im Zivilrecht, im öf-fentlichen Recht und im Strafrecht verwiesen wird. Daherkönnen keine neuen Berechtigungen aus diesem Absatz 2von Artikel 9a der nachgeführten Bundesverfassung direktabgeleitet werden.Es ist relativ selten, dass derart grossangelegte Gesetzge-bungswerke – dieses hier war auf vier Jahre angelegt – ge-samthaft und in allen Phasen zeitgerecht zu Ende geführtwerden können. Diesmal hat es in allen Phasen geklappt:Schon in der Phase der Experten bei der Ausarbeitung desVorentwurfes, dann nach der Volksdiskussion bei der Erar-beitung der Botschaft durch den Bundesrat und jetzt erneutbei der parlamentarischen Beratung.Sie erfüllen damit auch die Zielsetzung Ihrer ehemaligen Prä-sidentin und Kollegin, Frau Josi Meier, die in ihrer Motion javerlangt hat, dass die Arbeiten so vorangetrieben werden,dass Ende des Jubiläumsjahres eine abstimmungsreife Vor-lage vorliegt. Ohne der Schlussabstimmung vom Freitag vor-zugreifen, kann ich sagen, dass das zweifellos der Fall seinwird.Es ist mir daher vor allem ein Bedürfnis, allen Beteiligten vonHerzen zu danken, denn ohne einen ausserordentlichen Ein-satz aller Beteiligten wären diese ehrgeizigen zeitlichen Zielenicht realisierbar gewesen.Mein erster Dank geht an Ihren Präsidenten, der zudem Prä-sident Ihrer grossen Verfassungskommission war. Der Dankgeht aber auch an die Präsidenten der Subkommissionenund an alle Mitglieder der Verfassungskommission. Der Dankgeht an den ganzen Ständerat, weil ich mir bewusst bin, dassvor allem für die Nichtkommissionsmitglieder die vielen De-tailberatungen gelegentlich etwas mühsam waren. Dassauch sie dabei nie die Geduld verloren haben, verdient aus-drücklichen Dank.Der Dank geht an alle wissenschaftlichen Experten, diemassgeblich an diesem Gesamtwerk mitbeteiligt sind. DerDank geht auch an meine Verwaltung, vor allem an das Bun-desamt für Justiz, das über die ganzen vier Jahre hinweg ei-nen ganz ausserordentlichen Einsatz geleistet hat.Erlauben Sie mir noch eine letzte Bemerkung: Die Verab-schiedung der neuen Bundesverfassung ist ein wichtigesstaatspolitisches Ziel. Wir dürfen sehr zufrieden sein, dasswir dieses Ziel zeitgerecht erreichen. Aber es ist nicht dasEndziel; es ist ein Etappenziel in einem Prozess der Verfas-sungsreform, den der Bundesrat ganz bewusst als offenenProzess konzipiert hat. Weitere Reformprojekte – ich denkein erster Linie an die Justizreform, dann auch an die Reformder Volksrechte, an die Reform des Finanzausgleichs und
15. Dezember 1998 S 227 Bundesverfassung. Reform
Amtliches Bulletin der Bundesversammlung / Separatdruck
letztlich an die Staatsleitungsreform – müssen in einem na-türlichen Intervall folgen. Ich bin Ihnen daher dankbar, wennder Reformwille nach dem Erreichen dieses ersten Etappen-ziels nicht erlahmt.
Angenommen – Adopté
Votations finales 228 E 18 décembre 1998
Bulletin officiel de l’Assemblée fédérale / Tiré à part
Dreizehnte Sitzung – Treizième séance
Freitag, 18. Dezember 1998Vendredi 18 décembre 1998
08.00 h
Vorsitz – Présidence: Rhinow René (R, BL)
__________________________________________________________
SchlussabstimmungenVotations finales
__________________________________________________________
96.091
Bundesverfassung.ReformConstitution fédérale.Réforme
Schlussabstimmung – Vote final
Beschluss des Nationalrates vom 14. Dezember 1998Décision du Conseil national du 14 décembre 1998
__________________________________________________________
Carobbio Werner (S, TI), Nationalrat, unterbreitet im Namender Redaktionskommission (RedK) den folgenden schriftli-chen Bericht:
Wir unterbreiten Ihnen nach Artikel 32 des Geschäftsver-kehrsgesetzes (GVG) den vorliegenden Bericht.1. AusgangslageAm 28. November 1998 fand die Abstimmung über den Bun-desbeschluss vom 20. März 1998 über Bau und Finanzie-rung von Infrastrukturvorhaben des öffentlichen Verkehrsstatt. Die Vorlage wurde von Volk und Ständen angenommenund trat sofort in Kraft. Sie enthält Änderungen der Artikel 21und 23 der Übergangsbestimmungen der geltenden Bundes-verfassung.Diese Änderungen sind im Bundesbeschluss über die neueBundesverfassung versehentlich noch nicht aufgenommenworden. Die Redaktionskommission wurde von der zu-ständigen Verwaltungsstelle darauf aufmerksam gemacht,nachdem die Einigungskonferenz bereits stattgefundenhatte.2. VerfahrenStösst die Redaktionskommission auf materielle Lücken, Un-klarheiten oder Widersprüche, so benachrichtigt sie nach Ar-tikel 32 Absatz 3 GVG die vorberatenden Kommissionen. Istdie Differenzbereinigung bereits beendet, so stellt sie, im Ein-vernehmen mit den Präsidenten der vorberatenden Kommis-sionen, den Räten rechtzeitig vor der Schlussabstimmungdie erforderlichen Anträge.3. Ergänzung von Artikel 196 der Übergangsbestimmungender BundesverfassungEs geht darum, dass die von Volk und Ständen beschlosse-nen Änderungen der geltenden Bundesverfassung Eingangin die neue Bundesverfassung finden. Der neue Wortlaut derArtikel 21 und 23 der Übergangsbestimmungen der Bundes-
verfassung wird grundsätzlich unverändert übernommen undals zusätzliche Ziffer 3 in Artikel 196 der neuen Bundesver-fassung eingefügt. Die Verweise auf andere Verfassungsar-tikel (Schwerverkehrsabgabe, Mehrwertsteuer) werden sinn-gemäss angepasst. Als Folge von Artikel 196 Ziffer 3 mussauch die Ziffer 2 (Absätze 6 und 7) angepasst werden.Die Präsidenten der vorberatenden Kommissionen habendem Antrag der Redaktionskommission zugestimmt.
Carobbio Werner (S, TI), conseiller national, présente aunom de la Commission de rédaction (CRed) le rapport écritsuivant:
Conformément à l’article 32 de la loi sur les rapports entre lesConseils (LREC), nous vous soumettons le présent rapport.1. Le point de la situationL’arrêté fédéral du 20 mars 1998 relatif à la réalisation et aufinancement des projets d’infrastructure des transports pu-blics a été adopté le 28 novembre 1998 par le peuple et lescantons et est entré en vigueur immédiatement. Or ce textemodifie les articles 21 et 23 des dispositions transitoires de laConstitution en vigueur.Ces modifications ont été oubliées dans l’arrêté fédéral relatifà une mise à jour de la Constitution fédérale. L’administrationa rendu la Commission de rédaction attentive à cette lacuneaprès la conférence de conciliation.2. ProcédureAux termes de l’article 32 alinéa 3 LREC, lorsque la Commis-sion de rédaction constate des lacunes, des imprécisions oudes contradictions portant sur le fond, elle en informe lescommissions chargées de l’examen préalable. Si la procé-dure d’élimination des divergences est déjà achevée, ellesoumet, en accord avec les présidents de ces commissions,par écrit, les propositions nécessaires aux Conseils, asseztôt avant le vote final.3. Complément à l’article 196 des dispositions transitoires dela constitutionIl convient maintenant d’ajouter dans la constitution mise àjour les modifications de la constitution en vigueur adoptéespar le peuple et les cantons. Les articles 21 et 23 des dispo-sitions transitoires de la constitution sont repris à l’article 196chiffre 3 de la constitution mise à jour, les références àd’autres articles constitutionnels ayant été adaptées; le chif-fre 2 (alinéas 6 et 7) est adapté en conséquence.Les présidents des commissions chargées de l’examen préa-lable ont approuvé cette proposition.
Antrag der KommissionDie Kommission beantragt, den Ergänzungen zuzustimmen.
Proposition de la commissionLa commission propose d’approuver les modifications.
Angenommen – Adopté
Präsident: Wir haben heute am letzten Tag der Session wieüblich die Schlussabstimmungen durchzuführen. Eine dieserSchlussabstimmungen, diejenige über die Reform der Bun-desverfassung, rechtfertigt einige kurze Bemerkungen auspräsidialer Sicht.Im Januar 1997 nahmen die Verfassungskommissionen bei-der Räte ihre Arbeiten auf. Nach zehn Monaten, Ende No-vember desselben Jahres, beendeten sie ihre Beratungennach vielen Sitzungen und stellten ihre Entwürfe der Öffent-lichkeit vor. Die eidgenössischen Räte begannen Mitte Ja-nuar dieses Jahres mit ihren Verhandlungen, und zwar in ei-nem unüblichen Verfahren, indem die Vorlage aufgeteiltwurde und jeder der beiden Räte für je einen Teil der Verfas-sung als Erstrat zum Einsatz gelangte.Heute, am 18. Dezember 1998, elf Monate später, noch imJubiläumsjahr 1998, können wir nun unsere Arbeiten an die-sem Projekt termingerecht abschliessen – 33 Jahre, nach-dem der Solothurner Ständerat Obrecht und der Basler Na-tionalrat Dürrenmatt ihre Motionen eingereicht haben.
18. Dezember 1998 S 229 Schlussabstimmungen
Amtliches Bulletin der Bundesversammlung / Separatdruck
Damit liegt erstmals seit 124 Jahren wieder eine totalrevi-dierte Bundesverfassung vor; es ist die zweite in der150jährigen Geschichte unseres Bundesstaates.Wenn wir uns das Ergebnis unserer Bemühungen näher an-sehen, können wir folgende Schlussfolgerungen ziehen: Wirhaben den Auftrag, eine nachgeführte und aktualisierte Ver-fassung zu schaffen, zeitgerecht erfüllt. Es liegt nun ein les-bares, verständliches, modernes, klar gegliedertes und dasgeltende Recht wiedergebendes Grundgesetz vor. Dabei er-wies sich die Vorlage des Bundesrates als ausgezeichneteBasis, die wir teils übernehmen, teils weiterentwickeln konn-ten.Das Parlament darf für sich in Anspruch nehmen, auch beider Aktualisierung einen wesentlichen Anteil an der endgülti-gen Fassung geleistet zu haben. Wir haben, mehr als sonst,die einzelnen Worte gewogen, Begriffe durchleuchtet, dieFormulierungen auf ihren Rechtsgehalt und auf ihre symboli-sche Tragweite hin überprüft und die Systematik angepasst.Wir haben breite Kreise der interessierten Bevölkerung ange-hört und viele eingereichte Vorschläge berücksichtigt. Dervorliegende Entwurf ist ein Gemeinschaftswerk von Bundund Kantonen, von Parlament und Regierung, von Verwal-tung und aussenstehenden Experten, von Gesetzgeber undvielen Bürgern und Bürgerinnen sowie Organisationen.Die neue Verfassung ist aber auch ein Gemeinschaftswerkvon Nationalrat und Ständerat; beide Räte haben mit ausser-ordentlichem Engagement um diese Verfassung gerungen.Bis zuletzt wurden alle Verfahren der Differenzbereinigungausgeschöpft. Beide Räte haben aber auch Entgegenkom-men gezeigt und gegenseitiges Verständnis aufgebracht, sodass sie sich beide in der endgültigen Fassung wiedererken-nen. So können wir heute sagen, es sei die Verfassung vonNationalrat und Ständerat. Ein solches Ringen, in dem hübenund drüben viel Herzblut vergossen, viel Überzeugungskrafteingesetzt, immer wieder neue Kompromisslösungen ge-sucht und gefunden wurden, belegt anschaulicher als jedetheoretische Überlegung, dass Nachführung mehr ist alsNachführung im wörtlichen Sinn. Nachführung ist echte,schöpferische Aktualisierung.Diese Verfassung atmet unseren Zeitgeist, auch dort, wo siesich anschickt, das Geltende scheinbar nur auf die Höhe derZeit zu bringen. Doch wir haben auch bewusst verändert undNeues geschaffen, getreu unserer Devise, dass wir den Bo-den der eng verstandenen Nachführung dort verlassen wol-len, wo Neuerungen auf einen breiten Konsens zählen kön-nen, wo in diesem Sinne alte Zöpfe abgeschnitten oder Neu-entwicklungen aufgenommen werden sollen.Ich erwähne als Beispiele: das verstärkte Gewicht der Kan-tone im Rahmen der Zusammenarbeit mit dem Bund bei Ge-bietsveränderungen und in der Aussenpolitik; die besondereBerücksichtigung von Jugendanliegen, der Integration Be-hinderter, der Förderung von Kunst und Musik sowie der Un-terstützung mehrsprachiger Kantone; die neuen Bundeskom-petenzen im Bereich der Statistik und der Berufsbildung; diezahlreichen Änderungen im organisatorischen Bereich, vonder Mitwirkung des Parlamentes in der Aussenpolitik über dieneuen Erlassformen, die selbständigen Befugnisse der Kom-missionen, die Grundlage für Aufträge an den Bundesrat, bishin zur neuen Regelung des Truppenaufgebotes für die Wah-rung der äusseren und inneren Sicherheit.Wir haben schliesslich – dies ist meine letzte und vielleichtwichtigste Bemerkung zur Verfassungsvorlage – die Grund-lagen unseres Gemeinwesens bekräftigt, und wir haben dieverfassungsbildenden Grundwerte damit gefestigt. Rechts-staatlichkeit und Demokratie, Föderalismus, Integration meh-rerer Sprach- und Kulturgemeinschaften, Sozialstaatlichkeit,freiheitliche und wettbewerbsorientierte Wirtschaftsordnung,in der Völkergemeinschaft verankerte Souveränität: dies sindund bleiben die Konstanten unseres Landes. Sie erscheinenin der neuen Verfassung im neuen Lichte als sichtbare, ver-bindende Klammer, die unser Volk zusammenhält. Sie ver-mitteln Stabilität, Vertrauen in die eigenen Stärken, Gewis-sheit über das, was heute Identität genannt wird. Sie schla-gen damit die Brücke von der eigenen Vergangenheit zur of-fenen Zukunft mit ihren Herausforderungen. Mit der neuen
Verfassung haben wir auch den Boden dafür bereitet, dassweitere Reformen in Angriff genommen werden können,dass der Prozess der Verfassungs- und Staatsreform seinenFortgang nehmen kann, wenn – was ich hoffe – der Wille da-für vorhanden sein wird.Damit komme ich zum Dank. Ich danke allen, die massgeb-lich am Zustandekommen dieser Verfassung beteiligt waren:– dem Bundesrat zuerst, vor allem Herrn Bundesrat Koller:Wenn diese Verfassung auch nicht mehr sein alleiniges Werkist, so wären wir ohne seine wegleitende Beharrlichkeit nie soweit gekommen;– dem Bundesamt für Justiz für die hervorragende Beglei-tung der Verfassungskommissionen in den letzten zwei Jah-ren, namentlich Herrn Prof. Heinrich Koller, Herrn Prof. Lu-zius Mader und Herrn Dr. Aldo Lombardi;– der Verfassungskommission unseres Rates, die ein ganzbesonderes Mass an zusätzlicher Arbeit auf sich genommenhat und deren guter Geist von ausschlaggebender Bedeu-tung war;– den Parlamentsdiensten, insbesondere Herrn Graf, FrauLüthi, Herrn von Wyss und Frau Nufer für die ausgezeichneteMitarbeit in organisatorischer wie fachlicher Hinsicht;– schliesslich Ihnen allen für die positive Aufnahme, die en-gagierten Debatten und die vorbildliche Geduld über all dieDifferenzbereinigungen hinweg.Ich schliesse mit der Bitte, unserem Werk nicht nur heute,sondern auch in den kommenden Monaten die notwendigeUnterstützung angedeihen zu lassen.
Cavadini Jean (L, NE), rapporteur: Dans la hâte qui animaitchacun dans la perspective de mettre sous toit la mise à jourde la constitution pour la fin de cette année, il nous a échappéqu’il convenait de substituer systématiquement le vocabled’«être humain» à celui d’«homme» lorsque la déterminationpouvait être ambiguë. A l’article 119 alinéa 1er, on lira donc«être humain», comme on le fait d’ailleurs à l’article 120 etdans l’ensemble du texte.
A1. Bundesbeschluss über eine neue Bundesverfas-sung (Titel, Art. 1–126, 185)A1. Arrêté fédéral relatif à une mise à jour de la Consti-tution fédérale (titre, art. 1–126, 185)
A2. Bundesbeschluss über eine neue Bundesverfas-sung (Art. 127–184)A2. Arrêté fédéral relatif à une mise à jour de la Consti-tution fédérale (art. 127–184)
Abstimmung – VoteFür Annahme des Entwurfes 44 Stimmen
(Einstimmigkeit)
An den Nationalrat – Au Conseil national
230
Bulletin officiel de l’Assemblée fédérale
108. Jahrgang des Amtlichen Bulletins 108e année du Bulletin officiel
Herausgeber: Editeur:Dienst für das Amtliche Bulletin der Bundesversammlung Service du Bulletin officiel de l'Assemblée fédéraleParlamentsdienste Services du Parlement3003 Bern 3003 BerneTel. 031/322 99 82 Tél. 031/322 99 82Fax 031/322 99 33 Fax 031/322 99 33E-mail [email protected] E-mail [email protected]
Chefredaktor: Dr. phil. François Comment Rédacteur en chef: François Comment, dr ès lettres
Druck: Vogt-Schild AG, 4501 Solothurn Impression: Vogt-Schild SA, 4501 Soleure
Vertrieb und Abonnemente: Distribution et abonnements:EDMZ, 3000 Bern OCFIM, 3000 BerneTel. 031/322 39 51 Tél. 031/322 39 51Fax 031/992 00 23 Fax 031/992 00 23
Preise gedruckte Fassung (inkl. MWSt): Prix version imprimée (TVA incl.):Einzelnummer Ständerat Fr. 12.– Numéro isolé Conseil des Etats fr. 12.–Jahresabonnement Schweiz Abonnement annuel pour la Suisse(Nationalrat und Ständerat) Fr. 95.– (Conseil national et Conseil des Etats) fr. 95.–Jahresabonnement Ausland Fr. 103.– Abonnement annuel pour l'étranger fr. 103.–
CD-ROM-Fassung: Version CD-ROM:Vertrieb und Abonnemente: EDMZ Distribution et abonnements: OCFIM
Internet/WWW-Adresse: http://www.parlament.ch Adresse Internet/WWW: http://www.parlement.ch
ISSN 1421-3982 ISSN 1421-3982