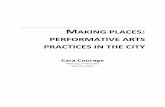Aesthetisch-performative Zugänge innovativer Organisations- und Arbeitsgestaltung
Transcript of Aesthetisch-performative Zugänge innovativer Organisations- und Arbeitsgestaltung
Zeitschrift für innovative Arbeitsgestaltung und Prävention 10,- Euro | ISSN 2190-0485 Nr.1 | 2011
Das „Andere“
Ästhetisch-performative Zugänge innovativer Organisations- und Arbeitsgestaltung
editorial
præview Nr. 1 | 20112
In der Vorbereitung dieses Heftes wurde im Redaktions-team so intensiv diskutiert wie selten zuvor. Was meinendie Autoren aus dem künstlerischen Bereich eigentlichgenau, wie kann man sich das praktisch vorstellen? Washat Ästhetik und „Spiel“ mit funktionalen Prozessen zutun? Kann man sich in Wirtschaftsprozessen wirklich sovon der unmittelbaren Zweckgebundenheit des beruf-lichen Handelns lösen? Diese Fragen spiegeln ein Unbehagen gewohntes, be-herrschtes Terrain zu verlassen, sich auf Neues, „Ande-res“ einzulassen und letztendlich – zu lernen.Wir sind am Ende zu dem Ergebnis gekommen, dassFritz Böhle und viele andere an diesem Heft beteiligteArbeitsforscher, Künstler, Kunst- und Kulturwissen-schaftler und Praktiker es mit diesem Schwerpunktheftgeschafft haben, „das Andere“ für die Organisations-und Arbeitsgestaltung zu erschließen. Damit haben sieeinen wesentlichen Beitrag zur produktiven Überschrei-tung der Grenze des zweckrationalen Denkens geliefert,das weite Teile der Arbeits- und Organisationsforschungbis heute in unterschiedlichen Facetten prägt. Sie neh-men damit eine notwendige Neubewertung und Erwei-terung bislang vorherrschender Begriffssysteme undDenkstrukturen der Arbeitsforschung vor, die jedenLeser dieser præview auch an seine eigenen Grenzenführen – Grenzüberschreitungen nicht ausgeschlossen.Unser gemeinsames Ziel mit diesem Heft war es, die unsprägenden Grenzen des Rationalen durch die Vermitt-lung künstlerischer und spielerischer Erfahrung zudurchbrechen – und damit auch „echte“ Interdiszipli-narität zu ermöglichen. In einigen Beiträgen führt die Eigenlogik des künstle-risch-ästhetischen Umgangs mit dem profanen Alltagder Organisation auf vielleicht zunächst wenig ver-ständliche Begriffswelten, die sich erst beim zweitenLesen in ihrem Sinn für die gestaltungsorientierte Praxiserschließen. Eine Organisation musikalisch zu denken,das ist für einen konventionellen Arbeits- und Organi-sationsforscher erst einmal eine echte Herausforderung.Insofern ist diese præview auch eine Provokation un-seres kategorialen, routinisierten, letztlich konsens -orientierten Denkens. Es stört, rüttelt auf, kann damitselber aber auch zu einer Innovation der Arbeitsfor-schung werden.Wer sehen will, wie das Spielerische künstlerischenHandelns (von Michael Brater in seinem Beitrag ein-drucksvoll beschrieben), das sich einer ökonomischenVerwertungslogik letztlich verweigert, zu einem auch
praktisch inspirierenden Treiber für Innovation undeinem Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fordernden Me -dium werden kann, dem sei das Interview mit Helga Weißvon der dm drogerie markt-Kette empfohlen. Es machtdeutlich, was man mit ernsthafter Einbindung vonKunst z.B. in Ausbildung erreichen kann: nämlich auto-nomes Denken von sich selbst entdeckenden und ent-wickelnden Menschen anzuregen. Und dies ist nicht nurdie unabdingbare Voraussetzung für Innovation – son-dern vor allem für eine „funktionierende“ Gesellschaftinsgesamt. Ein Experiment bleibt dieses Schwerpunktheft der præ-view dennoch, weil wir von unserem Anspruch, eineZeitschrift für ein interessiertes Publikum aus Praxisund Wissenschaft zu machen, die sich der alltäglichenPraxis in den Unternehmen und ihrer Handlungslogik,ihrer Sprache stellt – und auf diesem Weg auch Wirkungentfalten will – nicht abrücken. Aber den Blick über dendisziplinären „Tellerrand“ haben wir in fast allen bishe-rigen Ausgaben der præview eigentlich immer schongepflegt, auch durch Einbeziehung von Wissen aus an-deren gesellschaftlichen Subsystemen, etwa der Reli-gion. Wir werden dies auch fortsetzen und zum Beispielin den nächsten Heften Ethnologen einbeziehen, dieuns Arbeitsbegriff und Arbeitsverständnis anderer Kul-turen und Kontinente vorstellen sollen. Auch von His-torikern erhoffen wir uns in Zukunft Anregungen, un-sere eigenen disziplinären Grenzen zu überschreitenund unseren Betrachtungshorizont zu erweitern.Diese Ausgabe der præview hat ihr Ziel aber nur dannerreicht, wenn wir einen Dialog der Disziplinen initiie-ren. Ich möchte daher die Leser explizit ermutigen, sichmit den Autoren in Verbindung zu setzen und eine Dis-kussion zu beginnen!
Dortmund, im März 2011
Rüdiger KlattHerausgeber
Die Grenzen des Rationalen durch „Das Andere“ überschreiten
5
inhalt
præview Nr. 1 | 20114
Ästhetisch-performative Zugänge innovativer Organisations- und Arbeitsgestaltung
Natalia Balcázar, geboren 1966 in Valladolid (Spanien), wohntseit 1994 in Deutschland. Seit mehr als zwan-zig Jahren fotografiert sie verrostete Gegen-stände, die sie z.B. auf den alten Fabrikhaldendes Ruhrgebiets findet. Ihre persönliche Be-handlung von Struktur- und Farbharmonienmit der Kamera trägt den Blick weit über dashinaus, was alt und wertlos zu sein scheint.Ihre Fotografien suchen die direkte Kommuni-kation mit den Empfindungen des Beobach-ters. Sie stellt schlichtweg vor, was sie findet.
Natalia Balcázar ist Doktorin der Geologieund Inhaberin der European EnvironmentalProject Management (ENVIROpro), einem Beratungsunternehmen im Bereich Umwelt,Energie und Entsorgung. www.enviro-pro.de
Art Directors’ Comment Die versteckte KunstausstellungDas Thema dieser Ausgabe der præview ist „Das An-dere“. Und daher soll sie auch anders aussehen. Wirwollten nicht der sich quasi aufdrängenden Bildspra-che nachgeben, die simpel und plakativ Kunst undIndustrie in einem Bildmotiv zusammenführt odergegenüberstellt. Deshalb entschieden wir uns für eingrafisches Experiment. Alle Bilder dieser præviewstammen von einer Künstlerin, der spanischen Foto-grafin Natalia Balcázar, die seit vielen Jahren Rost alsdurchgängiges Motiv ihrer Arbeiten gewählt hat.
Rost symbolisiert das Alte, aber auch das Ruhige, Ent-spannte. Wenn man den Rost entfernt, kommt etwasGlänzendes zum Vorschein. Rost ist das Symbol fürdie Industriegesellschaft: geprägt von Eisen undStahl, Härte und Schwere, mittlerweile stillgelegt undruhend. Rost ist aber nur eine dünne Schicht, unterder sich weiterhin Funktionsfähiges und Schönes ver-birgt. Rost ist so verstanden Leitbild und Gegenstandder Arbeitsforschung.
Natalia Balcázar hat uns für diese Ausgabe der præ-view exklusiv unveröffentlichte Werke zur Verfügunggestellt. Die Motive stammen aus dem Ruhrgebiet,der Hochburg der Industriekultur und der Arbeitsfor-schung. Wir freuen uns, so mit dieser Ausgabe derpræview eine „versteckte Kunstausstellung“ als Hin-tergrund der Artikel verbinden zu können.
Der Leser ist herzlich eingeladen, die Bildbotschaft imKontext des einzelnen Artikels für sich persönlich zuerschließen oder aber die Ästhetik und die formaleQualität der Fotografien auf sich wirken zu lassen.
Renate Lintfert und Hans Waerder, Q3 design
Das „Andere“
Die Grenzen des Rationalen durch Kunst überschreitenRüdiger Klatt
Das „Andere“ Ästhetisch-performative Zugänge innovativer Organisations- und Arbeitsgestaltung
Fritz Böhle, Karin Denisow, Eva Renvert, Michael Brater, Wolfgang Stark
Ästhetische Interventionen als Medium der kritischen Reflexion und Gestaltung organisationaler Strukturen
Wolfgang Arens-Fischer, Eva Renvert, Bernd Ruping
Innovationsarbeit und Innovationsprozess – künstlerisch, erfahrungsgeleitet, spielerischFritz Böhle, Markus Bürgermeister
Organisation von Innovation – Management des InformellenEckhard Heidling, Judith Neumer, Stephanie Porschen
Wie Künstler vorgehen – das Konzept des künstlerischen HandelnsMichael Brater
Dienstleistung – die Kunst Kunden zu verstehenClaudia Munz, Elisa Hartmann, Jost Wagner
Durch Kunst kann man lernen: Es kommt auf mich an!Gespräch mit Helga Weiß, dm drogerie markt, Bereichsverantwortliche für Aus- und Weiterbildung
Vom Erhandeln des AnderenEin theatraler Einblick in Veränderungspotenziale von Organisationen
Jutta Bloem, Benjamin Häring
Music – Innovation – Corporate CultureDie Tiefendimension von Organisationskulturen musikalisch erfassen
Wolfgang Stark, David Vossebrecher, Oliver Bluszcz, Gisela Humpert, Michaela Wendekamm, Michaela Margiciok
Organisation musikalisch denkenChristopher Dell
Neue Horizonte für Innovationsarbeit Wie ein archetypisches Muster Innovationsprozesse strukturiert und stützt
Karin Denisow, Nina Trobisch
Was Führungskräfte mit dem risikoreichen Weg des Helden verbindet Einblick in die Praxis
Karin Denisow, Nina Trobisch
Digitale Spiele als innovatives Medium für Wissenstransfer und InterventionCarsten Busch, Florian Conrad, Martin Steinicke
Vom Entdecken des Neuen durch die „Entüblichung“ des DenkensZur Programmatik eines ästhetisch-performativen Ansatzes in der Organisationsforschung und -gestaltung
Wolfgang Arens-Fischer, Michael Brater, Karin Denisow, Stefanie Porschen, Bernd Ruping, Wolfgang Stark, Nina Trobisch
Der Künstler als Vorbild der Arbeitsforschung? Da ist Musik drin!Kurt-Georg Ciesinger
02 editorial
06
08
10
12
14
16
18 intærview
20
22
24
26
28
30
32 dælphi
34 prævokation
35 impressum
7præview Nr. 1 | 20116
Die Planung und die Herstellung von Planbar-keit sind besondere Errungenschaften indus-trieller Gesellschaften. Insbesondere im Bereichindustrieller Produktion wurden sie in großemUmfang realisiert. Doch trotz unbestreitbarerErfolge zeigt sich: Auch dort, wo die Planungweit fortgeschritten ist, bleiben Grenzen derPlanbarkeit bestehen und entstehen in neuerWeise. Komplexe technische Systeme und Or-ganisationen entziehen sich der vollständigenBerechnung und Planung. Doch nicht nur dies:Bei Innovationen stößt das Bestreben zu planennicht nur an Grenzen, sondern es beinhaltetauch die Gefahr, dass hierdurch Innovationennicht gefördert, sondern behindert werden. DasErgebnis und der Verlauf von Innovationen sindgrundsätzlich nur begrenzt vorhersehbar. Bishersind die Organisation und das Management vonOrganisationen jedoch kaum darauf vorbereitet,das Unplanbare nicht nur als Defizit zu sehen,sondern produktiv zu nutzen. Dementsprechendrichtet sich auch das Management von Innova-tionen vor allem darauf, Innovationsprozesseweitmöglichst zu planen, zu steuern und zu kon - trollieren.
In gesellschaftlichen Lebensbereichen außer-halb der Ökonomie finden sich demgegenüberjedoch vielfältige Erfahrungen und Praktikenfür einen „anderen“ Umgang mit Unbestimmt-heit und Offenheit. Beispiele hierfür sind derBereich des Künstlerischen und des Spiels, wieaber auch Erfahrungen, die in Entdeckungs-,Helden- und Abenteuergeschichten festgehal-ten sind. In modernen Gesellschaften haben sichunterschiedliche Lebensbereiche ausdifferen-ziert. Öko nomie, Politik, Bildung und Wissen-schaft unterliegen jeweils eigenständigen Regelnund Zielsetzungen. So sind auch das Künstleri-sche, das Spiel oder das Erzählen von Geschich-ten zu eigenständigen, von der Ökonomie, Tech - nik und Wissenschaft abgesonderten Lebens -bereichen geworden. Sie haben hier die Freiheit
Das „Andere“Ästhetisch-performative Zugänge innovativer Organisations- und ArbeitsgestaltungFritz Böhle, Karin Denisow, Eva Renvert, Michael Brater, Wolfgang Stark
scheinen vielmehr nebenbei: ein Rhythmus, dersich auf die Begriffe legt, ein Gestus, in demsich die Strukturen von Herrschaft brechen, einBild, das allen gegenwärtig ist und so die Wahr-nehmung neu ausrichtet. Kunst wirkt hier nichtals exklusives Kulturangebot, sondern als imma -nenter Bestandteil der Kommunikation zwischenden Protagonisten der Projekte und de nen derUnternehmen. Die Beiträge in diesem Heft ge -ben, entlang den beteiligten Forschungs- undEntwicklungsvorhaben, exemplarische Einblickein diese Prozesse. Es sind dies:
Der Forschungsverbund KES-MI (Künstle-risch, Erfahrungsgeleitet, Spielerisch – Manage-ment des Informellen zur Förderung innovativerArbeit) geht davon aus, dass menschliche Fä-higkeiten und Handlungsweisen, die zumeistdem Künstlerischen und Spielerischen zugeord-net werden, für innovative Arbeit wichtig sind.Beispielhaft hierfür sind das unbefangene Sich-Einlassen auf Neues, eine spürende und emp-findende sinnlich-körperliche Wahrnehmungoder das Erreichen von Ergebnissen, ohne dassdiese bewusst angestrebt und geplant werden.Innovative Arbeit fügt sich demnach nur be-grenzt in formalisierte Strukturen ein und er-fordert ein Management von Innovationen, dasinformelle Prozesse zulässt, unterstützt undfördert. Beispiele hierfür sind ein situativ-expe-rimentelles Projektmanagement, Entscheidun-gen in laufenden Arbeitsprozessen sowie agileEntwicklungsprozesse und ein kooperativer Er-fahrungstransfer. www.kes-mi.de
Der Forschungsverbund MICC (Music_Inno-vation_Corporate Culture) nutzt Musikspracheund musikalische Muster (Improvisation) alsMedium zur Analyse und Entwicklung von in-novativen Organisationskulturen. Gemeinsammit den beteiligten Unternehmen/Organisatio-nen werden über Fallanalysen und künstlerische
Zugänge (Partituren, Gesprächskonzerte) Mus-ter sichtbarer und verdeckter Organisationskul-turen in ihrer Bedeutung und Wirkung für dieOrganisation analysiert und verdeutlicht. DieSprache der Musik und musikalische Muster er-möglichen dadurch eine neue Dimension derWahrnehmung, die innovative Muster hörbarmacht. Relevante und wiederkehrende Erfolgs-muster, aber auch „pathogene“ Muster lassensich identifizieren, die die Basis für eine Muster -spra che für Organisationen bieten und für dieWei terentwicklung organisationsspezifischer Or -ganisationskulturen genutzt werden können.Die gemeinsame Entwicklung und Erprobungverschiedener Instrumente (Gesprächskonzerte,Organisationspartituren, Improvisationsmuster)ermöglicht neuartige Formen der Analyse vonOrganisationskulturen mit den spezifischen Di-mensionen der Musik. Werden Organisationenauf diese Weise auch im zeitlichen Längsschnitt„musikalisch gedacht“, werden innovative Ver-änderungsprozesse und nachhaltiges Organisa-tionslernen hinsichtlich zukünftiger Herausfor-derungen in Organisationen möglich. www.micc-project.org
Der Forschungsverbund THINK (Theatrale In-terventionen im Innovations- und Kooperati-onsmanagement) setzt den Schwerpunkt aufdie Exploration von Kommunikation und Ver-halten in Kooperationskontexten. Der zentraleAnsatz ist dabei die Theatrale Organisationsfor-schung (TO), die nach den Prinzipien der ästhe-tischen Bildung auf Schauspieltheorien und-methoden zurückgreift. Unternehmensakteurereflektieren ihre Wirklichkeit, indem sie dieselbeentweder in der Rolle des Regisseurs gestalte-risch in Szene setzen oder als Spieler selbstneue Zugänge zu den Situationen und Phäno-menen ihres Alltags finden. In der Reflexion derin Bild oder Szene eingefangenen Wirklichkeitzeigen sich zugleich die Möglichkeiten andererHandlungsoptionen. Dabei liegt der Fokus nicht
auf dem individuellen Verhalten des/der einzel-nen Protagonisten/in, sondern auf dem organi-sationalen bzw. kooperativen Kontext, in demsein/ihr Verhalten als notwendiges erklärbarwird. So werden die Zusammenhänge von orga -ni sa tionalen Strukturen und Verhaltens- undKommunikationsweisen sichtbar und im Kon-text von Prozessverläufen reflektierbar. Ziel ist,die Ergebnisse des Forschungsprojektes in ei -nem ver haltensbasierten Managementsystemzu sam menzufassen. www.forschungsprojekt-think.de
Der Forschungsverbund KunDien (Dienstleis-tung als Kunst – Wege zu innovativer und pro-fessioneller Dienstleistungsarbeit) geht derFrage nach, welchen Beitrag das künstlerischeHandeln, also die Handlungs- und Vorgehens-weise von Künstler/innen, zur Professionalisie-rung von Dienstleistungsarbeit leisten kann.Viele moderne Dienstleistungen zeichnen sichdadurch aus, dass ihre Erbringung offen-pro-zesshaft vonstattengeht, der Kunde direkt in dieLeistungserbringung miteinbezogen werdenmuss und die genaue Definition der zu erbrin -gen den Leistung erst im Leistungsprozess selbsterfolgt. Professionell zu handeln heißt vor diesemHintergrund, mit der Offenheit dieser Dienst-leistungssituation produktiv umzugehen undden Prozess situativ und dialogisch, ge mein sammit dem Kunden zu gestalten. In KunDien ar-beiten Künstler/innen, Wissenschaft ler/in nenund Unternehmensvertreter/innen zu sammen,um gemeinsam ein Verständnis für professio -nel le Dienstleistungsarbeit, das die zen tralenMerkmale eines „künstlerischen“ Vorgehensaufgreift, zu erarbeiten und in einem Leitbild„Dienstleistungskünstler“ zu beschreiben. Darü-ber hinaus werden Kompetenzentwicklungs-konzepte entwickelt und umgesetzt, mit derenHilfe Dienstleister die dafür notwendigen Hand -lungskompetenzen erwerben können. www.dienstleistungskunst.de
gewonnen – unabhängig vom Blick auf das un-mittelbar Zweckhafte – Kreativität, Fantasieund immanen te Grenzüberschreitungen zu ent-falten. Gleich wohl gelten sie aber als weitge-hend ökonomisch nutzlos.
Solche Abgrenzungen zwischen unterschiedli-chen Lebensbereichen werden jedoch zunehmendbrüchig und sind immer weniger haltbar. So er-weist sich die traditionell dem Künstlerischenzugeordnete gestalterische Selbsttätigkeit inmo dernen, dezentral organisierten Unter neh -men als eine unverzichtbare Humanressource.Man kann hierin eine Instrumentali sierung desKünstlerischen, Spielerischen usw. für die Sys-teme zweckrationalen Handelns sehen. Dochstellt sich die Frage, in welcher Weise darinnicht grundlegende Potenziale liegen, sowohlfür eine Weiterentwicklung der Organisationvon Unternehmen als auch einer humanen Ge-staltung von Arbeit jenseits von Planung undrigider Kontrolle.
In dieser Perspektive haben mehrere For -schungs verbünde in den BMBF-Förderprogram-men „Arbei ten – Lernen – Kompetenzen entwi-ckeln. In no va tionsfähigkeit in einer modernenArbeits welt“ und „Innovationen mit Dienstleis-tungen“ neue Wege zur Förderung von Innova-tion, der Organisationsentwicklung und Ar-beitsorganisation beschritten. Dabei sind jeweilsunterschiedliche Zielsetzungen, Konzepte undMethoden leitend. Gemeinsam aber ist allenBeteiligten, dass sie auf den Anspruch verzich-ten, Kunst für oder in Unternehmen zu produ-zieren. Vielmehr geht es in allen Forschungsver-bünden darum, autotelische Reflexions- undGestaltungsweisen in die Analyse und Entfal-tung von Arbeitssystemen und Unternehmens-kulturen zu integrieren sowie deren Wirkungund Reichweite zu überprüfen. Qualitäten, dietraditionell der Kunst, dem Spiel zugeordnetwerden, sind da mit nicht extrapoliert. Sie er-
Der Forschungsverbund HELD (Innovations-dramaturgie nach dem Heldenprinzip) erkundetdie nachhaltige Wirkung kultureller Grundmus-ter für Entwicklung und Innovation. Die in denHeldenmythen über Jahrtausende verdichteteMenschheitserfahrung von Wachstum und Wan -del wird als ursprüngliches Prinzip für die Be-wältigung von Ungewissheit in Innovationspro-zessen zugänglich. Unternehmen, Teams undIndividuen können mit dieser Struktur die eige-nen Entwicklungsprozesse als immer wieder-kehrende Abfolge von Phasen und Schrittennachvollziehen. In offenen Prozessen erhaltendie Akteure Sicherheit in der Unsicherheit. DasProjekt geht von dieser kollektiven Weisheit ausund entwickelt ein Konzept für die externe Be-gleitung von Organisationsentwicklung. Künst-lerisch-ästhetische Methoden – Dramaturgie,darstellende Kommunikation, Story Telling, Cre -ative Writing, bildkünstlerisches Gestalten, mu-sikalische Impulse, Körperarbeit etc. – sind Ar-beitsweisen, um das Heldenprinzip ganzheitlichzu vermitteln. Die in den kulturellen Zwischen-räumen der Organisation und des Einzelnenvorhandenen Möglichkeiten werden sichtbar;es eröffnen sich neue Handlungsoptionen undKommunikationsflächen. Im Ergebnis des Pro-jektes ist die Wirksamkeit dieses Ansatzes ge-prüft und ein Interventionsmodell entwickelt. www.innovation-heldenprinzip.de
9præview Nr. 1 | 20118
Ästhetik – funktionale Einordnung in die Gestaltung innovativer ArbeitDie Suche nach Erfolg versprechenden Konzeptenzur Stärkung der Innovationskraft wird intensivbetrieben. Dabei rücken die Organisationsmit-glieder selbst als „eigensinnige“ Menschen zu-nehmend in den Fokus des Interesses. So wirdpersonen- und körpergebundenes Erfahrungs-wissen und lebendiges Arbeitsvermögen immermehr zur zentralen Ressource im Umgang mitKomplexität und Unwägbarkeiten (vgl. Böhle etal. 2004; Pfeiffer 2004). Darüber hinaus eröffnetdas Erkennen der Verände rungs fähigkeit undVeränderungsbedürftigkeit or gani sa to ri scherArbeitskontexte die Option zu Hand lungs ini tia -tive und innovativer Arbeit (vgl. Gebert 2004). Ästhetik als Erkenntnisdisziplin, die sich im Un-terschied zum begrifflichen Erkennen mit Hand-lungen sinnlichen Erkennens befasst, stellt denMenschen als erkennendes Subjekt in den Mit-telpunkt. Ihr Anliegen: die menschlichen Sinneauf Wahrnehmung hin zu öffnen. Dabei helfenästhetische Interventionen zum einen Wahr-nehmung gezielt auszurichten und zu lenken,zum anderen sie polyvalent zu entfalten, so dasssich Raum für die Reflexion und weiterführendfür die Gestaltung neuer Arbeitskontexte ergibt(Arens-Fischer, Renvert & Ruping, 2010).
Ästhetische Interventionen als Medium der kritischen Reflexionund Gestaltung organisationaler StrukturenWolfgang Arens-Fischer, Eva Renvert, Bernd Ruping
Sinne einer Balance? Wie soll die Wahrneh-mung der Veränderungsbedürftigkeit und dieVeränderungsfähigkeit der Organisation initiiertund im betriebswirtschaftlich fruchtbaren Rah-men gehalten werden? Aus kunst-soziologi-scher Perspektive ist eines evident: Die inten-tional präformierte Ästhetik des Warenschönendominiert als Design jede offen-experimentelleDarstellungsweise und damit auch mögliche re-sponsive Formen der ästhetischen (Re)Präsen-tation: Die Marke führt, der Mensch folgt.Wir schlagen deshalb vor, die Offenheit und Ge-schlossenheit einer Organisation grundsätzlichdialektisch zu verstehen und sie auch in der Di-mension des Ästhetischen zu fassen (Arens-Fi-scher, Renvert & Ruping 2010).
ums auf Design oder Wieder-Erkennbarkeit,sondern mit Bezug auf die Mannigfaltigkeit derÄsthetik als Erkenntnisdisziplin, so lässt sich dieästhetische Dimension (s. Abb. 2) zwischen denPolen einer „geschlossenen“ und „offenen“ Form -gebung entfalten. Auf diese Weise wird dieIden tität der Organisation als Handlungs- undKommunikationssystem im ständig zu reflektie-renden Spannungsfeld zwischen Sinnvermitt-lung und Sinnsuche geprägt. Die ästhetischeErfahrung prägt das Verhalten der Organisati-onsmitglieder nachhaltig. Was man sieht (hört,fühlt) korreliert derart auffallend mit den un-sichtbaren Vorstellungen, dass man die entspre-chenden performativen Praxen ein Bilden, Fin-den und Erfinden von Selbst- und Weltbildernnennen kann (Schürmann 2008). Bewusst ein-gesetzte Ästhetik ermutigt den Menschen zueiner Wahrnehmung von „Etwas-als-etwas-An-deres“. Dies gilt sowohl für die Makrostrukturender Organisation, deren Bedarfe sich als Hand-lungs- und Verhaltensraum mit Regeln undRollenprofilen artikulieren, als auch für die Mi-krostrukturen des einzelnen Menschens, bei demsie als Einstellung, als Haltung wirksam werden. Erklärbar sind nun sowohl die organisationalenStrukturen und Prozesse hinsichtlich ihrer Ver-änderungsbedürftigkeit und -fähigkeit als auchdie Verhaltensweisen und -alternativen der Be-teiligten selbst. So rahmt die Betrachtung einerOrganisation mit ästhetischen Mitteln im selbenMaße das, was darin der Fall ist, wie sie Spiel-räume eröffnet und Vorstellungen ermöglichtjenseits der „normativen Kraft des Faktischen“.
LiteraturAdorno, Th. W. (1974). Ästhetische Theorie. Frankfurt a. M.:Suhrkamp.Arens-Fischer, W., Renvert, E. & Ruping, B. (2010). Zur Bedeu tung der Ästhetik in der Analyse und der nachhal tigenGestaltung betrieblicher Arbeitskontexte. Tagungsband 56,Kongress der Gesellschaft für Arbeitswissenschaft 24. – 26.März 2010. Darmstadt.Boerner, S. (1994). Die Organisation zwischen offener und geschlossener Gesellschaft. Athen oder Sparta. Berlin: Duncker & Humblot.Böhle, F., Pfeiffer, S. & Sevsay-Tegethoff, N. (Hrsg., 2004). Die Bewältigung des Unplanbaren. Wiesbaden: VS.Gebert, D., Boerner, S. & Lanwehr, R. (2001). Innovations -förderliche Öffnungsprozesse: Je mehr desto besser? In: Die Betriebswirtschaft, 61 (2), 204 - 222.Gebert, D. (2004). Innovation durch Teamarbeit. Stuttgart:Kohlhammer.Pfeiffer, S. (2004). Arbeitsvermögen – Ein Schlüssel zur Analyse(reflexiver) Informatisierung, Wiesbaden: VS.Schürmann, E. (2008). Sehen als Praxis – Ethisch-ästhetischeStudien zum Verhältnis von Sicht und Einsicht. Frankfurt a. M.:Suhrkamp.
Wolfgang Arens-Fischer, Eva Renvert, Bernd Ruping
Die AutorenProf. Dr.-Ing. Wolfgang Arens-Fischer ist Leiterdes Departments für Duale Studiengänge derHochschule Osnabrück. Prof. Dr. Bernd Ruping ist Leiter des Institutes fürTheaterpädagogik der Hochschule Osnabrück. Eva Renvert ist wissenschaftliche Mitarbeiterindes Institutes für Theaterpädagogik der Hoch-schule Osnabrück. Kontakt: [email protected]
len Bewegungen. Die Ästhetik weist den Sinnenein Erkenntnisvermögen zu – quasi als „Schwes -ternkunst“ zur Logik der Vernunft. KünstlerischeZugriffsweisen werden zum Medium, auf sinn-liche Weise Erkenntnisse zu generieren. Das,was sich „in Wirklichkeit“ zeigt, wird über diekünstlerische Verfremdung oder Verdichtungder sensorischen Deprivation des Alltags entris-sen und zu einem Ereignis, dem der Impuls an-haftet, das Gewohnte neu zu betrachten. Als Theorie der Kunst gewinnt Ästhetik hier eineerweiterte Bedeutung, indem sie insistiert aufdie Begrenztheit des linear-logischen Denkensund ihm die Polyvalenz des künstlerischen Er-eignisses entgegenhält, das (als Text, als Klang,als Bild, als Szene) der Vernunft des Intentiona-len misstraut und auf Responsivität setzt: Wasdenn für wahr zu halten ist, bildet sich erst imSpannungsraum zwischen ästhetischer Be-hauptung und ihrer Rezeption, d.h. den Ant-worten aus dem Dafür- oder Dagegenhaltender Rezipienten (s. Abb. 1), nicht aber in ratio-naler Diskursivität oder Empirie. Das Nicht-der-Fall-Seiende zu denken, sei die „Nötigung zurÄsthetik“ (Adorno 1974).Betrachten wir Organisationen nach Maßgabedes Ästhetischen im weiteren Sinne, dann istunschwer erkennbar, dass es sich dabei in allerRegel um intentional gewirkte, geschlosseneFormen handelt. Darin wird, nach Maßgabe desökonomischen Kalküls, auf Sicherheit gespielt.Das Wagnis, diese geschlossenen Formen des Ge-stalteten zu öffnen, wird unter dem Aspekt derInnovativität seit längerem diskutiert (vgl. Ge-bert et al. 2001). Dabei wird der „geschlossenen“Struktur eine „offene“ gegenübergestellt, gleich -sam als zwei Pole eines Dualismus. Deren Zweckist zum einen die Öffnung der organisationalenWahrnehmbarkeit, d.h. die Erschließung derVeränderungsbedürftigkeit und Veränderungs-fähigkeit der Organisation durch ihre Mitglieder.Zum anderen soll die Befähigung zur Selbst-Ge -staltung im Inneren der Organisation befördertwerden (vgl. Boerner 1994; Gebert et al. 2001). Als dafür geeignet indiziert ist die „Balance“zwischen offener und geschlossener Struktur.Nicht die hundertprozentige Öffnung im Sinneeiner vollständigen Situationskontrolle durchden Einzelnen ist demnach für die Gestaltungs-kraft einer Organisation erfolgversprechend,sondern die „Vermittlung“ zwischen den Polen. Doch wie funktioniert die „Vermittlung“ im
Abb. 2: Die Ästhetische Dimension im Spannungs-feld von Sinnvermittlung und Sinnsuche (Arens-Fischer, Renvert & Ruping 2010)
betr.: „Nötigung zur Ästhetik“ (Theodor W. Adorno)
Eine ästhetische Behauptung formierenRituale der organisationalen Kommunikation und Interak-tion über künstlerische Eingriffe gegen den Strich bürsten,zu spitzen, bis zur Kenntlichkeit verfremden = sinnliche Erkenntnistätigkeit
Die Arbeit des Deutens moderierenSpannung zwischen der Realität der ästhetischen Bilder (Szenen, Texte, Töne usw.) und den herrschenden Hand-lungs- und Denk-Konventionen verteidigen = begriffliche Übersetzungsarbeit (entlang den Wider-sprüchen, Brüchen und Ungereimtheiten)
Den „Mantle of the Experts“ neu probierenfür die Mitglieder der Organisation: die Koordinaten der betrieblichen Selbstverständnisse auf die Probe stellen = Akzentuierung der ou-topischen Dimension(das, was sein könnte) für die Theaterpädagogen: die Koordinaten der künstleri-schen Selbstverständnisse auf die Probe stellen = Akzentuierung der topischen Dimension (das, was ist)
Die Ästhetische Dimension im Spannungsfeld von Sinnvermittlung und Sinnsuche
monovalent
zielorientiert
die Sinne ausrichtendErfahrungsräume definierend
geschlossene CI (Corporate Identity)als sinnliche Bestätigung des Gewohnten(topische Qualität ~ orientierend)= sinnliche Anrufung
positionierend:regulieren & entlastenfixieren & einübenglauben & beschwören= für wahr halten(Sinn als Besitz)
polyvalent
autotelisch
die Sinne aufschließendErfahrungsräume öffnend
Artistic Brand (offene CI)als sinnliche Verfremdung des Gewohnten(ou-topische Qualität ~„Etwas fehlt.“)= sinnliche Erkundung
dispositionierend:deregulieren & zutrauenauftauen & erprobenzweifeln & neu-nachdenken= wahrnehmen(Sinn als Ziel)
Abb. 1: Der Prozess der ästhetischen Reflexion
„geschlossene Formgebung“ „offene Formgebung“
Wahrnehmung, Gestaltung und Deutung durch die Sinneaisthanomai = ich nehme wahr (gr.)
Bedeutung und Funktion der Ästhetik zur Reflexion und Gestaltung betrieb -licher ArbeitskontexteWie selbstverständlich werden ästhetische Mit-tel genutzt, um eine ganzheitliche ästhetischeErfahrung im Sinne einer Corporate Identity(also einer Identität der Organisation) zu entwi -ckeln, in der das als faktisch Wahrgenommene,dazu Imaginierte und dabei Gefühlte integriertwerden kann. Geschieht dies nicht in einseitigerVerpflichtung des ästhetischen Instrumentari-
Ästhetik als Erkenntnisdisziplin – Rahmung künstlerischer ZugängeDas Ästhetische bezeichnet die durch die Sinnevermittelte Wahrnehmung und ihre Deutung,einschließlich der damit verknüpften emotiona-
+
=
1
2
3
11præview Nr. 1 | 201110
Bestrebungen zur Förderung vonInnovationen in Unternehmenrichten sich zumeist auf individu-elle Fähigkeiten oder die Organisa-tion. Kaum beachtet wird dabei,dass Innovationen in Arbeitspro-zessen entstehen. Die „Innovations-arbeit“ ist das Verbindungsgliedzwischen individuellen Fähigkeiteneinerseits und der Organisation vonInnovationsprozessen andererseits.Sie ist ein bisher nicht beachteter„Missing Link“.
InnovationsarbeitArbeit ist nach dem in Wissenschaft und Praxisvorherrschenden Verständnis ein zielgerichte-tes, planmäßig-rationales Handeln. Der Grund-satz „erst planen, dann ausführen“ ist jedoch beiInnovationsarbeit nicht anwendbar. Der kon-krete Verlauf und das Ergebnis sind offen undunbestimmt. Dies besagt nicht, dass bei Inno-vationsarbeit planmäßiges Vorgehen keine Rollespielt. Doch sieht man nur dies, werden Inno-vationen nicht gefördert, sondern gefährdet.Das FuE-Vorhaben KES-MI hat sich zum Ziel ge-setzt Innovationsarbeit genauer zu bestimmen.Dabei wurden drei besondere Elemente heraus-gearbeitet: das künstlerische, das erfahrungs-geleitete und das spielerische Handeln. Das Element des künstlerischen Handelns (vgl.den Artikel von Michael Brater in diesem Heft)macht darauf aufmerksam, dass Innovationsar-beit besondere subjektive Haltungen erfordert.Neues kann weder durch Routine noch durchäußeren Zwang entstehen. Es muss vielmehr –auch dann, wenn es als „äußere Anforderung“auftritt – zu einem „inneren Anliegen“ werden.Damit verbindet sich die grundsätzliche Offen-heit für Unbekanntes und hierauf bezogene In-spirationen aus der Umwelt. Und schließlichkommt es darauf an, nicht nur Erfolge, sondernauch Misserfolge als Inspiration zu nutzen. Das Element des erfahrungsgeleitet-subjekti-vierenden Arbeitshandelns (Böhle 2009, Böhleet al. 2004) zeigt, in welcher Weise bei Innova-tionsarbeit das Ergebnis erst durch das prakti-sche Handeln eruiert wird. Grundlegend hierfür
Innovationsarbeit und Innovationsprozess –künstlerisch, erfahrungsgeleitet, spielerischFritz Böhle, Markus Bürgermeister
ist ein exploratives und dialogisch-interaktivesVorgehen. Das „Neue“ entsteht demnach durchein schrittweises „Herantasten“, bei dem das je-weilige Ergebnis eines Arbeitsschrittes auf denweiteren Verlauf einwirkt und ihn beeinflusst.Ein Gegenstand oder ein Problem wird somitnicht einseitig „bearbeitet“; es entsteht viel-mehr ein „Dialog“, bei dem die Wirkungen deseigenen Handelns gerade auch Unerwartetesund Überraschendes auslösen. Um zu erkennen,welche Wirkungen und Möglichkeiten sich auseinem Arbeitsschritt ergeben, ist eine subtilesinnliche Wahrnehmung notwendig. Es müssen„Informationen“ wahrgenommen werden, dienicht exakt und eindeutig definiert sind und dienur durch ein besonderes Gespür wahrgenom-men werden können. Das „Erahnen“ einer mög-lichen Entwicklung spielt hier ebenso eine Rollewie die Entwicklung von „Vorstellungen“ überbisher noch Unbekanntes. Solche Wahrneh-mungen sind eng verbunden mit einem bildhaf-ten und assoziativen Denken. Das Element des spielerischen Handelns (Böhle2006) bezieht sich auf das empirisch oft beob-achtete Phänomen, dass Neues gerade dannentsteht, wenn dies nicht bewusst angestrebtwird. Dies resultiert weniger aus dem viel zitier-ten Zufall, sondern aus einer – zumeist unbe-wussten – Umdefinition der Arbeitssituation ineine Spielsituation. Ein Merkmal des Spiels ist,dass im Unterschied zur Arbeit kein außerhalbdes Spiels liegender Zweck angestrebt wird. Die-ser kann sich – wie beispielsweise bei den pä-dagogischen Wirkungen des kindlichen Spiels –ergeben, er ist aber nicht das Ziel der Spieler.Die Abwendung von „äußeren“ Ziel- und Zweck-setzungen bei gleichzeitiger Konzentration aufden Selbstzweck spielerischen Handelns macht
es möglich, Lösungswege auch ohne Erfolgsga-rantie „mit allem Ernst und Sachverstand“ zuverfolgen. Damit verbindet sich das für das Spielcharakteristische Eintauchen in einen „geschütz-ten Raum“. Und zugleich macht das Spiel daraufaufmerksam, dass Offenheit und Unbestimmt-heit nicht gleichbedeutend mit Regellosigkeitsind. Regeln müssen jedoch so angelegt sein,dass Offenheit und Unbestimmtheit nicht ver-hindert, sondern vielmehr als Anreiz und Anstoßfür selbstständiges Handeln wirksam werden. Innovationsarbeit ist in Forschung und Entwick-lung der Kern der Arbeit. Bei einem breiten Ver-ständnis von Innovation ist Innovationsarbeitaber auch ein Element aller Arbeitsbereiche. In-novationsarbeit gibt eine Antwort auf die Frage,„wie“ bei Innovationen gearbeitet wird. Die hierzukomplementäre Seite ist der Innovationsprozess.Er beschreibt, „was“ bei Innovationen geschieht.
InnovationsprozessIm Rahmen des betriebswirtschaftlich und in-genieurmäßig ausgerichteten Innovationsma-nagements werden vier Phasen von Innovati-onsprozessen unterschieden: Ursprungsidee,Forschung und Entwicklung, Einbringung in denMarkt, Durchsetzung im Markt. Der Innovati-onsprozess verläuft demnach in klar definierten,abgrenzbaren Phasen, auf die sich jeweils un-terschiedliche Instrumente der Planung, Steue-rung und Kontrolle beziehen können. Richtetman demgegenüber den Blick auf Grenzen derPlanung und betrachtet diese als substanziellesElement und Potenzial von Innovationsprozes-sen, ist eine solche Phasenaufteilung unzurei-chend. Erweiterungen sind für die Phasen Ur-sprungsidee sowie Forschung und Entwicklungnotwendig.
Die Impulse für Innovationenkönnen sich aus konkretenpraktischen Problemstellungenoder Visionen über zukünftigeEntwicklungen ergeben. DieIdeenfindung erfordert in bei-den Fällen jeweils unterschied-liche Vorgehensweisen undRes sourcen. Zugleich ist sieaber nur ein Teilaspekt. Ebensowichtig ist die Sammlung, Be -ur teilung und letztlich Aus-wahl der Ideen, die aufgegrif-fen und weiterverfolgt werden.
Fritz Böhle, Markus Bürgermeister
Dies kann zu Beginn eines Innovationsprozessesstattfinden oder auch erst in dessen Verlauf fol-gen. So können aufgrund nicht vorhersehbarerpraktischer Erfahrungen Entscheidungen revi-diert werden, oder endgültige Entscheidungenkönnen bewusst offen gehalten und vom prak-tischen Verlauf des Innovationsprozesses ab-hängig gemacht werden. An die Stelle einesline aren, phasenhaften Ablaufs treten damit re-kursive und parallel verlaufende Prozesse.Im Besonderen betrifft dies auch das Verhältniszwischen Forschung und Entwicklung. Im Pha-senmodell beinhaltet die Entwicklung die prak-tische Umsetzung von Forschungsergebnissen(z. B. Prototyp). In der Praxis enthält die Ent-wicklung jedoch ein eigenständiges Innovati-onspotenzial. Neue Problem- und Fragestellun-gen können auftauchen und zu eigenständigenLösungswegen sowie neuen Anforderungen andie Forschung führen. Aus dieser skizzenhaften Betrachtung von In-novationsprozessen lassen sich unterschiedlicheTypen von Innovationsarbeit ableiten. Sie kön-nen sich auf den Innovationsprozess insgesamtoder nur auf einzelne Elemente wie beispiels-weise Forschung oder Entwicklung beziehen.
Die AutorenProf. Dr. Fritz Böhle leitet den Bereich Sozio-ökonomie der Arbeits- und Berufswelt an derUniversität Augsburg.
Dr. Markus Bürgermeister ist wissenschaftli-cher Mitarbeiter im Bereich Sozioökonomieder Arbeits- und Berufswelt an der UniversitätAugsburg. Kontakt: [email protected]
LiteraturBöhle, F. (2009). Weder rationale Reflexion noch präreflexivePraktik. Erfahrungsgeleitet-subjektivierendes Handeln. InBöhle, F. & Weihrich, M. (Hrsg.): Handeln unter Unsicherheit (S. 203-230). Wiesbaden: VS.Böhle, F. (2006). High-Tech-Gespür. Spiel und Risiko in der er-fahrungsgeleiteten Anlagensteuerung. In Gebauer, G., Poser, S.,Schmidt, R. & Stern, M. (Hrsg.): Kalkuliertes Risiko. Technik, Spielund Sport an der Grenze (S. 249-267). Frankfurt a.M.: Campus.Böhle, F., Pfeiffer, S. & Sevsay-Tegethoff, N. (2004). Die Bewäl-tigung des Unplanbaren. Fachübergreifendes erfahrungs ge -leitetes Arbeiten und Lernen. Wiesbaden: VS.
KES-Innovationsarbeit – Handlungsdimensionen
KES-Innovationsarbeit – Handlungsdimensionen
Offenheit für Unbekanntes(„Möglichkeitssinn“, Inspiration im Prozess)
„Kreatives Scheitern“ und„Kreative Zerstörung“
Inneres Anliegen,persönlicher Ausdruck
Explorativ-entdeckendesVorgehen als schöpferischerProzess
Sinnliche Wahrnehmungund Imagination des Ver-wendungszusammenhangs
Erahnen (Gespür) der im ma -nenten Entwick lungs logik
Absichtslose Zwecker-reichung („Eintauchen“)
Emotional involviert ingeschütztem Raum
Offen und ungewissinner halb von Regeln
Künstlerisch Erfahrungsgeleitet Spielerisch
Subjektive Haltung Aktion Situationsdefinition
Situativ-experimentelles ProjektmanagementInnovationsprozesse werden heute überwie-gend projektförmig gestaltet, organisiert undumgesetzt. Projekte mit hohem Innovations-grad haben besondere Merkmale: æ Es wird zwar ein zeitlicher Horizont fixiert, die
genaue Terminierung wird jedoch zwischenden Projektpartnern abhängig vom Verlaufder einzelnen Projektphasen ausgehandelt.
æ Die Art des Vorgehens ist häufig unscharfund entsprechend wenig planbar.
æ Die Art der Steuerung muss ein hohes Maßan flexiblen Umorientierungen erlauben, umunterschiedliche und bei Projektbeginn kaumvorhersehbare Wege zum Innovationsziel of -fen zu halten.
æ Die Zielbestimmung gibt statt eines vorab klarumrissenen Ergebnisses einen Rahmen vor,dessen Präzisierung im Projektverlauf erfolgt.
Der Erfolg industrieller Innovationsprojektehängt entscheidend davon ab, die Potenzialeoffener und unbestimmter Situationen undProzesse zu nutzen und damit künstlerische, er-fahrungsgeleitete und spielerische Innovations-arbeit zu fördern. Ein situativ-experimentellesProjektmanagement ist hierauf eine Antwort. Inden Mittelpunkt rückt die offene Planung. Siegibt einen Rahmen vor, der durch das konkreteHandeln der am Projekt beteiligten Akteureausgefüllt wird. Ein wichtiges Prinzip ist, keineDenkverbote aufzustellen. Dies führt dazu, dassder Innovationsprozess nicht durch Pfadvorga-ben begrenzt ist und methodisch bisher nichtbekannte Wege beschritten werden können.Misserfolge werden von Seiten des Manage-ments nicht mit Schuldzuweisungen gegenüberden Beschäftigten verbunden, sondern explizitals Erkenntnisgewinn verbucht. Ein wichtigesElement der Projektsteuerung ist, Austausch-prozesse zwischen den beteiligten Akteuren zuorganisieren, in denen die Überzeugungskraftvon Argumenten statt der hierarchischen Stel-lung über die jeweils nächsten Schritte im Pro-jektverlauf entscheidet. Dabei sind Räume undGelegenheiten für einen informellen Austauschüber die jeweiligen Problem- und Fragestellun-
gen häufig sehr viel wichtiger als offizielle Sit-zungen. Darüber hinaus besteht eine zentraleAufgabe für das Projektmanagement darin, of-fene Strukturen zu schaffen. Dies bedeutet et -wa, Teilaufgaben für Mitarbeiter zu definierenund in einem bestimmten Rahmen zeitliche undinhaltliche Freiräume zu geben. Der Verzicht aufexplizite Vorgaben (Zielhierarchien, Messbarkeitaller Projektschritte u.a.) fördert die Begeiste-rung der Beschäftigten, Ideen zu entwickeln.Solche Prozesse sind weniger durch leitendeund stärker durch moderierende Aufgabenstel-lungen des Projektmanagements geprägt.
Agile Entwicklungsprozesse und kooperativer ErfahrungstransferMit den inzwischen weit verbreiteten agilenEntwicklungsprozessen sollen Kreativität, Selbst-verantwortung und Freude am Arbeitsplatzgeför dert werden. Für erfolgreiche Innovations-projekte sind darüber hinaus geeignete Rah-menbedingungen für den Austausch von Erfah-rungswissen erforderlich, das in weiten Teilenimpliziten Charakter aufweist. Dies kann miteiner in laufende Prozesse eingebetteten Formder erfahrungsgeleiteten Kommunikation, demsog. kooperativen Erfahrungstransfer, ermög-licht werden. Die Führung, Anleitung und Be-gleitung von all dem ist mehr mit Jonglierendenn Kontrollieren verbunden. Es geht um Fin-gerspitzengefühl für Unterstützungsbedarf undsinnvollen Freiraum für die Beteiligten, aberauch dessen Grenzen. Der Raum in den hier untersuchten Fällen be-steht aus Gelegenheitsstrukturen, die mit eini-gen Instrumenten für agile Entwicklungspro-zesse gefüllt sind: Auftakttreffen zu Beginneiner Entwicklung ebenso wie tägliche kurzeAbstimmungsrunden (Stand-up-Meetings) wäh-rend der Entwicklungszeit sind die ersten An-kerpunkte für beständige Kommunikation, beider Teilnehmerkreis und Dauer abgewogen wer-den. Weitere Kommunikationsankerpunkte sinddie Reflexionsrunden technischer Natur in Re-view Meetings nach jedem Entwicklungsab-schnitt oder Retrospective Meetings am Endeeines Projektes zur Entwicklungsdynamik ins-gesamt. Die Abschätzungen, die im Laufe des
Entwicklungsvorhabens notwendig sind, wer-den beispielsweise mit Estimation Poker spiele-risch ermittelt. Die an einer Entwicklungsauf-gabe beteiligten Mitarbeiter geben auf denKarten Einschätzungen zu ihrem persönlichenArbeitsaufwand. Das „Kartenlegen“ dient zurEinschätzung über den Aufwand des Gesamt-projektes und zudem als Stimulus für den Wis-sensaustausch. Für den Wissensaustausch istferner ein Kooperationsmodell wie die Paarpro-grammierung sehr hilfreich: Hier sitzen zweiEntwickler gleichberechtigt an einem Rechnerund arbeiten gemeinsam an einer Aufgabe. Da-durch werden ein Lernen beim gemeinsamenTun und die aktive Verschränkung der Wissens-welten mit einem konkreten Bezug auf dasArbeits ergebnis – also ein kooperativer Erfah-rungstransfer – möglich. Ausbaufähig sind die -se Ansätze durch weitere personalpolitische undarbeitsbezogene Kooperationsmodelle wie z. B.das Tandemmodell: Hier werden die Wissens-welten je eines Mitarbeiters aus dem Soft- unddem Hardwarebereich miteinander verbunden.
Entscheidungen im laufenden ArbeitsprozessEntscheidungen im Innovationsprozess sindimmer mit Unsicherheit behaftet. Diese kanndadurch bewältigt werden, dass Entscheidun-gen „handelnd“ im laufenden Arbeitsprozessgetroffen werden. Vor allem bei inkrementellenProduktinnovationen, Veränderungen im Ferti-gungsprozess oder Arbeitsprozessoptimierun-gen fallen Entscheidungen oft vor Ort in derFertigung und im Produktionsprozess, nicht indavon abgetrennten Bereichen (wie etwa in derEntwicklung oder in Planungsmeetings). Sokommen beispielsweise Fertigungsmitarbeiterdurch konkretes Ausprobieren auf Ideen, dieeinem Ingenieur am Bildschirm nicht zugäng-lich sind. Die Entscheidung für oder gegen eineVeränderung fällt in der direkten Auseinander-setzung mit dem Material und der Zusammen-setzung der einzelnen Produktkomponenten. Inder Zusammenarbeit von technischem Büround Fertigung wird nicht immer „nur“ zuerstgeplant und dann die Praxis verändert, auch dasGegenteil ist der Fall: Die technischen Zeichner
kommen in die Fertigung und profitieren vonder praktischen Expertise der dortigen Mitar-beiter – man begibt sich gemeinsam auf die Su -che nach neuen Möglichkeiten am Produkt unddie planerische Zeichnung richtet sich nach derpraktischen Umsetzung, nicht umgekehrt. Entscheiden im laufenden Arbeitsprozess spieltsich vor allem im nicht-formalisierten odernicht-formalisierbaren Bereich ab und setzt einspezifisches Management des Informellen voraus.Die Aufgabe des Managements ist es zum einen,arbeitsorganisatorische Voraussetzungen fürEntscheidungen im laufenden Arbeitsprozess zuschaffen: durch die Förderung und die tatsäch-liche Delegation von Entscheidungskompeten-zen, durch die organisatorische Verankerungvon Gelegenheitsstrukturen für informelle Ko-operation und direkte Interaktion über Abtei-lungsgrenzen hinweg, durch das Einrichten von„Zonen der Ungestörtheit“ und angemessenenZeitkontingenten für die Suche nach alternati-ven Ideen. Zum anderen ist es die Aufgabe desManagements, Entscheidungen im laufendenProzess zu legitimieren. Wesentlich dafür sinddas aktive Aufgreifen der praktisch gefundenenLösungswege, die Wertschätzung informellerKooperation und Kommunikation und das Ver-trauen in das Erfahrungswissen der Mitarbeiter.
Die AutorenDr. Eckhard Heidling ist Wissenschaftler amInstitut für Sozialwissenschaftliche Forschung(ISF München).
Judith Neumer und Dr. Stephanie Porschensind Wissenschaftlerinnen am ISF München. Kontakt: [email protected]
LiteraturBöhle, F., Bolte, A., Bürgermeister, M., Heidling, E., Neumer, J. &Porschen, S. (2010). Mitarbeiter als Manager des Informellen.In Jacobsen, H. & Schallock, B. (Hrsg.): Innovationsstrategienjenseits traditionellen Managements (S. 378-388). Stuttgart:Fraunhofer Verlag.
13præview Nr. 1 | 201112
Eckhard Heidling, Judith Neumer, Stephanie Porschen
Künstlerische, erfahrungsgeleitete und spielerische Inno vations -
arbeit kann sich in Innovationsprozessen nur dann produktiv
entfalten, wenn die Formali sierung von Abläufen und Prozessen
begrenzt wird. Notwendig ist ein Management des Informellen.
Im Projekt KES-MI wurden hierzu unterschiedliche Gestaltungs -
ansätze entwickelt.
Organisation von Innovation –Management des InformellenEckhard Heidling, Judith Neumer, Stephanie Porschen
„Kreativ“ nennt man jemanden, der einfallsreichist, neue Ideen hat, auf originelle Gedankenkommt, der Ungewöhnliches, Innovatives tunund denken kann, und man scheint sich still-schweigend einig zu sein, dass es sich dabei umeine persönliche Eigenschaft handelt, die je-mand (mehr oder weniger stark) hat oder ebennicht hat. Im Rahmen des Projektes „Dienstleis-tung als Kunst“ hatten wir Gelegenheit, Men-schen zu interviewen, die zweifellos zu denganz besonders „Kreativen“ gehören, nämlichprofessionelle Künstler verschiedenster Kunst-richtungen. Wir wollten von ihnen wissen, wiesie vorgehen, wenn sie ein Kunstwerk erschaf-fen (oder inszenieren oder aufführen usw.). Wirwollten herausfinden, ob es so etwas wie eincharakteristisches „künstlerisches Vorgehen“ gibt,eine „künstlerische“ Weise des Handelns, die zu„kreativen“ Ergebnissen führt, also zu etwas nieDagewesenem, zu Kunstwerken eben.Diese Frage löste bei vielen Künstlern erst einmalUnbehagen aus. Denn natürlich hat jeder seinenpersönlichen Stil, seinen ganz eigenen Weg, undden pflegt er auch als Unterscheidungsmerkmalzu seinen Kollegen. Und in der Tat, es ist schwer,sich vorzustellen, dass sich im blutrünstigenVorgehen etwa von Matthew Barney und dersubtilen Landart von Andy Goldsworthy Ge-meinsamkeiten finden lassen. Zwar nennen sichbeide Künstler und bringen auch nach allge-meiner Überzeugung „Kunst“ hervor, aber dafürgibt es in der Gegenwart gerade keine übergrei-fenden Kriterien, Regeln oder Anforderungen.In klarer Abgrenzung zur kunsthistorischen Fra-gerichtung interessierte uns nun gerade nicht,was Barney zu Barney macht, also das Indivi-duelle und Besondere seines Stils „im Unter-schied“ zu dem von Goldsworthy. Sondern wirwollten umgekehrt wissen, ob sich hinter diesenoffenkundigen und augenfälligen Verschieden-heiten so etwas wie ein gemeinsames Musterdes „künstlerischen Handelns“ jenseits des Vor-gehens einzelner Künstler identifizieren lässt.Wir führten zwölf explorative Interviews, die wirnach den methodischen Schritten der „Groun-ded Theory“ analysierten, immer orientiert ander Frage: Lassen sich in der offenkundigen Ver-schiedenheit übergreifende Strukturen des Han-delns finden? Hier zusammengefasst die wich-tigsten Ergebnisse:
æWenn Künstler beginnen, wissen sie nicht,was dabei herauskommen wird. Sie habenkeine klare Vorstellung vom Ergebnis und kei-nen fertigen Plan. Sie lassen sich auf eine of-fene, unbestimmte Situation ein und kennenweder das Ziel noch den Weg. Und sollten siedoch eine Vorstellung haben, kann sie sichnoch vielfach ändern, bleibt sie offen fürÜberraschungen. Der Maler Gerhard Richtersagt das so: „Ich (...) möchte am Ende ein Bilderhalten, das ich gar nicht geplant hatte (...)
Wie Künstler vorgehenDas Konzept des künstlerischen Handelns
Michael Brater
15præview Nr. 1 | 201114
„Kreative“ Mitarbeiter zu haben, ist heute für
jedes Unternehmen ein wichtiger Erfolgsfaktor;
unter den Bedingungen der „Wissensökonomie“
angeblich sogar der entscheidende, denn hier
verschaffen allein die Mitarbeiter mit ihrem
Können, ihrer Motivation und ihrer „Kreativität“
dem Unternehmen die entscheidenden Wett -
bewerbsvorteile (Gorz 2004).
ich möchte ja gern etwas Interessanteres er-halten als das, was ich mir ausdenken kann“.
æAber dennoch bringen Künstler in ihre Arbeitein persönliches Interesse, eigene Fragen undMotive, eigene Ideen ein. Die sind allerdingsnicht klar umrissen, eher eine Stimmung, eineAhnung im Unbekannten. Es kann auch sein,dass äußere Anlässe oder das Material die Auf -merksamkeit oder das Interesse wecken. Jeden -falls sind Künstler immer persönlich beteiligt.
æEine Möglichkeit, ohne klares Ziel, ohne ein-deutige Orientierung vorzugehen ist: zu spie-len. Manche Künstler probieren im Materialetwas ohne Absicht aus und beobachten, waspassiert. Sie machen etwas damit, betrachtenes, verfolgen, was sich ändert, und lernen soihr Material gründlich kennen. Das Vorgehenbleibt dabei offen und unbestimmt, es kannjederzeit noch alles anders werden.
æDazu gehört der ständige, konsequente Wech -sel von Tun und Wahrnehmen der Folgen die-ses Tuns. Daraus ergeben sich neue Möglich-keiten, aus ihnen wiederum neue Fragen undein neuer Eingriff ins Material. Dieser Prozesshat immer noch kein Ziel, aber er trägt sichgewissermaßen selbst, wie ein Forschungspro-zess, bei dem sich aus jeder Antwort immerwieder neue Fragen und Möglichkeiten erge-ben. Es entfaltet sich ein Dialog zwischen demKünstler und seinem Material. Das Materialarbeitet mit.
æDie Wahrnehmung ist nicht nur „objektbezo-gen“, sondern sie ist erweitert um die Dimen-sion emotionaler und Stimmungs-Qualitäten,um das „Spüren“, um die Wahrnehmung von„Ausdruck“, von „Atmosphäre“ (Böhme 2001).
æAus dieser offenen, spielerischen Auseinan-dersetzung mit dem Material, aus dem wa-chen, aufmerksam gespannten „Herumpro-bieren“ kann – meist plötzlich – dem Künstleretwas entgegenkommen, das sein Interesseweckt, das ihn fasziniert, „anspringt“, an demer dranbleiben will, dem er zumindest einStück weit folgt. Damit hat sich aus dem of-fenen Prozess eine Art Ziel, zumindest eineSpur, eine Intention ergeben, die jetzt dasweitere Vorgehen leitet und strukturiert.
æDieser Augenblick kann eintreten, muss abernicht. Er lässt sich nicht herbeizwingen. Kommter nicht, kann der Künstler in eine Krise rut-schen. Die Krise gehört zum Künstlersein of-fenbar dazu. Sie kann auch eintreten, wennman glaubt, jenen Augenblick der Faszinationerlebt zu haben – um einige (mitunter län-gere) Zeit später zu bemerken, „dass es dasnicht war“: Die gefundene Idee trägt nicht,wird langweilig, schal. Oder es ist Krise, weilman nicht mehr weiter weiß, sich tot fühlt.Manche meinen auch: Die Krise kommt, weilsie merken, dass sie einer Idee nachgelaufensind, die mit ihrem ursprünglichen Motiv beigenauerem Hinsehen gar nichts zu tun hat.
æDie Krise kann länger dauern oder kürzer. Zuihrer Überwindung gibt es kein Rezept. DerKünstler leidet. Aber er weiß: Wenn er aufgibt,kann er die Krise nie lösen. Also macht er wei-ter. Manchmal kommen ihm Zufälle zu Hilfe.Jedenfalls muss er es schaffen, sein angefan-genes Werk mit ganz anderen, völlig neuenAugen zu sehen. Er muss mit dem Suchen auf -hören und sich für das Finden öffnen (Picasso).
æVon Spielen kann nun keine Rede mehr sein.Kunst ist jetzt die Arbeit, die Fülle des Wahr-genommenen zu sichten, zu verdichten, sichzu entscheiden und immer wieder dialogisch-explorativ wahrzunehmen, was sich zeigt.
æDabei kann – wiederum nicht: muss – dasMa terial transparent, zum „Bild“ werden füreinen ideellen Zusammenhang, es kann übersich hinausweisen auf etwas, das dem Künst-ler wichtig ist, das er selbst daran vielleichtentdeckt. Manchmal bemerkt er, dass das, wasentstanden ist, mit seinen ursprünglichen Fra-gen und Motiven im Zusammenhang steht.Vielleicht betrachtet er aber sein „Werk“ auchnur und stellt fest, dass es so „stimmt“, dasses fertig ist.
Dieses künstlerische Handlungsmuster als Wegzum Neuen und Originellen zeigt, dass Kreati-vität keine persönliche Eigenschaft, keine Fragedes individuellen Einfallsreichtums ist, sonderndass es durchaus so etwas wie ein Muster krea-tiven Handelns gibt. Dazu muss man sich aufoffene, unbestimmte Situationen einlassen undsie aushalten, weil man nur so das überwindenkann, was es schon gibt. Die Lösung liegt nichtin dem, was man sich ausdenkt, sondern indem, was im (spielerischen) Handeln am Mate-rial wahrgenommen werden kann, wenn mansich dem Unbestimmten, Ungewissen aussetzt,Krisen aushält und so lange ohne willkürlicheVorstellungen wartet, bis „das Material spricht“.Dann aber muss man zuhören.Das künstlerische Handlungsmuster kann nichtnur erhellen, wie Mitarbeiter „kreativ“ und „in-novativ“ handeln können. Es zeigt auch, wieman unter Unsicherheit und Ungewissheit –Kennzeichen postmoderner Gesellschaften –handlungsfähig bleiben kann. Wie es möglichist, offene Situationen zu bewältigen und sichauf den Wandel einzulassen.
Der AutorProf. Dr. Michael Brater leitet das InstitutKunst im Dialog an der Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft in Alfter bei Bonn. Kontakt: [email protected]
LiteraturBöhme, G. (2001). Aisthetik. München: Wilhelm Fink.Gorz, A. (2004). Wissen, Wert und Kapital. Zürich: Rotpunktverlag.
Kunst ist die Arbeit, die Fülle des
Wahrgenommenen zu sichten, zu
verdichten, sich zu entscheiden und
immer wieder dialogisch-explorativ
wahrzunehmen, was sich zeigt.
17præview Nr. 1 | 201116
Eine unentschlossene Kundin kommt in ein Rei-sebüro und möchte „irgendwo ans Meer“ reisen.Bisher wurden ihr bei ähnlichen Anfragen übli-cherweise nach einigen Fragen zu den Rahmen-bedingungen erste Vorschläge zur Entscheidungvorgelegt. Im aktuellen Fall aber ist es anders:Sie kann gar nicht genau sagen, woran es liegt,dass sie sich diesmal „atmosphärisch“ besserverstanden und aufgehoben fühlt. Einige Spu-ren werden ihr aber deutlich. So macht ihr derDienstleister des Reisebüros erst einmal garkeine Vorschläge. Er versucht stattdessen, imausführlichen Gespräch mit ihr genau zu ver-stehen, worum es ihr geht, welche Vorlieben siehat, welche guten bzw. schlechten Erfahrungensie mit früheren Reisen gemacht hat, welchenBezug sie zu unterschiedlichen Reisezielen hat.Kurz, er versucht gemeinsam mit ihr ihrem An-liegen genauer auf die Spur zu kommen und einBild davon zu entwickeln, welchen „Sinn“ derUrlaub über den Erholungseffekt hinaus für siehat. Außerdem wird ihm in diesem Prozessdeutlich, wie die Kundin „tickt“. Natürlich klärter auch die Rahmenbedingungen der Reise. Au-ßerdem setzt er Signale, die der Kundin das Ge-fühl geben, auf gleicher Augenhöhe mit ihm zukommunizieren. So dreht er beispielsweise denMonitor seines PCs so, dass er gemeinsam mitder Kundin darauf schauen kann. Er gibt fernerder Kundin zu verstehen, dass es ihm nicht aufeinen schnellen Abschluss ankommt, sondern
Dienstleistung – die Kunst Kunden zu verstehenClaudia Munz, Elisa Hartmann, Jost Wagner
darauf, die Kundin wirklich zufriedenzustellen.Nachdem sich im ersten Anlauf noch keineüberzeugende Lösung zeigt, schlägt er vor, dieKundin solle die Sache noch einmal überschla-fen, zu Hause im Internet selbst ein wenig „he-rumspielen“ und darauf achten, was ihr dabeigefällt, welche Richtungen für sie denkbar sind.Beim nächsten Besuch haben sich die Wünscheder Kundin konkretisiert. Sie selbst schlägt vor,doch mal der Idee „Mallorca“ näherzutreten.Der Dienstleister erwidert, daran habe er auchschon gedacht, sei sich aber nicht sicher gewe-sen, ob die Kundin dagegen Vorbehalte habe.Nun prüfen beide diese Idee und gestalten siedann gemeinsam aus; der Dienstleister bringtdabei anschaulich seine eigenen Erfahrungenmit verschiedenen Hotels ein, spiegelt der Kun-din, wie er ihr Anliegen verstanden hat und wieer sie und ihre Vorlieben einschätzt. Am Endefinden beide gemeinsam eine die Kundin über-zeugende Lösung.Betrachtet man dieses Beispiel eines Dienstleis-tungsprozesses nur vom Ergebnis her, ist es un-spektakulär und konventionell. Die entscheiden -de „andere“ Qualität liegt hier in der Prozess-und Beziehungsqualität, die durch eine bestimmteHaltung, Vorgehensweise und „handwerklich-technische“ Umsetzung des Dienstleisters mög-lich wird und die wir – in Anlehnung an das Vor -gehen von Künstlern – „Dienstleistung als Kunst“nennen. Bei diesem Ansatz, der im Verbundpro-
jekt „Dienstleistung als Kunst – Wege zu inno-vativer und professioneller Dienstleistungsar-beit (KunDien)“ sowohl theoretisch wie prak-tisch entwickelt wird, handelt es sich um eineradikal individualisierende Vorgehensweise, diesich auf einen offenen Prozess mit dem Kundeneinlässt, um dadurch eine nur für genau diesenKunden passende Lösung zu finden. Dies birgteinerseits große Chancen, die Dienstleistungs-qualität zu steigern und die weit verbreiteteKundensehnsucht nach wirklichem Wahr- undErnstgenommenwerden zu erfüllen. Anderer-seits ist uns bewusst, dass es durchaus Kunden-anliegen gibt, die mit stärker standardisierbarenLösungen befriedigt werden können. Wie Dienstleistungsarbeit genau zu definierenist und worin ihre Besonderheiten gegenüberder klassischen Produktionsarbeit liegen, lässtsich aufgrund der Vielfältigkeit von Dienstleis-tungen nur schwer auf einer allgemeinen Ebenebeantworten. Wir sprechen daher vom „Dienst-leistungscharakter“ von Arbeit und gehen dabeivom Modell eines Kontinuums aus: Der Dienst-leistungscharakter von Arbeit steigt, je wenigerdas Ergebnis der Leistung vorab zu definierenist, je offen prozesshafter die Leistungserbrin-gung vonstattengeht und je mehr das Gelingender Dienstleistung auf das aktive Mitwirken desKunden angewiesen ist. Je „dienstleistungshaf-ter“ sich also eine Kundensituation darstellt,desto „künstlerischer“ müssen Dienstleister vor-gehen können.
In erster Linie ist dabei die veränderte künstle-rische Haltung der Dienstleister entscheidend. æ Sie haben den Mut, sich auf Ungewissheit
einzulassen und die Überzeugung, dass derDienstleistungsprozess als offener Prozessanzulegen ist, der nur gemeinsam mit demKunden gelingt.
æ Sie handeln aus der Gewissheit, dass es nichtin erster Linie darum geht, schnelle Lösungenzu suchen, sondern das Kundenanliegen op-timal so zu klären, dass sich die angemesseneLösung „zeigt“.
æ Sie verzichten auf einen exklusiven Exper-tenstatus.
æ Sie vertreten einen eigenen Qualitätsan-spruch und verstehen sich nicht als Expertenfür die Ausführung von Kundenwünschen,sondern als Partner eines „Arbeitsbündnisses“mit dem Kunden.
æ Sie sind davon überzeugt, dass eine langfris-tige Kundenbindung Vorrang vor kurzfristi-gen ökonomischen Interessen hat.
„Dienstleistungskünstler“ wenden darüber hi-naus eine spezifische künstlerische Vorgehens-weise an.æ Sie sichern die Bereitschaft und Fähigkeit
ihrer Kunden zur gleichberechtigten Mitwir-kung im Dienstleistungsprozess bzw. stellendiese ggfs. durch „Professionalisierung“ derKunden her.
æ Sie achten auf den „Gesamt-Ausdruck“ ihrerKunden, d.h. sie nehmen mehr als nur derenverbale Botschaften wahr, sie vollziehen spü-rend mit, was sich bei den Kunden zeigt.
Claudia Munz, Elisa Hartmann, Jost Wagner
æ Sie halten den gemeinsamen Entwicklungs-prozess in Bewegung – sie sind Experten derProzess- und Beziehungsgestaltung.
æ Sie sind „Atmosphärengestalter“ und sorgenfür ein partnerschaftliches, vertrauenschaf-fendes Klima.
æ Sie vermeiden vorschnelle Schlussfolgerun-gen und Lösungsangebote und halten denProzess so lange wie nötig offen.
æ Sie setzen Impulse und nehmen die Reaktionihrer Kunden darauf genau wahr.
æ Sie greifen geistesgegenwärtig sich im Pro-zess zeigende Impulse auf.
æ Sie lassen „Krisen“ im Prozess zu und befra-gen diese auf ihren produktiven Beitrag.
Damit ihnen dies gelingt, verfügen „Dienstleis-tungskünstler“ über Techniken nondirektiverProzesssteuerung, umfassende Wahrnehmungs-fähigkeiten, Techniken der Gesprächsführung,sie sprechen die Sprache der Kunden, könnenihnen Lösungsvarianten anschaulich darstellen,wissen, wie sie den Kunden den gesamten Pro-zess transparent machen und sie können kon-struktiv mit (Interessens-)Konflikten umgehen. Für die Realisierung einer derartigen „künstle-rischen“ Dienstleistungsarbeit sind drei Bedin-gungen unerlässlich:æ Die souveräne Beherrschung der fachspezi-
fischen Seite muss selbstverständliche Basissein – erst wer sich sicher fühlt, kann freihandeln.
æ Die Rahmenbedingungen – sowohl von Seitendes Dienstleistungsunternehmens wie desKunden – müssen Offenheit ermöglichen.
æ Die Art der Kundenanfrage muss so beschaf-fen sein – oder so geöffnet werden –, dasssie tatsächlich einen offenen Prozess und In-terpretations- und Handlungsspielräume er-laubt.
Dies aber bedeutet in der Konsequenz eine ge-waltige Veränderung der bisher vorherrschen-den Art von Dienstleistungsarbeit: Eine rigidekurzfristig-ökonomische Ausrichtung mit z. B.betrieblichen Umsatzvorgaben sowie zu geringeVerantwortungsspielräume der Dienstleisten-den konterkarieren das Ziel künstlerischer Dienst -leistung. Diese jedoch hilft gerade den langfris-tigen ökonomischen Erfolg zu sichern, weil einedauerhafte Kundenbindung erreicht wird unddie Weiterempfehlung durch zufriedene Kun-den die beste Werbestrategie darstellt.
Dafür lohnt es sich, für den Erwerb der Kompe-tenzen für Dienstleistung als Kunst neue Wegein der Aus- und Weiterbildung zu gehen.
Die AutorenClaudia Munz, Elisa Hartmann und Jost Wagner sind Mitarbeiter/innen des Vereins fürAusbildungsforschung und BerufsentwicklungMünchen (VAB e.V.). Kontakt: [email protected]
præview: Welche Rolle spielt Kunst in der Aus-bildung bei dm?Weiß: Zentrales Element unserer Ausbildung istdas sogenannte Abenteuer Kultur, ein Theater-Workshop, in dem unsere Lehrlinge unter derAnleitung von erfahrenen Schauspielern, Re-gisseuren und Theaterpädagogen ein Stückentwickeln und aufführen. Ausgangspunkt beider Entwicklung dieses Ausbildungsbausteinswar die Frage, was die Kunst vor dem Hinter-grund der Herausforderungen und Problemedes Jugendalters leisten kann. Es war ein Expe-riment, wir haben den Schauspielern keine Vor-gaben gemacht, sondern sie einfach mit denjungen Menschen arbeiten lassen. Und wirwaren sehr begeistert über das Ergebnis, dennes hat sich herausgestellt, dass gerade für diebiografische Phase des Jugendalters im Thea-terspielen ganz viel drin steckt. Die Auseinan-dersetzung mit einer Rolle, die scheinbar erstmal ganz fremd ist und an der man dann plötz-lich ganz viel über sich selbst lernen, neue Sei-ten an sich entdecken kann. Aber auch das Ler-nen im sozialen Miteinander. Damit ein Stückauf die Bühne kommen kann, müssen die Lehr-linge zusammenarbeiten. Es ist nicht etwas,was sie sich als Fertigprodukt im Fernsehen an-schauen, sondern jeder Einzelne muss sich ein-bringen, damit nachher etwas entsteht, das an-dere sehen können. Die jungen Menschen erleben: Es kommt aufmich an! Ich muss mitkriegen, wann mein Ein-satz ist, wann ich auftreten und wieder abtre-ten muss. Und ich muss mich gleichzeitig somit den anderen verbinden, dass ein Gesamt-bild entsteht. Das ist besser als jedes Teament-wicklungsseminar. Auch weil Theater ja einesehr unmittelbare Kunstform ist: Ich mussmich mit meinem Körper einbringen, es stehtkein Instrument dazwischen, da bin nur ich, derin die Rol le geht und dieser Ausdruck verleiht.Und das ist gerade für Jugendliche sehr wich-tig: zu üben, wie sie sich ausdrücken können,wie sie das, was in ihnen vorgeht, in Worte undAusdruck fassen können. Zehn Jahre gibt esnun schon Abenteuer Kultur und es ist einesder nachhaltigsten Lernprojekte, die ich über-haupt kenne.
Durch Kunst kann man lernen: Es kommt auf mich an!Gespräch mit Helga Weiß, dm drogerie markt, Bereichsverantwortlichefür Aus- und Weiterbildung
præview: Die Lerneffekte, die Sie nennen, sindja vor allem jugendpädagogischer Natur. Inwie-fern stehen diese denn in Zusammenhang mitder Vorbereitung auf die Arbeit in einem Dienst -leistungsunternehmen wie dm?Weiß: Dienstleistung ist in erster Linie Dienstam Menschen. Natürlich, wir verkaufen Droge-rieartikel, aber für wen tun wir dies letztend-lich? Nicht für uns, sondern für die Kunden. DieBegegnung mit dem Kunden steht daher füruns im Zentrum unserer Arbeit. Diese willimmer wieder neu gestaltet werden. Das fängtschon bei der Frage an, mit welchem Gesicht,also welchem Ausdruck ich durch den Ladengehe – der Kunde nimmt das wahr. Oder aberwie ich reagiere, wenn mich ein Kunde an-spricht. Kann ich mich ausdrücken? Oder er-greife ich die Flucht, weil ich Angst habe, michmit ihm zu unterhalten? Ich glaube, was dmvon anderen Dienstleistungsunternehmen un-terscheidet, ist genau das: dass sich unsere Kol-leginnen und Kollegen in den Filialen der Be-gegnung mit dem Kunden jeden Tag immerwieder neu und vielfach stellen – und dabei er-leben: Es kommt auf mich an! Und auf dieseBegegnung bereiten die Erfahrungen des Thea-terspielens ja gerade vor: dass man lernt, sichaus- zudrücken, zu kommunizieren. Aber auch,sich selbst und andere genau und bewusstwahrzunehmen. Wenn der Kunde erlebt, dasser wahrgenommen wird, schafft das schon eineganz andere Form der Beziehung. Die Kundenkommen nicht zu uns wegen unserer Preiseoder einer besonderen Zahnpasta, sondern weilunsere Dienstleistung eine bestimmte Form derBeziehung zum Kunden ist.
præview: Was verstehen Sie vor diesem Hinter-grund unter einer guten Dienstleistung?Weiß: Also auf jeden Fall nicht, dass der KundeKönig ist. Wir rollen keinen roten Teppich ausund machen keinen Bückling. Gute Dienstleis-tung bedeutet, eine Partnerschaft mit demKun den auf gleicher Augenhöhe einzugehen, ineinen Dialog zu treten. Wir gehen auch nichtauf jeden Kundenwunsch ein – auch wenn wiretwa mit dem Verkauf von Zigaretten und Sil-vesterknallern viel Geld verdienen könnten,
præview: Sie beschäftigen ja jedes Jahr Hun-derte von Schauspielern bundesweit. Rechnetsich dieser Aufwand denn überhaupt?Weiß: Wir bekommen immer wieder Besuchvon anderen Unternehmen, denen wir Aben-teuer Kultur vorstellen. Als eine der ersten Fra-gen kommt immer die nach den Kosten unddem Nutzen. Und die Gäste sind dann immersehr überrascht, wenn ich antworte: „Ich kannIhnen genau sagen, was uns das Ganze kostet,ich kann Ihnen aber nicht sagen, was es bringt.“Denn die individuellen Lernergebnisse lassensich nicht messen und wiegen. Die Entschei-dung Abenteuer Kultur einzusetzen, entziehtsich der klassischen Controlling-Logik. Es istvielmehr eine unternehmerische Frage: Wir sindüberzeugt, dass sich dieses Investment in diePersönlichkeitsbildung unserer Mitarbeiterinnenund Mitarbeiter lohnt, auch wenn wir das nichtmit Zahlen belegen können.
præview: Setzen Sie auch in anderen BereichenKunst als Bildungsmittel ein? Weiß: Momentan sind wir in einer Phase, in derganz viele unserer jungen Filialleiter selbst anAbenteuer Kultur teilgenommen haben und sa -gen „Das hat mir so viel gebracht, ich will mehrvon diesen Erfahrungen machen können“. Da -her sind wir gerade stark auf der Suche, wieman die künstlerische Arbeit auch stärker in derWeiterbildung von Erwachsenen einsetzen kann.Wir haben viele Fragen im Unternehmen, dieuns intensiv beschäftigen. Führungsfragen, Fra-gen nach dem Verhältnis von Individualität undGemeinschaft, Fragen nach dem Selbstver -ständ nis, ja der Rolle unserer Mitarbeiterinnenund Mitarbeiter. Und da sind wir auf der Suchenach den Kunstarten und -formen, die hier an-gemessen und weiterführend sind.
Helga Weiß arbeitet seit 1973 bei dm drogeriemarkt, zunächst in Filialverantwortung, späterim Außendienst und anschließend im BereichMarketing und Beschäftigung. Seit 1999 ist sie Bereichsverantwortliche fürAus- und Weiter bildung bei dm. Das Interview führten Michael Brater und Jost Wagner.
sondern wir treten mit dem Kunden in einenAustausch, in einen Dialog, etwa in Form vonKundenforen. Und wir fragen uns auf der an-deren Seite immer wieder: Was ist unser Anlie-gen? Worum geht es uns eigentlich? Was er -leben wir als stimmig? Und was eben nicht!Dienstleistung bedeutet für uns eben nicht zudienern, sondern den Dienst zu leisten, den wirals Arbeitsgemeinschaft auch leisten wollen.
præview: Könnte man die dafür notwendigenFähigkeiten nicht auch einfach in einem Kom-munikations- oder Verkaufstraining lernen? Weiß: Diese Trainings können schnell den Cha-rakter einer Dressur bekommen. Da lernt manirgendwelche abstrakten Regeln, aber nichtsüber sich selbst. Wir verlangen von unserenMitarbeiterinnen und Mitarbeitern ja nicht,sich nach vorgegebenen Mustern zu verhalten,etwa immer ständig zu lächeln, sondern siesollen ihren authentischen Weg finden, mit denKunden umzugehen. Deswegen spielen wir beiAben teuer Kultur nicht einfach Shakespeareoder Goethe rauf und runter, sondern jedeGruppe von Lehrlingen findet für sich indivi-duell immer ihr Thema, findet ihr Stück undfindet ihre Texte – und das kann Goethe sein,das kann aber auch ein moderner Literat oderein Songtext sein. Gleichzeitig gibt es auchkeine allgemeinen und vorgegebenen Lernziele,sondern jeder Teilnehmer durchläuft seinenganz individuellen Lernprozess, nimmt etwasanderes aus der künstlerischen Arbeit mit:Einer lernt vielleicht, dass er sich viel besserausdrücken kann als er dachte, und der anderekann sich wieder besser körperlich bewegen –was auch immer. Das ist hoch individuell unddas ist immer persönlich! Beim Verhaltenstraining würde ich lernen: Hebeden rechten Arm auf diese und jene Art, weildas sympathisch macht, und wenn Du dich sohinstellst, macht das unsympathisch. Aber dashat nichts mit dem Menschen und seinerPersön lich keit zu tun. Der Unterschied zwischenVer hal tens trainings und selbstentdeckendem,selbstentwickelndem Lernen ist genau der: Imkünstleri schen Tun kann ich in dem, was ich tue,mein Mensch-Sein, mich als Mensch entdecken.
19præview Nr. 1 | 201118
intærview
21præview Nr. 1 | 201120
Einem Anders-Handeln stehen meist Barrierenim Weg. Dieses sind Barrieren organisationalenUrsprungs, die in den Organisationsstrukturenund -prozessen wurzeln, sowie Barrieren perso-nalen Ursprungs, die sich auf die Wahrneh-mung und Bewertung der Veränderungsfähig-keit und -bedürftigkeit der Organisation sowieder Bewertung der eigenen Kompetenzen be-ziehen (vgl. Arens-Fischer et al. 2009). Insofern ist ein Anders-Handeln zu erhandeln.Theatrale Methoden unterstützen den Prozessdes Erhandelns anderer Verhaltensoptionensowie des Erhandelns organisationaler Verän-derungen und die wechselseitigen Bezüge zwi-schen organisationalen Strukturen und Prozes-sen und personalem Verhalten. Der erste Ansatzist dabei zunächst die Öffnung der Wahrneh-mung und der (An-)Erkennung betrieblicherVeränderungsfähigkeit und Veränderungsbe-dürftigkeit mit ästhetischen Mitteln (vgl. Arens-Fischer et al. 2009).In diesem Beitrag werden „Veränderungsland-karten“ und das „Fixieren des Nicht-Sondern“als zwei Methoden der Theaterarbeit in Unter-nehmen aus dem Forschungsprojekt THINKvorge stellt. Im Rahmen des aktionsforschungs-orientierten Ansatzes der Theatralen Organisa-tionsforschung haben die Methoden sowohleine analytische Qualität im Sinne einer Orga-nisationsdiagnose als auch eine gestalterischeQualität im Sinne eines auslösenden Momentesder Veränderung (vgl. Arens-Fischer et al. 2010).Hinsichtlich der gestalterischen Dimension sen-sibilisiert die Anwendung der Methoden dieOrga nisationsmitglieder für die Veränderungs-fähigkeit und -bedürftigkeit und stärkt so dieVer änderungsbereitschaft.
Veränderungsräume innerhalb der OrganisationIm Rahmen der Methode der „Veränderungs-landkarten“ werden die Akteure aufgefordert,ihre Organisation zur Erhebung des Status quozu beschreiben. Als Orientierungslinien dienen
Vom Erhandeln des AnderenEin theatraler Einblick in Veränderungspotenziale von OrganisationenJutta Bloem, Benjamin Häring
die Fragen „Welche Veränderungsmöglichkei-ten sehe ich innerhalb der Organisation?“ und„Welche Veränderungsmöglichkeiten besitze ichselbst in der Organisation?“. Die Mitarbeiterwerden angeregt, ihre organisationalen Struk-turen sowie ihre Handlungs- als auch Gestal-tungsspielräume innerhalb der Organisation zubeobachten. Sie sollen sich innerhalb ihrer sub-jektiven Wahrnehmung differenziert mit demeigenen Kontext und mit dem Bezug zur Ge-samtorganisation auseinandersetzen. Die Ergebnisse werden mithilfe von Symbolenund Farben auf Papier visualisiert. Dabei werdeninsbesondere Bereiche hervorgehoben, von de -nen der betriebliche Akteur glaubt, direkt durchsein eigenes Handeln in seinem HandlungsraumVeränderungen etablieren zu können, sowie or-ganisationale Bedingungen, die den bisherigenStatus quo der Organisation fixieren. Die ersten Auswertungen der Intensivstudienzeigen, dass durch die Anwendung der Methodesowohl die Veränderungsfähigkeit als auch dieVeränderungsbedürftigkeit der Organisation of -fen gelegt werden. Dabei weisen die Verände-rungslandkarten durchaus auf vielschichtigeorganisationale Wirkzusammenhänge hin. Interessant ist nun, dass trotz der Offenlegungder Verhältnisse die Akteure häufig weder ihreOrganisation noch sich selbst als Teil dieser inveränderungsbereitem Zustand erleben. AnstattVisionen über alternative Verhaltensweisen undStrukturen zu entwickeln, erfolgt meist eine Be-schönigung beziehungsweise eine Umbewer-tung der Situation. Dies kann als Indiz gewertetwerden, dass die Wahrnehmung des organisa-tionalen und personalen Veränderungsbedarfshäufig nicht ausreicht, die Veränderungsbereit-schaft der Akteure zu schaffen. Sie müssen jen-seits der Wahrnehmung über praktisches Er le bendazu befähigt werden, imaginäre Spielräumeabseits der bekannten Routinen und Abläufe er-schließen zu können. Die Sensibilisierung derAkteure für die Imagination dient in diesem Zu-sammenhang dazu, die eingespielten Routinen
nicht notwendig als Status quo zu begreifen,sondern ihre individuelle Imagination für dieGestaltung von Veränderungen zu nutzen.
Erfahrungsräume für Organisations -akteureDie Wahrnehmung von Veränderungsbedarfensowie die Bereitschaft, Veränderungen zu initi-ieren, kann mittels der Methode des „Fixierensdes Nicht-Sondern“ befördert werden. Dazu wird ein Teilnehmer gebeten, seine sub-jektiven Beobachtungen und Erfahrungen überden eigenen Handlungsraum anhand der Ver-änderungslandkarte zu erläutern und zur Dis-position zu stellen. Seine Ausführungen dienenals Spielmaterial, aus dem eine kurze, prägnanteSzene entwickelt wird. Der Betroffene spielt da -bei zunächst sich selbst und inszeniert einen an -deren Teilnehmer als Antagonisten (Gegenspie-ler). Die Szene wird vor dem Plenum gezeigt. Die Methode setzt nun an dieser Darstellung derOriginalszene an: Jeder Beobachter des Plenumswird aufgefordert eine Verhaltens- oder Prozess -alternative einzuspielen, die der Prota go nist alsBetroffener nicht gezeigt hat. Dabei spiegeln dieBeobachter dem Betroffenen in bewusst über-spitzter, verkürzter Version, was sie bei dem Be-troffenen hinsichtlich Auffälligkeiten, Haltungenund Prozessroutinen wahrgenommen haben.Auf diese Weise entsteht zum einen eine Varia-tion von Wahrnehmungen zum Zustand der Or-ganisation und den Verhaltensroutinen ihrerMitglieder in Bezug auf die konkrete Situation.Zum anderen entsteht ein Pool aus Verände-rungsvarianten, die durch die Sitzungsteilneh-mer als Impulse zur Veränderung eingespieltwurden. Die Veränderungsvarianten werden ab-schließend von dem Betroffenen auf dem Hin-tergrund seines Handlungsraumes reflektiertund hinsichtlich des Nutzens und der Umsetz-barkeit analysiert. Die Vorschläge sind dabei alsOrientierungshilfen aufzufassen, die Impulse fürmögliche Veränderungen auf der per sonalensowie der organisationalen Ebene setzen.Zusammenfassend wird deutlich, dass der An-satz der theatralen Arbeit in dem bewusstenHeraustreten aus dem Kontinuum der routinier-ten Wirklichkeit besteht. Die Teilnehmer bege-ben sich während der Intensivarbeit in einentheatralen Spielprozess, der bestimmten Regelnfolgt, um anschließend mit den Ergebnissen inForm von Impulsen aus dem Prozess in die be-
triebliche Wirklichkeit zurückzukehren (vgl. Dör -ger & Nickel, 2008). Die theatrale Arbeit leistetauf diese Weise zweierlei: zum einen einen Bei-trag zur Beförderung der bewussten Wahrneh-mung von Veränderungsbedürftigkeit und zumanderen einen Beitrag zur Veränderungsfähig-keit, da im theatralen Prozess Verhaltens- undOrganisationsalternativen erprobt werden. DieSchlüsselelemente dieser Arbeit bilden die Par-tizipation der Akteure und die Aktivierung ihres
Reflexionspotenzials. Die Akteure werden imSpielprozess zum Übenden und damit zu einemlernenden Part der Organisation.
Die Stärkung der Innovationskraft in Organisationen setzt mit Bezug auf denorga nisationalen Status quo ein anderes Handeln voraus – sonst bliebe alles, wiees ist. Doch sind die betrieblichen Akteure bereit, anders zu handeln? Sind siebereit, etablierte Verhaltensroutinen aufzugeben und Energie in andere Hand-lungsoptionen zu investieren und diese unter der Unsicherheit des Er geb nis seszu erkunden? Erkennen sie überhaupt die Möglichkeit, anders zu handeln?
Die AutorenJutta Bloem ist wissenschaftliche Mitarbeite-rin am Department für Duale Studiengängeder Hochschule Osnabrück und an der Berufs-akademie Emsland.
Benjamin Häring ist wissenschaftlicher Mit -arbeiter am Institut für Theaterpädagogik derHochschule Osnabrück. Kontakt: [email protected]
LiteraturArens-Fischer, W., Renvert E. & Ruping, B. (2009). Der Beitrag des Unternehmenstheaters zur Unternehmensent-wicklung: Personales Verhalten in Organisationsstrukturen und-prozessen reflektieren. In Raab, G. & Unger, A. (Hrsg.): DerMensch im Mittelpunkt des wirtschaftlichen Handelns (S. 543-559). Tagungsband der Gesellschaft für Wirtschaftspsycholo-gie. Lengerich: Pabst Science Publishers.Arens-Fischer, W., Renvert, E. & Ruping, B. (2010). SzenischeAktionsforschung. In Jacobsen, H. & Schallock, B. (Hrsg.): Inno-vationsstrategien jenseits traditionellen Managements (S.190-199). Stuttgart: Fraunhofer Verlag. Dörger, D. & Nickel, H.-W. (2008). Improvisationstheater – einÜberblick: Das Publikum als Autor. Milow: Schibri-Verlag.
2322 præview Nr. 1 | 2011
Michaela Margiciok, Michaela Wendekamm, Oliver Bluszcz, David Vossebrecher,Gisela Humpert, Wolfgang Stark (v.l.)Music – Innovation –
Corporate Culture so wie zeitliche und performative Aspekte desOrganisierens spiegeln, die in statischen Orga -ni sa ti ons modellen fehlen. Sie kann jenseits vonSprachcodes Feedback auf struktureller undemo tiona ler Ebene geben. Musikalisches Feed-back regt – vor allem bezogen auf Elemente wiesoziale Interaktion, Emotion, Werte und Pro-zesse (Performanz) – Lern- und Entwick lungs -pro zesse der Organisation an und ermöglichteine positive Neuordnung. Fähigkeiten zurSelbst reflexion sind entscheidend für Innovati-vität, Erfolg und organisationales Überleben(Moldaschl 2006). Durch die Verbindung vonOrganisationskultur und Musik lassen sich neueWege zur Entwicklung innovativer Unternehmenund sozialer Systeme entdecken, wenn auch dieErfahrungsbestände für Innovation erschlossenwerden, die nicht nur kognitiv repräsentiertsind. Muster innovativer Organisationen – inihrer Tiefenstruktur bislang nur schwer erkenn-und darstellbar – können auf einer neuen Re-flexionsebene erfahrbar gemacht werden.
Organisationen unter komplexem Anforde-rungsdruck mit innovativen, lernfähigen Orga-nisationskulturen arbeiten mit Improvisations-prozessen (Cunha & Cunha 2006), die auch imJazz oder in Teilen der Neuen Musik identitäts-bildend sind (Dell 2002). Solche Konstellationenerfordern hoch qualifizierte Mitarbeiter undMitarbeiterinnen mit hohen Freiheitsgraden, umInnovationspotenziale erkennen und flexibelagieren zu können, erfordern jedoch keine kom-plexen Strukturen (vgl. Abb.).
Improvisationen als Muster innovativer Organi-sationen sind nach Cunha et al. (2006) beab-sichtigte, aber ungeplante Abweichungen vonRoutinen. Eben dadurch können unerwarteteProblemlösungen und Entwicklungsmöglichkei-ten erkannt/genutzt werden. Über das Brechenvorhandener Regeln wird eine neue „Figur“ er-reicht.
Innovationsmuster und Organisationenmusikalisch verstehenProzesse des Organisierens können durch Musikin indirekter, nicht-repräsentationaler Weise neuerfahrbar werden. Im Projekt MICC werden Er-gebnisse der Organisationsanalysen und derMus terentdeckung in Form musikalischer Feed-backs verfügbar gemacht, um Reflexions- undHandlungsräume zu eröffnen, die Lernpoten-ziale der Organisation stimulieren.
Als methodisches und inhaltliches Scharnierzwischen Organisation und Musik dient die Er-kennung und Darstellung von Mustern (engl.patterns)1. Patterns sind die kontextbezogeneBeschreibung hoch typischer Problemlösungen,die sich in Organisationen als erfolgreich (via-bel) erwiesen haben, sie explizieren impliziteshandlungsrelevantes Wissen. Als Kommunika-tionsformat bilden Patterns einen kooperativenLernprozess ab und transportieren Werte. Da esPatterns in improvisierter (und komponierter)Musik wie auch in Organisationen gibt, habensie eine verbindende Funktion.
Als Verfahren „musikalischen Denkens über Or-ganisationen“ werden Organisationspartiturenentwickelt und eingesetzt. Generell sind Parti-turen Formen des Erschließens von Sinn in derMusik: Wenn wir eine Beethoven-Symphoniestrukturell verstehen wollen, besorgen wir unseine Partitur und lesen beim Hören mit. Die Par-tituren der Neuen Musik (Mitte des 20. Jahr-hunderts) jedoch sagen nicht mehr den ge-
nauen Verlauf der Musikvoll ständig vorher: Sie sindnicht repräsentational, son-dern „diagrammatisch“ ange-legt. Die Interpreten spielennicht nur die Noten nach, son-dern müssen aus der Partitur
eigene Handlungsformen entwickeln. DiesesVerfahren ist für Innovation in Organisationenwertvoll, weil hier „unscharfe“ Anweisungen zu„scharfen“ Ergebnissen führen sollen: eine be-absichtigte, aber nicht planbare Nutzung vonFreiheitsgraden.
Bisher arbeiten Organisationsanalysen weitge-hend mit kognitiven Modellen: Sie erfassen denrationalen Teil von Organisationen, indem siesich vor allem auf direkt erkennbare Parameterund auf Zählbares beziehen. Je flacher jedochHierarchien werden und je komplexer damit dieOrganisation, umso mehr werden jene weichenFaktoren der Vergemeinschaftung bedeutend,die Tiefe haben. Die Erforschung der „Tiefendi-mensionen“ von Organisationskulturen geht in-dessen weit über rationale Modelle der Organi -sa tionsforschung hinaus (Horsmann et al. 2007).
Eine neue Sprache für die Tiefen -dimension von OrganisationskulturenKönnen die Kulturen, in denen die Organisati-onsmitglieder leben bzw. arbeiten, klanglich„hörbar gemacht“ bzw. musikalisch verstandenwerden, so kann das im Arbeitsalltag fast aus-schließlich genutzte KommunikationsmediumSprache sensorisch-emotional ergänzt werden.Tiefendimensionen von Organisation und Inno-vation werden über den Kanal der Musik erfahr-und für die Reflexion der Führungskräfte, Mit-arbeiterinnen und Mitarbeiter nutzbar. Musikeröffnet neue Erfahrungshorizonte des Orga -nisierens und Managens: Da sie selbst komplexist, kann sie komplexe organisationale Ebenen
So werden mit dem Medium der Musik neueReflexionsebenen für die Analyse organisatio-naler Zusammenhänge, Prozesse und Ereignisseerschlossen. Organisationale und musikalischeMuster verbinden sich zu einer Musterspracheder Organisationen, die Zugänge zur Tiefendi-mension von Organisationen erlaubt (Baitsch &Nagel 2008). Des Weiteren können organisatio-nale Mustersprachen dazu genutzt werden, Ab-läufe und Prozesse (z.B. zur Krisenbewältigung)neu zu gestalten. Insofern sind Partituren Ele-mente eines Instrumentenportfolios, das Musiknicht nur als Analogie nimmt, sondern die Sen-sibilität für und die Ermöglichung von Improvi -sa tionsprozessen im Sinne lernender Organisa-tion neu erklingen lässt.
Die AutorenWolfgang Stark ist Professor für Organisati-onspsychologie und -entwicklung, OliverBluszcz, Gisela Humpert, David Vossebrecherund Michaela Wendekamm sind wissenschaft-liche Mitarbeiter, Michaela Margiciok ist stu-dentische Hilfskraft am Labor für Organisati-onsentwicklung der Universität Duisburg-Essen. Kontakt: [email protected]
1 Angelehnt an das Konzept der Mustersprache von ChristopherAlexander (Alexander et al. 1977).
LiteraturAlexander, C. et al. (1977). A Pattern Language. New York: Oxford University Press.Baitsch, C. & Nagel, E. (2008). Organisationskultur – das verborgene Skript der Organisation. In Meissner, J., Wolf, P. & Wimmer, R (Hrsg.), Praktische Organisationswissenschaft.Heidelberg: Carl Auer.Cunha, J., Cunha, M. & Chia, R. (2006). Routine as Deviation.Working Paper, Fac. de Economia, Universidade Nova, Lisboa,Portugal.Cunha, M. & Cunha, J. (2006). Towards the Improvising Organization. Business Leadership Review. Vol 3 Issue 4.Dell, C. (2002). Prinzip Improvisation. Köln: Walther König.Hayek, F.A. (2006). Die sensorische Ordnung. Tübingen: Mohr Siebeck.Horsmann, C., Pundt, A., Martins, E. & Nerdinger, F.W. (2007).Beteiligungskultur als Kontextfaktor für das Ideenmanagement.Wirtschaftspsychologie, 9 (2), 103-114.Moldaschl, M. (2006). Innovationsfähigkeit, Zukunftsfähigkeit,Dynamic Capabilities. Managementforschung, 16, 1-36.
Simple People Complex People
Complex Structure Machine Bureaucracies Intelligent Bureaucracies
Simple Structure Simple Organisations Improvising Organisations
Wolfgang Stark, David Vossebrecher, Oliver Bluszcz, Gisela Humpert, MichaelaWendekamm, Michaela Margiciok
Die Tiefendimension von Organisationskulturen musikalisch erfassen
Forscher und Berater in Organisatio-nen sind oft wie taube Beobachter,die in einen Raum kommen, in demjemand Geige spielt. Sie beobachten,sie nehmen die Schwingungen mitMessgeräten auf und können darausbisweilen sogar Rückschlüsse auf Ton-lage und Form der Musik ziehen. Siewerden jedoch nie von der Sinnes-wahrnehmung des Klangs erfahren,nie davon, was Musik als Gehörtes anErfah rung bietet oder auslöst (Hayek2006), denn sie orientieren sich anden üblichen engen RationalitätsmodiKogni tion/Sprache und Messbarkeit.
Komplexität in Organisationen (Cunha & Cunha 2006)
25præview Nr. 1 | 201124
Organisation musikalisch denkenChristopher Dell
Das Erforschen der impliziten Formen des Wis-sens ist bereits seit langem Bestandteil der Or-ganisationstheorie. Neu ist, das künstlerischeForschen in diesen Komplex mit einzubeziehen.Im künstlerischen Forschen geht es mithin umdie Ausweitung der Forschung in ihrer katego-rialen Bestimmung und deren Auffächerung.Anders gesagt: Künstlerisches Forschen fragtneu nach den ontologischen Bedingungen vonForschung, also der Beschaffenheit des For-schungsgegenstands, der Form der Epistemeund den damit verknüpften methodologischenAnsätzen. Forschung in der Kunst wird vonBorgdorff (2009) als „performative Perspektive“bezeichnet, Donald Schön beschreibt sie als„Reflexion in der Aktion“. Die Trennung von Ob-jekt und Subjekt wird hier problematisiert, denndie Distanz des Forschenden zum Gegenstandist minimiert – im Gegenteil sucht der Forschen -de in performativen Kontakt mit den Dingen zukommen, um aus praktischen Situationen he-raus Wissen zu destillieren. Dieser Ansatz gehtdavon aus, dass die künstlerischen Praktikenselbst ein Reservoir an Wissen bereitstellen, diees für die Forschung fruchtbar zu machen gilt.Wenn Handlung reflexiv gemacht wird, im pli -ziert dies, dass „Konzepte und Theorien, Erfah-rungen und Auffassungen (…) mit Kunstprakti-ken verwoben“ (ebd.) sind. Warum aber Musik? Weil ihr Sinn sui generis ausdem relationalen Zusammenhang, aus einer To-pologie ihrer strukturellen Momente entsteht.Und: diese Relationalität muss hervorgebrachtwerden. Der Sinn von Musik entfaltet sich erstaus der Relationalität von Rhythmus, melodi-scher Anteile, harmonischer Verläufe, Klangfarbeetc., die nicht allein als physikalische Vorgängevon akustischen Schwingungen, sondern als ein„sinnvolles“ Konglomerat wahrgenommen wer-den können. Wichtig ist, dass jeder mitmachenkann: Strukturen dieser Vorgänge bilden für alleHörer gleichermaßen eine Grundlage. Sie kön-nen jenseits tertiärer Eigenschaften „Anlass fürzusammenhängende Erfahrung“ (Vo gel 2007)sein und bilden so wahrnehmungsstrukturie-rende Modelle, die nicht nur Spezialisten derMusik, sondern auch jedem Laien zugänglichund plausibel sind. Diese Modelle sorgen dafür,dass die Hörer eine Praxis, ein Tun nachvollzie-hen und daraus eine Form der Kohärenz ableitenkönnen. Dieser Nachvollzug ist jedoch stark sub-jektiv gefärbt, eine Eigenschaft, die durch die
Tatsache, dass in dem MICC Projekt organisatio-nale Strukturen auf einen musi kalischen Verlaufprojiziert werden und umgekehrt, noch verstärktwird. Wichtig bleibt: Die Musik bedeutet nichtdie Organisation, sondern das Tun eines musi-kalischen Spiels wird nachvollzogen oder imSchreiben der Partitur vorgedacht. Der Erfah-rungsraum des Musikmachens oder Musikhö-rens wird also umgekehrt zum strukturierendenMoment einer Reflexion über Organisation. Dasist wichtig, denn wir gehen ja davon aus, dassMu sikhören ebenso wie das daran angeschlos-sene oder vorgeschaltete Partiturenzeichen nichtbloß rezeptiv oder interpretatorisch zu verstehenist, sondern dass da rin Elemente einer Praxisenthalten sind, die sich daran beteiligen, musi-kalischen Sinn überhaupt erst zu „produzieren“.Der Fokus auf die Produktion von Sinn, auf dasVerfahren des Musizierens selbst rückt ein spe-zifisches Verfahren der Musikproduktion in denBlick: das der Improvisation. Dieses Verfahrenist für Organisationen zunehmend interessant.Aktuell beobachten wir, wie sich die Perspekti-ven im Komplex der Organisationstheorie ver-schieben. Auf der Basis eines „organisationalenLernens“ wurde ein „Prozess der Erhöhung undVeränderung der organisationalen Wert- undWissensbasis, die Verbesserung der Problem -lösungs- und Handlungskompetenz sowie dieVer änderung des gemeinsamen Bezugrahmensvon und für Mitglieder innerhalb der Organisa-tion“ in Gang gesetzt (Probst & Büchel 1994).Da mit ändert sich auch die Organisation vonOrganisation. Organisation ist nicht mehr nurals Planung und Ausbildung von Routinen, son-dern vor allem als organisatorischer Wand-lungsprozess zu verstehen. Innerhalb diesesKomplexes ist in neuester Zeit ein Untersu-chungsfeld emergiert, das Improvisation alsKompetenz des konstruktiven Umgangs mitdem Unerwarteten stärker in den Blick nimmt.„Organizational Improvisation is one of themore recent theoretical developments, and onewhich is only now beginning to capture theimagination of organization theorists“ konsta-tieren Kamoche et al. (2002). Dies hätte einenParadigmenwechsel in der Organisationstheoriezur Folge: In ihr wird herkömmlicherweise Pla-nung „als langfristig der Improvisation über -legene und erstrebenswerte Form der Problem-lösung definiert, während die Improvisationeine untergeordnete Rolle spielt. Aufgrund von
Der AutorChristopher Dell, als international bekannterVibraphonist Grenzgänger zwischen Jazz undNeuer Musik, leitet das Institut für Improvisa-tionstechnologie (Berlin) und entwickelt imProjekt MICC Konzepte musikalischen Verste-hens für Organisationen. Kontakt: [email protected]
Organisation wird im Rückgriff auf ihre Kultur nicht als substanzielle Form
oder neutraler Behäl ter verstanden, in dem organisationale Akteure handeln.
Vielmehr wird Organisation perfor mativ gedacht, d.h. sie entsteht durch Aus-
übung – Wiederholung, Routine, Rituale, Muster – und ihr Wissen ist tacit.
Als perfor mativer Akt ist Organisation prozesshaft und ent wi ckelt sich durch
ein Handeln, das an Wert vorstellungen, Materialien und Strukturen geknüpft
ist. Das Erforschungswürdige an diesem Konzept ist, dass wir meist kein be-
wusstes Konzept der Performanz von Organisation haben, also von dem, was
wir als Kultur einer Organisation „machen“ – uns fehlt mithin die Urteils-
kraft für das Relationale, Situative und Performative.
Planungsgrenzen wird in den Unternehmen ineinem Maße improvisiert, welches über dem dertheoretischen Darstellungen liegt.“ (ebd.) Schön (1983) rekurriert in seiner Beschreibungdes „reflexiven Praktikers“ auf die Arbeit vonMusikern, und zwar Jazzmusikern im Speziellen,weil diese Improvisation nutzen und so im Un-vorhersehbaren Kohärenz zu erzeugen in derLage sind: „Sie (die Musiker) können das haupt-sächlich deshalb tun, weil sie sich bei ihremkollek tiven Bemühen um eine einfallsreichemusikalische Gestaltung eines metrischen, me-lodischen und harmonischen Schemas bedie-nen, das allen Beteiligten vertraut ist und demMusikstück eine vorhersehbare Gestalt verleiht.(…) Indem die Musiker ein Gespür für die Rich-tung bekommen, in der sich das Musikstückaufgrund ihrer zusammenwirkenden Beiträgeweiterentwickelt, gewinnen sie daraus einenneuen Sinn und passen ihr Musizieren diesemneuen, von ihnen begleiteten Sinn an.“ Die Ana-lyse des reflektierten Handelns geht somit voneiner bestimmten Organisationspraxis aus, undzwar der der organisationalen Improvisation.Fassen wir zusammen: Musikalische Logik fügtsich nicht aus wahrheitserhaltendem Schließenzusammen, sondern aus der Relationalität einerspezifischen Nachbarschaftsordnung musikali-scher Elemente. Matthias Vogel (2007) sprichtin diesem Zusammenhang von medialen Prak-tiken. „Im Mittelpunkt medialer Praktiken stehentradierte und erlernbare Tätigkeitstypen, diewahrnehmbare Ereignisse hervorbringen, wobeiProduzenten und Rezipienten dieser Ereignissesich nicht an deren physikalischen Ei gen schaf -ten, sondern an deren beobachterrelevantenEigen schaften orientieren“.
LiteraturBorgdorff, H. (2009). Die Debatte über Forschung in der Kunst.In Rey, A & Schöbi, S. (Hrsg.), Künstlerische Forschung, S. 23-51. Zürich: ZHdK.Hagedorn, V. (2008). Musik vergisst man nie. DIE ZEIT,29.05.2008, Nr. 23.Kamoche, K., Cunha, M.P. & Cunha, J.V. (Hrsg., 2002). Organisational Improvisation. London: Routledge.Probst, G. & Büchel, B. (1994). Organisationales Lernen: Wettbewerbsvorteil der Zukunft. Wiesbaden: Gabler.Schön, D. (1983). The Reflective Practitioner: How Profes-sionals Think in Action. New York: Basic Books.Vogel, M. (2007). Nachvollzug und die Erfahrung musikalischenSinns. In Becker, A & Vogel, M. (Hrsg.), Musikalischer Sinn, S. 327. Frankfurt: Suhrkamp.
27præview Nr. 1 | 201126
Es ist eine prominente Weisheit: Innovationenbrauchen Mut und Kreativität, Altes abzulegenund Neues anzufassen. Dafür existiert eine re-präsentative Struktur: Die typische Schrittfolgefür Wachstum und Wandel ist nicht aus Soft-wareprogrammen ableitbar, sondern im Mono-mythos der Heldenfahrt verdichtet. Das For-schungsprojekt „Innovationsdramaturgie nachdem Heldenprinzip“ legt mit dem Zugriff aufdas kulturelle Archiv der Menschheit einen jahr-tausend bewährten Erfahrungsschatz frei und er -öffnet damit neue Dimensionen für Innovation.
Die „Lessons Learned“ aus den Projekten des LebensDer „rote Faden der Ariadne“, „die Gralssuche“,„die Büchse der Pandora“: Das sind geflügelteWorte. Allesamt entstammen sie der Mytholo-gie und liegen leicht auf der Zunge. Als Grund-form kollektiver Wirklichkeitsdeutung bündelnMythen und Märchen die Essenz der Mensch -heits erfahrung in Metaphern. Diese Narrationenbergen universelle Einsichten, in deren Sinn bil -dern seit Jahrtausenden Wissen und Erfahrunggesammelt wird. Von Generation zu Generationweiter gegeben, zuerst mündlich, dann gedruckt,verfilmt, sind sie nun auch via Internet verbrei-tet. Hier finden wir eine ursprüngliche Form desWissensmanagements.
Neue Horizonte für InnovationsarbeitWie ein archetypisches Muster Innovationsprozesse strukturiert und stütztKarin Denisow, Nina Trobisch
Vom Monomythos und seiner Adaptionfür die Gegenwart Im 20. Jahrhundert ging der amerikanischeKultur-Ethnologe Josef Campbell der Strukturweltweiter Heldenmythen auf den Grund. Seinevergleichenden Forschungen führten ihn zueiner bahnbrechenden Entdeckung: Nicht anHerkunft noch Besitz misst sich ein Held, son-dern an der Bereitschaft, sich auf eine tief grei-fende Transformation einzulassen. Heldenmy-then komprimieren dramatische Geschichtenvon Entwicklung und Veränderung. Unabhängigvon Kulturkreis und Jahrhundert, diesen Prozes-sen wohnt ein konstantes Muster inne. Mögendie Stories und Protagonisten des Heldenmy-thos’ in „tausend Gesichtern“ erscheinen, da-runter liegt ein immer ähnliches inneres Raster.Dieses dem Heldenmythos immanente Muster(Monomythos des Helden) macht sich das Pro-jekt „Innovationsdramaturgie nach dem Hel den -prinzip“ zunutze und adaptiert die archetypischeSchrittfolge für unternehmerische Kon tex te derGegenwart (Heldenprinzip). Sie folgt dabei demSpannungsbogen der klassischen Dramaturgie;das Geschehen wird unterteilt in drei Akte, un-tergliedert in Szenen.
Im „Aufbruch“ steht Ruf versus Weigerung. Not -gedrungen oder aus freien Stücken, das Wagnis
des Ungewissen beginnt.Das ist nur möglich, wennman sich einlässt auf Frem-des, Unbequemes, Schwie-riges. Der Mentor sichertdie notwendigen Ressour-cen, damit die erste Schwel -le ins Unbekannte über-windbar wird. Der Weg derPrüfungen „im Land derAbenteuer“ umreißt die he-rausfordernden Aufgabenund Hindernisse, die derProtagonist bewältigt oderauch noch nicht. In der ent-scheidenden Prüfung wirddie stärkste Angst besiegt.Die Belohnung gibt dieKraft, die zweite Schwellezurück in die Normalität zuüberwinden. Bei der „Rück-
kehr“ zeigt sich, wie der schwierige Rückweg dieerworbenen Fähigkeiten stabilisiert. Das Ge-wonnene und Erworbene wird in den Alltag in-tegriert. Als Meister zweier Welten ist manhandlungsmächtig, wenn der neue Zustand all-tägliche Selbstverständlichkeit ist.
Zum postheroischen Management„Arm das Land, das Helden nötig hat!“ heißt esin Bertolt Brechts „Galileo Galilei“. Aber: Ob inden Geschichten oder in der Geschichte, immergibt es Menschen, die sich be- und gerufen füh-len, Verantwortung zu übernehmen und übersich hinauszuwachsen. Zu allen Zeiten wird esUmstände geben, die der Veränderung oder Er-neuerung bedürfen, trotz Risiken und Gefahren.Der Heldenweg ist das Annehmen unwägbarerHerausforderungen. Indem Menschen und auchOrganisationen sich auf den Weg des Wandelsbegeben, werden sie kompetent. In diesem Sin -ne ist die Grundstruktur des Heldenmythos fürheutige Innovationsprozesse relevant und liegtparadoxerweise näher am postheroischen Ma-nagement als vermutet. Denn auch Dirk Bae-cker (2006) nutzt die Kraft der inneren Bilder,um seine Postulate für zeitgemäßes, sinnstif-tendes Wirtschaften zu untermauern.
Innovationsdramaturgie nach dem HeldenprinzipInnovation aus der Unschärfe und der Unplan-barkeit zu schöpfen, dafür gilt es Konzepte zugenerieren. Der Weg des Helden ist eine Projek-tionsfläche, die für jeden Entwicklungsprozessnutzbar ist. Innovationen gehören dazu. Inno-vationen sind in unserem Verständnis von Men-schen getragene Veränderungsprozesse, die sichim Spannungsfeld von ökonomischen, ökologi-schen und sozialen Einflüssen entfalten. Inno-vationen können sich auf Prozesse, Strukturen,Produkte beziehen – aber immer spielen sie sichauch dazwischen ab. In den Spannungsfelderndieser Zwischenräume liegt der kreative Gestal-tungsraum. Unsere Arbeit mit den Unterneh-men zeigt, wie fruchtbar es ist, sich auf die uni-versale Grundstruktur des Heldenmythos fürgegenwärtige Transformationsprozesse zu be-sinnen; sowohl für die Organisation als auch fürden Einzelnen. Hier stehen drei förderlicheKomponenten im Vordergrund:
1. Der Dreischritt des EntwicklungsbogensVerlassen der alten bekannten Welt (Aufbruch)– Neues Agieren in einer unbekannten Welt (DieLandschaft der Prüfungen) – Ankommen in deralten veränderten Welt (Rückkehr). Dieses Mus-ter ist einprägsam und nachvollziehbar, es schafftein Maß an Sicherheit in der Unsicherheit. DenBeteiligten des Innovationsprozesses gibt es einGerüst für das aktive, kreative Handeln in un-bekannten Situationen und setzt den Rahmenfür den damit einhergehenden Erwerb neuerKompetenzen.
2. Die Dramatik des SpannungsbogensZielplanungen und Meilensteine determinierenwirtschaftliche Prozesse. Obwohl es eine Viel-zahl von betriebswirtschaftlichen und sozialenMethoden gibt, Entwicklungsprozesse rationalzu gestalten – da werden Ziele vorgegeben, dawerden Problemlösungen moderiert, da wirdChange-Management kultiviert – fehlt dennochirgendetwas! Parallel schwingen ganz eigene„Logiken“ im Untergrund. Denn das Auf und Abeines Innovationsweges ist geprägt von Höhenund Tiefen, Krisen und Erfolgen, die Raum be -an spruchen und Beachtung finden müssen. DasHeldenprinzip ignoriert die Spannungsfeldernicht, sondern sensibilisiert für Ambivalenzen,Konflikte und Polaritäten und behandelt sie alsproduktiven Bestandteil.
3. Die Kraft der archetypischen Bilder und Quellen
Der Monomythos wirkt implizit und explizit.Seine Fährte ist tief im Menschen eingespurt. DieBeteiligten folgen ihr bewusst und unbewusst,durch und mit dem Handeln (performativ), durchAnsprache auf tieferen Ebenen, die dort etwaszum Klingen bringt. Das Grundmuster tragenauch die Beteiligten eines Innovationsprozessesin sich und greifen auf das kulturelle Gedächt-nis, die kollektive Intelligenz der Mensch heit zu.Die Metaphern haben bis heute kaum an ihrerStrahlkraft eingebüßt. In der Kom munikationent stehen dadurch mächtige innere Bilder, diesich mit anderen Menschen teilen las sen.
FazitDie Forschungsarbeit in den beteiligten Unter-nehmen zeigt, dass die Innovationsdramaturgie
Karin Denisow, Nina Trobisch
nach dem Heldenprinzip mit ihrer archetypi-schen Quelle, ihrer spannungsreichen Struktur,ihren kraftvollen Bildern und ihren ästhetischenPraktiken als Orientierungsmuster einer zu kunfts -fähigen Innovationskultur dient. Die Unterneh-men nutzen es als praktisches Wissen und Hand -werkzeug. Aus diesem Blickwinkel fördert sie,als Kompositionsprinzip von Veränderung, dasnon-lineare schöpferische Denken und das kre -ative Handeln; die zentralen Komponenten derInnovationsarbeit. Denn: Was wir schon wissen,ist nicht neu. Was neu ist, wissen wir noch nicht.
Die AutorinnenDr. Karin Denisow ist Geschäftsführerin der LUMEN |Organisationsentwicklung. Inspiration. Coaching. GmbH [email protected]
Nina Trobisch ist Forschungsleiterin des Pro-jektes „Innovationsdramaturgie nach demHeldenprinzip“ am Zentralinstitut für Weiter-bildung an der Universität der Künste [email protected]
LiteraturBaecker, D. (2006). Postheroisches Management. Berlin: Merve Verlag.Campbell, J. (2002). Der Heros in tausend Gestalten. Frankfurt a.M.: Insel Verlag. Hüther, G. (2006). Die Macht der inneren Bilder. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht. Rebillot, P. (2008). Heldenreise. Books on Demand GmbH.
1. Akt: Der Aufbruch
Schwelle
3. Akt: Die Rückkehr
2. Akt: Im Land der Abenteuer
Der Ruf
Die Weigerung
Der Mentor
Überwinden der 1. Schwelle Überwinden der 2. Schwelle
Meister zweier Welten
Der schwierige Rückweg
Die BelohnungDer Weg der Prüfungen
Die entscheidende Prüfung
Innovationsdramaturgie nach dem Heldenprinzip
Bekannte Welt
Unbekannte Welt
præview Nr. 1 | 201128
Der Forschungsverbund HELD stellt sich dieAuf gabe, das Heldenprinzip als universellesMuster für Wachstums- und Wandlungspro-zesse sowohl in der Begleitung von Unterneh-men als auch von Einzelpersonen zu erprobenund methodisch zu untersetzen. Hier sei vonder Arbeit mit Führungs kräften unterschiedli-cher Unternehmen berichtet.
Was ist der Ring of Leadership?In der Annahme, dass ein tief greifender Ent -wick lungsprozess mehr als nur ein zweitägigesSe mi nar braucht, entschieden wir uns, einen„Work shop zyklus in 7 Schritten“ zu konzipieren,alle zwei Monate ein zweitägiges Modul. DieseModule folgen der Struktur des Heldenprinzips.Nacheinander stehen ein bis zwei Szenen imFo kus, die in ihrer tieferen Bedeutung beleuch-tet, mit Sinnbildern angereichert und in ihremprak ti schen Bezug zum Führungsalltag umge-setzt werden.
Wer fühlte sich angesprochen? Die Bewerber hatten bereits Führungsseminarebesucht, waren aber unzufrieden mit den Er-gebnissen. Neugierig auf kreative Methodenund offen dafür, ihre Führungskompetenz durchästhetisches Arbeiten und kulturelle Schätze zustärken, öffneten sie sich dem Konzept, das so-wohl die Führungsrolle als auch die individuelleEntwicklung fokussiert. Heute setzt sich der Ringof Leadership aus zwölf Führungskräften viel -fäl tiger Branchen und Unternehmen zusammen(sechs Männer/sechs Frauen).
Was eint Führungskräfte und Helden? Menschen auf dem Heldenweg: Unwägbarkei-ten säumen ihren Pfad, sie lassen sich davonnicht schrecken. Hindernisse erschweren denAuftrag, sie überwinden sie situativ. UngewisseProbleme fordern sie heraus, sie lösen sie krea-tiv. Ihr Ziel ist erreicht, wenn die Errungenschaftin der Praxis verankert ist. Auf den ersten Blickscheint Führungsentwicklung also das idealeFeld für die Anwendung, auf den zweiten Blickaber ist es ein komplexes Unterfangen, die ar-chetypische Reihenfolge mit der Vielfalt indivi-dueller Prozesse zu kombinieren, die persönlicheEntwicklung mit der Aufgabe als Führungskraftin Balance zu halten und künstlerische und a na -lytische Methoden, in Resonanz zu einer vorge-gebenen Dramaturgie, in Einklang zu bringen.
Was Führungskräfte mit dem risikoreichen Weg des Helden verbindetEinblick in die PraxisKarin Denisow, Nina Trobisch
Dramaturgischer Aufbau der SeminarreiheModul 1 | 1. Akt | AufbruchModul 2 | 1. Akt | AufbruchModul 3 | 2. Akt | Land der AbenteuerModul 4 | 2. Akt | Land der AbenteuerModul 5 | 2. Akt | Land der AbenteuerModul 6 | 3. Akt | RückkehrModul 7 | 3. Akt | Rückkehr
Zwischenstand: Blitzlichter aus den Modulen 1 bis 5Modul 1 | Aufbruch: Ziel war auf der einen Sei te,die Grundstruktur zu vermitteln, um den Bo denfür die kommende Arbeit zu bereiten. Hierfürerfanden die Teilnehmenden nach der Drama-turgie des Heldenprinzips Stories, die sie in sze-nischen Improvisationen umsetzten. Schnell undschöpferisch schrieb sich das Muster ein undführte zu wunderschönen assoziativen Szenen .Auf der anderen Seite ging es um die Erar bei -tung des eigenen Rufes. Jeder der Teil neh men -den hatte ein unklares Gefühl der Un zu frie -denheit mit dem Bestehenden. Eine Ex peditionins Innere, eingebettet in Übungen zu Eigen-und Fremdwahrnehmung, führte in einem ge-meinsam geschaffenen Gemälde zu einer Annä-herung an den Ruf. Die Unschärfe, das Schwe-bende des Rufs wurde so greifbar.Modul 2 | Aufbruch: Thematisiert wurden dieWeigerung und die Begegnung mit dem Men-tor. Künstlerische Artefakte zum Thema Füh-rung verdeutlichten die inneren Ansprüche derGruppe an Führung sowie die Komplexität derFührungsaufgabe. In einer anschließenden spie-lerischen Erfahrungssequenz zeigten sich dieindividuellen Differenzen zwischen Anspruchund Realität. Zur Bearbeitung dieser deutlichgewordenen Ambivalenzen wurde in einem aus -führlichen Reflecting Team Setting die Grup pedem Einzelnen zum Mentor.Modul 3 | Land der Abenteuer: Die Überwin-dung der ersten Schwelle erfordert ein hohesMaß an Sensibilisierung für die eigenen Musterund Glaubenssätze sowie die Bereitschaft, aufdie blinden Flecken zu schauen. Dieser Übergangwurde durch die Arbeit mit der eigenen Stimme,Bewegung im Raum und Kryptogrammen un-terstützt. Die Schwelle zeigte sich symbolischdurch eine riesengroße hohe Wand, auf der dieSchwellenhüter dem „Helden“ Einhalt geboten.Es wurde erlebt, dass das Überwinden der Schwel - le vor allem einen großen inneren Mut braucht.
Modul 4 | Land der Abenteuer: Um die abso-lute Ungewissheit dieser Situation erfahrbar zumachen, führten wir die Gruppe an einen un-bekannten Ort, den Klangwelten in den BerlinerUnterwelten. Dort ertasteten sie – nicht sehend– den fremden Raum und erkundeten unge-wöhnliche Klänge. In diesem Modul kristalli-sierte sich heraus, dass es beim Erschließen vonNeuland viel weniger um die Außergewöhnlich-keit der Herausforderung geht, sondern um eineoffene, aufgeschlossene und durchaus vorsich-tige, ja tastende Haltung. Modul 5 | Land der Abenteuer: Die Mühsal desLoslassens alter Verhaltensmuster wird in einerPerformance erfahren: Die Teilnehmer bewegensich in einer Matrix (Seitz 20061). Ein Bewe-gungselement kommt zum nächsten. Immer wie -der werden ähnliche Situationen geübt. Wand-lung und Variation ist möglich. Gefühle wieLangeweile, Ärger, Leere, Sinnlosigkeit sind hilf-reich, um das Neue zu wagen, auszubrechen. Imperformativen Element wird die Unmittelbarkeitdes Wandels spürbar sowie die Schwierigkeit,im Alltäglichen seine Optionen zu nutzen.
ZusammenfassungDen dramaturgisch aufgestellten Seminarzyklusbestimmen vier Elemente:
1. Das narrative Element: Das Seminar bildetdie Akte und Szenen ab, unabhängig davon,wo jeder Einzelne gerade steht. Die Teilneh-mer machen sich mit Inhalt und Wesen ihrerGeschichte und den Geschichten der Anderenvertraut.
2. Das performative Element: Im Handeln äu-ßern sich Identität und Rolle, Persönlichkeitund Entwicklungsstand einer Führungskraft.Alle Stationen werden emotional und körper-lich verankert, handelnd erlebbar. Das aktiveemotionale Erleben der Struktur ermöglicht dieIntegration in das eigene intuitive Handeln.
3. Das künstlerisch-kreative Element: Farbeund Form, Bilder und Materialien, Raum undKlang, Bewegung und Spiel sind Teil des Kon-zeptes. Die ästhetische Gestaltung sensibi -lisiert die Wahrnehmung und ermutigt dieTeil nehmer, ihren kreativen Potenzialen zuver trau en und sie auszuloten.
4. Das mentorale Element: Ein zentrales Mo-ment des Heldenprinzips ist das Erschließenvon stützenden Ressourcen. Die Gruppe selbstist sich ein Kraftquell, eine mentorale Res-source. Klassische Methoden, z. B. das kolle-giale Coaching, werden eingesetzt, um dasVertrauen der Teilnehmer untereinander zufördern.
Das Heldenprinzip bietet ein Gerüst, in dem je -de/r seine Antworten selbst sucht: Was ist meinRuf als Führungskraft? Wo liegt der Kern meinerWeigerung? Wie nutze ich mentorale Unter-stützung? Welche Schwellen überwinde ich, umneues Verhalten zu erkunden, zu erproben, zupraktizieren? Welchen Gefahren bin ich im Landder Abenteuer ausgesetzt? Diese Dramaturgie ist ein Weg, Persönlichkeits-entwicklung und Füh rung zusammenzuführen.„Weil man sie kennt, aus Mythen, Märchen –und der eigenen Erfahrung. Ich kann mich mitihr identifizieren. Sie hilft mir, meine Heraus-forderungen besser wahr zunehmen, sie täglichneu anzugehen, ohne dabei den Mut zu verlie-ren.“, sagte Frank M., einer unserer Teilnehmervom Ring of Leadership in der Evaluation.
Die AutorinnenDr. Karin Denisow ist Geschäftsführerin derLUMEN |Organisationsentwicklung. Inspira-tion. Coaching. GmbH [email protected]
Nina Trobisch ist Forschungsleiterin des Pro-jektes „Innovationsdramaturgie nach demHeldenprinzip“ am Zentralinstitut für Weiter-bildung an der Universität der Künste [email protected]
1 Seitz, H. (2006). Ereignisse im Quadrat. Matrix für Performan -ces an der Schnittstelle zum Tanztheater. In Lange, M.-L. (Hrsg.),Performativität erfahren. Uckerland/Berlin: Schibri-Verlag.
29
31præview Nr. 1 | 201130
Digitale Spiele bieten eine alternative Mög-lichkeit, Wissen zu vermitteln und künst -lerisch-ästhe tische Interventionen, etwa inWorkshops, zu unterstützen. Am Beispiel desHeldenprinzips in Workshops für Unterneh-men und Führungskräfte werden zwei kom-binierbare Ansätze, Blended Game-basedLearning und Public Gaming, sowie die bis-herigen Erfahrungen mit diesen vorgestellt.
Da die Heldenreise als Erzählstruktur nicht nurunbewusst genutzt wird, sondern vielmehr indas Repertoire professioneller Geschichtener-zähler gehört, versteht es sich von selbst, dasssie auch in der Spieleliteratur als eine (Rollingset al. 2003) oder gar die (Howard 2008) Dra -maturgie für erfolgreiche und sinnstiftende(„meaning ful“) digitale Spiele gilt. Daher lassensich einzelne Szenen und häufig auch die kom-plette Heldenreise in zahlreichen digitalen Spie-len mit einer ausgeprägten Handlungskom -ponente nach weisen. Bei der Vermittlung desHel denprinzips als Entwicklungsstruktur bietetdie Nutzung solcher digitalen Spiele eine her-vorragende Möglichkeit, den Wissenstransfer zuunterstützen. Die Teilnehmer können allein oderim Team eine oder mehrere Szenen spielerischerleben und dann retrospektiv in Einzelarbeitenoder Gruppendiskussionen reflektieren. Diesermög licht und erfordert die tiefgehende Aus-einandersetzung mit dem Heldenprinzip undfördert dessen Verständnis als Grundmuster fürEntwicklung. Dabei wird die Fähigkeit der Teil-nehmer entwickelt, das Heldenprinzip auch inspielexternen Situationen, wie Arbeits-, Innova -tions- und Entwicklungsprozessen, anwendenzu können.
Zusätzlich wirkt das Erlebnis des Eintauchens indie digitale Spielewelt auf der Metaebene. Sowerden die Gefühle und Erlebnisse des Spielerszur Heldenreise ins Abenteuerland des Spiels alspersönliche Geschichte („Story“) erfahren undmit den zu reflektierenden Inhalten verknüpft.Der anschließende Austausch in der Gruppeverstärkt diese Verknüpfung durch die Kommu-nikation der eigenen Erlebnisse und das Erfah-ren der Geschichten anderer Teilnehmer im bes-ten Sinne des Storytellings, dessen positiverEffekt auf den Wissenstransfer hinreichend be-kannt ist (Denning 2001, Herbst 2008).
Digitale Spiele als innovatives Medium fürWissenstransfer und InterventionCarsten Busch, Florian Conrad, Martin Steinicke
Blended Game-based LearningUm erste Erkenntnisse über die mögliche Ein-bettung von digitalen Spielen in die Interventi -onen zu erlangen, wurden Tests mit Probandendurchgeführt. Diese entsprachen den potenziel-len Zielgruppen für die Interventionen und wie-sen als besonderes Merkmal minimale bis garkeine Erfahrungen mit digitalen Spielen auf.Über die Jahre entstanden in digitalen Spieleneine Menge von Konventionen und Quasi-Stan-dards für Spielmechaniken. In unseren Tests er-wies sich dies jedoch als immense Schwelle, diezu überwinden den Teilnehmern mitunter großeMühen abverlangte. So gibt es in vielen digita-len Spielen „Tutorials“ – kleine Abschnitte, dieden Spieler in die zentralen Konzepte und Me-chaniken des Spiels einführen (etwa das Sprin-gen und Gegenstände untersuchen oder dieSteuerung der Spielkameraperspektive). DieseTutorials, die von relativ erfahrenen Spielern inwenigen Minuten absolviert werden können,wurden von den Testkandidaten erst nach einerhalben Stunde oder mehr gemeistert. Obwohlsich dies positiv auf die Heldenreise der Meta-ebene auswirkt – je weniger Erfahrung, destoabenteuerlicher das Spielerlebnis – führt esdazu, dass die eigentlichen Spielinhalte in weiteFerne rücken. Gerade Spieltypen mit komplexenHandlungsstrukturen – wie digitale Rollenspie -le, die oft besonders gute Beispiele für die Sta-tionen des Heldenprinzips enthalten – erfor-dern/bieten selbst für erfahrene Spieler häufig30 oder gar 100 Stunden an Spielzeit. In „Dra-gon Age: Origins“ etwa können die Szenen desersten Aktes sehr gut nachvollzogen werden, bisjedoch etwa die „Überwindung der 1. Schwelle“der Spielhandlung erlebt wird, kann ein erfah-rener Spieler bereits 6-8 Stunden im Spiel ver-bracht haben. Natürlich ist es möglich, den In-terventions-Teilnehmern die Geschichten derSpiele einfach zu erzählen, dadurch verliert sichjedoch die eigentlich so besondere, performa-tive Komponente der erlebten Reise.
Um auch weniger spielerfahrenen Teilnehmerndiese Erfahrung zugänglich zu machen, wird imProjekt HELD mindestens eine Modifikation (Mod)eines digitalen Spiels erstellt werden. Diese Modwird den Fokus auf die Narration nach dem Hel-denprinzip legen und eine geringere Spieldaueraufweisen.
Trotz einer solchen möglichen Konzentrierungauf die Stationen der Heldenreise kann und solldie aktive Spielzeit nicht zu stark eingeschränktwerden, denn dies wäre nur auf Kosten des sowichtigen performativen Elements möglich.Daher scheinen sich diese digitalen Spiel- undInteraktionstypen weniger für die Verwendungin den Interventionen selbst anzubieten, alsvielmehr für die Nutzung als Vor- und Nachbe-reitung der zu bearbeitenden Konzepte. In deneigentlichen Präsenzphasen der Interventionenwerden die Erlebnisse der Teilnehmer dann alsStorytelling in der Gruppe geschildert und dieVer knüpfung zum Heldenprinzip diskutiert. Die -se Kombination von Präsenz- und Fernlernenwird im Kontext des elektronisch unterstütztenLernens typischerweise als „Blended Learning“bezeichnet (Graham 2006). Daher bezeichnenwir diesen Ansatz als „Blended Game-basedLear ning“.
Public GamingDies bedeutet jedoch nicht, dass es nicht mög-lich und sinnvoll ist, eine Unterstützung derPräsenzphasen und die Erweiterung des bereitsumfangreichen Sortiments an kreativ-ästhe -tischen und performativen Übungen durch di-gitale Spiele anzustreben. Denn häufig sindkomplexe und teilweise abstrakte Interaktions-mechanismen ein Grund für die enormen Un-terschiede der benötigten Spielzeiten und dieempfundene Spielbegeisterung bei Nicht- undVielspielern.
Eine vielversprechende Möglichkeit, diese Bar-rieren zu umgehen, findet sich im zweiten An-satz, dem Konzept des Public Gamings. Basie-rend auf Pervasive Games, einer Verschmelzungvirtueller und realer Spielewelten, werden hierdie Voraussetzungen und Anwendungsmöglich-keiten für digitale Spiele im öffentlichen Raumbeschrieben. Dazu gehören kurzweilige, leichtverständliche Inhalte, verbunden mit intuitiverBedienbarkeit und möglichst expressiven Be-nutzerschnittstellen. Das können beispielsweiseakustische, haptische, bewegungs- oder ges ten -gesteuerte Eingabe- und unkonventionelle, auchfür Zuschauer gut wahrnehmbare Ausgabeme-dien sein (Conrad 2009). Durch die niedrigeLernkurve und die Möglichkeit zur Einbindung
ganzer Gruppen von Teilnehmern sind digitaleSpiele dieser Art auch hervorragend für den Ein -satz als kreativ-ästhetische und vor allem per -for mative Übungen in den Interventionen ge -eig net. Letztlich kann festgehalten werden, dassdie Unterstützung des Wissenstransfers durchdigitale Spiele im Allgemeinen sowie im speziel-len Kontext der Interventionen im Projekt HELDvielversprechende Möglichkeiten bietet. Hierbeimuss jedoch immer – unter Berücksichtigungder Vor- und Nachteile der verschiedenen Opti -onen – eine für die entsprechende Interventi ons -situation und das Teilnehmerprofil geeigneteAuswahl getroffen werden.
Die AutorenProf. Dr. Carsten Busch ist Professor für Medienwirtschaft an der Hochschule fürTechnik und Wirtschaft Berlin (HTW) in den Studiengängen Medieninformatik und Interaction Design / Game Design. [email protected]
Florian Conrad und Martin Steinicke sindwissen schaftliche Mitarbeiter der HTW [email protected]@htw-berlin.de
LiteraturConrad, F. (2009). Public Gaming – Exploring the Potentials ofPublic User Interfaces in Pervasive Games”, Bachelorthesis,HTW Berlin.Denning, S. (2001). How Storytelling Ignites Action inKnowledge-Era Organizations. Journal of OrganizationalChange Management, Vol. 14, Nr. 6, S. 609-614.Graham, C.R. (2006). Blended Learning Systems – Definition,Current Trends, and Future Directions. In Bonk, C.J. & Graham,C.R. (Hrsg.), The Handbook of Blended Learning: Global Per-spectives, Local Designs. Hersbruck: Pfeiffer.Herbst, D. (2008). Storytelling. Konstanz: UVK Verlag.Howard, J. (2008). Quests – Design, Theory and History inGames and Narratives. London: A K Peters.Rollings, A. & Adams, E. (2003). Andrew Rollings and ErnestAdams on Game Design. Prentice Hall Computer, S. 93.
Carsten Busch, Florian Conrad, Martin Steinicke
33præview Nr. 1 | 201132
Die in diesem Heft aufgezeigten Themen eröff-nen einen ersten Blick auf ein Spektrum offenerFragen, die mit Hilfe ästhetisch-performativerZugänge zur Organisation formuliert und be-antwortet werden können. Dieser Blickwinkelist notwendig, weil eine Ökonomie und Arbeits-welt, in der ein Umgang mit Offenheit und Un-planbarkeit immer weiter in das Zentrum rückt,andere Organisationsrahmen und Lenkungs -formen erfordern, als sie in Unternehmen undöffentlichen Einrichtungen vorzufinden odervorstellbar sind. Wachsende Komplexität undGe schwindigkeit in der Veränderung des Wis-sens und denkbarer Strukturen können wederdurch restriktive noch durch beliebige Rahmen-bedingungen sinnvoll gestaltet werden. Sollkre ative Leistungsfähigkeit gefördert sowieÜber- wie auch Unterforderung der Mitarbeiterverhindert werden, gilt es, die Erforschung neu -er Wege aus den stark vorstrukturierenden unddamit einengenden und manchmal auch wider-sprüchlichen Arbeitsanforderungen in der Inno -vationsökonomie mit Hilfe der in diesem Heftbeschriebenen neuen und unverbrauchten Zu-gänge weiterzuverfolgen.Künstlerische Prozesse auf Basis wissenschaft-licher Herangehensweisen genauso wie for-schende Zugänge in der Kunst gelangen geradein der Anwendung in Organisationen zu neu -artigen Erkenntnissen und transdisziplinär be-gründeten Ergebnissen („Artistic Research“) jen-seits linear angelegter Analysestränge, die dieVerknüpfung einer Maßnahme quasi eins zueins mit einer erwartbaren Wirkung verbinden.Sie bergen hohes Potenzial für die Entdeckungvon organisationaler Veränderungsfähigkeit undVeränderungsbedürftigkeit und damit meist mit -telbar auch innovativer Prozesse. Die Anwen-dung künstlerischer, erfahrungsgeleiteter undspielerischer Analyse- und Kommunikations me -tho den in organisationalen Settings lassen In no -vationen durch die Entdeckung des Anderen, desUnerwarteten, des Optionalen erwarten, das neu eWege des Handelns in Unternehmen eröffnet. Vor diesem Hintergrund erscheint die weiterge-hende Untersuchung von Improvisationsmus-tern oder der Funktionsweise ästhetischer Pro-zesse auf Innovationsarbeit im Speziellen undauf das Arbeitshandeln im Allgemeinen zur Ge-staltung der Zukunft bedeutsam. Hier schließensich folgende Forschungsüberlegungen an:
Vom Entdecken des Neuen durch die „Entüblichung“ des DenkensZur Programmatik eines ästhetisch-performativen Ansatzes in der Organisationsforschung und -gestaltung Wolfgang Arens-Fischer, Michael Brater, Karin Denisow, Stefanie Porschen, Bernd Ruping, Wolfgang Stark, Nina Trobisch
Erforschung von innovativer Arbeit Um einer kreativen Innovationsarbeit gerechtzu werden, bedarf es spezifischer Organisations -formen zwischen Geschlossenheit und Offen-heit, zwischen Planung und Raum für Unplan-bares, die helfen das kreative Arbeitsvermögender Menschen zu erschließen. Dadurch ergebensich neue Herausforderungen an die Arbeitsge-staltung – es gilt also herauszufinden, wie sichinnovative Arbeit konstituiert. æDurch welche spezifischen Eigenschaften
zeich net sie sich gegenüber Produktionsar-beit, indus trieller Produktion, Verwaltungs-oder Dienst leistungsarbeit aus? Welche Rollespielt hierbei künstlerisches, erfahrungsge-leitetes und spielerisches Handeln? Wannspricht man von Inno vationsarbeit als Kern-aufgabe, wie gestaltet sich Innovationsarbeitals Rand aufgabe?
Die These, dass innovative Arbeit neue Anfor-derungen an das Zusammenspiel von Offenheitbzw. Freiraum und die Lenkung in Organisatio-nen stellt, führt zunächst zu der Frage, wie dieErkennbarkeit ihrer Veränderungsfähigkeit be-fördert werden kann, damit „man“ sich nichtder Struktur und den Prozessen widerstandslosergibt. Zudem brauchen Mitarbeiter andere Fä -hig keiten, um in neuem Ausmaß zwischen Ab -straktem und Konkretem jonglieren zu können. æ Lassen sich informelle Prozesse und der Um-
gang mit implizitem Wissen fördern? Wiekön nen die Arbeit und die Organisation dazuentsprechend gestaltet werden?
Schließlich wirft die Leistungsbewertung bei In-novationsarbeit neue Fragen auf, da unklar ist,was hierbei die eigentliche Leistung ist.æWas muss eine Bewertung von Innovations-
arbeit tatsächlich berücksichtigen?
Das künstlerische Handeln und die Materialität des GestaltungsprozessesKünstlerische Prozesse haben sich längst vonklassischen Materialien und Techniken gelöst.Sie können generalisiert als die Art aufgefasstwerden, wie mit jedem Material – vom Rhyth-mus einer sozialen Interaktion, vom Bild einersituativen Konstellation bis hin zum eigensin-nigen Gestus eines Mitarbeiters – umgegangenwerden kann, um die darin immanenten Mög-lichkeiten zu erfassen und Überraschendes, Un-vorhergesehenes hervorzubringen, das zuvorgerade nicht in der Vorstellung vorhanden war.
Das, was sich am und im Material zeigt, was alsseinsmächtiger Befund dem Gestaltenden ent-gegentritt wie die Struktur des Marmors, ohnedie Michelangelo seinem David nicht dieseDyna mik und Vitalität hätte verleihen können– das ist, was den Horizont weitet und die Ko-ordinatensysteme des Gewohnten aushebelt.Die Entüblichung des Denkens und Handelnsüber die Achtsamkeit für das Vorfindliche wirdso Kennzeichen einer der Kunst entlehnten Ein-griffs- und Reflexionsweise für organisationaleProzesse. Dabei entstehen ständig neue Variationen im-pliziten Wissens über das Material, die zugleichan ihm erprobt werden. Mit künstlerischem Han -deln werden Ziele nicht erreicht, sondern neuegefunden, und Regeln nicht beachtet, sonderneigene gesetzt. Im künstlerischen Handeln wer-den (soziale, technische, organisatorische, poli ti -sche, biografische) Dynamiken aktiv gestaltet. æAbgesehen davon, dass der künstlerische
Pro zess selbst nicht ausreichend erforscht ist,stellt sich die Frage, ob und wie unterschied li -che Materialien auf den Prozess zurückwirkenund ihn modifizieren bzw. das künstlerischeSubjekt als ein in seinem Grunde zu tiefst so-ziales verändern.
Ferner sind für viele gesellschaftliche Hand lungs -felder Fragen der Anwendung, Übertragung undAusgestaltung zu klären, etwa im Hinblick aufkon krete Arbeitsprozesse, Organisationsent -wick lungen oder die Gestaltung von Bildungs -pro zessen. Generell ist die Bildungswirkungkünstlerischer Prozesse weiterhin umstritten.Schließ lich sind weder die subjektgebundenenVoraussetzungen des künstlerischen Handelnsklar noch die Formen, in denen man es erlernt,noch seine sozialen Rahmenbedingungen.
Die fluide Organisation – Organisation als ImprovisationDas Wissen, wie ein soziales System funktioniertoder wie innovative Prozesse ermöglicht wer-den, wird als „Practical Body of Knowledge“meist intuitiv und implizit angewandt und kon-tinuierlich ergänzt – ist daher immer in Bewe-gung. Die Analyse und Entwicklung von Mustern(Patterns) hat sich nicht nur zur Beschreibungdes impliziten Wissens etabliert, das sich fürHerausforderungen des Alltags in Organisatio-nen als erfolgreich (viabel) erwiesen hat. Mustersind auch in vielen anderen Bereichen (z. B. von
der bildenden Kunst und Musik bis zur theoreti -schen Physik, aber auch in Disziplinen ange-wandter Wissenschaft wie Architektur, Soft ware -entwicklung oder Pädagogik) die Grundlage derAnalyse impliziten Wissens, weil wir – wie Hirn-forscher und Psychologen sagen – in Musterndenken und handeln. Muster bilden auch jene„Minimal Structures“, durch die das Potenzialfür improvisatorische und kreative Problemlö-sungen im Handeln entdeckt werden kann. Fürdie Organisationsforschung gilt hier die Frage:
æWie kann das implizite Wissen der Muster (a)entdeckt und entziffert, und (b) auf eineWeise notiert werden, dass Flexibilität undKreativität nicht nur ermöglicht, sondern imorganisationalen Kontext geradezu heraus-gefordert werden?
Patterns in der Kunst und in Organisationen sindErgebnisse eines gemeinschaftlichen Prozesses,in dem Potenziale und Lösungsstra tegien ver-dichtet werden, die sich durch die Beschäftigungmit dem Material sowie in den eingeübten Vor-gehensweisen, Vorstellungen und Kompetenzender Handelnden herausgebil det haben. Auf dieseWeise verbinden sie be triebs wirtschaftlich ori-entierte Wertschöpfungsprozesse mit Kultur,Wissen und Perfor manz. Der Prozess der Mus-tererkennung in Organisationen dient dazu, dieStrukturen zu identifizieren und zu dokumen-tieren, die das Wesen einer Organisation ausma-chen und ihr den je spezifischen Stempel auf-drücken. æAuf welche Weise können Verbindungen zwi-
schen den Mustern gelingen? Ihre lexikali-sche Struktur, d.h. die Zeichen, semantischen
Dælphi – Blick in die Zukunft der Arbeitsforschung
Die Aufgabe der Arbeits ge stalt ungs- und Präventions forschung ist es, heute Kon zepte zu entwi -
ckeln, um der Wirtschaft und Gesell schaft die Mittel zur Ver fü gung zu stellen, rechtzeitig den Ent-
wicklungstendenzen der Zukunft zu begegnen. In dieser Kolumne werfen Experten einen Blick
nach vorn und skizzieren aktuelle Trends und zukünftige For schungsbedarfe.
Relationen und Bedeutungs- und Sinnfeldersind zu entschlüsseln. Die grammatikalischenRegeln der Verbindung zwischen Musternund zwischen Mustern verschiedener Diszip-linen sind zu analysieren, um diese in Orga-nisationen im Sinne einer Mustersprachenutzbar zu machen.
Ähnlich wie im künstlerischen Prozess, bildet dieachtsame Auseinandersetzung mit den organi-sationalen Befunden, dem Material und dendarin eingeschlossenen musterhaften Merkma-len die Grundlage für Variationen und Verbin-dungen, die – wie in der Improvisation – flexi-bles, kreatives Handeln und damit Innovationensowohl bei der (Er-)Findung als auch bei derUmsetzung jenes „Anderen“ ermöglichen, dasin der Zweckrationalität linearen Denkens undAgierens gar nicht erst in den Blick gerät.
35præview Nr. 1 | 201134
Impressum
præview – Zeitschrift für innovative Arbeitsgestaltung und Prävention2. Jahrgang 2011 – ISSN 2190-0485 – Erscheinungsort Dortmund
Herausgeber: Dr. Rüdiger Klatt, DortmundVerantwortlicher Redakteur: Kurt-Georg Ciesinger, DortmundOnline-Redaktion: Johannes JahnsLektorat: Ursula Meyer, Projektträger im Deutschen Zentrum für Luft-und Raumfahrt, „Arbeitsgestaltung und Dienstleistungen“, BonnDruck: Druckerei Schmidt GmbH & Co. KG, An der Wethmarheide 36, 44536 LünenLayout: Q3 design GbR, Blenkerweg 33, 44265 Dortmundfon 0231. 222 35 91, [email protected], www.Q3design.de
Bildnachweis: Porträts: Dörte Schröder, S. 2 (Balcázar); DagmarSiebecke, S. 3 (Klatt) und S. 34 (Ciesinger); Mike Gallus, S. 11 (Böhle);Josef Walter, S. 15 (Brater) und S. 17 (Wagner, Munz, Hartmann);Yuri Arcurs/fotolia.com, S. 19 (2); Ruth Hommelsheim, S. 25 (Dell);Florian Conrad, Martin Steinicke, Nina Trobisch, S. 29.
Bezugsadresse /Kontakt: Redaktion præviewgaus gmbh – medien bildung politikberatungMärkische Straße 86-88, 44141 Dortmund, fon 0231/47 73 79-30, fax [email protected], www.zeitschrift-praeview.de
Die in diesem Heft dargestellten Verbundprojekte werden aus Mittelndes Bundesministeriums für Bildung und Forschung und aus dem Euro pä -ischen Sozialfonds der Europäischen Union gefördert. Die For schungs -verbünde KES-MI (FKZ 01FM08008-14), THINK (FKZ 01FM08015-6) undMICC (FKZ 01FM08040-4) werden gefördert im Forschungsschwerpunkt„Innovationsstrategien jenseits traditionellen Managements“, der For-schungsverbund KunDien (FKZ 01FB08011-7) wird gefördert im For-schungsschwerpunkt „Dienstleistungsqualität durch professionelle Ar-beit“, der Forschungsverbund HELD (FKZ 01FH09159) wird gefördert imForschungsschwerpunkt „Balance von Flexibilität und Stabilität in einersich wandelnden Arbeitswelt“. Die Forschungsverbünde werden jeweilsbetreut durch den Projektträger im DLR „Arbeitsgestaltung und Dienst-leistungen“.
Künstlerische Arbeitsprozesse, Beschreibungs-sprachen und Instrumente spielen nach wie vorin Arbeit und Wirtschaft und den entsprechen-den Wissenschaftsdisziplinen keine bedeutendeRolle. Die Kunst- und Kulturbranche selbst istaber wirtschaftlich ungeheuer bedeutend. Siebewegt sich dabei nicht in einem Nischendaseinaußerhalb der Marktkräfte und -dynamiken, imGegenteil: In Deutschland sind weitaus mehrErwerbspersonen in Kunst-, Kultur- und Krea-tivberufen tätig als in der Automobilindustrie.Und doch arbeiten und leben viele Menschendort so „anders“, als wir es aus klassischer Pro-duktion und Dienstleistung gewohnt sind. EinBlick auf diese „anderen“ Arbeits- und Lebens-entwürfe lohnt durchaus.
Der Künstler als BerufsinnovatorDas Innovationsmanagement hat zum Ziel,Struk turen und Prozesse so zu gestalten, dasset was irgendwie geartet Neues entsteht, inten-tional-zweckorientiert oder zufällig-explorativ.In diesem Sinne ist der Künstler ein Berufsin-novator: Er strebt danach, mit jedem Kunstwerkwieder eine Grenze auszudehnen, eine neuePer spektive zu entdecken, ein neues Stilmittelumzusetzen, zumindest eine neue Variation desVorhandenen zu erschaffen. Kunst ist Inno va ti -on per se. Wie Michael Brater in seinem Beitragausführt, managet der Künstler aber die Inno-vation nicht, er nimmt beobachtend an Entste-hungsprozessen teil und begleitet diese quasi„helfend“, aber nicht steuernd. Die „Krise“ istdabei ein Teil des Innovationsprozesses.
Hier sind wir Arbeitsforscher „anders“. Wir ma-nagen, entwickeln Handlungsleitfäden, Check-listen, Instrumente und Toolboxen, die unserWissen über Gestaltungsprozesse kondensieren,interindividuell nutzbar machen und das Risikodes Scheiterns von Innovationsprozessen mini-mieren sollen. Da passen Versuch und Irrtum,Begleiten statt Steuern, Geschehenlassen stattPlanen und das Akzeptieren der Krise als schöp-ferisches Element nicht ins Bild. Aber vielleichtminimieren wir mit unserem „Innovationsma-nagement“ nicht nur das Scheiternsrisiko, son-dern auch die Chance auf Sprunginnovation.
Künstlerleben als Modell moderner ErwerbsbiografienDer Künstler kann aber auch als Vorbild in an -de ren Gestaltungsbereichen der Arbeitsforschungdienen. Seit mehreren Jahren rückt beispielswei -se die Frage der zunehmenden Diskontinuitätendes Erwerbslebens in den Fokus des Forschungs-interesses. Was wir nun als neue Flexibilisierung,Erosion des Normalarbeitsverhältnisses oderpostindustrielles Prekariat be-schreiben, ist bei Künstlern nieanders gewesen und machtden Künstler geradezu aus.Die Normalbiografie einesKünstlers ist unstet, nicht -line ar und dis kon ti -nuierlich, ge prägtvon dem Suchenund Beschreitenvon im mer neuenWegen.
Die Bedingungen der „neuen Arbeitswelt“ nähernsich durch Internationalisierung, Beschleuni-gung und Pluralismus immer mehr dem an, wasdas „künstlerische Leben“ schon immer ausge-macht hat: Unsicherheit und Ungewissheit, einNeben- (und Mit-)einander von Selbstver wirk -lichung und Selbstausbeutung, Erfolg und Schei -tern, Entwicklung und Krise, Flexibilität und Sta -bilität. Künstler gehen mit diesen Heraus forde-rungen „professionell“ um, nicht weil sie leidens-oder widerstandsfähiger sind, sondern weil sieHandlungsmodelle und ein Skillrepertoire besit -zen, um diese Diskontinuität und Unsicherheitzu beherrschen, und sich nicht zuletzt eigeneSicherungssysteme (wie die Künstlersozialkasse)geschaffen haben. Hier könnten wir Modelle un -mittelbar übernehmen.
Kunst als MethodenpoolWeitere Gestaltungsbereiche, in denen wir ganzkonkret von Künstlern lernen und unmittelbarkünstlerische Mittel einsetzen können, liegenim gesamten Emotionsbereich, in dem wir man-gels alternativer Methoden widersinnigerweiseimmer noch mit Verbalisierung arbeiten undda mit zwangsläufig rational konstruieren. Oderder Bereich der gesamten handlungsbasiertenund erprobenden Intervention, die bei uns nachwie vor ihren Höhepunkt in Rollenspielen undnachfolgender analytischer Reflexion findet.Künstler sind nicht die amüsanten Hofnarrender Arbeitsforschung, sondern bieten genaudort Instrumente, Beschreibungssprachen undHandlungskonzepte, wo wir mit unserem Me-thodenset nicht weiterkommen. Und wahrscheinlich übersehe ich an dieser Stel -le sogar die wichtigsten Impulspotenziale ausder Kunst, weil ich als „traditioneller“ Arbeits-forscher schon wieder viel zu instrumentell undzweckrational denke ...
Kurt-Georg CiesingerRedakteur der Zeitschrift præview
Der Künstler als Vorbild der Arbeitsforschung?Da ist Musik drin!
prævokation
Die fruchtbarsten Diskussionen entste-
hen durch den Austausch kontroverser
Ansichten. Die Kolumne prævokation
ist ein Fo rum für die Formulierung von
pointierten Stand punk ten abseits der
„herrschenden Meinung“.
Die Arbeitsforschung ist multi-, inter-, transdisziplinär. Wir sind es gewohnt, unsals Psychologen, Soziologen, Mediziner, Ökonomen, Ingenieure mit den Perspek -tiven und „Eigenarten“ der jeweils anderen wissenschaftlichen Disziplinen aus -einanderzusetzen, miteinander zu arbeiten und – zunehmend erfolgreich – gemeinsame Ergebnisse zu erzielen. Warum sind uns die Kollegen aus der Kunst-und Kulturwissenschaft immer noch so fremd? Weil sie so „anders“ sind! Dabeikönnten wir viel von Künstlern, Kreativen und Kulturschaffenden lernen.