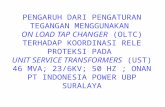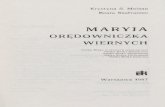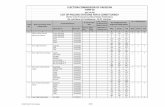4^ / I A\*f lüi - Repozytorium PK
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of 4^ / I A\*f lüi - Repozytorium PK
[ JJj
i3
■
i.::MPk"-f»
■
mfmwmVWi>#':Biv4'l• H’ ™ :k&§: ;•ilsliffiay.t*««*1mww \ ■
4^ / I A\*f? ' * 7
TviJizn. ts
ÜpK£g
pi S4|J'-''’•{•* ■■
B®L* « SS
lüi ffc;V| *-mi: : ^* I IIImI i$i V. n 5SiiKi'iraiifiÄ■ihhhhhhhi
h
|feS“";'
iOTWW!Hf»?8U$Tfl “i
Ilm}.«Y*f\V■RN
,
[1I |
PA
rs
’l
■.
I
: ■"
b}j 1l ;1
f
'
1
%
■■■%.V , . *w««»M
II\J
W;=®
■-
.
'Mr-
; jl,
3,
■j-—
jvgi
g.
«Uttrr JÄH.! MCi^' ri^r rgs®«!!|^| 4 <£■
■Mli Mlr / .**/1. > 3«
=i*5iS§M> K=i 4p % v ^*T►v-(fl Iffi ipi \ Ül l;Hj
«V*ii 11 Bigip|gkWm v // ^
§!Emm/ a-flSSO-© r* \2S
,111Igt:Ml r'
Iki ffe
({ fl|fl|| X ^ (( %| .f'-;: *• '";■':;;vÄ ’• * X ..x
s^.r.isro^*®*5j|j ’.'wwwMi'
Ifc^^fsß^x
H '-& XXS €
Ml3* x Vffl *MB
Xi ja: ; - 5MW
FPi^ü■x *•%-■
\' %l Ai a*2 ü:■ *?£y*ii i ~2?
A4w,■
sm.% mSkmmmm
> pm <Pm \
w j*t>i:'Aijf ii JjHßJ^gSSS^^«^»iKsÄrfcs 'V--
A ' X ÄS\ ’ ■"! xv~'' -c
£3— djjfiSZ,X*.A *c
r «r &BSSKii|f
RvBSHfiwnswSM»^'
■• '-mlfmimsm
mmm
Ser
SSI r**cC k£J^ \xWM u 1§p» • ‘ B\
fftV
s?w* :!j -fcXSM/ SU!feA \fe,A
i■Mi
S / ||XU hfl is£ig3® JTNV/
=|Ä<S»
©i^
3^:rr-0 PQ
jp|Sy
1#|K
•- ^feaaegSSlBiBfeg
f»
Bla aAMI
fseB..X ■j?
kV’m\
© ©X / / ifftSr Äl\
X /^ 4r \A^AA^x vy>'.
Mi iü sf-\....
sPREMti
t V.
PS 1X <■5gs
^ssrnkAmmma^i
jpM»M
v !AB '"*■+*’{**# -A;\
■X ■(!!Xia*
MÜS)■
mmM■rmi
WF- n i% m'S
VA vv saa^lP'Mk^lW
, Jfesg^jBgBihliotekr) Politechniki Kidkowskit'j
n •V■ a * flli Ha±@, wSm, e =m
|te /^;I
fj/^\3. .. ;X'
ea^p®
4-jgj|t x^.
.^-4' ;fc, ^AAiA^aans
hflr5« /■,100000302831$8 1
\A-
-^VA, rfk ^'^Av^-A\^-V, rEsü Ä'M;
m-X rorim/•
. _ &des £ V)
Urirlir-amtü des JimrrV/ Ax* >v>n C~k.:
1 (Wi ■ ,> ^' ^f ‘
frVA©!i A1w
5^o£<mni-.
V N«iÄ X 5 X
<*r <vt ^9HpX.. "
r 'SV'• -V *• ggSHfetfi)!*ßäßi,
Ipp==
ßiS I.»«!#.JlJjJl gr *vj■ ;'p>-1■
mm %wMm »
\ ¥?| TOT
ga^«Sw5^8g»^M^%aP"tälli kg• V-.jä#1 W'
mm ^ tQ&|jIüPI^.1*1».
. K-afaai m»5r^ C«f»M» ■SGL ^9 r * c#\ «BlIgk&gB*
i |A'C ■6gJ**ri B1ök Ww LJ“Ü1 Wi 11, 34mm gp-^JF
iÄ,«•»».,«»#»
1# ll&:Je£fil-mEM [Ä»
fe p?* 43 7im«ilsll ^
: » \
^pl®|pffSfciii
%jgn®g ^fiÜiw?wsm^K3 &#•■ 'Cr. ?
KS ■ä®f ■45fe."j“# E5
IP1V-£ %N ;SB?
RifM«***^1
/ \
ä^ssüH
sii i~-2^gUSWlmmw Vsiföjkv.4•^FiS^Vy?
:.3sMmsmI iw"5.. ,Ü^l1 iS•Ir ay*? raja1RiEÜH K$ a*safciP ?
«sy#\ 11«^i, Hi!“f'C ■ V( tw—■F
fe ÄjÄB.^
-JBSM|a
Bs rj*{• *v4
;4v; •J mm mawiI I ~K
^#T3 SSSK^IfaR a . m
mm 2?EMI raMNiwt
m .Vi
nmTb-klmmmm
•^aÖR^BJS®'iUB
4 V
m£4 ■nIi5=5 Ij7
■-jsm ? CHMm HkWirHr* JlsgV.y
mmr '• ^ 4‘,
....4!^h?.C^S$I»
I IfäÄfpWsllfl ■Bk!
V s?WLmx ssr^rgp
|m.ya
■IriiTTi
gi %» ■ pSf(liSiiBÜHWß Ä 7'fl04*
V J '"^ ’ *>- c7l|is»s Sbje«
gm1 > kl
■P;ai&A
4r/n
«teR • /Jüss; (fftlfi:,g> ^ssffissrfÄ;
Ü §i s,iiti.i«- 4P19 »«j[••il’.: ;J ■
HS3£
1sa
rnrörii
II
mm
Ss-S
IIP '|ft,§ , I »| 'I $§,, k i -.: f'•‘ittb ft »!i SHIii - • ff. 3'SB, f2*fc 3?:
ERf»v:i
-
;I I f I «ll 'fi SHü'.■V.
BEuJOf.j*-.Vj
| Ji {UJWj rii! ,MMs BK 2mL<4 IfZ
m.iüsi
m5Lvi’
iiWf
.[lill i
fi '■ 1 ’TiLKfe ■•
f -taiSd
2 f:'1 ‘{i !M ■
fl JXI I 1 #h .
Ili & trii,:uEs
II i II"S-'i j
«h
i imit 4t! m!-Wfi ftI' 'V. flk'y!v
ill »i:m■
! 'ii liil■I fwl
©*2fr
i:
V-\v
i I ii # miii».
sr-‘.fiiflI! f- Vti!1
I I ;B-j!fif ; Vi:
IfS ¥:; I■H
IVfei-1
11J
'
.t*.i
: ;'1 : :!.:1 } fi MXatm <m(h,i I
Ir ‘iTJjt'l ,1M f. I ' I■n j: j xoKiyjjh U r-«4V ?
: ESaj ■t i »%4 ’cnfeil* i 9 ÄL- iJf 'Stil ■/ i
4)%
V , il i.ML- •
Ikfi*'iV .' • W
&II!^ Ir, :fi
if‘1[»r-:
J ;
^l1I
II'
w
Ff
IIji (
Ä
mm
$,T
flÄ1!
«f
i\i
Her
man
n Riic
H/v
'srd
t,Ber
lin Gr•
Lic
hter
feld
e,ph
otu.
hel.
l-..i
- —^
T F
LT O
WK
AN
AL
.
PARK
B RU
CKE
BABE
LS B
ERG
.
.... -. ..
Äs
1’ ;f:r; "$U
- E-;’
’
«*
m
j V
FESTSCHRIFTZUR EINWEIHUNG DES
TELTOWKANALSDURCH
SEINE MAJESTÄT DEN KAISER UND KÖNIG
WILHELM II.
IM AUFTRÄGE DES KREISES TELTOW VERFASSTm
VON
ICHRISTIAN HAVESTADT Wfu
KÖNIGLICHER BAURATMITGLIED DER KÖNIGLICHEN AKADEMIE DES BAUWESENS
BERLINGEDRUCKT BEI ROB. ROHDE
1906
tfi.fXAV(
INHALTSVERZEICHNIS.
Vorgeschichte und Zweckbestimmung des Kanals...........................Linienführung und Längenprofil............................................................Die Boden- und Entwässerungsverhältnisse des vom Kanal durch
schnittenen Gebiets.................................................................Speisung des Kanals..................................................................................Abmessungen und Ausbildung des Kanalquerschnitts......................Erdarbeiten...................................................................................................Schleusen- und Wehranlage bei Klein Machnow.................................Das Schleusengehöft bei Klein Machnow................................. • .Wege- und Eisenbahnbrücken............................................................Leinpfadbrücken........................................................................................Sonstige Kanalbauwerke:
a) Die Hafenanlagen.......................................................................b) Grabeneinlässe, Rohr- und Kanalkreuzungen......................c) Wehreinbauten.............................................................................d) Ufermauern und Bohlwerke................................. .....
Einrichtung des elektrischen Schleppbetriebes.................................Das elektrische Kraftwerk.......................................................................Sonstige Betriebseinrichtungen:
a) Personenschiffahrt des Kreises.................................................b) Der Baggerbetriebspark des Kreises......................................c) Der Bauhof..................................................................................
Arbeiterverhältnisse und Wohlfahrtseinrichtungen.................................Anlagekosten.............................................................................................Verkehrsaussichten und Tarife............................................................Organisation der Ausführung, Bauverwaltung und Bauleitung
^ T \0 O
Ot
. oc
oo oo
r/N u^s
G\ON
ON ON 'J
' ^O
QC a\
fcO
_•
•_^n
OO
\O4^
^t00
C-1
Anlagen:
I. Genehmigungsurkunde für den Bau des Kanals.....................für die Treidelei......................................
III. Statistik des Verkehrs auf den Berliner und Charlottenburger Wasserstrassen
IV. Verzeichnis der Mitglieder der Kreis-Kanalkommission, derTeltowkanal-Bauverwaltung sowie der Bauleitung .... 98
V. Verzeichnis der beim Bau mit Arbeiten und Lieferungen beteiligten Unternehmer . .
II. •> •>
. . 94
. 100
Pläne:
Übersichtskarte der märkischen Wasserstrassen zwischen Elbe und Oder, Maßstab 1 : 400000.
Lageplan des Teltowkanals, der Verbindungslinie Britz-Kanne, und des Prinz Friedrich Leopold-Kanals, Maßstab 1 : 50000.
Höhenplan wie vor, nebst Kanalquerschnitten, Maßstab 1 : 500 und 1 :200.
Lageplan und Querschnitte der Machnower Schleuse, Maßstab 1 : 400 bezw. 1 : 2000.
: 50000 bezw.
'sO
3J
VORGESCHICHTE UND ZWECKBESTIMMUNG
DES KANALS.
0»I er Schiffahrtsweg von der Elbe zur oberen Oder führt zur Zeit aus der unteren Havel oberhalb Potsdam ausschliesslich über Spandau, Charlottenburg und von hier aus, unter Benutzung der Spree oder des Landwehrkanals, durch Berlin. Ausser den Drehbrücken in Spandau, welche infolge
des regen Eisenbahnverkehrs ein erhebliches Schiffahrtshindernis bilden, sind auf diesem Wege die Schiffahrtsschleusen von Charlottenburg und an den Berliner Dammmühlen, bezw. statt letzterer die Tiergartenschleuse und die obere Schleuse des Landwehrkanals zu durchfahren. Abgesehen von den Erschwernissen, welche der Schiffahrt hierdurch sowie infolge des erheblichen Umwegs über Berlin für die Fahrtrichtung von der Elbe zur oberen Oder erwachsen, bringt auch die starke Belastung der Wasserstrassen Berlins durch den Ortsverkehr und die Berührung mit der Großstadt erhebliche Zeit- und sonstige wirt-
] schaftliche Verluste mit sich. Unter diesen Umständen ist es erklärlich, dass seit langer Zeit der Gedanke einer südlichen |§||| Umfahrt um Berlin mehrfach erwogen worden ist.
I« Bei der Mehrzahl dieser Pläne war die Linienfüh-■
v rung so gewählt, dass die rasch fortschreitende Bebauungrrfirn ytm
der südlichen und westlichen Stadtteile Berlins und derMUSth« SWoitr 1900
anschliessenden Vororte die Ausführung dieser «Südkanäle» bezw. «Südwestkanäle» bald unmöglich machte. Der erste
dieser Pläne, der des Baurat Röder, stammt bereits aus dem Jahre 1861, also aus einer Zeit, als die Schiffahrtshinderungen in Spandau noch nicht bestanden (die Lehrter Eisenbahn war noch nicht gebaut). Der Kanal endete daher schon unterhalb Charlottenburg an der Unterspree.
WMmWjSo'Oa
I
Grössere Aufmerksamkeit erregte der Entwurf des Wirkl. Geh. Ober- Reg.-Rat Hartwich, den dieser 1874 in einer Broschüre unter dem Titel «Bemerkungen über die Schiffahrts- und Vorflutverhältnisse in und bei Berlin mit Anschluss eines Projektes zu einem Kanal von der Oberspree nach der Havel bei Wannsee» veröffentlichte, Der Berliner Architekten-Verein sprach sich 1875 in einer Denkschrift im wesentlichen zustimmend hierzu aus, hielt aber die gleichzeitige Regulierung der Spree in Berlin für erforderlich. Nicht günstig war das Urteil einer Kommission des Ministeriums der öffentlichen Arbeiten und des Polizeipräsidiums. Der Ausbau des Landwehrkanals, die Regulierung der Spree, einschliesslich der Beseitigung des Mühlendammstaues, wurden als wichtigere Aufgaben bezeichnet und in der Folge bekanntlich, wenn auch nicht ganz in dem anfangs geplanten Umfange,durchgeführt.
Im Jahre 1882 trat Major a. D. Wagner mit dem Vorschläge einerKanallinie auf, die vom Unterwasser des Landwehrkanals durch den Kurfürstendamm nach Halensee und durch die Grunewaldseen nach dem Wannsee geführt werden sollte, wobei namentlich auch die wirtschaftliche Seite des Unternehmens eingehend behandelt wurde. In Weiterführung dieses Gedankens wurden 1883 die späteren Ingenieure des Teltowkanals mit der Ausarbeitung eines Südwest-Kanals Berlin-Wannsee durch Interessenten der Westvorstadt beauftragt. Der Anschlag für den 18 km langen Kanal schloss mit 13,65 Millionen Mark ab.
Auch der Kreis Teltow hat sich mit der Frage eines derartigen Kanals schon früher befasst. Ein allgemeiner Entwurf für eine die Havel mit der Oberspree verbindende Kanallinie ist bereits im Jahre 1874 au^ Veranlassung des damaligen Landrats Prinz Handjery durch die Generalbaubank und 1881 von den Regierungsbaumeistern Höhmann und v. Lancizolle aufgestellt worden. Der Kanal sollte mit 4 Haltungen ausgestattet werden.
Der Initiative des Kreises Teltow unter Führung seines Landrats v. Slubenrauch ist es schliesslich zu verdanken, dass die Herstellung einer südlichen Umfahrt um Berlin endlich zur Tatsache geworden ist. Die Anregung hierzu entstand allerdings aus anderen Gründen, als sie bei den früheren Plänen ausschlaggebend waren, nämlich aus dem Bedürfnisse, den südlich und südwestlich von Berlin gelegenen Ortschaften des Kreises Teltow, insbesondere Britz, Tempelhof, Mariendorf, Lankwitz, Steglitz und Gross Lichterfelde, welche einer natürlichen Entwässerung ganz oder teilweise entbehren, eine wirksamere Vorflut zu schaffen.
W"’w KW.*.
m 'CT 14
V'
KL ä r
Erster Spatenstich am 22. Dezember 1900.
Bei dem raschen Wachstum dieser Vorortgemeinden und dem grossen Bedarf derselben an Bau- und Brennmaterial sowie an sonstigen industriellen Erzeugnissen lag es dann nahe, den Entwässerungskanal auch wirtschaftlich auszunutzen, d. h. ihn gleichzeitig zu einem Schiffahrtskanal derart auszugestalten, dass er den Interessen der Durchgangsschiffahrt von der Elbe nach der oberen Oder zu dienen imstande sei. Seitens der königlichen Staatsregierung sind dem vom Kreise verfolgten Plane gerade aus letzterem Grunde noch besondere Sympathien entgegengebracht worden.
Nachdem die Firma Havestadt & Contag im Aufträge des Kreises einen allgemeinen Entwurf aufgestellt hatte, wurde im März 1900 die Ausführung des Teltowkanals endgiltig beschlossen, der genannten Firma der Auftrag zur Aufstellung des endgiltigen Entwurfs und die Ausführung unter Aufsicht einer zu diesem Zwecke eingesetzten Kanalkommission und Kanal- Bauverwaltung übertragen. Am 22. Dezember 1900 wurde im Schlosspark zu Babelsberg, an der unteren Kanalendigung, in Anwesenheit Sr. Kais. Hoheit des Kronprinzen, der erste Spatenstich getan. Mit der eigentlichen Ausführung selbst wurde Anfang April 1901 begonnen.
ib
1/&
* i
H
•ul Z
|T *
\.W
f i
Bi.
r
EPw'
VI
mm
:■l
ii
k-ßV
im■H
1is?
MS »9
n,A
rt
mm
mmr;
mM /ft..*
111
mmm
am* t
r
''■Sä
?•Ö
T^**f'****.
Teltow.
LINIENFÜHRUNG UND LÄNGENPROFIL.(Vergl. Übersichtsplan und Längenprofil.)
Rolixw^er unteren Havel bei Klein Glienicke (der sogenannten Glienicker Hake) zweigt der Teltowkanal ab, führt durch den Griebnitzsee und alsdann das untere Beketal entlang bis Klein Machnow. Nach Kreuzung des Klein Machnowsees wird das
obere Beketal unter Benutzung des Schönow- und Teltowsees bis zur Grenze von Lichterfelde-Steglitz weiter verfolgt. Von hier ab durchbricht der Kanal das Hochgelände von Lankwitz, Mariendorf, Tempelhof und Britz, wobei die Linienführung durch die vorhandene Bebauung bestimmt war, um von dort in der Talniederung der oberen bezw. der Wendischen Spree nördlich von Rudow und Alt Glienicke bis zur Einmündung in die letztere zwischen Grünau und Cöpenick weiter geführt zu werden. Bei Britz ist noch eine Zweiglinie zur Oberspree unterhalb Nieder Schöneweide, an der sogenannten Kanne, in Ausführung, zwecks Herstellung einer Verbindung zu den zahlreichen bedeutenden industriellen Anlagen an der Oberspree zwischen Jannowitzbrücke und Cöpenick, sowie für den ausgedehnten Verkehr der östlichen Gebietsteile von Berlin.
Die gesamte Kanallänge beträgt von der Glienicker Lake bis zur Einmündung in die Wendische Spree unterhalb Grünau rd. 37 km, die Länge der Verbindungslinie Britz-Kanne rd. 3,5 km.
Stromaufwärts findet die von der Elbe zur Oder gerichtete Schiffahrt
M
•T
Glienicker Lake.
4
ihre Fortsetzung durch die Wendische Spree, den Seddinsee und die Werns- dorfer Schleuse zum Oder-Spree-Kanal, während von der Glienicker Lake die Richtung zur Elbe abwärts durch die Glienicker Brücke, den Jungfernsee über Nedlitz zum Sacrow-Paretzer Kanal führt. Die Wegeersparnis
gegen eine Durchfahrt durch Berlin beträgt für den Durchgangsverkehr
igjb^gj Elbe-obere Oder 16 km und für den Verkehr Elbe-obere Spree rd. 13,5 km.
Die einzige Schleuse des Teltowkanals, welche den Höhenunterschied zwischen derWendischenSpree(gleich dem oberhalb der Dammmühlen gestauten Wasserspiegel der Oberspree) und der unteren Havel vermittelt, be
findet sich bei Klein Machnow, unweit der jetzigen Staustufe des Beketals.Die massgebenden Wasserstände sind folgende:Für die Havel-Haltung des Kanals: Niedrigwasser + 28,97 (ent
sprechend dem beobachteten niedrigsten Wasserstande der Havel an der Langen Brücke in Potsdam), Mittelwasser + 29,56, Hochwasser + 30,54 NN,
52--XtZ3lSs3 ■ V\
Kanalmündung in die Havel (vor dem Durchstich).
; ,Wr
11. ■Oj
lL|
Kanalmündung in die Havel.
Kanalsohle + 26,47. Für die Spreehaltung: Niedrigwasser + 32,20, Normalwasser + 32,30 (entsprechend dem durch den Mühlendammstau gehaltenen Wasserstande der Oberspree), Hochwasser + 33,04 (höchster beobachteter Hochwasserstand der Spree an der Cöpenicker Brücke). Kanalsohle + 29,70. Das durchschnittliche Schleusengefälle beträgt mithin zwischen Mittelwasser der Havel- und Normalwasser der Spreehaltung 2,74 m.
5
Die Sohle des Kanals wird, abgesehen von der im Beketal liegenden Endstrecke der oberen Haltung, woselbst die Sohlenmitte, mit Rücksicht auf eine bessere Hochwasserabführung, eine muldenförmige Vertiefung nach i : 50000 erhalten hat, in beiden Haltungen wagerecht — also ohne Ge-
- angelegt.Die Ausbildung des Längenprofils des Kanals mit einer einzigen Stau
stufe bedingt natürlich auf längere Strecken ein tiefes Einschneiden des Kanalbetts, das im Mittel auf der Strecke Lankwitz, Mariendorf, Tempelhof, Britz etwa 9-10 m, an den höchsten Erhebungen bis zu 17 m beträgt. Entscheidend hierfür waren in erster Linie die Bedingungen, welche
fälle
die Entwässerung der durchschnittenen Vororte stellt; jedoch nimmt die Schiffahrt an den hierdurch erzielten Vorteilen, infolge vereinfachten und beschleunigten Betriebes, in wesentlichem Maße mit teil.
Durch den tief einschneidenden Kanal tritt eine Veränderung des Spiegels der durchschnittenen Seen ein: derohnehin versumpfte Schönowsee verschwindet vollständig, soweit er nicht zu Hafenzwecken erhalten bleibt, während der Machnowsee eine Absenkung seines Spiegels von + 32,85 NN bis auf + 32,30, also um 0,55 m, erfährt. Bei den steilen Ufern des Sees hat dies auf seine Oberfläche jedoch nur geringen Einfluss, sodass die reizvolle Gegend hierdurch in keiner Weise beeinträchtigt wird. Der Teltowsee sollte nach dem ursprünglichen Plane durch Führung des Kanals längs seines Nordrandes und Abschluss gegen den See in seiner ursprünglichen Spiegelhöhe von + 35,30 NN erhalten bleiben. Es ist jedoch hiervon Abstand genommen; der Kanal durchkreuzt, teils in 3-, teils in 4schifflgem Profil, geradlinig den See; letzterer erfährt also gleichfalls eine entsprechende Absenkung, während der Rest mit den Baggermassen aufgelandet wird.
Die Beke, welche früher als Vorfluter für die von Steglitz abwärts gelegenen Ortschaften diente, wird ebenso wie die seitlich einmündenden Bachläufe vom Teltowkanal aufgenommen; aus diesem Grunde musste auch die bei Klein Machnow gelegene, von der Beke bisher getriebene von Hakesche Mühle für den Kanalbau mit erworben werden.
Griebnitzsee.Krautungsarbeiten vor der Durchführung des Kanals.
i
Mllki N
> 1
!
fr
i'i
1
1 ii
I
f
P*■•lS
Ff
SPCfitfr#ä. rj^i. vört1/*
**-Äi>\ :Jjfe ^'!
üäfaSP-Tii :.
3!»rSähf-l*
•sj
Stolper Loch.
Im Anschluss an den Teltowkanal ist ferner noch, vom Griebnitzsee ausgehend, durch den Stölp- chen- und Kleinen Wannsee eine schiffbare Verbindung zum Wannsee hergestellt worden. Dieselbe ist für den Güterverkehr nur von lokaler Bedeutung; hauptsächlich ist sie bestimmt, die vorgenannten, landschaftlich bevorzugten, bisher von der Havel ab
getrennten Seen, für den Personen- und Vergnügungsverkehr aufzuschliessen und gleichzeitig einen wirksamen Spülstrom aus dem Wannsee durch die ehedem bereits stark versumpfte Seenkette bis zur Glienicker Lake zu leiten.
Alter Bekelauf bei Kohlhasenbrück (jetzt zugeschüttet und als Weg ausgebaut).
&&39.
iäi*.
b
i%
A L * L
9 %«V
*i
>*'k ,
5*
/
4 .-v
g *5
1*; i
■ -v v
J- rr. -Ttr
2-i
DIE BODEN- UND ENTWÄSSERUNGS
VERHÄLTNISSE
DES VOM KANAL DURCHSCHNITTENEN GEBIETS.
owohl nach dem Oberflächenbau, wie nach der geologischen Zusammensetzung lässt sich das vom Teltowkanal oberhalb des Griebnitzsees bis zur Spree in rd. 34 km Länge durchzogene Gebiet in vier verschiedene Abschnitte teilen, von denen der
erste von Kohlhasenbrück bis in die Gegend von Klein Machnow, der zweite von dort bis zum Verlassen des Beketals bei Steglitz, der dritte bis zum Rande des Spreetals bei Britz und der vierte schliesslich bis zur Wendischen Spree oberhalb Cöpenick reicht.
Die erste Strecke, km 3 bis rd. km 10, führt durch ein 5-6 km breites, sich von Spandau nach Südwesten erstreckendes, mit reichem Wald- bestande bedecktes Gebiet, dessen Boden in der Hauptsache aus reinem Sand in einer Stärke von mindestens 30 m aufgebaut ist. Stellenweise wird dieser Sand von dünnen, meist nur 0,5-1,5 m starken Decken lehmigen Bodens überlagert; ausserdem finden sich hier und da dünne Einlagerungen von Mergelsanden und Geschiebemergel, kleine Tonbänke und Kieslager. Dieser Boden ist befähigt, grosse Wassermassen aufzunehmen und gestattet den Durchgang des Grundwassers mit ziemlicher Geschwindigkeit. In dieses Sandgebiet sind zwei tiefe Rinnen, bis zu durchnittlich 32-34 m über Meereshöhe reichend, eingeschnitten, von denen die eine am Bahnhof Grune- wald beginnt und die bekannte Seenkette des Grunewalds darstellt, während die andere, welche sich mit der ersteren bei Kohlhasenbrück vereinigt, bei Steglitz beginnt und durch
i
JM
4^5
Teltow.
1 !'i
I IM
:V|j| i I.m•>*Ss 'if.i* i?*
Pl!'i|will* i
'',‘rf^j ! j
■'."wy |
", .
•"ff**;' ]•w4#■iJ.-i-V»
».M !#
’ül
.M?i ‘.
»M* .
I
j
w
'
t' h
"1jff
k> ,
Li»
iflWMV ([j, »I
IV •! j
%m
»I«M i
’
:«*
L.i !i
ii'f'Mw ! m11
11 I
M’,1,fc iR
4
I *
»C
"irr
•jCj5S
U££
t-?Jr
-V “=^s
s.g.
■✓IüM
i•, .
wmmmmmmmmm■
»*58«
'sves
aL§
;S£■•jp
;
. äW
*S
«iÜ
#2&
ii I T iT
iasiT
TT»z
izrisi
Z;?:
-;f :~
» ■»ar
i-H
s'lvV
333
m
STRA
SSEN
BRU
CKE
TELT
OW
•
TELT
OW
KA
NA
L
Gross Lichterfelde hindurch an den | Orten Giesensdorf, Teltow, Klein
Machnow und Albrechts Teerofen vorüber verläuft. Diese Rinne, welche nur noch drei Seen, den Klein Mach- nower, Schönower und Teltower See enthält, im übrigen durch Torf- und
Schlammbildungen verlandet ist, wird von dem Kanal benutzt. Ursprünglich ein einziger langgestreckter See mit gleichem Wasserspiegel, ist durch Absetzung eines kalkhaltigen Schlammes, der in feuchtem Zustande eine grosse Plastizität besitzt, nach dem Eintrocknen sich aber in einen hellen Kalkmergel umwandelt, die Rinne grösstenteils verlandet, und diese alsdann durch die Vegetation mit einer Torfschicht bedeckt, die jetzt den grössten Teil der Oberfläche des alten Sees einnimmt. Die ehemaligen Seespiegel zeigten eine verschiedene, von der Havel an zunehmende Höhe.
In der zweiten Strecke, km io bis 18,5, von Klein Machnow bis Steglitz, folgen den vom Kanal benutzten Seerinnen beiderseits ebene, nur von ganz flachen Rinnsalen durchzogene Plateaus, in welchen die in der ersten Strecke nur stellenweise auftretende dünne Lehmdecke allmählich grössere Mächtigkeit bis zu mehreren Metern Stärke annimmt. Sie geht nach unten in kalkhaltigen Geschiebemergel über. Teilweise ist sie hier wieder von Sanddecken von 1-2 m Mächtigkeit überlagert. Da diese Lehmschicht Wasser in nennenswerten Mengen nicht durchlässt, so kommt für den Kanal nur der Grundwasser
strom in Betracht, der sich in den unter dem Geschiebemergel wiederum lagernden starken Sandschichten bewegt. Die Seerinne ist in derselben Weise wie in der ersten Strecke durch Kalkschlamm und Torfbildung verlandet. Diese Schichten erreichen hier Stärken bis zu 17m und dar-
:
WijfV PA, 1■ > /. f-
Auerochsenschädel.
Elchschaufel.
1
r 5f,V
c * rg§|jfl
t
‘'"i
Riesenhirschschädel.
9
Sie haben sich als so wenigüber, ebenso wie auf der ersten Strecke, tragfähig erwiesen, dass die Einschneidung des Kanalbetts grossen Schwierigkeiten begegnet ist und eine kostspielige Sicherung desselben durch seitlich bis auf den festen Untergrund geschüttete Sanddämme erforderlich wurde. In den Torfschichten wurden, namentlich in der Nähe des Schönowsees, zahlreiche Hirschgeweihe, Elchschaufeln und Schädel von Auerochsen gefunden.
Die dritte Strecke von Steglitz bis Britz, km 18,5 bis 27, ist diejenige, welche die bedeutendsten Erdarbeiten erforderte, da sie die Hochfläche des Teltower Plateaus durchbricht, das einerseits leicht wellig bewegt ist und noch einzelne Hügel, andererseits namentlich im Laufe des Kanals zahlreiche, kesselartige Einsenkungen «Pfuhle», zeigt, die teils mit Wasser gefüllt, teils durch Verschlammen oder Vertorfung in Ackerland und Wiesen umgewandelt sind. Die mächtigste Schicht ist hier wieder der Geschiebemergel, der bei Steglitz mit 5 bis 7 m Mächtigkeit beginnt, vom Lankwitzer Hauptgraben dann allmählich mächtig anschwillt bis auf 16 m Stärke zwischen km 20 bis 21, dann in schwankender Stärke weiter verläuft und erst bei km 25,7 verschwindet.Von dort an liegt wieder der reine Sand zutage. Dieser Geschiebemergel ist überall wenig wasserdurchlässig, in den mächtigen Schichten fast wie reiner Ton gänzlich undurchlässig. Der Geschiebelehm ist stellenweise von Sand, stellenweise von Torf überlagert, durchweg nur von wenigen Metern Stärke. Unter dem Geschiebemergel liegt wiederum Sand, teilweise Kies in grösserer Mächtigkeit; hier liegt also auch der zusammenhängende Grundwasserspiegel.
Die letzte der drei Kanalstrecken liegt schliesslich im Spreetal, welches in voller Breite mit Sandmassen ausgefüllt ist, deren obere Schichten, die als «Talsande» bezeichnet werden, diluvialen Alters sind und zumeist mehr als 5 m Mächtigkeit besitzen. Die oberen Schichten, 4 bis 5 m, sind zunächst fein, darunter gröber, bis grobkiesig. An einzelnen Stellen finden sich flache, meist nur 0,5-1,5 m starke Torf- und Moorablagerungen. Das
Einschnitt bei Tempelhof.
IO
Kanalbett ist durchweg im Talsande eingeschnitten, in welchem sich der Grundwasserstrom bewegt.
Diese vom Kanal durchschnittenen Gebiete besitzen eine nur ganz unzureichende natürliche Entwässerung. Für das nach der Havel zu entwässernde Gebiet kommen nur die Beke nebst ihren Seitengräben und anschliessenden Entwässerungsgräben in Betracht. Die Beke hat von ihren Quellen im Schlossteich von Steglitz bis zur Mündung in die Havel eine Gesamtlänge von 22,8 km und bei gewöhnlichem Sommerwasserstande ein Gefälle von i 16900 bis 1 : 11600. Die Sohlenbreite schwankt zwischen 2 und 5 m, die Wasserspiegelbreite zwischen 3,6 und 6 m, die Wassertiefe bei mittlerem Sommerwasser zwischen 0,6 und 1,8 m. In die Beke münden eine Reihe von Zuflüssen, welche als Vorfluter der anschliessenden Feldmarken dienen, zumeist aber dieser Aufgabe nur in sehr unvollkommenem Masse genügen, soweit es sich nur um* die Entwässerung in intensiver Landkultur stehenden Gebiets handelt, in keiner Weise aber mehr ausreichen, sobald die Bebauung weiter fortschreitet.
Was vom Bekegebiet gilt, ist auch von den Vorflutverhältnissen des nach der Spree entwässernden Geländes zu sagen. Auch hier sind die Hauptabflussgräben nicht sachgemäss ausgebildet.
In diesen Verhältnissen werden durch den tief einschneidenden Kanal, dessen normaler Wasserstand erheblich unter den Wasserhöhen der bestehenden Vorflutgräben liegt, wesentliche Verbesserungen geschaffen; seine Ausführung gestattet namentlich auch die Herstellung einer zweckmässigen unterirdischen Entwässerung mit zahlreichen Regenauslässen nach dem Kanal. Letzterer Vorteil wird sich auch noch in grösserer Entfernung vom Kanal geltend
n machen und auch den Anschluss grösserer Teile der Gemeinden Friedenau, S<, Schöneberg und Wilmersdorf ermöglichen.
11
SPEISUNG DES KANALS.
1 s Niederschlagsgebiet des Kanals kommt insgesamt eine Fläche von rd. 19350 ha inbetracht. Es kann daher nach den üblichen, in dem vorliegenden Fall, nach Lage der geologischen Verhältnisse, indessen wesentlich hinter der Wirklichkeit zu
rückbleibenden Annahmen auf einen geringsten sekundlichen Zufluss von 0,75 cbm aus dem Niederschlagsgebiet gerechnet werden. Der gesamte Wasserbedarf des Kanals stellt sich aus Verdunstung, Versickerung und Betriebswasser zur Zeit stärksten Verkehrs auf 0,862 cbm/i Sek., für den 24stündigen Tag gerechnet. Wiewohl nun die Oberspree bei niedrigstem Wasser noch -13 — 15 cbm/i Sek. führt, ist, mit Rücksicht auf das Spülbedürfnis der Berliner Wasserstrassen, eine Wasserentnahme für die Zwecke des Teltowkanals zu Zeiten niedrigeren Wasserstandes der Oberspree seitens der Behörden als unzulässig bezeichnet worden. Es wurde demgemäss zwecks Sicherstellung des Betriebswassers, an der Schleuse zu Machnow ein Pumpwerk gefordert, welches in der Lage ist, in der Sekunde bis zu 1 cbm aus der unteren Haltung der oberen Haltung zuzuführen.
Die im Interesse der Reinhaltung des Wassers aus gesundheitlichen Gründen erforderliche zeitweise Spülung des Kanals muss daher auf Zeiten mittlerer und höherer Wasserstände beschränkt werden, bei denen die Oberspree mehr als 50 cbm (bei Hochwasser bis zu 150 cbm) führt.
Seitens der Behörden ist gleichzeitig die Auflage gemacht, dass zu Zeiten von Hochwasser zur Entlastung der Oberspree 25 cbm durch den Teltowkanal abgeführt werden sollen; es ist zu diesem Zwecke die Anordnung eines Freigerinnes an der Schleuse bei Klein Machnow vorgesehen.
Inzwischen weiter angestellte eingehende Ermittelungen über den künftigen Wasserhaushalt des Teltowkanals haben ergeben, dass die im Vorentwurf hierüber gemachten Voraussetzungen nicht allein erfüllt, sondern in Wirklichkeit übertroffen werden, sodass es weiterer künstlicher Vorkehrungen für die Spülung und Wassererneuerung des Kanals voraussichtlich nicht bedarf.
12
ABMESSUNGEN UND AUSBILDUNG
DES KANALQUERSCHNITTS.
er Kanal erhält eine Sohlenbreite von 20 m; bei der gewählten muldenförmigen Gestaltung der Sohle in der Mitte eine Tiefe von 2,50 m und in beiderseitiger Entfernung von 10 m von der Kanalachse eine solche von 2 m. Der Kanal ist somit zur
Aufnahme von Schiffen von 1,75 m Tiefgang und bis zu 600 t Tragfähigkeit geeignet.
Soweit nicht ausnahmsweise steile Uferschälungen errichtet werden, sind Neigungen von 1 : 3 unter Wasser angelegt. In ungefährer Höhe des Niedrigwassers erhalten die Böschungen, je nach der Art des Geländes, eine Befestigung durch längere oder kürzere Pfahlreihen mit darüber liegender Deckung aus Steinbewurf oder Betonplatten. Die Anlage der Böschungen über Niedrigwasser schwankt je nach der Art des Geländes zwischen 1 : 1,5 und 1:2. Die geringste Höhe des 2 m breiten Leinpfads über Hochwasser beträgt 1 m. Die verschiedenen Arten der Querschnittsausbildung und gewählten Uferbefestigungen sind auf der als Anlage beigegebenen Tafel 3 dargestellt.
Der geringste, nur vereinzelt vorkommende Krümmungshalbmesser beträgt 500 m. Innerhalb derartiger stärkerer Krümmungen soll die Sohle, und zwar auf der von der Kanalachse aus gesehenen konkaven Wasserseite, eine Verbreiterung bis zu 5 m erhalten, welche sich allmählich auf o m für einen Krümmungshalbmesser von 1000 m verringert.
er
>y $Hk i' n
3 -V-sTVv
jvV
n
V
u1^4
Rammarbeiten für die Uferbefestigung im Britzer Hafen.
*3
SUSI• x.
Bagger an der Giesensdorferstrassenbrücke.
ERDARBEITEN.
Beschaffenheit des Ge- ländes war auch der Be
trieb der Erdarbeiten innerhalb der wechselnden Geländeabschnitte ein sehr verschiedener. Am einfachsten gestalteten sich dieselben innerhalb der
*2 .ajfcr;
Ä-sHL>.' ',;_K
Bagger-Stufenbetrieb bei Tempelhof.
obersten Strecke von Grünau bis Britz, sowie am Verbindungskanal Britz- Kanne. Der dort angetroffene leichte, zum Teil mit Kies durchsetzte Sandboden konnte grösstenteils mittels Trockenbagger unter verhältnismässig leichter Wasserhaltung gefördert werden. Die Unterbringung des Bagger
guts wurde dadurch wesentlich erleichtert, dass die gleichzeitig betriebene Hebung und der viergleisige Ausbau der Görlitzer Bahnstrecke grosse Bodenmengen erforderten, welche trotz der zum Teil grossen Transportweiten eine zweckdien-.
eheliche Verwendung des
Bodens■
gewonnenenermöglichten.
2.“
Erdarbeiten in Klein Machnow.
1 4
* ’ v i•■
SS<:
BK
fJ
j'*
5 '’fH
;s
r
.
ftev
V '
m
S-Ulfn:V
I d
I
Ü4 S
T
*¥s
■
-mt■
Ms
,1.■
M£-
ihk
Kt if
lm
Gleiche oder ähnliche Verhältnisse lagen auch für die weiter abwärts folgende Strecke bis Tempelhof vor, nur dass hier die wesentlich tieferen Einschnitte in dem nach der Oberspree sich abdachenden Gelände eine grössere Wasserhaltung erforderten, auch die Bodenförderungen in den zum Teil mit sterilem Lehm durchsetzten tieferen Schichten die Arbeit der Trockenbagger erschwerten. Entsprechend den bis zu 18,0 Meter hinuntergehenden Tiefen des Kanaleinschnitts wurden hier zum Teil Stufenbetriebe eingerichtet, derart, dass die in der Richtung von Britz nach Tempelhof betriebene Bodenförderung, mit Rücksicht auf die umgekehrte, also zur Oberspree gehende Vorflut, unter tunlichst geringer Wasserhaltung erfolgen konnte.
Der in der Britzer Lage zum Teil angetroffene Kies wurde hierbei seitlich ausgesetzt und für die Zwecke des später zu verlegenden elektrischen Treidel-
’S®Ml- 'v. '«* 1
-EU.
Tiefbagger. Hochbagger.
gleises aufgehoben. In diesem Gelände war es auch, wo die weitaus meisten durch den Kanalbau zutage geförderten vorgeschichtlichen Eunde — Reste von Mammutknochen, sowie zahlreiche Bernsteinspuren — gemacht wurden.
Der erheblich schwierigere Teil der Erdarbeiten befand sich auf der Weststrecke des Kanals, von der Berliner Strasse in Tempelhof-Mariendorf, der ungefähren Scheitellinie des hohen Teltow, abwärts. Die nächst der Oberfläche liegenden Sande nehmen hier bald an Mächtigkeit ab, werden vielmehr in den unterliegenden Tiefen von tonigen und mergelhaltigen, zum Teil vollständig schluffigen, teilweise auch mit Moor durchsetzten Schichten abgelöst, die bei reichlichem Wasserandrang aus dem oberen Grundwasserstrome zu zahlreichen Rutschungen führten und die Ausführung der Erdarbeiten sehr erschwerten. Auch hier wurde die Erdförderung durchweg im Trockenen, und bei den grossen zu bewältigenden Bodenmassen — die Einschnittstiefen betragen zwischen Tempelhof und Lankwitz-Steglitz bis zu
15
'ff.0
I-#
■ jv.. V ^*5»■
m :..;. tgf£
; j
1?>*W £
iV;.mm4 -*.«
p
-.
Handschächtefast ausschliesslich mittels Trockenbagger bewirkt, kamen hier, ebenso wie innerhalb der vorerwähnten oberen Strecke, nur aushilfsweise, vornehmlich zum Abbau der mittels der Trockenbagger nicht mehr förderbaren letzten Bagger- und Gleissätze, vor. Im übrigen ist überall da, wo die Trockenbagger in Tätigkeit getreten sind, durch abwechselnden Um-
16 m
bau derselben zu Tief- und Hochbaggern, eine weitgehendste Ausdehnung dieser Betriebsart und Ausnutzung der Baggerapparate erzielt worden.
Wesentlich anders liegen die Verhältnisse im Beketal, das innerhalb derGemarkung Steglitz beginnt und vom Kanal bis zu seiner Ausmündung in den Griebnitzsee verfolgt wird. Abgesehen von einigen, im Interesse einer schlankeren Linienführung oder zwecks Gewinnung von besserem, zur Schüttung von Leinpfaddämmen geeigneten Bodenmaterial, angeschnittenen
Sandnasen wurde auf der westlichen Strecke — innerhalb des Beke- tals — ein grösstenteils von kalk- und mergelhaltigem Schlamm durchsetztes tiefgründiges Gelände ange- troffen, das die Ausführung der Erdarbeiten, zumal bei dem herrschenden hohen Grundwasserstande, ausser
ordentlich erschwerte. Ein profilmässiger Aushub und standsichere Böschungen waren nur dadurch zu erzielen, dass zunächst die Leinpfaddämme mittels besseren, sandigen Schüttmaterials durchgedrückt wurden. Letzteres wurde innerhalb der Kanallinie nur vereinzelt und spärlich angetroffen, musste viel-
Dammschüttungen bei Klein Machnow.
Schüttgerüst im Schönowsee.
I 6
■
ܧ4k<.
'am .mmmm ------
■»_____
m4L
mm
»tS?fg£Sgjfes.'
IßS k■ J,: ♦ -.•••
1p5|
- •$|£.v'<^ 1 N\
kFS;V\
,-V':,5>-:i&
%'% yv>j
ÄdJr. ^
M.L&;5£A0!j3
Bf-' ...
km;V?-V J %<•"■* *-*m
[r^S|
>
6kjrIS—V
;/$ *
c*> -jfc
ls:\. ■ ^^iiitfPi■ ’ f- ÄAV,- *; L v4 ’4
.'**■
ält^W mv-r.:.«•fr'- ‘& m h •v.%
ri ,r«.. • jEHF . ^s- ■[* V :-
'wmm
i;£&NlgNi* * ■-? * ,1p- Bei
ms&/*•
rVv ■ *• <i*.
K
I;
.« r;Vy ,' *f-aik [!| m .-tv
■ I **, ,/rii \\ LlvmfeflflK^"'
|
• it? • os!■*-'%:■<
pSr-if*k rV-e-
k*
*i *^IswJIhIItopi !■■')’■ ■
:'Vj'?j( • V :ivvii?4 LV?
[i L *v
IteliiUfilM
HM.
ma§1
&p?
ipyfc-M i H*/f f !igjj 1:ifjj/.
>jUWgsrfMI
li f'^Wil»! i
HAU•< = I JUi&
f1 fl: ■
il!i
liiiit'>t- ni1/1. Kä%
M -Kl■
lisilp iiMiff#M
ilf11»!
|.|
11 '
.»:k, j| Jh
"1;?lil
:f ■! a i«if
iitc'f» if i|a
lil 7-ilf/51
S-
• « iff
. T
r,
EB
N
>>
i
1
m
m t,£2S w-
Her
man
n Rüc
kwar
d+. B
erlin
, Gr.-
Lich
terfe
lde,
phot
u.he
i-
> >
^ •
ftrfrr
i
TE L
TO W
K A
N A
L
MAR
IEN
DO
RFE
R WE
GEB
RU
CKE
.R
I X D
O R
F
mehr grösserenteils aus den benachbarten höher gelegenen Talrändern neu geworben werden. Die Schüttungen selbst mussten mit äusserster Vorsicht vorgenommen und konnten nur langsam gefördert werden, da sie in dem wenig standfesten Gelände, zum Teil sogar unter Anwendung von Prahm- und Pfahlkippen zu erfolgen hatten, um die gleichzeitig erforderlichen Längstransporte aus den oberen Kanalstrecken, gegenüber den stetigen Dammversackungen aufrecht zu erhalten.
Die Dammschüttungen haben, nach den vorgenommenen Bohrproben, Tiefen von im Mittel 12 bis 15 Meter, ja bis zu 20 Meter erreicht. Der Böschungsfuss der beiderseitigen Schüttungen reichte gewöhnlich zusammen; die Aufpressungen, welche diese sowohl im Kanalquerschnitt wie ausserhalb desselben im Nachbargelände veranlassten, erreichten zeitweise Höhen bis
>
M|P '• i
päM ' ’ Ä'
j; *farnm .■
hi». ...•**I'.55
|§g
Rinnenelevator.Eimerbagger in Klein Machnow.
Dass innerhalb dieses Geländes die Trockenbaggerzu 3 und 4 Meter, versagten, ist selbstverständlich; es musste hier vielmehr innerhalb der oberenSchichten zur Handarbeit, und in den tieferen Lagen, wo die Wasserhaltung sich besonders schwierig gestaltete, sowie in den Seeabschnitten zum Nassbaggerbetrieb übergegangen werden. Beide Betriebsarten gestalteten sich um so zeitraubender, als die seitlichen Dammschüttungen fortgesetzt zu neuen Bodenauftreibungen Veranlassung gaben.
Für die erste Förderung aus dem Kanalprofil dienten im Nassbaggerbetrieb ausschliesslich Eimerbagger. Insoweit das Baggergut nicht in Prähme gebracht, sondern sofort seitlich der Kanaldämme in den Wiesenniederungen abgelagert werden konnte, geschah letzteres mittels Spülrinnen von 60-80 m Länge, denen das nötige Wasser vom Bagger aus mittels besonderer Pumpen zugeführt wurde. Da, wo grössere Transporte des Baggergutes erforderlich wurden, erfolgte die Entleerung der Eimerbagger in Baggerschuten, aus denen
17
das Baggergut sodann entweder — bei kürzeren Längen — mittels Rinnenelevatoren oder — bei längerer Verteilungsfläche — mittels Sauge- und Druckpumpen den Verteilungsflächen zugeführt wurde.
m¥ ; 3F i.t.»r>V
3IS
-Erfreulicherweise wur
den derartige Aufnahmeflächen in grösserem Umfange im Beketal selbst angetroffen und ist mit der Aufhöhung der betreffenden Gelände zugleich ein gut Stück Melioration derselben erreicht worden.Früher zum Teil unnutzbare oder saure Wiesen wurden durch die Aufhöhung nicht allein rein landwirtschaftlich verbessert, sondern auch zugleich für spätere industrielle Verwertung nutzbar gestaltet.
Während der rd. 4V2 Baujahre, von denen auf die eigentliche Bodenförderung — nach Abzug der Winter- und der durch die schwierigen Arbeitsdispositionen bedingten Ruhemonate, — etwa 40 wirkliche Arbeitsmonate zu rechnen sind, wurden im ganzen rd. 1 1000000 cbm profilmässig gefördert. Hierzu kommen aus den für die Damm-
Bodenauftreibungen in Gross Lichterfelde.
» 4i-14
Bodenauftreibungen in den Wiesen bei Teltow.
1»-V «fcSVK
1
Auftreibungen im Schönowsee.
18
7J-
-M 7^& S!?. . Ä2£T Ül. ~ ■ ül fgb§§IS 31|
- : ::;• , T~
Schüttungen erforderlichen Seitenentnahmen rd. 1600000 cbm, mithin im ganzen 12600000 cbm.
Durchschnittlich waren in den verschiedenen Baulosen zur Zeit der stärksten Förderung beschäftigt: 6 Trockenbagger zu je 120-150 cbm durchschnittlicher stündlicher Leistung; 10 Nassbagger zu je 40-60 cbm durchschnittlicher stündlicher Leistung; 9 Elevatoren, Schutensauger und Druckpumpen zu je 40-60 cbm durchschnittlicher stündlicher Leistung; rund 800 PS Wasserhaltungspumpen; 42 Stück Lokomotiven mit zusammen rund 3600 PS; 1330 Loren von 0,5-3,5 cbm Fassungsvermögen und rund 90 km Transportgleis von 0,60, 0,75 und 0,90 m Spurweite; 2700 Arbeiter.
Bagger mit Druckleitung im Schönowsee.
19
: . *.:r
Ä mm
nü SCHLEUSEN- UND WEHRAN
LAGE BEI KLEIN MACHNOW.
Mi
_____ _ ’feg|1 1 1 I 1 ujm aJK& .. H ■»<.jCePi-«
.gm»*.- L,£j --: .
V».Hillit>
^ ~ "■ Die bei Klein Machnow, rd. 6oo m unterhalb des Machnowsees erbaute Schleuse ist die einzige des Teltowkanals; sie trennt die beiden Haltungen, die Spree- und die Havelhaltung und vermittelt den Ab- und Aufstieg der Schiffe bei einem mittleren Gefälle von 2,74 m, das
zu Zeiten, wo in der Havel der niedrigste Wasserstand herrscht, auf 3,33 m steigt. Während das Unterwasser sich nach dem jeweiligen Havelwasserstande richtet (NW + 28,97; MW + 29,56; HW + 30,54 NN), ist der Wasserstand des Oberkanals im wesentlichen durch den Höhenstand der Spree bei Grünau bezw. Niederschöneweide, den Anfangsstellen des Kanals, bedingt. Bei Niedrig- und Mittelwasser der Spree wird hier annähernd der gleiche Wasserstand herrschen wie an den Wehren am Mühlendamm in Berlin, die einen gleichmässigen Jahreswasserstand von + 32,28 NN halten sollen. Führt die Spree aber grössere Hochwassermengen mit sich, so haben in früheren Jahren die Wehröffnungen des Mühlendamms zur Wasserabführung in gewünschter Weise manchmal nicht ausgereicht, und es trat am Mühlendamm ein Aufstau ein, der für die Durchfahrt der Schiffe, infolge der verminderten Durchfahrtshöhe, unbequem war. In Zukunft wird nun der Teltowkanal einen Teil des früher allein durch die Berliner Wasserläufe geflossenen Hochwassers insoweit aufnehmen, als an der Schleuse stets ein bestimmter Wasserstand, nämlich höchstens + 32,30 innegehalten werden soll und zwar auch dann, wenn die Spree bei Grünau einen höheren Wasserstand zeigt. Als höchster an der oberen Kanalmündung jemals zu erwartender Stand ist der von + 33,04 angenommen worden, derselbe, der im April 1895 bei Cöpenick sich einstellte (als freilich die Regulierungsarbeiten im Oberund Unterkanal des Mühlendammwehrs noch nicht beendet waren); alsdann
■- j5Jtp
20
würde bei dem absoluten Gefälle von 0,74 m auf der 28 km langen Strecke der oberen Kanalhaltung eine sekundliche Wassermenge von 25 cbm durch den Kanal fliessen, die bei Machnow durch ein mit dem Schleusenbauwerk verbundenes Freigerinne abgeführt wird. Es ist allerdings zu erwarten — besonders wenn die Regulierungen im Spreewald ausgeführt sein werden—, dass ein Hochwasserstand von + 33,04 sobald nicht mehr eintreten und somit auch nicht jene genannte Hochwassermenge dem Kanal und dem Machnower Wehr zufallen wird. Gleichwohl ist mit Rücksicht auf die Ermöglichung einer rascheren Wasserspiegelsenkung und erwünschter Entlastung der Oberspree dem Wehr ein Quantum von 25 cbm in der Sekunde bei Hochwasser überwiesen worden.
Die Schleusenanlage ist eine Doppelschleuse;
sie besteht aus 2 nebeneinanderliegenden, durch eine 12 m breite Plattform getrennten Kammern, diemiteinander derart verbunden sind, dass eine jede der anderen als Sparbecken dient. Hierdurch kann bei regelmässigem Betrieb stets die Hälfte des Wassers gespart werden. Es hat dies freilich zur Voraussetzung, dass stets zu gleicher Zeit ein Schiff in der einen Kammer talauf und eines in der anderen talab geschleust wird; dies wird im allgemeinen zu erreichen sein, da infolge der Übernahme des Treidelbetriebes durch den Kreis selbst die Ankunfts- und Abfahrtszeiten für die Schiffe an der Schleuse scharf geregelt werden können. Ist nur ein Schiff zu schleusen, so erspart der Doppelkammerbetrieb immerhin V3 des Wassers.
Die Kammern besitzen eine Nutzlänge von 67,0 m und eine Breite von 10,0 m. Die Länge entspricht der der künftigen Mittellandkanalschleusen, die Breite ist von der für diese vorgesehenen von 8,60 m auf 10,0 m erhöht
I
mMl1* W-
I
« ; s) :• Ji?' * iM Ji w,V-0*2
Schleusenbaustelle im August 1903.
21
worden, damit auch 2 nebeneinander gekuppelte Finowkähne, die eine Gesamtbreite von 9,20 m aufweisen, bequem durchgeschleust werden können. Die Drempel liegen auf + 29,00 bezw. + 26,47 NN; die Fahrtiefe beträgt demnach an der Schleuse im Oberkanal 3,30 m unter Normalwasser undim Unterkanal 2,50 m unter NW und 3,09 unter MW.
Die Verbindung einer jeden Kammer mit dem Ober- und Unterwasser geschieht durch beiderseits der Kammern liegende Umläufe von je 2,46 qm Querschnitt, von denen aut jeder Seite 9 Einläufe von je 0,72 qm Querschnitt abzweigen, sodass das in die Kammer einströmende Wasser aut
VVrT~'*-.;/■*»£ F-* i1 • MT» 1
,,, ÜK* - r-r ■
deren ganze Länge sich verteilt und in ruhiger Bewegung die Schiffe hebt.
Die Verbindung beider Kammern unter sich geschieht durch einen im Oberhaupt liegenden Querkanal, der sich an die seitlichen Umläufe anschliesst. Hierbei sei erwähnt, dass der Scheitel der in den Kammerwänden befindlichen
Unterhauptheber der Mittelmauer.
Umläufe nicht horizontal liegt, sondern von den Abschlussstellen im Oberund Unterhaupt an zu einer Mauerwerkaussparung etwas ansteigt, die ähnlich wie ein Dampfdom hier bezweckt, die während der Schleusenfüllungen in den Umläufen mitgerissene Luft zu sammeln. Von jedem Scheitelraum führt ein circa 0,01 qm grosser Luftkanal in gebrochener Richtung zur Schleusenkammer und gestattet somit das Entweichen der Luft aus den Um-
(1
C l4!
1 “-'fiUi'läufen, die sonst in diesen verbleiben und das Einfliessen des Wassers beim Füllen der Kammer beeinträchtigen würde.
Der Abschluss der Umläufe geschieht durch die am Elbe-Trave-Kanal bewährten Hotoppschen Heber. Jede Kammer besitzt deren 4, je 2 am Ober- und Unterhaupt. Die Verbindung bezw. der Abschluss der beiden Kammern, zwecks wechselseitiger Füllung derselben, erfolgt gleichfalls mittels eines am Oberhaupt in der Mittelmauer angeordneten Hebers. Der Über-
Verbindungsheber.
22
fallrücken desselben liegt auf + 32,33, also 3 cm über dem. normalen und höchsten Wasserstande; der Scheitelquerschnitt beträgt rd. 1,38 qm. Die Heber sowohl die Kappen, wie die Schenkel — sind aus schmiedeeisernen Blechen zusammengenietet und durch kräftige Verankerungen mit dem sie umgebenden Mauerwerk verbunden. Die Eisenbleche reichen 10 cm unter den tiefsten Wasserstand hinunter und gewährleisten somit eine absolut luftdichte Ausbildung der Heber. Es erschien die tiefe Hinunterführung der Eisenverkleidung nötig, weil ohne sie zu befürchten steht, dass das Mauerwerk bei seiner Porosität doch etwas Luft hindurchlässt und dadurch dieWirkungsart des Hebers unmöglich macht oder doch beeinträchtigt.
Die Kammern werden gegen die beiden Haltungen durch senkrecht auf und nieder gehende Hubtore abgeschlossen. Bei der Wahl der Tore ist von ^ . den üblichen Stemm- ii ,«* bezw. Klapptoren aus folgenden Gründen abgesehen worden:
Durch den in senkrechter Ebene liegenden Abschluss der Kammern wird infolge Ersparnis an Torkammerlänge das beim Schleusen verloren gehende Wasser auf ein geringstes beschränkt, zumal zugleich ein dichterer Wasserabschluss erzielt wird, als bei Toren, die eine Drehachse besitzen. Ein weiterer wesentlicher Vorzug der Hubtore besteht darin, dass sie auf die Wände keine stemmende Kraft ausüben. Vor allem aber darf hervorgehoben werden, dass bei Anwendung von Hubtoren an der ganzen Schleuse kein beweglicher, dem Betrieb dienender Konstruktionsteil dauernd unter Wasser liegt. Da die Tore bei jeder Schleusung zu Tage treten, ist man in der Lage, ihren baulichen Zustand, ihre Dichtigkeit etc. regelmässig zu prüfen. Allerdings bedingen die für die Hubtore erforderlichen turmartigen Aufbauten einen grösseren Kostenaufwand. Letzterer Umstand fällt indessen angesichts der vorerwähnten Vorteile vielleicht weniger ins Gewicht, zumal bei der landschaftlich schönen Lage und der grossen Bedeutung
■ 1; «3» PIR II 16
m m
//i____
[frisch
Untertor der Schleuse.
23
rn iiTT* TT^jg'. >,tP^'J ff'""" II1 “f«klKPS Fl !
Mi hfcj i
fil
eine architektonischedieser Schleuse der einzigen des Teltowkanals Ausgestaltung der Schleusenhäupter in Verbindung mit einer Aussichtsgalerie und dem Schleusengehöft so wie so beabsichtigt war.
Es hätte vielleicht nahe gelegen, beim Oberhaupt statt der Hubtore Klapptore zu wählen, und hat die Entscheidung hierüber gelegentlich der Entwurfsaufstellung in der Tat auch lange geschwankt. Wenn diese schliesslich zu Gunsten der Hubtore ausfiel, so waren es hier mehr Gründe der Konsequenz als eines praktischen Gebots.
Jedes Tor ist durch ein Gegengewicht so ausbalanziert, dass es im Wasser noch ein Übergewicht von rd. i t besitzt, also sicher in seine untere Schlussstellung, trotz des rd. 2 t betragenden Auftriebes, gelangt. Der Motor
— ein Drehstrommotor von10 (intermittierend 15) PS
— vermag im Anfang der Aufwärtsbewegung das
Übergewicht von 1 t und später von 3 t in der Gesamtzeit von höchstens 60 Sekunden auf die vorgeschriebene Höhe von 8,27 m zu heben und zwar unter Überwindung sämtlicher Reibungs- und durch Winddruck verur
sachten Widerstände sowie eines Wasserüberdrucks von rd. 10 cm. Im Interesse der Zeitersparnis kann also gegebenenfalls auf eine vollkommene Schlussausspiegelung der Wasserstände verzichtet werden.
Tor und Gegengewicht hängen an einer gemeinsamen, quer über der Schleuse gelagerten Welle an sechs Drahtseilen bezw. Ketten. Um eine Parallelführung der Torbewegung zu erzielen, sind für die beiden äusseren der 6 Aufhängungen Gallsche Ketten vorgesehen, die über Kettenräder laufen, welche auf der Antriebswelle fest aufgekeilt sind und am anderen Ende einen die Kammer und die beiden Leinpfaddurchgänge überspannenden, in Führungsschienen laufenden Gegengewichtskasten tragen. Die 4 anderen Aufhängungen bestehen aus Seilen, die über 4 glatte auf der Antriebswelle lose aufsitzende Seilscheiben laufen und am anderen Ende jede selbständig einen Gegengewichtsanteil tragen. Dieser spielt in dem obenerwähnten, durch die Gall-
Obertor der Schleuse (vom Oberwasser aus gesehen).
24
m!fV-
4 .
1's:
ft|U
riRTÜ«il in*5«i1
m :-li»'..idrjÄ *
. •
msäV wan-jj
äi i V-' * *#'5 ‘füu
ank•=R
kTWr* v*.Hj. S,V
Ili
i ■;*: 911!: ylf ;.• VÄw*vr * ; itt
'r-4nK 5\4g S»
5Nr
'I -1 hiliÄ-31!
■f ' -CT Ii I mn* k >...*
>i»ML TiilE
/ J 3il'Ili'IIy
- <KjRjP rSÜ 3‘ r • v{(tjij rJn■Mt * t ;•r llEl y 5 !*f ,sL |i
Äs : ?—> me - ^ **
;Ti Iv!
IX:*v iUTT ji
»ui- in
I!
m
r
m
{iiiiiiisM|lli»?=tSm
|=5=S; 555SS
| mmimi HK=H|||
I siiis'gla | ====?-=?■=«
«tw1| SälisIlH 4 ?ää~ -=m
ä
i■;,r»
‘Mmh'iS■timrr r/j»’*TJ
:;;v
flSf Mw
ip:mfc Km m
y\
l\ % .I —'- Ia11■f«
F .g LiinLar
I {T i X
||| i ||! ;I ]
u
I•r
]
mmr I
''
1
~ia*
r-
ar"”
■ l
Her
man
n Rüc
kwar
df, B
erlin
.Gr-.
-Lic
M-e
rfeld
e.ph
ot.u
.Hel
.:
•;üi
.
UN
TER
HA
UPT
.SCH
LEU
SE.
MA
CHN
OW
ER
T E
LT O
WH
AN
AL
JL
£
i ii 1
sehen Ketten aufgenommenen Kasten und erhält durch ihn seine Führung, ohne ihn aber zu belasten, da zwischen der Unterfläche des Gewichts und dem Kastenboden ein kleiner Zwischenraum von 5 cm Höhe belassen ist. Das gesamte Gegengewicht ist danach in einzelne Teile aufgelöst; hierdurch wird jede Aufhängung mit dem ihr tatsächlich zukommenden, durch Rechnung ermittelten Gewichtsanteil möglichst genau belastet, wohingegen der statische Gleichgewichtszustand zwischen Tor- und Gegengewicht nicht klar zu erkennen wäre, sofern man letzteres in einem Stück ausführen wollte. Ein jeder der 4 Gewichtsteile ist mit dem Führungskasten, unter Wahrung der für den regelmässigen Betrieb erforderlichen Unabhängigkeit, so verbunden, dass beim Reissen einer oder beider Gallschen Ketten der Kasten an den Seilen hängt und durch sie vor dem Herunterfallen bewahrt wird. Reisst aber eines der Seile, so fällt dessen Gegengewichtsteil in den Kästen und belastet entsprechend mehr die Gallschen Ketten. Das Tor ist demnach durch die Aufhängung an6 Punkten in seiner Ruhelage und während der Bewegung so gesichert, dass das Versagen einer oder gar zwei der Aufhängungen durch Reissen oder Dehnen wohl eine — übrigens rasch zu beseitigende — kleine Betriebsstörung, aber keine Gefahr bedeutet.
Befindet sich das Tor oben in seiner End- und Ruhestellung, so wird sein Übergewicht von 3 t durch eine Bremse gehalten, die bei der Torbewegung durch einen Bremselektromagneten gelüftet wird, sobald Strom in den Motor eintritt. Damit nun im Falle eines Versagens der Bremse das Tor durch das Übergewicht nicht hinabgezogen wird, ist eine Verriegelung vorgesehen, die in der höchsten Lage des Tores stets selbsttätig unter dieses greift. Die erfolgte Verriegelung wird den Schleusenbediensteten durch einen deutlich in die Augen fallenden, auf «freie Fahrt» sich einstellenden Signalarm angezeigt; nach der Schleusenbetriebsordnung ist nur
Obertor der Schleuse (von der Kammerseite aus gesehen).
25
iil.HO
iss^ss^ Pi
:1
1:1
■
S,■ftrv
dann das Durchfahren unter den Toren gestattet. Die Bewegung des Tores wird selbsttätig durch einen elektrischen Zentrifugalausschalter und 2 Endausschalter geregelt und gesichert.
Beim Obertor liegt die Konstruktionsunterkante des herabgelassenen Gegengewichts und des aufgezogenen Tores wie bei sämtlichen Brücken der Spreehaltung nicht tiefer als + 37,04, d. i. 4,74 m über Normalwasser; die Mindest-Hubhöhe beträgt 8,24 m. Das Untertor wird bis +34,54, d. i. 4,0 m über HW aufgezogen, sein Gegengewicht aber nur bis + 34,80 herabgelassen, damit für den Längsverkehr an der Kammerwand noch eine lichte Höhe von rd. 2,00 m frei bleibt. Die Hubhöhe beträgt 8,27 m.
Zur Führung des Tores sind jeseitig eine grössere Zahl von Führungsrollen angeordnet, von denen ein Teil in einer Ebene rallel zur Schleusenachse, der andere senkrecht dazu liegt. Diese Rollen laufen zwischen Führungsschienen, die unter Plattformhöhe am Mauerwerk und über ihr an einer Eisenkonstruktion befestigt sind, die den an den Tür
men frei zu haltenden Leinpfaddurchgang überragt. Für das Durchziehen des Treidelseils sind die Führungsschienen über der Plattform auf 0,70 m Höhe unterbrochen; diese Lücke hat für die Torführung keinerlei Bedenken, weil genügend viel Rollen vorhanden sind, um bei jeder Höhenlage dem Tore eine sichere Führung zu gewährleisten.
Für die Tore selbst bilden wagerecht liegende (beim Obertor 4, beim Untertor 6), grösstenteils als Gitterträger ausgebaute, den Wasserdruck auf die Tornischen übertragende Riegel in Verbindung mit leichten senkrechten Verbänden das Gerippe; gegen sie legt sich die eiserne Torblechhaut. Einen Diagonalverband besitzen die Tore nicht; die erforderliche Steifigkeit in der Torebene gibt vielmehr die 10 mm starke Blechhaut. Das Gewicht des fertigen Untertores beträgt rund 20 t, das des Obertores rund 16 t.
pa-
Leitwand im Unterhafen (im Bau).
26
mm «gr •»
■■1
7
1mH
iiJ}
■i
-
W
1r+
l1
\
+.
mm
Die Abdichtung des Toranschlages erfolgt durch Bohlen aus Kiefernholz, die an dem Rahmen des Tores angeschraubt sind und gegen das Mauerwerk der Tornischen sich pressen. Die Anschlagsbreite ist auf 20 cm bemessen worden; demnach erhält die Anschlagsnische in der Torkammersohle eine Tiefe von 25 cm und in den beiden aufgehenden Seitenmauern, mit Rücksicht auf die hier noch unterzubringenden Führungsrollen und Schienen, eine solche von 35 cm; annähernd um dieses Mass ist das die Führungsschienen tragende eiserne Gestänge hinter die Kammerflucht zurückgezogen.
An die Mittelmauer schliesst sich im Ober- und Unterkanal je eine 140 m lange Leitwand an, an welcher die auf Einfahrt wartenden Schiffe festlegen. Damit das aus dem in der Mittelmauer angeordneten Wehrkanal, über den weiter unten das Nötige folgt, strömende und dem Unterwasser zuffiessende Freiwasserdie am Leitwerk liegenden Schiffe nicht in ihrer Ruhelage stört, ist dieses an den Längswänden mit durchbrochenen Lattentafeln versehen, durch die das Freiwasser seitwärts nur allmählich austreten kann. DieAnordnung der Leitwand in der Mitte, — und nicht an den Ufern der Vorhäfen
Ausführung der Leitwand im Oberhafen.
, ist, abgesehen von der hierdurch gegebenen Möglichkeit einer guten Abführung des Freiwassers, noch aus dem Grunde gewählt worden., dass das einfahrende Schiff in schnurgerader Richtung in die Kammer hineingezogen werden kann. Das aus fahrende Schiff fährt in schlankem Bogen in die der Leitwand abgekehrte Richtungslinie, was ihm dadurch ermöglicht wird, dass es bei der Ausfahrt aus der Schleuse mittels elektrischer Kraft die zur Erreichung der nötigen Steuerfähigkeit erforderliche Geschwindigkeit erhält.
Über die allgemeine Regelung des Betriebes bei der Ein- und Ausfahrt in die Schleusen geben die im Lageplan eingezeichneten Schiffsstellungen und deren Eahrtrichtungen im allgemeinen genügenden Aufschluss; im einzelnen sei folgendes bemerkt:
Im Unterwasser wird das in die Schleuse einfahrende Schiff von derauf dem Leinpfad laufenden Treidellokomotive der südlichen oder nördlichen
27
I
-msm
Lm
m
rm
>
jm
TT
Leitwandseite zugeführt. Die Lokomotive fährt von der südlichen Uferseite über die Schleusenbrücke auf die nördliche über und nimmt hier ein aus einer der beiden Kammern ausfahrendes Schiff auf. Im Oberwasser tritt wegen des an den Vorhafen anschliessenden Machnowsees und der damit fortfallenden Leinpfaddämme ein Schleppdampfer an die Stelle der Treidellokomotive.
ln der Regel wird nur ein Schiff an jeder Leitwandseite für die Einfahrt in die Schleuse bereit liegen, und nur in Ausnahmefällen, wenn der Schleusenbetrieb aus irgend einem Grunde unregelmässig geworden, wird ein zweites Schiff hinter dem ersten an die der Leitwand vorgelagerten
Dalben sich festlegen. In diesem Fall hat das die südliche Kammer nach dem Unterwasser hin verlassende Schiff mit seiner eigenen, ihm bei der Ausfahrt aus der Schleuse gegebenen lebendigen Kraft einen Weg von rd. 300 m zurückzulegen, ehe es von der Treidellokomotive ins Schlepptau genommen werden
kann. Im Oberwasser kann das die nördliche Kammer verlassende Schiff in schlanker Kurve durch den Vorhafen fahren, da hier der Schleppdampfer das Schiff an jeder Stelle antrossen kann.
An Stelle der sonst für den Schiffszug bei Schleusen üblichen Spills sind für die Hauptbewegung der Schiffe auf den Leitwänden elektrisch getriebene Laufkatzen vorgesehen. Es ist bekannt, dass die Anwendung von Spills mit dem Übelstand verbunden ist, dass das zum Ein- und Ausziehen der Schiffe bestimmte Drahtseil zum Befestigungspoller des Schiffs hingetragen werden muss, wodurch Zeitverlust, Beschädigungen der Schleusenplattform und Verschleiss des Seils entstehen. An der Machnower Schleuse, wo auf das langsame und unsichere Entlangziehen der Schiffe an der Leitwand mit der Hand aus naheliegenden Gründen verzichtet wird, würde eine Seillänge von ca. 120 m erforderlich werden, die von den Schleusen
! jfcÄ. Ä
r.
Fi Jüui ^, füi«
Laufkatze.
28
Deshalb soll das Schiff von einer Laufknechten kaum zu bedienen wäre.. katze bewegt werden, die auf einer um rd. 2 m hinter der Kammermauerflucht zurücktretenden und in 2,5 m Höhe über den Leitwandstegen angelegten Bahn vom Schleusenhaupt bis zum Leitwandende läuft, dies sind auf der Mittelmauer der Schleuse noch 2 Spills, für jede Kammer eins, vorgesehen, die das glatte Ein- und Ausfahren der Schiffe unterstützen sollen und bei Störungen im Gange der Laufkatze Aushilfe leisten.
Im Anschluss hieran sei mit einigen Worten der in Aussicht genommene Dienstbetrieb erläutert:
Über-
Der Schiffahrtsbetrieb an der Schleuse soll von einem Schleusenmeister geleitet und beaufsichtigt werden, der während der Dienstzeit seinen Platz auf der Mitte der Mittelmauer hat. Von hier übersieht er am besten die in den Vorhäfen und in den Kammern sich abspielenden Vorgänge. Unter seiner Aufsicht steht der Schaltwärter, der in dem in Höhe der Brückenfahrbahn im Unterhauptsbau belegenen Schaltraum sich aufhält. Dem Schleusenmeister sind ferner die Schleusenknechte unterstellt, von denen je einer auf den Leitwänden der Vorhäfen und der dritte auf der Mittelmauer Dienst tut.
Auf der Mittelmauer befindet sich eine kleine Dienstbude Schleusnerbude
dievon wo der Schleusenmeister durch Fernsprecher oder
Klingelzeichen an den Schaltwärter und die auf den Leitwänden sich aufhaltenden Schleusenknechte seine Anweisungen erteilen kann. Die Verständigung, im besonderen mit dem Schaltwärter, wird erleichtert durch einen an seinem Stand befindlichen Signalapparat, dessen Hebelstellungen dem Schaltwärter den Befehl geben: «Tor abwärts!» oder «Halt!» — Letzterer Befehl gilt nicht nur für den Betrieb der Tore, sondern auch für den der Heber.
Der Schaltwärter hat in seinem Schaltraum den Steuerungsapparat für die Bedienung der Heber, zwei Schalttafeln für die Tore der beiden Schleusen und eine selbsttätige Anzeigevorrichtung für den jeweiligen Wasserstand der Kammern. Endlich befinden sich hier, wie bereits erwähnt, Fernsprecher sowie eine akustische und optische Signalvorrichtung für seine Verständigung mit dem Schleusenmeister.
Das Schaltbrett vereinigt die nötigen für die Torhebung bestimmten elektrischen Verbindungen. Das Ingangsetzen der Heber und das Heben der Tore geschieht im allgemeinen ohne besonderen Befehl des Schleusenmeisters, während das Schliessen der Tore erst auf sein Geheiss ausgeführt
29
wird, dies zwar, weil der Schaltwärter von seinem Standpunkt nicht immer gut übersehen kann, ob ein Schiff vollständig aus der Schleuse ausgefahren oder in diese eingefahren ist. Sind die hochgezogenen Tore in ihre Endstellung gelangt, so werden sie durch einen am Führungsgestänge befindlichen Haken selbsttätig verriegelt; alsdann stellen sich die am Mauerwerk der Mitteltürme angebrachten Signalarme ebenfalls selbsttätig auf «freie Fahrt» und geben hierdurch das Zeichen zur Ein- und Ausfahrt der Schiffe.
Bezüglich der Leistungsfähigkeit der Schleuse sei erwähnt, dass die Dauer einer Doppelschleusung (ein Schiff bergauf und eines bergab in einer Kammer) auf ’/2 Stunde bemessen ist. Jede Kammer kann ein Normalschiff von 600 t aufnehmen; rechnet man seine mittlere Füllung mit 400 t, so ergibt sich bei zehnstündigem Schleusenbetrieb beider Kammern ein Verkehr in beiden Richtungen von 2x10x2x2x400 = 32000 t pro Tag. Bei 270 Arbeitstagen im Jahre können demnach 8,64 Millionen t auf dem Kanal bezw. mittels der Doppelschleuse bewältigt werden. Da ohne weiteres auch Nachtbetrieb leicht eingerichtet werden kann, ist keinZweifel, dass die Schleusenanlage dem Verkehr für weit absehbare Zeiten völlig genügen wird.
Eng verbunden mit dem Schleusenbauwerk ist das zur Abführung der im Eingang erwähnten Hochwassermengen angeordnete Ereigerinne und Wehr, die in der Mittelmauer ihren Platz gefunden haben. Der Abfall der Freigerinnsohle ist möglichst nahe dem Oberwasser gelegt, damit die lebendige Kraft des abstürzenden Wassers am Ereilaufende möglichst vernichtet ist; hier wird die Wassergeschwindigkeit höchstens 1,4 m betragen. Das Schütz ist ein gewöhnliches Reibungsschütz; die abdichtenden kiefernen Holme gleiten bei der Schützbewegung an schmiedeeisernen, mit dem Mauerwerk fest verbundenen Gleitflächen. Bei niederem Unterwasser muss freilich eine beträchtliche Kraft zum Öffnen oder Senken des Schützes aufgewandt werden; jedoch ist dies ohne Belang, da die Veränderung der Zuflussmenge im Oberkanal auch bei Hochwasser in der Regel sehr gering ist und ein Heben oder Senken des Schützes um nur wenige Zentimeter in den meisten Fällen für die Wasserabführung genügen wird. Voraussichtlich wird das Schütz einen grossen Teil des Jahres überhaupt vollkommen geschlossen bleiben. Für die Bewegung des Schützes dient ein Drehstrommotor von 8 PS und 580 Umdrehungen bei 220 Volt Spannung. Die Übersetzung geschieht durch 2 senkrechte parallele Spindeln aus Deltametall, an denen die Schütztafel hängt und durch 2 Paar Kegelzahnräder. Ein zweiter Antrieb gestattet im Bedarfsfälle die Schützbedienung mittels Hand.
30
.
St iS3 ** tf,'>
'ftrkäBSk^sK ,-J;
K ..■■ ■' “*öv k<;
.S/- Lwr*L~,‘
Das aus dem Niederschlagsgebiet des Teltowkanals diesem zuströmende Grund- und Tageswasser wird nach den angestellten, eingehenden Untersuchungen auch zu trockenen Jahreszeiten für den Kanalbetrieb und die Wassererneuerung genügen. Gleichwohl ist zur grösseren Sicherheit und zur Ermöglichung einer etwa erforderlichen Spülung des Kanals am Ober
haupt in einem Raum der Mittelmauer eine Pumpe von i cbm sekundlicher Leistung vorgesehen worden, die weiteres Wasser aus der unteren Haltung der oberen im Bedarfsfälle zuführen kann.
Als Betriebskraft steht elektrischer Strom zur Verfügung, der in dem dem Kreise Teltow gehörenden, 3 km oberhalb der Schleuse bele- genen Kraftwerk erzeugt wird. Der
hier hergestellte Starkstrom (Drehstrom) von 6000 Volt wird an der Schleuse in Schwachstrom von 220 Volt umgewandelt und entsprechend verteilt. Eine Leitung führt zum Schaltraum des Schaltwärters und verteilt sich hier zu den Antrieben und Sicherungen der 4 Hubtore, eine andere zweigt zu der Schleusnerbude ab, woselbst die Beleuchtung der Schleuse und das Anlassen des Schütz- und Pumpenmotors geregelt wird.
Die Laufkatzen und Spills werden aus dem von dem Kraftwerk für die elektrische Treidelei gelieferten Gleichstrom von 550 Volt Spannung gespeist.
Saugrohre für die Pumpe in der Mittelmauer.
Zur Verständigung zwischen Schleuse und Kraftwerk dient einebesondere Fernsprechleitung; ausserdem ist die Schleuse an die am ganzen Kanal sich hinziehende Dienstfernsprechleitung angeschlossen. Der Schleusenmeister hat ferner in seiner Schleusnerbude, zwecks Verständigung mit dem Schaltwärter und den auf den Leitwänden sich aufhaltenden Schleusenknechten, einen lauttönenden Fernsprecher, der von besonderen Elementen gespeist wird.
Pumpenraum.
31
;
1an ßiisu*■ ; wa
Hol;f T
!ae-JWMM
'____JjP
nr'lTi: /*<
X'nt,-3**
Für den zeitweisen Abschluss der Kammern dienen die in den Häuptern angelegten Notverschlüsse. Von den schwer zu bedienenden Dammbalken ist abgesehen worden; statt dieser sind Nadelwehre aus eisernen Mannesmannrohren gewählt, die oben an einem quer über die Kammer zu legenden Träger, der sprengwerkartig abgesteift wird, sich anlehnen und unten in der Sohle in einem Anschlag ihren Halt finden. Das Dichten der kleinen Zwischenräume zwischen den Nadeln geschieht in zweckdienlicher Weise durch eine vorgeworfene Mischung aus Asche, Sand und Kiefernadeln. Voraussichtlich wird indessen für die Zukunft die Notwendigkeit des zeitweisen Absperrens der Kammern bei weitem nicht in dem Masse eintreten, wie bei anderen Schleusen, die keine Hubtore besitzen.
Über das Unterhaupt der Schleusenanlage führt eine Brücke von 37 m Länge und 10 m Nutzbreite; von dieser entfallen 6 m auf die Fahrbahn und je 2 m auf die beiderseitigen Fusswege. Die Brücke überführt den jetzt verlegten, bisher am Westende des Machnowsees den Kanal schneidenden Verbindungsweg zwischen Klein Machnow und Wannsee.
Im Unterhafen befindet sich in einer Einbuchtung der nördlichen Uferböschung eine Anlegestelle für die Personenschiffahrt, die auf der unteren Kanalhaltung in Verbindung mit den Havelgewässern vom Kreise betrieben wird.
Auf der Südseite der Schleusenanlage ist eine Ruderbootsüberschleppe,die erste im Bereich der märkischen und benachbarten Wasserstrassen, angelegt; dieselbe wurde aus Sportkreisen aus dem Grunde besonders erbeten, weil die leicht gebauten Ruderboote beim gleichzeitigen Durchschleusen mit anderen Schiffen leicht beschädigt werden. Die Überschleppe ist soweit von der südlichen Kammer zurückgezogen Schleusenkammer entfernt
sie liegt 10 m von der , dass sie weder auf der Schleusenplattform
noch in den beiden Vorhäfen dem Schleusen- und Schiffahrtsbetrieb irgendwie unbequem werden kann.
Die Vorhäfen erhalten jeseitig der mittleren Leitwand, um die Vorbeifahrt der Schiffe zu erleichtern, zwischen Böschungsfuss und Leitwandkante eine Breite von 22 m. Bei dieser können bequem genug selbst 2 nebeneinander gekuppelte Finowkähne an anderen ebenso verbundenen vorüberfahren. In der oberen Haltung ist das südliche Ufer für Lösch- und Ladezwecke um weitere 10 m zurückgerückt.
Die Uferböschungen sind in der Schleusennähe durch Pflaster auf Kies und Schotter befestigt; die Grundbefestigung besteht aus einer Pflasterung von 30 bis 40 cm hohen Sandsteinen auf Schotter und Sinkstücklage, die
32
v I
i *n T*los;
*;ä!i r /'!CU
^2hlla M
wyfa.jiS "Bi U
i>
II ;;.#r%*1*SS g§®rHi s li'
Hg g” i‘ rvEi
i ' fcss
«! *I I •jAfe
g :== JlJ1 f !# ..W* PM•*,-rjsr* !PLit8
- r'ff■:!U; n*xi E?Ä3W£ 5;
thPf 3?£ »<a im
J£ K»A>IW' -1gl - Jliki -'
/ ®p; -•W« A4Batl 1 • • <4
■^wk'
1 ,££ :::=
V
fe I(lw E:*v*r ;
e4 Lu!imjmm l
4%. • r!i ff 3[f- ; kMW^riSaij JE» l 1n T -v«
IKSfitu ; ;SfI i n ,,„*jl MJiilj
jW
MmMBüI
SaE: /fl
A
ßjä....sfiwwm» ji if i
■A
Mi
:I
5
w,
fr'
3fc;
v
fy
[/'r
Kc-.■.
X\i jl'
S
’i!;
Ii:fi;K
Ei
II!«::
IttliiR
11 t-TTÄ?
/
Sl* CT
ff II II
II II
-
1 ,«^gnp
i^ui
prw
1' „ !■
Berli
n. 0r
> Li
chte
rfel d
e, ph
ot.u
.hei
.H
erm
ann R
ückw
ardt
.ti
*'
-n TJm
üfS
3
T 4t'
Ja
iS
r
4
MA
CHN
OW
ERSC
HLE
USE
.
,7
TELT
O W
KA
N A
L
durch 3 m lange, in Abständen von 2-5 m stehende und bis zur Pflasteroberfläche reichende Grundpfähle, weiter befestigt ist. Im Unterkanal ist die Sohle auf 30 m Entfernung von der Schleuse in ganzer Breite, alsdannunter der Leitwand auf weitere 60 m in 26 m Breite durch Pflasterung be-
*festigt. Im Oberkanal ist die entsprechende Fläche etwas geringer. 1
Was die Gründung der Schleuse und ihren weiteren Ausbau anlangt, so steht das Bauwerk auf tragfähigem Sande, der an einzelnen Stellen mit Tonschichten durchsetzt ist. Unmittelbar südlich der südlichen Schleusenmauer fällt der gute Baugrund rasch zu beträchtlicher Tiefe ab; es sind daher für die anschliessenden Leinpfaddämme und Lösch- und Ladeplätze umfangreiche Sandschüttungen erforderlich geworden. Auch in der Längsrichtung der Schleusenanlage traf man ober- und unterhalb derselben den guten Baugrund erst in grösserer Tiefe an; deshalb sind auch die Leitwände nicht, wie es sonst wohl erwünscht gewesen, massiv, sondern in Holzkonstruktion ausgeführt worden. Die Schleuse selbst ist auf Beton zwischen Spundwänden gegründet und hierbei in verschiedene Bauteile gemäss deren verschiedenen Belastungen zerlegt.
So teilen 2 Quer- und 4 Längsspundwände die Gründung des Unter- und Oberhauptes von denjenigen der Sohlen und Kammermauern ab; die letzteren sind, um keine Risse infolge der durch Temperaturschwankungen bedingten Formveränderungen auftreten zu lassen, in einzelne Teile von je rd. 13 m Länge durch besonders eingefügte Trennungsfugen zerlegt worden. Auf der aus Granitsteinschlagbeton (1 : 3,5 : 6) bestehenden Sohle ist das Bauwerk bis zur Höhe des unteren Niedrigwassers mit Kies- Stampfbeton 1 : 6, sodann bis zur Schleusenplattform in Klinkern mit Zementmörtel 1 : 3 ausgeführt, und zwar unter Verblendung der Kammern und der Plattform mit Eisenklinkern und der Flügelmauern mit roten Klinkern. Die vor dem Wasserangriff oder dem Stoss der Schiffe zu schützenden Kanten sind im Betonmauerwerk durch Eisen, sonst durch Granit geschützt.
■v» V
3 SSi
i
i m— -» .____— *■ ■
’ Ji-*. Ü»
Trennungsfuge in der Mittelmauer (in der Nähe des Oberhaupts).
33
Die ebenfalls in Klinkern in Zementmörtel ausgeführten Tortürme sind geputzt, am Sockel indessen mit Basaltlava verkleidet.
Ungewöhnliche Schwierigkeiten bereiteten die Betonaussparungen für die Hohlräume der Umläufe, insbesondere an den Übergangsstellen der Heber
rücken. Die nebenstehenden Abbildungen zeigen einige Formen der zu diesem Zwecke hergestellten Holzlehren und Verschalungen.
Die Bauarbeiten begannen im März 1902; im ersten Jahre wurden die Bodenmassen bis zur Fundamentsohle ausgehoben, die Spundwände geschlagen und im Trockenen die Sohle betoniert. Letztere Arbeit ging gut vonstatten, mit Ausnahme an einer Stelle des nörd-
■j4__ ‘
HR
mßm-?Holzverschalung für Betonierung der Mittelmauer.
liehen Oberhauptes, wo eine grössere Quelle aufbrach, deren Unschädlichmachung nicht geringe Arbeit und
Holzverschalung für Betonierung der nördlichen Kammerwand (am Unterhaupt).
Fundamentverstärkungen erforderte. Immerhin hatte die Quelle, die zeit weise stark Sand aus dem Untergründe mit sich führte, diesen so ge
lockert, dass während des weiterenAufbaues des Mauerwerks Senkungen von 3-5 cm eintraten, denen aber, weil sie nicht unerwartet kamen, in geeigneter Weise begegnet wurde.
Im Jahre 1903 wurden die Hauptmassen der Kammermauern,die Sohlen- und Uferbefestigungen der Vorhäfen und diese selbst ausgeführt; im Jahre 1904 folgte die Voll-
Holzverschalung für Betonierung der Mittelmauer am Oberhaupt (Verbindungsheber und Freigerinne). endung des Schleusenmauerwerks
34
ÜIJ- "A. A
*3
* A
7*
sm
1/mm
V
yJflUs
VmI
sam
Sc
an
und der Tortürme, wonach die eisernen Führungen und Trägerkonstruktionen für die 4 Hubtore montiert, die beiden Leitwände gerammt und verbunden und die Unterhauptsbrücke im wesentlichen fertiggestellt wurden. Auch gelangten die Hochbauten des Schleusengehöftes, mit dessen Ausführung im Juni 1904 begonnen wurde, unter Dach. Im letzten Baujahre wurde die Montage der Tore und Gegengewichte, des Torantriebes, der bedeutenden Heberrohranlage nebst Zubehör, der gesamten elektrischen Einrichtungen usw. zu Ende geführt. Die Arbeiten waren bis Mitte März 1905 soweit vorgeschritten, dass das im Oberkanal erforderliche Baggergerät von der Havelhaltung aus durchgeschleust werden konnte. Anfang Oktober wurde die Schleuse sodann vollständig fertiggestellt.
3
fil“35
Jt! - -vtkJ Mk*ei ^2:
•■ «2 . •’V I;
F 'V --r.
Schleusenbaustelle im September 1904.
35
DAS SCHLEUSENGEHÖFT BEI KLEIN MACHNOW.
einer Zweckbestimmung nach zerfällt das Schleusengehöft in drei Baubestandteile: Das Schleusenunterhaupt mit der Aussichtsgalerie, das Schleusenwirtshaus und das eigentliche Dienstgebäude.
Die beiden ersteren sind durch die Eingangshalle verbunden; eine breite Wendeltreppe führt von hier aus zu einer in Höhe des im Hauptgebäude liegenden Festsaals befindlichen Plattform, von der sich eine prächtige Aussicht in das untere Beketal eröffnet. In voller Länge des Unterhauptes schliesst sich eine nach Westen offene Galerie an, mit einem in der Mittelachse der beiden Schleusenkammern sich öffnenden Durchgang, bestimmt, dem Publikum die Einzelheiten des Schleusenbetriebes sichtbar zu machen.
Den Blick talab gerichtet, sieht man die aus dem Unterwasser in die Schleuse auf-, bezw. aus der Schleuse in die Havelhaltung absteigenden Schiffe, von der auf der unteren Leitwand sich bewegenden Laufkatze geführt, während ein Ausblick nach oben den Auf- und Abstieg der Schiffe in den Schleusenkammern und den Vorgang des Füllens und Entleerens derselben zeigt.
Das Schleusenwirtshaus ist, wie schon der Name sagt, in der Hauptsache gastlichen Zwecken gewidmet. Schon lange ist Machnow der Zielpunkt vieler Ausflügler, die von Gross Lichterfelde mittels der nach Stahnsdorf führenden Dampfstrassenbahn oder von Zehlendorf und Wannsee aus zu Euss — von letzterem Punkt aus am Jagdschloss Dreilinden vorbei durch schönen Wald — dem Machnowsee und dem Beketal zustreben. Die früher in Stahnsdorfendende Dampfstrassenbahn ist inzwischen bis zur Schleuse fortgeführt; auch hat der Kreis seine Personenschiffahrt von Neu Babelsberg aus auf den Teltowkanal bis zur Schleuse ausgedehnt. Weitere Bahnverbindungen, zunächst die
36
einer elektrischen Strassenbahn von Zehlendorf aus, sind projektiert und stehen zum Teil bereits in naher Aussicht.
So lag der Gedanke nahe, das interessante, in schöner Landschaft aufgebaute Schleusenbauwerk auch weiteren Kreisen zugänglich zu machen und zugleich zu einem behaglichen Ruhepunkt für diejenigen zu gestalten, denen nebenbei ein Stück modernen Verkehrslebens von Interesse ist.
Der Hauptzugang zum Schleusenwirtshaus erfolgt von der über das Unterhaupt führenden Strassenbrücke, und zwar durch die vorhin erwähnte kreisförmige Eingangshalle, welche den Treppenaufstieg zu der über das Unterhaupt führenden Aussichtsgalerie enthält.
Im Anschluss an diesen Vorraum befindet sich links die Diele mit einer zu dem oberen Saale führenden freieingebauten Treppe. In unmittelbarer Verbindung mit der Diele, welche die beim Kanalbau gemachten, zum Teil vorgeschichtlichen Funde aufnehmen soll, stehen die Gasträume sowie Schenke und Anrichte.
Aß " 1111 liRi|maa
i t.fuI - 53,*i l IUI r 5 l.ES!
jK
v *: V 'Wf 4_____ Baüü]Untertor mit Aussichtsgalerie.
Das Obergeschoss enthält im Anschluss an den auch oben durchgeführten Dielenvorraum einen Saal von 21,5 m Länge und 10 m Breite, ein daneben liegendes Zimmer von rd. 58 qm Grösse und, in gleicher Lage wie unten, die Schenke und Anrichte.
Im Dachgeschoss befinden sich ausser der Wohnung des Wirts, Schlafräume für Dienstboten, sowie mehrere Fremdenzimmer.
Das unter dem Erdgeschoss des Hauptbaues, in Höhe der eigentlichen Schleusenplattform liegende Untergeschoss enthält neben den recht zureichend bemessenen Küchen- und Vorratsräumen noch die Wohnung des Schaltwärters.
Unter einem Teil des Untergeschosses befindet sich endlich noch ein Tiefkeller, welcher sowohl von den Wirtschaftsräumen des Untergeschosses, wie auch unmittelbar von der Schleusenplattform zugänglich ist. Die Anlage
37
3*ffl.
lii fffl
»■•’Sr 1:5
L *
II 1W\
lää 1».
im ■iiI'
iüI! ii 1! ii it
I
I ,M
des letzteren war zum Teil schon durch die gelegentlich der Ausführung der Schleusenkammerwände erfolgte Freilegung der Baugrube und die hierdurch bedingte Tieferführung der Fundamente gegeben.
Die Ausnutzung dieses Tiefkellers ist zum Teil für Wirtschaftszwecke, grösstenteils aber zum Lagern von Stückfässern und Fudern lür die Teltower Kreis-Weinkellerei bestimmt, welche auf dem Wasserwege ankommen und
, von der Schleusenplattform aus alsdann mittels Schrotleiter auf Lager gebracht werden.
Das eigentliche Dienstgebäude besteht aus 2 Teilen, deren ersterer, der Zwischenbau, an den Hauptbau parallel der Schleusen-Längsachse sich
anschliesst; er enthält im Erdgeschoss Geräte- und Magazinräume für Schleusenbetriebszwecke, im Obergeschoss den Schlafraum für die unverheirateten Schleusenknechte, sowie 2 Diensträume für die Betriebsverwaltung. Im Dachgeschoss befinden sich Trockenboden, Waschküche, Plättzimmer und Baderaum, sowohl für die
Zwecke des Wirts, wie auch der im Schleusengehöft wohnenden Beamten. Der Zwischenbau ist gleichfalls voll unterkellert, und zwar entsprechend der wechselnden Höhenlage der Magazinräume in wechselnder Tiefe.
Der Zwischenbau ist mit dem Hauptbau durch ein Treppenhaus verbunden, welches von der Höhe der Schleusenplattform bis zum Dachgeschoss des Hauptgebäudes hochführt. Dasselbe bildet also zugleich die Verbindung für den inneren Wirtschafts- pp. Betrieb.
In dem weiter anschliessenden östlichen Endbau befinden sich im Erdgeschoss die Wohnungen für 2 verheiratete Schleusenknechte. Der Zugang zu diesen Wohnungen, welche getrennte Vorflure erhalten, erfolgt mittels gemeinschaftlichen Eingangs von der Schleusenplattform aus. Das Obergeschoss enthält eine geräumige Dienstwohnung für den Schleusenmeister. Der Zugang
Ansicht des Schleusenhofes.
38
1
m,r
xl A
« * 'hS-
*SB
ff
i
i
m ^4
*“zsmmum
m
zu dieser Wohnung erfolgt von der Nordseite (Waldseite) von einem gesonderten, von Erdgeschosshöhe bis zum oberen Geschoss reichenden Treppenhause aus. Zur Verbindung dieser Wohnung mit den dazu gehörigen Kellern und Bodenräumen dient ein weiteres, zwischen diesem Gebäude und dem Zwischenbau belegenes Treppenhaus.
Rings um das Schleusengehöft befinden sich Gartenanlagen mit Grotten und einer sorgfältig ausgewählten Flora, reichlich schattige Sitzplätze für einen Sommerwirtschaftsbetrieb zugleich bietend.
Der im Oberwasser anschliessende nördliche Leinpfad, der für den elektrischen Treidelbetrieb hierselbst unbenutzt bleibt, ist zu einer baumbe- pflanzten, bis zum Machnowsee reichenden breiten Promenade ausgebaut. Auch auf der Südseite der Schleuse befinden sich Gartenanlagen, welche zugleich bestimmt sind, später Unterstandsräume für Personenfuhrwerk aufzunehmen.
Der Versuch, ein Schleusenbauwerk zugleich zu einer wirtschaftlichen und einer Art architektonischen Anlage auszugestalten, dürfte bei der Machnower Schleuse zum ersten Male gemacht sein.
Der Umstand, dass das Bauwerk in Wasserbau- und betriebstechnischer Beziehung manche Neuheiten und Eigenheiten zeigt, dass die landschaftlich reizvolle Lage und die Nähe der Großstadt Berlin einen besonderen Anreiz geben, endlich die Tatsache, dass sich hier, wie kaum an irgend einer anderen Stelle im binnenländischen Wasserstrassennetze, in Zukunft ein bedeutender Verkehr abwickeln wird, mögen die reichere Ausgestaltung der Schleusenanlage und die für sie bewilligten nicht unerheblichen Mehrausgaben auch in den Augen derjenigen rechtfertigen, welche geneigt sind, aus praktischen Erwägungen heraus, einem sogenannten Nutzbau auch nur notwendige oder rein nützliche Aufwendungen zuzubilligen.
39
'fr fr fr fr'-frfr -:j;.:-fr.------------- ---- -- ' ' ■■‘■«a"""»"1« l ■ ! l ,m- v, *
i=r
WEGE- UND EISENBAHNBRÜCKEN,
Sfc^j^jpjs bedingte die Ausführung des Kanals die Herstellung einer grossen Anzahl von Brücken, da derselbe nicht weniger als 9 Eisenbahnen, ferner zahlreiche Wege und Strassen kreuzt, endlich noch für künftige Erweiterungen der Eisenbahnen,
sowie für inzwischen festgelegte oder im künftigen Bebauungspläne vorgesehene Strassen, weitere Brückenanlagen gefordert wurden.
In der Hauptlinie Babelsberg-Grünau gelangten zur Ausführung:8 Eisenbahnbrücken mit zusammen 16 Gleisüberführungen,
37 Strassen- und Wegebrücken; in der Verbindungslinie Britz-Kanne:
i Eisenbahnbrücke mit zunächst 4 Gleisüberführungen,6 Strassenbrücken;
im Prinz Friedrich Leopold-Kanal:
3 Wegebrücken, zusammen also 9 Eisenbahnbrücken mit 20 Gleisüberführungen nebst mehreren Eundamentverbreite- rungen für spätere weitere Gleisanlagen und 46 Strassen-und Wegebrücken.54 Brücken sind mit eisernem Überbau und nur eine (die Chausseestrassenbrücke in Britz) als Massivbrücke, und zwar als Dreigelenkbogenbrücke von 39 m Lichtweite in Beton mit Sandsteinverblendung
&
: ~
m
fn-ü . . >. - rM
Chausseestrassenbrücke in Britz. Gerüst für das Betongewölbe.
40
: ■'
l'-S ^ v':; 111 1|l
* i*.Jliii
an i jHa■
stlm IRE ..1
II
pip
i;I%'fl
L |
«
y
wK
1
isr,-!,i
1
• ■ i i i«
OBE
RHA
UPT
.SC
HLE
USE
.M
ACH
NO
WER
Her
man
n Ruc
kwar
df. B
erlin
,Gr.-
Li'c
h+er
feld
e ,p
hotu
hel.
Mf
H9r
m
'
" A
1
m.in
adSÜ
Btt
■#5
I
V:
I i-I
üüF«
Sm
ir
m
S ..V*n
--. .... ■ -- ^
IT
f
1
i
TELT
OW
KA
NA
L
Cflii
iii *i
a
nrn rxm
ausgeführt. Wiewohl — namentlich innerhalb des hohen Teltow Konstruktionshöhe sowohl bei den Strassen- wie Eisenbahnbrücken für eine massive Ausführung vielfach ausgereicht hätte und demgemäss auch die Bauentwürfe vorbereitet waren, musste leider auf eine derartige Ausführung verzichtet werden, nachdem sich der Untergrund infolge der stark wechselnden und grösserenteils ungenügend tragfähigen Bodenschichten fürdieAuf- nahme schräger Drucke als unzuverlässig erwies.Auch stellten die über- I
die
aus ungünstigen Grundwasserverhältnisse einer derartigen Ausführung ungewöhnliche Hindernisse entgegen.
Chausseestrassenbrücke in Britz. Ausführung des Betongewölbes.
Ausser den voraufgeführten Brücken sind noch eine grössere Anzahl von Leinpfadüberführungen über die als Stichbassins projektierten öffentlichen und privaten Häfen, sowie einige, z. Z. noch in Ausführung begriffene Fussgängerbrücken zu erwähnen. Dem Fortschritt der Bebauung und
,
•• -# .
■ - '&£&%&■J. .V
mp.
m
lull■r
r
1*^
r---A
1 1la,*■ ■ 4 ft.' j
’M •*' —*pn
«•T,•
■
A "
’S'Ntf.(i
mOSSm & l,r V ]
Provisorische Unterführung im verlegten Bahndamm der Dresdener und Militärbahn.
Brücken bei Kohlhasenbrück (vom Griebnitzsee aus gesehen).
Entwicklung des vom werden voraussichtlich weitere Brückenbauten in näherer absehbarer Zeit noch folgen. Während der Ausführung selbst wurden für die Zwecke
Kanal durchschnittenen Geländes entsprechend,
41
L:
1
/ %kr***mz'
4'Jlil
ilfJ
mi
Hl—
Mi
PiH
m
?«r
i m"i
w'«fl
1
II
flu
•Ir
vorübergehender Wege-, Eisenbahn- usw. Verlegungen, eine grosse Anzahl von Notbrücken und Untertunnelungen zwecks Aufrechterhaltung der Vorflut sowie Ermöglichung der durchgehenden Erdbewegungen erforderlich.
Eine der bemerkenswertesten und in der Ausführung schwierigsten Teilstrecken des Kanals war der Durchstich vom Griebnitzsee zum Beke-
Es werden hier auf etwa 400 m Kanallänge 3 doppelgleisige Eisenbahnen, und zwar die Wannseebahn, die Wetzlarer und die Potsdamer Stammbahn und ausserdem noch 2 Wege, der Böckmannsche Privatweg und die Kreischaussee Stolpe-Neuendorf gekreuzt, wie aus dem nachstehenden Teillageplan ersichtlich ist.
tal.
0uik|7*.INI ///#/LAGEPLAN
von Km 3,1 -3,9. V/ Ar\\ i? 1
50-rr-
- - Jjktr. Trsfetjem^k """ "v ’Z.!.! ,f.,: 11Trtiae/betrieo^*^ y 6‘leisle’S 1ffi...
.ci> /iiiujpmmGticVjtüVa-$ :soo *1LJSee //
1 /nÜ'ilP
Zur Herstellung der 3 Eisenbahnüberführungen mussten die 3 Bahnen vorübergehend verlegt werden und war hierfür die Schüttung hoher Dämme, grösstenteils in sumpfigem Gelände, sowie die Herstellung zweier Notbrücken
über die Beke erforderlich. Diese Notbrücken sind als hölzerne Jochbrücken ausgeführt worden.
Vom Böckmann- schen Privatweg bis zur Potsdamer Stammbahn ist der Kanal in gerader Linie durchgeführt; am Anfang und Ende dieser Geraden schliessen sich Krümmungen von
500 m Halbmesser an. In diesen ist das Kanalprofil zwecks Erleichterung der Durchfahrt um 5 m verbreitert.
t /1 m
hg.
te V v ~ Ü££1*1Wjk
M- •*s5
N*
N,
Brücke für die Potsdam-Magdeburger Stammbahn.
42
MHM
|i
m Vfflg:
JU;
k-■^4
■
Personenschiffahrts-Anlegestelle bei Kohlhasenbrück.
Die Brücken haben im Wasserspiegel zwischen den massiv durchgeführten Leinpfaden eine normale Lichtweite von 20 m erhalten; nur bei der Potsdamer Stammbahn ist dieses Lichtmaß noch um 3 m vergrössert, weil unmittelbar hinter der Bahn eine Kanalkrümmung von 500 m Halbmesser beginnt.
mLP:
f.
J* ;■t
Mmarf’r
ggp»i;
4
Chausseebrücke Stolpe - Neuendorf bei Kohlhasenbrück.
43
1
Sil
maa
mVmm
!i-iJ
Bi
r
M
v, ■ , •
p<s
»r
.Hk IBk; 3ps£S?sä£' !L*jtBk 1iwEgssLby.--.aife'. - tii
IrH•3- : U&*" **> JRlIMiaHNMMKjiMMMikJiaw
|1!
W-.
^ ~L■fi
Bl ■i>3^#^gäsß->.. ••»**! =Eg£4ÄS
Adlergestellbrücke bei Adlershof.
Zwischen der Wetzlarer Bahn und der Chausseeüberführung ist, wie der Lageplan zeigt, auf der Südseite des Kanals eine Verbreiterung um 5 m auf 55m Länge vorgesehen, um Personendampfern, Motorbooten u. s. w. das Anlegen zu ermöglichen.
3fst
S}Af. x3FA .Jgh, «7 0% Ir
t flylU* ip.* j
fr j:
31 ftV[• Ir-
Hau&m
L.•*VJ3
~4~ "r"^ IV -‘ ^
0 ff
m m>:
Chausseebrücke Stolpe - Neuendorf bei Kohlhasenbrück.
44
Für die Brücken des Kanals wurden, soweit nicht für die Eisenbahnbrücken besondere Vorschriften der Eisenbahnverwaltung Platz greifen, die folgenden allgemeinen Bestimmungen gegeben:
Als lichte Mindestmasse derselben wurden für die Strecken Glienicker Lake- Griebnitzsee und Griebnitz-
l
mXiiiimmmm .
jgmm¥■. i
Brücke Rudow-Johannisthal.
see-Potsdamer Stammbahn landespolizeilich 20 m Lichtweite und 4 m Lichthöhe über dem höchsten Wasserstande festgesetzt. Die Brücken auf
dieser Strecke zeigen beiderseits einen massiv durchgeführten Leinpfad von 1,5 m Breite. Die Überbauten erhielten demnach nur rd. 24 m Stützweite, soweit nicht etwa besondere örtliche Verhältnisse eine Vergrösse- rung derselben bedingen (wie z. B. bei der Brücke der Potsdamer Stamm-
t.hm, thl m n i7 ■7 W 4
1/- niHiiHi
bahn, bei welcher infolge der, wie vorstehend bemerkt, sich anschliessenden Krümmung und des schiefen Schnittwinkels die Stützweite auf 33m sich vergrössert). In der Spreehaltungmussten diese knappen _____________________________________Masse für die Überführung der Görlitzer Bahn und des Adlergestells bei Adlershof sowie bei der Kreuzung der Görlitzer Bahn mit der Ver- bindungslinie wegen der beschränkten örtlichen Verhältnisse beibehalten werden; im übrigen hat man aber, namentlich
Brücke in Alt Glienicke.
TL' äm -
Viktoriastrassenbrücke in Steglitz.
45
^ '■£■'►* rA • ■ .■< <'*'4. —j - ,;»V tf -KSi» * '' ^s; t,
4,KaV 44;s$!
.V
2.2 \' . ••• '-v-%,.< ■'£&>* * *v V *x •• *LSä*:.. «...
i k ■
Giesensdorferstrassenbrücke in Gross Licliterfelde (im Bau).
mit Rücksicht auf die beabsichtigte Durchführung des elektrischen Treidelbetriebes und die hierfür wünschenswerte bessere Übersicht des Kanals, sich zur Durchführung des regelmässigen Kanalprofils auch unter den Brücken entschlossen, wobei nur die Leinpfade eine Einziehung von 2 m auf 1,5 m erfahren. Dementsprechend stellen sich die normalen Stützweiten der
Überbauten bei den rechtwinkligen Strassenbrücken für die Mittelöffnung auf rd. 37 m.
Die eisernen Strassenbrücken wurden in der Spreehaltung jeweilig nach den örtlichen-Verhältnissen nach 3 Typen ausgebildet. Der erste entspricht, abgesehen von der vergrösser- ten Stützweite, dem System der Überführung der Stolpe-Neuendorfer Chaussee, zeigt also einen über der
Fahrbahn liegenden Trapezträger mit einfachem Netzwerk, dessen Felderweiten noch durch eine Vertikale zur Zwischenaufhängung der Fahrbahn geteilt sind. Bei schiefen Brücken sind der obere Quer- und Windverband fortgelassen und die Vertikalen steif ausgebildet.
Die nach dem zweiten Typ konstruierten Hauptträger sind als Bogenträger mit Zugband ausgeführt.
jüft2
mmMl
; /<*
Mittelmühlenwegbrücke in Teltow.
46
ah- •
i h *
r rf- W.ti
'1W
r
Ls
'X
-•iiÜ■»1If1
m
%i
) l*
444
'KS.’tfT;. •Sc
//r'
>
. .J '
L
*ük
ML&■ t- -ä.
:-**&*fg
s?
Durchstich bei Klein Glienicke.
47
; ,;.■
>>j,,
r^’W'4^■1ZS3
^»5bu»-.■ ‘"‘tWvi-
Rungiusstrassenbrücke in Britz,
Beim dritten Typ überspannt die unter der Fahrbahn liegende Konstruktion den Kanal in voller Breite, sodass grössere, auf Erddruck beanspruchte Widerlager fortfallen. Die Hauptträger sind als Kragträger mit überstehenden Enden ausgebildet, wobei zur Vermeidung negativer Auflagerdrucke die Brückenenden mit Granitpflaster versehen sind, während die Fahrbahn zwischen den Stützpfeilern mit Holz gepflastert ist.
■
Prinz Friedrich Leopold-Kanal, Feldwegbrücke.
48
Die abweichenden Formen der beiden Strassenbrücken an der Kanal-mündung in die Havel, woselbst auch auf die Durchführung des Treidel weges verzichtet werden musste, zeigt vorseitiges Schaubild.
Im Vordergründe erscheint die Überführung der Chaussee Potsdam-Wannsee, die mit einer nach dem Gefälle der Strasse wachsenden Trägerhöhe hergestellt ist, und dahinter eine nach dem Park von Schloss Babelsberg führende Privatbrücke, die der gefälligeren Erscheinung wegen als Bogenbrücke hergestellt wur-
Ferner zeigen abweichende Formen die Überführung des Rixdorf- Mariendorfer Weges, die mit Rücksicht auf die grosse verfügbare Konstruktionshöhe und den tiefen und breiten Erdeinschnitt als Dreigelenkbogenbrücke mit überkragenden Enden ausgebildet wurde (die Stützweite der Mittel-
Brücke Rixdorf - Mariendorf in Tempelhof (im Bau).
de.
. mm
i :it
V!j
L
V
fl§
&. !
m'■4
■ ■
WYH
'm
m
m
m1m
SSSS
I»
ii?
'1l M
s
'iXi
T.ä
1
1 *,
*
m
Öi^v
EK1 '
: mm
an*w JiR^Tp
'T^B
m:■
JÄÖöSÄ1
~vt|
m:'r:
IHRRKiSill^mmm
W:iäß*i-
B8SÜE?A'4§mWm
■- ~>-
I.aW*!
V - ’S■"3 Sf-SsSSfe' A•aBÜSfe.-.W**IS ■•e • ®%i- ■ ry ■■r'%^..^
JSt^V-gT
AL . '3f
:• ^ y/\ >
i ir» ^0sb®Ajli s ** 1
*.$ 1FViLRI * \V vV v!fe • Lr\<: < Y *|
i i \ %sv\ ;a vF
~->-
\1 ‘i; 1 »(>.T - ’
VT<
,!■\ '■ 'F?( Lfe • r f'• ’ . )r H*V^^*a \ \ ■"' ’ V
sf i-i
,/ä1
J
i&.
mSji
1 ;Al ,
Mi ’ii
s:alt:iT■m r ~rj; II■fl
fcSl-ililüS
42n r^y t < Jiimmn TjJMMIIIH ^ ^
*T>-
i:il\;. äy
a
Öjfe<■( •
Es < k
■i
fSr ^M-a ,7
fe.5'vr }«
w.’
naiiispflii
4
a|IP77\A»TU
• “F -T-J-kwWISl f Inf&eZ*
r/mtu rv
äsri■&7Sr
7
..« «
r Jomtmm
mSSSs
■ Ä^fliB*■ * •«* >J| —•. ,
lüMl'URI
lü!. — -JC'T
l!§SS=^:m>4ni rsiHi 3
-
fl pnvsin
, 2piiilSWI
i|,fA%
A...— iN
ti:v
li_SSf=?l
ri& I.
Mül
f
i
it<l1
-
s
j
HE
nmz:=:
i.A^yÄ^,*’* i jj
iE
C'yfjA'
[£
;'y<4
-
Her
man
n Roc
kwar
dt. B
erlin
-6r. L
ichl
erfe
lde.
phat
.u h
eI.
"55
^-r^
■ — *' >>
n
K5
MM
- _•. • .... _
--
SS
%•a
.f
!?>
HU
n
«£2T
Ü
...
KA
NA
LMU
ND
UN
GG
RU
N A
U
TELT
OW
KA
NA
L
Vsov
/*:'Ä' : / / ^W / ■■. .
4r+
Öffnung beträgt 48, die der Seitenöffnungen je 20,72 m), sowie die der Cöpenicker Landstrasse im Zuge des Verbindungskanals Britz-Kanne. Letztere ist mit Gerberschen, die Mittelöffnung überragenden Trägern, welche einen weiteren versteifenden Obergurt erhalten haben, hergestellt. Hierdurch wird dem Überbau die Erscheinung einer Kettenbrücke gegeben; die Mittelöffnung hat 36,81, jede der Seitenöffnungen 14,32 m Stützweite.
Beim Prinz Friedrich Leopold-Kanal, welcher im wesentlichen nur dem Personendampfer- und Bootsverkehrdient, konnte die Lichtweite der mittleren Durchfahrtsöffnung auf 16,5 m beschränkt werden. Um einemöglichst freie Durchsicht zu erzielen, wurde auch hier gleichwohl das volle Kanalprofil überbrückt, indem die Brücke Cöpenick-Grünau.
als Blechbalken konstruierten Hauptträger der Seitenöffnungen kragförmig über die Mittelpfeiler fortgeführt wurden. Die Mittelöffnung erhielt so eine Stützweite von 18,0 m, bei einer Länge des mittleren aufgehängten Trägers
jede der Seitenöffnungen eine solche von 12,0 m.Die Eisenbahnbrücken sind
von 11,5 m,
durchweg als Parallelträger teils mit untenliegender, teils mit aufliegender Fahrbahn, je nach der vorhandenen Konstruktionshöhe, ausgebildet. - Die Leinpfadanschlüsse an den Brückenbei den Übergängen aus den Normalquerschnitten werden durch Krümmungen von 50 m Halbmesser vermittelt.
Für die Strassenbrücken sind, je nach der Verkehrsbedeutung, bestimmte Breiten von 7, 10, 13, 15 und 20 m festgesetzt, die sich auf Fahrdamm und Bürgersteig im allgemeinen wie folgt verteilen:
Gesamtbreite Fahrdamm Bürgersteig je m
Rudowerstrassenbrücke in Britz.
20 20
I 7,6 + 2 X 3,2 I I ,02,5 2,5 3,0 . 4>5*
49
tjv>.
' v :\<
..
, -- - -
OOC
oE £
■*SK34} rar
ü! 1 _--j
iOiM'fl lillim»
«AiKl]Ifeüihr±~I
Bei den über der Fahrbahn liegenden Hauptträgern ist für jeden Träger noch eine Mehrbreite von 0,5 m zugegeben. Von diesen Normalien weicht nur die Babelsberger Parkbrücke ab, die, wie schon erwähnt, nichtdem öffentlichen Ver- _______________kehre dient und auch hinsichtlich der übrigen Einzelheiten Abweichungen aufweist.
Das Gefälle der Brückenrampen ist auf höchstens 1 '.40 bemessen, das der Brückenfahrbahn auf beiderseits 1:100. Eine Ausnahme bildet die Brücke im Zuge der Provinzialstrasse Klein Glienicke-Neuendorf, die mit Rücksicht auf das stark ansteigende Gelände eine einseitige Neigung von 1:23,6 erhalten musste.
Die Brückenbahnen sind im Eahrdamm bei den Feldwegen mit Bohlenbelag, bei den Chausseen, bei Spannweiten bis 26 m, mit Granit
pflaster, im übrigen wie bei den städtischen Strassen fast durchweg mit Holzpflaster versehen, während bei den Bürgersteigen grösstenteils eine Abdeckung mittels Elie- sen oder Mosaikpflaster auf Beton bezw. Asphalt gewählt wurde. Die Eahrbahntafel ist bei Pflasterungen aus Belageisen und Beton, in einem Ealle (Kaiser Wilhelmstrasse in Lankwitz) mittels
Koenenscher Voutenplatten hergestellt. Bei den Eisenbahnbrücken besteht die Eahrbahntafel, soweit der Überbau über dem Kanalquerschnitt liegt, aus einem Bohlenbelag, soweit über Uferstrassen, aus einem Schotterbelag auf eisernen Buckelplatten.
Chausseebrücke Teltow-Zehlendorf in Teltow.
Rammen der Spundwand für die Widerlager der Chausseebrücke in Kl. Glienicke.
50
laJL
M :V-.
L: ’ M
4 ' ' ~-i.
__
mmmi
tüm.
X;
■T-m
' ? {'l IH r
i .ifa»* 4&
..
&Jr. >i -• ’ . ■■»M{:■
2**gpHj
■WW
'sX; f *;^ . *7V eL'vZJ* ' • t-'■• ^EfKerts,
Die geringste Lichthöhe über der Fahrbahn ist bei den Wegebrücken auf 4,55 m und zwar für die Brücken mit 6 m Dammbreite in 2,5 m, bei den breiteren Brücken auf mindestens 5 m Breite symmetrisch zur Fahrdammitte festgesetzt. Die Gründung der Brücken erfolgte bei gutem Baugrund auf Beton zwischen Spundwänden.
Die Betonsohle liegt bei den Brücken mit eingeschränktem Profil (Durchstich Klein Glienicke und Kohlhasenbrück) 1,5 m, bei den übrigen Brücken nur 0,2 m unter Kanalsohle. Die Einbringung des Betons erfolgte, wenn irgend möglich,im Trockenen unter Wasserhaltung und zwar bei kiesigem und sandigem Untergrund unter Senken des Wasserspiegels mittels Röhrenbrunnen. Nur bei wenigen Brücken musste der Beton mittels Schüttrichter unter Wasser bezw. in Betonsäcken eingebracht werden.
Betongründung des nördlichen Widerlagers der Chausseestrassenbriicke in Britz.
Der Beton für die Fundamente ist teils aus Kies im Mischungsverhältnis 1:8, teils aus Ziegelkleinschlag oder Granitsplitt im Mischungsverhältnis ausgeführt.
: 6: 3
Luisenstrassenbrücke in Steglitz. Fundierung mittels Betonsäcke. Wannseebahnbrücke. Einrammen der Pfähle.
51
iiJ4
V
.*v
mrm
fgsfVäK v i
Bei den Brücken mit eingeschränktem Profil wurden die Widerlager und Pfeiler bis zum Leinpfad in Beton ausgeführt. Wo der gute Baugrund erst in grösserer Tiefe angetroffen wurde, ist durchweg Pfahlrost zur Anwendung gelangt; es wurden hier Pfähle bis zu 20,0 m Länge, je nach der Beschaffenheit des Baugrundes, verwendet. Die Pfähle wurden unter Niedrigwasser miteinander gehörig verzangt und verholmt und dann direkt mit Beton aufgefüllt. Nur die Brücken bei Kohlhasenbrück erhielten ausserdem einen 1 o cm starken Bohlenbelag. Wo der Baugrund nicht allzu ungünstig war, aber die tragfähige Schicht doch so tief lag, dass eine direkte Betonfundierung unmöglich erschien, wurden zwischen den Spundwänden Pfähle von 6,0 bis 10,0 m Länge gerammt, diese unter Niedrigwasser abgeschnitten und sodann etwa 0,5 m tief ohne vorherige Verzangung mit einbetoniert.
Das aufgehende Mauerwerk ist aus hartgebrannten Ziegeln, teils in__hydraulischem
mörtel 1 : 2 V2, teils in Zementmörtel 1 : 4, hergestellt und mit roten Ziegeln verblendet. Die Ecken, Auflagersteine und Abdeckplatten sind in Granit ausgeführt. Die Eisenkonstruktionen sind durchweg in Elusseisen, die Auflager in Gußstahl hergestellt. Sie wurden, soweit irgend möglich,
in den Werkstätten fertig genietet. Nachdem die Widerlager bis zu den Auflagersteinen fertig gestellt waren, erfolgte die Montage auf festem Gerüst. Nur bei der Dresdener- und Militärbahn wurden 2 Überbauten der Hauptöffnung im Interesse der Zeitersparnis auf seitlichem Gerüst während
l:k?a
1Vt
v,I J S «tm1 I v$51;£*slM(gl
TO[
Nördliches Widerlager der Wetzlarer Bahnbrücke. Blossgelegte Pfahl-Abstauchungen.
Kalk-
* m 1
*ymkt5k. LG
• IW y- V r • ■
T • ppM
—ri,.,A ;
ij
Fi1■i_ \ jEtt00
Giesensdorferstrassenbrücke. Anbringen der Zangen und Holme des Pfahlrostes.
52
der Aufmauerung der Widerlager montiert und später in die richtige Lage verschoben. Die Eisenkonstruktionen haben zunächst in der Fabrik einen Grundanstrich aus Mennige oder Ferrubron und dann auf der Baustelle nach fertiger Montage einen zweimaligen Öl- respektive Ferrubronan- strich erhalten.
Die Geländer sind in Schmiedeeisen ausgeführt und, je nach der örtlichen Lage und Bedeutung der Brücke, einfacher oder reicher ausgebildet.
Die für die Bauwerke zur Verwendung gekommenen Mörtelmaterialien sind fortlaufend von der Bauverwaltung in einer hierzu errichteten Versuchsanstalt auf Zug- und Druckfestigkeit in den verschiedensten Mischungsverhältnissen untersucht worden. Ebenso wurden bei den zu den Eisenkonstruktionen verwendeten Materialien fortlaufend Festigkeitsproben veranstaltet. Für die 9 Eisenbahnbrücken mit ihren 20 Gleisen waren zusammen 834 lfdm. eiserne Gleisüberbauten erforderlich. Das Gesamteisengewicht dieser Überbauten beträgt 1910 t. Die 46 Wegebrücken haben eine Gesamtlänge von 2280 m und eine Gesamtfläche der Brückentafel von 26290 qm. Das Gesamteisengewicht der 45 Wegebrücken mit eisernem Überbau beträgt 8700 t.
Das Eisengewicht bei den Kragarmbrücken beträgt für 1 qm überbaute Fläche 340-385 kg, bei der Kaiser Wilhelmstrassenbrücke in Lankwitz, wo die Fahrbahndecke durch Koenensche Voutendecken hergestellt ist, nur 285 kg. Bei den Brücken mit untenliegender Fahrbahn (Trapezträger) beträgt das Eisengewicht für 1 qm überbaute Fläche 300 bis 350 kg, während für die Bogenträgerbrücken sich das Eisengewicht pro 1 qm auf 396 kg stellt. Das Eisengewicht der Brücken des Prinz Friedrich Leopold-Kanals stellt sich für 1 qm überbaute Fläche auf 306 kg.
Vergleichsweise ergibt sich für 1 qm überbaute Fläche das Eisengewicht wie folgt:
as^3m§i K ' ^ %wm m
Sänfsliiiyi■ ........X.
. V.. ’
■ ir-hsitl :
... • &<*£ # 'Pi JJKT m
'si»■
Anhalterbahnbrücke. Anbringen der Zangen und Holme des Pfahlrostes.
53
7 m mit Bohlenbelag Mittelmühlenwegbrücke
Armhauswegbrücke 300 kg249 kg
Rungiusstrasse 340 kglim gepflastert Viktoriastrassen- brücke
Rudow-Johannis- thaler Chausse 322 kg
Britzerallee395 kg
13 bezw. 14 m gepflastert
15 bezw.16 m gepflastert
15 bezw.16 m
Bekestrasse 347 kg 310 kg
Giesensdorferstr. 350 kg Teltow-Zehlendorfer Strasse 341 kg
Rudowerstrasse in Britz
Siemensstrasse 377 kg352 kg
Bei gleichen Bodenverhältnissen und ohne Berücksichtigung der Nebenanlagen sind die Brücken mit obenliegender Fahrbahn (Kragarmbrücken) etwas teuerer als die Brücken mit untenliegender Fahrbahn (Trapezträger).
Zum Vergleich mögen dienen die nachstehenden Brücken gleicher Stützweite und gleicher Nutzbreite, bei ungefähr gleichen Ausführungsverhältnissen der Widerlager bezw. Pfeiler.
Kosten:
76000 M. 70000 ,,
| Rungiusstrasse, Kragarmbrücke l Rudow-Johannisthaler Brücke, Trapezträger
Giesensdorferstrasse, Kragarmbrücke . Teltow Zehlendorfer Brücke, Trapezträger
Bei der Giesensdorfer Brücke sind die Bodenverhältnisse allerdings noch ungünstiger gewesen als bei der Teltow-Zehlendorfer Brücke.
Bei den schmalen Brücken mit Bohlenbelag ist hingegen die Kragarmkonstruktion billiger geworden. Die Mittelmühlenwegbrücke (Kragarmsystem) kostet 56000 M. und die Armenhauswegbrücke (Trapezträgersystem) 71000 M.
175ooo „ 135000 „
Montage der Brücke Rixdorf - Mai iendorf.
54
Bogensystem mit Zugband
Brückenbreite Kragarmsystem Trapezsystem
di
::
. ?m
m' %
E
PW&: 'j
fi m i
1
V h g
X
- >
m-:
■
KSff
' •
'l *
'M
% tK
:
1 m■ ■
:
4- •
n'
"-j- i
?■jm
: ^ \;7. i
v
I rar
; > J» - ^MBK< jijÜk
—«f~£Bgpjjr* ■
» - U^IaJtJ»" _____?*cT^ — -»Leinpfadbrücke für den Steglitzer Hafen (im Bau).
LEINPFADBRÜCKEN.
,^^|ie Leinpfadbrücken — im ganzen bisher 8 —, welche zur Über- führung des elektrischen Treidelbetriebes über die Einfahrten der
|uAJ als Stichhäfen ausgeführten Hafenbassins erforderlich wurden, sind nach verschiedenen Systemen in Eisen konstruiert. Eine
Ausnahme machen die am oberen Ende des ehemaligen Teltowsees belegenen Leinpfadstege, welche zur Überbrückung der dort im Interesse des Eiswerks und der Kadettenschwimmanstalt belassenen Ausbuchtungen dienen und in normaler Leinpfadhöhe als einfache Holzjochbrücken ausgeführt wurden.
Die eisernen Leinpfadbrücken haben grösstenteils 3 Öffnungen, deren mittlere Durchfahrtsöffnungen eine Lichtweite von rd. 33 bis 56 m aufweisen.
Die Leinpfadbrücken für die Hafeneinfahrt Tempelhof, Britz und für den Verbindungskanal sind als Trapezträger mit 33,0 m Spannweite konstruiert. Die anschliessenden Rampen sind der Übersichtlichkeit wegen in leichter Eisenkonstruktion als Gerbersche Blechbalkenbrücken auf mehreren Stützen mit
p
p
7,0 m Eeldweite hergestellt. Die Leinpfadbrücke für die Hafeneinfahrt des Gasanstaltshafens in Mariendorf ist als Gerberscher Gelenkträger mit 56,0 m Mittelöffnung und je2 Seitenöffnungen von 20,0 m Spannweite ausgeführt; die Einfahrten zum Steglitzer und Lichterfelder Hafen sind in3 Öffnungen mittels Eachwerkträger mit gebogenem Untergurt überbrückt.
r_.,- • -t-ptt-
*- £5% "fTyr—r-; '
~r\
■
Leinpfadbrücke für den Gasanstaltshafen in Mariendorf (im Bau).
55 \
K
■A
«5-\ A A A
V ?«&
- ‘.. ^ j' - * «s»
,
sse»*- ,-r - -'^ - ..: ....: - t- .
--'-‘-A ••-.;r.L*- - ''- Tv ...
S& ". «w. .
£is*^ , ;: rA- vC. jHafen Rudow (einschiffige Kanalerweiterung).
SONSTIGE KANALBAUWERKE.
a) Die Hafenan 1 agen.
MKbmd^ werden die in grosser Anzahl vorgesehenen öffentlichen Hafenanlagen bezw. Ablagen durch eine ein- oder beiderseitige Ver- breiterung des Kanals um je io m gebildet; nur für Gross Lichter- felde, Steglitz, Tempelhof und Britz sind besondere Hafenbecken
neben dem Kanal zur Ausführung gebracht. Es hat sich dies hier als notwendig erwiesen, weil bei einer mehrschiffigen Verbreiterung des Kanals, wie sie für diese Plätze mit Rücksicht auf das stärkere Verkehrsbedürfnis erforderlich geworden wäre, die Durchführung des elektrischen Treidelbetriebes sich wesentlich erschwert hätte.
Ausser dem den Dienstzwecken der Kanalverwaltung gewidmeten Bauhofshafen am elektrischen Kraftwerk sind ferner noch zwei grössere private Stichhäfen, der eine für das Schönower Industriegelände am ehemaligen Teltowsee, der andere für den Kohlen- pp. Umschlag der englischen Gasanstalt in Mariendorf, ausgeführt.
Die Hafeneinfahrt bei den vorgenannten Stichhäfen ist so gestaltet, dass die Kähne von beiden Richtungen nach den Liegeplätzen ein- und ebenso
56
I!
i% |tf i-si 1 ?, !! I
mmmmm M\1£3ij p
.0
I 1
J|
- Mr1»H
iIj- W.1
Iß Rm t 'p-f 1,1■ /I
ü _
Vj3-, C,*■«
* w JLjv
flBb,
\ ''
f Ww . Mn
wm ■■■"fB? ., ••kt.
r II jiillil HUS I] IIli «PiIS1bI§UTUEyv;
f & m ij?
i;* If 3
1 I RS& * ' I%*% »ft--k
\V ® J«T ll kJ . A J
iplr'hr !fJß fWwJw URv.
tef<Pl
■ Ii,1 fr* 1U|
pmHli D 8rl IM Qli
: M iui>i
?m ll &12|W‘ «
-,ja "1,V !j8»i !’!ihK
ti Imj r<T:" ‘f*n f'■;'1
*v';i
tiii
vj!
Th Fi1 ® « * <
;5C»i hMfit1lllT;,U^| H i I IIf
l 1 l~,. il?!:1M frfcy.. •• */4Hw ! ^
iw■V : *
• ' i m'#, j* * .*■'% .»d3
fv ♦;;r it-& i1fk *- *., ■■ 1:
:rn.. Ü i s\iI.ife )Wis
■ ■ p, t ^
. • :^r 'p', . •
mtCT
/ //'• * t: aJFi>: > äNm - *
■3r Mi’V
V v" " ^ /■& r >sy
yr&z~
<*C-
+-T
-;
-i
-i-
> ■■■
V •:
J
J, f
S fr'" fc»-r-vjj
■r
j*-
_ -
«r—'
' • *•*
. v
“ y
r=- —
T'
V
TELT
OW
KA
NA
L
BRIT
Z.CH
AU
SSEE
STRA
SS EN
BRÜ
CKE
IAK iim m r r i) i r; t 11 m i M; i ir^nTnTTfTWTTrfTTTTTTUTTrrrnT'r'fTr^^TrmrTTTTTrfrrrffTrfü'i ii iVl ii/iVTTT'iVi'M ;Vh rr-' I r r f'i f1' rVr!': [''M'M'r'h'ViVi'i'rVi'r't; f *' Vr m m '"r^HrTTTfnTfr'r^K
1^3 ~ ~*-:Bosü)(7ncisrüss
!7SÄä^SJ^fl&||=
■n1
T e I t o w | K s> n a /+5+.Q+-70
Hafenbecken > * *£•y JJ
Lösch - und Ladeplätze'•7t vA\.-3+.J Lac/esh T ?5 -•1:5000 $/_1|0 m 0+Z5.Q?—5I° 100 i
BrJ“+36,0
/ Zn efl 7? «<5sVA5J/S’ ch esZ u künftig e ¥-5^ NQuerschnitt A - B. §im Maasstab 1:1000. t- <3<0.«•g s 5
-- — 13-3-- — ------
■‘TTTTnT!flS I fe feilTeltow-Kanal-------
N.W. + 32.2Hafenbecken
M.W.+32.2%! ft
+2b,ö |f I ipT'-yrm:JL■S+--, K - - - - - - ----------------$0,0 --------- w. 3,2.0 *--------- Ig o---------*6,2SS +S------------- 30,0 ------*-6,235-*— 16,0------w 8.0 11,0
Hafen Gross Lichterfelde.
/ 3-------K'S 'n ~af[~~S~ ;si==3jS8^i
iygdegät#—--T'e Lösch - 3 \ov
VL. HaFenbe ckfnfy=
Lsdepjst^$yo^ f $
*1: 5000^50 mt 50 100 .6
•’JMc,
Hafen Steglitz.
Ausser den öffentlichen Hatenanlagen ist noch auf längeren Strecken des Kanals für den Aufschluss von Industriegelände eine grössere Anzahl von Verbreiterungen um i und 2 Schiffsbreiten auf Kosten der Anlieger beabsichtigt und zum Teil bereits ausgeführt.
57
Die Durchführung des Leinpfads bedingt bei den Stichhäfen eine Überbrückung der Hafenmündungen, über die das Nähere bereits an anderer Stelle gesagt ist.
in beliebiger Richtung wieder ausfahren können; vor der Einfahrt sind ein bezw. zwei Warteplätze im Kanalprofil ausserhalb der Durchfahrtsstrasse angeordnet.
Die Lösch- und Ladeplätze sind im allgemeinen an der Wasserseite auf + 34,04 NN., d. i. 1,0 m über HW. bezw. 1,74 m über Normalwasser angenommen, sodass ein bequemes Aus- und Einladen von Baumaterialien und anderem Schiffsgut ermöglicht wird.
Lade
plät
zeLö
sch
und
La de
st n
pejc/uio
3170
-
b) Grabeneinlässe, Rohr- und Kanalkreuzungen.
Die den Kanal zahlreich kreuzenden Gräben sind, soweit dieselben zur Zeit noch der reinen landwirtschaftlichen Entwässerung dienen, als einfache Rohreinlässe von 0,50 bis 0,90 m Durchmesser in den Kanal und zwar in Niedrigwasserhöhe eingeführt.
Schwieriger gestaltet sich die Einleitung der Abwässer aus dem lür die Bebauung bereits erschlossenen oder demnächst
Nach langen Verhandlungen zwischen den verschiedenen beteiligten Behörden und der Teltowkanal-Bauverwaltung sind hierfür allgemeine Grundsätze festgelegt worden, die im wesentlichen darauf hinzielen, dass nur durch vorherige Absatzbassins mechanisch vorgereinigte Meteorwässer unmittelbar in den Kanal eingeführt werden dürfen.
zu erschliessenden Gelände.
# %iwfmrnnTTMumiuMm'.n.mm.,.......... , , r , r------ ,
! ' '■ ' • ' 1------ 1
rrmtn
& tk | j I Zollfreie Niederlage J "ly/. ^ Lösch u.Lade-
m i. 1I *r, LS? §!. Hafenbecken hf
Sohle + 30,2
~ Z7~ZPt £
platze
WM * 1,T e / t o w KanalW.
ÄQß_cjh^ynasfusß_müfiT 1 i. 1111
Tmw/iiwmmiTTmTniiiHin fiin j 1 u i I fln rri 171 rrm r! iimnTTTmi:nrinnrmiTiTnmnTiiTiimntiiTnTTTrrnTilillliiM nrnrnru riTTTiTrrmnn
$ 1:5000
1/ 150 m1000. 50
Hafen Tempelhof.
Für Gebrauchs- und Eabrikabwässer wird vor Einleitung in den Kanal eine vollständige Vorreinigung auf Rieselfeldern oder mittels biologischen Verfahrens, gegebenen Falles mit Nachrieselung, gefordert. Sogenannte Notauslässe aus dem Schwemmsystem zum Kanal werden unter keinen Umständen gestattet. Wie dies bei dem grösseren Teil der nach dem Teltowkanal Vorflut nehmenden Entwässerungsverbände bereits der Fall, werden künftig die betreffenden Ortskanalisationen danach im allgemeinen nach dem Trennsystem
Für die Einleitung von Fabrikabwässern wird, zweckseingerichtet werden.Entlastung der Ortskanalisationen, hierbei die Einrichtung besonderer Zweckverbände angestrebt.
58
Es liegt auf der Hand, dass bei der Lage des Kanals in unmittelbarer Nähe der Großstadt Berlin zahlreiche bereits vorhandene oder in näherer Zeit zu erwartende Kreuzungen von Rohr- und Kanalleitungen bei der Bauausführung zu berücksichtigen waren. Während Gas-, Wasser- und Schmutzwasser-Druckleitungen grösserenteils innerhalb der Brückenüberbauten mittels schmiede- oder gusseiserner Leitungen überführt werden konnten, mussten für die sogenannten Gravitationsleitungen durchweg dükerartige Unterführungen vorgesehen werden. In solchem Falle sind durchweg schmiedeeiserne Rohre von 10,0 bis 20,0 m Länge verwendet worden, wobei die Oberkante der Rohre 80 cm unter Kanalsohle verlegt wurde. Die Rohre sind zwischen Spundwänden ringsum einbetoniert.
NORD'S- A
I Schuppen ft*/ 'bezw.Lrweit. ft*HaFenbecken
Sohle* 30,?+ 34-.04-^ZuTahrtsweg -'30273rjfejE;
O.Seiten weg
\z
r* \V \1A X- '1:50000 , , , , 50 , , , ,100, , , ,^0m \'I\ V\ ' \'
V’\'S
w-
Hafen Britz.V* >\ \&V1i\\%
c) Wehreinbauten.
Zwecks Ermöglichung eines zeitweisen Aufstauens und Absenkens einzelner Kanalabschnitte zur Durchführung periodischer, etwa erforderlich werdender Spülungen oder der Vornahme von Ausbesserungen an den Uferbefestigungen sind in der Nähe der oberen Kanaleinmündungen, und innerhalb der Adlergestellbrücke im Haupt-, und innerhalb der Görlitzer Eisenbahnbrücke im Verbindungskanal, ferner in der Stolpe-Neuendorferbrücke der Havelhaltung zwischen den Widerlagern, quer durch die Kanalsohle, 3-5 m breite Fundamente zur Aufnahme von Nadelwehrverschlüssen
zwar
59
Gl&cißotaß.f •? 1
l
j_ _.js*. —y. TM*P_;
3!
*
,r
ILJmm*?*'**,
.
\
ilM fy
/<&tfRaßctaSX. "Lf...?&
fl \y> Fbhlrst'Jnqerjilajtz.\ , V* Vfvfl ^ m \ %~\ &B/£n§ __
/>o/ •Strasse;
Lii
iv ^\11 i 1 i 1 i: 11111! 1 n 11 iT 1! 1 l 111 i 11 il 1.1111111111; i •,!1; 1: in 1111 i 1 i
1 ■ Berlin - jDnptiaeriär JffiöeriöcisiTis ■ ■ ■nlvurr
Hafen Gasanstalt Mariendorf. Querschnitt Ansichtder Ufermauern.
d) Ufermauern und Bohlwerke
so im Durchstich bei Klein Glienicke, vor dem elektrischen Kraftwerk und im Gasanstaltshafen bei Mariendorf bezw. an der Kunheimschen Fabrik, nahe der oberen Ausmündung des Verbindungskanals — zur Ausführung gebracht. Die Einrichtung weiterer steiler Uferschälungen soll dem eintretenden späteren Bedürfnisse Vorbehalten bleiben.
sind bisher nur vereinzelt
60
eingebaut. Voraussichtlich werden dieselben, nach Lage der örtlichen Verhältnisse und bei den zu erwartenden zureichenden Grundwasserzuflüssen, indessen nur selten in Betrieb zu stellen sein.
Hl
*a:
S-24 y
s:« 3
:::5
t•> 3
TFTS
_
Al
-!;•
EINRICHTUNG DES ELEKTRISCHEN
SCHLEPPBETRIEBES.
|8^S^^^|ie besonderen auf dem Teltowkanal zu erwartenden Verkehrs- un<^ Betriebsverhältnisse legten den Gedanken nahe, von dem
SllF^rd ^^s^er^en Grundsatz der sogenannten freien Schiffahrt abzu- weichen und die Frage eines verwaltungsseitig zu regelnden
Schleppbetriebes in Erwägung zu ziehen. Wie an früherer Stelle bemerkt, hat der Teltowkanal nicht allein den üblichen Schiffahrtsinteressen, sondern auch anderen Zwecken zu dienen. Aus dem Bedürfnis ursprünglich entstanden, zunächst die Vorflut der südlich von Berlin im Kreise Teltow belegenen und in lebhaftem Aufschwung befindlichen Vororte zu verbessern, wurde seine Zweckbestimmung später dahin erweitert, dem Ortsverkehr, namentlich für den Bezug von Bau- und Brennmaterialien, zu dienen und ihn somit angesichts des zu erwartenden Massenverkehrs zu einem Hafenkanal auszugestalten. Tatsächlich ist denn auch diesem Umstand in weitestgehender Weise durch Anlage öffentlicher und privater Häfen Rechnung getragen.
Endlich bietet der Kanal eine wesentliche Abkürzung für den Durchgangsverkehr zwischen Elbe und Oder. In letzterer Beziehung erscheint er als ein wichtiges Bindeglied im öffentlichen Wasserstrassennetz, während ihm zugleich noch die Auflage gemacht ist, zur Entlastung der Oberspree als sogenannter Hochflutkanal zu dienen.
Wenn nun schon von Staats wegen die Frage angeregt worden ist, die Betriebsverhältnisse auf den künstlich regulierten Wasserstrassen und den künftig zu schaffenden Kanälen dahin zu regeln, dass der Schlepp- und Treidelbetrieb behördlicherseits in die Hand genommen werden soll, so liegt die Ausführung dieses Gedankens beim Teltowkanal um so näher, als die vorerwähnten verschiedenen Zweckbestimmungen des Kanals die Durchführung einer freien Schiffahrt ausserordentlich erschweren würden und der Kreis Teltow als alleiniger Träger des Unternehmens ein besonderes Interesse daran hat, den Betrieb und zugleich die hieraus zu erwartenden Einnahmen nach eigenem Ermessen zu regeln bezw. festzusetzen.
Erfahrungen und Vorbilder nach dieser Richtung liegen bisher nicht vor. Auf dem Kanal von Douai ist zwar ein Treidelbetrieb mittels elek-
61
erst neuerdings sind eingerichtet; derselbe wird
trischer spurloser Lokomotiven (cheval electrique) dieselben in spurende umgeändert worden aber neben der freien Pferdetreidelei betrieben. Die bisher dort getroffenenEinrichtungen sind immer noch primitiv. Ebensowenig ist der auf dem Seekanal Brüssel-Rüpel eingerichtete Propellerdienst monopolisiert; ein unmittelbares Vorbild für das auf dem Teltowkanal anzuwendende Betriebssystem konnte also nicht herangezogen werden. Nach den auf dem Oder- Spreekanal gemachten Erfahrungen stand zunächst nur soviel fest, dass im Interesse der Kanalunterhaltung von einem Dampfer-Schleppdienst zweckmässig abzusehen, vielmehr ein Schiffszug vom festen Ufer einzurichten sei. Seitens der Eirma Siemens & Halske waren bereits früher am Einowkanal Versuche nach dieser Richtung hin gemacht worden. Wenn dieselben bisher ein befriedigendes Resultat nicht ergaben, so lag dies ebensowohl an der für die Einrichtung eines derartigen Betriebes nicht recht geeigneten Eorm der Uferausgestaltung der gewählten Versuchsstrecke, wie an der Neuheit des Problems selbst. Die Teltowkanal-Bauverwaltung entschloss sich daher auf Grund eines sehr eingehend durchgearbeiteten und vorbereiteten Programms, ein allgemeines Preisausschreiben für die Gewinnung eines geeigneten Schleppsystems zu erlassen. Trotzdem, wie vorbemerkt, in erster Linie an die Einrichtung eines elektrischen Treidelzuges vom Ufer aus gedacht war, wurde gleichwohl in dem Preisausschreiben auch die Wahl anderer Systeme — mittels Propeller beliebiger Betriebsart (auch an Kette oder Seil etc.) — freigestellt. Unter den zahlreich eingegangenen Entwürfen gelangte schliesslich der mit dem ersten Preise gekrönte Vorschlag der Firma Siemens & Halske, eines elektrischen Lokomotivbetriebes, in enger Anlehnung an die von der Teltowkanal-Bauverwaltung aufgestellten Grundsätze, zur weiteren Behandlung. Letztere traf nun mit der inzwischen vereinigten Eirma Siemens-Schuckert ein Abkommen dahin, auf gemeinschaftliche Kosten und unter Aufwendung nicht unerheblicher Mittel eine rund 1,3 Kilometer lange Versuchsstrecke einzurichten. Dieselbe wurde innerhalb der unteren Kanalhaltung von Albrechts Teerofen bis zum Griebnitzsee gewählt, weil sich hier die beste Gelegenheit fand, das System unter besonders schwierigen Verhältnissen (enge und kurz aufeinander folgende Brückendurchfahrten mit geringen Krümmungshalbmessern und steilen Rampen) durchzuproben.
Es sei hier noch hervorgehoben, dass die Entscheidung des Preisgerichts zugunsten des elektrischen Lokomotivbetriebes trotz des Umstandes fiel, dass die Betriebskosten bei Annahme eines Jahresverkehrs von rund
6 2
i 500000 Tonnen zu o,8 Pfennig pro Tonnenkilometer ermittelt waren. Im Vergleich zu der Tatsache, dass bei Pferde- und Propellerbetrieb diese Kosten nur rund 0,3 bis 0,4 Pfennig erreichen, war das Ergebnis des Preisausschreibens im Grunde wenig ermutigend. Gleichwohl waren die Erwägungen über die spätere Verbilligung dieses Satzes bei gesteigertem Verkehr und die Ersparnisse an der Kanalunterhaltung doch derartig durchschlagend, dass in erster Linie die Einrichtung des Lokomotivtreidelbetriebes weiter verfolgt wurde. Vorbedingung war nun zunächst die Erwirkung eines Schleppmonopols und der hierzu erforderlichen staatlichen Genehmigung. Nach längeren Verhandlungen mit den beteiligten Behörden wurde letztere dem Kreise durch Erlass der betreffenden Ressortministerien unter dem 17. Mai 1901 erteilt.
Elektrischer Treidelzug.
Die Schleppversuche sind nun in vielseitigster Weise durchgeführt worden und zwar sowohl mit einer von den Siemens-Schuckertwerken inGemeinschaft mit der Teltowkanal-Bauverwaltung neu entworfenen, elektrischen Adhäsionslokomotive, wie mit einer Reihe von Schiffspropellern. Zu letzteren zählten ein elektrisch betriebener Dreischraubenschlepper, welcher seine Betriebskraft sowohl aus einer Akkumulatorenbatterie, wie auch unmittelbaraus einer in der Kanalachse gespannten doppelpoligen Oberleitung, endlich mittels Lombard-Gerinschen Rollenkontaktes
sowie aus einer seitlichen
Uferleitung entnehmen konnte. Fernere Versuche wurden angestellt mit einem Sauggas-(System Körting), Daimler-Spiritus-, sowie endlich mit einem
63
Dampfschlepper.indessen mit Steinkohlenteeröl geheiztengewöhnlichenWenngleich es schon feststand, dass im wesentlichen der elektrische Lokomotivbetrieb für die Hauptstrecke gewählt werden sollte, so waren doch die gleichzeitigen Versuche mit den Propellern deshalb nicht zu entbehren, weil innerhalb des Kanals Strecken Vorkommen, bei denen einanderer, wie ein Propellerbetrieb, ausgeschlossen ist.
r
5■I
*
■ . * P Jfk 4t
»pp*?"V
Elektrische Treidellokomotive.
Der Schleppzug selbst wurde in verschiedenster Weise zusammengestellt: er bestand abwechselnd aus 2 westlichen Normalschiffen von 600 t, 4 Finowschiffen bezw. Oder- und sogenannten Berliner Maßkähnen von rd. 250 t, welche in verschiedenster Form, kurz und lang, hinter- und nebeneinander gekuppelt, zum Teil in freier Fahrt, zum Teil über am Ufer liegende Hindernisse (leere Schiffe) in verschiedenen Geschwindigkeiten geführt wurden.
Die eingehend durchgeführten Versuche erstreckten sich namentlich auf den Kraft- und Stromverbrauch, Messungen der Zugkraft bei verschiedenen Fahrgeschwindigkeiten und Widerständen, die Inanspruchnahme des Gleisoberbaues, der Fahrdrahtleitungen und die Lauffähigkeit der Lokomotive, sowie endlich auf die Einwirkung der verschiedenen Betriebsmittel und geschleppten Fahrzeuge auf das durch Schrauben- und Bugwelle bewegte Wasser und den hierdurch beeinflussten Kanalquerschnitt.
64
t FR*«t I
:: m*5 4 ;■
rittäfe *
11
vT!
T* P^lM *«TO V*@ Aig "i
i ■ '*:=
1PJ -:,iÄ iPS nsfp; q
ii t siSfd
BfiWI>■Be|
S seiI F“!II ETT, ■•.X
i' r#=r
hll1
/
gl1 r*li *4,
Vrijfj?'*!
y ÜBIiL '
58S
H§8Pp
#;WKä' £. L;• i •*"T^ho* Al
mwiwitoa
' I»
mmJa
m&A-i; mmK*ftS■
3 ?, r*.■* *Pr1
T -j2
TMspg/ st4; $:»mHr
l|P»•
IJ
i Wmmm M' lf ti /
KBr&
t y.t ' ■
Ctm
W
wi
i
a*■i
tu-
i-f'
.§• |
;,f
sclil'jbI
Her
man
n Rüc
kwar
dt. B
erlin
, 6 r.
-Lic
hter
fel d
e, ph
otu h
e!-
m
U. LO
KO
MO
TIV
SCH
UPP
EN.
KLE
IN-M
ACH
NO
W.
CHA
USS
EEBR
UCK
E
TELT
OW
KA
NA
L
Über die Einzelheiten der für die Durchführung des Schleppbetriebes endgültig getroffenen Einrichtungen sei nun folgendes bemerkt:
Soweit irgend möglich, ist der Schleppbetrieb vom festen Ufer aus mittels elektrischer Lokomotiven eingerichtet; ausgeschlossen ist derselbe auf der untersten Kanalstrecke von der Glienicker Lake bis zur oberen Einmündung des Kanals in den Griebnitzsee, sowie oberhalb der Schleuse innerhalb des Schleusenoberhafens und des Machnowsees, aul welchen beiden Strecken aus örtlichen und landschaftlichen Gründen die Durchführung von Treidelwegen, sei es am Ufer, sei es auf etwa einzubauenden Leinpfad- brücken, unmöglich ist. Betriebstechnisch wird daher der Treidelbetrieb auf dem Hauptkanal Klein Glienicke-Grünau in 4 getrennten Abschnitten geführt:
1. Glienicker Lake bis zur Kanalmündung in den Griebnitzsee, rd. 3 km lang, Propellerbetrieb,
2. vom oberen Ende des Griebnitzsees bis zur Machnower Schleuse, rd. 5 km lang, elektrischer Lokomotivbetrieb,
3. von der Machnower Schleuse bis oberhalb des Machnowsees, rd. 1V2 km lang, Propellerbetrieb,
4. vom Machnowsee bis zur oberen Kanalmündung bei Grünau, rd. 28 km lang, Lokomotivbetrieb.
Die Lokomotiven durchfahren die Strecke 2 bezw. 4 in voller Länge und im Ringbetrieb. An den Endpunkten wird also eine jedesmalige Überführung der Lokomotiven über den Kanal erforderlich. In der Nähe des unteren Endes der Strecke 2 (bei Albrechts Teerofen) und an beiden Endpunkten der Strecke 4 befinden sich Lokomotivübernachtungsschuppen.
Um ein eventuelles Auswechseln auf der längeren unter 4 gedachten Strecke unterwegs ermöglichen zu können und grössere Leerläufe der Lokomotiven bei etwaigen Betriebsstörungen oder Unregelmässigkeiten zu vermeiden, sind auf zwischengelegenen Brücken noch einige Übergänge vorgesehen.
Auf dem Verbindungskanal Britz-Kanne, dessen Länge nur rund 4 km beträgt, soll bei der bestehenden örtlichen Schwierigkeit, an den Endpunkten dieser Strecke Lokomotivübergänge zu schaffen, auf einen Rundlauf der Lokomotiven verzichtet werden. Es würden diese vielmehr hier jedesmal die Rückfahrt im Leerlauf zu machen haben.
Auf dem Prinz Eriedrich Leopold-Kanal ist, da derselbe zum wesentlichen Vergnügungs- und Sportzwecken und weniger dem Erachtverkehr dient, auf die Einrichtung eines organisierten Schleppbetriebes überhaupt verzichtet worden.
65
Innerhalb der mittels elektrischer Lokomotiven betriebenen Treidelstrecken erhält der Kanal auf den beiderseitigen 2 m breiten Leinpfaden einen 1 m spurigen, symmetrischen Vignolesschienenoberbau. Das Schienengewicht beträgt 20 kg je lfdm, dasjenige der flusseisernen Querschwellen rund 12 kg je lfdm. Die Lokomotive ist als einfache Adhäsionslokomotive derart konstruiert, dass sie einen Schleppzug von 2 westlichen Normalkähnen von je 600 t Tragfähigkeit oder 4 Finowkähnen bezw. östlichen Normalschiffen von durchschnittlich 250 t Ladungsfähigkeit mit 4 km Geschwindigkeit in der Stunde zu befördern in der Lage ist. Die grössten vorkommenden Steigungen, beispielsweise bei der Durchfahrt unter den Wege- und Eisenbahnbrücken, sowie bei der Überfahrt über die Hafeneinmündungen, betragen 1:50 bezw. 1:20 und die kleinsten ebenfalls dortselbst vorkommenden Krümmungshalbmesser 50, vereinzelt 20 m. An solchen Stellen soll allerdings die Schlepptrosse gelockert werden, sodass lediglich der Lokomotivwiderstand zu überwinden ist, während das Schiff zwischenzeitlich mit seiner eigenen lebendigen Kraft weitergeht. Mit Rücksicht darauf, dass die Schlepptrosse über Schiffe, welche am Ufer löschen und laden, weggeführt werden muss, ist die Lokomotive mit einem mittels Schraubenvorgeleges verstellbaren, elektrisch bedienten Ausleger versehen. Die Schlepptrosse, welche aus einem 10 mm starken und rd. 100 m langem Drahtseil aus Tiegelgußstahl besteht, befindet sich auf einer gleichfalls elektrisch betriebenen Trommel, sodass bei Steigungen, Krümmungen und beim Überholen am Ufer liegender Schiffe dieselbe beliebig gelockert und wieder angezogen werden kann.
Die Trommel ist mit ihrer Achse durch eine Reibungskuppelung derart verbunden, dass das Seil bei Überschreitung einer Zugkraft von 1200 kg ausgelöst wird. Letztere Einrichtung ist zu dem Zwecke getroffen, ebensowohl unnötige Überanstrengungen der Motoren, wie die Gefahr einer Entgleisung zu vermeiden.
Die Lokomotive selbst hat eine Länge von 6,88 m und eine Breite von rd. 1,65 m. Das Laufwerk besteht aus einem vorderen Drehgestell, dessen Achsen durch je einen Gleichstrommotor von 8 PS Dauerleistung mittels doppelten Zahnradvorgeleges angetrieben werden. Die hintere dritte Achse ist als freie Lenkachse konstruiert.
Die zur Bedienung vorerwähnter verschiedenen Motore sowie der Beleuchtung erforderlichen Schaltapparate sind bequem und handlich in einem verdeckten und allseitig durch Eenster geschlossenen Führerstand angeordnet.
66
, «3VI -J -.
Elektrische Treidellokomotive. Massstab ca. 1 : 40. iilAls Betriebskraft für die elektrische Treidelei
langt Gleichstrom von 500-600 Volt zur Verwendung. Zum Teil wird derselbe unmittelbar aus dem bei Teltow belegenen Kraftwerk entnommen, zum Teil, und zwar für die östliche Strecke, aus einer bei Britz errichteten Unterstation, auf welcher die Umformung des ihr aus dem vorgedachten Kraftwerk zugeführten 6000 Volt messenden Drehstromes erfolgen soll.
Die zur Durchführung des Schleppbetriebes zu beschaffenden Betriebsmittel sind zunächst für einen Jahresverkehr von 2000000 t berechnet. Es ist hierfür
ge- ="i
/500
abt rrlP
f-vd:
D O
"LJ M-1Jl
14«^ -ff ' _die Beschaffung von 20 Lokomotiven für rd. 1200 kg grösste Dauerzugkraft bei 4 km Fahrgeschwindigkeit 6 Schleppbooten von 100 PS,sowie von
67
soo soo
— 6880
~r
Nach den Ergebnissen der bisher gemachten und sehr eingehend durchgeführten Versuche kann der Fahrwiderstand zu 0,6 kg, die Nutzleistung der
Lokomotive zu 0,01 PS, die Bruttoleistung zu 0,0112 KW für 1 t Deplacement und die verbrauchte Arbeit zu 2,75 Wattstunden auf 1 tkm, bei 4 km Fahrgeschwindigkeit angenommen werden.
1
® 1 ®
oltu-
8/5 —
f=« r
7**
[ij
für
um
r
h
8?1
H
fc
Pf
♦ w3:m
»1
vr
Fl\
T
sr"
EL
PFf
K-
tÄ
TZi*i*r
■055
:ti1rr
fri'-3
STUiad
-7»
YnC
Lm1
• ♦| -
♦ •
P
NÄl
□
1♦ •
IT I—
;
-> t
*
%
pj"
'1
I ea
i
p—
i-
rTR
“t
I
ji
I35
g * * Lf
A
1I i*•fl
1
:@
r>'
*:—
:—:—
:.
mzsoo
Es darfwelche mit Teerölrückständen geheizt werden sollen, erforderlich, bemerkt werden, dass die mit dem so geheizten Probeboot angestellten Versuche bezüglich der Rauchlosigkeit wie auch des Heizerfolges zu durchaus befriedigenden Ergebnissen geführt haben.
Der Betrieb ist nun in der Weise gedacht, dass die für den Kanal bestimmten Schiffe in der Glienicker Lake mittels Propellers bezw. in Grünau mittels elektrischer Lokomotive aufgenommen und ununterbrochen nach festem Fahrplan durch den Kanal bezw. an ihre Bestimmungsstelle geführt werden. Bei dem nach vorhin aus zwei westlichen Normalschiffen bezw.drei bis vier Finow- oder östlichen Normalschiffen bestehenden Schleppzug muss an der Machnower Schleuse jeweilig eine Teilung stattfinden. Zunächst ist der Eahrtabstand der Schleppzüge auf eine volle Stunde festgesetzt. Es würde hierbei, 13 stündige tägliche Betriebszeit und 270 Betriebstage vorausgesetzt, ein Jahresverkehr von 3-4 000 000 t bewältigt werden können.
Der Schlepptarif ist noch nicht endgültig festgelegt. In Aussicht genommen ist für den Durchgangsverkehr die Erhebung einer Gebühr je Tonne Nutzlast von 15 Pfennig für die ganze Kanalstrecke. Bei rund 37 Kilometer Länge würde dies durchschnittlich also für Lokomotiv- und Propellerbetrieb durcheinander gerechnet, den Satz von 0,4 Pfennig je Tonnenkilometer ergeben. Für den Ortsverkehr ist die Erhebung einer Gebühr von 0,5 Pfennig je Tonnenkilometer beabsichtigt. Es ist ohne weiteres klar, dass die Kosten des Schleppbetriebes im wesentlichen von der Stärke des Verkehrs abhängen. Bei schwachem Verkehr wird selbstverständlich der Propellerbetrieb erheblich billiger sein als der Lokomotivbetrieb, trotzdem der Nutzeffekt bei letzterem mindestens das Dreifache des ersterenbeträgt. Angestellte Vergleichsberechnungen ergeben, dass bei einem Jahresverkehr von 2-2 V2 Millionen Tonnen ungefähr der Lokomotivbetrieb gleiche Kosten wie der Propellerbetrieb, darüber hinaus indessen erheblich geringere Kosten, erfordert. Bei einem Durchgangsverkehr von rund 1,5 Millionen Tonnen und einem Ortsverkehr von rund 1,6 Millionen Tonnen, also einem Gesamtverkehr von 3,1 Millionen Tonnen, ist unter den vorliegenden Verhältnissen eine 4 prozentige Verzinsung nach Deckung der Betriebs-, Unter- haltungs- und Erneuerungskosten zu erwarten, wobei das erforderliche Anlagekapital zu rund 2,4 Millionen Mark und die Kilowattstunde Gleichstrom
reichlich hoch500-600 Volt Spannung 16 Pf. Selbsterzeugungskosten angesetzt ist.
mit durchschnittlichvon
68
!Yi 14tU'x< >> 3•^r,-5
r >
~ >iXru_________ä /ssr .... ’ V ^SiÄ.TT> • "V9ä U=—\gsr32i*4f fl&lpil i
• <£"' v.'‘kl/"^AJ1 n/f'A<i * y__
mh||aJJ=afedS!>sa' • ''' H.llil.'llll ■-.- • •
I•V u iL'?Bö ;V;. •
ar T-if. ■■■,. . . . . . . . . . . . JÜpS3mm '■*2*
w
DAS ELEKTRISCHE KRAFTWERK.
jja^py^jöür die Beschaffung der zur Durchführung des elektrischen Loko- mot^v^etr^et)es auf dem Teltowkanal erforderlichen elektrischen
flSPf Kraft ist am Teltowkanal auf einem in der Gemarkung Zehlen- tdorf unmittelbar am Ufer gelegenen Grundstück ein elektrisches Kraftwerk errichtet. Es bestand zwar die Möglichkeit, elektrischen Strom auch von einer der bei Berlin bestehenden Elektrizitätsgesellschaften für die Zwecke der Treidelei zu erhalten, die Bauverwaltung war indessen der Ansicht, dass es zweckmässig sei, da sie alle wichtigen Betriebe des Kanals tunlichst in eigener Hand behalten wollte, auch die Stromerzeugung selbst zu betreiben. Zudem lag es nahe, mit der Errichtung eines elektrischen Kraftwerks auch den Nebenzweck zu verbinden, durch Lieferung billigen elektrischen Stroms Industrie an den Kanal heranzuziehen und hierdurch ebensowohl den Verkehr auf dem Kanal wie auch die wirtschaftliche Aufwertung des durchschnittenen Geländes zu fördern. Die zur Gewinnung von Stromabnehmern unternommenen Schritte haben denn auchbereits zu befriedigenden Ergebnissen geführt.
Der elektrische Lokomotivbetriebist wegen der Leitungsanordnung und wegen der stossweisen Beanspruchung Elektrisches Kraftwerk.
69
' f-
< #H
-<
>. 35
rt;US'___U
□p
Ü'LI II o
<ft N«ft ! ■ ilJbrfn!!- 4- ti I1 I
\ o$11
z_. r:i m ,r; r rtr.ii
« » o<t> ©I I1 _L
<gaLi 3»
d^iLcrjc/in itt.
!^K"
:w1rt.i<r~-’-! W fcl 1P u 1,-L
der in Hochspannungskabeln, die in den Leinpfaden des Kanals verlegt sind, den einzelnen Abnehmern zugeführt wird, bei welchen vermittels Trans
formatoren die Umformung in die Gebrauchsniederspannung erfolgt.Das elektrische Kraftwerk (siehe Abbildung) besteht aus einem zwei-
schiffigen Hallenbau, dessen einer Teil die Maschinen und dessen anderer die Kessel aufnimmt. Der dem Kanal zugekehrte Kopfbau der Kesselhalle ist mehrstöckig ausgebaut. Im Erdgeschoss des Kopfbaues befinden sich die Geschäfts- und Lagerräume, im ersten Stock die Dienstwohnung des Betriebsleiters des Werkes, während im Dachgeschoss noch zwei Wohnungen für den Maschinenmeister und Oberheizer untergebracht sind.
Der Betriebsdampf wird in vier Wasserrohrkesseln von je 200 qm Heizfläche mit Überhitzern von 60 qm Heizfläche erzeugt, welche Dampf von 12 Atmosphären Überdruck und 300° Temperatur liefern. Die Hauptdampfleitung sowie die Hilfsdampfleitungen sind als Ringleitungen ausgeführt. Die Speisung der Kessel erfolgt durch zwei Duplex-Pumpen.
4 0 40m
70
der Motore beim Anziehen schwerer Schleppzüge zweckmässig mit Gleichstrom zu führen. Andererseits macht es die grosse Ausdehnung des Leitungsnetzes unmöglich, den gesamten Gleichstrom unmittelbar zu erzeugen und auf die volle Kanallänge von einer Zentralstelle aus zu verteilen. Die Stromerzeugungsanlage wurde daher so entworfen, dass das elektrische Kraftwerk den Gleichstrom für die Treidelei auf der einen Hälfte des Kanals unmittelbar liefert, während der anderen Kanalhälfte der Gleichstrom aus einer Unterstation, in der der hochgespannte Drehstrom umgeformt wird, zufliesst. Für alle übrigen Zwecke ausser zum Lokomotivbetrieb sowie einigen Nebenbetrieben an der Schleuse wird im wesentlichen nur Drehstrom verwendet,
Elektrisches Kraftwerk.§znnoziss.m
r-t r-t
1
1 1
r 1
1 ti. f
o 00 O O
yjSy
S.
d
* - *■
i Kolbendampfmaschine von den Tagen, an welchen der
An Maschinen sind folgende vorhanden:250-350 PS Leistung, welche den Strom an Treidelbetrieb ruht, liefern soll. Sie treibt eine Drehstrommaschine von 230 KVA Normalleistung und eine Gleichstrommaschine von 1 10 KW Leistung.
Innenansicht des Kesselhauses.
Die eigentlichen Betriebsmaschinen sind 2 Dampfturbinen von je 1000 PS Leistung, System Zoelly, welche gleichfalls mit je einer Drehstrom- und einer Gleichstrommaschine direkt gekuppelt sind. Sämtliche Maschinen arbeiten mit Einspritzkondensatoren, welche das erforderliche Wasser aus dem Kanal
Das Kondensat der Maschinen fliesst dann durch eine gemein- Rohrleitung zu einer Wasserkammer, in welche ein Wehr eingebaut
ist. Der grössere Teil des Wassers fliesst über dieses Wehr hinweg durch
ansaugen, same
71
lUii: s
&
ri. y
____
_'T
3
y&
x-rm
r . f
X/L
U
eine Rohrleitung, etwa ioo m abwärts der Entnahmestelle, wieder in den Kanal zurück; das zur Kesselspeisung erforderliche Wasser hingegen fliesst vor dem Wehr auf 2 Filter und von diesen durch eine Rohrleitung in den unter den Pumpen befindlichen Behälter, woselbst es, bevor es in den Kessel gelangt, noch durch den Pumpenabdampf auf rd. 60 Grad vorgewärmt wird.
Die Schaltanlage (siehe Abbildung) ist in der Weise angeordnet, dass für jede Maschine ein besonderer Schaltständer, auf welchem sich die Spannungs-, Strommesser u. s. w. befinden, vor der Schalttafel aufgestellt ist. Auf der Hauptschalttafel befinden sich die übrigen Apparate, und zwar diejenigen, welche zur Bedienung der Maschinen und der Drehstromverteilung an die einzelnen Entnahmestellen bestimmt sind. Für die ausgehenden Kabel und für die Gleichstromanlage sind besondere Schalttafeln hinter der Hauptschalttafel aufgestellt.
In dem eigentlichen Schaltraum herrscht nur Niederspannung, sämtliche Hochspannungsapparate sind aus Sicherheitsgründen in einem unter der Schaltbühne angelegten, besonders abgeschlossenen Keller aufgestellt.
Die Erregung der Drehstromdynamos erfolgt durch Gleichstrom von 65 Volt Spannung, der in 2 vor der Schaltbühne befindlichen Umformern aus Drehstrom erzeugt wird. Zur Erregung der Drehstromdynamos nach einer vollständigen Betriebsunterbrechung sowie für eine Notbeleuchtung ist ausserdem eine kleine Sammlerbatterie vorhanden.
Die Betriebsmaterialien, Kohlen u. s. w. sollen tunlichst nur zu Wasser herangeschafft werden. Es ist zu diesem Zwecke auf die Frontlänge des Werkes eine mit einer Betonufermauer eingefasste einschiffige Verbreiterung des Normalquerschnitts hergestellt worden, an welcher die Kohlen vermittels eines elektrischen Krans gelöscht werden. Der Kohlenhof ist so gross angelegt, dass auf ihm der ganze Winterbedarf des Kraftwerkes untergebracht werden kann.
Die in Britz bei km 28,6 des Kanals errichtete Unterstation enthält 2 Transformatoren und 2 Einankerdrehumformer von je 150 KW Leistung. Die Schaltanlage ist nach denselben Grundsätzen wie beim Kraftwerk eingerichtet. Kraftwerk und Unterstation sind in baulicher Beziehung so angelegt, dass eine Erweiterung in einfachster Weise durch Hinausrücken der hinteren Frontwand möglich ist.
72
BTT •u
mk$L
' i s?A
ml —■ i
u nu■1iJmmtsO § n * :M I;1 -
I-fr—H’M o ■♦iia n
I»»,€■" f, sfteili & MÜ (s
Pirv = fj=f1
. ■ i
*®| ^.fS*n
AV\*r\ V\ v-Ü;ffl**i*r )/4 —'i~/-, V V t., \ \1fv
\ \ .
",»1 iVt ö
iu//¥/: /jjy
/ j» <k ‘iS . Ir<«kl ■i InV/ /l «X* I
_____ *:i
•v »/ 1 , * ^1
f. *fMm %h>• wsy i
k ’i*;!i;k •/
m9T p7” ■-N/ .1/
ä»*Vv17 >w
f i>!f
•7i
M// «Kt, ’A '//- *j4
'■ i/
»»&'».
iS.7
iH I iJ
• -
ryi
t\
-*>vj
IC)Ulf'* :
§*«3
<*►
4T.
w?e.
.-rr*
T E L
T O
WK
AN
AL
MA
SCH
INEN
HA
LLE .
EL. E
KTR
ISC
HE5
KRAF
TWER
K.
mW.*&} ^sritr11 * * *
*
CS
—— .'" ■■ &'" 'ar:' ■" w______ __;Personenschiffswerft bei Klein Glienicke.
SONSTIGE BETRIEBSEINRICHTUNGEN.
a) Personenschiffahrt des Kreises.
ereits seit einer Reihe von Jahren wurde seitens der Terrain- geseHschaft Neu Babelsberg während der Sommermonate auf dem Griebnitzsee eine Personendampfschiffahrt unterhalten, welche von der Glienicker Lake aus Anschluss in der Richtung
nach Nedlitz und Potsdam mittels gleichfalls durch die Gesellschaft betriebener Dampfschiffslinien fand. Der Betrieb musste früher in getrennten Linien erfolgen, da zwischen dem Griebnitzsee und der Glienicker Lake vor der Erbauung des Teltowkanals eine schiffbare Verbindung nicht bestand. Das dem Kreise verliehene Treidelmonopol, welches, wie an anderer Stelle erörtert, die Einrichtung eines geregelten Schleppbetriebes zwischen Glienicker Lake
eventl. schon von der Glienicker Brücke an — bis zum oberen Ende des Griebnitzsees bedingt, legte es nun nahe, die auf dem Griebnitzsee bestehende Schiffahrtslinie zu erwerben; dies zwar umsomehr, als die bei Glienicke-Neu Babelsberg bisher unterbrochene Verbindung nunmehr direktnach Potsdam und in die übrigen Havelseen fortgeführt werden konnte. Die
*gleichzeitige Herstellung des Prinz Eriedrich Leopold-Kanals liess ferner eine Ausdehnung des Personenschiffahrtsverkehrs in der Richtung nach Wannsee und Beelitzhof mit weiterer Rundfahrt an der Pfaueninsel vorbei in der Richtung nach Potsdam und Nedlitz angezeigt erscheinen. Auch die Erschliessung des unteren Beketals von Neu Babelsberg über Kohlhasenbrück bis zur Klein Machnower Schleuse für den Personenverkehr erschien um so wünschenswerter, als Eisenbahn- und Strassenbahnverbindungen innerhalb dieser Strecke nicht bestehen. Durch die kreisseitig veranlasste gleichzeitige Fortführung der Dampfstrassenbahnlinie Lichterfelde (Ost)-Stahnsdorf bis zur Schleuse ist
73
nunmehr eine durchgehende Verbindung von Potsdam über Klein Machnow, Stahnsdorf, Teltow nach Gross Lichterfelde erreicht worden.
Auf diese Weise hat sich das Kreisunternehmen des Teltowkanals zugleich zu einem Schiffahrtsbetriebsunternehmen erweitert, dessen Zweckmässigkeit in Kreisen des Publikums durch eifrige Benutzung der Verkehrsmittel bereits vielseitig Anerkennung gefunden hat. Zur Zeit umfasst der Schiffspark der Personenschiffahrt 3 offene Einschraubendampfer, welche von der Terrain-Gesellschaft Neu Babelsberg übernommen wurden, ferner 1 neu beschafften Einschraubendampfer, 2 Doppelschraubendampfer und 4 grössere Benzin-Motorboote, mit einem gesamten Eassungsvermögen von 1300 Personen und insgesamt rund 330 PS.
Eine weitere Vermehrung der Betriebsmittel ist in Aussicht genommen, nachdem — zumal seit der in diesem Sommer erfolgten Eröffnung des Prinz Eriedrich Leopold-Kanals und der Aufschliessung des unteren Beketales — es sich gezeigt hat, dass nicht minder der regelmässige Tages- wie der Ausflugsverkehr eine ausgiebige Benutzung der Kreisboote in Aussicht stellt. Inwieweit auch die obere Kanalhaltung für den Personenschiffahrtsverkehr künftig aufgeschlossen werden soll, unterliegt noch näheren Erwägungen. Jedenfalls dürfte innerhalb gewisser Strecken des Kanals sich die Einrichtung eines derartigen Verkehrs gleichfalls empfehlen. Vorbedingung hierbei wäre allerdings, dass die innerhalb des Kanals verkehrenden Fahrzeuge nur von kleineren Abmessungen sind und mit keiner zu grossen Geschwindigkeit verkehren, damit Beschädigungen der Uferbefestigungen und der Sohle ausgeschlossen bleiben, dass ferner die Fahrzeuge, wie dies auch bei den übrigen Fahrzeugen des Kreises der Fall ist, eine absolut rauchlose Feuerung besitzen, entweder also mit Benzinmotoren oder Ölgasfeuerung ausgestattet werden.
b) Der Baggerbetriebspark des Kreises.
Im grösseren Umfange, wie dies wohl sonst bei Kanalbauten, deren einzelne Arbeitslose in Generalentreprise vergeben werden, der Fall ist, sind seitens der Teltowkanal-Bauverwaltung schon während des Baus Bagger nebst dem erforderlichen Zubehör an Schuten, Schleppern etc. beschafft worden. Vornehmlich Anlass gab hierzu der Umstand, dass die Ausbaggerungen innerhalb der Seenstrecken, bei den stark wechselnden Untiefen und der schlammigen Beschaffenheit des Untergrundes, sich profilmässig vor Arbeitsbeginn nicht bestimmen Hessen, sowie die Erwägung, dass auch
74
künftig nach Eröffnung des Kanals, innerhalb gedachter Seestrecken unter Umständen mit einer dauernden Vertiefung und Erweiterung der Schiffahrtsrinne zu rechnen sein dürfte. Weiter war vorauszusehen, dass in Zukunft, ausser den bereits in grossem Umfange hergestellten Profilerweiterungen im
Kanallauf selbst, dem Fortschritt der Ansiedelung der Industrie folgend, noch mehrfach Erweiterungen zu erwarten sein werden, deren Ausführung alsdann zweckmässig in der Hand des Kreises selbst verbleibt. Bei dem grossen Betriebspersonal, das künftig in dem Kanalunternehmen tätig sein wird, werden sich bei geschickter Dis
position die Arbeiten und Arbeitskräfte leicht so verteilen lassen, dass erstere verhältnismässig billig ausgeführt werden können, während für ein eingeschultes, ständiges Arbeiter- und Beamtenpersonal auch zu Zeiten geringeren Schiffahrtsverkehrs zugleich eine passende und genügende Arbeitsgelegenheit verbleibt. Die bisher von der Teltowkanal-Bauverwaltung in Selbstbetrieb ausgeführten Baggerarbeiten sind zu verhältnismässig niedrigen Preisen ausgeführt worden, und haben sich die bisherigen Anschaffungen demgemäss auch als zweckmässig und ökonomisch erwiesen. Es wurden beschafft: zwei Eimerbagger mit einer Stundenleistung von je 50-60 cbm und einer Maschinenstärke von je 30 PS. Die Bagger sind mit Dampfdynamo und elektrischer Beleuchtung ausgestattet.Hierzu ferner 1 Schutenentleerer mit einer Stundenleistung von 50-60 cbm und einer Maschine mit 20 PS, 1 Schutensauger mit einer Stundenleistung von 30-60 cbm (je nach der Bodenbeschaffenheit) und einer Lokomobile von 80 PS nebst der dazugehörigen, durch eine besondere Dampfmaschine
n*■
r
1 H
e-v*MS£
Schutenentleerer.
-^rl
4 W,.v L* j£F
M -
Schutensauger.
75
angetriebenen Schlamm- und Zentrifugalzusatzwasserpumpe. Zu vorstehendem Baggeraggregat wurden ferner beschafft: 15 grössere Holz- bezw. Eisen-Prähme.
1
ji»n,
f l LTÜWT jrnrT** * - ' 1-Ä.PF
Ub-:-Nassbagger.
c) Der Bauhof.
Im unmittelbaren Zusammenhang mit dem elektrischen Kraftwerk wird für die Betriebs- und Unterhaltungszwecke des Kanals ein Bauhof errichtet. Auf demselben sollen zunächst die laufenden Ausbesserungen der eigenen Betriebsmittel des Kreises Teltow, dann aber auch, da Privatwerften am Kanal noch nicht bestehen, Ausbesserungen etwaiger im Kanal Havarie erleidender fremder Schiffe vorgenommen werden.
Die Einfahrt zum Bauhof erfolgt durch einen in der Sohle 10 m breiten, durch einen Leinpfadsteg überbrückten Stichkanal, der am unteren Ende zu einem Hafenbassin von 65 m Länge und 25 m Breite in der Sohle ausgebaut ist. An dieses Hafenbassin schliessen sich seitlich die Querslips an, von denen vorläufig drei eingerichtet werden, während der Platz für zwei weitere vorgesehen ist, so zwar, dass nach vollständigem Ausbau im Notfälle die grössten Kanalkähne von 65 m Länge aufgeschleppt werden können. Die Slips werden durch achträdrige Aufzugswagen, die auf einem Gleis von 5 m Spur laufen und einzeln oder gemeinsam durch eine elektrische Winde angetrieben werden, bedient. Das zweistöckige Hauptwerkstattgebäude, welches eine Länge von 50 m und eine mittlere Breite von 20 m besitzt, enthält im Erdgeschoss 8 Stände mit Revisionsgruben für die elektrischen Treidellokomotiven, eine Schmiede, Dreherei und Schlosserei, sowie eine Holzbearbeitungswerkstatt. Das obere Stockwerk ist zur Lagerung von Schiffsinventar und leichteren Vorratsstücken bestimmt.
76
\\\
\
\
\ i\ /Zofen bassin\
:\"I \r •** ntt\ & \ v\ \ '\ \ \
s\ \ V '•gl \ \ 'm'"$\ m \
\V \rc\ ■'
u ii£W-.riyu>- ’: 'rp«V ,«L U?\ I\ mgV i (T'l .
■
§V\•* i. t i
KoKLenhof\ V,<v£ O\\\;\ \ \
\ \
\h -rvoUrung
'S\ 2_t
Z/u/3sUü> J-72600
Z___T l-T"7_x.
Lageplan.
0
33
Reserviertüu-su.t fthhnuny&i j ^Air
oo
o
o ooo_°L___O__
c
0c
G
ccccL
Ct
ü
Q
frC
t
00
«D
haus, in dessen unterem Geschoss zugleich ein Aufenthaltsraum für die Arbeiter vorgesehen ist. An Nebenbauten sind noch Schiffsschuppen für die Vornahme von Bootsanstrichen, Eisen-, Holz- und sonstige Materiallagerung vorhanden. Die Anlage des Hafenbassins und der Slips ist so gross bemessen, dass nahezu sämtliche Betriebsmittel des Kanals im Winter dort untergebracht werden können.
77
Die Wohnung des Bauhofsverwalters befindet sich in einem unmittelbar am Kanal errichteten zweistöckigen Gebäude, dessen unteres Stockwerk die Bureauräume enthält. Am Zugang zum Bauhof befindet sich das Pförtner-
ifape
g**'
uuxL
uyvu
o^
s*w//5
'
I2026
461793
110424242550
19011902I9°319041905
ARBEITERVERHÄLTNISSE UND WOHLFAHRTS
EINRICHTUNGEN.
ei der unmittelbaren Nähe der Reichshauptstadt Berlin ge- i staltete sich die Arbeiterfrage für den Teltowkanal zu einer
besonders schwierigen. Derartige Menschenansammlungen — die Höchstziffer der beschäftigten Arbeiter betrug annähernd 3000 — können für die Großstadt mannigfache Gefahren in sanitärer, politischer und polizeilicher Hinsicht mit sich bringen.
Es war den Unternehmern zur Pflicht gemacht, wenn möglich nur einheimische Arbeiter zu beschäftigen und die Kreiseingesessenen in erster Linie zu berücksichtigen.
Als Erdarbeiter, namentlich in nassem Gelände, versagten die Einheimischen jedoch vollständig. Ebenso missglückte der Versuch, sogenannte Arbeitslose aus Berlin einzustellen.
Durchschnittlich wurden während der Bauzeit beschäftigt:
RussenPolen
Gesamt- SonstigeAusländerItaliener KroatenJahr Deutsche Galizierzahl
(N
NO "-1 -L“G
\
On
"T-
t"'» O
X
}- (N
00 ^(N
(N (N
A
On
NO NO 4 NO1“
OCN
o
G\
u-nrrv
On
O CN
' rr\
00^4
GN
to
to
GN
^ GN
00—
] 00
Wie diese Zusammenstellung zeigt, war eine grössere Menge Ausländer bei den Kanalarbeiten notwendig. Für die Bauverwaltung'bedeutete dies eine Erschwernis, weil die ausländischen Polen nur vom i. März bis 20. Dezember beschäftigt werden dürfen und die unumgängliche Kontrolle der ausländischen Arbeiter überhaupt eine schwierige ist. Vorwiegend und abgesehen von einer Minderzahl von Italienern, welche als Maurer, Steinmetze, Steinsetzer und Zimmerleute beschäftigt wurden, waren die Ausländer Erdarbeiter.
Die Überwachung der Arbeiter war, den besonderen Verhältnissen Rechnung tragend, wie folgt geregelt.
Der Kanalbau war in bestimmt abgegrenzte Teile zerlegt und in diesen Abgrenzungen dazu besonders berufenen Gendarmen zur Beaufsichtigung zugeteilt. Jeder eintretende Arbeiter erhielt ein Arbeitsbuch — entsprechend der Allerhöchsten Verordnung vom 21. Dezember 1846 — mit welchem er sich bei dem Gendarm seiner Strecke zu melden hatte. Dieser prüfte die Papiere des Arbeiters und besorgte die Meldekontrolle. In dieser Beziehung trat der Gendarm an die Stelle der Orts- beziehungsweise Ortspolizeibehörden, behufs gesicherter Durchführung der Kontrolle und Entlastung dieser Behörden. Ausserdem hatte der Gendarm die durch Untersuchung seitens der vom Unternehmer angestellten Streckenärzte festgestellte Brauchbarkeit des Arbeiters zu bescheinigen.
Diese Streckenärzte, welche zweimal wöchentlich ihre Strecke revidierten, fungierten gleichzeitig als Kassenärzte der mit regierungsseitiger Zustimmung von den Unternehmerfirmen für ihre Arbeiter eingerichteten Betriebskrankenkassen. Die Betriebskrankenkassen hatten ihrerseits mit denden einzelnen Baustrecken zunächst gelegenen Krankenhäusern Vereinbarungen über die Aufnahme Schwerverletzter resp. Schwerkranker getroffen, so dass also für schnelle ärztliche Hilfe und eingehende ärztliche Kontrolle gesorgt war.
Besonders günstig war in dieser Beziehung die nahe Lage der beiden vortrefflich eingerichteten Kreiskrankenhäuser zu Gross Lichterfelde und Britz.
Epidemien sind trotz der Ungunst der Witterung und der sumptigen Beschaffenheit grosser Strecken des Baugeländes nicht aufgetreten. Vielmehr war der Krankenbestand ein äusserst geringer. Ein eingeschleppter Typhusfall wurde isoliert und blieb vereinzelt.
Schwere Verletzungen sind während der Bauzeit verhältnismässig wenige vorgekommen. Mit tödlichem Ausgange sind nur sieben zu ver
79
zeichnen. Ausserdem ist beim Baggerbetriebe ein Mann über Bord getanen und ertrunken.
Wohnung und Unterkunft suchte der Arbeiter mit Vorliebe in Privatquartieren, selbst auf die Gefahr eines längeren Anmarsches zur Arbeitsstelle. Eine auf Veranlassung der Teltowkanal-Bauverwaltung von dem Unternehmer Ph. Holzmann & Co. errichtete Schlafbaracke stand anfänglich längere Zeit gänzlich leer und wurde schliesslich entfernt. Erst mit der wachsenden Arbeiterzahl im zweiten und dritten Baujahre wurden die Baracken von ausländischen Arbeitern, Kroaten, Galiziern und Polen in Benutzung genommen; sie wurden je nach Bedarf an verschiedenen Stellen der Baustrecken errichtet. In mehreren Fällen konnten vorhandene Häuser
für die Unterkunft der Arbeiter benutzt werden.
Lediglich das Bedürfnis musste darüber entscheiden, ob Schlafbaracken in Ver- bindung mit einem
Kantinenbetriebe oder ohne solchen eingerichtet wurden, oder ob lediglich eine Kantine ohne Schlaf
gelegenheit am Platze war. Selbstverständlich stand jeder Baracken- und Kantinenbetrieb unter der Aufsicht der Teltowkanal-Bauverwaltung, welche mit den Wirten die unbedingte Befolgung aller zu erlassenden Vorschriften vertraglich geregelt und sich das Recht Vorbehalten hatte, durch Ordnungsstrafen ev. durch sofortige Schliessung der Baracke oder Kantine ihren Willen zu erzwingen. Bei den ständigen Revisionen fungierten die Streckengendarmen als Organe der Teltowkanal-Bauverwaltung. Besonderer Wert wurde auf auskömmliche Waschgelegenheit und Öfen zum Trocknen durchnässter Kleidungsstücke gelegt, während zugleich in den ausreichend bemessenen Speiseräumen für einen behaglichen Aufenthalt der Arbeiter nach Eeierabend Sorge getragen wurde.
Die Beköstigung der Arbeiter erfolgte teils aus den Kantinen zu vorgeschriebenen Preisen, während andere, so insbesondere Italiener, Kroaten und
Kroaten — Mittagsrast.
8o
III\
'■1I
I
r
1
■
ITk
' ■ ■ ‘_ZJ
b
:-:XK
vt/ ■.-,. tlBrlfnr
1
l • ■
r_■ T
!§b!§§IUI;•■:
; *yai','■ •*<.Mg
1 *,A ’ , 7 M
..1*
Pif^s
1
':l
lilt»
R 7tS§§E ;,|T '-'z!# '
,/i.
■
iäüi t*:wj,: f
IÄIS
,1.-\\ V -
fei,W!
'»‘«•1,1
.VW'
if,.
‘'iliiiV';' '
ää ■ -1
lltÄ
iii %
■!
I ;-i
Jt.
u;i,i|,|'|Ä LI
mm■«i* i>\ f |iisi
M
ij (11Mti
[
p ki
w 1
!|i I J.’lirv/
j>,3
,
.i
:3
Sr
Tj
l'Ü
Njn-
m&[HaA
-5$
Rh
m
■ ■m
v.i»V*
IE
m ■■■■■,
m *»i
1 {*• •■■
%i
iit
H&
Ii
k1.Hym
Her
man
n Rüc
kwar
dt,B
erlin
-6 r.
-Lic
hter
fel d
e, p
hot.u
he!
--
^ ’!T"
*c. f
imrn
.M
-i.
teä
Hp
HP
-1
m1
'1*
¥J
7X
?£V \
\\A
rr j
&
ii
A / fc
-
% ^
■7X#
A7
/
A
f//■v
V\
.2
TELT
OW
KA
NA
L
SPÄ
TH S
TRA
SSEN
BRÜ
CKE
BRIT
Z .
Eine bestimmte Anzahl Teil-Galizier die Selbstbeköstigung bevorzugten, nehmer wählte einen Koch, welchem der Tagesverdienst erstattet wurde.Der Koch kaufte unter Beihilfe der Unternehmung ein und bereitete die Mahlzeiten: morgens Milchkaffee, mittags Fleisch mit Kartoffeln, Gemüsen oder Hülsenfrüchten — wobei auf drei bis vier Mann ein Pfund Fleischgerechnet wurde — nachmittags Kaffee, abends eine dicke Suppe.
Der Preis vorgedachter Mahlzeiten, einschliesslich des Kaffees, indessen ohne Brot, das die Arbeiter meist selbst einkauften, stellte sich pro Tag auf etwa 40 Pf.
Trotz der grossen Anzahl der Arbeiter sind weder Revolten noch Streitereien in grösserem Maßstabe vorgekommen. Auch sozialdemokratische Agitatoren aus Berlin vermochten Unfrieden nicht zu erregen.
Die Befürchtung der Landbevölkerung, dass seitens der Kanalarbeiter in den umliegenden Ortschaften Diebereien an der Tagesordnung sein würden, hat sich nicht bewahrheitet.Untereinander jedoch haben die Landsleute sich mehrfach bestohlen. Es war daher der Vorschlag mit Freuden zu begrüssen, dass die Kreissparkasse günstig zu den Arbeitsstrecken gelegene Annahmestellen errichtete, bei welchen die Arbeiter zu ihrer eigenen Sicherheit ihre Ersparnisse zinstragend anlegen konnten. Von dieser Einrichtung wurde jedoch kaum Gebrauch gemacht, trotz des Einwirkens der Streckengendarmen, denen es fast ausnahmslos gelungen war, sich das Vertrauen der Arbeiter zu erwerben. Die Mehrzahl zog es vielmehr vor, die Ersparnisse ihrer Löhnung — und diese betrugen bei der Sparsamkeit und Nüchternheit der Ausländer reichlich drei Viertel des jeweiligen Verdienstes — bis zu ihrer Rückkehr in die Heimat zum Teil in beträchtlichen Summen im Brustbeutel bei sich zu behalten.
Der Stundenlohn eines gewöhnlichen Erdarbeiters betrug im Durchschnitt 38 Pf., sodass bei einer durchschnittlich täglichen Arbeitszeit von
Kroaten — Feldküche.
81
FRISCH
b &
■ m
mjtä
«
Ez\
W'
4|IS| .
lll.
SL
welche sich im Sommer und bei dringlichen Arbeiten, aufsich
io StundenGrund freiwilligen Angebotes der Arbeiter, zeitweise noch steigerte der Wochenverdienst bis auf 26 Mark belief.
Der Stundenlohn, sowie auch die Arbeitszeit der Handwerker Maurer, Zimmerleute und Steinmetze — entsprach im allgemeinen den in Berlin und dessen Vororten üblichen Sätzen.
Die in landwirtschaftlichen und zum Teil auch in industriellen und Baukreisen anfänglich gehegte Befürchtung, es könnten diesen durch das grosse Bedürfnis von Arbeitskräften beim Bau des Teltowkanals wirtschaftliche Nachteile,Entziehung der Arbeitskräfte selbst, unzutreffend erwiesen.
Die Sonntagsruhe ist streng durchgeführt worden; darüber hinaus haben die ausländischen, meist katholischen Arbeiter auch an den sonstigen kirchlichen Eesttagen ausnahmslos gefeiert, sodass es mitunter schwer hielt, auch nur die notwendigsten zur Sicherheit des Betriebes erforderlichen Arbeiten an solchen Tagen aufrecht zu erhalten.
Der Seelsorge ist sowohl seitens der Kanalverwaltung, wie seitens der Kirchenbehörden die nötige Fürsorge gewidmet worden. Während für die evangelischen Arbeiter in den dem Kanal benachbarten Orten sich reichlich Gelegenheit zum Besuch des Gottesdienstes bot, waren für die katholischen Arbeiter durch die erzbischöfliche Delegatur von St. Hedwig in Berlin besondere Veranstaltungen zur Befriedigung der kirchlichen Bedürfnisse, namentlich auch der nicht deutsch redenden Ausländer, auf Veranlassung und unter materieller Unterstützung der Bauverwaltung getroffen worden.
sei es durch Steigerung der Löhne, sei es durch dieerwachsen, hat sich ebenfalls als
82
AN LAGE KOSTEN.
Kosten des Kanals waren nach dem Voranschläge für die Hauptlinie und die Verbindungslinie Britz-Kanne zu insgesamt
il|Py| 25’25 Millionen Mark ermittelt worden. Darin waren der
Grunderwerb mit 3,6 Millionen enthalten, 10,5 Millionen für Erdarbeiten ausgeworfen, während der Rest auf die Bauwerke, Uferbefestigungen u. s. w. entfiel. Der Grunderwerb wird nicht unerheblich überschritten werden. Dies liegt zum Teil daran, dass der Preis des Geländes im Laufe der letzten Jahre ganz ungewöhnlich gestiegen ist, während andererseits eine grosse Anzahl von zum Teil recht beträchtlichen Trennstücken erworben werden musste, die allerdings später wieder dem Grunderwerbskonto zugute kommen. Diese Überschreitung der für den Grunderwerb ausgeworfenen Summe konnte auch dadurch nicht verhindert werden, dass auf viele Kilometer Streckenlänge der Grunderwerb unentgeltlich war. Es haben sich nämlich längs des Kanals Terraingesellschaften gebildet, welche den Grund und Boden unentgeltlich hergeben, gegen die Berechtigung, auf eigene Kosten sich Erweiterungen des Kanals zu Lösch- und Ladezwecken bezw. auch eigene Stichhäfen hersteilen zu dürfen. Ein Teil dieser Erweiterungen gelangte, wie an anderer Stelle erwähnt, bereits bei der Herstellung des ersten Kanalprofils zur Ausführung.
Der eigentliche Bauanschlag, also die Titel: Bauwerke, Erdarbeiten, Uferbefestigungen sind durch behördliche Mehrforderungen, durch landespolizeiliche Auflagen, durch Zugeständnisse, welche an Interessenten und Gemeinden insbesondere bezüglich der Brückenbreiten und Erweiterung der Hafenanlagen gemacht worden sind, und sonstige zusätzliche Mehraufwendungen, gleichfalls nicht unwesentlich erhöht worden.
Weiter ist durch die Einrichtung der elektrischen Treidelei und die hiermit in unmittelbarem Zusammenhang stehende Anlage eines elektrischen Kraftwerks, ferner die vom Kreise eingerichteten Nebenbetriebe, wie bspw. die Personenschiffahrt auf der unteren Kanalhaltung, dem Prinz Friedrich Leopold-Kanal und den anschliessenden Havelgewässern, sowie die Erbauung einer grösseren Speicheranlage am Tempelhofer Hafen, in Verbindung mit einer von der Steuerbehörde bereits genehmigten Steuerabfertigung und zollfreien
83
Niederlage, das Kanalunternehmen auch sonst über seinen ursprünglichen Rahmen hinaus wesentlich gewachsen.
Die Aufgaben des Kreises bezüglich der Ausgestaltung des Kanalunternehmens dürften hiermit noch nicht erschöpft sein; insbesondere schweben zur Zeit Erwägungen über die Herstellung von Gütereisenbahnanschlüssen an verschiedene Stellen des Kanals mit den dazu gehörigen Umschlagvorrichtungen.
Es werden auf diese Weise Mehrausgaben entstehen, deren Schlusssumme sich zur Zeit noch nicht übersehen lässt, die aber dem Kanalunternehmen und dessen späterem Betriebe wesentlich zugute kommen und von denen zugleich ein Teil als selbständig werbende, dem Kreise dauernd verbleibende Kapitalanlagen bezeichnet werden können.
Nach einem vorläufigen Überschläge werden sich die Ausführungskosten ungefähr wie folgt stellen:
a) für den Teltowkanal Klein Glienicke-Grünau, einschliesslich des Verbindungskanals Britz-Kanne rd. 39000000 M., die sich wie folgt verteilen:
auf Grunderwerb ....,, Erdarbeiten.............,, Uferbefestigungen . .,, Bauwerke................,, Häfen......................,, Bauzinsen................,, Betriebseinrichtungen ,, Bauleitung, Verwaltung und Ins
gemein ....................................
rd. 8850000 M. . . 12550 000 ,,. . 1 470 000 ,,rd. 9000000 ,,. . 790000 „•. . 3 300000 ,,. . 970000 ,,
2070000 ,,
Zusammen. . . . 39000000 M. b) für den Erwerb von Restgrundstücken 2363 000 M.
die elektrische Treidelei................) „ das elektrische Kraftwerk, Unter
station ...........................e) ,, die Speicheranlage und zollfreie
Niederlage in Tempelhof . . 1die Personenschiffahrt....................
2 518 000 ,,
1 272 000 ,,
580000 ,, 432000 »
g) „ den Prinz Eriedrich Leopold-Kanal 650000 ,,0 „
Zusammen. . . . 8815000 M.
84
Q- O
VERKEHRSAUSSICHTEN UND TARIFE.
<jßS!j5jE^ücksichtlich des auf dem Kanal zu erwartenden Verkehrs ist in den allgemeinen Vorarbeiten mit einem Anfangsverkehr von r<^’ ^ gerechnet, von denen 400000 t auf den Orts-verkehr und der Rest auf den Durchgangsverkehr zur Oder
und Oberspree entfallen. Die Ziffer von 400000 t für den Lokalverkehr wird voraussichtlich bereits in den ersten Jahren nicht unerheblich überschritten werden, sodass mit einem Verkehr von 2 Mill. t mit ziemlicher Sicherheit in Bälde gerechnet werden darf. Die Abgabenfrage ist noch nicht endgültig erledigt. Die Sätze müssen sich in einer Höhe bewegen, welche eine angemessene Verzinsung und Unterhaltung des Kanals ermöglichen; sie waren von Hause aus einschliesslich der Schleusengebühr angenommen für die Durchgangsschiffahrt zu im Mittel 20 Pf. für 1 t und für den Lokalverkehr auf 60 Pf. für 1 t. Innerhalb von Berlin werden bei einer Durchfahrt für zwei Schleusenhebestellen nach dem neuen Tarife für die märkischen Wasserstrassen je nach der Warenklasse 10 bis 22 Pf., im Mittel 16 Pf. zu zahlen sein. Dazu dürfte als Aufschlag jedenfalls gerechnet werden die Wegersparnis für den Durchgangsverkehr nach der oberen Oder bezw. der Oberspree mit 12 bis 15 Pf. Letztere Sätze stellen die reinen Beförderungskosten für eine Wegersparnis von 16 bezw. 13,5 km dar, welche sich bei einer Benutzung des Teltowkanals gegenüber der Fahrt durch Berlin ergeben.
Hiernach würde der Durchgangstarif gegen die frühere Annahme — auch ohne Rücksicht auf die in sonstiger Beziehung der Schiffahrt gebotenen Erleichterungen
Was die für den Lokalverkehr zu erhebenden Sätze anlangt, so bestimmen sich diese aus Rücksichten des Wettbewerbs mit den übrigen
eine wesentliche Aufhöhung vertragen.
85
n
\\\>
\mAW
S
mm
yj$
J/L
’ / !&i'A
wn
:/
1
für den Ortsverkehr in Betracht kommenden Verkehrs- und Zufuhrwegen einerseits und solchen auf die Ansiedelung einer leistungsfähigen Industrie andererseits. Es ist ermittelt, dass bei einer Erhebung von 60 Pf. für i t der Bezug von Kohle, Baumaterial usw. für den Ortsverbrauch sich zum Teil nicht unwesentlich gegen den jetzigen Zustand verbilligt.
Im Interesse der Industrien werden für Güter, namentlich auch Rohmaterial, das in verarbeitetem Zustande wieder exportiert werden soll, unter Umständen besondere Erleichterungen zu gewähren sein.
Bezüglich der Treidelgebühren sind folgende Sätze in Aussicht genommen: Eür Durchgangsverkehr von der Glienicker Lake bis zur Kanalmündung bei Grünau bezw. der Kanne pro Tonne Nutzlast 15 Pf., im Ortsverkehr pro tkm 0,5 Pf.
Die endgültige Feststellung der Tarife, deren Genehmigung den Staatsbehörden untersteht, wird auch davon noch abhängig zu machen sein, ob die Treidelgebühr getrennt oder gemeinschaftlich mit der Kanalabgabe erhoben wird. Hierüber sind die Erwägungen zurzeit noch im Gange.
Wann eine Rentabilität des Kanals zu erwarten steht, kann natürlich nicht vorausgesagt werden. Bei einem Anfangsverkehr von 1,5 bis 2 Mill. t wird der Kreis noch Zubussen zu leisten haben. Bei einem Verkehr von 3 bis 4 Mill. t wird ungefähr die Grenze liegen, woselbst das Anlagekapital eine angemessene Verzinsung erfährt.
86
Der Kanal wird aus alleinigen Mitteln des Kreises gebaut; dieser, mit seinem Landrat an der Spitze, hat eine aus
^g! dem Kreisausschuss und sieben Kreis- ' tagsmitgliedern bestehende Kanal
kommission gebildet. Die geschäftsführende Behörde, welche den Kanal
Ki zu erbauen und betriebsfähig zu machen hat und welcher der Verkehr
8| mit den Behörden, insbesondere auch das Grunderwerbsgeschäft, die Feststellung der Entwürfe, der Ab
schluss und die Abwickelung der Verträge mit den Unternehmern usw. obliegt, ist die «Teltowkanal-Bauverwaltung». Sie besteht aus zwei Technikern und einem Juristen, sowie einigen technischen und juristischen Hilfsarbeitern nebst einem bescheidenen Schreib- und Registraturapparat. Die Entwurfsbearbeitung, sowie die Bauleitung und Abrechnung, einschliesslich der Stellung des gesamten Aufsichtspersonals, sind der Ingenieurfirma Havestadt & Contag übertragen. Die Bauverwaltung hat ihre Geschäftsräume im Geschäftsgebäude -der Eirma Havestadt & Contag in Wilmersdorf. Hierdurch, sowie durch den Umstand, dass der Vorsitzende der Teltowkanal-Bauverwaltung zugleich Mitinhaber der bauleitenden Ingenieurfirma ist, wurde dauernd ein unmittelbarer persönlicher Verkehr zwischen der Teltowkanal-Bauverwaltung und der Bauleitung ermöglicht.
In gewöhnlich allmonatlichen gemeinschaftlichen, im Kreishause stattfindenden Sitzungen der Kanalkommission, der Bauverwaltung und der Bauleitung wurden die Entwürfe, die Grunderwerbs-, die Lieferungs- und Arbeits-
!UM ;
3ImÜMI Il&ff IS_-;*CJ5r'
j.
E *
-W:.,
Teltower Kreishaus Berlin W., Viktoriastrasse 18.
87
ORGANISATION DER AUSFÜHRUNG,
BAUVERWALTUNG UND BAULEITUNG.
m
vertrage beraten und endgültig festgestellt. Auch der Verkehr mit den Behörden hat sich erfreulicherweise grösstenteils zu einem mündlichen gestaltet. Die Kommissare der Potsdamer Regierung und ein höherer Techniker des Arbeitsministeriums nahmen an den vorgedachten gemeinschaftlichen Sitzungen regelmässig teil. So wurde kurzerhand mündlich das meiste erledigt und der schriftliche Verkehr — wenigstens in technischen Angelegenheiten — auf das allernotwendigste beschränkt.
Die Ausschreibung der Erd-, Maurer- usw. Arbeiten ist losweise grösserenteils in öffentlicher Submission erfolgt. Die eisernen Brückenbauten sind zunächst in öffentlicher, später in engerer Submission vergeben worden. Die Baggerungen im Griebnitz- und Machnowsee wurden im Selbstbetrieb der Bauverwaltung mit eigenen Baggern ausgeführt.
Nach Fertigstellung des Kanals wird der Betrieb einem höheren Techniker — dem Kanaldirektor — unterstellt werden, welcher in Gemein- schaftmit einigenHilfsarbeitern unter Aufsicht des Kreisausschusses bezw. einer von dem Kreistage zu wählenden Kommission nach Maßgabe der noch zu erlassenden behördlichen Vorschriften die ferneren Geschäfte der Kanalverwaltung leiten wird.
.
y4 7 VV /SEILS E
5T3
Geschäftsräume der Teltowkanal-Bauverwaltung und -Bauleitung (Havestadt & Contag, Kgl. Bauräte), Wilmersdorf, Berlinerstrasse 157.
f iM
m . •v '\r 4W?1
v/£ W
88
k®
* $ jm
, I
m-Ifl «;W
■
r,l1
m \"
i PT$ V*—f]
>
m, v.
K
$
^ üb:
• s
5 -
? i“:••
|
W, AV
ins§== V-
lt■' i
A°#l&
«p*. JWf;•^1 ?£:V/!
Er'’,..$ rj$f
■•:4a #' *4; fv &vä
v
*s? **£’•'' ,&
tlFlJföi
IMIflü
ilH
»Mid.
pp
L
• <m
-
mۊ
HN
>MÜ
L
Her
man
n Rüc
kwar
dt, B
erlin
, Gr.-
Lich
terfe
lde,
phot
.u.h
el.
SfG
Aiä
£fi&
s£ s
Y ’:. J'-m
*
K i ;jf.m
ia
sw
*.
räf
5t*
Sä
* di
m
PRIN
Z FR
IED
RIC
H LEO
POLD
KAN
AL
W A
N N
S E E
•K
AN
ALM
UN
DU
NG
Anlage /.
GENEHMIGUNG.
Kreise Teltow wird mit Zustimmung des Herrn Ministers ^er öffentlichen Arbeiten die landespolizeiliche Genehmigung
illlSlj zum ^au e*nes Schiffahrtskanals von der Glienicker Lake bei wr Potsdam nach der wendischen Spree bei Grünau mit einerAbzweigung nach der Treptower Spree beim Baumschulenweg nach den vorgelegten, von den Bauräten Havestadt & Contag aufgestellten allgemeinen Entwürfen vom 15. April 1898 unter folgenden Bedingungen erteilt:
1. Der Bau, der Betrieb und die Unterhaltung des Kanals geschieht auf Kosten des Kreises unter der Aufsicht des Regierungspräsidenten.
2. Mit dem Bau darf erst vorgegangen werden, nachdem die auf Grund besonderer Vermessung auszuarbeitenden Lage- und Höhenpläne, sowie die Entwürfe für die grösseren Kanalbauwerke, Schleusen, Wehre, Brücken, Eisenbahnübergänge und für die Lösch- und Ladeplätze usw. nach besonderer Anordnung des Regierungspräsidenten einzeln ihm vorgelegt und landespolizeilich genehmigt worden sind.
Alle wesentlichen Abweichungen von den genehmigten Plänen, sowie etwa später auszuführende wesentliche Veränderungen am Kanäle bedürfen der besonderen Genehmigung des Regierungspräsidenten.
3. Alle bei der Prüfung, während des Baues und in Zukunft nach Fertigstellung des Kanals im öffentlichen Interesse von der Landespolizeibehörde für erforderlich erachteten Veränderungen, Verbesserungen und Erweiterungen der Kanalanlage in Bezug auf Bau oder Betrieb sind von dem Kreise auf eigene Kosten zur Ausführung zu bringen.
89
Besonders behält sich die Aufsichtsbehörde vor, bei der landespolizeilichen Prüfung der Sonderentwürfe zu entscheiden, ob der Kreis noch andere Brücken- und Hafenanlagen (Lösch- und Ladeplätze) herzustellen hat, als im vorliegenden Entwürfe vorgesehen sind, und ob einzelne dieser Anlagen unausgeführt bleiben sollen.
4. Für die Speisung der oberen Haltung des Kanals aus der Havel ist bei der Schleuse ein Pumpwerk mit einer dem grössten Wasserbedarf entsprechenden Leistungsfähigkeit zu erbauen und nach besonderer Anweisung des Regierungspräsidenten zu betreiben. Das gleiche gilt hinsichtlich der Benutzung der Freiarche zur Spülung und zur Ablassung von Hochwasser.
5. Alle Schäden, welche etwa durch den Bau oder den Betrieb des Kanals Dritten erwachsen, sind vom Kreise zu beseitigen oder zu ersetzen. Die Genehmigung wird erteilt unbeschadet aller Rechte Dritter, gegen welche der Unternehmer sein Unternehmen lediglich selbst zu vertreten hat.
6. Der Kanal wird nach Fertigstellung dem öffentlichen Verkehr nach Maßgabe der noch zu bestimmenden Tarife freigegeben. Der Kanal wird in gleicher Weise wie die bestehenden öffentlichen Wasserstrassen, insbesondere auch hinsichtlich der Einleitung von Abwässern, der Aufsicht der staatlichen Strom- und Schiffahrtspolizeibehörden unterstellt. Die unteren Strompolizeibeamten — Kanalaufseher werden vom Kreise angestellt und besoldet. Die Genehmigung von Uferanlagen oder anderen Wasserbauten soll aber Dritten nicht ohne Zustimmung des Landrats erteilt werden.
7. Der Kreis beabsichtigt, die Herstellungskosten für den Kanal durch eine Anleihe aufzubringen. Wenn diese nach den hierfür zu erlassenden Vorschriften vollständig getilgt ist, steht es dem Staate jederzeit frei, den Kanal mit allem Zubehör ohne Entschädigung in das Eigentum zu übernehmen.
Wenn der Staat von diesem Rechte keinen Gebrauch macht, so verbleibt dem Kreise die Unterhaltungspflicht.
8. Der Staat behält sich das Recht vor, vom zehnten Jahre nach der Betriebseröffnung der Kanalschleusen an, jederzeit den Kanal mit allem Zubehör gegen Ersatz von 60 vom Hundert der dem Kreise tatsächlich entstandenen Herstellungskosten käuflich zu erwerben.
qo
Von den Herstellungskosten sind dabei in Abzug zu bringen:a) die Geldbeiträge und alle sonstigen Leistungen, welche etwa
von Kommunalverbänden, Privatpersonen oder anderer Seite für den Kanalbau dem Kreise unentgeltlich zur Verfügung gestellt worden sind;
b) die zur Zeit des Ankaufs bereits getilgten Beträge der vom Kreise für die Herstellung des Kanals aufzunehmenden Anleihe.
9. Nach Fertigstellung des Kanals hat der Kreis dem Regierungspräsidenten eine Zusammenstellung der Herstellungskosten und der von Kommunalverbänden, Privatpersonen oder anderer Seite geleisteten Beträge und Anforderungen dazu vorzulegen.
Potsdam, den 31. Oktober 1899.
Der Regierungs-Präsident.
In Vertretung:
gez. von Patow.
L. S.
Der Königliche Regierungs-Präsident.Potsdam, den 31. Oktober 1899.
W. 1157.
j^^.ie Genehmigungsurkunde zum Bau eines Schiffahrtskanals von der Wendischen Spree bei Grünau und von der Spree bei Treptow nach der Havel bei Potsdam, sowie die hierneben näher bezeichneten Entwurfsstücke übersende ich mit der
Anheimgabe, wegen Beschaffung der Baukosten nunmehr die geeigneten Maßnahmen zu treffen.
Zur Stellung des Antrags auf Verleihung des Enteignungsrechts ersuche ich, mir baldigst einen zur Vorlage an Allerhöchster Stelle geeigneten, in nicht zu grossem Maßstabe gehaltenen Lageplan über den Kanal einzureichen.
91
Inhaltlich des Erläuterungsberichts befindet sich die Binnenentwässerung nicht in einem den Bedürfnissen der Vorflut entsprechenden Zustande. Da die ordnungsmässige Herstellung der Binnenentwässerung mittelbar auch dem Kreise zu Gute kommt, hält es der Herr Minister für empfehlenswert, bei Gelegenheit der Kanalausführung auch die Vertiefung und Regulierung der Hauptentwässerungsgräben zu bewirken. Jedenfalls muss gefordert werden, dass die an dem Kanal selbst auszuführenden Vorrichtungen für die Einleitung der Tagewässer nicht dem jetzigen ungenügenden Zustande der Gräben, sondern derjenigen Verfassung anzupassen sind, in der sie sich nach ordnungsmässiger Vertiefung und Regulierung befinden müssen.
Bei der Ausarbeitung der Sonderentwürfe wird auf diese Forderung Rücksicht zu nehmen und sowohl hierbei, als insbesondere bei der Bearbeitung der Spezialprojekte für den Kanal und bei dessen Ausführung der Meliorationsbauverwaltung dauernd Gelegenheit zu geben sein, sich von der Wahrung der Vorflutinteressen zu überzeugen.
Den für die Genehmigungsurkunde verauslagten Stempelbetrag von 1,50 Mk. ersuche ich der Stempelgebührenkasse der hiesigen Königlichen Regierung binnen 2 Wochen portofrei zu erstatten.
In Vertretung:
gez. von Patow.
An
den Herrn Landrat des Kreises Teltow
Berlin.92
Anlage II.
Der Minister der öffentlichen Arbeiten.
Berlin W.^, den 7. Mai 1901.Wilhelmstrasse 79.
III.A 5168. I. Ang. M. d. ö. A. III. 4330.
1. 6018. F. M.II. ± 1441. M. f. H. u. G.
«PSIft Bezug auf die Berichte vom 8. Oktober v. J. und 23. Märzsovvae au^ Grund der am 1. v. M. stattgehabten kom-
mwMm m^ssar^sc^en ^erhandlungen erklären wir uns nunmehr damit
kHfl einverstanden, dass an dem neuen Kanal von Glienicke a. d. Havel nach der Oberspree ein elektrischer Schiffszug durch den Kreis Teltow eingerichtet und die Befahrung dieser Wasserstrasse grundsätzlich nur bei gleichzeitiger Benutzung der elektrischen Schleppeinrichtung gestattet wird, während jede andere Art der Fortbewegung von Schiffen, insbesondere durch eigene Dampfkraft, durch Treideln oder Staken ausgeschlossen bleibt.
Ausnahmen für besondere Fälle können vom Kreise mit Genehmigung Euerer Hochwohlgeboren zugelassen werden.
Die Ausgestaltung der elektrischen Schleppeinrichtung im einzelnen bedarf der landespolizeilichen Prüfung und einer von uns, den Ministern der öffentlichen Arbeiten und für Handel und Gewerbe, zu erteilenden Genehmigung.
Die Einbeziehung des Entgelts für die Schleppleistung in die allgemeine Kanalschiffahrtsabgabe ist nicht grundsätzlich ausgeschlossen. Es bleibt indessen späterer Entschliessung Vorbehalten, ob diese Einbeziehung als zweckmässig zu erachten ist. Jedenfalls muss der Schlepplohn in der einen oder anderen Weise tarifarisch geregelt werden.
Der Minister der öffentlichen Arbeiten.Im Aufträge:
gez. Schultz.
Der Finanzminister.In Vertretung:
gez. Lehnert.
Der Minister für Handel und Gewerbe.In Vertretung:
gez. Lohmann.An
den Herrn Regierungspräsidenten
in Potsdam.93
190019011902
I9°3I9°41905
5736962 73 5 4°8 4 5°9 2 7399172759509 4918 2764427 20175642331 686 6882 2338 5682531472 3328 2 5348002714886 4343
1 900 042 1942 376 1819535 1 887 731 1 882 196 1994558
2719 2292753057 2702 2755759
2916 667 2789597
2 91 5 577 5 °9°2 788 274 I3232977596 3714,5 2981310,5 208283I2900689 1578 2902267 21306312853785 685 285447O2 874672 1481 2 876 I 533066797 966 30677635 704233 4 3 58 37o8 59>3807697 --- 38076974 >99763 — 4 199 763
1927425
1 73 3 45 12 295 16830589052 844 1003 163 276
190019011902
I9°319041905
580771 43206882025632 47900591906489 42450571 953 698 44884981830095 45493241895971 46517501882 759 14 799 406
4 784 3 '45065 15950545364 782 978 46100415 5642426 770025 6651 797 7363059
1994717 2 083 848,5 2132 269 1 928 5081 73 3 8882 296479 30614342 844 1003 163 276
1 3112 529
1591017,5
7°7580686447
11 322 10560
8 240
363647 396 668
395 792 532121496342 482 310
48? 553443230
571972 626 083 672 561 558 506 591 864
731 561 663 245 643 015
243737262 341261 396
119910 243 737262 341261 396 253243 280481 276597
291825 290 182596713 54 396 713579905
352114 340447276 581 281 925228222 | 363642303215,51 428345,5 331929 331316281705 361 310
119 91 o
1 34 3 27 134 396 278 878 215861 205713 191728
■ 5 3 ° * 4 >75259246178
>34327134396 278 878 215 861
205 713191728153014
1 75 259246 178
3 32 1 14276 581228 222303 215,5
331929281705
253243 280481 276597 291 825 290 216
379905 340447 281 925 363 642 428345,533> 3 >6 361 3IO
Gesamt- Ortsverkehr
1897189618951 8941893189218911 890 18991898 19051900 190419m 1902 1903
ttttttt t tt t tt tt
5020619 5045666 5134040 5282959 522754446408494684335 5186727 [5 637 > 3 > 5 660619 7 5OI 586 8 006 0545 >68547 5 9561065455539 7 3 > 5 042
V
94 95
I
Anlage III.
ORTSVERKEHR AUF DEN BERLINER WASSERSTRASSEN.
AbgegangenAngekommen
T a 1T a 1 BergBerg z uz u z uz u zusammen(angekommen
zu Berg und zu Tal)
zusammen (Abgegangen
zu Berg und zu Tal)
JahrJahr FlösseFlösse FlösseFlösse zusammen zusammenzusammenzusammen
t tt ttt tt tttt
CS 30
G\
G\
G\
Gn
G\
CK G
n G
\ G
n G
\ G
\00000000000000000000o
T
V)
G'n
G'\G
\G\G
\G\G
'nG
\G\G
\00000000000000000000 00
-^1
ocs
00rc\ O
O <^r\
\Q O
-N
190019011902
i9°319041905
1 2021 677 1122
10 061105 304 142 320 I05 777.5 2384
3 6°7
I 1o 751 256541 180 589,5 249751 299454 550906,5 554780 299 148 410 529 452 522 471102
515 997726 009
88611 1515 890
7359985
957520
33°1 422 1321
1 3931 422
779520957
383818015
1890115 365!45 927108 161,5110 751 245 402 181 740,5 255641 306 813 3 51 891,5
3 3 5 73 7299 668410 859
45 3 944472423515 997726 009
18911892
11111899190019011902I9°319041905
190019011902190319041905
10063 2 8287 022
9 299
Zusammen zu Berg und zu Tal.
187 088 285 261
254 752>5272 736415 856 500097,5
439 534454922507 00 I 476 269 502188 683 612 840 684 925 622 778 032 907 388
861 745,5 812 006 801856
1 094 920 1294628
3981171 294029
655 597
1
1
96
857907,5 811049 801 336
1 094 141 1 293 206 1596724 1 294029 1655 597
510407457012368 832 585487 660 460483 515696 307 765675
292 392 427581 360 530 585487 650597 480 687 689 285754376
195 042 291085 260 670,5 272 736 415 058
301 774>5 440 666 456 862 509854 476 269 502188 684061 840684 925694 778 03 2 907 388
Flösse Flössezusammen zusammenJahrJahrt t t t t t
DURCHGANGSVERKEHR
AUF DEN BERLINER WASSERSTRASSEN.
T a 1Zu Berg Z u
Flösse Flössezusammen zusammenJahr Jahrtt t t t t
03 «v
~n
xr w
-n vo 00
G\
G\ Os
CK CK
CK CK
CK CK CK
CK 00
00 00 00 X 00 00 00
00 00
o
c
SOto
4^
Xj“
CK 00
-4
03
0300 SO
O
xt“ xj- 00
u~
n 03
CK OO G\
t'-'N U
~\
I ^ 00
CK _K.
'oo
00 00
SO SO
SO 00
0000
0000
0000
0000
SOSO
SOSO
SOSO
SOSO
CK
^ -L
O03
Erde, Lehm, Sand, Kies 805655 136854 559291 9784Steine, Dachziegel, Tonröhren. . . . 2553966 35244 1030718 11250Stein- und Braunkohlen.................... 1167845 31613 261378
5493 2829 360191 75 5 60 716572 512 1 70178
104 67847
Sonstige Erzeugnisse des Bergbaus .Rohstoffe für die Industrie.............Industrieerzeugnisse ..........................Düngemittel .......................................Erzeugnisse des Land- und Garten
baues, der Viehzucht und Eischerei Bau- und Brennholz
573797232 28971
7 47°
1 870 82 122
717 001 1 1 5 342348 708 22 392
Zusammen 7363039 643015 2038708 57475
97
ORTSVERKEHR AUF DEN CHARLOTTENBURGER
WASSERSTRASSEN.
Angekommen Abgegangen Gesamt-Jahresverkehr
Jahrzu Talzu Berg zu Berg zu Tal zusammenzusammen
tt t t t t t
I 899 887 098 48 950 62 027
32 i75 48 424 21 671
47 3°9 57475
936048 18;054
I OO4 596 324 664
1 732 5 3 51 7O54272 096 183
449824 566 83 5
431277 560 212 7 58 414 603 056 699 851
457274554 >72541 144716028 952450
1055 062 338857
23 720 28 939
25 23O 3 3 088 22 567 26625
190019011902
1 121 007 19 608972 421
1 276 240 1710 864 1658 118 2038 708
21 799 14601 25 840
3 5 ?84
II9O3 7 070
21 46919041905 1 32 091
WARENSTATISTIK FÜR DEN ORTSVERKEHR
auf den Berliner und Charlottenburger Wasserstrassen im Jahre 1905.
Berlin CharlottenburgLfd. Gattung der GüterNo. Angekommen Abgegangen Angekommen Abgegangen
t t t t
(N
t+- LT'
1^- Q
CG
\
Anlage IV.
VERZEICHNIS DER MITGLIEDER.
a) Kreis-Kanalkommission.
Mitglieder des Kreisausschusses:
von Stubenrauch, Königlicher Landrat, Berlin, Vorsitzender, Keller, Ritterschaftsrat, Gross Ziethen, Kreisdeputierter j, v. d. Knesebeck, Generalleutnant z. D., Excellenz, Löwenbruch,
Kreisdeputierter,Dr. Badewitz, Rittergutsbesitzer, Siethen, Kreisdeputierter, Borgmann, Bürgermeister a. D., Cöpenick,Massante, Gemeindevorsteher, Rudow,Zimmermann, Amts- und Gemeindevorsteher, Steglitz j, Mussehl, Amts- und Gemeindevorsteher, Tempelhof,Schulz, Amts- und Gemeindevorsteher, Gross Lichterfelde.
&f»\ mi *
MummKeller f.
nMitglieder der Baukommission:
Kretzer, Kommerzienrat, Kreistagsabgeordneter, Berlin, Lange, Schöffe, Kreistagsabgeordneter, Gross Lichterfelde, Nathan, Fabrikbesitzer, Kreistagsabgeordneter, Nowawes, von Oppen, Rittmeister, Kreistagsabgeordneter, Adlershof ■ Rammrath, Ingenieur, Kreistagsabgeordneter, Wilmersdorf, Richter, Rittmeister, Kreistagsabgeordneter, Mahlow, Schweitzer, Kreistagsabgeordneter, Zehlendorf,Techow, Königlicher Baurat, Landesbaurat, Steglitz.
Zimmermann f.
t>
Jl
von Oppen
Mitberatende Beamte der Kreisverwaltung:
Dr. von Achenbach, Regierungsassessor,Borgmann, Kreissyndikus,Kleine, Regierungsbaumeister a. D., Kreisbaumeister, Hannemann, Direktor der Kreiskommunal- und Sparkasse, Heider, Kreisausschußobersekretär.
98
b) Teltowkanal-Bau Verwaltung.Havestadt, Königlicher Baurat, Mitglied der Königlichen Akademie des
Bauwesens, Vorsitzender,Sievers, Regierungs- und Baurat, stellvertretender Vorsitzender, Kremnitz, Regierungsrat.
Hilfsarbeiter:Steffani, Gerichtsassessor, Block, Regierungsbaumeister, Plentz, Katasterkontrolleur.
Simon, Kreisausschußsekretär, Bureauvorsteher.
c) Entwurf und Bauleitung.Havestadt & Contag, Königliche Bauräte.
Dauernd während der Ausführung
beschäftigt:
1. Uthemann, Chefingenieur.2. Lucas, Ingenieur und Prokurist.
Vorübergehend beschäftigt:
Abteilungsbaumeister.12. Becker, Landes-Bauinspektor.13. Haussmann, Architekt.
Abteilungsbaumeister.3. Goetzcke, Wasserbauinspektor.4. Kühn, Wasserbauinspektor.5. Wiig, Oberingenieur.
Strecken ingenieure.
14. Schloe, Regierungsbaumeister.15. Kredel, Regierungsbaumeister.16. Erhardt, Regierungsbaumeister.17. Klaus, Regierungsbaumeister.18. Strasburger, Regierungs
bauführer.19. Contag, Regierungsbauführer.20. Havestadt, I^ipl.-Jng., Regierungs
bauführer.21. Schinkel, ^ipl.-^ng., Regierungs
bauführer.22. Gablenz, Ingenieur.
Streckeningenieure6. Kuhnert, Ingenieur.7. Balder, Ingenieur.8. Rüdiger, Ingenieur.9. Zölker, Ingenieur.
Im Konstruktionsbureau.10. Winter, 3PtpI.-3Ing.11. Meies, ©ipl-^rtg.
99
33. Leiter, I^ipL-Hng., Regierungsbauführer.
34. Schwabach, Ing.35. Ellendt, Ingenieur.36. Gaudig, Ingenieur.37. Kirchner, Ingenieur.38. Schotanus, Ingenieur.39. Klingelhöf er, Wv?l-Jn$.40. /Cd/te, Ingenieur.41. Ahlbory, Ingenieur.42. Jörgensen, Ingenieur.43. Braun, Ingenieur.44. Magnino, vereid. Landmesser.
23. Wagner, Ingenieur.24. Zimmermann, Ingenieur.25. m/2 Someren, Ingenieur.26. Gocwinski, Bahnmeister.
Im Konstruktionsbureau.27. von Troeltsch, Oberingenieur.28. Busse, Ingenieur.29. Meier, Regierungsbaumeister.30. Schönwald, Regierungs
baumeister.31. Stäckel, Regierungsbaumeister.32. Lahrs, Regierungsbauführer.
Anlage V.VERZEICHNIS
der mit grösseren Arbeiten und Lieferungen beteiligten Unternehmerin zeitlicher Reihenfolge.
Gegenstand der Ausführung oder LieferungWo h n o r tFirmaNo.
Erdarbeiten, Uferbefestigungen, Baggerungen, Ramm-, Maurerund Zimmerarbeiten einschl. Lieferung der erforderlichen Materialien für die Brückenbauten und für die Schleuse.
Erdarbeiten, Uferbefestigungen, Baggerungen, Ramm-, Maurerund Zimmerarbeiten einschl. Lieferung der erforderlichen Materialien für die Brückenbauten.
Frankfurt a. M.P/2. Holzmann & Co., G. m. b. H.
1.
B. Wittkop, G.m. b. H.vertreten durch die
Oberingenieure
Prentzel j u. Fastenrath
Charlottenburg2.
HPrentzel f.
I OO
Gegenstand der Ausführungoder LieferungFirma WohnortNo.
Aschaffenburg Erdarbeiten, Uferbefestigungen, Baggerungen, Ramm-, Maurerund Zimmerarbeiten einschl. Lieferung der erforderlichen Materialien für die Brückenbauten.
Säger & Woerner,in Verbindung mit
/. H. Bachstein,2. Ph. Holzmann&Co.
3-
BerlinFrankfurt a. M.
Ti efba ugesellschaft m. b. H.
dgl.Berlin4-
Steffens & Nölle Eisenkonstruktionen für Brücken und Hochbauten.
Berlin5-
Benebelt & Co.6. Grünberg i. Schl. Eisenkonstruktionen für Brücken.
Thyssen & Comp. Eisenkonstruktionen für Brücken.
Berlin7-
Windschild & Lange- Cossebaude bei Dresden
8. Betonbrücke Chausseestrasse in Britz, Ufermauern und Filteranlage am elektrischen Kraftwerk.
lott
Dregerhoff & Schmidt Reinickendorf bei Berlin
Kunstschmiedearbeiten (eiserne Brückengeländer).
9*
Miksits Berlin Kunstschmiedearbeiten (eiserne Brückengeländer).
io.
H. Freese Berlin Holzpflaster für die Strassen brücken.
11.
AktiengesellschaftFerrum
Kattowitz Zawodzie a. S.
Lieferung eiserner Rohre für die Düker.
I 2.
IOI
Gegenstand der Ausführungoder LieferungFirma WohnortNo.
Lieferung und Aufstellung der Masten, Gleisverlegung für die elektrischeTreidelei und Kabelverlegung.
Th. Schmidt,vertreten durch Ingenieur
v. Knoblauch
Berlin13-
Siemens-Schuckert- werke
Berlin und Nürn- Elektrische Maschinen u. Schaltanlagen des Kraftwerks, der Unterstation und Schleuse, Kabel. Elektrische Treidellokomotiven, Oberleitung für die Treidelei, elektrische Beleuchtungseinrichtung.
M-berg
Siemens & Halske, Akt-Ges.
Berlin Sämtliche Messinstrumente und Fernsprechanlagen.
1 T
F. Gebauer fC. HoppeJ
Berlin Hubtore, Heber und maschinelle Einrichtung für die Schleuse.
16.
Escher, Wyss & Co. Zürich Dampfturbinen des Kraftwerks.
Dampfmaschine des Kraftwerks.
17-
G. Kuhn18. Stuttgart-Berg
Maschinenfabrik Cyclop, Mehlis & Behrens
Berlin Dampfkessel des Kraftwerks.l9‘
Weise & Monski Kesselspeisepumpen fürdaselek trische Kraftwerk.
Halle a. S.20.
Franz Seifert & Co.
Akkumulatorenfabrik, Akt-Ges.
Rohrleitungen des Kraftwerkes.Berlin2 i.
Berlin Akkumulatoren des Kraftwerks und des elektrischen Schleppbootes.
22.
102
Dresdner Maschinenfabrik und Schiffswerft Uebigau
29.
Stettiner Odei werke, Maschinenfabrik und Schiffswerft
30.
Caesar Wollheim, Werft lind Reederei
31 •
F. Pumplun32-
W. Eichelkraut Nachfolger
33-
Steglitz Seibtsche Pegel an der Schleuse.
Berlin Spiritusboot und Oelfeuerung der Schleppdampfer für die Schleppversuche.
Aumund-Vege-sack
Dienst- und Personen - Motorboote.
Zeuthen i. Mark dgl.
Rummelsburg dgl.
Spandau, Weinmeisterhorn
Bagger, Elevator, Schutensauger, eiserne Prähme.
Dresden Personen- und Schleppdampfer.
Stettin Personendampfer.
Breslau Schleppdampfer.
Dt. Wilmersdorf Maurer- und Zimmerarbeiten für das Schleusengehöft, sowie Ausführung der Lokomotivschuppen.
Zehlendorf Maurer- und Zimmerarbeiten tür das elektrische Kraftwerk.
103
^^•ehnict^d
R. Fuess
Georg Apel & Co.
F. Luerssen, Schiffswerft
C. Engelbrecht, Schiffswerft
Anker, Schiffswerft
R. A. Wens & Co.
Gegenstand der Ausführungoder LieferungFirma WohnortNo.
-LC\
OO
-4
CN
ts)
(NCN
to
CN
Mit kleineren Arbeiten und Lieferungen waren beteiligt für Schleusengehöft und elektrisches Kraftwerk.
Aktiengesellschaft für Beton- and Monierbau, Berlin, Voutendecken.M. Schmelter, Deuben bei Dresden, Dampfschornstein und Kesseleinmauerung. Warneboldt & Nasse, Berlin, Fliesenbeläge.A. Pieck, Berlin, Fliesenbeläge.Westdeutsche Eisenbahngesellschaft, Cöln, Steinmetzarbeiten.Gebr. Friesecke, Berlin, Kunstsandsteinstufen.Assmann, Gross Lichterfelde, Zimmerarbeiten.Lemnitzer, Friedenau, Dachdeckerarbeiten.A. Wagner, Zehlendorf, Dachdeckerarbeiten.A. Staud, Deutsch Wilmersdorf, Klempnerarbeiten.B. Richter, Zehlendorf, Klempnerarbeiten.W. Wutzdorff, Deutsch Wilmersdorf, Glaserarbeiten.P. Heiland & Co., Zehlendorf, Stuck- und Rabitzarbeiten.Wegner, Deutsch Wilmersdorf, Tischlerarbeiten.Hischer & Conradsen, Deutsch Wilmersdorf, Tischlerarbeiten.Stumpfs Reformschiebefenster-Gesellschaft, Berlin, Schiebefenster.Benecke, Berlin, Anschlägerarbeiten.Stumpf, Deutsch Wilmersdorf, Anschlägerarbeiten.P. Golde, Deutsch Wilmersdorf, Kunstschmiedearbeiten.Gerschel, Berlin, Bildhauerarbeiten.C. Schmidt, Deutsch Wilmersdorf, Malerarbeiten.Zahn, Berlin, Malerarbeiten.C. Leifheit, Deutsch Wilmersdorf, Malerarbeiten.Gebr. Hildebrandt, Tapezierarbeiten.Schulzke & Classmann, Berlin, Linoleum.Wille & Co., Berlin, Oefen.E. Paul, Wilmersdorf, Oefen.Boerner & Herzberg, Berlin, Be- und Entwässerungsanlagen.C. Kneipp, Berlin, Be- und Entwässerungsanlagen.Xaver Kirchhoff, Friedenau, Blitzableiteranlage.C. Flohr, Berlin, Aufzüge.Gebr. Hammer, Berlin, Kochanlagen.M. Schachtmeyer, Berlin, Kühlanlagen.Schäffer & Walker, Berlin, Beleuchtungskörper.
104
VS 17(BSgJs JmS
"CTöv’X1 ZA!* ’ RegowschZeuse.iQiu \Z< ”'•- aCT7 ' ßi1: 400 000. Vjß:«/ 5 'assow I ■/ i\C30 km.. tiTLsfei70 Z&rppJiTi J3y§fro 5 o \510
»*» llwe->-8 0i
''n ■* v^. ^ 3NBÜÖLG-STRrm %C^Les=-<iS3^
Zaorensehleuseh^SjQw^—^if
jluisP
J® l.X em\ia-S. 'W/< iNSchl. tOTTt(r % i.>jMgMlM,
*^TNL/ MEC
k^/)
VCTCTwl^3K|B
Nord.. V. \Ä
a§ ■•’j*8 -,A ö
X’
y j&j
Grei£emfj % W\rJ'erleb erö phfS? Pimumr\£ 'retzi J5I Q
)({.-- @\ si GEHÖRT)f Dannenrod lUe Schwedt
’s-w
7
#4/% /\ Ä#k*^ ’S-a ZU l'VilxlenbrueJi, IVf*'»w i,// /V. 'wall ic SjICT N r *N____
T*N« >rrvovr
See
; ¥ Uchldoi'P%£***»* i%jn 4 Ll fA I7 % Jr %V,'u&jde
I«1 Grcti 79
CT"***
D*)7 1msn b w CV'
\N■>itqelin. HT ^'ans ec fr V. ’S« #>yc?eZs- 79?4^ ____________V'A r% - ■C,S^v= />fli % [%#So »ScO /’i □: I f \
^J||l |/ H WÄ i
r X„
■’*% Oi v See \ :JoachnnsthaS^Xi
■’^,',t f<a «w*
»7/s /// J o /| '-wii-jWM't ? %r-^X
%Nfa *.r 1\duhn± ySeelertieaiECKLENBTIRb■7or x
VA >I '-,7f^z< 77
Ze$JjSK$&.7 i %ä
v e7^\o\jc\vov
Qr¥' * mr)\ «’******%„//// Q*1
,'".:'|T |i? \
n?y'KJ. C7 7Os....
ÄW*'
|
y# ■w
■■ -JGr.. ip&dtoß^ii',x e^.smH 7 ?KyHTz^
fri
pScM.
€ %%■
JÄ 01H!)|
m//\ qfß ^
ldfWusterh:zusen (*?
n{ s f/f
;( >X. W
7'"fJ MjE U-RUPPI J:/ \ ^9-oJjti<5/
. f /fS-a iVtldca&Q.
mttfS*’ fosdBz,.JfifeJjÄüfl
€&
je*OI^Tsi' •Z’ or-
im 6S7Sei £s
ät M 1*///r**,''m7V•C'
wQ7M&sfra^C A SÄJJr^OXtfb'rü-
* Schi /»
iSmA» **Sii|□ 1✓5BJ
,v cuzt7ien/ß\2
\£sjjSchlaiseWfyjp
,7!^kZöwenbet*/
\ räs>Aw^ Lieben
mir***i, \Oderberg7 V#X'Wfeg /G 0% ■"o‘ZOHr
io« tX?Brf 'V£&
%MzV.- / |W*
7 i..JO u>rcjV «4!Vyw_*X
'•>HbW)e77 xVcnsüid tyjr
&/B-bJienofaJy
tchbi kS’wx ro 1•sckJc Schl?1 wN, / /»oi-
ivelb ... /
a rierGn/rafeft
’Lnchen,RäbePyM
^2dtßj ^
*■■'■.<■ J^r a
k/ <7 ’B^dS
meesenSPrfk* Jwej4ßE._ „
WALDE
ly w« Sfe1...."■ v. J« J x&rb^:^7,.<Jö'ieiSi e s Q
y bellin rac-~
rrio\\r‘%
re 1$
x 7s e 4%p- /j8evs'rar;
\ HohenbriLch. . O u Sch/. |\v o
?;v'xS Malz. <*. Schl,
:aMehlgast Mt,OSJf ■* ^assw^sarj
<o'erborg ’iDreet SärvmJde# %Lwalde O,Ju I&) 711aus^ Jü^f*o ö;.-■ -.X,/ nx
T Tulceriber'(j Jliehegith&J
Hs bi.Dosse | SeA/. yIS eie -
listrirLchi'rvten. ‘x."V ThLercj
Garz
=77,: H-.Stroi Krfininciit '"• -vs«esac^QHin fleribt \ .'•'"’Sw -*4^SKJ
:X ((r -gftßi
7 *■"*
VÖ 5"'*S; o
gu vstx;n£cldclrf*g9jL
»1Vwwu
Or&TiieTtburc /öin in QA.grGrüitthcilISmF'St-c
*%%*»
l7 XL elGn |■> 5T "GvÄ-ve-r-;C ' 1 "S□I* HeeJcelbergg2^pi^ie^cÄ^N
\ r<Z>#•* ibiese.
%GoLclbexic * Wriezeii,■r.
Oo Giilpe
} %□7 Swxy1h V\j(> If
At^mß V Gr: j\tMenelorlpk$y.s Hyl) 13 loUx-rnhurg
yParey
Schi\Sirar ÄÖF«cJul ZY r(Jyje s$m?J I wercler
mj a>
)N^ sy*’\ •I 4
igUen
X..
'aulb Niinrruilil?örjticJee Bernau qc\\o i/ieziz»Uh
t>t
ane <birvio\vetv^
1/
s Ikersbr'r/'
jt£ '?#17/9 Kienitz,-,7
A 'Lirul&7 «ff%":;m o& Zorrv-•zvRjfrn I -~-Mi C f
-siv br / x.
-• ^^GbtZe^z^r ^ilorr
77-Qo/ JP•V. .etschirv'Ae 'Bü BachBörstel/ <? ^'^jTeravigseLorr ar e#S®e/77/Js-7 qsh&u7rÖttUlTL Ö\ V-'7 I v
SteeleLstüu, rt'
J.J es, ö v./ '(Küetx« (j Seeu Aleder-
XezLernlon/'.
Wo) ’emeucheriihren x.S« ! 117/ .4^Streffe %i oö /»5*. Zechirr<]Carole/ Nauen Ö Sc/)/. s 3= Hardenbergv>
\‘KurzeVcA* ' ItGr: TVuxli eJc e r7iATe7 iriTia jtsenfBärh,X* o MaAi , ^jRrTrsclmncf Q^rS
Fvnkenbrug
^^s^Seege/eld
f y|%4V '
Jt,) o
«€gvry. 7
ptAOU«
6V?STEN ! ) CUSTRJMschow ibg.V.417^ VI QStrausberi■>ly
Golzcnurn ßc holz
; • .'
: 7 Gortfastyi1 ),50/ tlLein..,»"■■ HerbfHu»/’ Böhne.i Ibifelin, ),
irjsterrnxirh^ Tang|ermünm-Derhker ■
I0)
BAUofvS2Ä2S^hiöftere Sn Sci^
'Tfe1 <Va 4 y//)!sensee: Viifeck. 'ßr
' Strcuiy>p£0ijj\\iS~ 2
11 J^ ,^?e7oTt’K|/.A
Ketzür* Jäw„ Q^S.
mI ö 7: - ;;•Xm-.„„„.»V/,.„/ r^ryy^£.“LIi!°.’rernnttzVierilz{ V Ä
erg //c ¥i ivie-mrMrhff.aM*%»sSg ,-| Vdhitzei'be JO >7 J l 7,J I!«FpBölscLo
■
Biehelsdo
CHARLOJ*■1 |«ife|5H kttre r s 'y*M \'i mPVeracfeowr
^tAIiinchcAMäURtiU 9JJß 73r lichi&ixwr
^CiiBerz/eQeJ f
^BlulersilorgJ 7) ^57^..*'’'
ma
KetJfr (Pr»®r ™gO,( itraLaxi
i >*■i ferchel■ 1 v. p/K©Y«aB^ r 4fGr.-GGenieJce.o SBSO 11 /Tryffiieih-nan
(XxZxiHV CT
Aß Lre\ l/>CT7 ’cZ r^1/ rskow rhagen,fPlfiv,0>
A o ^-Knoblauch/—^
>. ^
[Q Berners eio/F
y7QßrtÄsCTX CTffcZ.Är«)
H.)ENi-5riiQ|^rfr\ X) i •
;.Tangerbulte, altersfyfPr1 b / WP Schl.:IP %=\k\&P- gIP«
tdnr) ö U etu- Scho n flies;7Ws ,4^tCA’ehlcrir,cLorp/i
IJLebtzsmQ Gollwitz
*&L Bläue% >OTSDA]
a:
^Kan7> rr/74J&/W<ö7.5d 7, *«I/)/ MM mdigrlslrergPi fergzow- Schl. y ■ Jf c fOi LoulseriAl al i
XGr.m 0.■n''JI% Y C ßFÜllSTENWALDE J}
b.,.-
0 i ,Ae/sdbrP^
öGenf hin ' »CfrT ?....CT=I ^Ves« 1 11i11 Al^nchsw inlce^ J'S) (Iwd %o ...“ "-J s Teltow l c
Stahnndorr / ll
sivO fürs (er •-iviiz
V x- 7^5=g^ ■ 'V'" r ZI-XI ft
evnsAWi eh!
w ...7j7Giis.
Code ,o uCT,
aäfdkb
ty YWSv" wp;
’axcnsiLm ät Wehr4'm .. ij.' wirAr. Darr rät■X irvBeerenSfl Boosen.
{rifver.\.V Rosengarten^
CT Sch/. a/t£%gschi. ~r~
^Ä?n^a/(yeo
cLorf*f;JSea- xannsdP. y.® Cr.ISchl.J ■ ■_.|H y% /
Ferch
Berlccn. -oVv' X > ‘Gross Beeren!ifl Giiserv, ■ f/\ u w%
■^se dd^JA» _j;
4«®' <f
TtFoseFl Ai\uh<A r.(Ji\%>
SaajmnnxL £' ■ V
jf Bari
ogatz
flCFURT«IX Lg ran l4 Tzschetzsa
'dtjugbsdfß s sS ö1 Q^ e> v,/’^i’/fv Ä OdcB lY>S'■y.,.ree540 KerscLorfcr '~X
Schijetuse %llLehnirv i. s o’A 7CTI •y. /iöriiqs-,$8toi
Allafterh anseriQ i!a» jf Busch is t ncuhle iX
o.v.smv O %s ■i idorP Ir^0 < \'
*^5?W%CT 7 7TXcuCT /.«Zojtevl
Ziesar f%\ i Hse iySfeidJu ‘ubM.Q
fzi«^"¥'w11 Goltz u\4O
SedAim^Jjd, .„
:’*CT \ /I ^
iwVf <{
11 5to9 O IVCT\ ....« u\m-•I:r, .yyp»m^»aJ"
trat:MwM CT»
X . . , .«.
T 'hf hat esiJfhf.'lYeeliJx.. \i\cr5J% iRas%
**% martnsTim4 1 ;rrrCT e W-Ai/
jf /z ' BLanlcej isee. #"" 6 »«f »«“VS <; v\ s, :/
I Ti•» \%V 1
»*%„,
Bj
K: Krcbg ai ix-he !
Zilterulorp
□.4 oin-dovetß^Trebbii iSeis
issäriBeelitz.C^'
%'reros%«4 Ipy Schön 5
c it-Z OSS'g&h*‘%e<'".*»,.
^ \\ *'- Mot*e»vev
!/7serinT ß TA
al% 'mbi Xvv' 0/z
,/7ItfiCT (
'4 &Z4*mP®
?F: I4 It ijjlJlecs&mv?
=SX■;VA BruckY IPrXWSfO
JF o■/
): |
/*v M# >iXOK K
y i■ i (lörzke M\ ' fl T’V’-
ll V/cbinerpf>'*C.N
(BH
Eortfo^J
<: fgbCT|
iW OeUfW*« oV 1V-nT ..•'CT..
5Vogel -
ya/ig
CT--. |d%!rsi KW;II IV 7-_ _ _ _ / !//■ ______./
■'• - .i?-r; %ct7 H'I/\ > UV"•sWt\
n 5^7""CT■ .■•...•
"■■: ■ /7(TSsS-Pi-"■•VvZ J%7V
(yKeinjiHz ^
n./ u rsfc7ing?f£ I
ÄA/J/W I| ..V—""’ / perenhg.Q \ i«r ,x,\ r—*r
Sseriblt
■ Jr ISeuenrtVcvrWr
r»ee\ i f r/V»7
Frarüeertfördß-.
s f ich/\Schl4/ uTwwm/w~*d.obiird
t*njjSS»r^ /-CTS’’
4.)\5\ BeCuhiihntly;)-7 ntz Jk*’latkow*
\pilzsnjt&\ Fäiec^lhhd llJrS4x 1
CT.CT'/ X...i o•vss J\föb i&Jx'm ibjcS:>CT CT Q-/.I.-Vw><»-X Hr4- Schiess-Platt\. yfeiwCTb
Biichholz CTCTtßTreuenbrietzen ° Ni Halbem
t)ÜFNedlitz NeiüioPpjlucke: sJi
Trfr?^Ksmi\Mittwflde /\|Ä
//-4m
,eibscho IVeithe KGünters - \ dorP
BretschenLeitzkrui, Jr. ^/\MiemeekBeuden Scho bendorP
O ftraH.Q^ °
Ä4*V \
,u\l 1 v\r u
\ v %Rodeland
Glashütte‘’f^waorT
O yLe/ Jtiz?i'at^Neif^
c yVellmitzBfS)Yl-C Gr. Wcisserb
\ !
\ ; )/- /Linden l
LtJ*rvLinowi BTTjlSrtlZcA 7 5 d?4J>•'■ •*"\ /uQ 7 r ^.,1®\. (hf!J3r»anxL¥ f\~
CT xJJorPZinruiy SchiepzigKloLter Zinna.
kn«ÜCbiX, .. -Hi
n. }iLith.Anst.v.Bogdan Gisevius, Berlin W. Linkstr. 29.
Wilmersdorf-Berlin 1905. HAVESTADT & CONTAG
Königl. Bauräte.
L
—— Prinz Friedrich Leopold -Kanal.Teltow-Kanal. a Verbindiaigslinie Britz -Kanne. ------- GroßseJu/Yahrtswep Berlin - Stettin.
• »
TELTOW-KANAL.Übersichtskarte.
■M
“CT
tCM
..v'1*/. / “
IU 'x'*1 ’4((
CT'’-"''
,V) n'7
J^jidt BerlinVy una ^b} -rr
jllllQs«mf'C-t fäb‘r t
ü—. Bf W/XXl
>;/>* • ■■';- ä/-a®#twJP*X Xa®i|§
jy&'l.
.£*» XriX [ frlj 4^Lk ra&£'&. ^Tk&SStf-Ä k!
^•PlXSp7, 'f|"'|™jp1*'
. ufSkx/mM«IltÄsi%äpf/Mißißw
gMWflpi.-fc~e muji p 4*e;l4rf^^^ fc^Kfös*
«rfgiflltlfe.
„ Ä«.s#|ÄI<«»|f - Äuj# .V
ÄllIhRJläh..,
draiiiH^-tiMHXX//X//mxmm/ ®
mx.^1
X 4 r 7\PFßyilNBwsm.
rnt^sly■x:~~/Ofl]g»i
..«
PSä^^P»^'
** ^^Äifc’«
Bcchi xN,// 'jf'jS<£\ * /V^y»er > j/' Jrßzj ]'■
T7ss. W PJr:f®'^f> itfe i SMM/ 1 •'f&fpf* 0 UpTf mmmlit> t-^i
IPf-'Lpy*?fjP|;J uMMff«rfc42.™
«■i* 1 ‘JT^i,:ÄV |Äpr«^fr F#3
fct/1 11
1 7l,'AjWj •:km,;W' ,ltZ “JfüUjic)( fi i ■
w||v 'J;v.^li:.
t^EKm EriTO<rJ
v /»/. / ;fc,B ‘*X_ mmä/r-■^4»-••-■'Bu^iPr m&LuL. r.. —1 # y
^SI'aiPM,. ,ra. WHaepsdö^h
/.V; *.Ä‘;V ' fV*:;4■ 22A-4‘ 1BEai«i^■^iPÄr
JSOte; !,r.; ^Mßß%'K
" ■ ;i ',;S
...........................................................
iiäy^ '■ ^mkmm m^-mw4* :?*
:f/y53EKMMriAiiW|»&
— ^=^TT"7^nf>rRife?. M Sli^SB^^'i;!'
Ä--,-
M 44ÜX >
K i'*:»>.«* .., i^..ä£&Mul,j vJr-y5/L/A\* >,* '''f>%jj&!i%&
■#?#5
fu V KjiK-:-:-N>dB(jato> lUencfilörie. 1$&5£,l 'feS?W^ii’8 ^ 'MS^s^y^f,-.
.o^ifk WJ^pwP
<'l■wx:
a' V'< m,• i:svxfPüpenpf.Q
■1.:^iS! M223T^t:/. lia.scr
neu.I..J] a ig!4' ‘ iV, J*^jHfeiW'gL,...
//.» - rfti^i /.
i <■w'*%&
-M,/irrrn* ... »f'?4.
‘i>Ma!/, .VJ "E ic»r •/
r. -■• /M/fi/itu),
p/’j ISS:w>,, IMj,v i*Lä 5A
wI 3 ^i;. ifVfi 4i» < //O^ w nn;
im üa^i 7
IHSMI.s^siijSJsiÄj l'i'i<“cVGjmu i
Wimm\fflM
aihmfLrg eijdßf fß l y?-fä_3. .A2 / ' /> a n gjs Wl S:’f 4v.
f/.if Va:®ir sa»«'
: fa||^' AJ'l ■P ;i/ • i\ » Av
wl^i.V‘-AJM trlp^rmtH
Mi ■</ ,• /• m litfr c '
Hfc.“ :
OTfeM
\
i Ritter-
: -
# aStfifanft'nJj.
Cr n„ Z’ <' r / / /• « t .v <» « f: j 7>4; /. ::4 Al ä Är-»^* + ■» »■*.♦ tJg^*mtuhom1 ?: :#'
%A:/Ä•-A ?4ii
ä, jrf1
^9MH
L>»II üdpr-«fi■itlT-J -rA-1 rf #y^‘>?• .‘,V^
ST/'e5 .r-oa s'
'■■H iii!
mßSu.t-: . >">.'s? %:38 /•>• .^•Pa4\s
//j ^ fA r iffisr.?A@WBX<
T)^n^p(uhX.^^C^vif --
•: .4" 4Ä
DasLorh
iS3» si.< O ■' >/ I ->•/ f a.n
• ■ -.1
4v; V-vrÄJ /|t arsr,»
‘4s savchraftise nfe 1 d./
Esplanade. /
'Cr yci\ l/fot.j-jbt
fiV. ,'itirt^Sempelltbf ✓
fjes^nl&mamm^
^Kwätlttitr 1rr.tle/iom2Car i'/l'- • jf L 4.4sc Verbindung
CÄfeKf‘iit: ^22iPZiiiis> r40\SÖ
\ylM-nx*t .Adder.S rf-aBvfl vä
A;fS4ä''«S',v;'‘?:rP
'^P^MBpgSÄ«ÄiiS'Ä^ä£s&sI&
»xjr > .u ss . *»»/ f-Roh*-, Jm/'L V^Cl/ulon-
tqrctEtsrvg;A
aJhlexcL ■
PipV«(?r a *• «-re 5 i ’trMa/L.
ÄUHx<34<t8 ,-•' L;i- .rii$Vhi*t'.fCrampnA
Se&
m30 58IW Steffens)/
& NÖlle jL^
— • - • v^5
424 /> 7’ v eRohrt) »p.- JVeriLichte saf! tt' : :■ ..'•D /irnfnincrixMLJm,
Fahrlander ,
mm '£ClX4ysx,,30 \1. älfjsg.- • %
v=^~% fÄ$y\ yWM^&i £Mnoie-Abi.
Or. SteinltmAei v i#§4 .. . ■
^;""/r r,-W'---v^ü.!4 «Pi nTS'n • /rfen Vf'>5 i ^ 9^ wa^H .* V •y:f 37 Äf#B SXty°j
mM§mp?i? />
yw»cftCT
Xs’jfei.- 4 . 4Ä E,,r^4J
Xfp^4*
a (f. 'ÖÄ£P«I?r ; f b 44'«"""-- c:4Ulnar-* sa
Le ii mit z-r^reß/f'f
%sp§??4#(5 e e
Vt % - ^^4ÄF
TvISrff^
JfJuxtstenhortv 30^cV I.«GrunciVfild0 See X"i~t>si *WUhtlm«ba<l adBdUruc
pjgWrafii'oo ehic/i losat/he n y/v BadcnttxUdt
Dampf\WF^\■Easretxa^ ütZ’.rf Mm*n..
s^5//Ä
|ÄLW/WA./n> :S5 S. u'i(ii>il|g;b; ;/ÄiJSPV // esB/t pVS 2?AoV*
Scharr nt mham:-j,t..- Ar'-Svh:
. '»7 V-Sty‘*A- ÜKOB8E1/? / <' fi re i.te .-;|P
X **i:4:; Md. Pf) 46 Ä-
iiÄilf»
____________ ______________IBllss^l^ifeliM«“f.* ’ S....n '
F- "---S
''-a4R ^äS^2> F 1
Äi| H/ ;■MSßorii itns cr\M<^.
HBfll Pvp54 .}W)A 1 7
\ /ZeMeu
,.X £ y^/iothcPiä4
^p|A4
s>tVnafirrtit ' ■■*#""**
if^ ffl 4«vb4; •• i--1 r *cä‘•tirv.» *’ 32ü\ A L'i Strand sch faxs
&%fydprnPf.k»9
mij GG¥iL =■fr o\, !sk\ ii ?1/7 o Juyorten,
(e<’iceshortv
\ 7c ;ji:^^
A'&jote** >_**-.9cAa/crP'! A *7'^'Rrnfisr.
fP;
’-f;' . ‘V.iiTA • tJßArJ ■ ■
i^Pife»
TO \ '.•*,
ÄHMy Xf,^ i«ZrfdiiSchiife.rtd \
\ %ß- :\
(MT«SS X ■5 ^J.f. (ÜBU o r:-e \Aw».
1
öl^fßS~-.J(h'lIÜTnph/mi ^
Sacrow Lrcnke
mM 1Fa3ri 1
xHC!SJX#
r^«f...
. ■ I»X*’ r7,:"-] VI
iwsll' ■rx /.’ V eineYf?,“:4 \
Kr^iilOBfe vpvckViareck^Remist j
/
IbX■?4
r ,-i « dtof -\ß*i\v
III '!■mff71miW
(i V 0y0P'-<0;.ß^0:i
Pj#g^pmrv
jk'.-v •*
HrlS-- i*
IL Wff C:‘^V\ A .
,S;n ‘Fvj.V4 f17A0.7 fö?ü,jper^^ rt-c>. n% A4 /;»vA-Ä
«F4Ai77- /Stf) IM :V.*. 4}JMz */ y ... 4
e4 y®5«W'/v!ß j/t
V. v'. '■
orJl4-. \•> srr^’cul Zahlen
\ oder.: *' • fiS e Ir■ *
v- ;:: Xuj/scbuxch.•-'\\' \;4
Xt'«4A4'v'.,'W^f
he M?lt:w.K»3«Ä
(fs « cffev If'•■feiiU
;>w A.4
o «äs.4 -CD&5f/»-. «'-J
yW.4 ■ M
spA #. .c-
»1 A;• EijKpi/^vf |ij'4
»Pc,'
■ iWs^|Äi®k JW^#«r -1—s»«rÄSsfeä
■f4b •5-
^w¥\VMijm
A fNJk? 0w&*wmp1\ fyiiiiiiM&L '.'.i•y*
0mri'■ -, I»2> 1^ * •ns■njir./r7«•'« « Z c Ajv/C-S
0 ,SUk A i
Glienick^
tCTBBi ■ V ■ii 4v-ff I35§fM%rXXii&s-
AntferyimnnS-/' X]Regn/Laojtr *
ElysijutÄ
ASS:‘AX%£.(«/.]/ v' ‘Axt
e I 44> v LiEC:'<? ■%>'Af
v \ 'mimHpy^i’7$£mki
-W-i 1M>'Sk A4 \ A a i* \IXT- s. ■/■• if Ru<&
' , zy^, Mäi'ieitfelt
Bf n_jL3rl*.V 1 l\i X-.,„. IJerSchrcUj
K x e r z i fi r plat ^a.s.... -u .
Ä i '' *:v.«Pf,V.'
3Xgv \/*StoS'’Ava •r' 5;^<F
.XrS 1p
MXo \1j/ Kspen -Fj ’ Küjöj r‘; 3><u'immk 1l IM
M
m74>vr?f- ' A Ä4, \^dröukaj/.MMM
mä*«5 ■>
aSM- vSp^ tfStVO*«j*ß
äüfÄii
■cV •f
i-'44 fl
/■f
1 .............
^4 s ..m #■■ w« s. 4
?®sr
III r\ . ;-
y A/
p u n\ fX XX
I,u rten V>/^sÄ jlteA-Fj \ \0.IjrfrvB - 47 /*
HÜ;4X piiit
u30 MwM mM tXXX/.•-A lii■ !J
0finit0/ßXX^:r ■
| iS*
tRinr. eAJfcey v.' *■* C77I .^Vps;^z£?fpjß&%
%M$SiÄSS
T t c- ,*ST<-
f * ^ •■•: .• p'IM "A"1.^4'•- / IIS Kl \ \ \: S-* ^ Bohlt^ ^4'jöe [xA [AÜK |4#«l.(cj
42 V
1 fa
40' fr.m&. ■ /X-si'
/ff'OV:Vj ■ &4ÜiK 4,
/C£X:^xgmc “'. .K1'
% so ! ..• *(W
rFM-rfäi;• üf.>;. • ;lsfeV. :f
'AifkBgsl iyr.0AW,. & • <v4 »>*<■>«■' .1 ■> '■ if.ö
m?T 1 ifgpipiS!ifflpl
pfMÄrtÄfisi
>tnl‘ Mf w MV. *
®™^fc.':AMffe'ySSrifSGliin6<!t«ri
iSS-CksSSSW « ’F'X’X/X
' ‘111^7 Mx
-..7 T.A;4 . \\ ,i »v';is
r AjSL;/
!ämi»ÄP
<^Ü8U
ft® /s ' dlerJtnhle ^ \#. ,jA A U€ >4^ #v
‘ **"»ÄJiT
«r 59 I.Kr\rcl%x
8 S. f\ N
a^s.x AX »
0 tssrJ-Pf
mm- ■”4 ~ -
ÄlpH#+z0/ pLl x/
M:0r£jjr 4Tt7l:• »rSi 33S.l'A v:-
S
•VvIM y-Vfl*.u Pi*ä5'L
wMMx& mja
w
. w«
1 S£:^?C
~Z Itä/l
vA / i‘X'ät-I] »/ J? !.;-...5 «Jt . ■■■LicJ^teurade»1: "
V 30& s:;•>'V cy? \
i—3 A /L4
£}S^ä||"* ISfir «*:.m4.wr
X,s|,4s
?? va;KI V]ftlÄ liXy KAI
i CSS
»jut ■A
yj515«
*.■-< ,*-\'/4v. s ; vv -s-A\ \ *
,e <A*V* 4,,^'v v
.' VJÄV^,"
S>»>
!S1.• f k/ 4641 |;i 1» feld4 ¥ ffm mmK; .UM
f v7-fs
.^•HiS^^PÄsrS ^
it
M^MKäÄ®l4,
l^ll
1 4s»•■ y
fN .-»A \ -/> -
fer/A;bloyer
xü? ■i s«./ l'
.M»llpÄir
Ü» ^
ü
JiT-I Ai* .vS'>\V
jWI
1Ä-‘i
f 1
/ /Af#A'
WKNPmmmlÄ v // CS+-\,-i. >Väi!% Ml A
l‘x0~x:/'ipjrel**rfu a "yf :!:•,■ ii 77 A
1140:j5Wj
'yfT’vTw
‘yV X 141 U'RfMi
JfNS !**"n V..
‘XC#- il-A^
\ 55
11Dio- )
fK (Lp p r '({/,' m
wMm
&9%y''>-.Von.\xCildr*'x - lpirs*fl
A 4;
. kxV&M
T^ffm.BCrP.txJJ 4 ao^X '■-
-
• ’i : ’ } x4v ^ 4*
' AVAL*:£W>
V-, A \.4 \x% •y.X'-KXT CK. 7 /» ^AVaAVi 1Uix V 2? m * XV /Vv \mi Kl.YXcthxX ■ ->'tr Alfp Tf,
at« #4»
M/MmMmmtsx:
S HcrpiJ/N ' XS -, ■ '*'jRT}v .
«T
V/ £^m . • •, '• ': * | ■ /IvX *^v‘ r«
C:«|
sesflfe# ’ *Ä
^ XiV.' i>v
^VSCrv/ /mz*xA
.; t Vt:•X \ »xV Vitm rn> J Jr 1Kirkfdi / .f
X .«-
.x.c\ y jsXJ
X- }'»0 rtWeö-r,Ch/nhtTUL» ;*• ■; 48x ■■■!■■
a
®X
A\ 98
HÜ8StXt* Maltersdorfcr i ScJidfcrct?«7
CTfi•y ; y 1
X*. SK?\ V ,4 L;i_v\J r
Ä SS iVAd.n:
|PBygASl
»MiTOl^JNHili
fl SSI
'JtA>
TWWfflk / \ x.Jx1 / 2 V«&\ ■• ßUtrm.X Pl' Ä
Sllf-, , . „„. r | ii .&XX. xx mm
X- -.«1 Xxjßixk’ ü“ 'i'iV1 V/ T°THlf. ,
K:\•'-Kt S <x1
ral(ers4lorfX
V T-|^
^ȟsS aajfe^ifeki
«&Ä»pI§f7 ,
;V
Diepensee;w Fsfö »Vassu^ums
jsSii^^Ss,ri:X* nusm3B-.'"•^>eeV r ■ SS
:4 KX4 ./rWt.,rVH77 1/, ,t.c /»/' hJ <HRiuVX X’-SC--.. 7 ü.!1 V'"*1 4fefflw yXX; I* 'V* cvl/£y.ßX... ■ Ai■
xs<*ItOPVw4 <.jp MAXsX'"^Ä7^px
•v Tv/Mm
* vfe
f.1,S.#" n. yt SSü* H7/ o¥7 Ui-
\'T ^ V. • itJUn.k ItVw ^rs.1' * v^ -v: wx'X• j > €1X xxVx
st?. i/rw&mj
UV •:Vm^^Xp’XX/'P'CjX^^X iWJ»* Äv,i‘s?■*i•' *Q:! \* C
mkA»<T‘* i.
f4>- X v.eV K /Uf* \>J |\\XX l.-vij uV7X'cr£spi
Ü'Cü* BHV17*„j j
V:xsf'-X.M. „«AMlJ.. # khf.'/hl .'»*? X • y SchulzeV\X iXX »f1 1. X-/ X
..1L.A.A .■ VA X
*X'f3
Lith.Anst. v. Bogdan Gisevius .Berlin W. L1nkirtr.29.
Bemerkung: Die öffentL Häfen, sind, mit stehender Schrift bezeichnet. » Pr brat- Häfen »
Marsstab 1: 50 000. Bemerkung: Die rot punktierten Linien sbixi.projektierte Giiteranschlußgleise." liegender 600 Wilmersdorf-Berlin 1905.HAVESTADT & CONTAG
Königl. Bauräte.
7000 30002000;n.. - kooo $000 6000 7000 6000 9000 70000 m
TELTOW- KANAL, Lageplan.
i
4
mm%V
H«a*mu •■mk
i-.
1k
m
wm%m
wm
WB.4.
W
£i«^5J»r^=
«RHi«4
II)
«■»» e
fcV
.»# •:' /
f.-.
SA'.r
0 yG
om\re
• ■■.-■
;
y
*
4:
<V 7bA
%
V---
•A*'
+ 36,00 +36,00
Der
5;'S'S§1<9
ö'S33«.Q
+ 38,26
—
Buckow
+36,66+ 38J5
+37,61
Y
•:■8«3
■•s•nTI§ c
•4 ■nI b8 5
•!3 s£1«c £:-- ♦ 3 9, bO+38,70 +38,5*+ +38,87+ 38,27
Soül-V IIr.+ 32,30V+32.
=ADer große Wannsee
H. W+3Q,5‘+N. W. + 2», 37
- ■ ■ -Ll—1. -112
kleine Wannsee
V,
f^r«00,00
“ == pV
IT-
0)EQ
s<nw<p/—
inJSotß• rH
Tic
H.W.*33,Q6i
Verbin dungslinie
Britz - Kanne.i] -Ai
-o Kan tohle + 29,70+—^^i+wrp•9 8!§ «s-u-ss .* ( :orst)KanneilRixdorf
s>. Cöllnistfche HeideCölln.Heide
Prinz
Friedrich Leopold-Griebnitz-Slee
ff.Hl* 30,56 j
JX.W.6 28,97 !Kanal. + -f>',,7
+38,2 7
3 ritz
Maßstab für die Längen 1: 50 000.12 3 5 km.0,5 O1
TT5 Oto IO 20 +30 *tO 50 m,
Maßstab für die Höhen 1: 500.
30a28a 29a 31aWilmersdorf-Berlin 1905.
HAVESTADT & CONTAG
Koni gl. Baurätejv lOOOm
Kanal-Quer schnitte der Spreehaltung ln sandigem, standfahigen Gelände
In sumpfigem Gelände
■ii»bei teuerem Grunderwerb bezw. Liefen Einschnitten.
bei billigem Grunderwerbfür die ersten Ausführungen. &für die späteren Ausführungen.
>£<+36,0+
v'iH. Hijt 33,06 N. W.^ligo
Ijl ü. Hij +33,06
jX. W.+32.30 ’aucs teuujrutM , '.ren
KaUcspdjij^^F^fii
alle 0,30 m, einPfalil J
SMÖasm ES <Tu55KaUcstdpignU*, alfab,
! l2’°°K
*bi,30jJ.*A&b.jaL ein Ifahl ,30,20 9,33 m. ein PTaKl
6,28 !
If-üMr 1:20 —_
10,00
Ym &nPfaTtl |- ---^ '10,00 ! ^ "
\aJle 1 -2m.
10,00s,+o i, 2>°° j i,2 00*10,00 ■<— 3’°7 JL Ui___ *♦£.___I.■+ „ ,33°17,2016,253+17,0026,20
22,68 18,835 jT•?oo —-1
1.**% * :
Kanal - Querschnitte der Havelhaltung fg, Lichtes Profil der Brüchen ftejr Kohlhasenbrück M.
+31,5++ 31,5Vfür die Ausführungen unterhalb km 5,1. +6, + 31,5+ A
X’M ifür die Ausführungen oberhalb hm 5,1. rjiff. Ul j 30, 56
M.W,yio,5i:yr.w.\28.37
Jiä & Tl.W. +30,66I1— iBctbnpi+30,05- K
M.W. +29.56 diudkstangrulki 97 Ir^. - KcilkstrinanitT.SM f ZirtjeUhichschichlStülpvkvuf
, ^*ZJ,77 ]
alle, 0,33 fn, ah. PfhlüY '
7 * 20,07 _—----—----------fo.oö
* 26,97
+ tS,*llff'mmyrrn10,00
alle 0,33 m ein Pfii/ii•J*°L 6,20 *•k 2,00 5,56 J°M 6,60 6.*,006,60 SS6JA°i* -.1»__ ^ ...6,20 _I 10,60gjw------t:21,9*+ .21,96 .16,9S5_
.. Kanalsohle +.......
V
Alt-udow
Höhenplan
Verbindungslinie Britz-Kanne
Teltow-KanalsDESNEBST DER
SOWIE DES
Prinz Friedrich Leopold-Kanals.
0 1 32
Lith. Anst.v.Bogdan Gisevius,Berlin W. Linkstr 29. 300 WO300 300
Teltow-Kanal.it
?
II•SS
I«5 ä§t s sis s?si;II il!||| It§l L
%5 5§
|ä 5 S-§ A;*II Ä 51 §
I8
31i; SJ' ■'Ss's Ai1 §-2 <4I *8
il VSI ?5 £°34 'S 41 <S«■ 1 + W,95«5|la s;
:^0 :LiS + 1+0,10«5ii i 3s+ W, 40 + 1+2,70
■93 <s + i+2,33i/ + 1+7,90^rjsl?3 QJ y i+7,30 + 1+0,90+ 1+1/10,+1/1,00 + 10,20^+i+0,7o\ + •+0,70+ 1+0,60+ +0, 796' +1/0,70+ it0,60+ 1+0,33 (V+ 1+0,25^3 P? %
+39,+0+ 39,95 Teltower See +38,77■ 39,01+38,76++ 38,3++38.2
+37,1+1 +y 35,71
+ 37,3+ 38,6+35,95 , +35,32„+35,20+35,11
55++33,>+0
v+32,30Griebnitz- See^4 3Q,56^P N---
„*32,30:„*32,85
Aif A 8TT...I% /hxH.W. * 30,56 Ka nuLsohle *29,70SR II* Tis-9*28,60 f Iv + 28,1 7UtZjtZJ -OL---N.VX* 28,07 TTm :
Pc5 rb ^
—iH = mii
öS ^Kajudso hie * 26,475=SSiST=r-ggSrsür-ajgi CJi
* >: 1— i II- ~Cf (S- «■ flll| lll 8£|
25T--Kl. Glienicke
Babe Isberg
1I TempelhofMariendorfLankwitzGroß-Lieh :erfeldeSchönow
Teltow4 4
Klein-Matfh now Stahnsdorf
iPotsdam Fortet Potsdaai z21StolpeI«
•1
S iS 1■r.i8I N1=I—I 3 5 ttü - > «i
1 > +%o 9kK *1 n5? 5 £* «3Gcläiidehöhe'S
Ssch----> l schif/iej• 3 oi ler '+ sehiffig Ai K +Horizontale t ALE
2720 2625100 23 2421 223 1917 181613 14 158 9 11 1274 5 62130 3735 363433323129
3 bm: 6 j d>‘f schilfig. i44444I4
1___ frooo\ _I lOOOm. J faLj
/woo\{woo\ ^N (woo\(loool l6O015Qo\600m J
600m1500 m.900 mlOOOlVlOOOm lOOOm 800m \^15QoJ\1000ni 1500 m\^OOQmJ^yooniy■^ooj \mooJ "^ooejlOOOm, 800yioooj 900m
Stolpe
0l<$■
niQO
'L 33piij{.f-fr9.upp,[ Ch
.-Bn S
lolp
e-Ba
belsb
erg
10,0
0m
"AjßM
(h Yi
bejie
uila
^sX
gußa
&H
o/u'
O.ß
Oni
d\*
3212
0
Stöl
pche
n - S
ee
CA.-B
n Köp
enic
k - G
riina
u 10,
00 m
J3r. G
örlit
z er E
isenb
ahn 2
p lei
s. Ü
berb
au
ChrB
r. Ad
lagc
stell 1
1,00
m
Die
Spre
e
Br K
öpen
ieke
r Lan
dstra
ße 2
0,00
m
Br Iü
efho
lzstra
ße Pt
OO nt
t Br.
Bcai
msd
aden
straß
c 10,
00 m
■co Br.
Brit
zer A
llee 1
6,00
m
FeLd
wenb
riiek
e, 11
,00m
%+ Br K
önig
straß
e 16,
50 m
? Ch: B
r. Ad
lers
hof-A
lt G
lieni
cke 16
,00
>
Tonr
ohr 0
.3G
raba
4llI
I Grü
nkn
i 33,7 I
M
c4
Q3
-
AdU
Lash
of36
,7 1___
___
cC:
O
4
i r
36.7
|Al
t Glie
nick
e
-1 .-1 CO
o
A\F
orst
-Haf
en-n
gußc
i.i.B
ohr0,
80ij|*4
Ch.-B
n Bud
ow-A
dlei
'slwf
0,00
m
iCA
.-Bn J
ohai
viist
hal -
Rudo
w 11
,00i
n
Rohr
0,3
0mp
^ . fl;1 u
Gi •a
haie
iidaß
M Jl|+32
po
ffuße
is.Ro
hr O
.GO
m p
Bv S
päth
straß
e IfyO
Om
,-t. *\28,ii0
36 6
366
32,9
e-!
Che
J.A 'ie
dcö’S
chön
eH’eu
le -
fiep L
owe-
363
36,3
‘ ö
36,6
Rüde
\rv
368
36,3
jvißsuiimnop
-MÖ
prm27
,6
o-OCfloL
l-
r\>—
Br. H
iidow
ci'S
traße
Z6.0
Om
Br C
Aaus
sees
traßc
Biic
lxow
-Rix
cwrf 1
5,00
m
Rohr
1,50
m <
£
naiuiltsalio
TLS -Düker.
Sir?
-Br?
Rix
dorf'
-Mam
mdo
n' 1
0,00
m
43,s
Tem
plh
oPBr
Ber
linej
'stra
ße 2
0.00
n
Br G
rimds
traßc
11,0
0 m
Stn-
Br. Sc
höne
berg
-Jfa
rim
do/f
H,0
0m
Mar
tend
orf
3gle
is. L
eben
?0,
80m
&
8 06
Bn B
erlin
-Anh
alle
r Eise
nbah
n A gl
eis.
Ueb
erb.
. 29
Z
Gas
-Bii]
cer,7
*. R
ohr lO
O itb
p/A
Bn L
ouise
nstra
ße 15
,00m
Roh
r OßO
m y'
aBr
Birk
busc
hstra
ße 13
,00 m
ove
Steq
lMz
36,4
Br P
arks
traße
13,0
0 m
Br B
ekes
U'a
ße 13
,00m
.
Br. G
iese
nsdo
rrer
Stra
ße 15
,0O
m
Gro
ßLi
chte
rfeld
r
Br A
rmen
haus
wen 7
,00 m
Rohr
0,8
0 m. S
Kaiu
ilisa
tions
- Diu
ter,
Rohr
i/OO
nv <*
Telto
w er
Eni
wcL
sser
uMEi
nlaß
der
Stn-
Br. T
cLto
w-D
ahle
m 10
,00n
i35
,5
Ch.-B
r. Te
ltow-
Zehl
endo
rf 16
,00m
Schö
now
er Se
e
Gra
bene
inla
ß, R
olu»
Og+
Om
S
35,4
Br M
iileb
nühl
emve
g 7,0
0
Rüh
r 1,0
0 m
&
Mac
hno w
er Se
e
Sohl
e +
29.6
0”
30,4
31,7
30,5
Br. S
tülp
e -Al
brec
htste
erof
at 7,0
Om
2 gle
is.U
eber
bau.
37,5
Br B
erlin
-Mag
debu
rger
Sta
mni
balu
iC
h.-B
r. ßf
euen
dorT
- Sto
lpe
11,0
0 m
Gra
bene
inlä
sse
OßO
J?Tb
rwoh
rcer
bau
ChrB
r:Ill
ein G
lieni
cke -
Xeiie
ndor
r 10,
00m
Tonr
ohre
Park
briic
ke 5,
00 ni
Glie
nick
er La
ke
T
360
■
£h- \B
ritz\
M
28,6
E
O)Q_
Doppelschleuse bei Klein Machnow.
Oberhaupt. T I.Küche1ft EXZirrv.Zins.
Uo.Ä.E — <□ —> ZimmerGast - MeüSc^vCT- ■+•----- □ Schlafraum, der terv-
Schleusenknechte, \ - nf□Dienst-l ‘"Cs ^5.
Zirm.s; Zük,. Zinv.fr
• ♦31,90Vor-TT '.ffSüffel
Zimmer raum
Grundriß des Erdgeschosses.□Sä-Ef§|( □X +34P>4
P +~——-_1 TN «. -□ex-. Diele. V-
-i Kx-xxxCK 5*lamervI\s£vf
II -SkH Jffl,04 i7: SO Aufsicht. ±Bf2*ZSdI:kl + \32,8Q Bf+32,80 X-idi-L >4s \ / ügpfc*JYarrn . JV. + 32,30 IX ISteinschüibmgil 32^r -
Vorhalle. starke■irj I -I o 50 am.+30/I♦ SfP^:X__ !?£?—.__ L— sfo
ITm^Äiii 1|11|| !: _ Xr>/ D 1j]V>■ R t;»Xd : 4: 1-Hl + 20,0071EJ1. u ul lM>+ 32,80K + 31,54 t IV: c iH|•. + 26,47
1fl Vorhafen derSchnitt a-b. . ho^es Stei ^
auf Fasch ine lunierlagg
so cm,
Vorhafen; der yV ■r' 7,10 ttfi -r- ___________ ' 71,50r;-:h]- ]-; HV 1 fl J it
^osc/iz7ienitfi6e7*>
iBrii'i-
}f#*+20,00lägehohes Steinpf las tet? auf
il t; 1 >y x Br „f k ■" El
y il , 1 ®j f ft f
4ö am hflV H %
i:j S s * flü- 'i; rtW il N -l-fnl,J ~1TTtSiIIW »
l hn '+20,00r^n 1 I"PT
s’■ + 32,80 opllllllllllj 1 © oo iwick?c
P'ü M1!/2?!iJt-s\
: : |— 102
fll- ! 1 {t ; ; ■r1 ■’V i^{yjt L Dinsteige- ■Schleiisner-'{-■
„„1 14-i -1 f---■u -f-H- nlsthe*4 *ihpö \ >1■p-," Budeu schachtN»! ÜJ ii i_JL<m ffflA•A-i;-f jn •i-M U-_JSJspfi};:'
J; Od Pit tSt ick - -O^3.&'4fm©oo—. o + 32,80i’i.—Jii—tu ? T1L LlH■ J^_i -flII. HU jo,.7', i];l- HWlml M441*1
. \m! ‘4
'4 1;|ropo t■1t fl,'Mm mk 1 Ii iji1
¥0< i.n*Z6,*7-§!------ _____________+*£*21_________ 1t Spreehai liingm 4 i uIlavellialtunP siI
+ 29,0 0.4 im?1::-t flf!m W? ¥: 1- Ll,
i*2S/,71,I |Ki,+ J2,80\ i *ar,s*\ 1 ,I n nl i H
o
1 ipmSchnitt c-d. ♦ 29,001 r •fl iJ:i 1-tv-K6,00 j1r6S^S012 + 32,80+ 32,80 JV°rm.W. + 32,30 I r j mm•f:
mmiImk
; t5Pl^! T1- , duMW. +! 20, se'f>ei - s I Ä■ E:i-m 1 __________ Boot übersahI ES♦ 26,47I
8iüfit
\
j*l rn j_ 1. i 1 ^ 11 11 ’ 1 1 1 1 ,i ii|0 Xli -VLrL|l 1 f
EMilÄflllllllr; oIdsasäs 1:400.--& m ;"X-30 771//4?/<?Sy? '^TffrPrV -.>,x
'K'//S *« ^u i |%Wm.S □?oj
+ X’«/77dg
0—-
JW-II«f CT">e Lageplan.<x.
V.rrrrrrrA- ?'V, +35,70
L? TnTTHJTrfTT \e;-j m TTMMI!rtTTTT 1111M! ITH H11ITTIII f I fT)
/miiiiHiiiTriTniiiimmiHiiiiiiiiiiiiiiii!ii?ifiiiimiimnMmiiiiiimmiiiilllmmMm'ilMiiiimiimiiimlliiimmMij7|v>l/._ * — IIIIIgIIIIg^^IflSIin]ITTTTTTT11lllll|^<111 nnHimmillilllHiimliiiiiiliiiMimiiiiiiiiifiiiiiiiiiimiiiiiimiiiiiiiiimiiiiiiiiiniiiimmHTnmTiifiiiiiniiHmiiiiiimTTTTTTTTTT___________________________________________ _______ +_2G,97__
,W- A
___ _____ L -•*&*_______ Machn ow-5^\x
-*zäpT"il + 32,80 + 32,80 ___+3000______________________
Be--ql ~—-^lP£g_ ^is,oo ^JO,oo< 69,OO ,36,30Jd|-;^---40,0013,00 ap
i "g—<L.
"7
%
See8,8"d—v. ✓r -8cä7__________-8d6________«ö5_-4- ___ ir~Sb 1? ------------J----- -oEir^iipE Ohere CSpre e -) Haitun g-------------- 1------------1» 132,80 ,V°e
«'V<--------------- >NS+2%oo5N d-> slSi *30,00
i » rx '“fl2 s?El 111 n 1 illiili 1 ii 1111111 lilil iiiiiiiiillii//l li i j f/ri j 11 i|tt+32,80 Ns+ ZGa97 -V* Ex 4 ai ______\
f|Ü|V "A
•-EUo 0 6ö
I +30,00IISic &h mmmmmunmmnnmmmimmnm
+31,54 ;.v..- ATS i + 33,30+35,80
+33,30c& Lk Xösch - utld LadeplatzX/ f irtjri - /,jE
Eii
/. *33,30m m Wilmersdorf-Berlin 1905.HAVESTADT X CONTAG
Königl. Bauräte.
M 'JJJJJM Bv'lsyter Jp 1: 2000.\ - Ä:,islft
oa-cDeeg
W O 10 20 30 40 50 60 70 SO .90 rOOLuluul
200rrty;Lith. Anst.v.Bogdan Gisevius, Berlin W. Linkstn 29.
05
TT
TT
Teltow- Kanal.
i
räume
Q
äi"‘67,00
■F5,
19“
il
I
v\x
msiiiiiiinm
iisimMiiifip
ioi
rm pH rm\ SriV \fß
v,v i ~x~ ,s \ v i*5 ,—,Ci HS^ j s— ^ c* wc'\ j ■JH| % s£38^X
:-feSStsäWß
m m-v
s pwgf m. Ä1Hui.» c-
5 »V
wai■fc*BIN » äct^öüp
Äfe" ,
feSfi»ÄÄifSfiSra
;iW3 wa i 1 4 ■$;■CWivlm l'fp§ y#-....
1% ^üg? rf>-BlP^a jpy** V~vgi
r* S&F* y.‘jp*v ■
ö
H /Mrjäff
IC fl
Jd HKC y pp*
* v.r;'V
^stehjagMlfr % $s-
■■■<
,.,AkVSt
E.'5 flEL-a^-:jfeö*« =“
■
« I \25i sST***Ü 51 Tj$w’Tmk w,■'■
iiBi /i 'imm &PyV A n H .;;•
mmlil;s» ■ -
wi£
äfe’ aWlMIMSPJ
y sas:r ty
:f® $il®i m’A:ipISif
—. t 'L^-V^n- <ttAik
i , H9 1 s.gal !‘c1v
SJ WS^SM v pqtittaB’. v .:?**&*$
n>;_iS !%■. ' &}*igf
Jp3»3KM-J IfS '0\m9 t %mwf@ WJs TOi_
5^-8-f p=g==
^■dBS£S<iEfemI jawrTB
. jrWi \
» R »I -r#WP^JI,r M;.r !JTL«mmr~\ AK ""—'n' "....
va _-rv: :5\
- >• XM mr* T’S*’
I V r :J?
.
r»Mto’ I mm*ES • .: ~ -
i«//A‘XA-nJ/
k'v
{Us-\ s^fflß*?«^S^^sa9SSS :^
Sft . -- ■ mp pjjg
i ...■ "fÄj tf
/^SSsgKmoj iiiKu.
V ^4* s*' i*c ISr.1 STj F*ä?
IrafeRE ? Hif'ls*S 0 7y mmAy ,V
%ff Iwt:
Mwpi,
JÜ?r: ^.,..'':*'’'"':>"',J./;
US / , vlflHk V> ^ .;■¥. ygagSIpj
(/% i^,Ü x.'si ii\ *■'.
‘ y; Hd* 1TViv> yy y&< m>^yy J^3t93F
m&f
lityfiB*@
Mj^fPEx 591"a
m——~=w j
^Ä1jllyk
EL.%•ik IwJ
rtja^SÄ-,' ^ Li« . ÄsSfcV-ji , atSj»!
vf /\g '/-^r*/ PM*rjs.r■'
-■TWS <:S:■ii u mjt?
iUäs^'d y»vv UM»'•i/i
@@@
yfc:y"/ -.v^;Q}.\Jr£w'
.vV
BK
WM
mm
m
@0®
PF5 1
SSrtf
fl
6 .TEa
x__
Im"2 mmm yn / i .. ..r.--5£2; ■ "’ 5y =§== £?/
mf ■ «I£
P,nwjum?■. ■ j
’yf=s»*£"\
i. { V1I^£M
rm*UtI S=gigaaA^Tir
SSI ET~-- -J =
?w>
gfplf==:sAViZ. - '■.?
V *=3mym %Ir?=»v\
—3V* ‘ ■fl /#\ rt3*//£yJI sss EM USpfcfJpffSHSfll - S
;.*c
^~fff %Ma
fty ^jgp^SfeJlSKr8*®^
Ä&fc-7', 'X. -Mrr ■®f ••
‘Xj> S. y“al 1■1 l"4
5 *2 ^4vi« sösiSV\V"KaiKU\* llilffiiÖiö'g -s
|KBj »**•*!>g mm
> * * -V— :^v • ( ‘
•• wiJü :I1 /yy
:§f§,Hü»iS?
t9k*B| . ;*1»Skf « % ..
gsä11
mäi M Wmm L/i1 ■>5WimmiVIMMl
ßSB^Sw^te^Nar ^ -*
s/' d*11.. paVßV, -M
\ jvAps§j
,$•#»,ÜSfi■■y.y-j
*& feil!:.;^rjtscbl m U3hfl‘flliil 1! 1§§EP■■HP
\[J&KW ' ' -^k£^y-: m
_ «'.Ä’iÄsi^mmm+i * ä ■ Bwn?: m Üa
riS :S&P3"i»«fÄ «?-giÄIMi# «: MMMA■ ?; 1%ßmTOr'
IV ■ ■ Mi 4tfSf***&= y-
,.fl»
K■; I: w3m* P£\ZrzzE^mi3t\ —HW MP» /j 8
llHl
. ■M pj==a
yj,'. .\1 Kv V
II:'x^. f^HÜB S^rs>:r ‘- 2>
V\ .<•1 jj|jjp§tä %m ■ kVSeil m■MaS/i ■U ’ rU / Kv-. t: yyi:^s=mw==^=srmn--
mi V'lII,<IX?
riB3B3 m'i
WX
mm
rö;
ii
Im
o®
mm
+
BT'
f.»«
Ss’V: , r-r
34
Mi
O
■HBy
I ■14
1
■