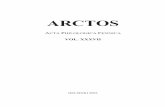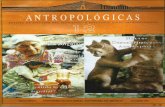1994 Supplementa Epigraphica Pannonica
Transcript of 1994 Supplementa Epigraphica Pannonica
SPECIMINA NOVA UNIVERSITATIS QUINQUEECCLESIENSIS 1994
ISTV AN TOTH:
SUPPLEMENTA EPIGRAPHICA PANNONICA
1. Teil: Savaria 1. Abschnitt: Die Steininschriften
c Vor fünf und zwanzig Jahren ist der erste Band des neuen ungarischen
Inschriftencorpus - Die römischen Inschriften Ungarns = RIU -erschienen. Dieser Band enthält insgesamt 284 Inschriften, unter ihnen 160 Stücke aus Savaria und seiner Umgebung. Seit 1972 sind mehrere Rezensionen über diesen Band und darüber hinaus weitere Ergänzungen zur Sammlung in verschiedenen Zeitschriften erschienen. Wir haben hier die in den Rezensionen eröffentlichten neuen Lesungen und Ergänzungen zusammengesammelt und auch jene Inschriften zusammengestellt, die entweder aus der RIU ausgeblieben worden waren, oder seit 1972 zu publiziert oder zum Vorschein gekommen wurden. Hier soll ich meinen besten Dank den Kollegen M. MEDGYES und V. CSERMENYI ausdrücken, die mir die tinpublizierten Inschriften durchgelassen haben. Ebenso soll ich E. T6TH einen freundlicen Dank sagen, der er mir ebenfalls seine Handschrifte zur Verfügung gestellt hat, wie er mir auch mit der Durchlesung dieser Arbeit wertvolle Hilfe geleistet hat.
Bei der Zusammenstellung der hier folgenden Sammlung habe ich ebenso wie die Autoren der RIU 1. - L. BARK6cZI und A. M6CSY - nur die Steininschriften beachtet. Die weiteren, auf nicht steinernem Material geschriebenen Inschriften dürfen das Thema einer anderen Mitteilung bilden.
* * *
A.I In der RIU nicht veröffentlichte Inschriften
1.1 Szombathely, beim Bau des neuen Rathauses, Ecke der Bejczy u. und Thököly u., aus einer Grube, 1974. Ausgrabung von M. MEDGYES. - SM Tafel aus gelblichem Marmor, oben profilierter Rahmen, rundherum gebrochen. Sehr schöne Buchstaben, mit gut erhaltener roten Färbung.
H 65, B 48, D 8-9, Bh 6,5 - 6 cm.
J. T6TH, Savaria 17-18 (1983-83) l39 ff; DERS., Specimina Nova 1986.41. ff. - Bu6cz T., Lapidarium - Savaria Muzeum. Szombathely 1994. 35. Nr. 45.
3
~GENIO'VIcr :HANAZIBO :CEN O~CIVI .
~ TlS~CAESER y Aß r ON
Nr. 2 - Nach I. T6th, IDT
:-x:c V IT~I r:IA 'lEG
. \LM \J 0 1ft:
Cos
Nr. 3 - Nach I. T6TH, IDT
5
[I(ovi) o(ptimo) m(aximo) Depujlsori [pro salute I Savariejnsium po[rticum cum I ?exedrja quam L(ucius) O[ctavius M(arci) j(ilius) I Faustijnianus de[c(urio) c(oloniae) C(laudiae) Savar(iensium) praej(ectus) oder patr(ollus) I coll(egii) jabr(um)j · centon(ariorum) [?aediliciusill vir i(ure) d(icundo) II vir q(uin)1q(uennalis) fl[amen coloniaejl----.
Vgl. RH! 71 = hier unten Nr. 54. Über L. Octavius Faustinianus s. neurdings J. FITZ, Pannonok evszazada. Budapest,1982. 31. Witere Literatur TOTH, a. a. O.
Die folgenden vier Inschriften sind i. J. 1967 auf gleichen Ort zum vorschein gekommen. Der Fundort - Szombathely, Rak6czi u. 14. - ist ein Gebäudekomplex dem IsisHeiligtum gegenüber, auf der Ostseite der großen römerzeitlichen Straße (aller wahrscheinlichkeit nach der Bernsteinstraße). Von dem gleichen Ort stammt der Iuppiter Dolichenus gewidmeter, seit 1928 bekannte Benefiziaraltar (RIU 11). So vermuteten der Ausgraber selbst wie auch Andere ein Iuppiter Dolichenus Heiligtum an dieser Stelle, während A. MOCSY diese Annahme verwies. Die vielmals erörterten Inschriften, welche größtenteils akephale sind, teilen wir in einer zusammenhängenden Gruppe mit: Nr. 2 - 5.
2./ Fundort: angebliches Dolichenum. - SM Stark beschädigter Altar aus krönigem Kalkstein. Der Abacus und die Stirnkante sind getrennt, es fehlt auch der untere TeiL An heiden Seiten Reliefverzierung, rechts eine Flügelschlange, links vielleicht dieselbe, fast völlig vernichtet.
H 44, B 40, D 33
T. SZENTLELEKY 397 f. Nr. 1- . I. TOTH (1971) 80 f. Nr. 1. - K. B. ANGYAL - L. BALLA, Acta Class. 8 (1972) 93. Anm. 31 . - A. MOCSY, Acta Arch. 25 (1973) 395. ~ K. B. ANGYAL - L. BALLA, DME 1972 [1974] . 168. Anrn. 31. - L. BALLA, Festschr. B. Gunda 485. - L. BALLA - Z. FARKAS 473. - I. TOTH, Acta Arch. 28 (1976) 93 ff. -DERS., Alba Regia 15 (1976) 97. Anm. 55 - DERS., IDT 96. Nr. 2. Ebd. 115. - DERS., Acta Class. 13 (1977) 67. Nr. 2 - A. MOCSY, Acta Arch. 29 (1977) 395. - DERS., Ant. Tan. 24 (1977) 250.
[- - - - -j I et Genio vici I Chanazibo I et Genio civil[tjatis Caeser(ensium) (siel) I [Gerjm(aniciensium) Fab(ius) Lonl[ginus ejx I [visu? oder iussu dei? ---j.
1: bei SZENTLELEKY fehlt. [I(ovi) o(ptimo) m(aximo) D(olicheno) oder Dol(ichene)jl. TOTH (1971) und in den weiteren Werken. [ - - - - -] MOCSY.
2: L(oco) SZENTLELEKY, et TOTH, BALLA, ANGYAL-BALLA, BALLA-FARKAS.
4/3: civiltatis SZENTLELEKY, civil[tjatis TOTH u. A.
5/6: M(arcus) Fabi(us) On(esphorus) SZENTLELEKY, [Gerjm(aniciensium) Fabi(us) Ord[- -j TOTH (1971). Fab(ius) Ionl[- - -j BALLA-FARKAS, TOTH. Acta Class., DERS., IDT., Fab(ius) Lonl[-gus, -ginusj etc. TOTH, ebd.
7: bei SZENTLELEKY, BALLA und BALLA-FARKAS fehlt.
6
3./ Fundort: angebliches Dolichenum. - SM. Stark beschädigter Altar aus grobkrönigem Kalkstein. Die Inschrift ist auf drei Seiten mangelhaft. Die Zeilen sind liniert, ind den Buchstaben Spuren roter Farbe.
H 44, B 36, D 24
T. SZENTLELEKY, 55 ff. Nr. 2. - 1. TOTH (1971) 81 f. Nr. 2. - K. B. ANGY AL - L. BALLA, Acta Class. 8 (1972) 93. Anm. 31. - A. MOCSY, Acta Arch. 25 (1973) 395. Anm. 308. - K.B. ANGYAL-L. BALLA DME 1972. [1974] 168. Anm. 31. - L. BALLA, Festschr. B. Gunda 485 - L. BALLA - Z. FARKAS 437. - I. TOTH, Alba Regia 15 (1976) 97. Anm. 55. - DERS., IDT 97. Nr. 3. - DERS., Acta Class 13 (1977) 68 f. Nr. 3. - A. MOCSY, Acta Arch. 29 (1977) 395.
[- - - - - 1- - - - -] 1 [civ]es [Surus] 1 ex c[i]vitate 1 [Seleu]cia Ze(u)g(ma?) 1 [v.] s. l. m. 1[- --]no et 1 [- - -] co(n)s(ulibus).
1: [I(ovi) o(ptimo) m(aximo) D(olicheno)] abgeschlagen, TOTH.
2: [- - - civ?]es BALLA-FARKAS.
3: ex civitate SZENTLELEKY.
4: (centurio) leg(ionis) mit 7 + L Ligatur M6CSY. Dagegen TOTH Acta Class. und IDT zeigt auf den Wiederspruch zwischen dem [civ]es ... ex c[i]vitate und den militärischen Rangstufe.
5: v. s. I. m. SZENTLELEKY.
6: ... no let SZENTLELEKY, T6TH, (1971), ... no II (?) et BALLA-FARKAS, T6TH, Acta Class, und IDT.
4./ Fundort: angebliches Dolichenum. - SM. Bruchstück eines weißen Marmoraltars. SZENTLELEKY, 383. - I. T6TH (1971) 82. Nr. 3. - L. BALLA - Z. FARKAS, 437. - 1. TOTH, Acta Class. 13 (1977) 70. Nr. 5. - DERS., IDT 99. Nr. 5.
I(ovi) o(ptimo) [m(aximo) - - -] 1 LO - - -.
1/2: I(ovi) o(ptimo) [m(aximo) Dojllo[cheno] - - - - -. TOTH.
5./ Fundort: angebliches Dolichenum. - SM. Bruchstück vom Rande einer großen Schüssel aus weißem Marmor.
H 22, D 25
SZENTLELEKY, 383. - I. T6TH (1971) 83. Nr. 4. - L. BALLA - Z. FARKAS, 437 - I. TOTH, Acta Gass. 13 (1977) 70. Nr. 6. - DERS., IDT 99. NR. 6.
7
J( ovi) o(ptimo) m( aximo) - - - - -.
1: J(ovi) o(ptimo) m(aximo) [D(olicheno)j. T6TH
6./ Szombathely, Bajcsy-Zsilinszky u. 4., neben dem Gebäude des ehemaligen Palace-Hotels, 1954, aus einem römischen Brunnen. Ausgrabung von E. TÜRR. - SM. Bruchstück einer großen Basis, am oberen Rand profiliertes Gesims. Nach E. T6TH, Arch. Ert. 98 (1971) 164. kann die Inschrift mit der großen (160 x 160 x 200 cm), mit weißen Marmor. bedeckten, und auf gleichem Ort zum Vorschein gekommenen, Statuenbasis zusammenhängen, neben der auch die Bruchstücke einer großen Statue gefunden worden sind.
H 88, B 78, D 37
E. TÜRR, Arch. Ert 82 (1955) 98. - T. P. BUOCZ, Savaria topognifilija. Szombathely o. 1. [= 1968] 24., 41. - L T6TH, Arch. Ert. 100 (1973) 255. NI. 3-5. - DERS., Acta Arch. 26 (1974) 164. Nr. 3-5. - L. BALLA-Z. FARKAS, 436.
[- - - - -] col(onia) Clau(dia) Sa[varia] sac [ - - -j.
7./ Sxombathely. Verschollen? N. FETTICH, Az Orwigos Magyar Regeszeti Tarsulat Evkönyve 1 (1920-1922) [1923] 63. Anrn. 15. - Arch.-ep. Mitt. ' 16 (1893) 30. - Ephem. Ep. IV, 496.
[- - - - -] dd(ominorum) nn(ostrorum) Augg(ustorum) [- - - - -j.
8./ Der Fundort ist nach dem handschriftlichen Tagebuch von T . A. HORV ATH (aufbewahrt im Komitatsarchiv von Szombathely) Szombathely, Szechenyi u. 4-6. Nach E. T6TH ist dieser Fundort vielleicht mit dem des Bruchstückes RIU 120 identisch. - Kleiner Bruchstück, vielleicht Verschollen. T. P. BUOCZ, Savaria topognifiaja. Szombathely o. J. [= 1968] 80. - E. T6TH Epigr. 300.
- - -] ex voto [ - - -.
9./ Fundort ubekannt, vielleicht Szombathely. - SM. Der untere Teil eines Sandsteinaltars. Unp buliziert. - - - - -] I Bas[sus] I v. s. [I. m.]
10./ Fundort unbekannt, vielleicht Szombathely. - SM. Unterer Teil eines Kalksteinaltars. Unten die Reste des profilierten Sockels. Unpubliziert.
- - - - -] v. s. [I. m.]
11./ Szombathely, Alkotmany u. 1. (= Jardanyi Paulovics Istvan Ruinengarten). - SM. Kleiner Bruchstück einer weißen Marmortafel, oben profilierter Rahmen.
8
I. PAULOVICS, Savaria-Szomathely topognifiaja. Szombathely 1943. (Acta Savariensia 1.) 61. - I. T6TH, Arch. Ert. 100 (1973) 255. Nr. 2. - DERS., Acta Arch. 26 (1974) 164. Nr. 2. - L. BALLA-Z. FARKAS, 436.
- - -] C . H [- - -
1: C. H[erennius] - H[elvius] - H[irtius] usw. PAULOVICS.
12./ Fundort der Jardanyi Paulovics Istvan Ruinengarten in Szombathely. - SM .
. ... .. :~_.c-:--
] 0 M CAETRCI N iV5 b FE TVS . V' S . ~'.-'---=..:-.. '. ""'---::---
---:--. .. . ~--
Nr. 12 - Nach P. BUOCZ
Fünf Altare, bzw. Altaren-Bruchstücke. Die Pulbikation der Inschriften ist von T. BUOCZ zu erwarten. Neuerdins, im Jahre 1994 ist der Band 20/1/1991 des Jahrbuches Savaria erschienen, in dem S. 21. Abb. 11-12. hat BUOCZ zwei Photographien veröffentilicht, die zwei Stücke aus diesen Altare darstellen. Die Maßen der Steine blieben unbekannt.
9
a.j I(ovi) o(ptimo) m(aximo) ICaetrolnius Fe[sJ,tus I v. s. b.1 Mercu[r(io)] I sacr(um) I P(ublius) Titius Op~atus I v. s. l. m.
, 13.' Szombathely, Rak6czi u., südlich vom Iseum, unter den Wänden des sog. 'Horreum's, in sekundärer Verwendung. Ausgrabung von V. CSERMENYI. - SM. Bruchstück einer weißen Marmortafel. Die Inschrift hatte ehemals mindestens zwei, vielleicht aber mehrere Kolumnen, mit aufzählung von Namen. Die Tafel ist unten unversehrt, dort Spuren von Mörtel. Reste roter Bemahlung.
H 15,5, B 11,5, D 2,5 Bh 1 Unpubliziert.
Spalate A (links):
- - -] s I Iul[- - -]s I Marinus I Aur(elius) Iust[us] I Castor Den[- - -] I Aur(elius) Pri[scus -mus] I Marcianus I Aur(elius) Iulia[nus] I Mar[cellus, - cianus, etc.] I Aquila Sisc[ianus?] I [A]ntonius Fi[rmus ?] I [A]ur(elius) Maxi[mus] I [Au]r(elius) Cor[inthus ?].
14.1 Szombathely, Rak6czi u., aus dem sog. 'Horreum', aus sekundärer Verwendung. Ausgrabung von V. CSERMENYI. - SM. Kleiner Bruchstück aus weißem Marmor. Schöne Buchstaben.
H 6, B 12, D 1,8 Unpubliziert.
- - -] ton [- - -
15.' Fundort wie Nr. 14-15. Ausgrabung von V. CSERMENYI. - SM. Bruchstück einer weißen Marmortafel. Unten und an der linken Seite die Reste des einfach profilierten Rahmens. An der linken Seite eine größere Fläche ohne Inschrift.
H 31 , B 33, D 2 (oben) - 4 (unten), Bh 3, 2-3, 8 Unpubliziert.
- - -] I Il [ - - -] I ad[- - -] I PROC[- - -] Emeri[tus? - - -] I imp. dd [- - -].
16.' Unbekannter Fundort. - SM. Bruchstück einer Tafel aus Sandstein. Unpuliziert.
- - -] I ex pr[- - -] I Il[- - -
17.' Unbekannter Fundort. - SM: Bruchstück aus Kalkstein. Die rechte Seite ist unversehrt. Die Zeilen sind liniert. Unpubliziert.
- - - I [- - -]BM I [- - -] L?Bl.
10
18./ Fundort unbekannt. Kleiner Bruchstück aus Kalkstein. - SM. Unpubliziert.
- - - I [- - -jBM I [- - -jIA? [- - -j
19./ Fundort unbekannt, vielleicht Szombathely. - SM.
Die Stemma der Familie ist wie folg1:
i Cordius -.I Petronia X. I Veneria
Boror
M. Petronius Quintus
"'-' I uJ. i a
\
Aquilina coniun.x
Cordius ~ Xx Y. I Yy
Petronius Crispinianus filius
1 Cordius Cordia Mercator RufiniJ.la
nepoites
Nr. 19 - Nach M. MEDGYES
11
Sarkophag mit Deckel aus grobem Kalkstein. Von der Deckel nur zwei kleinere Bruchstücke vorhanden. Gut lesbare aber sehr schlecht, eingeritzte Buchstaben auf dem linken Teil der Langseite und auf dem Rand. Eventuell ein moderner Einritz? Steind. 178.
- - -] S. S. Tam[- - -], bzw.: IT
Nr. 20 - Nach T. BUOCZ
ff.
20./ Szombathely, Vörösmarty u. 3., 1970. Aus einem spätrömischen Grab in sekundärer Verwendung. Fundrettung von M. MEDGYES. - SM. Kalksteintafel. Über dem Inschriftenfeld eine größere leere Fläche. Schöne, gut gemeißelte Buchstaben. Viele Ligaturen, am Ende der 4., 6. und 7. Zeilen je ein Buchstabe auf dem profilierten Rahmen. Nach dem Namen fehlt der Platz für die Lebensalterangaben. -
Vielleicht die Tafel für eine Familienbegräbniß.
H 70, B 45, D 7
M. MEDGYES, Savaria 5-6 (1971-1972) 195
M. Petro(nius) Quin~us v(ivus) f(ecit) sibi et I Iul(iae) Aquilin(a)e I con(iugi) et Petro(nio) Crz1spiniano ji/(io) et I Petr(oniae) Veneriae Soro(ri) let Cord(io) Mercatori I et Cor(diae) Rujinill(a)e I nepti
5/6 jil(io) let MEDGYES.
21./ Szombathely, Kertesz u. 43., aus einem römischen Friedhof. Ausgrabung von T. P. Bu6cz. - SM. Bruchstück einer Grabinschrift, in dreifach gegliedertem Rahmen.
H 24, B 24 cm
L. BALLA, A Debreceni Kossuth Lajos Tudomanyegyetem Törteneti Inrezerenek Evkönyve 1 (1962) 26. - T. Bu6cz, Savaria 1 (1963) 137., 144. - L. BALLA-Z. FARKAS, 436.
[- - -] erD vet(erano)1 [- - -] et Sep[timio, - timius?] I [- - -]ji ? oder EI IVSI- - -.
1: V Bu6cz ohne die Bezechnug der Ligatur; [--- Sept(imio)? V]ero ... BALLA
3: ji[/]ius BALLA ohne Grund.
12
L(ucio) Caesio C(aii)jil(io) / Tuendo on(norum) LeI I Pelroniae Q(uinli)jil(lae) ICrispinae coniu(gi) / an (norum) VL C(aius) Caesius C(aii) f(ilius) / Vicloran(narum) /ralri / plissimo C(aius) Caesiu .. C(aii) f(ilius) / Vilulus an(nonlm) L(ucius) Caesius / C(aii) f(ilius) Optalus an(norum) el Caesia / C(aU) f(ilia ) Graeca an(norum) nepo-I(es) / avonculo / .
I L. Caesius C. f. Tuendus Petronia Q. f. Crispina
C. Caesius C. f. Vitulus
C. Caesius . . - ., I
C. Caesius C. f. Optatus
C. Caesius C. f. Victor ' Iulia Ti. f. Procula
I , Caesia C. f.
Graeca
Nr. 21 - Nach M. MEDGYES
13
22./ Fundort: Chernelhaza-Damonya, aus einem sparömischen Grab. Gefunden i. J. 1981. Fundrettung von M. MEDGYES. - SM.
Großer Grabstein aus gelblichem Marmor. Im Tympanon die Lupa Capitolina mit den Zwillingen. Die abgebrochene obere Ecken haben liegende Löwenfiguren enthalten. Auf dem Fries unterhalb des Giebels ein Hahnenkapf-Szene, beiderseits je ein Panter mit einer Beutetier. Die Inschrift zwischen zwei korinthischen Halbsäulen die von Wienranken bedeckt sind. Unter der Inschrift eine Zone mit Efeublättern. Im unteren Bildfeld eine Jagdszene mit einem Ritter, vor dem zwei Jagdhunde und ein laufender Tier (vielleicht ein junger Wildschwein) sind sichtbar. An beiden Seiten der Szene Blattverzierung. - Ein anderer Grabstein mit fast gleicher Verzierung: RlU 157. - Repceszentgyörgy, von Mitglieder gleicher Familie. H 208, B 86, D 17, Bh 6,5 - 3 cm
14
10M N \Ij M l N 1 Ave
:; LC C1LIVS·V IJ\OR AV MVNöRGCOl LEe I O·LI ßE ~TINb·K
~ . OB· üNORE·CENI KIA'D'D~
VLP
1CÄC
IVL ekel
IVL CELER. MV'T VCDRN oCT FIRMVS C7\N ROflYl'S IV L LN'IlV/5 IV L [.JRIMIo · AVR P}\RON
Nr. 22 Nach T. P. BUOCZ
M. MEDGYES, Savaria 15 (1981) [1988] 199 ff. - Bu6cz T., Lapidarium - Savaria Mlizeum. Szombathely 1994. 51. Nr. 81.
23.1 Fundort: Ostffyasszonyfa, unter dem Mörtelbeschlag der katholischen Kirche. Quadratische Kalksteinplatte, die obere und linke Seite ist beschädigt. Pie Inschrift in einfachem rand. H 98, B 53,5 D 6-3,5 Bh 5-3 cm
Bu6cz T., Savaria 11-12 (1977-78) 165 ff.
Die Inschrift ist von der 8. Zeile in zwei Spalten geteilt.
[l(ovi) o(ptimo) m(aximo) I [Nu}mini Aug(usti) I [L(ucius) Ca}ecilius Viator I [Au}g(ustalis) mun(icipii) Brig(etionensium) Coll [leg}io libertinor(um) I [ob} honore(m) centel[na}ria D(onum) d(edit) I
Spalte A:
[?Q(uintus) Ulp(ius)} Felix f- - -?L}ucius [- - -} Adiutor [ ?Caec(ilius)} Viatorianus [- - -} Germanus [Jul(ius)} Eutichas [ ?Caecilius} Viator
Spalte B:
Iul(ius) Celer M(arcus) Ant(onius) Victorin(us) Oct( avius) Firmus Catin(ius) Trofimus
Iul(ius) Lentinus Iul(ius) Primio Aur(elius) Patrion (?)
Mit dieser Inschrift werden wir im nächsten Fascikel dieser Zeitschrift uns beschäftigen.
B.I Ergänzungen zu den in der RIU eröffentlichten Inschriften
24.1 RIU 4.
I. T6TH, Acta Class. 13 (1977) 70 f. Nr. 8. - DERS., IDT 100. Nr. 8.
1/2: I(ovi) o(ptimo) m(aximo) I D(olicheno?)
25.1 RIU 6.
Die richtige Dimensionen sind:
H 78, B 38, D 19
26.1 RIU 7.
E. T6TH, Epigr. 299. Eine alte Maßangabe aufgrund von POCOCKE-MILLES (ed. KUBITSCHEK):
B 1 Fuß 9 Zoll.
16
4157 Sabariae non procnl a foro ad sinistrum aedium ordinem CLUSIUS. Ebersdorfi apud Hieron. Beck lUPP.
J'uer
laum in ttrram dtmittm3
i • 0 • M • lVI
Illc·L·M VICTOR • c C • AVITA
[) V·S·L·M·DV
OBVS'ASPRIS
COS ·IDIBVS·IVNIS
pUtT
lacem in terram dtmitteM
p. C. 212
Clusius ms. Hag .. et apud Grut. 132, 1; lupp a. 1588 p. 34 (inde Steiner n. 3553). -
3.4 VICTOREI! Cl/VITA Clus. - ldem additutrimque in lateribus cerni statuam militarem. 9
Nr. 26 - Nach RIU 9 = CIL n 4157
27./ RIU 9.
Das Denkmal ist nur in der Handschrift von Clusius auf uns geblieben. Die hier folgenden Verbesserungen möchten die mögliche Ungenauigkeiten der hadschriftlichen Abschriften korrigieren. So am Ende der 1. Z. konnte eine Ligatur IfN = Iun(oni), am Ende der 2. z. aber eine Ligation der Buchstaben CLA V, ohne Interpuction stehen. Aufgrund dieser emendationen lautet die wahrscheinliche Lesung wie folgt:
[I(ovi)] o(ptimo) m(aximo) Iun(oni) I [Reg(inae)] C/au(dius) I Victor et I C(laudia) Avita I v. s. 1. m. Dulobus Aspris I con(n)s(ulibus) Idibus Iuni(i)s.
17
Die Interpretation der zu ergänzenden Nomina als Claudius/Claudia hat schon L. BALLA, Steind. 21. vorgeschlagen.
28./ RIU 11.
L. BALLA, Festschr. B. Gunda 487 . - I. TOTH, Acta Class. 13 (1977) 69. Nr. 4. - DERS., IDT 98. Nr. 4.
29./ RIU 12.
I. TOTH, Acta Class. 13 (1977) 67. Nr. 1. - DERS., IDT 95. Nr. 1. Das Bruchstück soll ein Überrest der Bauinschrift des Dolichenums sein.
30./ RIU 13.
L. VIDMAN, SIRIS 661. - I. TOTH, Stud. Aeg. 1 (1974) 355. Nr. 18.
31./ RIU 14.
L. VIDMAN, SIRIS 662. - L. BALLA, Stud. Aeg. 1 (1974) 2. - I. T6TH, Ebd. 355. Nr. 11.
32./ RIU 15.
Das Denkmal ist kein Altar, sondern ein Teil der Basis einer Isis-Statue. Auf den Seiten der Basis standen drei Götterfiguren: rechts Harpokrates, unter ihm Anubis mit Palmenzweig, links Osiris-Sarapis und oben ihm ein Kranz. Übwer dieser Interpretation siehe ausführlich: I. T6TH, Studia Aeg. 3 (1977) 131 ff. und DERS., Vasi Szle 32 (1978) 585 ff. Die originelle Höhe des ganzen Monuments sollte etwa 155-160 cm sein. L. VIDMAN, SIRIS 663. - L. BALLA, Stud. Aeg. 1 (1974) 2. - I. T6TH, Ebd. 355. Nr. 12. - I. I. RUSSU, 250. - I. T6TH, Stud. Aeg. 3 (1977) 131 ff. - DERS., Vasi Szle 32 (1978) 585 ff.
6: [Sjellio RUSSU, [Bjellic(us) T6TH.
6/7: [rocejrdo[t(es)j T6TH, [rocejrdo[t(ibus)j A. M6CSY bei T6TH.
Neue Lesung der ganzen Inschrift nach I. T6TH:
[Ijsid[ij I Aug(ustae) sa(crum) I Q. Iuliu[sj I [Mjoderat(us) I [et oder Q. Ijulius I [Bjellic(us) [Sacejrdo[t(es)? oder -tibus? - - -j.
33./ RIU 18.
L. BALLA-Z. FARKAS, 437. - I. I. RUSSU, 250. 3: nach dem L Punkt RUSSU, wohl richtig. 4: G statt C RUSSU, ohne Grund.
18
3
. I .-
I I I I I
I
I
• I . l .
I I I . . '- -------------_ ... ---'-
Nr. 31 _ Nach R1U 15 und 1. T6TH, Stud. Aeg. 3 (1977) 131 ff.
19
5: AI unergänzlich RUSSU, an[tistesj BALLA-FARKAS, vgl. RIU 21: [ ?Sjatrius Fi(r)mini antestis.
34./ RIU 19.
E. T6TH, Epigr. (1974) 299. Maßangaben nach POCOCKE-MILLES (ed. KUBITSCHEK): wohl die
H 2 Fuß 11 Zoll, wohl die B 1 Fuß.
35./ RIU 20.
L. BALLA, Acta Class. 3 (1967) 87. - An. ep. 1969-70, 109. - A. M6CSY, Acta Arch. 21. (1969) 366 f. Anrn. 287. - L. BALLA, Festschr. B. Gunda 475. - I. I. RUSSU, 250.
5: Zwischen I und D Punkt RUSSU, ohne Grund.
L. BALLA, Acta Class. a. O. bringt diesen Valerius Valerianus mit dem gleichnamigen Ritter auf der großen Cursus-Inschrift aus Caesarea Palaestinae (An. ep. 1966, 495.) in Zusammenhang. Contra: An. ep. a. a. 0 ., M6CSY.
36./ RIU 21.
L. BALLA-Z. FARKAS, 437. - L. BALLA, Festschr. B. Gunda 476. - I. I. RUSSU, 250.
8: [Sjatrius BALLA-FARKAS, weil: "Der antistes konnte nicht der libertus des 'Inschrift widmenden Valerius Ursus sein, der offensichtlich patronus loei war." Auch [Sjatrius bei RUSSU. - Die Autopsie des Steines zeigt eindeutig die AT Ligatur, so das Nomen kann nicht [Vjalerius (RIU) Sein. Fi(r)min. RUSSU
37./ RIU 22.
L. BALLA, Muzeumi Kurir (Debrecen) 1970. Nr. 4. S. 42. - I. T6TH, Arch. Ert. 100 (1973) 250. - DERS., Acta Arch. 26 (1974) 156. ff. DERS., Vasi Szle 29 (1975) 560 ff. -L. BALLA, Festschr. B. Gunda 479 f., 486. Die alte Fundortangabe des CIL kann man mit der heutigen Hock Janos u. identifizieren. Dieser Ort liegt in der Nähe des Iseums, aber er ist nicht mit Thököly u. 18. identisch. So kann die Tafel nichts mit der Gründung des Isis-Heiligtums zu tun haben. BALLA, T6TH.
Curia II, 8: Valentinus coi. (falsche Zeilenangabe, RIU p. 3.) Curia TI, 17: Paeon(ius?) Caes(iorum servus) mag(ister) T6TH. Curia IV, 18: Kanius Crescens, zum Nomen: 1. BILKEI, Zalai Gyiijtemeny 16 (1980-1981) 5. Nr. 3.
38./ RIU 31.
1. T6TH, Arch. Ert 100 (1973) 252. - DERS., Acta Arch. 26 (1974) 159 f.
20
Palimpsest. Die Buchstabenspuren der ersten Inschrift - die auf der Zeichnung der RIU nicht bezeugt sind - sind aller Wahrscheinlichkeit nach die Überreste einer Grabinschrift. Dies erklärt den Gegensatz des Inhaltes der zweiten Inschrift (Signum Vicotriae ... etc.) zu der typisch sepulchralen Abbildung des Greifes mit Kantharos.
39./ RIU 36
Über den unbekannten Fundort: E. TÖTH a. a. 0 ., besonders Arch. Ert. 98 (1971) 159. E. TÖTH, Arch. Ert. 98 (1971) 159. - DERS., Ant. Tan. 19 (1972) 142. - L. BALLA, DME 1972. 160 ff. - DERS., Acta Class. 8. (1972) 85 ff. - E. TÖTH, Alba Regia 13 (1972) [1974] 163 ff. - E. TÖTH, Epigr. 299. - A. MÖCSY, Acta Arch. 29 (1977) 377. - E. TÖTH, Ein Siegesdenkmal aus Domitian's Zeit. Acta Arch. 35 (1983) 3-61.
1: [HelvidiJus ? TÖTH, Ein Siegesdenkmal. 3: Die Diskussion zwischen L. BALLA und E. TÖTH über dem hiesigen Sinn des Wortes consularis beendete sich mit den folgenden Feststellungen: "Da consularis eine Rangbezeichnung ist, hätte man aus einem Text in dem sich der Statthalter selbst als consularis bezeichnet keinerlei Schlüße auf seine Funktion ziehen können." TÖTH, Alba Regia. Ebenso: "In den Inschriften bezeichnet das Wort consularis niemals den Statthalter einer Proviz, falls der Statthalter selbst die Inschrift anfertigen ließ." TÖTH, Epigr. - Im gleichen Sienne L. BALLA, Acta Class.: " .. . ce n'etait pas les legats eux-memes qui ont dresse ces monuments, mais, dans la plupart des cas, les troupes, les officiers, les soldats, etc. qu'ils commandaint."
E. TÖTH interpretiert das Monument in siener neuen, vollkommenen Analyse des Denkmals (Ein Siegesdenkmal ... ) als ein Tholes-förmiges Tropaeum, dessen Aufstellung mit dem germanischen Krieg des Domitian's i. J. 93 zusammenhängt. An dieses Denkmal knüpft er die Inschrift RIU 120 (s. unten Nr. 82.) und das großen Geison-Bruchstück, Steind. 234. In den Figuren an den Seiten der Basis erkennt er Mars, Fortuna, Victoria und zwei Camilli links und rechts der Inschrift. S. aber zu der Interpretation dieses Monuments die andere Meinung von K. Strobel: Die Donaukriege Domitians. Antiquitas 1/38, Bonn 1989, 135 ff.
Die Ergänzunsmöglichkeiten der getilgten Inschrift - d. h. das Nomen oder die Nomina des consularis - sind völlig unsciher.
40./ RIU 37.
E. TÖTH, Epigr. 299. - L. BALLA-Z. FARKAS, 437.
1: TEREN RV- - - TÖTH, aufgrund von K. KARPATI, VREJ 23-24 (1895-1896) 71., der diesen Buchstaben noch gesehen hat. 5/6: wahrscheinliche Datierung nach BALLA-FARKAS das Jahr 227.
41./ RIU 39.
I. I. RUSSU, 250. - J. FITZ, Pannonok evszazada. Budapest 1982.22.
22
Lipp
Nr. 41- Nach 1. T6TH, IDT Nr. 7
P lV S'QV 1 3
y • ~CVMTAET y A LV I St~C
41
Nr. 42 - Nach RIU 41
23
Über die Unsicherheit des Fundortes vgl. E. T6TH, Ant. Tan. 19 (1972) 142. - DERS., Arch. Ert. 98 (1971) 165. - I. T6TH, Arch. Ert. 100 (1973) 251. - DERS., Acta Arch. 26 (1974) 156.
5: vi ignis das erste I ist erhöht, RUSSU.
6: E VISTAM RUSSU ohne Grund.
42./ RIU 40.
L. BALLA, Acta Arch. 15 (1963) 233 . - I. T6TH, Arch Ert. 100 (1973) 253. - DERS., Acta Arch. 26 (1974) 161. - DERS., Alba Regia 15 (1974) 97. Anm. 55. - DERS., Acta Class. 13 (1977) 70. Nr. 7. - DERS., IDT 99. Nr. 7.
5/7: [Alntipal[ter] cives I [Surus oder Suri] T6TH.
Ähnliche Lesung: schon T. P. Bu6cz, Vasi Szle. 1963, I, 76.
43./ RIU 41.
L. BALLA-Z. FARKAS, 437. - E. T6TH, Epigr. 299.
Über den Fundort s. E. T6TH, Arch Ert. 98 (1971) 162. Anm. 228., wo er bezweifelt, daß das Haus Alkotrminy u. 16 'der primäre Fundort wäre.
2: - - -]pius Quir[- - - das erste Wort kann aber kaum [Ul]pius sein, weil vor dem P der untere, waagrechte Hasta des L nicht sichtbar I. T6TH. Meiner Autopsie nach vor dem beschadigten R kann man einen Punkt sehen, so ist eine mögliche Lesung: - - -]pius qui r[- -. Das letzte Wort kann u. A. r[estituit], r[enovavit] sein.
3: [- - - c(olonia) C(laudia)] S(avariensium) BALLA-FARKAS.
4: - - -]am kann nicht [port]am sein, weil vor dem A der waagerechte Hasta des T nicht sichbar ist. Möglich: [aedicul]am oder [cell]am. T6TH.
44./ RIU 42.
E. T6TH, Epigr. 299. - V. CSERMENYI, Tajak - korok - telepillesek. A r6maiak varosa: Savaria. [Szombathely] 1982. 2. "Der Text und die Zeileneinteilung wie sie RIU vorschläg, konnten nicht bestehen." T6TH. E. T6TH hält die von I. PAULOVICS, Savaria-Szombathely topogrMiaja. (Acta Savariensia 1.) Szombathely 1943. 60. vorgeschlagene Ergänzung - Di[vo] I Clau[dio] - für die wahrscheinlichste Variante.
45./ RIU 43-44.
E. T6TH, Arch. Ert 98 (1971) bringt die Inschriften mit einer vermuteten Minerva-Tempel,
24
deren Donator der Kaiser Domitian war, in Zusammenhang. A. M6CSY, Acta Arch. 25 (1973) 398. weist diese möglichkeit zurück. 1. 1. RUSSU, 254. Anm. 8. korrigiert den Druckfehler bei der Umschreibung der Inschrift RIU 44., also:
4: ... desig[nat. VlIII p. p.] etc.
" ... · . · : · . :. . ' . ' .' .:
. '
., ..
...... ..
e ••••••
'.- :' .•. : ........ . .:: ... : .:.
.••... -.. //- .-... .. .... ~ .. l~" ","' , ., .' .' .. ' .' .' .- "
. ' . . ~.. .-.' . '.;.'
, , , , j : ' , '. . , ~ , . , ',''. : I \.' 'I
\ \ " \. ... '".:~~------ ,~,!'
...... '.. ." ., ... .. .. . .... " o. .. '. .. ' . ' .
/ : ., ..... ........
.. .,
., ., .. . ...
.;,,,, ... ........ ,f " " \\ " \, f, I I
t , I' \ \ I ,' '.!\. )/
..._~,'
Nr. 43 - Nach E. T6TH, Epigr. 299.
46./ RIU 48.
E. T6TH, Arch. Ert. 98 (1971) 164. - DERS., Ant. Tan. 19 (1972) 142. - 1. I. RUSSU, 250.
Der Fundort ist unbestimmbar. Nach einem alten Angabe (p. KRESZNERICS, A csaszarok. Pozsony - Pest 1806. 121.) kann er in der heutigen Gyöngyös u. liegen. T6TH.
RUSSU hat völlig Recht indem er die Auflösung dieser wichtigen Inschrift bemängelt.
Obzwar die Durchschrift des Textes in mehreren Publikationen erreichbar ist (zum letzten Mal: Steind. 11.), wird es vielleich nicht überflüssig sein; ihn hier zu reproduzieren:
Beatitudine d(omini) n(ostri) Constantis victoris I ac triumfatoris semper Aug(usti) I pro visa copia quae horreis deerat I postea quam condendis horrea deesse coepertunt I haec Vulc(acius) Rufinus v(ir) c(larissimus) praef(ectus) praet(orio) per se coepta I in securitatem perpetem rei annonariae dedicavit. '
47./ RIU 49.
R T6TH, Epigr. 300.
Rechte Seite 5: Digne T6TH.
Linke Seite 3: Opt T6TH.
25
48./ RIU 50.
L. BALLA-Z. FARKAS, 437. - 1. 1. RUSSU, 250.
1/3: [D. M. 1- - - Aurel(io) Resplectiano vet(erano) leg(ionis)] BALLA-FARKAS.
4: feIt T. Aurel(ius) etc. RUSSU, wohl richtig .
3
9 J .
/
T N. k,\·T E · r-·Lf~~IV. :~P( 1:\\J i:' \';-1' \JE
\ L· ., - ~
I I I '-
\ J \ C~ ).
, \ / T
~ 1 IV,,",
Nr. 48 - Nach E. T6TH, Epigr. 300.
49./ RIU 52.
Eine völlige Ergänzung des kaum lesbarren Textes nach E. T6TH, Epigr. 300. wie folgt:
C. Calp(urnius) Secu[n]dinus 1 sexvir c(oloniae) C(/audiae) S(avariae) [v(ivus)] f(ecit) s(ibi)
26
et Ant(oniae) I Bonon(iae) [con(iugi) v(ixit) a]n(norum) et Iul(iae) Urs[i]n[o] jil(io) [a]n(norum) et Iul(iae) Urs[i]n[ae] nuru[i et] Calp(urnius) Poten tinus jil(ius) ann(orum) [et T]ert(ia) Avent!i!na !nur(us) ann(orum) C!alfp(urnia) B!on!onia ? ann(orum) C!alfp(urnius) !Attic!us v(ixit) ann( os) Calp(urnius) p!o tenti!nus an(norum) Calp(urnia) Ant!o(nian?) an(norum) et - Ca!lp(urnia) T!ertiaM v(ixit) ann(os)! et Ca!lp(urnius) A!ve!n!t(inus?) ann(orum) nepoti eius.
50./ RIU 53.
2/3: Wahrscheinlich: ... [Bonon(iae)] Vallentinae ...
Der Bononius Crescens in der letzten Zeile der Inschrift konnte kaum Andere als der schon früher gestorbener Bruder der Gattin sein, ebenso wie z. B. RIU 94. usw.
51./ RIU 54.
J. FITZ, Pannonok evszazada. Budapest 1982. 75 f. Nr. 43. 1. T6TH, Baranya 7-8 (1994-95) 119 ff.
52./ RIU 56.
1. 1. RUSSU, 250. Die Interpunction ist auf der Zeichnung nicht bezeichnet. So:
1: Zwischen L und Licinius.
2: Zwischen L und F, bzw. Fund Clau(dius).
4: Zwischen natus und dom[o].
53./ RIU 61.
E. T6TH, Epigr. 300. Alte Maßangaben bei POCOCKE-MILLES (ed . KUBITSCHEK):
Wohl H 2 Fuß 6 Zoll, B 4 Fuß
Heutige H 69 cm.
54./ RIU 66.
E. T6TH, Epigr. 300. alte Maßangaben ebd.: H 2 Fuß 6 Zoll, B 1 Fuß 8 Zoll.
Nr. 54 - Nach G. ALFÖLDY, vgl. Nr. 1
27
55./ RIU 71.
L. BALLA, Ant. Tan. 12 (1965) - DERS., Acta Class. 2 (1966) 89 ff. - DERS., Festschr. B. Gunda 471. - DERS., Sutd. Aeg. 1 (1974) 7. - L T6TH, in diesem Band Nr. 1. G. ALFÖLDY, Listy Filol. 88 (1965) 265 f. identifizierte den Widmer dieser Inschrift mit dem L. Octavius Faustinianus, bekannt von der großen Basis von Carnuntum (An. ep. 1966, 268.) . Es wurde von L. BALLA angenommen, aber von A. M6CSY stillschweigend abgewiesen, Acta Arch. 21 (1969) 367. - Aufgrund eines neuen Bruchstückes schloß sich auch der Unterzeichnete der Ansicht von ALFÖLDY und BALLA an. Vgl. oben Nr. 1.
56./ RIU 74.
E. T6TH, Epigr. 300. - I. I. RUSSU, 251. Das Denkmal aus weißem Mannor wurde von dem Reisege fährte des POCOCKE angekauft, und es ging später verloren. T6TH, nach KUBITSCHEK.
2: wohl po(suit) de s(uo) RUSSU.
57./ RIU 75.
E. T6TH, Fol Arch. 23 (1972) 59. - DERS., Ant. Tan. 19 (1972) 143. - DERS., Epigr. 300. Das Denkmal ist ein Bruchstück einer altchristlichen Loculus-Platte mit der Darstellung des "Guten Hirten". T6TH. In der Inschrift zeigt die Autopsie den charakterististisch spätantiken Buchstaben L mit der hochgezogenen unteren Linie klar (wie z. B. auf der Inschrift RIU 83.) - was auf der Zeichnung der RIU nicht gezeichnet ist. Ergänzungsvorschläge von E. T6TH, Fol. Arch.:
.. . vixit a}n(nos) V Sulp[icius. - a. - ianus. - iana etc .
.. . vixit ann(os)} n(umero) Vetc .
... }nus Ulp[ius, -ianusj.
58./ RIU 78.
J. FITZ, Alba Regia 16 (1978) 366. Nr. 18.
59./ RIU 80.
Die poetische Übersetzung des Grabgedichtes in ugarischer Sprache ist erschienen: J. REVAI, Setak a romai aMagyarorszagon. (Spaziergange in der römerzeitlichen Ungarn.) Budapest o. J. [= 1943] 281., 2. Ausg. Budapest 196. - I. T6TH, A romaiak Magyarorszagon. (Die Römer in Ungarn.) Budapest 1975. und 1978. 71. - Neuerdings: T. ADAMIK, Arch. Ert. 110 (1983) 3 ff.
60./ RIU 81. Der Text der 5/6. Zeilen ist in der überlieferten Form kaum verständlich. Es gibt aber eine Möglichkeit zur Emendation.
28
I _-,"", ~J'-
~~Ls'j~;4;~ Nr. 56 - Nach E. T6TH, Fol. Arch. 23 (1973) 59 ff.
Die beiden Wörter 'vector - lector' und 'nam' haben in diesem Zusammenhang keinen Sinn. Wenn wir aber das Wort 'nam' mit den vor ihm stehenden zwei Buchstaben, OR zusammenlesen, erhalten wir das Wort ornam(entum), oder mit dem nacher stehenden ET zusammen: orname(n)t(um).
Das Wort 'protector' - das einen ritterlichen Rang bezeichnet - kann in dieser Inschrift kaum akzeptabel sein. Das R am Beginn der 6. Zeile kann anstatt eines Q ein Lesefehler sein. So kann man das Ende der 5. und den Beginn der 6. Zeile als protecto!,q(ue) lesen. Schließlich die am Beginn der 5. Zeile stehenden Buchstaben ET VECT (CIL) oder ET LECT (Lazius) kann man als et fet(i)t / et Jedt (mit eines IT Ligatur) interpretieren.
29
So erhalten wir einen Text der hinsichtlich sowohl seiner Fonn, als auch seines inhaltes zu einer grabinschrift pact:
5/6: et [flec(i)t orname(n)t(um) protectol[q(ue)] etc.
61./ RIO 84.
I. I. RUSSU, 251.
3: Her(e)nilla ? RUSSU
7/8 : Die Zeichnung is falsch. Richtig: posulit ( so schon CIL, Diahl, ILCV) RUSSU .
. 4186 Stein am Anger in ecclesiae ~ S. Martini pariete.
BENE MEMORANDAE co N I V GI DVLCISSIMAE
QYE VIX AN XX M V FL POMENTi
VS AVR IVSTINAE MARITVS
5 ET "C:CTOR NAM ET PROTECTO
R CONTRA VOTVM MEMO
RIA.M. POSVIT
Lazius r. r. p. 1144 (inde Grut. 794,12); Clusius ms. Hag. (inde Grut. 816, 5 col1. Saxio).
1 MEMORANDA, 2 DVLCISS, 3 QYAE et lVI v EL
(pro M V FL), 5 ET LECT·ORNAM. Lazius. ' 81
Nr. 59 - Nach RIU 81 = CIL m 4186
62./ RIU 85.
I. I. RUSSU, 251.
2: Das erste I im Wort cymiteri ist auf dem Stein in griechischer Fonn geschrieben I (Y), es zeigt die zeichnung gar nicht.
30
63.1 RlU 86.
2: möglich auch: - - - dad - - -
64.1 RIU 89-90.
L. TARDY-E. T6TH, Fol. Arch. 22 (1971 ) 35. Anm. 2. - E. T6TH, Ant. Tan. 19 (1972) 142. Der Fundort der beiden Steine ist aufgrund des Reisetagebuches von F. I. KEPPEN (1. 1822) der Kalvana~Hügel am Nordrand der Stadt.
......... -.. : .
Nr. 64 - Nach I. I. RUSSU, op. cit.
65.1 RlU 91.
I. I. RUSSU, 251. 4 und 5: Der Platz auf dem fehlenden Teil reicht weder für [Ursin]o noch für [Ursinia]no aus. Es wäre besser [Ruflo oder etwas Ahnliches. RUSSlJ. Meiner Meinung nach sollte in dieser Zeilen [Urs]o bzw. [Ursilno stehen.
6: Das rätselhafte Bruchstück - - -]temp kann man als ... i]temq(ue) interpretieren. Daraus folgt:
5/6: .. . Vel[rae i]temq(ue) Brig(a)e avi(a)e ...
66.1 RlU 93-94.
L. TARDY-E. T6TH, Fol. Arch. 22 (1971) 35. Anm. 2. - E. T6TH, Ant. Tan. 19 (1972) 142. Der Fundort der beiden Inschriften ist aufgrund des Reisetagebuches von F. I. KEPPEN (J. 1822) der Kalvana-Hügel.
31
67./ RlU 99.
I. I. RUSSU, 251.
5: bfLigatur RUSSU. 6: [v.] s. l. I. m. RUSSU.
68./ RlU 100.
I. I. RUSSU, 251. Es fehlen die Maßangaben.
H 82, B 42, D 26, Bh 7 - 6-4,5.
69./ RlU 103.
L. BALLA, Festschr. B. Gunda 476. - I. I. RUSSU, 251.
3: p(ro) s(e) RUSSU; wohl richtig.
70./ RlU 107.
I. I. RUSSU, 251.
Die verlorene erste Zeile sollte noch die Dedikation enthalten:
1: [I(ovi) o(ptimo) m(aximo)] RUSSU.
71./ RlU 108.
Ein Ergänzungsvorschlag: I. T6TH, Specimina Nova 1989. 77. Nr. 25.
- - - - - I ex [visu oder iussu oder ... .] I Egnat(ius) [. .... sac(erdos)] I Matris [Magnae] I I(ocus) d(atus) d(ecreto) d(ecurionum).
72./ RIU 110.
L. BALLA, Acta Arch. 15 (1963) 228.
73./ RIU 112.
Aufgrund Autopsie: 3: IVVENT d. h. 3/4: Iuventlino. In den Buchstaben Spuren roter Bemahlung.
74./ RlU 113. L. BALLA, Acta Arch. 15 (1963) 231 f. - I. I. RUSSU, 251.
32
E EGNA MATRI
,l,",.l
·VOTO ·SAC·
'MAG~rAE
D D
Nr. 70 - Nach I. T6TH, op. eit.
2: AVCVLO = avunculo bemerkt RUSSU.
75./ RIU 114. Das kleinere Bruchstück hatte in dem Band "Die röm. Steindenkmäler von Savaria." Budapest 1971. noch eine gesonderte Nummer: RIU 114 = Steind. 151 + 199.
76./ RIU 118.
I. 1. RUSSU, 251. 3: collegi[orum] RUSSU.
77./ RIU 120.
E. T6TH, Epigr. 300. - DERS., Ein Siegeesdenkaal aus Domitian's Zeit. Acta Arch. 35 (1983) 3-61. Fundort aufgrund des handschriftlichen Ausgrabungstagbuches von T. A. HORV ATH (aufbewahrt im Komitatsarchiv): Szombathely, Szechenyi u. 4-6im im Jahre 1935. T6TH. Nach E. T6TH hängt diese Inschrift mit dem hexagonalen Topaeum (RIU 36., s. oben Nr. 40.) und mit dem großen Marmorgeison (Steind. 234.) zusammen und sie stammt aus der Zeit der Flavier. Die Ehrenschrift wurde später vernichtet, und dieses Stück wurde schon in der Römerzeit als Baumaterial verwendet.
33
3
p:,-EAAVG~I
ASSIA ESACR '
w
' :~VGEII1 IAVK
120
Nr. 76 - Nach RIU 120
..... ...... \ ...........
legllto Aug. pr. pr. provo Pannoniae et misso ad adsignan- /
d.os agro]S PVBLICO [s . ... . leg. Aug. pr. pr. /
leg. tertJ IAE AVG IT[em ••••• curat. viar. I Olodiae] CASSL.<\.E C[·iminiae . .. . electo ad jacf,endum /
. . . ..] AE SACRIF[-icium . . .. adlecto inter praetor. /
ab. imp. Ves]P ET TITO [Aug. f. et iisdem imp. donis milit. dun. /
coronis i] II A VREA M[ urali vallari hasta pura vexiU. iii /
patrono coloniae]
Nr. 76 - Erganzungsvorschlag von E. T6TH, Acta Arch. Hung. 35 (1983) 50. Vgl. oben Nr. 38 auch.
34
78./ RIU 121.
E. T6TH, Epigr. 300. - I. I. RUSSU, 251. Aufgrund der Erstpublikation von K. KARPATI, VREJ 2324 (1897) 7l. war die Inschrift damals noch größer. Die in den Eckklammem stehenden fettigen Buchstaben bezeichnen Jene, die KARP A TI ncoh gesehen hat.
[- - - - -jI{undan - - -J I [a - - ci - - -J co[npar - -J I pub[liaia - -J I libe[rtusJ sart[- - ea --J I Primus [ - - -J I 9 CAPITLLM - - -
3: libe[rt - -J auch RUSSU.
5: das dritte Buchstabe scheint in der RIU S zu sein, bei KARP A TI aber B.
79./ RIU 125.
S. K. PALAGYI-S. T6TH, A romai es közepkori k5tar katalogusa. Tihanyi Muzeum. o. O. [= Veszprem] 1976. Nr. 25. Zu den Fundort A. M6CSY, Acta Arch. 25 (1973) 375. Anm. 10., wo er die falsche Fundortangabe der Archäologischen Topographie von Ungarn (MRT 3, 118. Nr. 23/15: Kamond) korrigiert. .
eiL
~
NVR I ET·L·SEPT·SEVER01\N E1-ls SE T·AVSONfO·AN ETSEPT
3 5 ERANTIOAN ET ls·SEPT 5 VERAE-AN FII.sIIS AN pr NTISSIMJS
Nr. 79 - Nach RIU 126
35
80./ RIU 126.
E. T6TH, Epigr. 300 f. Die Inschrift sollte ursprüglich viel länger sein, wahrscheinlich zeigt das in der letzten Zeile stehender Wort - [pijentissimis - mit einem größeren Spatium vor und nach ihm, die Symmetrie-Verhältniße der Tafel.
1: [nurjui ist ausgeschloßen, es soll die Endung eines Cognomen oder noch eher eine fragmentarishce Altersangabe der ersten person soin T6TH.
4: das zweite AN ist offensichtlich ein Irrtum T6TH. Ergänzung: [L. Sept(imio) - - -an(norum) - -jVI et L. Sepi (sie! = Septimio) Severo an(norum) et L. I [Sept(imio - - -an (no rum) et Sejpt(imio) Ausonio an(norum) et Sept(imio) 1[- - - an(norum) et Sept(imio) Spjerantio an(norum) et L. Sept(imio?) 1[- - -Sejverae an(norum) filiis an(norum) 1[- -pijentissimis.
Sei es hier auch bemerkt, daß die Umschrift von. E. T6TH, a.a.O. - wohl infolge eines Druckfehlers - störend mangelhaft ist. Es fehlt: 3: et, 4: et L. Sept., 5: die ganze Zeile.
81./ RIU 129.
1. FITZ, Pannonok evszazada. Budapest 1982. 78. Nr. 76.
82./ RIU 133-134.
B. GALSTERER-KRÖLL, Epigr. Stud. 9 (1972) 44 f. beachtet heide Inschriften als Fälschungen. Diese Ansicht lehnt A. M6CSY, Acta Arch. 25 (1973) 381. Anm. 91-92. mit Recht ab. Die Inschrift 134. teilt K. SZ. P6CZY, Scarbantia. A romai korl Sopron. Budapest 1877. 13. ohne die Bezeichnung der epigraphischen Abkürzungen mit.
83./ RIU 135.
E. T6TH, Epigr. 301. Die Zeichnung der RIU stellt die Akzentuirungen (apiees) nicht hin:
Aeeornae I Aug(ustae) sae(rum) I Emonienses I qui I eonsistunt lfinibus I Savar(iae) I v. s. L m.
84./ RIU 136.
1: Das IV am Ende der Zeile kann kaum "eine schlechte Ligatur von in(vieto)" sein. 2: Der erste Buchstabe kann ebenso gut S wie C sein.
85./ RIU 138. RUSSU, 251.
36
/
AECORNAE .I'
A VG·SAC ./ ./1 J
3 EMON J EN5:S
6
/QV I CONSISTVKr
135
FJNJBVS SAVAR V~S·L·M
Nr. 82 - Nach RIU 135, ergänzt mit den Apices
2-4: T. Fl(avius) Laulrentil[an]u[s] RUSSU. T. Fl(avius) Laulrentilu[s] Steind. T. Fl(avius) Laulrentilus An ep. 1965, 293.
86./ RIU 139.
I. PALKÖ, Vasi Szle 30 (1975) 578. - 1. TÖTH, Vasi Szle 31 (1976) 602. - DERS., Arch. Ert. 100 (1973) 254. - DERS., Acta Arch. 26 (1974) 162.
1: M(ercurio) A(ugusto) s(acrum) TÖTH, eher als M(inervae) A(ugustae) s(acrum) (Steind. 26.). 4: Sabar(iae) PALKÖ, Savar(iae) TÖTH, Vasi Szle.
87./ RIU 142.
I. I. RUSSU, 251.
37
Es fehlen die Maßangaben:
H 118, B 83, D 22, Bh 8 - 6,5 -4
88./ RIU 145.
I. I. RUSSU, 251. - I. T6TH, R6mai sirkövek közt setilgatva. In: Iskolanidi6, 1978. Fomiselemzes. Budapest 1978. 37 ff. "Era absolut necesara fotografia piesei ... " RUSSU.
89./ RIU 146.
Es fehlen die Maßangaben: H 214, b 85, D 22, Bh 8 - 2,6 - 5.
90./ RIU 153.
E. T6TH, Epigr. 301. Die Lesung des erhalten gebliebenes Bruchstückes ist sehr ungewiß. Neben der problematischen Lesung des eIL sollte man auch die Lesung von V. LIPP, VREJ 2 (1874) 82. zitieren:
Semproni I M. F. - - AN I IVL - - fili I P.
91./ RIU 157.
Die gleiche Familie vgl. oben Nr. 21.
38