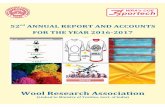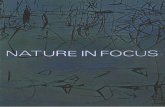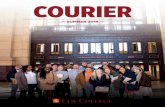Sequentia - Coe
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of Sequentia - Coe
Eine vierteljährliche Zeitschrift der Europäischen Audiovisuellen Informationsstelle über Informationsquellen
Okto
be
r /
No
ve
mb
er
19
96
. V
ol.
III
, N
r. 9
• EUROFICTION : Eine europäische Informationsstelle für Fernseh-Fiction
• Sponsoring von Sportereignissen, Übertragungsrechte für diese Sportereignisseund Sponsoring der Übertragung im Fernsehen
• Internationale Koproduktionen: Ein weiterer Prüfstein für die gemeinsame europäische Kultur - und bestimmte andere Dinge
• Rechte an Formaten von Sendungen
TV-Programme:EuropäischeForschung und Informationsquellen
Sequentia
2 Sequentia Vol. III, Nr. 9, OKTOBER/NOVEMBER 1996
© D
.R.
Sequentia • Herausgeber: Europäische Audiovisuelle Informationsstelle / 76 Allée de la Robertsau / F-67000 Strasbourg / Tel. (33) 03 88 14 44 00 / Fax (33) 88 03 14 44 19 / E-Mail : [email protected] / URL http://www.obs.c-strasbourg.fr /Sequentiamain.htm • Herausgeber und Vorsitzender des Redaktionsteams: Dr. Ismo Silvo • Chefredakteurin (Verantwortliche): Lone Le Floch-Andersen, assistiert von Sonja Lindén • Redaktionsteam: Ismo Silvo (Vorsitzender), Lone Le Floch-Andersen (Chefredakteurin),Dr. André Lange (statistische und wirtschaftliche Informationen), Ad van Loon (rechtliche Informationen), Markus Booms (Marketing) und John Hunter (IT und Multimedia). • Sekretariatund Koordination der Übersetzungen: Brigitte Thomas • Dokumentation, Sequentia Bibliographische Beilage und Iconography: Sonja Lindén • Layout: Thierry Courreau • Satz: Atelier Point à la Ligne • Druck: Finkmatt Impression (La Wantzenau) • ISSN 1022-6338 • Erscheinungsweise: vierteljährlich seit September 1994. - Copyright: Europäische Audio-visuelle Informationsstelle und die Autoren. Vervielfältigung, Speicherung und Nachdruck gleich welcher Art, auch auszugsweise, bedarf der schriftlichen Genehmigung des Heraus-gebers. Die in den Artikeln zum Ausdruck gebrachten Meinungen geben nicht unbedingt den Standpunkt der Informationsstelle, ihrer Mitarbeiter oder des Europarates wieder.
Beiträge dieser Ausgabe: Maciej Karpinski (Vorsitzender des Vorstandes der Europäischen Audiovisuellen Informationsstelle), Milly Buonanno (Dozentin, Universität Salerno; Leiterindes Osservatorio sulla fiction televisiva italiana und Koordinatorin des Eurofiction Forschungsnetzes), Lorenzo Vilches (Direktor des Fachbereichs Kommunikationswissenschaften, Uni-versität Barcelona), Richard Paterson (Leiter Medienerziehung/Forschung, BFI), Régine Chaniac (INA - Europ. TV-Programme), Dr. Gerd Hallenberger (SFB Bildschirmmedien, Univer-sität Siegen), Paul Hendriksen (Berater, Verantwortlicher für die Entwicklung des ESCORT-Klassifizierungssystems), Janet Greco (Direktorin von Infomedia), Michael Johnson (Organi-siert Konferenzen für die EBU, ehem. Mitarbeiter der BBC), Joan K. Bleicher (Forscherin, Fachbereich Literaturwissenschaft, Universität Hamburg), Michel Grégoire (Generalsekretär,European Group of TV Advertisers), Peter Kraewinkels (Generalsekretär, AMMIE), Rauli Kohvakka (Forscher, Kultur- und Medienstatistik, Finnland), Françis Denel (Hörfunk- und Fern-seharchiv, Institut National de l’Audiovisuel), Richard McD. Bridge (Jurist, Charles Russell-Kanzlei, London), Peter van den Berg (Europäischer Kabelkommunikationsverband), MarcNoyons (Direktor, C-sales, Amsterdam) und Linda Bouws (Programmdirektorin, Kunstkanaal).
Wir danken: Jean-Michel Taillefer/Anne Gaignard (Banco Prod.), Christophe Valett/Stéphanie Garboua (GMT Prod.), Sylvie Guyomarc'h (Hamster Prod), Georgina Xicoy (TV3 Cata-logne), José Luis Orosa (TVE - Televisión Española), Hans-Peter Dahlhausen (RTL Television), Goffredo Lombardo/Barbara Broglio (Titanus), Bepi Nava (RAI), Charo Ayán (Telepro-grama), Milena Fogliatti (RAI), Christian Hellmann (TV Spielfilme), Dominique Marques/Louis Klipfel (Europarat - Photo-Abteilung), Peder Grøngaard (Nordicom), Viera Stefancova (STV),Dominique Mathioudakis/Olga Kliamaki (IAA), Heikki Kasari (YLE), Catharina Bucht (Nordicom), Chris Groeneveld (Koninklijke Bibliotheek), Josef Schuchnig (ÖGFKM), Violeta Olteanu(TVR), Zinta Oshleja (Latvian TV), Eija Poteri (Nordicom), Ziya Arikan (TRT), Hilmar Thor Bjarnason (Nordicom), Zoltán Jakab (MTV).
Umfragen zufolge stellt das Fernsehen mit sei-nen Informationsprogrammen die am weitesten ver-breitete und somit einflußreichste Informations-quelle unserer heutigen Zeit dar. Insofern sind dieInformationsprogramme des Fernsehens nicht alleineine Angelegenheit der Journalisten und der Tech-nologie, sondern auch Gegenstand einer erheblichenmoralischen Verantwortung. Zum rechten Zeitpunktverfügbare und objektive Information vermag dieWelt zu verändern, wie in jüngster Zeit zu sehen war.Durch Informationen zu den unterschiedlichstengeographischen oder aktuellen Themen läßt sichzudem das Verständnis unter den Nationen in einersich rasch verändernden Welt fördern.
In wachsendem Maße ist Information auch ein Motorfür die Industrie. Europa befindet sich am Übergangin das digitale Fernsehzeitalter. In rascher Folgeentstehen immer neue Fernsehkanäle und Multi-media-Dienste. Sie alle suchen interessantes undattraktives Programmaterial neueren wie älterenDatums.
Informationen zu Filmkatalogen, Urheberrechten,Programmanbietern und Produktionsfirmen sind aufeinmal außerordentlich gefragt und von unschätz-barem Wert. Spätestens jetzt, an der Schwelle zumdigitalen Zeitalter, erkennt man im audiovisuellenSektor mit aller Schärfe die Bedeutung verläßlicherInformationsquellen und Kontakte.
In Zeiten politischer, ökonomischer und sozialerVeränderungen, wie sie Europa gegenwärtig imLaufe nur einer Generation erfährt (wobei dieserProzeß längst noch nicht abgeschlossen ist), wirddeutlich, welche Verantwortung den Informations-anbietern zukommt. Das Internet bietet sich hier zueinem Vergleich geradezu an. Wir alle wissen,welche Unmengen an Information man sich aus demInternet holen kann, aber gleichzeitig ist es schwie-rig, sich wirklich verläßliche und gute Informationenzu beschaffen. Das gleiche gilt auch für den audio-visuellen Sektor, wo die Fülle an Information und dieVielzahl der Quellen sorgfältige Recherche und einewachsende Verantwortung verlangen. Die Medien-schaffenden in Europa sind dabei für jede Hilfe zurErleichterung dieser Vorgänge dankbar. Einen wich-tigen Beitrag können hier auch die europäischenOrganisationen und Einrichtungen liefern. DieEuropäische Audiovisuelle Informationsstelle undihre Schwesterorganisation Audiovisual Eurekabemühen sich aktiv darum, die Medienschaffendenin Europa auf diesem Feld zu unterstützen.
In beiden Organisationen führt zur Zeit Polen denVorsitz, welches zu vertreten ich die Ehre habe. Nungehörte Polen bekanntlich lange Zeit zu jenem TeilEuropas, der von einem politischen System be-
herrscht wurde, in dem Information - vor allem imFernsehen - ein Gegenstand staatlicher Manipula-tion war. Die Menschen in Mittel- und Osteuropawissen aus eigener Erfahrung um den Wert und dieBedeutung verläßlicher Information, die politischunabhängig und jedermann zugänglich ist. Siewissen auch, wie schwer es sein kann, die ent-sprechenden Informationen zu sammeln, und wiewichtig Forschungsergebnisse sind.
Die europäische Integration und insbesondere dieSchaffung eines gemeinsamen audiovisuellenMarktes in ganz Europa machen weitere Entwicklun-gen in diesem Bereich nötig; zu nennen wären hierder Aufbau von Netzwerken, der Austausch von Men-schen und Ideen, sowie der Abbau noch bestehenderGrenzen und Hindernisse auf dem Weg zu einer bes-seren Verbreitung von Fernseh-Informationspro-
grammen in Europa. Sogäbe es beispielsweiseUnterschiede in derGesetzgebung verschie-dener Länder aufzuhe-ben.
Man nimmt gemeinhinan, daß die Informa-tionssysteme in denStaaten Mittel- undOsteuropas gegenwär-tig weniger entwickeltsind als die im Westen.Dies trifft bis zu einemgewissen Grad auch zu,
aber auf der anderen Seite sind hier zahlreiche neueInformationssysteme entstanden, die die Entwick-lung in den entsprechenden Ländern veranschau-lichen. Neu aufkommende Industrie- und Dienstlei-stungszweige haben ebenfalls Bedarf an verläßlichenInformationen zu Programmen und Publikum. Lang-sam aber sicher beginnen sich die Informations-lücken im audiovisuellen Sektor zu füllen. Die Wirt-schaft in den betreffenden Ländern investiert inneue Technologien, was den Austausch von Infor-mation künftig erleichtern wird. Und natürlich gibtes das Internet. Ich freue mich aufrichtig über dieseVeränderungen und möchte die Medienschaffendenin Ost und West auffordern, diese Entwicklung zuunterstützen. Verantwortliches Handeln bedarf alsGrundlage der Information.
Es freut mich, daß die Europäische AudiovisuelleInformationsstelle mit dieser Ausgabe der Zeitschrift“Sequentia” ihren Beitrag in diesem wichtigen Pro-zeß leistet.
Maciej KarpinskiVorsitzender des Vorstandes
der Europäischen Audiovisuellen Informationsstelle
Coverphoto: © D.R., Dominique Marques (Europarat - Photo-Abteilung).
VerantwortungInformation
Leitartikel
© D
.R.
und
Das neue Telefon-nummern-Systemder France TelekomAm 18. Oktober 1996wird France Telekomeine neues Nummern-system in ganz Frank-reich einführen. Um dieInformationsstelle vonFrankreich aus zu errei-chen, müssen Sie deraktuellen Nummer die03 voranstellen; bei Anrufen aus demAusland ist nur die 3 einzufügen.
Dossier
Mit der Einführung digitaler Technologienund Kanäle erlebt der europäische Fern-sehmarkt seinen bislang größten Boom.Fernsehsender und Programmherstellersehen sich infolgedessen einem ständigsteigenden Konkurrenzdruck gegenüber;Programmangebote werden heute von einergrößeren Zahl von Verteilernetzen geliefertdenn je zuvor - vom herkömmlichen terres-trischen Rundfunk bis hin zu Pay-TV, Videound dem Internet.Zusätzlich führen veränderte gesetzlicheRahmenbedingungen, technologische Ent-wicklungen und das Aufkommen neuerKabel-, Satelliten- und Videodienste zueinem heißen Wettbewerb. Die Verbreitungder Zuschaueranteile auf eine ständig wach-sende Zahl von Kanälen zwingt die Bewer-ber dazu, immer auf dem neuesten Standder Forschung zu Programmen und Publi-kum zu sein. Dies trifft umso mehr zu, alsder Druck besteht, landeseigenen Spielfil-men eine Chance zu geben und gleichzeitigbei der Programmauswahl auf eine stärkerinternationale Ausrichtung zu achten.In der vorliegenden Ausgabe von Sequen-tia, welche das zweijährige Bestehen unse-rer vierteljährlich erscheinenden Zeitschriftmarkiert, befassen wir uns näher mit For-schungsprojekten, Netzen und Quellen, diemit Herstellung, Inhalten und Verteilungvon Fernsehprogrammen in Europa zu tunhaben.Ergänzende Informationen und Materialien(interaktive Versionen der Artikel, eineumfassende Bibliographie und Referenz-liste zu europäischen TV-Spielfilmen,WWW-Quellen zum Thema Fernsehenusw.) zu den Artikeln dieser Ausgabe kön-nen auf unserer Websi te (ht tp ://www.obs. c-strasbourg.fr/Sequen-tiamain.htm) abgefragt werden. Wer kei-nen Zugang zum Internet hat, kann ent-sprechendes Material direkt über dieHerausgeberin beziehen.
Lone Le Floch-AndersenSachverständige und Chefredakteurin
von Sequentia
Dossier 3–15
TV-Programme• EUROFICTION : Eine europäische
Informationsstelle für Fernseh-Fiction
• ESCORT - Europäisches Standard-verfahren zur Klassifikation von Radio- und Fernsehsendungen
• Infomedia Internet Professional
• Fernsehspiele und Koproduktionen
• Programminformation für daseuropäische Fernsehen:Quellen der Informationsstelle
• Programmgeschichte des Deutschen Fernsehens
• Kunst, Kultur und Fernsehen
• Kunstkanaal
• Sponsoring von Sportereignissen,Übertragungsrechte für diese Sportereignisse und Sponsoringder Übertragung im Fernsehen
• Europäische Verleiher von TV-Progammen schließen sich zusammen
Märkte und Werke 16–19
• Internationale Koproduktionen: Ein weiterer Prüfstein für die gemeinsame europäische Kultur - und bestimmte andere Dinge
• Digitales Rundfunk im Kabelnetz
Die Spielregeln 20–23
• Die französische Inathèque
• Medien und Forschung-Neue Bedingungen, Zugang zu Archivenund Dokumenten
• Rechte an Formaten von Sendungen
TV-Programme:EuropäischeForschung und Informationsquellen
TV-Programme
Fernseh-Fiction
EUROFICTION:
4 Sequentia Vol. III, Nr. 9, OKTOBER/NOVEMBER 1996
Die strategische Bedeu-t u n g d e s a u d i o v i s u e l l e nBereichs für die Wirtschaft undKultur der europäischen Län-der ist Gegenstand intensiverDiskussionen zwischen ver-schiedenen Beteiligten: Sen-dern, Produzenten, Politikern,Intellektuellen, Wissenschaft-lern und der Öffentlichkeit. Esherrscht mittlerweile ein dif-fuses Bewußtsein, daß in deraudiovisuel len Arena einKampf im Gange ist, der für dieBesserung der Wirtschaftslage(die immer mehr von der Pro-duktion und Verbreitung “sym-bolischer” Waren abhängt) unddarüber hinaus für die kul-turelle Autonomie Europas vonentscheidender Bedeutung ist.Der audiovisuelle Bereichspielt daher eine zentrale Rolle,wenn nach dem unermüdlichenAufbau kultureller Identitätenund nach der Förderung einereuropäischen Kultur im Kon-text schnell fortschreitenderG l o b a l i s i e r u n g s p r o z e s s egefragt wird.
Fiktionale Fernsehprogrammespielen wegen ihrer kulturellenund wirtschaftlichen Doppel-identität in diesem Bereicheine Sonderrolle. Gemessen amgesamteuropäischen audio-visuellen Szenario – das Unter-schiede zwischen den einzel-nen Ländern durchaus zuläßt –ist Fernseh-Fiction allerdingsdurch einen krassen Gegensatzgeprägt: Sie ist ein Produkt von hohem strategischemWert, in puncto Produktion,Angebot und Verbreitung je-doch schwach.
Diese Schwäche wirkt sichauch auf der Informations-ebene aus: Genaues undaktuelles Wissen über die Ent-wicklungen in den europä-ischen Ländern im BereichFernseh-Fiction ist bislangnicht ohne weiteres verfügbar.
Die nationale Programmgestal-tung mit fiktionalen Sendungenhängt mehr oder weniger vonImporten aus Nord- und Süd-amerika ab; Verbreitung undAustausch von Fiction-Materialeuropäischen Ursprungs spie-len kaum eine Rolle. Die Ver-mehrung der Kanäle, die vonden neuen Technologien geför-dert wird, und die riesigeMenge an Inhalten, die benötigtwerden, um diese Kanäle zu fül len, könnten diesesUngleichgewicht noch ver-schärfen.
gründliche Analysen der erfolg-reichsten oder besonders imTrend liegenden Produktionen;
Erfassung von Finanzdatenüber Investitionen, Importeund Exporte;
wechselweise Beschäftigungmit spezifischen Themen wieMarketing, Star-System, Aus-bildung von Fachleuten usw.
Das wichtigste Ergebnis vonEUROFICTION wird einJahresbericht sein, der ver-gleichende Überblicke, Ana-lysen und Synthesen derbedeutendsten Fiction-Trendsinnerhalb der europäischenLänder und im Vergleich zwi-schen ihnen bietet.
Damit wird ein doppeltes Zielverfolgt: zum einen Wissen zuproduzieren und zu verbreiten,das die Interessen verschiede-ner Gruppen – Fernsehschaf-fende, Politiker und Medienfor-scher – trifft, und zum ande-ren die Bedingungen für einestärkere Nutzung und Wert-schätzung der europäischenFernseh-Fiction und ihrer kul-turellen und wirtschaftlichenFunktionen zu begünstigen.
Die meisten Daten und Infor-mationen, die EUROFICTIONanbieten will, sind sonst nir-gendwo zu finden, oder sie sindverstreut und fragmentiert.Wenn sie alle zu einem organi-schen Ganzen geordnet wer-den, und wenn man ihrer zeitlichen Entwicklung folgt,werden sich neue, fruchtbareErkenntnisse ergeben. Es istdas Wissen um einen erhebli-chen Teil der europäischenProduktion und des euro-päischen Konsums, das da-durch transparent und verfüg-bar wird, und zwar mit demzusätzlichen Wert der Rezipro-zität, die durch einen ver-gleichenden Forschungsrah-men begünstigt wird.
Von Milly Buonanno(außerordentliche
Professorin an der Universität Salerno,
Leiterin des Osservatoriosulla fiction televisiva
italiana und Koordinatorindes EUROFICTION-Forschungsnetzes),
mit Beiträgen von Lorenzo Vilches,
Richard PatersonRégine Chaniac,
und Gerd Hallenberger.
Das Projekt EUROFICTIONentstand aus der Überzeugungseiner italienischen Förderer(Fondazione Hypercampo undOsservatorio sulla fiction
televisiva italiana), daß sy-stematische, gut dokumentier-te, analytische und umfassendeInformationen und Kenntnissedringend erforderlich sind, umMaßnahmen zugunsten einesso wichtigen audiovisuellenTeilbereichs zu verwirklichen.
Bei dem Projekt EUROFIC-TION geht es, kurz gesagt,darum, eine europäische Infor-mationsstelle für Fernseh-Fic-tion einzurichten, deren Zielvor allem die quantitative undqualitative Beobachtung derFiction-Programme ist, diejährlich in den europäischenLändern produziert und ange-boten werden. Für den Anfangsind, ohne daß dies dieMöglichkeit ausschließen soll,daß andere Länder sich demN e t z i n n a h e r Z u k u n f tanschließen, fünf nationaleForschungsteams und Institu-tionen an der bereits gegründe-ten und (seit 1996) tätigenInformationsstelle beteiligt:
- in Italien: Osservatorio sullafiction televisiva italiana;
- in Frankreich: Institut Natio-nal de l’Audiovisuel;
- in England: British Film Insti-tute;
- in Deutschland: UniversitätSiegen;
- in Spanien: Universitat Autò-noma de Barcelona.
Die jährliche Arbeit von EURO-FICTION erfolgt auf der Grund-lage harmonisierter Kriterienfür die Datenerfassung undDatenbearbeitung und betrifftfolgende Bereiche:
Kontrolle der wichtigstenVariablen des Angebots: Titel,Zahl der Folgen, Länge, Termi-ne, Format, Sparte, Herkunft,Bewertung und Quote;
Klassifizierung einiger Dimen-sionen der Handlung als kultu-relle Indikatoren: Zeit, Schau-platz, Umgebung, Figuren;
Zusammenstellung eines filmo-grafischen Indexes und einerSynopse aller Programme;
Mak
inav
aja
© D
.R. R
TVE
Eine europäische Informationsstelle für
Il m
ares
cial
lo R
occa
© R
aiJu
lie L
esca
ut©
J. L
oew
Nav
arro
© B
. Fau
/K
ipa
Sequentia Vol. III, Nr. 9, OKTOBER/NOVEMBER 1996 5
Italien: Osservatorio sulla fiction televisiva italianaDas Osservatorio sulla fiction
televisiva italiana wurde1988 auf Initiative von “Il Cam-po” gegründet, einem privatenMedienforschungszentrum mitSitz in Rom, zu der mittlerweiledie gleichartige Hypercampo
Fondazione toscana di
comunicazione e media inFlorenz hinzugekommen ist.
Unter der Leitung der Soziolo-gin und Medienwissenschaft-lerin Milly Buonanno arbeitetdas Osservatorio mit der For-schungsabteilung der RAI(Verifica Qualitativa Program-mi Trasmessi) und der Marke-tingabteilung von Fininvest(heute Mediaset) zusammenund wird auch von diesenunterstützt.
Das Osservatorio sammelt undanalysiert quantitative undqualitative Daten zur Produk-tion und zum Angebot von fik-tionalen Fernsehprogrammenin Italien und veröffentlichtjährlich einen breit angelegtenForschungsbericht. In seinerachtjährigen Tätigkeit hat dasOsservatorio eine einzigartigeTradition langfristiger For-schungsarbeit begründet, undseine Jahresberichte sind mitt-lerweile eine maßgeblicheInformationsquelle, die jedesMal mit Spannung erwartet
Sendeplätze für fiktionaleFernsehprogramme für Jugend-liche.
Produktion und europäischerMarkt für fiktionale Program-me: 1988 und 1989 wurdeunter der Trägerschaft derComissió Interdepartamentald'Investigació I InnovacióTechnològica (CIRIT) derGeneralitat de Catalunya unterder Leitung von LorenzoVilches und J. Luis Fecé einForschungsprojekt mit demTitel “Beziehung zwischen Filmund Fernsehen. Untersuchungder Krise der europäischenaudiovisuellen Produktion”durchgeführt. Dieses Projekt,das auf der aktuellen wirt-schaftlich-strukturellen audio-visuellen Szene in Europaberuhte, hat die Ursachen derKrise des audiovisuellen Sek-tors in Europa zum Zeitpunktder Liberalisierung des Fern-sehens in Spanien analysiertund Fallstudien zu TelevisiónEspañola, Channel Four undCanal Plus vorgelegt. DieseUntersuchung diente a lsGrundlage für die Gliederungdes Berichts, der im erstenSeminar zur audiovisuellenProduktion des Media-Pro-gramms in Spanien mit Unter-stützung der Universidad Inter-nacional Menéndez y Pelayound des Kulturministeriumsvorgelegt wurde.
wird. Außerdem ist eine positi-ve Interaktion zwischen For-schung und Produktion ent-standen, denn die Daten undAnalysen des Osservatoriozählen zu den Indikatoren, dievon Sendern und Produzentenberücksichtigt werden.
Unter der Überschrift “La fic-tion italiana / L’Italia nella fic-tion” sind bisher sechs Bände inder RAI-VQPT-Reihe erschie-nen. Alle wurden von Milly Buo-nanno herausgegeben.
Kontaktadresse:
Prof. Milly Buonanno – Osservatorio sulla fiction – via di Novella 8, I-00199 Roma, Tel.: (39) 6 86217366, E-Mail: [email protected]
Fondazione Hypercampo, Prof. Giovanni Bechelloni, via dei Servi 20, I-50125 Firenze, Tel./Fax: (39) 55 2396235-2381338
Spanien: Universitat autònoma de BarcelonaVor EUROFICTION hat sich dieForschung zu fiktionalen Fern-sehprogrammen in vier Rich-tungen entwickelt: a) Produk-tion und europäischer Marktfür fiktionale Programme; b) Sendeplätze, Sparten undInhalte von fiktionalen Pro-grammen in Spanien; c) Ent-wicklung computergestützterHilfsmittel für die Erstellungvon Drehbüchern für fiktionaleaudiovisuelle Programme; d)
Europäische Fernseh-Fiction inItalien, Spanien, Vereinigtes Königreich,Frankreich und DeutschlandBeteiligte nationale Forschungsorganisationen
Sendeplätze, Sparten undInhalte von fiktionalen Pro-grammen in Spanien: 1990 und1991 führte ein Team der Uni-versitat Autònoma de Barcelo-na unter der Leitung von Loren-zo Vilches in Zusammenarbeitmit dem CTP (Club de Técnicasde Producción) ein Forschungs-projekt zur Evaluierung vonProduktions- und Programm-planungsstrategien für Fern-seh-Fiction in Spanien währendder Zeit des Wandels vomöffentlichen Fernsehmonopolzum privaten Fernsehsystemdurch. Diese Untersuchungberuht auf der Analyse von Pro-grammen und Inhalten sowievon Fiction-Quellen, Spartenund Formaten von Fernseh-serien und der Investitionenvon Televisión Española.
Industrielle Produkte für dasSchreiben von Fiction: Im Juni1989 verlieh die ConferenciaMinisterial dem Projekt CAP(Computer Assisted Pro-duction) das Eureka-Etikett(EU305). Dieses Projekt unterder wissenschaftlichen Leitungvon Lorenzo Vilches, an demverschiedene spanische undfranzösische Unternehmen(CTP, BDE, C. LAUBIN) sowiedie Universitat Autònoma deBarcelona beteiligt sind, befaßtsich mit der Erzielung techni-scher Fortschritte bei der Com-puterisierung von Produktions-prozessen für Film und Fern-
Die Testwoche (2.-8. März 1996)Zwar betrifft die grundlegende Beobachtung im Rahmen vonEUROFICTION in jedem Land die Erstausstrahlung nationalerProduktionen und Koproduktionen im Laufe eines Jahres, dochum die Ergebnisse besser in den jeweiligen Kontext einordnen zukönnen, wurde ein weiterer Schritt unternommen: die erweiterteBeobachtung einer Testwoche. Als Testwoche wurde die Wochevom 2. bis 8. März 1996 ausgewählt. Anders als sonst wird indieser Woche (zwischen 8.00 und 1.00 Uhr) das gesamte Ange-bot an Fiction im weitesten Sinne berücksichtigt, unter Einschlußvon Spielfilmen, importierter Fernseh-Fiction und Wiederholun-gen. Die Erfassung und Aufarbeitung dieses breiteren Spek-trums an Daten erlaubt den Zugriff auf relevante Informationenüber den unterschiedlichen Anteil von Spielfilmen und Fernseh-Fiction innerhalb des wöchentlichen Sendeplans, die Herkunftimportierter Fiction-Sendungen und Filme sowie den Umfang derWiederholungen. Auch wenn eine einzige Woche nicht als voll-kommen repräsentativ für das Angebot an fiktionalen Fernseh-programmen gelten kann, liefert sie zumindest einen wichtigenund nützlichen Hintergrund, vor dem die Grunddaten von EURO-FICTION gelesen und interpretiert werden können.
M. Buonanno
Italien: Filme und Fernsehfilme nach Ursprungslandpro Sender (%)
Quelle: EUROFICTION Italien / Osservatorio sulla fiction italiana,
sehen. Ein erster Prototypwurde 1994 vorgestellt.
Europäisches Jugendfernse-hen: Ein Forschungsprojekt zufiktionalen Fernsehprogram-men für Jugendliche wurde vonRadio Televisione Italiana(RAI), France 2 und TelevisiónEspañola zusammen mit denUniversitäten von Rom, Rennesbzw. Barcelona (UniversitatAutònoma) gefördert. Präsen-tiert wurde die Untersuchungim Rahmen der Aktivitäten deritalienischen Präsidentschaftder Europäischen Union im Mai1996 in Ravello. Sie beruht aufder Analyse der Inhalte undinsbesondere der Wertesy-steme sowie der Sendeplätzefür Jugendsendungen in diesendrei Ländern im ZeitraumDezember 1995 und Januar1996. Die Leitung des spani-schen Teams lag bei LorenzoVilches gemeinsam mit CharoLacalle, Rosa Alvarez Bercianound einem Team der Univer-sität.
Kontaktadresse:
Lorenzo Vilches, Director, Universitat autònoma de Barcelona, Fac. Ciencias de la Comunicacion, E-08193 Bellaterra, Barcelona, Spanien, Tel.: (34) 3 581 16 89, Fax: (34) 3 581 20 05.
Vereinigtes Königreich:British Film Institute(BFI)Britische Fernsehspiele und -serien können auf eine lange,gut dokumentierte Geschichtezurückblicken. Die Erfolge dersechziger Jahre, von den BBCWednesday Plays bis zu ITC-Serien wie The Avengers (“MitSchirm, Charme und Melone”)kamen sowohl bei der Kritik alsauch wirtschaftlich gut an.Ergänzt wurden sie späterdurch die Entwicklung der bri-tischen Seifenoper, für dieGranadas Coronation Street
ein Paradebeispiel ist. BritischeFernseh-Fiction ist auf demInlandsmarkt äußerst populär,und einige Programme habensich auch auf dem internationa-len Markt gut verkauft.
Es ist eine Binsenweisheit, daßdie einheimischen Serien inden meisten Ländern jedeWoche die besten Quotenhaben. Das Fernsehen ist natio-nal: Fernsehspiele greifen The-men auf, die die Nation bewe-gen, und in Komödien (speziellSitcoms) spiegeln sich oftschwierige Bereiche der kollek-
tiven Psyche wider. Der Filmdagegen ist das internationaleMedium und wird von den Hol-lywood-Majors beherrscht.
Mit dem EUROFICTION-Projekt wird es nun erstmalsmöglich sein, das Profil derFernseh-Fiction in den großeneuropäischen Ländern zu ver-gleichen. Für das BFI, das seitlangem die grundlegendenDaten sammelt, haben wir Gele-genheit, grundlegende kultu-relle Indikatoren in bezug aufdie Publikumsreaktionen zuuntersuchen. Dadurch könnenwir über die simple Quoten-statistik, die der Branche alsMaß aller Dinge dient, hinaus-gehen und die Beziehungenzwischen Zuschauern und Pro-grammen in ihrer ganzen Kom-plexität verstehen. In diesemZusammenhang ist es interes-sant, dem jüngsten Erfolg derBBC-Komödien Ballykissangel
und Hamish Macbeth im tradi-tionellen Ealing-Stil nachzuspü-ren – filmische britische Iden-tität, neu interpretiert imFernsehen der neunziger Jahre.
Am meisten interessiert sichdie Branche natürlich für dieZukunft. Das Gesamtprojektkönnte nicht nur zeigen,welche Schrullen die einzelnenNationalstaaten in Europahaben und wie schwierig es ist,europäisches Fernsehen zumachen, das mit den US-Majorskonkurrieren kann, sondern eskönnte auch klarstellen, daß esbestimmte Bereiche gibt, indenen Kooperationen undKoproduktionen funktionierenkönnen, ohne daß ein “Euro-pudding” entsteht, den nie-
Schaffen von zentraler Bedeu-tung. Sie haben die höchstenZuschauerzahlen, ihre Herstel-lung kostet am meisten unddauert am längsten, und nir-gendwo sonst sind so vieleBerufe beteiligt. Fernseh-Fiction kann auch sehr lang-lebig sein und für einenwirklich internationalen Marktinteressant sein.
Seit rund zehn Jahren führt dieINA Studien durch und veröf-fentlicht Fachartikel überverschiedene Aspekte fran-zösischer Fernseh-Fiction:Sendeplätze und Formate,Zuschauerzahlen, Verkäufeund Wiederholungen, Finanzie-rung und Produktionskostennoch nicht ausgestrahlter Sen-dungen, Beteiligung des Sen-ders, Beziehung zwischen Filmund Fernsehen usw. Nennens-werte Veröffentlichungen sindz.B. La Fiction télévisée,
inventaire, mutations et
perspectives1, die schon 1988das Comeback der Fernseh-Fiction in Frankreich voraus-gesagt hat, Feuilletons et
Séries à la télévision fran-
çaise, généalogies2, die dieGeschichte fiktionaler Pro-gramme im französischenFernsehen nachzeichnet, undLa fiction de 20h303, die dieFernseh-Fiction im Abend-programm in den drei Jahren1988-1990 untersucht.
Einige dieser Analysen habenzu regelmäßigen Publikationengeführt. Der Jahresberichtüber Programmangebot undZuschauerzahlen4 hat die fiktio-nalen Programme wieder inden Kreis der anderen großenProgrammkategorien einge-reiht. Die VeröffentlichungObservatoire de la Création5
bot eine Analyse von fiktiona-len Programmen, Dokumentar-und Trickfilmen, den dreiHauptbestandteilen des Pro-gramms, von der Produktionbis zum Export.
Unsere Arbeit findet jedochüberwiegend im Rahmen einerinternationalen und insbeson-dere einer europäischen Per-spektive statt, wobei die INAsich beteiligt an den komparati-ven Forschungsarbeiten unterder Leitung von Alessandro Siljüber Fernsehserien in Europaund ihren Kampf gegen dieamerikanischen Importe6, aneiner Untersuchung des Aus-tauschs von Fernsehserien mit Europa7 und zuletzt anJean-Pierre Jézéquels ArbeitProduction de fiction en
mand will und niemand sichansieht. Die BBC-SeifenoperEldorado versuchte, die inner-britische Szene mit einemSchuß Europa anzureichern,und fiel durch. Vielleicht wer-den Forschungsarbeiten dieserArt den Grund des Scheiternsfinden.
Dieses Forschungsprojekt wirdzeigen, wie vielfältig euro-päische Fiction ist, und viel-leicht weitere Einblicke inIdentitätsfragen gewähren undmögliche Strategien für denErfolg europäischer Produk-tionsfirmen vorschlagen.
Kontaktadresse:
Richard Paterson, Head, Media Educ./Research, BFI, British Film Institute, 21 Stephen Street, London W1P 1PL, Großbritannien, Tel.: (44) 171 255 14 44, Fax: (44) 171 436 7950.
Frankreich: Institut national de l’audiovisuel (INA)Der Studienbereich der INAgehört zur Forschungsabtei-lung und gibt wertvolle Auf-schlüsse über die Entwicklun-gen, die die Programmangebote(Produktionswirtschaft, Pro-grammpolitik, Wettbewerbusw.) und die Bedingungen desEmpfangs (Zuschauerverhal-ten) beeinflussen.
Angesichts des gestecktenRahmens ist es nur natürlich,daß sich die INA auf die allzeitbeliebten fiktionalen Fernseh-programme konzentriert. Siesind für jedes audiovisuelle
TV-Programme
6 Sequentia Vol. III, Nr. 9, OKTOBER/NOVEMBER 1996
Spanien: Filme und Fernsehfilme nach Ursprungslandpro Sender (%)
Quelle: EUROFICTION Spanien/Universitat Autònoma de Barcelona, Fac. Ciències de la Comunicació.
Sequentia Vol. III, Nr. 9, OKTOBER/NOVEMBER 1996 7
Europe8, die den Einfluß spezi-fischer Nationaleigenschaftenauf europäische Koproduktio-nen aufzeigt.
Eurodience9, der Brief zu Pro-grammen und Zuschauerzahlenin Europa, bietet monatlicheErgebnisse der erfolgreichstenSendungen in jedem Land undbringt regelmäßig Artikel überdie Stellung fiktiver Sendungenin der Programmgestaltungeuropäischer Sender. FürFachleute bietet die INA alsErweiterung dieser Veröffentli-chung die Datenbank Euro TV
Programmes an, die auf Anfor-derung Programme der großeneuropäischen Kanäle sucht,aufzeichnet und analysiert.Dieser neue Service bedeutet,daß die Entwicklungen beifiktionalen Programmen inSerienform (Sitcoms, Soapsund Fernsehserien) jetzt be-obachtet werden können.
1 Im Abonnement verkaufte Studie, INA/Carat-TV, 1988. 2 R. Chaniac und J. Bianchi, For-schungsministerium, 1989. 3 J.-P. Jézéquel,erstellt für CNC und SJTI, 1991. 4 La Télévi-sion de 1983 à 1993, chronique des pro-grammes et de leur public, R. Chaniac und S.Dessault, INA/SJTI, La Documentation Fran-çaise, 1994. 5 Veröffentlicht 1989-1995 in Ver-bindung mit CSA, CNC und SJTI. Seit 1991schöpfte das Kapitel über Exporte aus einerspeziellen Studie, die von der INA durchgeführtwurde. 6 A est di Dallas, RAI-VPT, Rom, 1987;East of Dallas, BFI, London, 1988. 7 Series etfeuilletons, les échanges franco-européens,INA, 1988. 8 CNC/INA/Kulturministerium/LaDocumentation Française, Paris, 1994. 9 ImAbonnement verkaufter Brief. Ansprechpartne-rin: INA/Nicole Debut.
Kontaktadresse:
Régine Chaniac, Euro TV Programmes, INA, 4 Avenue de l'Europe, F-94360 Bry-sur-Marne, Tel:. (33) 1 49 83 20 00,Fax: (33) 1 49 83 31 95.
Deutschland: Universität SiegenDie Stadt Siegen hat zwar einenoch junge Universität, diekürzl ich erst ihr zwanzig-jähriges Bestehen feierte, doch die Arbeit ihrer Medien-wissenschaftler/innen ist inganz Deutschland bekannt. Imwesentlichen auf Initiative desFachbereichs Sprach- und Lite-raturwissenschaften wurdeSiegen 1986 Trägerhochschuleeines DFG-Sonderforschungs-bereichs Bildschirmmedien,des einzigen medienwissen-schaftlichen Sonderforschungs-bereichs überhaupt. Zu Anfangumfaßte der Sonderforschungs-bereich elf Teilprojekte, vondenen sich die meisten mit derdeutschen Fernsehgeschichtemit Blick auf die unterschied-lichsten Programmformen be-schäftigten. Heute umfaßt der
rufen. Außerdem führt dieFAM auch eigenständige Arbei-ten in medien- und kommuni-kationswissenschaftl ichenBereichen durch.
Der deutsche Teil von EURO-FICTION ist in dieses Netzeingebettet: Er leistet einenBeitrag zu den Forschungs-aktivitäten der FAM und wur-zelt in der Arbeit des Projekts“Fernsehen und neue Medienim Europa der neunziger Jah-re”, eines Teilprojekts des Son-derforschungsbereichs Bild-schirmmedien, und erhältzusätzliche finanzielle Unter-stützung von der Landesanstaltfür Rundfunk, der regionalenAufsichtsbehörde für kommer-ziellen Rundfunk in Nordrhein-Westfalen.
Bei seiner Arbeit kann sich derdeutsche Teil von EUROFIC-TION auf eine Reihe laufenderoder bereits abgeschlossenerEinzelprojekte des Sonderfor-schungsbereichs Bildschirm-medien stützen, die sich mitden verschiedensten Aspektenvon fiktionalen Fernsehpro-duktionen beschäftigen bzw.beschäftigt haben, wie z.B. mitder Entwicklung deutscherFernsehserien und Fernseh-spiele oder dem Einfluß ame-rikanischer und englischerFernsehproduktionen auf dasdeutsche Programmangebot.
Kontaktadresse:
Universität Siegen, SFB Bildschirmmedien, Dr. Gerd Hallenberger, Tel.: (49) 271 740 4938, Fax: (49) 271 740 49 43, E-Mail: [email protected].
Sonderforschungsbereich Bild-schirmmedien 16 Projekte, diesich anhand verschiedener For-schungsansätze mit einer Viel-zahl medienwissenschaftlicherFragestellungen beschäftigen,unter anderem auch mit neuenEntwicklungen im BereichFernsehen und Computer.Neben einigen Projekten, dieeindeutig in der Programmana-lyse gründen, wurzeln anderein der Medientheorie, denSozialwissenschaften, der Wirt-schaftstheorie der Rechts-wissenschaft und sogar in derKunstgeschichte.
Diese Mischung von Themenund Ansätzen sollte den frucht-baren Boden für eine interdis-ziplinäre Befruchtung bereiten,was dann auch wirklich gelang.Einerseits war die Idee, For-scher mit unterschiedlichemHintergrund und unterschiedli-chen Interessen zusammenzu-bringen, die Grundlage für dieerfolgreiche Arbeit des SFBBildschirmmedien, anderer-seits wurde dieser Erfolg zumAusgangspunkt für weitereAktivitäten wie die Einführungeines Medienstudiengangs ander Universität Siegen.
I m J a h r 1 9 9 5 w u r d e a l sGemeinschaftsprojekt der Uni-versität Siegen und des KreisesSiegen-Wittgenstein die Fort-bi ldungsakademie Medien(FAM) eingerichtet, die Fort-bildungsveranstaltungen in vierBereichen anbietet, und zwarin der Lehrerfortbildung, zuMedien in Wirtschaft und Ver-waltung, zu Medienkunst und-kultur sowie Fortbildungs-veranstaltungen in Medienbe-
D.R
.
Frankreich: Filme und Fernsehfilme nach Ursprungslandpro Sender (%)
Quelle: EUROFICTION France / INA.
8 Sequentia Vol. III, Nr. 9, OKTOBER/NOVEMBER 1996
TV-Programme
gung” ist der Schlüsselbegriff indiesem Zusammenhang;
b. Die öffentlich-rechtlichen Rund-funkanstalten müssen sich ineinem wachsenden Markt von Pro-grammanbietern behaupten; dieserfordert zunehmend den Einsatzvon sachdienlichen statistischenAngaben und Untersuchungs-ergebnissen. Diese Informationendürfen nicht auf die Empfänger-seite des Kommunikationspro-zesses (Untersuchung der Ziel-gruppe) beschränkt sein, sondernmüssen auch die verschiedenenAspekte des Produktionsver-fahrens und insbesondere desProduktinhalts umfassen.
ESCORT-A: Multidimensionale Klassifikation der SendungenEine gute Klassifikation muß zweiwichtige Voraussetzungen erfüllen:a. Die Informationen müssenzuverlässig sein, das heißt, die Sen-dungen müssen so objektiv wiemöglich klassifiziert werden. DiePerson, die die Zuordnung vor-nimmt, darf nur eine äußerst gerin-ge, wenn nicht gar keine Rolle spie-len; b. Die Informationen müssenebenfalls gültig sein, das heißt, daßdie Informationen auch tatsächlichdas aussagen, was sie (für denBenutzer der Informationen) aus-sagen sollen.
Als die Angaben der Mitglieder zuden ausgestrahlten Sendungenerfaßt wurden, stellte die Statistik-gruppe der EBU fest, daß es sehrschwier ig , wenn nicht sogarunmöglich war, vergleichbareDaten zu beschaffen.
Dies lag in erster Linie daran, daßdie meisten der damals vorhande-nen Verfahren mehrdimensionalwaren, d.h. es handelte sich umVerfahren, in denen jede Sendungnur einmal klassifiziert wird und indenen die Person, die die Zuord-nung vornimmt, aus verschiedenenKlassifikationskategorien solchemit unterschiedlichen Gesichts-punkten auswählen kann.
Einige dieser Klassifizierungskate-gorien stützten sich auf die Funk-tion der Sendung (pädagogisch,informativ), andere auf das Format(z.B. Dokumentarfilm), andere aufden Inhalt (z.B. Sportsendung),andere wiederum auf den ange-strebten Zuschauerkreis (z.B. Kin-dersendung), noch andere auf dieHerkunft der Sendung (z.B. Kino-filme).
Dieser Ansatz führt zu Problemenin den Fällen, in denen die Sen-dung, die klassifiziert werden soll,mehr als einer Kategorie zugeord-net werden kann.
Ein Beispiel: Wenn ein Klassifika-tionsverfahren Kategorien wieLehrfilm, Dokumentarfilm, Sport-sendung, Kindersendung verwen-det (wie es die meisten Klassifika-tionsverfahren tun), kann nichtdavon ausgegangen werden, daßdie Klassifikation eines speziell fürKinder produzierten pädagogi-schen Dokumentarfilms über Sportsehr zuverlässig ausfallen wird; ineinigen Fällen wird die Sendung alsLehrfilm, in anderen als Dokumen-tarfilm oder Sportsendung oderKinderprogramm eingestuft wer-den. Es ist deshalb kaum damit zurechnen, daß die Ergebnisse derKlassifikation besonders gültigsind, da der Benutzer dieser Infor-mation nicht weiß, ob die Kategorie“Lehrfilm” auch Sportsendungenumfaßt oder ob die Kategorie“Dokumentarfilme” auch Doku-mentarfilme für Kinder einschließtusw.
Aus diesem Grund wurde beschlos-sen, ein multidimensionales Ver-fahren zu entwickeln, mit dem jedeSendung in mehr als einer Dimen-sion klassifiziert werden kann,wobei die Sendung in jeder Dimen-sion aus einem anderen Gesichts-punkt betrachtet wird.
Die wichtigsten Dimensionen von ESCORT-ADie fünf wichtigsten Dimensionenzur Klassifikation der Sendungenunter ESCORT-A lauten wie folgt:
1. Intention: Worin besteht dieoffensichtliche Intention der Sen-dung? Hier wird zunächst zwischen“Unterhaltung”, “Information”,“Bereicherung” und “emotionaleBeteiligung” unterschieden.
2. Format: In welcher Form ist derInhalt der Sendung verpackt? Eineerste Unterteilung unterscheidetzwischen: “nicht fiktionale Forma-te” (Nachrichten, Magazin, kom-mentiertes Ereignis, Dokumentar-film, Diskussion usw., Vortrag usw.,mit Text usw.); “Formate mit Spielhandlung” (Fernsehspiele und-serien, Puppenspiele, Zeichen-trickfilme), “Unterhaltungsforma-te” (Show mit Showmaster, Talk-Show, Show ohne Showmaster,Alleinunterhalter) und “Musik/ Ballett/Tanz-Formate” (Solodar-bietung, kleines Ensemble, mitOrchester, mit Chor, Theater, Bal-lett/Tanz).
3. Thema/Inhalt: Wovon handeltdie Sendung oder woraus bestehtsie? Hier wird zunächst unterteiltin: nicht fiktional (allgemein,Lebensphilosophien, sozial/poli-tisch, Sport, menschliche Schick-sale, Freizeit, Kunst & Medien,Geisteswissenschaften, Wissen-schaften), Spielhandlung (mitleichter Thematik, mit ernster The-
Vor einigen Monaten hat die Europäische Rundfunkunion(EBU) die letzte Version ihres Vor-schlags für ein computergestütztesManagementinformationssystemnamens ESCORT 2.4 fertiggestelltund allen Mitgliedern als ein Satz“vereinbarter gemeinsamer Vor-schläge” zugesandt.
Das ESCORT-Verfahren wurde vonder Statistikgruppe der EBU ent-wickelt, die bereits 1978 ihreTätigkeit aufgenommen hat. DieseGruppe wurde eingerichtet, umstatistische Angaben der EBU-Mit-glieder zu allen wichtigen Berei-chen ihrer Tätigkeiten zu erfassen.Der wichtigste Tätigkeitsbereichwurde natürlich durch die ausge-strahlten Sendungen gebildet. Esstellte sich jedoch schnell heraus,daß alle Mitglieder unterschied-liche Klassifikationsverfahrenanwendeten, die eine Erhebungvergleichbarer Daten unmöglichmachten. Um dieses Problem zulösen, bestand eines der Ziele derStatistikgruppe darin, ein Verfah-ren zur Klassifikation der Sendun-gen zu erarbeiten, mit dem ver-gleichbare Daten vorgelegt werdenkonnten. Das Ergebnis dieserBemühungen war ESCORT, ur-sprünglich ein Verfahren zurKlassifikation von Sendungen, dasnach und nach auch auf andereBereiche der Rundfunkaktivitätenausgedehnt wurde und heute alsModell für ein Rundfunkmanage-mentinformationssystem betrach-tet werden kann.
Die ESCORT 2.4-Vorschläge be-stehen aus zwei Teilen, im Folgen-den ESCORT-A und ESCORT-Bgenannt. ESCORT-A betrifft dieKlassifikation der Produkte derRundfunkanstalten, d.h. die Sen-dungen; ESCORT-B bezieht sichauf die Klassifikation der ver-schiedenen Betriebsdaten derRundfunkanstalten, d.h. die Pro-duktionsmittel, die während desgesamten Produktionsverfahrenseiner Sendung eingesetzt werden(Planung, Rechte, Betriebsanlagen,finanzielle Angaben, Mitarbeiter,Untersuchungen usw.).
Der Bedarf für einRundfunkmanagement-informationssystemDa die Stellung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks - aufgrundder zunehmenden Konkurrenz dur-ch private Rundfunkanstalten - anSelbstverständlichkeit verliert, istder Bedarf für ein gutes Verfahrenzur Klassifikation der Sendungengestiegen, und dies aus zwei Grün-den:
a. Die öffentlich-rechtlichen Rund-funkanstalten sind mehr und mehraufgefordert, ihre Existenz zu legi-timieren; “öffentliche Rechtferti-
D.R
.
Europäisches Standardverfahrenzur Klassifikationvon Radio- und Fernsehsendungen (ESCORT)
INFOMEDIAon-line
• Infomedia Internet ProfessionalInfomedia Internet Professional (IIP)verarbeitet Werbeinformationenüber das vollständige Programm derRundfunkanstalten und stellt dieseInformationen ALLEN Herausgebernvon Fernseh- und Rundfunk-programmheften zur Verfügung, die Zugang zu den Listings einerGruppe von Kanälen benötigen. Für die Verlage ist die Arbeit mit denTV- und Radiolistings einfacher, daIIP eine einzige elektronische Quellemit einer Auswahl einheitlich forma-tierter Listings für eine Gruppe vonKanälen anbietet. Die Rundfunk-anstalten haben die Möglichkeit, die Zustellung ihrer Daten anEmpfänger ihrer Wahl zu unter-stützen. Andererseits können auchdie Verlage Abonnent bei IIP werdenund aus 200 ständig aktualisiertenOnline-TV-Programmen, Presse-mitteilungen und Programmhöhe-punkten auswählen. IIP stellt dasDatenmaterial automatisch zu denvom Benutzer im voraus festgeleg-ten Zeiten per E-Mail über Internetzur Verfügung.
• Internet TV GuideInternet TV Guide (ITVG) bietetZuschauern und Zuhörern aus ver-schiedenen europäischen MärktenZugang zu einem umfassendeninteraktiven Electronik ProgramGuide (EPG - elektronischerProgrammführer) im World WideWeb, der an die Bedürfnisse deseinzelnen Benutzers angepaßt wer-den kann. Unter dem Markennamengroßer TV-Zeitschriften, Zeitungenund Rundfunkanstalten ist jedesAngebot länderspezifisch gestaltet.ITVG bietet eine Plattform für elec-tronic publishing und Werbung, über die der Benutzer Erfahrung inder sich schnell verändernden Szene des electronic publishingsammeln kann. ITVG enthält Querverbindungen zu TV-Angebo-ten, sowie Möglichkeiten fürinternationale, nationale und lokale Werbung.
• Infomedia TV ArchiveInfomedia TV Archive bietet einegroße Datenbank aus TV-Pro-grammplänen, die für Such- undAnalysezwecke genutzt werdenkann. Unsere Listings beginnen1991 und enthalten Programmplänein unterschiedlichen kundenspezifi-schen elektronischen Formaten, dienicht über das Internet abgerufenwerden können. Daten aus demInfomedia TV Archive eignen sich fürProgrammplaner und Organisatio-nen, die sich mit Zuschauermärktenund Forschung befassen und zuderen Aufgabe die überwachung derProgramme gehört. Infomedia TVArchive bietet die Möglichkeit zuindividuellen ad-hoc Suchvorgängenauf der Grundlage folgender Krite-rien: Titel, Titel in der Original-sprache, Titel einer bestimmten Folge, Ursprungsland; andere Auswahlkriterien sind ebenfallsmöglich. Nähere Informationen bei unserer Verkaufsabteilung.
•••
Sequentia Vol. III, Nr. 9, OKTOBER/NOVEMBER 1996 9
matik, dokumentarischer Spielfilm,Gedichte/Erzählungen), Unterhal-tung (Spiel-Show, Quiz, Humor),Musik (E-Musik, Jazz, U-Musik,Pop/Rock, Volksmusik).
4. Zielgruppe: An welches Zu-schauer- oder Zuhörersegment rich-tet sich die Sendung? Hier wirdunterschieden zwischen “allge-meines Publikum”, “Altersgruppen”,“regionale Gruppen”, “Minoritäten”,“Berufsgruppen”, “andere Gruppenmit besonderem Interesse”.
5. Herkunft: Für welches Publikumwar die Sendung ursprünglichgedacht? Hier wird unterteilt in:“Fernsehstudio”, “Konzerthalle/Theater”, “Kinoindustrie”, “Video-gramm”, “öffentliches Ereignis”.
In den meisten Fällen wird nachder ersten Unterteilung noch ein-mal unterteilt, und viele Kategorienwerden besonders definiert.
Eine Sendung, die jeder dieser fünfDimensionen zugeordnet wird,kann in angemessener Weisezuverlässig und gültig klassifiziertwerden. Dazu heißt es in dem EBU-Bericht über ESCORT 2.4: “Einmultidimensionales Klassifikations-verfahren kann als eine Methodeverstanden werden, eine Radio-oder Fernsehsendung anhand ver-schiedener Koordinaten in einemmultidimensionalen Raum zu be-schreiben. Das bedeutet ebenfalls,daß die Zuordnung einer Sendungzu einer spezifischen Dimension ansich nicht bedeutungsvoll seinmuß. Nur die Kombination der Ein-teilung in mehreren (in einigen Fäl-len sogar in allen) Dimensionenergibt eine Bedeutung”.
In ihrem Anschreiben nennt dieEBU zwei interessante Vorteile fürdie Einführung dieses Verfahrens:
1. Wenn eine Organisation ausirgendeinem Grund jetzt oder inZukunft beschließen sollte, ihreKriterien für die statistischenBerichte über die Sendungen zuverändern, kann dies einfach durchrelativ geringfügige Anpassungender für die Auswertung der Infor-mationen eingesetzten analyti-schen Software geschehen. Dafürist es nicht nötig, alle Sendungen(der letzten fünf Jahre) vollständigneu zu klassifizieren;
2. Wenn alle EBU-Mitglieder das-selbe ESCORT-A-Verfahren alsGrundlage für ihre Statistiken überdie ausgestrahlten Sendungenanwenden, kann jede Organisationauch weiterhin eigene Kriterien füraussagekräftige Berichte auf derGrundlage dieser Daten zum natio-nalen Gebrauch festlegen. Sie kannaber auch Berichte erstellen, dieinternational vergleichbar sind,indem sie für diesen Zweck ein vonallen genutztes analytisches Soft-wareprogramm anwendet.
Hand gegeben, mit dem das Pro-duktionsverfahren - soweit möglichund erforderlich - verbessert wer-den kann.
Eine der interessantesten Anwen-dungen dieser Informationenbetrifft die sogenannte “Leistungs-analyse”, die den Rundfunkanstal-ten die Möglichkeit gibt, den Ein-satz ihrer (stets beschränkten)Produktionsmittel im Verhältniszur Zufriedenheit des Publikums zuoptimieren.
Weitere EntwicklungenDie EBU hat inzwischen Version2.4 von ESCORT veröffentlicht.Das Verfahren ist noch lange nichtfertiggestellt und ähnelt in einigenAspekten immer noch demsprichwörtlichen Kamel, das dabeiheraus kam, als ein internationalerAusschuß die Aufgabe erhielt, einAuto zu gestalten. Zweifellos wirddie Statistikgruppe der EBU für dieweitere Entwicklung, Verbesse-rung und Anwendung sorgen, dasich das Verfahren auf eine guteGrundlage stützt und seineZweckmäßigkeit, wenn nicht sogarNotwendigkeit kaum in Zweifelgezogen werden kann.
Eine Kopie des vollständigen Berichtserhalten Sie bei: EBU, PermanentServices, P.O. Box 67, CH-1218 Grand-Saconnex-13.57A050.doc.
Paul HendriksenConsultant,
ehemaliger Mitarbeiter der Forschungsabteilung
von NOS, Niederlande.
ESCORT-B: Betriebsdaten der Rundfunkanstalten Die fünf wichtigsten Dimensionenvon ESCORT-B lauten:
1. Information zur Produktion/Beschaffung der Sendung: Eineerste Unterteilung unterscheidetzwischen “Produktionsdatum”,“Herkunftsredaktion”, “redaktio-nelle Zuständigkeit”, “Produktions-land”, “Produktionsart” und “Artder Ausstrahlung”.
2. Informationen zur Programm-planung: Eine erste Unterteilungunterscheidet zwischen “Dauer”,“Häufigkeit”, “Sendezyklus”, “Pro-grammierung”.
3. Informationen zur Sendezeit:Eine erste Unterteilung unterschei-det zwischen “Sendedatum” und“Sendezeit”.
4. Informationen zur Zielgruppen-untersuchung: Eine erste Unter-teilung unterscheidet zwischen“Einschaltquote”, “Reichweite”,“Publikumsanteil”.
5. Finanzielle Daten: Hier wirdunterschieden zwischen “Kosten”,“Mittelbeschaffung”, “Rechte”.
In den meisten Fällen wird nachder ersten Unterteilung noch ein-mal unterteilt, und viele Kategorienwerden besonders definiert.
Wird jede Sendung anhand der ver-schiedenen Dimensionen klassifi-ziert oder beschrieben, wird demManagement der Rundfunkanstal-ten mit den Endergebnissen einnützliches Werkzeug zur Analysedes Produktionsprozesses an die
Einige Angaben zu unserem Klassifizierungssystem:
• Universal Genre Classification SystemDas Universal Genre ClassificationSystem (UGCS) von Infomediabietet die Möglichkeit, verschiedeneProgrammarten konsequent auf TV-Programme aller Art anzuwenden.Mit UGCS erhält der Benutzer derneuen Generation von interaktivenon-screen EPGs zuverlässig dieexakten Suchergebnisse, die erbenötigt. Darüber hinaus stelltUGCS ein wichtiges Werkzeug fürdie Druckmedien dar, da es die kon-sequente Ausgabe von Programm-kategorien ermöglicht. UGCS ist einabnehmerorientierter Dienst, der die maßgeschneiderte Ausgabe vonProgrammkategorien, nach länder-spezifischen Spartendefinitionen undSprachen geordnet, möglich macht.
Und zu unserer Gesellschaft:
• InfomediaInfomedia wurde 1991 als JointVenture zwischen Janet Greco, derGründerin von Infomedia, und Info-partners S.A., einem Informations-technologiekonzern mit Sitz inLuxemburg, gegründet. Janet Grecoist Spezialistin für das Zeitungs-wesen und verfügt über 15 JahreErfahrung in der europäischenMedienindustrie. Ende 1995 wurdeInfomedia umstrukturiert und alsJoint Venture zwischen Frau Grecound dem Medienkonzern CLT MultiMedia mit Sitz in Luxemburg organisiert. Für CLT ist Infomedia ein effizienter und kostensparenderDienst, dessen Angebot sich an alle Rundfunkanstalten und Verlagerichtet. Im April 1996 wurde dasGesamtbild des Unternehmens inder Öffentlichkeit neu gestaltet;gleichzeitig bezog Infomedia neueGeschäftsräume im Zentrum derStadt Luxemburg. Derzeit verfügtdas Unternehmen über eine Gruppevon 18 hoch motivierten Spezialis-ten in den Bereichen Informatik, Ver-lagswesen und Internettechnologie.
Infomedia will seinen Vorsprung als älteste europäische Standard-adresse für TV- und Radiolistings in elektronischer Form weiter aus-bauen. Infomedia ist eine unabhängi-ge Gesellschaft, die unbearbeiteteDaten bei allen Rundfunkanstaltenerfaßt; dabei wird keine Anstaltbevorzugt oder benachteiligt. Dieerfaßten Daten werden von Info-media streng vertraulich behandelt;dabei werden Programmeinzelheitenweder an andere Rundfunkanstaltenoder Kunden verkauft noch in einerWeise zugänglich gemacht, die eineBeeinträchtigung der Interessen derRundfunkanstalten, die Infomediaihre Listings zur Verfügung stellen,darstellen könnte.
Kontaktadresse:Janet GRECO, DirecteurINFOMEDIA4, rue Auguste Neen2233 BELAIRGroßherzogtum LUXEMBURGTel.: (352) 64 92 70Fax: (352) 64 92 71http://www.infomedia.lu
Le ju
ge e
st u
ne fe
mm
e©
TF1
•••
10 Sequentia Vol. III, Nr. 9, OKTOBER/NOVEMBER 1996
Gastgeber der 15. Experten-konferenz über Fernsehspiele im Mai 1996, die von der EBU und dem Audiovisuellen Eurekaunterstützt wurde, war das pol-nische Fernsehen. Die Konferenzfand vom 24. bis 28. Mai statt; dielange Liste der Teilnehmer umfaß-te 75 Delegierte aus 18 Ländern,darunter auch Delegierte mehrerereuropäischer Institutionen.
Das Thema Koproduktion domi-nierte die Konferenz. BesondereAufmerksamkeit wurde der Fragebeigemessen, ob die Koproduktionzwischen Fernsehpartnern vonErfolg gekrönt sein könnte, aberauch Verbindungen zur Filmindus-trie wurden näher untersucht.Dabei wurde ein universellerBedarf des Fernsehens an Fern-sehspielen mit leichter Thematikfestgestellt, die ein Leben wider-spiegeln sol len, auf das derZuschauer relativ leicht reagierenkann.
Lange Zeit waren Film und Fern-sehen zwei getrennte Welten, dieeinander bestenfalls ignoriertenund schlimmstenfalls in Konfliktgerieten. Doch brachte eine Reihevon Veränderungen die beidenzunächst einander näher, um sieheute im Rahmen von Partner-schaften aneinander zu binden.
Diese Beziehung manifestiert sichin drei Dingen: Erstens, das Fern-sehen strahlt als EinkaufspartnerFilmproduktionen aus; zweitens,das Fernsehen investiert alsProduktionspartner in die Film-produktion; und drittens, dasFernsehen befaßt sich als Ver-triebspartner mit den Filmrechten.Daraus ergeben sich mehrere Fra-gen. Worin besteht, vom Stand-punkt der Fernsehgesellschaftenaus betrachtet, der Unterschiedzwischen einer Filmproduktionund einer kleinen Fernsehproduk-tion? Welche sind die Beweg-gründe der Rundfunkanstalten fürdiese neue Art der Partnerschaft?Ist es die Notwendigkeit, nationaleoder europäische Vorschriften zu beachten, oder ist es Eigen-interesse?
Canal+ Poland und TVPZwei Beispiele wurden genannt.Canal+ France ist ein verschlüs-selter Sender, der sich einenNamen als Sport- und Filmkanalgemacht hat; der polnische SenderTVP ist ein öffentlich-rechtlicherSender, der kürzlich eine besonde-re Strategie für Filme entwickelthat. Anhand dieser beiden Senderwurden eine Reihe von Aspektender Kinoproduktion erläutert.
größte Investor in der polnischenFilmproduktion sein.
Ein anderes Beispiel stammte vondem belgischen öffentlich-rechtli-chen Sender RTBF, der pro Jahrrund 25 Fernsehspiele produziertund für die Mehrzahl dieser Fern-sehspiele zur Koproduktion mitunabhängigen Produzenten ver-pflichtet ist. Obwohl die Mittel desSenders knapp sind, kann er dieVorgaben für die jährlich zu pro-duzierenden Filme dank einesSonderfonds, der 1994 einge-richtet wurde und von RTBF und der belgischen Regierungalimentiert wird, erfüllen und seineBeteiligungen aus Fondsmittelnergänzen.
Einige Zweifel an der Wirksamkeitvon Koproduktionen unter demGesichtspunkt der Kosten und derZuschauerzahlen wurden implizitauch im Titel der Eröffnungs-veranstaltung des zweiten Tages(“Halbierte Kosten, halbierteZuschauerzahlen?”) geäußert. DieErfahrungen der Delegierten wur-den durch die Ergebnisse einerUntersuchung der Einschalt-quoten ergänzt, doch mahnten diehohen Kosten von Koproduktio-
Canal+ Poland ist verpflichtet,eine bestimmte Anzahl polnischerFilme auszustrahlen: 1996 sind es40, 1997 werden es 80 Filme sein.TVP ist den polnischen Gesetzenunterworfen, doch gibt es auch einElement der Unternehmerent-scheidung. Was unterscheidet dieBeteiligung an einer Filmkopro-duktion von einer Beteiligung an einer Fernsehproduktion ?Miroslav Bork, der Vertreter despolnischen Fernsehens, machtedarauf aufmerksam, daß die Unter-schiede zwischen Kinofilmen undfür das Fernsehen bestimmten Fil-men über die Größe des Budgetshinausgehen: Auch Unterschiedein der Erzählweise sind möglich.TVP wollte einen Kinofilm produ-zieren und mußte feststellen, daßder deutsche Partner der Optioneines für das Fernsehen produzier-ten Films den Vorzug gab, weil erbefürchtete, daß der Film keinKassenerfolg sein könnte.
Canal+ Poland ist verpflichtet,1995 drei Millionen Zloty und 19964,4 Millionen Zloty in polnischeProduktionen zu investieren.Canal+ Poland wird aller Voraus-sicht nach auch 1997 der zweit-
TV-Programme
Programminformationfür das europäischeFernsehenQuellen der InformationsstelleInnerhalb der Informationsstellesind verschiedene Aktivitäten aufdas Sammeln und die Verbreitungvon juristischen, marktbezogenenund praktischen Informationenüber die Produktion europäischerFernsehprogramme und ihrer Ver-teilung ausgerichtet.
1. Das Statistische Jahr-buch: wird seit 1994-95 veröf-fentlicht. Dieses Referenzwerkliefert umfassende Informationenüber europäische Fernsehpro-gramme sowie eine Zusammen-fassung wichtiger Markttenden-zen. Das Buch enthält Daten überFernsehkanäle, Finanzierungs-möglichkeiten, Budgets, Pro-gramme nach Art und Ursprung,Satellitenfernsehen, Pay-TV-Sen-der, interaktives Fernsehen, Ein-schaltquoten in 29 europäischenLändern und audiovisuelle Pro-duktionen. Die in dem Jahrbuchaufgeführten Statistiken deckendie meisten Sektoren im gesam-ten Europa, von Island zur Türkeiund von Portugal bis Rußland, ab.Zur komparativen Analyse sindauch Daten über die USA undJapan enthalten. EuropäischeAudiovisuelle Informationsstelle.Statistisches Jahrbuch 96. Film-industrie, Fernsehen, Video undneue Medien in Europa. Councilof Europe / Europäische Audio-visuelle Informationsstelle, Stras-bourg, 1996. 300 Seiten, ISBN92-871-2906-1. 249 DEM / 800FRF. Das Buch wird in der Bun-desrepublik Deutschland undÖsterreich exklusiv über denNomos-Verlag vertrieben (Fax Nr: (49) 7221.2104 27).
2. Die PERSKY-Referenz-datei: Die europäische audio-visuelle Informationsstelle hat imJahre 1993 die PERSKY-Refe-renzdatei eingerichtet, um eineÜbersicht über die sich ständigändernde Situation hinsichtlichder Anzahl der Unternehmen zuhaben, die Übertragungs- undSendeeinrichtungen sowie ande-re Dienstleistungen anbieten, diemit dem Fernsehen in Zusam-menhang stehen. Diese Datei sollalle bestehenden Fernsehdienstein Europa enthalten. Die Jahres-berichte werden im Dokumenta-tionszentrum der Informations-stelle gesammelt. Statistiken überdie Finanzierung und die Program-me von Sendern werden inZusammenarbeit mit der EBUStatistic Group und mit IDATE,einer Partnerorganisation der
Ala
rm fü
r C
obra
11-
Die
Aut
obah
npol
izei
© D
.R. R
TL
SK
-Bab
ies
- Cou
ntdo
wn
© D
.R. R
TL
•••
Glanzlichterder Expertenkonferenz der Europäischen Rundfunkunion und des Audiovisuellen Eureka über das Fernsehspiel, Gdansk 1996
Fernsehspiele und Koproduktionen:
Sequentia Vol. III, Nr. 9, OKTOBER/NOVEMBER 1996 11
nen, deren Budget sich häufig nachdem des reichsten Partners rich-tet, zur Vorsicht. Die unausweich-lichen Produktionskompromissebei der Handlung, der Besetzungund dem Schnitt waren allesamtgeeignet, von den kreativen Ener-gien derjenigen, die am meistendamit zu tun hatten, ihren Tributzu verlangen, und diese Kompro-misse waren für die Zuschauerleicht festzustellen.
Dieser skeptische Ansatz setztesich in den ausführlichen prakti-schen Ratschlägen fort, die vondenjenigen gegeben wurden, diefür die Verhandlung schwierigerVerträge zuständig sind. Rechts-systeme, die kaum miteinanderkompatibel sind, wurden zitiertund als Beispiel die in Frankreichund dem Vereinigten Königreichunterschiedliche Auffassung vonder Unantastbarkeit des Rechtseines Autors, Entstellungen seinesWerkes zu verbieten, erwähnt, dievon Rechtsanwälten und Produk-tionsmitarbeiten gleichermaßenbetont wurde. Der unterschied-liche Geschmack des europäischenund des amerikanischen Markteswurden anhand einiger Beispieleerläutert. Die Erfahrung Austra-liens gewährte ebenfalls Einblickin die Art und Weise, wie dieAnforderungen des Landes an dennationalen Inhalt Einfluß auf dieSuche der Produzenten nach Kom-promissen bei der Zusammen-stellung des Produktionsteamsund der Besetzungsliste nahmen,noch bevor Unterstützung bei derFinanzierung der Koproduktiongewährt wurde.
Die Australian BroadcastingCorporation strahlt pro Jahrwährend rund 80 - 100 Stundenaustralische Fernsehspiele aus, dieerstmals einem australischen Fern-sehpublikum gezeigt werden. Inden letzten vier Jahren stammterund 78% dieses Materials ausKoproduktionen, an denen sowohlinternationale Produzenten undFernsehanstalten als auch austra-lische Koproduzenten beteiligtwaren. Neben der Produktion vonSerien und Miniserien mit einerSpieldauer von vier bis sechsStunden bemüht sich ABC Dramaverstärkt um die Produktion vonKurzfilmen und Dokumentarbe-richten für das Fernsehen unddenkt ebenfalls über die Produk-tion von Fernsehspielen mit einerSpieldauer von 50 Minuten nach.Für jede Stunde einer Miniseriezahlt ABC Drama zwischen 200 000 und 250 000 australischeDollar Lizenzgebühren. DieseMiniserie wird in der Regel mitProduktions- und Postproduktions-krediten und -mitteln finanziert, dadie Abteilung nicht viel Geld hatund normalerweise versucht, Kre-dite aufzunehmen und Geld ausanderen Quellen aufzutreiben.
Zu den wichtigsten Finanzierungs-quellen der australischen Film-und Fernsehindustrie gehört dievon der Regierung finanzierte“Filmbank“, die Australian Film
Finance Corporation. Zwar hatABC keinen direkten Zugang zu
reiche Aufzeichnungen von Thea-terproduktionen aus, von denensich tatsächlich viele auf die tradi-tionelle estnische Literatur stüt-zen. Die ungarische Literatur wareine wichtige Quelle für die Fern-sehspiele von MTV, doch nur sechsvon 16 Filmen und Stücken, die1995 produziert wurden, stamm-ten aus dieser traditionellen Quel-le. Der Anteil der zeitgenössischenThemen war hoch, und die einge-kauften Seifenopern kamen beiden Zuschauern sogar besser an. Trotz der Konkurrenz hat YLE inFinnland an einigen Themen fest-gehalten, die Teil der kulturellenTradition des Landes sind, dochauch dies muß unter der Bedro-hung der wachsenden Konkurrenzum Geld und Zuschauerzahlenbetrachtet werden.Der niederländische Sender VARAbeschrieb einen interessanten Ver-such der Suche nach einer neuenGeneration von Autoren undRegisseuren: VARA führt eineDatenbank über diejenigen, diesich und ihre Arbeit bei demUnternehmen vorgestellt haben.Die Sorge um die Zukunft der an-spruchsvollen Fernsehspielpro-duktion war das Thema, das unter-schwellig alle Gespräche auf derKonferenz beherrschte, wobei dieKoproduktion nur eine der Reak-tionen auf den wirtschaftlichenDruck ist. Die Notwendigkeit, dieZuschauer von Fernsehspielen mitleichter Thematik an sich zu bin-den, erzeugte eigenartigerweisesowohl einen Bedarf an vertrauten,zeitgenössischen Geschichten, diein der Sprache des Landes produ-ziert werden, in dem sie auchausgestrahlt werden, als aucheinen Bedarf an den Seifenopernaus Amerika, Australien und dem Vereinigten Königreich, die sich überall großer Beliebtheiterfreuen.Letzten Endes stand diese schein-bar logische Antwort auf dieMittelknappheit, die in dem Ver-such bestand, die Produktionsko-sten zwischen internationalenPartnern aufzuteilen, im Widers-pruch zu diesem Bedarf an manch-mal anspruchslosen, aber belieb-ten Serien, die sich auf nationaleQuellen stützen und zahlreicheZuschauer anziehen. Die europäi-schen Institutionen würden zwei-fellos gerne mehr Zusammenarbeitzwischen ihren Mitgliederorganisa-tionen sehen, doch macht die prak-tische Erfahrung nach wie vordeutlich, daß wir sehr verschiede-ne Länder mit unterschiedlichenZwängen und Geschmäckern sind.Diese Unterschiede machen es zueinem Vergnügen, Europäer zusein, und durch die Erfahrung sovieler Leute aus so vielen Ländernauf diese Unterschiede aufmerk-sam gemacht zu werden, darinbestand der wichtige Diskussions-beitrag dieser Konferenz.
Michael Johnson, früher bei der BBC,
hat die Konferenz im Namen der EBU organisiert.
Mit Dank an Frau Forbin, AudiovisuellesEureka und Frau Sue Smith, AustralianBroadcasting Organisation.
den finanziellen Mitteln der FFC,dafür aber die Koproduzenten vonABC. Das bedeutet, daß die über-wiegende Zahl der von ABC aus-gestrahlten Kurzserien und Mini-serien mit finanziellen Mittelnproduziert werden, die aus in-ternationalen Lizenzgebühren,Vertriebsvorschüssen und Pro-duktionsbeteiligungen der FFCstammen.
Es gibt keine Allheilmittel für Koproduktionen Je länger die Konferenz dauerte,desto deutlicher wurde, daßKoproduktionen nicht das Allheil-mittel sind, für das man sie nochvor zehn Jahren in den Konfe-renzsälen gehalten hatte. Es wurdeanerkannt, daß der Dialog, derheute geführt wird, zum großenTeil darauf zurückgeht, daß Pro-duzenten auf der Suche nachFinanzierungsmöglichkeiten sind,die ihnen bei minimaler Einfluß-nahme ein Maximum an künstleri-scher Freiheit gewähren sollen.Diese Ansicht, die bei Fernseh-schaffenden weit verbreitet ist,war für diejenigen, deren Erfah-rungen aus dem Filmbereich stam-men, wie z.B. diejenigen, die mitEurimages oder Eureka zu tunhaben, nicht so offensichtlich. IhreErfolgsbeispiele waren zahlrei-cher, obwohl auch hier die Gefahrbestand, daß die Beteiligung aneiner multinationalen Produktionnur um der Kriterien willen, dieerfüllt sein müssen, um bescheide-ne internationale Mittel anzapfenzu können, leicht mit Tränenenden konnte. Zwar war die Büro-kratie, die mit der Verwaltung derMittel zu tun hatte, verbessert wor-den, doch waren immer noch vieleDinge zu erledigen und zahlreichekünstlerische Kompromisse not-wendig, bevor Geld, häufig in derForm eines rückzahlbaren Darle-hens, verfügbar wurde.Bei den Vorbereitungen zu dieserKonferenz waren Vertreter vonnationalen Fernsehspielabteilun-gen um eine kurze Darstellung derSituation in ihrem Land gebetenworden. Es konnte nicht ausblei-ben, daß die Mittelknappheit hierein weit verbreitetes Thema war.Sie wurde im Zusammenhang mitdem wachsenden Wettbewerb umdie Zuschauer gesehen, insbeson-dere im Bereich der bei denZuschauern beliebten Fernseh-spiele am einen Ende der Skala.Die Mittelknappheit stellt allerWahrscheinlichkeit eine Bedro-hung für die traditionelleren Lite-raturquellen sowie für Fernseh-spiele am anspruchsvolleren undhäufig auch kostspieligeren, ande-ren Ende der Skala dar.Das ist zweifellos der Fall beimtschechischen Fernsehen, dasüber eine ausgezeichnete Tradi-tion anspruchsvoller Produktionenverfügt, aber einem neuen undsehr ernst zu nehmenden kommer-ziellen Wettbewerb ausgesetzt ist.Aus wirtschaftlichen Gründenstrahlt die Fernsehspielabteilungdes estnischen Fernsehens zahl-
Informationsstelle, zusammenge-tragen. Die Ansprechspartnerinnerhalb der Fernsehanstaltenwerden in die Adressendatenbankder Informationsstelle ORIEL ein-gegeben. Die PERSKY-Daten-bank wurde nach ConstantinPersky benannt. Er benutzte inseiner Rede vom 25. August1900 auf dem InternationalenElektrizitätskongreß - der im Rah-men der Weltausstellung vonParis abgehalten wurde - als er-ster das Wort Fernsehen (“Tele-vision”), um eine Maschine zubeschreiben, die, basierend aufden magnetischen Eigenschaftenvon Selenium, Bilder empfangenkonnte.3. Verbindungen zu euro-päischen Fernsehanstalten:Um ihr Dienstleistungsangebotabzurunden, bietet die Informa-tionsstelle auf ihrem Server einumfassendes Verzeichnis vonInternet-Servern an, die von denFernsehanstalten selbst oder ineinigen Fällen von anderen gutinformierten Organisationen ge-schaffen wurden. Siehe dazuhttp://www.obs.c-strasbourg.fr/eurtv.htm.
4. Bibliographien und Refe-renzlisten über europäischeFernsehprogramme: In Ver-bindung mit unserem MagazinSequentia Nr 9, wird auf unseremInternetsite http://www.obs.c-strasbourg.fr/fictionbiblio.htmeine ausgewählte Bibliographieüber europäische Unterhaltungs-programme veröffentlicht.
5. IRIS - Rechtliche Rund-schau der EuropäischenAudiovisuel le Informa-tionsstelle: wird zehnmal imJahr veröffentlicht. Dieser News-letter enthält kurze Zusammen-fassungen über die neuestenrechtlichen Entwicklungen in derProduktion und in der Distributionaus den Bereichen Film, Fernse-hen, Video, Multimedia und ande-ren neuen Informationstechnolo-gien (mit genauen Referenzen).Eine Liste mit den seit 1995 veröf-fentlichten Artikeln steht demBenutzer unter http://www.obs.c-strasbourg.fr/Irishmain.htmzur Verfügung.
6. Bibliographischer Anhangzu Sequentia: eine Liste derneuesten Veröffentlichungen undHandbücher über Fernsehen undProgrammverbreitung und -pro-duktion kann unter http://www.obs.c-strasbourg.fr/pub.htm ein-gesehen werden.
7. RAP - Ressourcen füraudiovisuelle Produktio-nen: eine Referenzdatei fürFinanzierungsquellen und Finan-zierungsmechanismen innerhalbdes audiovisuellen Sektors, ein-schließlich Fernsehen, in Europa.Die ersten Ergebnisse, die RAPentnommen werden konnten, ste-hen nun in Form eines allgemei-nen Berichts über die finanziellenRessourcen für europäischeSpielfilme zur Verfügung. SolltenSie zusätzliche Information benö-tigen und eine Kopie wünschen,senden Sie bitte ein Fax an FrauLone Le Floch-Andersen unter(33) 03 88 14 44 19.
•••
12 Sequentia Vol. III, Nr 9, OKTOBER/NOVEMBER 1996
TV-Programme
Das Problem der Unzugänglichkeitvieler Quellen erschwert die Pro-grammgeschichtsschre ibungaußerhalb der Sendeanstalten.Senderarchive sind aufgrund recht-licher Problematik für Wissen-schaftler nur in Ausnahmefällenzugänglich - der Sonderforschungs-bereich 240 “Ästhetik, Geschichteund Pragmatik der Bildschirmme-dien. Schwerpunkt: Fernsehen inder Bundesrepublik Deutschland”in Siegen hat mit den Fernsehar-chiven Nutzungsverträge abge-schlossen. Ausgehend von dieserProblematik engagiert sich derehemalige RIAS- Intendant HelmutDrück für die Gründung eines deut-schen Medienarchivs, das auch fürWissenschaftler zur Verfügungstehen soll.Die Programmgeschichtsschrei-bung des Fernsehens erfolgte seitden achtziger Jahren vor allem imRahmen der produktbezogenenliteraturwissenschaftlich orientier-ten Medienwissenschaft. HelmutKreuzer hat nach seinem Postulatüber das “Fernsehen als Gegen-stand der Literaturwissenschaft”(Saarbrücken 1971) 1980 ein Son-derheft der Zeitschrift für Litera-turwissenschaft und Linguistikzum Thema: “Fernsehforschungund Fernsehkritik” herausgege-ben, das den Gegenstandsbereichvorstellte. Bislang dominiert dasBausteinprinzip der Programm-geschichtsschreibung die For-schungsvorhaben. Helmut Kreuzerund Karl Prümm legten in ihremSammelband “Fernsehsendungenund ihre Formen” 1979 eine ersteÜbersicht über die Programm-formen des Fernsehens und ihrehistorische Entwicklung vor. KnutHickethier hatte bereits 1980 eineumfassende Darstellung der histo-rischen Entwicklung des Fernseh-spiels veröffentlicht.
Gründung einer gesonderten ForschungsabteilungMit dem Ziel der Schließung be-stehender Forschungslücken imBereich der Programmgeschichtedes Deutschen Fernsehens grün-dete die DFG den Siegener Son-derforschungsbereich “Ästhetik,Pragmatik und Geschichte derBildschirmmedien. Schwerpunkt:Fernsehen in der BundesrepublikDeutschland”. Der Sonderfor-schungsbereich arbeitet seit 1986in Kooperation mit Wissenschaft-lern der Universitäten Aachen undMarburg und legte auf der Basiseiner Vielzahl von genrebezogenenEinzeluntersuchungen3 - etwa zurGeschichte des Magazinformats,der Nachrichten, des Kinderfern-sehens, der Werbung, des Doku-mentarfilms, der Serien und derFernsehgeschichte der Literatur -mit dem von Helmut Kreuzer undHelmut Schanze herausgegebenen
Peter A. Horns “Damals in Berlinund Paris” (1981) zum BerlinerFernsehen und dem deutschenBesatzungsfernsehen in Paris.Auch die historische Entwicklungvon Spartenprogrammen, insbe-sondere des Kinder- und des Bil-dungsfernsehens ist Gegenstandeiner Vielzal von Untersuchungen.Ellen Marga Schmidt befaßte sichmit der Entwicklung des “Schul-fernsehen in der ARD 1964-1971.”Hans Dieter Erl inger hat imRahmen seines Teilprojektes im Siegener Sonderforschungs-bereich diverse Publikationen zurhistorischen Entwicklung des Kin-derfernsehens herausgegeben.Programmgeschichte ist auch Teilvon Versuchen neuer Geschichts-modellbildung. Axel Schildt hat inseiner kulturhistorischen Arbeit zuden fünfziger Jahren auch dieFernsehgeschichte berücksichtigt.Hans Ulrich Gumbrecht, PeterSpangenberg, Thomas Müller undMonika Elsner haben in diversenPublikationen versucht, historischeFernsehentwicklung und Menta-litätsgeschichte zu verknüpfen.Eine Modellbildung hinsichtlichder Parallelen von historischenEreignissen mit aktuellen Pro-grammentwicklungen ist Teil einerUntersuchung, die gegenwärtig imRahmen des von Knut Hickethiergeleiteten DFG-Projektes “Fern-sehen in den neunziger Jahren” ander Universität Hamburg durch-geführt wird. Strategien der Pro-grammkonkurrenz zwischen ARDund ZDF in den sechziger Jahrenwerden mit aktuellen Programm-planungsstrategien kommerziellerAnbieter verglichen. Es zeigt sich,daß die bisherige Fernsehentwick-lung viele Erklärungsmöglich-keiten für aktuelle Programment-wicklungen liefert und darüberhinaus viel Informationen überErfolgspotentiale von Programm-plazierungen und der Gestaltungvon Fernsehsendungen enthält.
Joan Kristin Bleicher
Frau Bleicher ist wissenschaftliche Mitarbei-terin in einem DFG-Projekt an der HamburgerUniversität, das sich mit der Entwicklung desFernsehens in den 90er Jahren befaßt. Vonihr liegen zahlreiche Untersuchungen zuAspekten der Programmentwicklung desdeutschen Fernsehens vor.
1. Friedrich P. Kahlenberg: Voraussetzung der Pro-grammgeschichte - Die Erhaltung und Verfügbar-keit der Quellen. In: STRGM 1982 Nr.1 S.18-27.
2. Projektgruppe Programmgeschichte: Zur Pro-grammgeschichte des Weimarer Rundfunks.Frankfurt am Main 1986.
3. Jeweils aktualisierte Bibliographien geben eineÜbersicht über den Forschungsstand der einzel-nen Teilprojekte. Zuletzt: Sara Bernshausen;Susanne Pütz; Veröffentlichungen aus dem Son-derforschungsbereich “Bildschirmmedien” III.Siegen 1996.
Band “Fernsehen in der Bundesre-publik Deutschland: Perioden -Zäsuren - Epochen” einen erstenVersuch übergreifender Zäsuren-bildung vor. Datensammlungen alsBasis der Programmgeschichte desFernsehens und der Entwicklungseiner speziellen Sendeformenbilden Joan Kristin Bleichers Chronik zur Programmgeschichte des Deutschen Fernsehens undGerd Hallenbergers/Joachim Kaps“Hätten Sie’s gewußt” zur Ent-wicklung von Game-shows.Als projektübergreifendes zen-trales Werk des Sonderforschungs-bereichs ist die Veröffentlichungder von Helmut Kreuzer und Chris-tian W. Thomsen herausgegebenenfünfbändigen “Geschichte desFernsehens in der BundesrepublikDeutschland” (München 1993), zunennen. Band 1 befaßt sich mitGrundlagen und Rahmenaspektender Programmgeschichte desFernsehens, etwa der Technik-und Institutionsgeschichte. KnutHickethier behandelt die Pro-grammgeschichte des Fernsehensin der BRD; Peter Hoff setzt sichmit der Programmgeschichte desDDR-Fernsehens auseinander.Band 2 befaßt sich mit der histori-schen Entwicklung künstlerischerDarstellungsformen des Fernse-hens, Band 3 mit der Entwicklungvon Informationssendungen, Band4 mit sonstigen Sendeformen,Band 5 mit Handlungsrollen, wieetwa der Autorschaft.Einen Schwerpunkt der Pro-grammgeschichtsschreibung bildetdie Entwicklung des deutschenFernsehens in der Zeit des Natio-nalsozialismus. Klaus Winkler hatin seiner materialreichen Disserta-tion “Fernsehen unterm Haken-kreuz. Organisation, Programm,Personal.” (Köln 1994) die Ent-wicklung des NS-Fernsehensanhand vorhandener Unterlagenaufgearbeitet. Pionier des The-menkomplexes ist Erwin Reiss, der1979 “Wir senden Frohsinn. Fern-sehen unterm Faschismus” publi-zierte. William Uricchio hat sich indem von ihm 1991 herausgegebe-nen Sammelband mit den Pro-grammangeboten des NS-Fernse-hens auseinandergesetzt. Auchpersönliche Erinnerungen vermit-telten subjektive Einsichten inTeilbereiche der frühen Programm-entwicklung. Kurt Wagenführbeschreibt in zahlreichen Beiträ-gen Teilbereiche der Fernseh-geschichte auf Basis seinerlangjährigen Erfahrungen als Fern-sehkritiker. Wiederholt sind in denFernseh-Informationen auch Erin-nerungen von Programmitarbei-tern aus früheren Phasen derFernsehentwicklung enthalten.Etwa die Erinnerungen von GerhatGoebel zum Fernsehsender “PaulNipkow” in Berlin aus den Fern-seh-Informationen Jg. Nr. 33,1982oder die Reihe mit Erinnerungen
Im Rahmen der deutschenMediengeschichtsschreibung tratdie Programmgeschichte des Fern-sehens lange Zeit hinter die Be-schreibung von Entwicklungen derMedientechnik, der Medienpolitikzurück. Sie war bis in die frühenachtziger Jahre hinein vielfach in die Darstellung der Sender-geschichte integriert. Das zeigenu.a. Untersuchungen wie RüdigerNebes Analyse zur Entwicklungdes Saarländischen Rundfunks1955-1978 oder die Dissertationvon Rüdiger Steinmetz über dasStudienprogramm des BayerischenRundfunks. Die Jahrbücher derSendeanstalten vermittelten Rück-blicke in Teilbereiche der eigenenProgrammentwicklung und Höhe-punkte der Programmangebote.Auch Jubiläen boten Anlaß zumRückblick in die eigene Programm-geschichte, so etwa der Rückblickvom ehemaligen SDR-IntendantenHans Bausch auf 30 Jahre ARD.Eine senderübergreifende Institu-tionsgeschichte des Rundfunks in Deutschland wurde von HansBausch 1980 im DeutschenTaschenbuch Verlag vorgelegt.Archivare der Rundfunkanstaltenund Historiker gründeten am10.6.1969 in Ludwigshafen denStudienkreis Rundfunk und Ge-schichte zur Sicherung der Quel-len1 mit dem Ziel der Aufarbeitungvon bundesdeutscher Rundfunk-geschichte. Wiederum stand nebender Entwicklung der Sendeanstal-ten zunächst die Geschichte derMedienpolitik im Zentrum desInteresses. Eine Programmge-schichte schien den Beteiligten alsThemenkomplex zu umfassend zusein. Diskussionen über die Metho-dik der Programmgeschichts-schreibung gingen umfassendenUntersuchungen zur Fernsehge-schichte voraus. Winfried B. LergsBeitrag Programmgeschichte alsForschungsauftrag, eine Bilanzund ihre Begründung in “Stu-dienkreis Rundfunk und Geschich-te Mitteilungen” (STRGM) Jg.8,1982 löste eine Diskussion über dieadäquate Methodik der Programm-geschichtsschreibung aus. Die Pro-blematik des additiven Ansatzes,der Programmgeschichte nur alsSumme aus Bausteinen der Ge-schichte einzelner Programmfor-men möglich erscheinen läßt, hatKnut Hickethier in seinem BeitragGattungsgeschichte oder gat-tungsübergreifende Programm-geschichte? Zu einigen Aspektender Programmgeschichte desFernsehens in STRGM Jg.8, 1982Nr. 3 erörtert. Erst in den achtzi-ger Jahren befaßte sich eine For-schergruppe des Deutschen Rund-funk Archivs (DRA) mit derkonkreten Problematik der Pro-grammgeschichtsschreibung desWeimarer Rundfunks, die etwahinsichtlich der Kategorienbildungauch für das Fernsehen zutreffen.2
Bea
ch B
irds
(199
1) -
Mer
ce C
unni
ngha
m D
ance
Com
pany
- © M
icha
el O
’Nei
ll
Eine verständliche Bibliographiezur Fernsehprogrammierung inDeutschland finden Sie unterhttp://www.obs.c-strasbourg.fr/seqmain.htm.
ProgrammgeschichteDeutschen Fernsehensdes
Sequentia Vol. III, Nr 9, OKTOBER/NOVEMBER 1996 13
In einer Umgebung, in der eineimmer kleinere Anzahl von Unterneh-men immer mehr Kanäle kontrollie-ren, geht mit der Erweiterung desAngebots ein neuer Trend einher: zuKanälen, die Programme zu einemspeziellen Thema bieten. Der nie-derländische Kunstkanaal ist ein Bei-spiel für ein neues, unabhängigesUnternehmen in kleinem Rahmen.Der Stellenwert von Kunst- und Kul-turprogrammen innerhalb der offi-ziellen Fernsehanstalten ist ehergering. Dies scheint jedoch vielmehrauf die Kurzsichtigkeit der Senderzurückzuführen zu sein als auf dasöffentliche Interesse an der Kunst.Die Nachfrage nach Kulturprogram-men ist viel größer als bisher ange-nommen.Die Einführung des kommerziellenFernsehens hat dem bisher geschütz-ten Status der öffentlich-rechtlichenFernsehanstalten ein Ende gesetzt.Dies hat zu e iner zunehmendkommerziellen Programmstrategiegeführt. Dabei gibt nicht allein dieQuantität und Qualität der Kulturpro-gramme auf den öffentlich-rechtli-chen Sendern Anlaß zu Besorgnis.Ein ebenso wichtiger Punkt ist dieTatsache, daß die Programme zuKunst, Kultur und Wissenschaft kei-nen angestammten Platz mehr haben.Kunst- und Kulturprogramme errei-chen nur selten Einschaltquoten überein bis zwei Prozent und werden oftauf wirtschaftlich schlecht nutzbareSendezeiten ‘verbannt’. Kunstpro-gramme werden ausgegrenzt, indemsie abends und nachts zu immer spä-terer Stunde gesendet werden.Wenn das Fernsehen wie jedes ande-re Kommunikationsmittel betrachtetwird, kann es auf die Bedürfnisse spe-zieller Zuschauergruppen ausgerich-tet werden. Bisher konnte dieserAnsatz aus technischen Gründen fürdas Fernsehen und die elektroni-schen Medien nicht verwirklicht wer-den: weil es nicht möglich war, solcheZielgruppen mit speziellen Interesseninnerhalb des Fernsehpublikums zuisolieren. Heute stehen wir vor derdigitalen Revolution, und bald schonwerden 700 Kanäle zur Wirklichkeitgehören. Die Werbeindustrie, die hin-ter all dem steht, hat dann dieMöglichkeit, die Spartensender zubeauftragen, sich auf die besonderenInteressen der Werbebranche einzu-stellen. Dies bietet auch der Kunst-welt die Gelegenheit, einen Kunst-kanal ins Leben zu rufen.Gegenwärtig sind drei Modelle vonInteresse: kommerzielles Fernsehen,Pay-TV sowie regionale und lokaleNetze.1. Kommerzielles Fernsehen: ImZuge der erwarteten Liberalisierungder Gesetzgebung, der die kommer-ziellen Sender in den meisteneuropäischen Ländern unterliegen,werden die aktuellen restriktivenVorschriften gelockert. Das kommer-zielle Fernsehen bietet die bestenVoraussetzungen, um eine möglichstbreite Zuschauerschicht zu errei-chen. Zur Zeit ist es noch recht unsi-cher, Voraussagen der zukünftigenMarktanteile zu treffen. Auf derGrundlage der durchschnittlichenEinschaltquoten lassen sich die Zah-
Was und für wen?Millionen Zuschauer kommen mitKunst hauptsächlich über das Fern-sehen in Berührung. Ziel eines Spar-tenkanals für Kunst und Kultur solltees sein, die (inter)nationale Lage aufdiesem Gebiet darzustellen, indemeiner breiten interessierten sowohlals auch einer spezialisierten, beruf-lich motivierten Zuschauerschicht einvolles Spektrum an Kunst und Kulturgeboten wird.Hierbei sollten Massenkultur undTraditionen zwar nicht außer Achtgelassen werden. Der Schwerpunktsollte jedoch in erster Linie darin lie-gen, dem interessierten Zuschauerund dem Experten die zeitgenös-sische Kunst ohne Kommentar nahe-zubringen. Kunstprogramme sollten an sichschon eine wertvolle Fernseh-erfahrung darstellen. Es sollte dieBereitschaft herrschen, mit Formund Inhalt zu experimentieren. EinenFilm zu senden oder ein Konzert zuübertragen, ist eine Sache. Es istjedoch etwas ganz anderes, Formendes künstlerischen Ausdrucks zu fin-den, die sich speziell die Merkmaleder neuen Kommunikationstechnolo-gie als schöpferisches Mittel zu eigenmachen.Zum vollen Spektrum der Genresgehören:- Aufzeichnung und Adaptation vonLive-Aufführungen;- Film: Spielfilme, experimentelle Fil-me, künstlerische Dokumentationen- Medienkunst, Produktionen speziellfür dieses Medium, Dokumentationenüber die Entwicklungen in Kunst undKultur; Porträts von Künstlern undKulturschaffenden; Programme überunser kulturelles Erbe: Denkmälerund Museen; Interviews und Talk-shows; Aufzeichnungen von Diskus-sionsrunden und Lesungen; Bildungs-programme zum Thema Kunst;kulturelle Aktivitäten.Der größte Teil der Programmbeiträ-ge kann durch Nachforschung imeigenen Land und im Auslandgedeckt werden. Erfolgreiche, vonöffentlich-rechtlichen Fernsehanstal-ten produzierte Sendungen könnenauch erneut ausgestrahlt werden.Produzenten, Repräsentanten,Künstler und Programmgestalter sindeng an der Herstellung von Program-men und Sendungen beteiligt. DerKontakt zu ihnen ist wesentlich.Das Programm muß einen kulturellenVeranstattungskalender enthalten,um den interessierten Zuschauer überdie aktuellen Opern- und Theater-aufführungen und Konzerte zu infor-mieren, (durch Ausschnitte, Kurz-dokumentationen, Interviews etc.).Weltweit wird jeden Tag hochwer-tiges Film- und Hörfunkmaterial pro-duziert. Durch Nachforschungen vomSchreibtisch aus erlangt man Zugangzu den wichtigsten Programmquel-len. Dies führt zu einer einzigartigenVerbindung zu Produktionsnetzenauf der ganzen Welt. Zur Zeit bestehtein reicher Fundus an hochwertigen,unabhängigen Produktionen, die,wenn überhaupt, nur sehr wenigeZuschauer weltweit erreichen.
len grob schätzen. Das Programmwird eine durchschnittliche Ein-schaltquote von ein bis anderthalbProzent haben. Der Marktanteil einesnicht-zielgerichteten Kulturkanalswird auf zwei bis vier Prozent ge-schätzt.2. Pay-TV: Neue Technologien führenzu neuen Mitteln der Verbreitung.Das Senden für eine begrenzteZuschauerschicht wird als idealesMedium für zielgerichtete Program-me angesehen. Die Dienstleistungendes Pay-TV können noch weiter auf-geteilt werden, und zwar in Pay-per-View (Gebühr pro konsumierte Sen-dung) und Video-on-Demand (Filmenach Bedarf). Die DienstleistungenPay-per-View und Video-on-Demandverzeichnen überall in Europa einerasante Entwicklung. Das gleiche giltfür die relativ neue Entwicklung desinteraktiven Fernsehens.Die Kosten für Satellitenübertragun-gen gehen weiter zurück; die relativeKnappheit an Satellitenkapazität wirdzurückgehen, zum Teil aufgrund derEinführung digitaler Komprimie-rungstechniken. Dadurch wird esmöglich, bei gleicher Kapazität mehrProgramme zu übertragen.Es ist sinnvoll, sich an einem bereitsbestehenden Pay-TV-Kanal zu betei-ligen, da so das Risiko gesenkt wer-den kann und keine Investitionen indie spezifische Technologie und dasMarketing getätigt werden müssen.Die Obergrenze an Zuschauern wirdbei etwa zehn Prozent der Haushaltemit Kabelfernsehen liegen. Es ist vonentscheidender Bedeutung, daßneben verschlüsselten Sendungenauch unverschlüsselte Sendungen inder sogenannten “offenen Sendezeit“übertragen werden. Dadurch wird dieZuschauerzahl insgesamt erhöht, undder Kanal dient gleichzeitig alseigenes Marketinginstrument.3. Regionale und lokale Netze: EinQualitätskanal für Kunst und Kulturkönnte auch über lokale und/oderregionale Netze eingespeist werden,die ausschließlich zur Kabelübertra-gung genutzt werden könnten. DerGrad der Einspeisung kann je nachLand unterschiedlich sein, aber bismaximal 80 Prozent der Haushaltemit Kabelfernsehen ausmachen.Theoretisch könnten auf diesemWege ebenso viele Zuschauererreicht werden wie über das kom-merzielle Fernsehen.Hierzu ist die Gründung eines ganzenSendeunternehmens erforderlich.Das Pay-TV steht an zweiter Stelle.Das Wesentliche bei diesem Modellliegt darin, daß das Unternehmenlediglich das Programm zusammen-stellt. Für die Verbreitung, das Mar-keting etc. ist der Partner verantwort-lich, der auch alle Risiken übernimmt.Bei diesem Modell muß ein optimalesGleichgewicht gefunden werden zwi-schen den Sendungen, die nur fürAbonnenten zugänglich sind, undSendungen für die Allgemeinheit inder “offenen Sendezeit“.Das dritte Modell ist weniger attrak-tiv, was zum Teil an den begrenztenMöglichkeiten liegt, durch WerbungGeld zu verdienen.
Ein kleines Budget für Koproduktio-nen könnte einen Anreiz für Künstlerund unabhängige Produzenten bie-ten. Der Kanal könnte - in weit größe-rem Umfang als jede kommerzielleoder öffentlich-rechtlichen Fernseh-anstalt - eng mit nationalen audio-visuellen Institutionen, Fernsehge-sellschaften, unabhängigen Ver-leihern und Bildungseinrichtungenfür Film und Fernsehen zusammen-arbeiten, um Produktionsbeziehun-gen aufzubauen.Obwohl Kunst- und Kulturprogram-me an eine kleine Zuschauergruppein gewissen Ländern gerichtet waren,deutet der zunehmend internationaleCharakter dieses Mediums daraufhin, daß diese Programme auch einenbeträchtlichen Teil der Zuschauerweltweit erreichen könnten.Durch die Gründung von Kunstkanä-len werden neue Märkte für unabhän-gige Produzenten geschaffen. Es wirdeinen neuen Primärmarkt für Pro-gramme geben, die bisher noch nichtim Fernsehen gesendet wurden oderdie neu in Auftrag gegeben wordensind. Außerdem wird es einen neuenSekundärmarkt für Programmegeben, die erst in ein oder zwei Län-dern ausgestrahlt wurden. Es könntesehr wohl auch ein kleiner Markt fürKunstvideos entstehen.
Linda BouwsGeschäftsführerin/
Programmdirektorin
Fernsehenund
Kunst,Kultur
Kunstkanaal Kunstkanaal wurde für diejenigenZuschauer gegründet, die sich fürmoderne Kunst, Kultur und Qua-litätsprogramme interessieren. Seitden ersten Sendungen über dasAmsterdamer Kabelnetz im Jahre1987, hat Kunstkanaal Hundertevon Kunstsendungen in regelmäßi-gen wöchentlichen Programmenüber die Kabelnetze einer wachsen-den Anzahl niederländischer Städteausgestrahlt. Kunstkanaal bietetSendungen über zeitgenössischesKunstgeschehen und Entwicklungenin den Bereichen Theater, Tanz,visuelle Kunst, Literatur, Design,Musik, neue Medien, Architektur,Kunstfilm etc. auf regionaler, natio-naler und internationaler Ebene.Kunstkanaal hat es geschafft, dieLage der Kunstwelt aktuell darzu-stellen. Es geht hier nicht nur umKunst, die die dynamischen undumfangreichen Aspekte des regio-nalen, nationalen und internationalenkünstlerischen Lebens widerspie-gelt, sondern auch um Kunst, diedas übliche Angebot der herkömmli-chen Fernsehkanäle bedeutenderweitert und ergänzt. Kunstkanaaltrifft eine Auswahl aus dem enor-men Angebot an zugänglichen Pro-dukten, unabhängig davon, wohersie stammen. In kleinem Rahmenarbeitet der Kanal auch mit künst-lerischen Organisationen bei Kopro-duktionen zusammen.
Adresse:KunstkanaalP.O.Box 53066NL-1007 RB AmsterdamTel. (31) 20 6271 496Fax (31) 20 6249 368E-mail: [email protected]
14 Sequentia Vol. III, Nr. 9, OKTOBER/NOVEMBER 1996
In Zukunft wird es immerschwieriger werden, das Event-Sponsoring und das TV-Sponso-ring voneinander zu trennen;dies ergibt sich zum einen ausder Art und Weise, wie sich dieKaufverträge für die Fernseh-übertragungsrechte entwickelnund zum anderen aus denMöglichkeiten, die die virtuelleWerbung ahnen läßt.
Die Finanzierung des Sportsüber das Sponsoring setztvoraus, daß sich die in demDreieck Auftraggeber einer
Werbesendung/Veranstalter/
Fernsehsender wirksamen Kräf-te im Gleichgewicht befinden.Das ist heute jedoch nicht mehrder Fall: Im Bewußtsein ihrerdominierenden Position würdeneinige Sportverbände die Sendergerne zu passiven Verteilernmachen und sie gleichzeitig mitweitaus größeren Summen zurKasse bitten, als sie je durch dieWerbung in Verbindung mitdiesen Ereignissen einnehmenkönnten.
Damit profitieren die Veranstal-ter von einer Phase des scharfenWettbewerbs zwischen denFernsehsendern, die in einigenFällen mehr um ihr Ansehen alsum die Zuschauer besorgt sind,die sie von einem solchenEreignis tatsächlich erwartenkönnen.
Wird dem Sport damit aber nichtletzten Endes der Ast abgesägt?
Aber zunächst ein kurzer Aus-flug in die Theorie.
Den Unternehmen werden zweiArten von Produkten angeboten,die gesponsert werden können:
Bei dem ersten Produkt sind alleGegenleistungen präsent, die mitdem Ereignis selbst in Verbin-dung stehen: Werbetafeln am Ortder Veranstaltung, “title sponso-
ring”, gut sichtbarer Namenszugoder Logo auf den Trikots undStartnummern, Zusammenarbeitmit dem Sponsor bei Werbekam-pagnen für die Veranstaltung,Presse- und PR-Kampagnen.
Diese Gegenleistungen bildendas “Sponsoring der Produk-tion”, auch event sponsorship
genannt. Die Fernsehsenderhaben keinerlei Kontrolle überdiese Art des Sponsoring.
Die Veranstalter der Sportereig-nisse und Eigentümer dieserGegenleistungen zwingen denFernsehsendern eine ständigsteigende Zahl dieser gut sicht-bar angebrachten Namenszüge
installieren und die Spannungenzwischen den drei wichtigstenAkteuren verstärken:
1. Sie fungieren als Vermittlerzwischen Sponsoren und Veran-staltern. Die Agenturen, die vonden Veranstaltern beauftragtwerden, verursachen einenWettstreit zwischen den Unter-nehmen, den sie nach Beliebenlenken, mit dem Ergebnis, daßdie Preise, die für den Titel einesoffiziellen Sponsors gezahlt wer-den, in astronomische Höhenklettern.
Erste negative Konsequenz fürdie Fernsehanstalten: Je mehrein Sponsor zahlt, desto strengersind seine Bedingungen, was diesektorielle Exklusivität innerhalbder Werbefläche und des TV-Sponsoring angeht, und destohäufiger sollen Namenszug undLogo des Sponsors auf denBildern von der Veranstaltung zusehen sein, ohne daß dieFernsehanstalten irgendeineGegenleistung dafür erhalten.
Zweite negative Konsequenz für die Fernsehanstalten: DieWerbekunden, die bereits starkin Anspruch genommen werden,haben den Eindruck, für dieselbeSache zweimal zur Kasse gebe-ten zu werden, wenn sie TV-Wer-beflächen (Spots oder Sponso-ring) kaufen müssen, um ihreAktion bekannt zu machen.
2. Dieselben Agenturen fun-gieren auch als Vermittler zwi-schen Veranstaltern und Fern-sehsendern. Sie organisierenund leiten die Versteigerung zwi-schen den konkurrierenden An-stalten und tragen auf dieseWeise mit dazu bei, die Preis-spirale für die Übertragungs-rechte in die Höhe zu treiben -noch eine negative Konsequenzfür die Fernsehanstalten.
3. Und schließlich sorgen dieAgenturen dafür, daß in die vonden Fernsehanstalten unter-zeichneten Verträge Bestimmun-gen aufgenommen werden, diedem Schutz der offiziellen Spon-soren noch größere Bedeutungbeimessen und von dem Willengeprägt sind, über die Werbe-flächen vor und nach den betref-fenden Ereignissen zu verfügen.
Somit ist es den Marketingagen-turen gelungen, sich als zwin-gend vorgeschriebener Vermitt-ler zwischen den Werbekundenund den öffentlichen Werbeun-ternehmen zu etablieren mitdem Ziel, über das Sponsoringund die Werbeflächen im Fern-
und Logos auf, die sie in derRegel von Marketingagenturenvertreiben lassen. In vielen Fäl-len übernehmen diese Agentu-ren im Namen derselben Veran-stalter auch den Verkauf derÜbertragungsrechte an die Fern-sehanstalten.
Das zweite Produkt bezeichnetman als TV-Sponsoring (broad-cast sponsoring); es besteht ausGegenleistungen, die mit denübertragenen Ereignissen inZusammenhang stehen und vonden Fernsehanstalten eingeführtwerden.
Dabei handelt es sich um Ankün-digungen oder Hinweise auf dasTV-Sponsoring (TV billboardsoder sponsored credits), ge-sponserte Vorschauen auf dasEreignis (sponsored trailers),Einblendungen (injections)usw., die mit der klassischenWerbefläche kombiniert werdenkönnen.
Die Fernsehsender, die Eigentü-mer dieser werblichen Gegen-leistungen sind, vertreiben dieseüber ihre Verkaufsabteilung oderüber ihr öffentliches Werbeun-ternehmen (régie publicitaire).
Die meisten Sportverbändebesitzen ein Monopol; ihnensteht eine ständig steigende Zahlkonkurrierender Fernsehsendergegenüber. Diese konkurrierenmiteinander nicht nur um den Bekanntheitsgrad, sondernnatürlich auch um die Aufmerk-samkeit der Zuschauer, die mitden Sportereignissen gewonnenwerden können.
Mehr war nicht nötig, damit diePreise für die Fernsehübertra-gungsrechte in astronomischeHöhen kletterten und die sonsti-gen Bedingungen, die den Fern-sehsendern von den Veranstal-tern aufgezwungen wurden(Mindestsendezeiten, Vorzugs-rechte für offizielle Sponsorenusw.) schlicht und einfach alsEinmischung bezeichnet werdenkönnen.
In diesem Zusammenhang solltedie Rolle, die die Marketingagen-turen der Veranstalter spielen,näher beleuchtet werden. Siestel len gewissermaßen denverlängerten Arm der Verbändedar: Ihre Aufgabe besteht darin,die (Geld-)Angebote der Werbe-kunden und Fernsehanstalten indie Höhe zu treiben. Über diesenAuftrag hinaus wollen sich dieMarketingagenturen aber auchunentbehrlich machen, indemsie sich mitten in dem Dreieck
TV-Programme
EGTA
EGTA, European Group of Tele-vision Advertisers, ist eine inter-nationale Organisation belgischenRechts, die 1974 von der EBU(Europäische Rundfunkunion) undmehreren öffentlichen Werbe-unternehmen (régies publicitaires)gegründet wurde. Heute gehörenihr 27 öffentliche Werbeunterneh-men oder Vermarktungsabteilun-gen von EBU-Mitgliedern aus 22 europäischen Ländern an.
EGTA, die ein echter Berufs-verband ist, vertritt die Interessenihrer Mitglieder auf europäischerEbene. Dazu greift EGTA auf eineständige Vertretung mit Sitz inBrüssel zurück, deren Tätigkeitsich auf folgende Bereicheerstreckt:
– Europäische Angelegenheiten;
– Studien und Untersuchungen imBereich der Zuschauermärkte;
– Marketing und Verkaufs-methoden;
– Werbung und neue interaktiveMedien;
– Unterstützung neuer Mitglieder;
– TV-Sponsoring und Sponsoringvon Sportereignissen.
Auf europäischer Ebene beteiligtsich EGTA aktiv an der Überprü-fung von Gesetzestexten, z.B. der Richtlinien Fernsehen ohne Grenzen und über dieInformationsgesellschaft, undbetätigt sich als Gesprächspartnerder europäischen Behörden, wenndie Interessen ihrer Mitgliederbetroffen sind.
Zusammen mit den Agenturen,den Werbekunden und anderenMedien tritt EGTA für das Prinzipder Selbstdisziplin des Berufs-standes ein. EGTA unterstütztaktiv EASA (European AdvertisingStandards Alliance).
Im Rahmen der EBU bemüht sichEGTA, bei den Fernsehsenderndas Bewußtsein für Fragen derWerbung zu fördern.
Kontaktadresse:EGTAMichel GREGOIRE, GeneralsekretärRue Colonel Bourg 133B-1140 BruxellesTel.: (32) 2.730.44.49Fax: (32) 2.726.39.35
Übertragungsrechte für diese Sportereignisse und Sponsoring der Übertragung im Fernsehen
SponsoringSportereignissen,von
Sequentia Vol. III, Nr. 9, OKTOBER/NOVEMBER 1996 15
sehen mehr und mehr Macht zugewinnen.
Daraus folgt, daß die Haupt-akteure (die Fernsehanstaltenund ihre Werbeunternehmen,die Veranstalter und die Werbe-kunden) nicht mehr direkt mit-einander verhandeln und nurnoch mit den Vermittlern zu tunhaben.
Neueste EntwicklungenBisher haben die Werbekundendavon abgesehen, die Rentabi-lität ihrer Investition in dasSponsoring des Ereignisses mitderselben Gründlichkeit zu be-urteilen, die sie bei den Werbe-flächen oder dem Sponsoring imFernsehen walten lassen. Nungibt es aber erste Studien überdie Wirksamkeit und das Einprä-gen der Bandenwerbungensowie erste Versuche, die “Kon-takte” zu bewerten, die demSponsor über seinen sichtbarenNamenszug oder sein Logo amOrt der Ereignisse geboten wer-den; aufgrund der Ergebnissemüssen die Werbekunden einMißverhältnis zwischen derfinanziellen Investition und derwerblichen Gegenleistung fest-stellen.
Dem versuchen die Sportverbän-de und ihre Marketingagenturenzuvorzukommen, indem sie vonden Fernsehanstalten die Ein-blendung von allerlei Logos indas Fernsehbild verlangen, dieihren Sponsoren zum Vorteilgereichen sollen. Diese gut sicht-baren Beschriftungen sind aberEigentum der Fernsehanstaltenund Bestandteil der Produkte,die in der Regel denjenigen Wer-bekunden angeboten werden, diedie Übertragung des Ereignissesim Fernsehen unterstützen.
In diesem bereits sehr bewegtenUmfeld machen nun erstmalsVerfahren der virtuellen Wer-bung von sich reden (L-VIS sys-tem in den Vereinigten Staaten,EPSIS in Frankreich, ORAD undSCIDEL in Israel). Zunächst seidaran erinnert, daß es sich umein System handelt, mit dem ineinem Fernsehstudio anstelleder tatsächlich auf der Bandevorhandenen Werbung einevirtuelle Werbetafel elektronischin das Bild eingefügt werdenkann; dabei findet am Ort desEreignisses keine Veränderungstatt und der Fernsehzuschauerkann auch nicht feststellen, daßsich etwas verändert hat.
Es leuchtet ein, daß ein solchesSystem das Sportmarketing voll-
ständig verändern könnte. Dasgilt nicht nur für die Art und Wei-se, wie die Fernsehrechte ver-marktet werden, sondern auchfür den Verkauf der Werbung, dadie bisher als “Bandenwerbung”bezeichnete Werbung elektro-nisch in das Bild eingefügt wer-den könnte, so wie es heuteschon bei der Wiederholung desNamens des Sponsors und denEinblendungen praktiziert wird.
Schon träumen einige davon,daß es in Zukunft möglich seinwird, die Fernsehsender von derVerantwortung für den Inhaltder Übertragung durch den Ver-kauf (zum Höchstgebot) eines“schlüsselfertigen” Programmszu entbinden, in dem virtuelleWerbung, verschiedene Einblen-dungen und andere Namenszügeoder Logos lückenlos von denVeranstaltern festgelegt und denWerbekunden zu noch höherenPreisen angeboten werden.Damit würde der Wettbewerbzwischen dem Sponsoring vonEreignissen und dem Sponsoringim Fernsehen tatsächlich ver-schwinden, und die Sportverbän-de erhielten ein absolutes Mono-pol über die Werbung in Ver-bindung mit den Ereignissen undihrer Übertragung im Fernsehen.
Mit einem Wort: Damit wirdnicht nur der Finanzierung desSports die Grundlage entzogen,diese Möglichkeiten verführenauch dazu zu glauben, daß esmöglich ist, sich in einer Umge-bung, in der Einigkeit undZusammenarbeit unverzichtbars ind, a ls Einzelkämpfer zubewähren: Ohne freiwil l igeBeteiligung der Fernsehanstal-ten gibt es keine großen Sport-ereignisse mehr!
Um der Preisspirale ein Ende zusetzen, um die Zukunft derSportereignisse zu gewährleistenund deren Ausstrahlung imFernsehen zu fördern, ist es not-wendig, daß die Veranstalter aufder einen und die Fernsehsenderauf der anderen Seite eine part-nerschaftliche Zusammenarbeitvereinbaren, in die sie ihre jewei-ligen Beiträge einbringen, umsicherzustellen, daß möglichstviele Zuschauer nach wie vorZugang zu einer mögl ichstgroßen Auswahl an Sportdiszipli-nen haben.
Michel Grégoire
Dieser Beitrag wird in “Kommerzielle Kom-munikationen” erscheinen, eine von der GDXV der Europäischen Union gesponserte Zeit-schrift über Politik und Praxis der Werbungund des Marketing.
Europäische Verleiher von TV-Programmenschließen sich zusammenDrei Jahre der erfolgreichen Zusammenarbeit zwischen den führenden europäischen Fern-sehgesellschaften überzeugten deren Manager davon, daß die Zukunft tatsächlich in derZusammenarbeit liegt. In der Folge entstand 1995 eine neue Initiative der Programmindustrie:die Audio-visual Media Marketing Initiative Europe, kurz AMMIE genannt. AMMIE wurde mitdem Ziel gegründet, den Verleih europäischer audiovisueller Produktionen zu fördern und dasImage Europas weltweit zu verbessern. Die Initiative ergibt sich aus der allgemeinen Kenntnisvon den Schwächen Europas auf diesem Gebiet - eine zerstückelte Fernsehindustrie und einmanchmal negatives Image bei den Programmeinkäufern - sowie aus der Einsicht, daß es eingroßes Potential für die Absatzsteigerung und die Schaffung von Arbeitsplätzen gibt.
Die Initiative selbst ist das Ergebnis einer praktischen Tätigkeit, die den chinesischen Markteffektiv für europäische TV-Programme geöffnet hat. Als die europäische Fernsehindustriesich als geschlossene Einheit präsentierte, konnte ein unerwarteter Zugang zu diesem Marktgeschaffen werden.
Aus dem China-Projekt wurde ein umfassendes und kohärentes Marketingprojekt. Dazu gehö-ren zweimal pro Jahr Reisen nach China, die Teilnahme an den großen Fachmessen,regelmäßige Werbung über ein Mitteilungsblatt in chinesischer Sprache, die Einladung einerständig steigenden Zahl chinesischer Delegationen nach Europa und - natürlich - ständigeMarktforschung. Zusammen mit hohen Beamten der Europäischen Kommission versuchtAMMIE, Einfluß auf die chinesischen Behörden zu nehmen, beispielsweise in Fragen des Urhe-berrechts und des besseren Zugangs zum chinesischen Markt.
Ausweitung der erfolgreichen China-Strategie
Heute zählt AMMIE bereits mehr als 30 Mitglieder aus praktisch allen Mitgliedstaaten, diemeisten stammen jedoch - erwartungsgemäß - aus Frankreich, dem Vereinigten Königreich undDeutschland. Mehr als die Hälfte der 50 führenden audiovisuellen Unternehmen Europas -sofern sie sich mit dem Fernsehen befassen - sind inzwischen direkt oder über ihre Vertriebs-abteilung Mitglied von AMMIE geworden.
Am Anfang wurde das China-Projekt in erster Linie von den öffentlich-rechtlichen Rundfun-kanstalten unterstützt - sie verfügen in der Regel über einen größeren Programmkatalog undsind sich ihrer “öffentlichen Aufgabe“ bewußt. Inzwischen zählen auch kommerzielle Fern-sehsender sowie eine ständig steigende Zahl größerer unabhängiger Produktions- und Ver-triebsgesellschaften zu den Mitgliedern. Im Rahmen ihrer Aktivitäten ist AMMIE auch zurZusammenarbeit mit Nicht-Mitgliedern bereit. Dazu zählen Verleiher wie BBC Worldwide undOrganisationen wie TV France International.
Gestärkt durch die breite Unterstützung der Industrie fand der erste europäische Workshopzum internationalen Programmverleih im Dezember 1993 in Maastricht, der Stadt mit demgroßen europäischen Symbolcharakter, statt. Nach einer ausführlichen Analyse der europäi-schen Wettbewerbsposition wurde hier eine umfassende, gemeinsame europäische Marke-tingstrategie entwickelt. Im Anschluß an die Beratungen mit der Industrie, die im letzten Jahrdurchgeführt wurden und an denen sich mehr als 100 professionelle Verleiher beteiligten,wurde die Strategie überarbeitet und befindet sich jetzt in der Durchführungsphase.
AMMIE heute
Die kombinierten Werbeanstrengungen von AMMIE in China sind heute größer als die alleranderen europäischen Mitbewerber. Der Programmverkauf nach China ist gegenüber demersten Jahr des Projekts um mehr als eintausend Prozent gestiegen. Beim Verleih zählt dieGröße mehr als alles andere: die Größe des Katalogs und die Größe der Vertriebsanstrengung.
Die regionalen Aktivitäten von AMMIE, erstmals in China durchgeführt, wurden Anfang desJahres in Osteuropa fortgesetzt. Bei einem Besuch in Vietnam, der ausschließlich der Vorbe-reitung diente, wurden die Grundlagen für eine längerfristige Anstrengung geschaffen, mit demZiel, eine europäische Präsenz innerhalb dieses neuen “asiatischen Tigers“ zu etablieren,bevor dieser vielversprechende Markt von einem anderem Unternehmen oder Land beherrschtwird. AMMIE setzt sich in der Tat mit ganzer Kraft für die Förderung europäischer audio-visueller Produktionen in Asien ein.
Im August wurde ein gemeinsamer europäischer Stand auf der ostasiatischen Programmessein Kuala Lumpur eingerichtet. Auf der MipAsia in Hongkong wird AMMIE ebenfalls mit einemgemeinsamen Stand vertreten sein. Im Vorgriff auf die Programmesse in Bombay im kom-menden November wird eine Studienreise nach Indien organisiert.
Weitere regionale Initiativen für den afrikanischen und den nord- und südamerikanischen Marktsowie umfangreiche Marktuntersuchungen und eine Reihe von Ausbildungsprogrammen befin-den sich in der Planung. Auf der MipCom wird erstmals ein paneuropäischer TV-Programm-katalog vorgestellt, der über das Internet zugänglich sein wird. Im Rahmen einer gemeinsamenAnstrengung mit Philips New Media soll die neue CDI-Online-Technologie von Programm-einkäufern bei ihrer Suche nach Programmen und Serien zur optimalen Abrundung ihres Pro-gramms als wirksames Suchwerkzeug genutzt werden. Mit der CDI-Komponente wird esmöglich sein, Videoausschnitte ausgewählter Programme vorzuführen.
Und schließlich ist der audiovisuelle Sektor sowohl in den Augen der Industrie als auch dereuropäischen Institutionen eine Industrie mit sehr großem internationalen Potential, die auchzahlreiche Arbeitsplätze schaffen kann. Dies wird eindeutig durch die Tatsache belegt, daß derEU-Kommissar für Handel, Sir Leon Brittan, die Mitglieder von AMMIE aufgefordert hat, sichan einer Handelsmission auf höchster Ebene nach China zu beteiligen, die Mitte Novemberstattfinden wird. AMMIE lädt diejenigen internationalen Verleiher, die noch nicht Vollmitgliedsind, ein, sich an der gemeinsamen Anstrengung, die europäische audiovisuelle Produktionweltweit zu einem Begriff zu machen, zu beteiligen.
Peter Kraewinkels, Generalsekretär, AMMIE
Kontaktadresse:AMMIE, the Audio-visual Media Marketing Initiative EuropeEuropartners House - Rue Joseph II, 122-124 - B-1000 Brüssel, Belgienhttp://www.ammie.org/E-Mail: [email protected].
Mitglieder
Zu den Mitgliedern von AMMIE gehören Antenna TV, BRB, BRTN, Canal + Distribution, Chan-nel IV International, CTE Carlton, Deutsche Welle, Endemol, ERT, EuroPartners, ICTV, TheIrish Trade Board (Screen Ireland), ITE, MCM International, NDR International / ARD, NIS FilmDistribution Holland, NOS, Octopus Media, ORB, ORF, RTBF, RTVE, SACIS, SVT, Télé-images, Telewizja Polska, Transtel, TV2 Danmark, Yorkshire Tyne Tees Television.
16 Sequentia Vol. III, Nr. 9, OKTOBER/NOVEMBER 1996
Es ist allgemein bekannt, daßinternationale Koproduktionen inden letzten fünf bis zehn Jahreninnerhalb des westeuropäischenFilmsektors zunehmend selbst-verständlich geworden sind. Inden Mitgliedsländern der Euro-päischen Union wurden 1993mehr Filme koproduziert als inden vergangenen zwanzig Jahren(Screen Digest, Juli 1994). Darü-ber hinaus sind Koproduktioneninzwischen auch bei der Produk-tion von Fernsehprogrammen all-gemein üblich.
Bei der Suche nach den Ursachenfür diese Entwicklung wurdenmeistens die ökonomischen As-pekte der Film- und Fernsehpro-duktion ermittelt. Am häufigstenwird zweifellos der Umstanderwähnt, daß es heute zunehmendschwierig ist, Filme und Fernseh-programme vollständig aus natio-nalen Mitteln zu finanzieren. EinFernsehproduzent erklärte daswichtigste Motiv für die Kopro-duktion folgendermaßen: “Esführt kein Weg an dem Postulatvorbei, daß Koproduktion dieWahl des armes Mannes ist”.1
“Arm” bedeutet hier nicht notwen-digerweise klein, da einige derArmen über große Budgets verfü-gen. Tatsache ist, daß sie nichtsoviel Geld besitzen wie sie gernehätten - jedenfalls nicht genug, umProduktionen mit großem Budgetzu realisieren. Finanzierungs-schwierigkeiten waren für einigeProduzenten der Anlaß, nach Gel-dern aus dem Ausland Ausschauzu halten und Ressourcen mitausländischen Produzenten zukombinieren. Diese Situation lie-fert eine Erklärung für die Einfüh-rung verschiedener nationaler undinternationaler Anreize zur Förde-rung von Koproduktionen, einwichtiger Faktor, der zum Anstiegder Koproduktionstätigkeit bei-getragen hat.
Obwohl Faktoren im Zusammen-hang mit den ökonomischenAspekten der Film- und Fernseh-produktion zweifellos die wichtig-sten Gründe für den Anstieg derKoproduktionen darstellen, gibt esauch noch andere Gründe. Hierzugehören die gestiegene internatio-nale Orientierung der Regisseureund Produzenten und die steigen-de Nachfrage nach Filmen undProgrammen, die durch die Ver-vielfachung der Fernsehkanäleund Programmstunden verursachtwird. Bei all diesen Gründen han-delt es sich in Wirklichkeit umVeränderungen in den Vorbedin-
Filmen, weil sich die Partner einerKoproduktion in der Regel gegen-seitig an ihren Projekten beteili-gen.
In Europa werden Koproduktio-nen allgemein so finanziert, daßjede Gesellschaft im eigenen Landfür den eigenen Anteil am Budgetsorgt. In kleineren Ländern wer-den dafür zumeist Subventionender nationalen Filmstiftung be-antragt und ein Fernsehsendergesucht, der vorab die Fernseh-rechte an dem Film erwirbt.Einkünfte aus anderen Vertriebs-kanälen sind zu gering, um indieser Phase eine große Rolle zuspielen. Europäische Produktions-gesellschaften sind in der Regel soklein, daß es ihnen schwer fällt,Filme aus eigenen Mitteln zufinanzieren, eine Tatsache, die siesogar bei Minderheitsbeteiligun-gen sehr stark von nationalenFinanzierungssystemen abhängigmacht. Wenn in einem Land dieökonomischen Vorbedingungenfür Koproduktionen gut sind,bedeutet dies somit, daß diesesLand über ein gutes System derFilmsubventionierung verfügt unddaß die Nachfrage nach Filmenausreichend ist. Darüber hinausist auch die Mitgliedschaft in inter-nationalen Filmstiftungen notwen-dig, da die Koproduktionspartnerhier einen gemeinsam Antrag aufProduktionszuschüsse oder -dar-lehen stellen.
Zwischen den Motiven und Vorbe-dingungen für internationaleKoproduktionen besteht offen-sichtlich ein Widerspruch. Um eseinfach auszudrücken: Je schwä-cher das nationale Finanzierungs-system ist, desto größer ist derBedarf der Produzenten anausländischen Geldern und damitauch an Koproduktionen.
Prüfstein für die gemeinsame KulturInternationale Koproduktionensind ebenfalls ein Prüfstein für diegemeinsame Kultur, im Falle derEuropäischen Union sogar einweiterer Prüfstein für die ge-meinsame europäische Kultur.Regelmäßige Koproduktionen, andenen Gesellschaften aus ver-schiedenen Ländern beteiligt sind,setzen voraus, daß die Kulturendieser Länder genügend Gemein-samkeiten aufweisen. Dieser An-spruch bezieht sich auf den Druck,der in jedem der beteiligten Län-der auf Koproduktionen lastet.
gungen für internationale Kopro-duktionen; Vorbedingungen, diekontinuierliches und umfassendesKoproduzieren ermöglichen odererleichtern. Welche sind also dieseVorbedingungen? Warum istKoproduzieren in einigen Länderneinfacher als in anderen? Warumschließen sich Produzenten ausbestimmten Ländern so häufigzusammen? Ich habe versucht, dieVorbedingungen herauszuarbei-ten, indem ich mich näher mitinternationalen Koproduktionenals eine Art des Filmemachensund Produzierens beschäftigthabe; was ist kennzeichnend fürinternationale Koproduktionenund inwiefern unterscheiden siesich von nationalen Produktioneneiner einzigen Produktionsgesell-schaft? Dabei erwies sich das cha-rakteristischste Merkmal vonKoproduktionen - ihre Verschie-denartigkeit - als Hindernis. Da dieStudie in Finnland durchgeführtwurde, werden die Vorbedingun-gen aus der Sicht eines kleineneuropäischen Landes untersucht.2
Im Folgenden werden die Vorbe-dingungen internationaler Kopro-duktionen als Prüfsteine für dieLänder, Filme und Filmemacherdargestellt. Damit soll die Tat-sache hervorgehoben werden, daßdie Existenz dieser Vorbedingun-gen nicht als selbstverständlichbetrachtet werden sollte. Selbstdie gestiegene Zahl der Koproduk-tionen bedeutet nicht notwendi-gerweise, daß Koproduzierenüberal l und jederzeit e inemögliche oder erfolgreiche Strate-gie darstellt.
Prüfstein für die nationale FilmfinanzierungInternationale Koproduktionenstellen die nationalen Systeme derFilmfinanzierung auf die Probe, daeine der Vorbedingungen für kon-tinuierliches Koproduzieren insignifikantem Umfang darin be-steht, daß Produzenten finanzielleMittel aus ihrem eigenen Landerhalten. Ein Produzent, der nachausländischen Partnern und Gel-dern sucht, aber keine nationalenfinanziellen Mittel erhält, hat sicheine äußerst schwierige, wennnicht unmögliche Aufgabe gestellt.Ist dagegen ein Großteil desBudgets bereits sichergestellt,erscheint das Projekt in vielen Fäl-len für ausländische Mittelgeberinteressanter (Light, 1994). Darü-ber hinaus erhalten Produzentenhäufig Gelder für Minderheits-beteiligungen an ausländischen
Märkte und Werke
Culture and the Media UnitStatistics FinlandCulture and the Media Unit of Sta-tistics Finland, die Abteilung Kultur& Medien des nationalen statisti-schen Instituts Finnlands, führtUntersuchungen in den BereichenKultur und Medien durch undveröffentlicht statistische Angabenhierzu. Die Berichte stützen sichauf statistisches Material, das vonStatistics Finland und einigenanderen Instituten erhoben wird.Zu den Berichten gehört FinnishMass Media, ein statistischesKompendium, das alle Mediensek-toren abdeckt und im Abstand vonzwei Jahren veröffentlicht wird.Die Tabellen zu den Berichten derAbteilung Kultur & Medien werdenin finnischer und englischerSprache vorgelegt; eine Zusam-menfassung der Berichte wirdebenfalls in englischer Spracheveröffentlicht.
Nähere Informationen bei:Statistics Finland,Culture and the Media,FIN-00022 HelsinkiFax: (358) 9 1734 3264
Rauli Kohvakka(Audiovisuelle Medien)Tel.: (358) 9 1734 3448E-Mail: rauli.kohvakka@stat,fi.
Mirja Liikkanen(Kultur)Tel.: (358) 9 1734 3459E-Mail: [email protected]
Tuomo Sauri(Medien)Tel.: (358) 9 1734 3449E-Mail: [email protected]
europäische KulturEin weiterer Prüfstein für die gemeinsame
und bestimmte andere Dinge
Internationale Koproduktionen:
Sequentia Vol. III, Nr. 9, OKTOBER/NOVEMBER 1996 17
Dieser Druck versucht aus demFilm diejenigen Merkmale zu ent-fernen, die für das Publikum als zuungewöhnlich oder zu fremdbetrachtet werden. Zu den amhäufigsten in diesem Zusammen-hang genannten Merkmalen gehö-ren: Sprache, Schauspieler, Situa-tionen und Schauplätze. Aberauch subtilere Aspekte sind ge-eignet, die Aufmerksamkeit vonProduzenten, Mittelgebern, Fern-sehsendern und Verleihern aufsich zu lenken. Darüber hinaussind auch zahlreiche Subventions-anreize mit Bedingungen für dieBesetzung und die Außenaufnah-men verbunden.
Wenn man bedenkt, wie interna-tional die audiovisuellen Mediensind, ist es erstaunlich, daß heuteein solcher Druck ausgeübt wird.Die Zuschauer sehen bereits seitso vielen Jahrzehnten auslän-dische Filme und Programme, daßdiese Bestandteil der jeweiligennationalen audiovisuellen Kulturgeworden sind. Und doch konntenwir bei unseren Untersuchungenfeststellen, daß dieser Druck tat-sächlich existiert, und Produzen-ten aus anderen Ländern habendieselbe Erfahrung gemacht(Light, 1994; Strover, 1994).
Prüfstein für die KompetenzInternationale Koproduktionenstellen ebenfalls die Produzentenauf die Probe, was als Kompetenz-prüfung bezeichnet werden kann.Wird ein Film gemeinsam mitausländischen Partnern produ-ziert, verändert sich das Produk-tionsverfahren signifikant undgestaltet sich schwieriger. Im all-gemeinen gilt: Um bei einemkoproduzierten Film Fortschrittezu erreichen, sind mehr Verhand-lungen, mehr Sitzungen, mehrReisen, mehr Präsentationsmate-rial, mehr Anträge, mehr “Ver-kaufsbemühungen” und mehrAbsprachen notwendig als beinationalen Produktionen. Dane-ben ist auch mehr Zeit und Gelderforderlich, weshalb Koproduk-tionen für kleinere Gesellschafteneine größere Belastung sind als fürgroße Produktionsgesellschaften.Trotzdem ist an den Kompeten-zen, die für Koproduktionen benö-tigt werden, nichts Geheimnis-volles; alle notwendigen Dingelassen sich lernen. Ein Produzentmit internationaler Erfahrung, denwir bei unserer Untersuchungbefragt haben, gab an, daß Kopro-duktionen nicht schwieriger sindals nationale Produktionen, unddas obwohl sie komplizierter sind.Seiner Meinung nach ist es genauso einfach, Kontakt mit jemandemaufzunehmen, der tausend Kilo-meter entfernt ist, wie mit jeman-dem, der am anderen Ende derStadt wohnt.
Das ist zweifellos richtig, dochsollte nicht vergessen werden, daßdieser Produzent über Zusam-menhänge sprach, in denen er sich
eingesetzt. Allgemein gilt: Je mehreine Gesellschaft in einen Filminvestiert, desto größer ist ihrInteresse, sich an der Realisierungdes Films zu beteiligen. FürGesellschaften, die Geld in Pro-duktionsausrüstungen angelegthaben, bieten Koproduktioneneine willkommene Gelegenheit,die Stillstandszeit dieser Gerätemöglichst gering zu halten. DieProduktion wird in größerenAbschnitten unter den Partnernaufgeteilt, so daß eine Gesellschaftfür die Fotografie, eine andere fürden Ton und eine Dritte für Gar-derobe und Schauplätze verant-wortlich ist.
Koproduktionen stellen ebenfallsdie Produktionsgesellschaften aufdie Probe. Eine Vorbedingung füreine langfristige Partnerschaftbesteht darin, daß die Arbeitswei-sen der verschiedenen Gesell-schaften zueinander passenmüssen, noch wichtiger, dieGesellschaften müssen dieselbeArt von Filmen machen wollen.Für kleinere Produktionsgesell-schaften ist es ganz besondersschwierig, verschiedene ästhe-tische Linien zu bearbeiten. In vie-len Fällen ist für diese Gesell-schaften die Zusammenarbeit miteinem Verleiher einfacher als mitanderen Produktionsgesellschaf-ten, da ein Verleiher sich mit einergrößeren Auswahl unterschiedli-cher Fi lme befassen kann.Darüber hinaus geben die Produk-tionsgesellschaften langfristigenPartnerschaften den Vorzug, dasie die Möglichkeit bieten, die Pro-bleme, die ein Partner verursa-chen kann, möglichst gering zuhalten. Es ist einfacher, mit einemvertrauten Partner zusammen-zuarbeiten. Deshalb wollen Gesell-schaften mit den Partnern zusam-menarbeiten, die ihnen ausfrüheren Koproduktionen bekanntsind, und wenn sie gezwungensind, neue Partner zu suchen, ge-schieht dies im Hinblick auf einelangfristige Partnerschaft.
Rauli Kohvakka, Forscher, Kultur- und
Medienstatistik, Finnland
1. aus: Light, 1994. Originalquelle: TelevisionWeek - Edinburgh International TelevisionFestival Magazine (London: EMAP, 1991).
2. Dieser Beitrag stützt sich auf einen Unter-suchungsbericht von Markku Huttunen undRauli Kohvakka: Kansainväliset yhteistuotan-not suomalaisessa elokuvatuotannossa (Inter-nationale Koproduktionen in der finnischenFilmproduktion). (Statistisches Zentralamt,Finnland). Der Bericht wird noch in diesemJahr in englischer Sprache vorgelegt.
Referenzen:Celsing, Anna (1993): “Internationell filmpro-duktion. Fler kockar - sämre soppa?”. Medie-Notiser 1993/3.Light, Julie (1994): “Co-operation and com-promise: co-production and public servicebroadcasting”. Screen 35(1994):1.Screen Digest, Juli 1994: “Film production:the growing importance of co-productions”.Strover, Sharon (1994): “Institutional adapta-tions to trade: the case of US-European co-productions”.Unterlage für die “Turbulent Europe”- Konfe-renz, London, VK, Juli 1994.Strover, Sharon (1995): “Filmfinanzierung inEuropa: Ein sich verändernder Markt”.Sequentia 1995:5.
bereits genügend Know-how, Kon-takte, Erfahrung und internatio-nales Renommee erworben hatte.Das Problem besteht darin, ersteinmal dahin zu kommen. Für Pro-duzenten aus kleineren Ländernist dies schwieriger, da sie seltenerdie Möglichkeit haben, internatio-nal interessante Filme zu machen.
Prüfstein für die gemeinsameArbeitskulturFilme, die nicht nur internationalproduziert, sonder auch interna-tional gemacht werden, stellen fürFilmfachleute eine andere Heraus-forderung dar als für Produzenten.In der Forschungsliteratur wirdsehr häufig auf Probleme und Rei-bungen in der täglichen Arbeiteines internationalen Produk-tionsteams verwiesen (Celsing,1993; Strover, 1994). Diese Pro-bleme werden durch die Unter-schiede in der Arbeitskultur verur-sacht. Aus diesem Grund gehörtdie Ähnlichkeit in den Arbeits-kulturen der Filmfachleute zu den Faktoren, die internationaleKoproduktionen vereinfachen.
Bei jeder Produktion ist die Aus-wahl der Mitglieder des Produk-tionsteams eine schwierige Aufga-be, und ein Produzent, der dieseAufgabe erfolgreich löst, stelltdamit in großem Umfang sicher,daß die Produktionsphase rei-bungslos verlaufen wird. Sind aneinem Produktionsteam Personenaus verschiedenen Arbeitskulturenbeteiligt, werden dadurch zusätz-liche Anforderungen an die Team-mitglieder gestellt. Personen, diebereits in internationalen Kopro-duktionen gearbeitet haben undeine anpassungsfähige Persönlich-keit besitzen, werden bevorzugt.Lenkung und Koordination einesinternationalen Teams sind darü-ber hinaus mit Mehrarbeit verbun-den, selbst wenn die Zuständigkei-ten der Gesellschaften eindeutig ineinem Koproduktionsvertrag gere-gelt sind.
Unglücklicherweise gibt es keineStatistiken über den Anteil inter-nationaler Koproduktionen, dieauch international durchgeführtwerden; Koproduktionen sindganz allgemein statistisch schwerzu erfassen. Doch dürfte derAnteil international realisierterFilme erheblich sein, selbst wenndie Mehrzahl der Koproduktionenmit größter Wahrscheinlichkeitauf nationaler Ebene gemachtwerden. Zahlreiche Anreize fürKoproduktionen setzen aber krea-tive Ressourcen aus mehr alseinem Land voraus. National reali-sierte Filme werden in der Regelauch national finanziert. Die Auf-gabe der ausländischen Produk-tionsgesellschaften besteht darin,als Minderheitsgesellschafterzusätzliche finanzielle Mittel in das Projekt einzubringen und den Film förderungswürdig zumachen. Internationale Teamswerden häufiger bei teuren Filmen
18 Sequentia Vol. III, Nr. 9, OKTOBER/NOVEMBER 1996
Märkte und Werke
Die aktuelle Entwicklung imdigitalen Rundfunk hat weitrei-chende Folgen für die von denKabelnetzbetreibern angebote-nen Dienstleistungen. Ebenso wiedie Betreiber von Direct-to-home-Satelliten und terrestri-schen Übertragungssystemensind auch die Kabelgesellschaftendabei, digitale Rundfunkdienstein ihren Netzen einzuführen.
Gleichzeitig rüsten die Kabelnetz-betreiber ihre Netze auch fürinteraktive Kommunikations-dienste wie etwa Telefonie, Inter-net und andere Formen derDatenübermittlung auf. Somitverwandeln sie ihre einseitiggerichteten Breitbandnetze ininteraktive Breitband-Telekom-munikationsnetze, über die sieihren Kunden Zugang zu einerVielzahl von Diensten verschaf-fen, wie etwa herkömmlicheRundfunk- und Telekommunika-tionsdienste, aber auch neueDienste, die Interaktivität mitherkömmlichen Diensten verbin-den. Den Kabelnetzen kommt imVergleich zu anderen Infrastruk-turen eine einzigartige Stellungzu, da sie in der Lage sind, dieFunktionen der Breitbandüber-tragung und die interaktiven Tele-kommunikationsnetze miteinan-der zu kombinieren. Die Kabel-branche zählt in Europa über 40Millionen Kunden.
Die Verbindung der obengenann-ten Faktoren veranlaßte dieEuropäische Kommission, dieVerwendung von Kabelnetzen fürTelekommunikationsdienste (mitAusnahme des öffentlichen Fern-sprechdienstes) mit Wirkung vom1. Januar 1996 zu liberalisieren.
Das Kommissionsmitglied Karelvan Miert stellte dazu fest, dieKabelindustrie habe das Poten-tial, zum führenden Anbieter vonMultimedia-Diensten in Europazu werden.Gegenwärtig investie-ren die Kabelnetzbetreiber in dieDigitalisierung und Hochrüstungihrer Netze, um dieses Potentialauch umzusetzen.
Mehrere Betreiber planen nochEnde 1996 bzw. 1997 die Einfüh-rung digitaler Dienste, welchemittelfristig zu den wichtigstenvon den Kabelgesellschaftenerbrachten Diensten gehörendürften.
Die größten Herausforderungenergeben sich für die digitalenaudiovisuellen Dienste dabei imBereich der technischen Möglich-keiten, den verschiedenen zu ent-
len Videoausstrahlung, d.h. aufden Empfang digitaler Sende-signale, zugeschnitten sein undden Betrieb von sogenanntenConditional-Access-Systemen(CA) ermöglichen. NachfolgendeGenerationen von Set-Top-Boxenwerden in stärkerem Maße fürden Umgang mit interaktivenDiensten ausgelegt sein. Die Set-Top-Box dürfte sich zur techni-schen Plattform für sämtlicheArten von Diensten entwickeln,welche die Kabelgesellschaftenüber ihre Netze anbieten. DieMarktentwicklung würde ganzentschieden gebremst, wenn derVerbraucher zum Empfang ver-schiedener Dienste eine Vielzahlan technischen Geräten bräuchte.
Digitale Techniken sorgen füreine höhere Kapazität undkönnen problemlos Conditional-Access-Systeme integrieren,welche eine Aufgliederung derangebotenen Dienste zulassen.Diese Conditional-Access-Syste-me ermöglichen es dem Kunden,pro Nutzung für die Kabeldienstezu bezahlen.
In die Gesetzgebung zur Rege-lung des digitalen Rundfunks inEuropa (Richtlinie zur Verwen-dung von Normen für die Über-tragung von Fernsehsignalen,95/47/EC) wurde für die Betrei-ber von Conditional-Access-Sy-stemen die folgende Verpflich-tung eingebaut:
“Conditional access systems ope-rated on the market in the Com-munity shall have the necessarytechnical capability for cost effec-tive transcontrol at cable head-ends allowing the possibility forfull control by cable televisionoperators at local or regional levelof the services using such condi-tional access systems.”
(Auf dem Markt in der Gemein-schaft betriebene Conditional-Access-Systeme sollen die not-wendigen technischen Voraus-setzungen für kostengünstigeTranscontrol an den Kabel-Head-ends mitbringen, die den Kabel-netzbetreibern auf lokaler oderregionaler Ebene die Möglichkeitvölliger Kontrolle über die Dien-ste gewährt, bei denen derartigeConditional-Access-Systeme ver-wendet werden.)
• Dienste:Die Kabelnetzbetreiber werdendie größere Kapazität und dieMöglichkeit, den Verbraucher proNutzung zur Kasse zu bitten, dazunutzen, neben dem Basispro-grammpaket auch gebühren-pflichtige Dienste einzuführen.
wickelnden Diensten, dem zuneh-menden Wettbewerb und derVerfügbarkeit von Inhalten.
Technische MöglichkeitenZu den Hauptvoraussetzungeneiner digitalen Ausstrahlung überKabelnetze gehört die Installationeines aufgerüsteten Headends,welches eine digitale Übertra-gung erlaubt, sowie digitalerReceiver/Decoder in Form vonSet-Top-Boxen, mit denen derVerbraucher die digitalen Signaleempfangen kann.
Allerdings bestehen hinsichtlichder technischen Aspekte des digi-talen Rundfunks noch einigeProbleme. Zunächst einmal ist esbei der gegenwärtigen Marktlageschwierig, digitale Receiver/Decoder zu einem für den Ver-braucher günstigen Preis zu be-schaffen. Um dies zu gewährlei-sten, müssen zunächst Decoderin hohen Stückzahlen bei glei-chen Spezifikationen bestelltwerden. Das zweite Problem wirdsein, eine einheitliche Plattformfür sämtliche im Kabelnetz ange-botenen Dienste zu schaffen.
Eine Unterabteilung der Techni-cal Working Party der ECCA setzte sich mit diesen Themen auseinander und entwarf eineSpezifikation für eine DVB-Recei-ver/Decoder Set-Top-Box, welchesich für den Einsatz durch Kabel-netzbetreiber in ganz Europaeignet.
In Verbindung mit einem auf-gerüsteten Headend erlaubt dieseSet-Top-Box dem Kabelnetz-betreiber einen flexiblen Umgangmit der Kabelnetzkapazität. Jenach Art des Dienstes (digitaleZeitung oder bewegte Video-bilder), der gewünschten Qualität(Limited Definition TeleVision -vergleichbar mit VHS - oderEnhanced Definition TeleVision)und der Modulationstechnik (64QAM) können die Betreiber dieNetzkapazität für Fernsehkanälemittels digitaler Kompression umdas drei- bis zwölffache steigern.
Im Vergleich zu der gegenwärtiggebräuchlichen analogen Über-tragungsweise ermöglicht dieEinführung digitaler Video-ausstrahlung in Kabelnetzen dieWiedergabe von sechs Kanälenmit Standard-Definition-Tele-vision-Programmen (QualityPAL) über einen herkömmlichenPAL-Kanal (unter Verwendungder DVB-Norm).
Die ersten Set-Top-Boxen werdenauf die Erfordernisse einer digita-
ECCADie ECCA (European Cable Communications Association)ist der europäische Verband derKabelnetzbetreiber und umfaßteuropäische Kabelgesellschaftensowie deren nationale Verbände,welche insgesamt über 34 Mio.Abonnenten vertreten. Hautpzieldes Verbandes ist es, die Zusam-menarbeit zwischen den Kabel-gesellschaften zu fördern undderen Interessen auf euro-päischer Ebene zu vertreten.
Zu einer ersten informellenZusammenarbeit zwischeneuropäischen Kabelnetzbetreibernkam es 1949. Als diese informel-len Treffen häufiger stattfanden,verlangte der Zusammenschlußnach einer formalen Struktur, undso wurde am 2. September 1955von Vertretern der Schweiz,Belgiens und der Niederlande dieA.I.D. (Alliance Internationale dela Distribution par câble) einge-richtet. 1993 erfolgte die Umbe-nennung der A.I.D. zur EuropeanCable Communications Associa-tion, wodurch der Kommunika-tionsaspekt sowie dieeuropäische Ausrichtung des Verbandes betont wurden.
Der ECCA gehören mittlerweile21 Mitglieder aus 14 Ländern an.Daneben besitzt sie Sondermit-glieder in drei zentral- und osteuropäischen Staaten.
Die ECCA wahrt die Interessen'privater' Gesellschaften, Kommunen und Versorgungs-unternehmen, welche Kabelnetzebetreiben, sowie von Kabelgesell-schaften, welche mit Telekommu-nikationsunternehmen zusammenhängen.
Die Zielsetzungen des Verbandesumfassen:• Förderung der Entwicklung imKabelsektor durch internationaleKontakte;• Wahrung der Interessen vonKabelnetzbetreibern aufeuropäischer Ebene;• Beteiligung an internationalenAktivitäten den Kabelsektorbetreffend;• Gewährleistung des Informa-tionsaustauschs zwischen denverschiedenen Mitgliedern;• Klärung technischer, geschäftli-cher und juristischer Angelegen-heiten, welche direkt oder indirektdem Erreichen der o.g. Zieledienen.
Die ECCA ist als Vertretung dereuropäischen Kabelgesellschaftenauf EU-Ebene anerkannt. Verbin-dungen wurden mit folgendenanderen Industrieverbänden eingegangen:
KabelnetzimDigitaler Rundfunk
•••
Sequentia Vol. III, Nr. 9, OKTOBER/NOVEMBER 1996 19
Diese Dienste können sich vonPay-TV bis hin zu Video-on-Demand erstrecken.
• Pay-TV:Abonnementfernsehen auf zu-sätzlichen Kanälen ergänzendzum Grundpaket.
• Pay-per-View-Dienste:Der Verbraucher kann sich in einzu einer festgelegten Sendezeitausgestrahltes Programm ein-schalten und wird für dieses Pro-gramm zur Kasse gebeten. Filmeund Live-Übertragungen vonSportereignissen gelten derzeitals geeignetster und beliebtesterInhalt für diese Dienste.
• Near-Video-on-Demand:Diese Dienste nutzen dasselbetechnische Prinzip wie Pay-per-View-Dienste, gestatten dem Ver-braucher jedoch eine größereFlexibilität im Hinblick auf diezeitliche Auswahl der Program-me. Bei einem Near-Video-on-Demand-System wird ein- unddasselbe Programm auf verschie-denen Kanälen ausgestrahlt. DieAustrahlung erfolgt dabei aufjedem Kanal zu einem anderenZeitpunkt. Je mehr Kanäle einge-setzt werden, desto flexibler istder Verbraucher bei seiner Zeit-einteilung.
• Video-on-Demand:Diese Dienste ermöglichen esdem Verbraucher, eine Sendungbzw. einen Film jederzeit aufAbruf zu empfangen. Dem Ver-braucher wird hierzu eine Aus-wahl verschiedener Programmeangeboten. Hat der Verbraucherseine Wahl getroffen, wird dasentsprechende Programm direktzu ihm nach Hause übertragen.
Die aufgeführten Dienste greifendabei nach wie vor auf traditio-nelle Distributionsmerkmale vonRundfunkanstalten zurück (vongewissen Formen von Video-on-Demand einmal abgesehen).Allerdings werden die digitalisier-ten, interaktiven Netze der Kabel-gesellschaften ihren Kunden inZukunft viele weitere Diensteanbieten können, wie etwaDatenübermitt lungsdienste,welche sich für alle möglichenAnwendungen, wie z.B. das Inter-net und Multimedia, verwendenlassen. Die Breitbandtechnologieder Kabelnetze stellt in Verbin-dung mit dem Internet ein ganzenormes Potential dar.
Zunehmende Konkurrenz im Infrastrukturbereich:Die Kabelgesellschaften sehensich einer wachsenden Konkur-renz ausgesetzt, nachdem sichdie Betreiber alternativer Tech-nologien wie etwa von DTH-Satel-liten und terrestrischem Rund-
anderen Informationsdienstengewähren, welche sich in dem mitdem Begriff Informationsgesell-schaft umschriebenen Zeitalterbzw. in dem als Datenautobahnbezeichneten Netz herausbildenwerden.
Das technische Potential der überBreitbandkabelsysteme angebo-tenen (interaktiven) digitalenDienste steht kurz vor der Umset-zung. Die Herausforderung be-steht nun darin, Inhalte zu schaf-fen, die den Verbraucher starkgenug interessieren, daß er dafürauch zu zahlen bereit ist. DieAnbieter von Inhalten werdensich umstellen müssen, um ande-ren Märkten, Nischenmärktensowie anderen Auslieferungs-systemen (z.B. Internet und On-Demand-Dienste) gerecht zuwerden und den Produktions-umfang zu steigern. Der Erfolgder neuen Dienste, seien dies nunRundfunk- oder Informations-dienste, wird von der Verfüg-barkeit qualitativ hochwertigerInhalte auf dem Markt abhängen.
Obschon die Liberalisierung imInfrastrukturbereich zu sinken-den Preisen für deren Nutzungführen dürfte (wie in einigen Län-dern bereits der Fall), werdenDienste und Inhalte zunächst rarsein. Unter normalen ökonomi-schen Bedingungen wird dieerhöhte Nachfrage nach Inhaltendazu führen, daß diese in größe-rer Menge produziert werden.Man sollte allerdings immerbedenken, daß die Marktstruktureine Reihe führender Anbieter inEuropa, die den Markt unter sichaufteilen und größtenteils dieInhalte kontrollieren, nichtberücksichtigt. Dieser Umstandist ein Kernthema für Kabelnetz-betreiber, die zu Endanbieternvon Diensten werden wollen, an-statt lediglich die Rolle eines Car-riers zu spielen. Für den Ausbaudieser Unternehmen ist eswesentlich, daß sie die geschäft-liche Beziehung zum Kundenaufrechterhalten. Dies erfordertunter anderem, daß sie Conditio-nal-Access-Systeme betreiben,Set-Top-Boxen ausliefern, denVerkauf von Diensten organisie-ren usw.
Eine vertikale Integration undKonzentration ist in der Informa-tionsgesellschaft wahrscheinlichunvermeidbar. Dies sollte aller-dings nicht dazu führen, daß einebeschränkte Anzahl von Anbie-tern, die über den Zugang zuInformationen wachen, den Marktkontrollieren. Angesichts dessenist es ein wichtiger Umstand, daßdie Mehrheit der europäischenKabelnetzbetreiber von den füh-renden Medienkonzernen in Eu-ropa unabhängig ist.
von Martin Christoph,Vorsitzender der Working
Party der ECCA.
funk ebenfalls die erhöhte Kapa-zität der digitalen Ausstrahlungzunutze machen. In der Fernezeigen sich bereits weitere Mit-bewerber wie etwa MultichannelMicrowave Distribution Systems(hochfrequenter mehrkanaligerterrestrischer Rundfunk in geo-grafisch eingegrenzten Gebieten)sowie Telefongesellschaften, dieebenfalls Videodienste anbietenmöchten. Mit Hilfe der digitalenTechnologie ließe sich dabeimöglicherweise das Problem derknappen Verteilungskapazität aufein Minimum reduzieren. Eskönnte sogar die Situation eintre-ten, daß das Angebot an Inhaltenhinter der vorhandenen Kapazitätzurückbleibt.
Neben Filmen und Sportereignis-sen, mit denen auf einen Massen-markt abgezielt wird, bietet derdigitale Rundfunk auch dieMöglichkeit, einen stärker aufge-gliederten Markt zu bedienen, dabestimmte Verbrauchergruppenganz gezielt angesprochen wer-den können (infolge der hohenKapazität und der Möglichkeit,den einzelnen Verbraucher zurKasse zu bitten). Die Möglichkei-ten des digitalen Rundfunks, indi-viduelle Vorlieben der Verbrau-cher anzusprechen, werden nochlange nicht ausgenutzt. DieAnbieter von Inhalten und Dien-sten werden sich an einen neuenMarkt anpassen müssen, der sichvon einem homogenen Massen-markt zu einem stark aufgeglie-derten Markt entwickeln dürfte,in dem die angebotenen Dienstegezielt individuelle Interessen derVerbraucher ansprechen.
Ebenso wie das Potential der digi-talen Rundfunkdienste erkenntdie Kabelindustrie auch die Not-wendigkeit der Integration derverschiedenen Elemente derDistributionskette (Inhalt, Ver-packung von Diensten und Distri-bution).
Einige Kabelnetzbetreiber wer-den sich mit etablierten Pay-TV-Gesellschaften zusammentun, umgemeinsam digitale Rundfunk-dienste anzubieten. Andere wer-den eigene Gesellschaften insLeben rufen, die sich um die Ver-packung von Diensten und dieAkquisition von Inhalten küm-mern.
Besonders wichtig ist für dieKabelnetzbetreiber hierbei, daßdie Dienste über eine anwender-freundliche technische Plattformangeboten werden, die es demVerbraucher ermöglicht, die imNetz verfügbaren Dienste übereinen Decoder abzurufen undmögl ichst e ine gemeinsameRechnung für sämtliche ange-forderte Dienste zu erhalten. Die Kabelnetzbetreiber dürftenzunehmend die Funktion vonEndanbietern der in den Netzenangebotenen Dienste einnehmenund Zugang sowohl zu digitalenRundfunkdiensten, als auch zu
• The European Association ofConsumer Electronics Manufactu-rers (EACEM);• The European Public Telecom-munications Network Operators´Association (ETNO);• The European BroadcastingUnion (EBU);• The European Committee forElectrotechnical Standardisation(CENELEC).
Der Vorsitzende der TechnicalWorking Party der ECCA istgleichzeitig Vorsitzender desCENELEC-Ausschusses TC209,welcher sich mit der Normierungim Kabelsektor befaßt.
Die ECCA vertritt die euro-päischen Kabelnetzbetreiber auchdurch ihre Mitgliedschaft bei:• The European Digital VideoBroadcasting Project;• The Advisory Committee of theEuropean Audiovisual Observatory;• The European Telecommunica-tions Standards Institute (ETSI).
Die ECCA beteiligt sich aktiv aneuropäischer Politik zum ThemaKabel in den Bereichen:• Telekommunikation,• Fernsehnormen (digitales Fernsehen),• Audiovisuelle und geistigeEigentumsrechte (Urheberrechtund verwandte Rechte).
Die ECCA und ihre Mitgliedersetzten sich bei der EuropäischenKommission nachhaltig für eineLiberalisierung im Kabelsektorein. Das Ergebnis hiervon war,daß die Kommission am 18. Oktober 1995 eine Richtliniezur Aufhebung der Beschränkun-gen bei der Verwendung vonKabelnetzen für Telekommunika-tionsdienste mit Wirkung vom 1. Januar 1996 verabschiedete.
Bezüglich des regulativen Rah-mens für das digitale Fernsehenhat sich die ECCA um Transcon-trol (die Möglichkeit, am HeadendConditional-Access-Informationeneines Programmveranstalters mitdenen eines Kabelnetzbetreibersauszutauschen) und Simulcast (imFormat 16:9 empfangene Pro-gramme können auch im Format4:3 gesendet werden) bemüht.Daneben ist sie auch amEuropean Digital Video Broad-casting Project aktiv beteiligt.
Mit Blick auf den audiovisuellenSektor (Fernsehen-ohne-Grenzen) und geistiges Eigentum(SATCAB-Richtlinie, geistigeEigentumsrechte in der Informa-tionsgesellschaft und Gesetzezum Schutz vor Piraterie) vertrittdie ECCA aktiv die Ansichten derKabelnetzbetreiber zu diesen Themen. In Bezug auf das Urheberrecht setzt sich die ECCA für eine Erleichterung desErwerbs von Rechten ein. Außerdem unterstützt sie Gesetzesbemühungen um einen Schutz vor Piraterie.
Für weitere Informationenwenden Sie sich bitte an die:ECCAAvenue Van Kulken 9 AB-1070 BRUXELLES/ANDERLECHTFax: (32) 2621 7676
•••
20 Sequentia Vol. III, Nr. 9, OKTOBER/NOVEMBER 1996
Die Spielregeln
und Tanzaufführungen, Video-Clipsund Kurzfilme), Unterhaltungssen-dungen, Werbespots sowie Sendun-gen, zu denen die Sendeanstaltenaufgrund ihrer staatlichen Auflagenverpflichtet sind; selektive Hinterle-gung für die anderen Sendungen -z.B. Spielshows oder Sportübertra-gungen - und zwar vier Sendungenpro Titel oder Sportart pro Jahr undSendeanstalt. Von den Fernseh-nachrichten wird nur eine Ausgabetäglich von jeder Sendeanstalt aufbe-wahrt.
Außerdem werden jedes Jahr vonjedem Sendeveranstalter 7 Muster-Tage im gesamten Programmablaufvollständig von Sendebeginn bis Sen-deschluß aufgezeichnet, damit dieForscher ein getreues Abbild einesProgrammtages erhalten können.
Aufgrund der Erfassung der Begleit-dokumente der Sendungen, die eineVoranalyse des Programmschemasermöglichen, schickt die Inathèque
den 7 französischen terrestrischenFernsehanstalten vor der Ausstrah-lung die Liste der Sendungen, dieunter die Hinterlegungspflicht fallen.
Die Sendeanstalten übermitteln derInathèque zwei Wochen nach derAusstrahlung die entsprechendenSendungen, die letztlich auf Beta SPaufbewahrt, zunächst aber von derInathèque auf S-VHS für die Recher-cheabfragen kopiert werden.
HörfunkIn Verbindung mit Radio France,das die Signale der 5 Hörfunksender(France Culture, France Inter,
France Musique, France Info undRadio Bleue) der Inathèque über-mittelt, wurde eine einzigartige tech-nologische Lösung umgesetzt:- Empfang und Aufzeichnung desSignals erfolgen digital;- Kompression nach der MPEG-Norm;- Prägung jeweils einer CD-Worm zurArchivierung und einer zur Abfrage,was den Benutzern den flexiblenZugang der Digitaltechnik bietet undgleichzeitig die technologische Ent-wicklung der Inathèque im Fernseh-bereich vorbereitet.
wie die Analysen des MediumsHörfunk bzw. Fernsehen in seinenjeweiligen Besonderheiten (Pro-grammierungslogik, Programm-planungsstrategie, Entwicklung vonGenres und Formen usw.).
Die Methodik-Workshops stellen dieHauptschnittstelle mit den Be-nutzern dar. Es handelt sich dabeium ständige Arbeitsgruppen, andenen Forscher, Archivare/Doku-mentare, Akademiker und INA-Experten beteiligt sind. Sie forschenin folgenden Bereichen:- Organisation der Datenbanken,- Verwaltung der schriftlichen Be-gleitdokumente,- Organisation der Abfragegeräte,- Organisation des Bestands.
Weitergabe der ErkenntnisseDas Bildergremium (Collège ico-nique): Fachübergreifende Gruppeaus etwa dreißig Philosophen undBilderproduzenten, die theoretischeÜberlegungen zu Bildern anstellen.Die monatlichen Vorträge und Dis-kussionen dieses Gremiums werdenzweimal im Jahr veröffentlicht.
Die Sorbonne-INA-Begegnungen:Jährliches, fachübergreifendes Kollo-quium, das von der Académie deParis und dem INA zu folgendenThemen gemeinsam organisiert wird:« Neue Geräte, neue Gebräuche »(1993), « Techniken, Gesellschaf-ten, Kulturen » (1994), « Das Bild,Gewußtes und Ungewußtes »(1995) sowie 1996 « Bilder der Lust,Lust nach Bilder ».
Die INA-Télérama -Gespräche:Begegnungen, die von der Inathèquein Zusammenarbeit mit der Fernseh-zeitschrift Télérama für das breite,informierte Publikum organisiertwerden. Auf der Grundlage laufenderoder abgeschlossener Recherche-arbeiten von Forschern, Intellek-tuellen und Fachleuten, die dieInathèque nutzen, kommt hier dieÖffentlichkeit mit Forschern undFachleuten aus dem Hörfunk- undFernsehbereich zusammen.
Medien-Recherche: Eine vom Ver-lagshaus Nathan und der Abteilungfür Veröffentlichungen des INAgemeinsam herausgegebene Samm-lung von Arbeiten, denen die Recher-cheergebnisse aus der Inathèquezugrunde liegen.
Frankreich hat damit eine bewußtePolitik der Vergangenheitsbewah-rung umgesetzt, ausgeweitet auf diemodernen Medien, und begonnen,schrittweise die technischen, tech-nologischen und wissenschaftlichenBedingungen zu vereinen, um fürspätere Generationen ein kritischesWissen über die zeitgenössischenMedien zu erstellen.
von Francis Denel, Direktor, Inathèque.
Inathèque de FranceDépôt légal de la radio-télévision (Staatliches Hörfunk- und Fernseharchiv)Direktor: Francis DENELINA4, avenue de l’Europe - F-94366 Bry-sur-Marne CedexTel.: (33) 01 49 83 30 11Centre de Consultation de l’Inathèque de France(Recherchezentrum der Inathèque)83-85, rue de Patay - F-75013 ParisTel.: (33) 01 44 23 12 08
Dokumentarische BearbeitungSämtliche von der Inathèque erfaß-ten Dokumente werden dokumenta-risch bearbeitet: Es erfolgt eineProgrammkennzeichnung (Katalogi-sierung) nach Programmplanung,Titel, Autoren, Produktionsart und,insbesondere bei Werken und Fern-sehnachrichten, detaillierter Be-schreibung des Inhalts der nachSichtung oder Anhörung (Analyseund Indexierung) mit Schlüsselwör-tern und Zusammenfassungen wie-dergegebenen Sendungen; all dieskann durch jede andere Informationergänzt werden, die die Forscher beider Nutzung der Dokumente benöti-gen.Alle kopierten und dokumentiertenProgramme sind spätestens dreiMonate nach der Ausstrahlung imRecherchezentrum der Inathèquezugänglich.
RechercheDas Zentrum zur Vorbereitung derAbfragekriterien der Inathèque deFrance steht offen für Forscher,Lehrkräfte, Studenten und Fach-leute, die mit dem französischen Bestand an Hörfunk- und audio-visuellen Dokumenten arbeiten. Dieältesten Dokumente stammen von1933. Seit 1995 kommen jährlich diezur ‘gesetzlichen Hinterlegung’ be-stimmten 36 000 Sendestunden dazu.
Wie bei anderen Einrichtungen imRahmen der Hinterlegungspflichtauch, muß jeder Benutzer (Forscher,Universitätsdozenten, Studenten,Fachleute oder Einzelpersonen mitpersönlichem Forschungsvorhaben)vor der Reservierung eines Arbeits-platzes und der Einführung in die Suchmöglichkeiten (Datenbank,Multimedia-Geräte an den audio-visuellen Arbeitsplätzen) einenBenutzerausweis bei der Inathèquebeantragen.
Die audiovisuellen Arbeitsplätze be-stehen aus einem Multimedia-Gerät,mit dem auf demselben PC die INA-Datenbank benutzt, Sendungenangehört bzw. angesehen, mitAnmerkungen versehen und auchinnerhalb der Sendungen mit denvom INA selbst entwickeltenAnalysehilfsprogrammen (Vidéo-Scribe und RadioScope) bestimmteStellen gesucht werden können.
- Mit Forschungseinrichtungen wur-den 30 Abkommen geschlossen, und1995 erhielten knapp 1000 Personeneine Nutzungsberechtigung zurArbeit an dem vom INA aufbewahr-ten Hörfunk- und Fernsehbestand.
- 111 Institutionen sind vertreten:35 Universitäten und Forschungs-einrichtungen aus der französischenProvinz,39 aus dem Pariser Becken und Parisselbst,37 ausländische Universitäten undForschungseinrichtungen aus 19Ländern.
33 ausgewiesene Disziplinen werdenbehandelt, von der HauptrichtungGeschichte und Infocom über dieBildenden Künste bis hin zur Wirt-schaft.
Die Recherchethemen decken dieVielfalt der von Hörfunk und Fernse-hen behandelten Gebiete genauso ab
Die Inathèque de France, am1. Januar 1995 gegründet, ist eineder drei Sektionen des französischenaudiovisuellen Medieninstituts INA(Institut National de l’Audio-visuel). Dieses Institut ist mit derVerwaltung der ‘gesetzlichen Hinter-legung’ (dépôt légal) aus Hörfunkund Fernsehen beauftragt, wie sie imGesetz vom 20. Juni 1992 definiertist. Dieses Gesetz
• vollzieht eine Reform sämtlicherGesetzestexte zur ‘Hinterlegungs-pflicht’ seit dem 16. Jahrhundert;
• verteilt die Rollen zwischen demINA, dem staatlichen FilminstitutCNC (Centre National de la Ciné-matographie) und der National-bibliothek Bibliothèque de France;
• bekräftigt die zweifache Zielset-zung der ‘Hinterlegungspflicht’:Bewahrung des nationalen Kultur-guts und Konsultationsmöglichkeitzu Recherchezwecken.
Mit dieser gesetzlichen Bestimmungwerden Bild, Ton und die Medien alswesentliche zeitgenössische Aus-drucksformen anerkannt, erhaltendenselben kulturellen Status wie dieanderen Verbreitungsarten (Druck-erzeugnisse, Kino, Fotografie) undwerden als Inhalte gegenwärtigerForschung und Wissensgebietebetrachtet. Damit werden die grund-legenden Aufgaben des Medien-instituts - Produktion, Forschung,Lehre und Bewahrung - zu einemzweckmäßigen und kohärentenGesamtauftrag vervollständigt unddie spezifische Rolle des Instituts imheutigen audiovisuellen Bereichverstärkt.
ErfassungFernsehenDie in den gesetzlichen Bestimmun-gen und Vorschriften festgelegtenKriterien sind zum einen die franzö-sische Herkunft sowie die Erstaus-strahlung, zum anderen das Prinzipeiner je nach Genre unterschiedli-chen Hinterlegung: vollständige Hin-terlegung für Magazine, Informa-tionssendungen, audiovisuelle Werke(Dokumentationen, Fernsehspiele,Zeichentrickfilme, Theater-, Musik-
Die Inathèque de France in Fakten:2 Standorte:– 3000 m2 in Bry-sur-Marne zur Erfassung und Archivierung,– 200 m2 in Paris zur Vorbereitung der Abfragekriterien; Ende 1997 wird ein Zentrum
zur Vor-Ort-Konsultation innerhalb der Nationalbibliothek eröffnet.
Kapazität:– 18 500 Fernsehstunden jährlich (bei 50 000 Sendestunden) für Sendungen der
französischen terrestrischen Sendeanstalten;– 17 500 Hörfunkstunden jährlich (bei 40 000 Sendestunden) für Sendungen der
5 landesweiten Sender von Radio France;– 35 000 schriftliche Begleitdokumente der Programme jährlich (50 000 Seiten).
Trägermaterial:– 40 000 TV-Bänder pro Jahr (Beta SP und S-VHS);– 10 000 Hörfunkträger pro Jahr (CD-Worm), also 1 800 Längenmeter pro Jahr.
Ausstattung:– 3 Fernsehübertragungsroboter;– 10 digitale Hörfunkbearbeitungsstraßen;– etwa 100 mit der dokumentarischen Datenbank des INA vernetzte PCs;– 16 audiovisuelle Einzelarbeitsplätze (Ende 1997: 58 Plätze in der Nationalbibliothek).
Beschäftigte:– 37 Dokumentare,– 16 Korrespondenten von Sendern sowie Fachverwaltungskräfte,– 11 Techniker,– 7 Sekretariats- und Verwaltungskräfte,– 7 Verantwortliche/Leitungsteam.
Inathèque Diefranzösische
Sequentia Vol. III, Nr. 9, OKTOBER/NOVEMBER 1996 21
Frankreich hat mit dem Gesetzvom 20. Juni 1992 und der Verord-nung vom Dezember 1993 die Be-stimmungen zur ‘gesetzlichen Hin-terlegungspflicht’ auf den Hörfunk-und Fernsehbereich ausgeweitet.
Wie bei den Druckerzeugnissen (seitAnfang des 16. Jahrhunderts), derFotografie und dem Kino, wird deraudiovisuelle Bereich (bewegte Bil-der, Ton, Medien) nun als einewesentliche Ausdrucksart unsererZeit und als « kulturelles Objekt »betrachtet, das bewahrt und an künf-tige Generationen weitervermitteltwerden soll.
Neben der Anerkennung dieses« kulturellen » Status’ schreibt derGesetzestext mit diesem Auftragauch die Forschung als vorrangigfest.
Die ‘Hinterlegungspflicht’ in Frankreich und Europa -geschichtlicher ÜberblickIm Sinne des französischen Gesetzge-bers geht es nicht nur um eine tech-nische Anpassung des alten Gesetzes,mit der die für andere physische Trä-ger geltenden Bestimmungen aufneue Technologien angewandt wer-den, sondern vor allem um eineNeuorientierung seiner Politik imHinblick auf das nationale Kulturgut.
Die Ziele der ‘Hinterlegungspflicht’ -und ihre Durchführungsmittel:Pflicht zur Übermittlung und Aufbe-wahrung - dienen nicht mehr derKontrolle oder der Verteidigung derAutoreninteressen (die historischenGrundlagen des Gesetzes), sondernder Vergrößerung staatlicher Samm-lungen und vor allem der Forschungund der Erstellung eines kritischenWissens.
Das Kulturgut aus Hörfunk undFernsehen wurde außerdem wegender Besonderheit seiner großen Men-ge sowie seiner Produktions- undVerbreitungsweisen der ‘Hinterle-gungspflicht’ unterstellt (die für ingroßer Menge verbreitete « Werkeund Dokumente » gilt) und nicht derArchivierungspflicht (die Dokumen-te in jeder physischen Form aus derTätigkeit einer juristischen odernatürlichen Person betrifft). Einzel-heiten legt das Gesetz von 1979 fest.
Die Weitergabeverpflichtung betrifftdie Sendeveranstalter (und nichtetwa die Produzenten, wie beimKino); die entsprechenden Informa-tionen dazu erfolgen kostenlos undunverzüglich, die Bedingungen sindaber dem hinterlegenden Unterneh-men überlassen (z.B. nur Informa-tionsweitergabe vor Ort), zumSchutz der verschiedenen Katego-rien von Anspruchsberechtigten.
Zahlreiche Länder, die im Hinblickauf Bewahrung, Information undRecherche zu Ausbildungs- und Wis-senschaftszwecken bereits überstrukturierte Möglichkeiten verfügenoder dies für die Zukunft einplanen,stellen sich zur Zweckmäßigkeiteines so systematischen Ansatzeswie der ‘Hinterlegungspflicht’ inFrankreich Fragen. Die mehrheit-liche liberale Tendenz in Europascheint eher in Richtung einer Auf-bewahrungspflicht durch die Produ-zenten selbst, mit Zugang für die
Forschung, zu gehen und hält diekonkrete Durchführung für unmög-lich und unzweckmäßig.
Produzent oder Sendeanstalt werdennach rein wirtschaftlicher Logik
- ausschließlich in die Archivierungund Verwaltung der Sendungeninvestieren, an denen sie selbstrechtmäßig beteiligt sind,
- nicht die Kosten für Struktur, Mittelund Einschränkungen übernehmen,die mit der wissenschaftlichen Nut-zung von Archiven oder Bibliothekenverbunden sind.
Außerdem bezieht sich die Aufbe-wahrung von einzelnen, aus demsignifikanten und strukturierendenProgrammumfeld des Mediumsherausgerissenen Dokumenten undWerken auf eine ideale, schöpfe-rische Auffassung des Werkes undnicht auf die « Natur » selbst vonHörfunk oder Fernsehen als kultu-relles Massenobjekt mit seinenRhythmen, seiner Vergänglichkeitund seinen spezifischen Bräuchenbei Produktion und Empfang.
Die Rolle des INAAngesichts der Besonderheit vonHörfunk und Fernsehen wurde demINA, das bereits durch das Gesetzvon 1986 und die unterschiedlichenBestimmungen seit seiner Gründung1975 mit der Aufbewahrung des Kul-turguts aus dem fünfzig Jahre altenöffentlich-rechtlichen Hörfunk undFernsehen beauftragt ist, die Aufga-be der Bewahrung und der For-schung übertragen, während dieNationalbibliothek weiterhin die Hin-terlegung von kommerziell in großemMaße vertriebenen Fotografien,Schallplatten und Videobändernsicherstellt und das Centre Natio-
nal du Cinéma, mit bessererRückendeckung, analog im Kino-bereich wirkt. Die technische Aus-stattung für Aufbewahrung, Bearbei-tung und Recherchen ist in Betrieb,und die modernsten dokumentari-schen Arbeitsweisen kommen zumEinsatz. Ein Team von Ingenieurenund Archivaren-Dokumentaren (100Personen) arbeitet seit drei Jahrendaran.
Die Forschung im Hörfunk- undFernsehbereich kann damit inZukunft in historischer Tiefe, ineinem fortlaufend geführten Kultur-gut und dank der bewährten doku-mentarischen und technischenSuchinstrumente mit sicheremZugang geführt werden. Aber dieeigentliche Neuerung der For-schungsvoraussetzungen liegt woan-ders: sie findet sich im wesentlichenin den modernen, der Art, den Zwän-gen und dem Zweck einer For-schungstätigkeit angepaßten Metho-den und Instrumenten, die mit einerprofessionellen und kommerziellenAktivität weder völlig vergleichbarnoch ganz von ihr zu trennen sind.
Diese neuen Methoden und Instru-mente (audiovisueller Multimedia-Arbeitsplatz mit einem PC-Bild-schirm, von dem aus freier Zugang zusämtlichen beschreibenden Angabenvon 850 000 Programmstunden desINA besteht, zu digitalisierten Bild-und Tondokumenten, zu Computer-programmen, mit denen ohne großenAufwand Recherche-Verzeichnisse
erstellt werden können, zu Program-men für Analyse, Anmerkungen undSegmentierung von Bild und Ton)wurden in enger Zusammenarbeitmit Forscherteams ausgearbeitet,getestet und von ihnen für gut befun-den, um ein Mißverhältnis zwischenübertrieben technischen Möglichkei-ten und dem tatsächlichen Bedarfder Nutzer zu vermeiden.
Diese seltene, wenn nicht gar niedagewesene Zusammenarbeit vonKonservatoren, Nutzern und Fach-leuten sowie die regelmäßigen und instruktiven Arbeitsgruppen-sitzungen (monatliche Methodik-Workshops, disziplinübergreifendesGremium zur Bild-Forschung, Veröf-fentlichungen, Kolloquien und öffent-liche Veranstaltungen) haben derForschung mit oder an audiovisuellenQuellen echte Legitimität und einekonkrete Dynamik verliehen.
Die Legitimität der Forschungim audiovisuellen BereichTrotz einer steigenden, von einigenPionieren (Edgar Morin und GeorgesFriedman bereits 1960, Marc Ferro,Pierre Sorlin und schließlich Jean-Noël Jeanneney, um nur einige zunennen) zum Ausdruck gekomme-nen gesellschaftlichen Nachfrage, dievon einer Gruppe Intellektueller,Philosophen, Historiker und Denkerin einem Artikel der Zeitung LeMonde im Oktober 1994 öffentlichneuformuliert wurde, blieben Not-wendigkeit und Legitimität von For-schung an den Massenmediennebensächlich.
Die « kulturellen » Hürden bei einemals gering eingeschätzten TV-Sys-tem, dessen Zuschauern eine Sensi-bilität oder gar Faktenwissen zuge-schrieben wird, sind ein Vielfacheseines kognitiven Ansatzes. Die tech-nischen, juristischen und finanziellenZwänge, die traditionelle Strukturder akademischen Ausbildungs- undForschungssysteme, der schwierige,oft gar unmögliche Zugang zu Quel-len, die vorrangig zum zweiten Marktder Programmindustrie wurden, sindzahlreich und effektiv vorhanden.
Die ersten ErgebnisseDie wichtigsten Voraussetzungen fürProduktion und Weitergabe kriti-scher Erkenntnisse über die Medien,von Intellektuellen, Politikern undFachleuten als dringlich gefordert,sind nun zu einem großen Teil ge-schaffen.
Im Medienbereich wurde, um denAusdruck von Michel de Certeau auf-zugreifen (Traverses, Nr. 36), fol-gende Verknüpfung hergestellt:- Gruppe (Forscher, Benutzer,Fachleute, Konservatoren),- Orte,- Praktiken und Techniken.
Mit dieser Verknüpfung konnte, inZusammenarbeit mit den Bibliothe-ken, Museen und Archiven eine west-liche Kultur aus historischer Sichterstellt und künftig weitergeführtwerden.
Die Forschung selbst ist nicht mehrdem Zufall und punktuellen Ergeb-nissen (durch das Videogerät) unter-worfen oder von jungen und isolier-ten Sendungen abhängig, ohnehistorischen Tiefgang, aus dem Pro-grammzusammenhang gerissen und
Medienund ForschungNeue BedingungenZugang zu Archiven und Dokumenten
immer der Gefahr von Programmän-derungen ausgesetzt. Die notwen-dige Distanzierung und der wissen-schaftliche Ansatz aus Hypothesen,Beweisen, Zitaten, Verweisen undErstellung eines entsprechendenKorpus sind möglich.
Die ersten Arbeiten, in der Mehrzahlin den Bereichen Geschichte, Kom-munikations- und Informationswis-senschaft sowie Soziologie, unter-scheiden sich voneinander undhalten einer kritischen Prüfungstand. Sie entgehen eher den Ver-lockungen und den Fallen der sim-plen Darstellung (Phänomen, Bewe-gung, Ereignis « aus der Sicht » desFernsehens), die nichts anderes ist,als eine überstürzte Synthese,Gemeinplätze oder Allgemeinheitenzu « dem » Fernsehen oder « den »Medien bzw. Entstellungen, die z.B.die Einschaltquoten vor den Jahren1984, 1986 hypostasieren.
Die Fachkreise, die für einige vonNatur aus mit den Mysterien desSchöpfungsprozesses verbundensind, für andere mit der berufsethi-schen Freiheit oder den apodikti-schen Kompetenzen und Expertisender technisch-kommerziellen Zwän-ge, verlieren ihr vorherrschendesMißtrauen.
Bleiben noch die zu engen juristi-schen Zwänge anzupassen (Re-cherche vor Ort, Problem der Zitateu.a.). Die Hilfswissenschaften fürdiese « Dokumente » müssen nochgeschaffen, die Methodik der Hu-manwissenschaften sicherlich ange-paßt und/oder bereichert und dieStrukturen, die Praxis und dieUnterstützung für Lehre und For-schung weiterentwickelt werden. DieLehre ordnet z.B. weiterhin, außerbei wesentlichen und krassen Aus-nahmen, eine einzelne Fernsehsen-dung der Logik einer Disziplin unter:Geschichte, Frankreich. So wird sie« einverleibt », und die zeitlicheBesonderheit der Produktion undder Ausstrahlung dieser « Dokumen-te » wird verändert. Es muß auchfestgestellt werden, daß es heute inder akademischen Ausbildung keinespezifische Auseinandersetzung mitFernsehen und Medien oder ihrerGeschichte gibt.
Wie dem auch sei, eine Antwortzeichnet sich für diese dringlicheNotwendigkeit einer Objektivierungder Medien durch den organisiertenEinsatz von Quellen ab, durch eineAnpassung, eine stärkere technolo-gische Sozialisierung, mit der die Wis-senschaftsgemeinde, die Lehrendenund durch ihre Vermittlung dieÖffentlichkeit nach und nach moder-ne « Geräte » und « Prothesen »(Computer, Multimedia) bedienenkönnen, mit denen die Forschungbereichert und vereinfacht wird, danun mit ihnen und nicht mehr nur ausder Erinnerung oder an audiovisuel-len Quellen gearbeitet werden kann.
« Die größte Erfindung dieses Jahr-hunderts », nicht nur Spiegel son-dern wesentlicher Bestandteil un-serer Gesellschaft, « schlimmes,notwendiges Objekt », konnte es sichnicht erlauben, ungestraft undunversehrt der einzige Ort eines radi-kalen Nichtdenkens zu sein.
von Francis Denel, Direktor, Inathèque.
22 Sequentia Vol. III, Nr. 9, OKTOBER/NOVEMBER 1996
Die Spielregeln
Rechte anFormaten von Sendungen
Weltweit handelt die Fernseh-industrie scheinbar routinemäßigmit den Formaten für Fernseh-serien. Deshalb sind sich juri-stische Beobachter außerhalbEnglands wahrscheinlich nichtdarüber im klaren, weshalb dieCopyright Directorate im Ver-einigten Königreich ein “weiteresKonsultationsdokument“ vorgelegthat, in dem über die Möglichkeit,diese Dinge gesetzlich zu schüt-zen, nachgedacht wird.1
Das juristische Problem betreffendden Schutz von Sendeformatenergibt sich aus einem Urteil (derFall Hughie Green) des britischenKronrates. Es ist zwar nicht für alleCommon Law-Gerichte bindend,wird aber dennoch von diesen inBetracht gezogen.
Der kombinierte Effekt diesesGerichtsurtei ls und andererAspekte des englischen Rechts(s.u.) zieht die Vermutung, daßSendeformate wirksam geschütztseien, erheblich in Zweifel. Manhört, daß die Lage in Kanada, wodas Konzept des Formats einerSendung gerichtlich anerkanntwurde, anders ist, und es heißtauch, daß wenigstens bestimmteFormate in vielen Gerichtsbarkei-ten wirksam geschützt sein kön-nen, z.B. in Italien, Frankreich undSpanien, wenn auch nach unter-schiedlichen Rechtstheorien. Wasdie USA angeht, so wird nichtbezweifelt, daß Formate geschütztwerden können, aber vielleichtwürde sich dieser Schutz eher ausdem amerikanischen Gesetz gegenden unlauteren Wettbewerb dennaus dem Urheberrecht als solchemergeben. Im Vereinigten König-reich gibt es kein allgemeinesGesetz gegen den unlauterenWettbewerb.
Fünf unwirksameSchutzmaßnahmenNach englischem Recht gibt es fünfoffenkundige Methoden um fest-zustellen, ob das Format einer Sen-dereihe geschützt ist. Keine davonfunktioniert zufriedenstellend. Es handelt sich um folgendeMethoden:
VertraulichkeitSolange der Inhalt eines Formatsvertraulich ist, kann er gesetzlichgeschützt sein. Dieser Schutzbezieht sich auf die Idee im Unter-schied zum Ausdruck (eine pas-sende grobe Vereinfachung). DieVertraulichkeit des Formats wirdjedoch spätestens bei der erstenAusstrahlung der entsprechendenSendung zerstört, unabhängig vomEmpfangsgebiet. Infolgedessen istVertraulichkeit nur während derEntstehungs- und Entwicklungs-
planung, sondern auch die Ausga-be großer Geldbeträge genau indem Stadium erfordern, in demder Wert des eigentlichen Formatsnoch nicht festgestellt ist.
Urheberrecht in Teilen(1) Kurze Musik- und/oderTanzstücke können urheberrecht-lich geschützt werden. Die Gestal-tung von Vorrichtungen undZubehör werden in der RegelUrheberrechten an Mustern oderähnlichen Rechten unterworfensein. Es können aber andere, wennauch funktionell äquivalente Merk-male benutzt werden.
(2) Eine ausführliche Zusammen-stellung von schriftlichen Spiel-regeln wird in der Regel als litera-risches Werk dem britischenUrheberrecht unterworfen sein.Doch wird es aufgrund dieserRegeln im allgemeinen nichtmöglich sein vorherzusagen, ob einSpiel, das nach diesen Regelngespielt wird, aufkommen wird.Nach englischem Urheberrechtwerden diese Regeln durch dasSpielen eines Spiels in Überein-stimmung mit diesen Regeln nicht“nachgebildet“.
Das Format selbstDie Möglichkeit wird durch Folge-rungen aus dem Entwurf desenglischen Copyright Designs
and Patents-Gesetzes von 1988(CDPA) und dem Urteil im FallHughie Green zerstört.
Obwohl der Begriff “Format“ in der Fernsehindustrie allgemeingebräuchlich ist, ist es nicht ganzeinfach, diesen in eine gesetzlicheDefinition zu packen. Nach demUrtei l des Kronrates im Fal lHughie Green kann der Begriff“Format“ als “eine Kombinationvon Merkmalen verstanden wer-den, die in jeder oder in den meis-ten Folgen einer Serie wiederholtwerden und von dem sich verän-dernden Material, das in jeder ein-zelnen Folge präsentiert wird, isoliert werden können (die Hand-lungen der Künstler in einerTalentshow, die Fragen und Ant-worten in einem Ratespiel usw.)“.Diese wiederholten Merkmale wer-den in der Regel in einer festgeleg-ten Form bestimmt. Die am deut-lichsten festgelegte Form wird dasgeschriebene Wort sein. Diese ge-schriebenen Worte werden die Ori-ginaläußerung des Autors sein.Europäische Rechtsanwälte glau-ben vielleicht, daß ein neues For-mat wahrscheinlich mit “dem krea-tiven Funken“ zu tun hat. Keinesvon diesen Dingen liefert jedocheine Antwort auf die Frage, ob einFormat nach englischem Rechtgeschützt sein wird.
phase von irgendeinem Nutzen,und selbst in dieser Phase gibt esProbleme. Das Gesetz, das sich aufvertrauliche Informationen be-zieht, ist von Gerichtsbarkeit zuGerichtsbarkeit verschieden. Eininternationales Übereinkommenhierzu gibt es nicht.
Passing off (Ausgeben eigener Waren als die eines anderen)Manchmal wird die Ansicht vertre-ten, daß das englische Delikt despassing off gewisse Ähnlichkeitmit einem Gesetz gegen den unlau-teren Wettbewerb hat. Der Klägermuß seinen guten Namen (oderGoodwill) nachweisen, sein Eigen-tum an den Waren oder Dienstlei-stungen sowie tatsächlichen odermöglichen Schaden. Internationa-le Übereinkommen hierzu gibt esnicht. Grundsätzlich steht es demPlagiator frei, eine Kopie anzuferti-gen und dabei ausdrücklich daraufhinzuweisen, daß sein Produktweder das Original noch geneh-migt ist. Es läßt sich der Stand-punkt vertreten, daß ein Wechseldes Moderators, Fernsehsendersund Titels, während alle anderenwesentlichen Elemente des For-mats gleich bleiben, eine ausrei-chende Unterscheidung ergeben,um eine Klage aus passing off zuFall zu bringen. Sicher hat es einKläger, der sich auf einen gutenNamen berufen will, den er sich imAusland erworben hat, vor demenglischem Recht schwer.
Eingetragene WarenzeichenEingetragene Warenzeichen kön-nen für Schlagworte oder daswichtigste Zubehör beantragt wer-den. Das britische Warenzeichen-recht wurde kürzlich (um das Tra-
de Marks Act 1994) ergänzt, sodaß die vormals strenge Trennungnach Gebrauchsklassen inzwi-schen nicht mehr ganz so strengist. Selbst wenn man annimmt, daßder angeblich verletzende Ge-brauch tatsächlich der Gebraucheines Warenzeichens wäre (so daßhierfür die Einschränkungen desbritischen Warenzeichenrechtsgelten), gibt es nichtsdestowenigerProbleme. Es wird nicht möglichsein, alle Merkmale eines Formatsdurch Warenzeichen zu schützen.Diejenigen, die geschützt werdenkönnen, können wohl durch denEinsatz eines funktionellen Äqui-valents “überarbeitet“ werden. Inder Praxis würde die Notwendig-keit, viele verschiedene Waren-zeichen in unterschiedlichenGebrauchsklassen und unter-schiedlichen Gerichtsbarkeiteneintragen zu lassen, nicht nur eineungewöhnlich gründliche Voraus-
Charles RussellMitarbeiterRichard McD. Bridge hat seit1987 mehrere Beiträge überFormate publiziert. Er ist Soziusder englischen Kanzlei CharlesRussel. Charles Russel nimmtseit mehreren Jahren Stellungzu Fragen aus den BereichenTelekommunikation undMedien. Nach der Fusion mitCompton Carr wird die Medien-gruppe Charles Russel heutevon Brian Carr geführt undbefindet sich weiter aufExpansionskurs.
Kontaktpersonen bei Charles Russell:
– Telekommunikation: Mark Moncreiffe
– Medien und Musik: Brian Carr
– Film, Fernsehen und Video:Richard McD. Bridge
– Klassische Musik: Laurie Watt
– Verleumdung: Peter Scandrett
– Computerrecht: David Berry
Charles Russellsolicitors8-10 New Fetter LaneLondon EC4A 1RSTel.: (44) 171 203 5000Fax: (44) 171 203 0202
Sequentia Vol. III, Nr. 9, OKTOBER/NOVEMBER 1996 23
Es wird manchmal vorgeschlagen,daß die Worte, die das Formatdarstellen, ein literarisches Werksein müssen. Nach dem Copyright
Act 1956 wird allgemein nicht be-zweifelt, daß ein Werk gleichzeitigein literarisches und ein drama-tisches Werk sein kann. Nach demArtikel 3(1) des CDPA schließenliterarische und dramatische Wer-ke einander aus. Was ist aber eindramatisches Werk? Die Definitionin demselben Artikel lautet: “dra-
matisches Werk schließt ein Werkdes Tanzes oder der Pantomimeein“. Es wird vorgeschlagen, daßdie Prüfung, ob ein Werk “drama-tisch“ ist, aus dem Fall Fuller ./.
Blackpool Winter Gardens
(1895) 2 QBD hervorgeht. Hierwurde die Meinung vertreten, daßdas Lied nicht dramatisch war, weiles nicht “für das Schauspiel ange-paßt“ war und für dessen “korrekteDarstellung kein Spielen (acting)und möglicherweise keine Bühnen-dekoration [erforderlich] war“. Ver-langt die korrekte Darstellungeines Werkes Spielen und eineBühnendekoration, ist das Werksomit von Natur aus dramatisch,ganz gleich, ob es geschützt istoder nicht. Deshalb kann es keinliterarisches Werk sein.
Zweitens, selbst wenn das Formatein geschütztes literarisches Werksein könnte, darf bezweifelt wer-den, ob die Darstellung eines,sagen wir, Spiels in Übereinstim-mung mit einem in einem schriftli-chen Werk niedergelegten Planeiner Verletzung des literarischenUrheberrechts gleichkäme.
Urteile des Kronrates scheinen dieMöglichkeit des Schutzes als dra-matisches Werk umfassend zu ver-werfen.2
Fernsehsendungen mit einem For-mat bilden rund 30% der im briti-schen Fernsehen ausgestrahltenEigenproduktionen. Es gehört zumAlltag, Lizenzen für Sendeformatezu erteilen. Dieser rechtmäßigeHandel verdient einen passendenSchutz. Die Schöpfer von Forma-ten wenden erheblich kreativeFähigkeiten und Arbeit auf. Diesekreativen Fähigkeiten und Arbeitsind von derselben Art, die auch indas Schreiben eines Romans ein-fließt. Formate sind Werke deskreativen Geistes ihres Schöpfers.Dem Wettbewerbsdruck folgt derkommerzielle Druck, solche For-mate zu kopieren, die sich alserfolgreich erwiesen haben.
Der aktuelle Vorschlag, der in dembritischen Konsultationsdokumenterläutert wird, besteht darin zuklären, daß “Kopieren im Zusam-menhang mit einem urheberrecht-lich geschützten Werk oder einerSerie von urheberrechtlich ge-schützten Werken, die ein ausrei-
chend detailliertes Schema odereinen Plan für eine Serie von Sen-dungen dokumentieren, auch dieHerstellung einer Sendung nachdiesem Schema oder Plan umfaßt“.Die Fixierung wäre Vorschrift. DasWerk oder die Serie von Werkenmüßte der ersten Sendung, dienach dem Schema oder Plan pro-duziert wird, zeitlich vorangehen.Damit (DTI hat darauf bestanden)wird die Herleitung des Schutzesvon Formaten durch die bloße Pro-duktion einer Sendung oder einerReihe von Sendungen verhindert.Es sind technische Unterscheidun-gen zu klären im Hinblick darauf,ob das Format “nicht kopiert“ oder“originell“ (oder, um die Harmonieim EWR zu fördern, sogar “krea-tiv“) sein soll. Bisher ist noch nichtklar, wie die Probleme, die sich ausder Fortentwicklung von Formatenwährend der Entwicklung erge-ben, behandelt werden sollen(während der gesamten Entwick-lung wird jede aufeinanderfolgen-de Fortentwicklung in großemUmfang von einer vorangegange-nen Fortentwicklung kopiert wor-den sein).
Das Konsultationsdokument aner-kennt, daß es, obwohl ein Schemaoder ein Plan für eine Reihe vonSendungen allgemein die Merk-male, die in jeder Sendung der Rei-he präsent sein müssen, erläuternmuß, auch Serien geben wird, z.B.Wettbewerbe, für die es ein Finaleund Halbfinale geben wird, die not-wendigerweise unterschiedlicheAspekte haben werden.
Drei ProblemeDerzeit macht der Entwurf denVorschlag, daß “ausreichenddetai l l iert“ Ausführung mitgenauen Angaben zu “erheblichmehr als einer Idee“ heißen sollte.Es gibt keinen Grund, weshalb einFormat anders als jedes andereurheberrechtlich geschützte Werkbehandelt werden sollte. Deshalbsollten die allgemein gültigenMindestanforderungen in bezugauf Kreativität, Originalität undWesentlichkeit ausdrücklich auchim Zusammenhang mit einemSchema oder Plan, aus dem ein Format gebildet wird, gelten.
Die britische Regierung sagt, daßwährend eines Übergangszeit-raumes der einfachste Ansatz inder bloßen Anwendung des geän-derten Gesetzes auf solche Forma-te, die nach der Gesetzesänderunggeschaffen wurden, bestehen wür-de. Es würde damit versäumt, vie-le vorhandene Formate richtig zuschützen. Das neue Gesetz, vorbe-haltlich einer angemessenen Über-gangsfrist, um denjenigen, diebereits gutgläubig Vereinbarungeneingegangen sind, Gelegenheit zugeben, ihre Positionen neu zu ge-stalten, sollte auch für alte Forma-
te gelten. Dieses Problem hatÄhnlichkeit mit der Frage, diehäufig im Zusammenhang mit demBeitritt zur Berner Übereinkunftzu klären ist.Bis zur internationalen Harmoni-sierung ist die Frage der Gegensei-tigkeit vielleicht etwas schwierigerzu beantworten. Wenn Formate alsliterarische oder dramatische Wer-ke geschützt sind, dann würde derelementare Grundsatz der BernerÜbereinkunft darin bestehen, daßWerke, gemäß dem nationalenRecht zu schützen sind. Artikel 6der Berner Übereinkunft aner-kennt, daß Länder, die der BernerÜbereinkunft beigetreten sind, inder Lage sein müssen, den Schutz,der Werken von Autoren, dieStaatsangehörige anderer Ländersind, gewährt wird, einzuschrän-ken, wenn diese Länder Werkenvon Autoren aus Ländern der Ber-ner Übereinkunft selbst keinenausreichenden Schutz gewähren.Gegenwärtig scheint das britischeRecht sogar noch etwas weiter zugehen: Artikel 160 des CDPA ge-stattet dem Vereinigten König-reich, durch Regierungsverord-nung Vorschriften zu erlassen, diedie Rechte in bezug auf Werke vonAutoren, die zu einem beliebigen
Land gehören, das britischen Wer-ken keinen ausreichenden Schutzgewährt, einschränken. Wenn aberFormate eine sui generis Katego-rie urheberrechtlich geschützterWerke wären, dann sollten Forma-te, falls Mitgliedsländer der BernerÜbereinkunft diesen allgemein kei-nen Schutz gewähren, nicht sobetrachtet werden, als fielen sieunter den Begriff “literarische undkünstlerische Werke“ für dieZwecke des Artikels 2 der BernerÜbereinkunft.
Wahrscheinlich sind Formate vonSendungen in einer Reihe vonGerichtsbarkeiten geschützt.Sofern die Formate den Anforde-
© Europarat.
rungen an Kreativität, Originalitätund Wesentlichkeit genügen, dieallgemein für urheberrechtlichgeschützte Werke gelten, solltensie im Vereinigten Königreichurheberrechtlich geschützt sein.Besondere Sorgfalt könnte jedochnotwendig sein, um sicherzustel-len, daß existierende Formate(oder existierende Beteiligungenan Formaten) durch die Änderungdes britischen Gesetzes nicht zuUnrecht benachteiligt werden, unddaß die Gesetzesänderung sich derallgemeinen europäischen Positionannähert.3
von Richard McD. Bridge,Partner
Charles RussellSolicitors
(Vereinigtes Königreich)
1. Exemplare des “weiteren Konsultationsdo-kuments” zu Fernseh-Format-Rechten kannbezogen werden von: Mrs Judith Sullivan,Department of Trade and Industry, HazlittHouse, 45 Southampton Buildings, LondonWC2A 1AR. Kommentare sind ebenfalls andiese Adresse zu richten.
2. Zunächst bezog sich das geschätzte HoheGericht auf “die Schwierigkeit des Konzepts,das eine Reihe von angeblich unverwechsel-baren Merkmalen einer Fernsehserie von demsich verändernden Material, das in jeder ein-zelnen Darbietung präsentiert wird (die Hand-lungen der Künstler in der Talentshow, dieFragen und Antworten im Ratespiel usw.), iso-liert und als ein “original dramatisches Werk“identifiziert werden kann“. Die Richter führtenweiter aus, “daß dem Hohen Gericht kein Fallgenannt wurde, in dem ein Urheberrecht ähn-lich dem hier geforderten festgestellt wordenwar“. Die Richter erklärten weiter, daß “eindramatisches Werk eine ausreichende Ge-schlossenheit aufweisen muß, um dargebotenwerden zu können, und daß den Merkmalen,die das “Format“ einer Fernsehshow bildensollen, diese wesentliche Eigenschaft fehlt, dasie außer als Zubehör, das für die Präsenta-tion einer anderen dramatischen oder musika-lischen Darbietung verwendet werden muß, inkeiner Beziehung zueinander stehen.“
3. Es gibt bisher nur eine umfassende Unter-suchung über die Rechtsstellung von Forma-ten nach englischem Recht. Dabei handelt essich um “The Protection of Formats underEnglish Law“ (Part I and II) [1990] 3 Entertain-ment Law Review, von den Autoren Lane undBridge.
D.R
. TF1
Bestellen Sie diese Dokumentensammlung bis zum 30.11.1996 zum Subskriptionssonderpreis von nur FF 245,- und Sie verfügen über die komplette Sammlung der urheberrechtlich relevanten Dokumente von übernationaler Bedeutung in drei Sprachen!
Subskriptionspreis: Nur FF 245,- (an Stelle von FF 345,-)
Gesamtbetrag meiner Bestellung FF
❏ Visa ❏ Eurocard / Mastercard ❏ Access
Kartennummer
Gültig bis
Unterschrift
❏ Beiliegender Scheck in FF an die Europäische Audiovisuelle Informationsstelle
Name Vorname
Position Unternehmen
Anschrift
PLZ - Ort Land
Telefon Fax
* Abonnenten von IRIS - Rechtliche Rundschau der Europäischen Audiovisuellen Infor-mationstelle, erhalten IRIS Spezial kostenfrei.
Diese Daten werden in die Datenbank der Europäischen Audiovisuellen Informationsstelle aufgenommen,damit sie an Dritte weitergeleitet werden können. Gemäß den vom Europarat verabschiedeten Vorschrif-ten über Datenbanken und den Schutz der Privatsphäre, haben alle Personen, zu denen Angaben in derDatenbank enthalten sind, einen Anspruch auf Zugang zu den sie betreffenden Informationen und auf derenAbänderung oder Löschung. Falls Sie nicht wünschen, daß Ihre Daten weitergeleitet werden, kreuzen Siebitte hier an: ❏
Ja ! Ich bestelle IRIS SPEZIAL 1996 !*
Bitte zurücksenden an :Europäische Audiovisuelle Informationsstelle - Anne Boyer76 allée de la Robertsau - F - 67000 StrasbourgTel.: (33) 03 88 14 44 06 - Fax: (33) 03 88 14 44 19URL http://www.obs.c-strasbourg.fr
1996
IRIS• •
SPEZIALIRIS SPEZIAL 1996
Internationale Dokumentezum Urheberrecht
Das Urheberrecht hat durch die schnelle Erweiterung der Nutzungs- und Verbreitungsmöglichkeiten audio-visueller Werke dramatisch an Bedeutunggewonnen. Die Diskussionen um dasUrheberrecht betreffen dabei sowohl dasAusmaß wie auch die inhaltliche Ausge-staltung des Regelungsbedarfs. In demMaße, in dem die audiovisuellen Märkteimmer grenzüberschreitender werden,gewinnt auch die Bedeutung interna-tionaler Vereinbarungen in diesemBereich. Die Informationsstelle publiziertaus diesem Grund in einer IRIS-Sonder-ausgabe alle Europäischen Konventionenund sonstige internationale Verträgesowie die europäischen Richtlinien imBereich des Urheberrechts. Das Werkenthält die Volltext-Version der neben-stehenden Texte sowohl auf deutsch alsauch auf englisch und französisch undgibt für die internationale Verträge einenumfassenden Überblick über den Standder Unterzeichnung und Ratifikationen:
Inhalt: • Berner Übereinkunft zum Schutz von Werken derLiteratur und Kunst • Welturheberrechtsabkommen • Multi-laterales Abkommen über die Vermeidung der Doppel-besteuerung von Urheberrechtsentgelten • InternationalesAbkommen über den Schutz der ausübenden Künstler, derHersteller von Tonträgern und der Sendeunternehmen(Rom-Abkommen) • Übereinkommen zum Schutz der Her-steller von Tonträgern gegen die unerlaubte Vervielfältigungihrer Tonträger • Europäisches Übereinkommen zur Klärungurheberrechtlicher Fragen des GrenzüberschreitendenSatellitenrundfunks • Richtlinie des Rates vom 14.05.1991über den Rechtsschutz von Computerprogrammen • Richt-linie des Rates vom 19.11.1992 zum Vermietrecht und Ver-leihrecht sowie zu bestimmten dem Urheberrecht verwand-ten Schutzrechten im Bereich des geistigen Eigentums •Richtlinie des Rates vom 29.10.1993 zur Harmonisierungder Schutzdauer des Urheberrechts und bestimmter verwandter Schutzrechte • Richtlinie des Rates vom27.09.1993 zur Koordinierung bestimmter urheber- und leistungsschutzrechtlicher Vorschriften betreffend Satelli-tenrundfunk und Kabelweiterverbreitung • Richtlinie desRates vom 11.03.1996 hinsichtlich des rechtlichenSchutzes von Datenbanken.
26 Sequentia Vol. III, Nr. 9, OKTOBER/NOVEMBER 1996
TV programmes
Die Programmgeschichte desFernsehens trat lange Zeit hinterdie Beschreibung von Entwick-lungen der Medientechnik, derMedienpolitik zurück. Sie war bisin die frühen achtziger Jahrevielfach in die Darstellung derSendergeschichte integriert. DieJahrbücher der Sendeanstaltenvermittelten Rückblicke in Teil-bereiche der eigenen Programm-entwicklung und des Programm-angebots. Auch Jubiläen botenAnlaß zum Rückblick in die eigeneProgrammgeschichte, so etwa derRückblick vom ehemaligen SDR-Intendanten Hans Bausch auf 30 Jahre ARD. Eine senderüber-greifende Institutionsgeschichtedes Rundfunks in Deutschlandwurde von Hans Bausch 1980 imDeutschen Taschenbuch Verlagvorgelegt.
1969 wurde in Ludwigshafen der Studienkreis Rundfunk undGeschichte zur Sicherung derQuellen1 mit dem Ziel der Auf-arbeitung von bundesdeutscherRundfunkgeschichte gegründet.Wiederum stand neben derEntwicklung der Sendeanstaltenzunächst die Geschichte derMedienpolitik im Zentrum desInteresses. Eine Programm-geschichte schien als Themen-komplex zu umfassend zu sein.Diskussionen über die Methodikder Programmgeschichtsschrei-bung gingen umfassenden Unter-suchungen zur Fernsehgeschichtevoraus. Winfried B. Lergs BeitragProgrammgeschichte als For-
schungsauftrag, eine Bilanz und
ihre Begründung in “Studien-kreis Rundfunk und GeschichteMitteilungen” (STRGM) Jg.8. 1982löste eine Diskussion über die adä-quate Methodik der Programm-geschichtsschreibung aus. Die Pro-blematik des additiven Ansatzes,der Programmgeschichte nur alsSumme aus Bausteinen der Ge-schichte einzelner Programmfor-men möglich erscheinen läßt, hatKnut Hickethier in seinem BeitragGattungsgeschichte oder gat-
tungsübergreifende Programm-
geschichte? Zu einigen Aspekten
der Programmgeschichte des
Fernsehens in STRGM Jg.8. 1982Nr. 3 erörtert. Erst in den acht-ziger Jahren befaßte sich eine For-schergruppe des Deutschen Rund-funk Archivs (DRA) mit derkonkreten Problematik der Pro-grammgeschichtsschreibung desWeimarer Rundfunks, die etwahinsichtlich der Kategorienbildungauch für das Fernsehen zutreffen.2
Das Problem der Unzugänglichkeitvieler Quellen erschwert die Pro-grammgeschichtsschre ibungaußerhalb der Sendeanstalten.Senderarchive sind aufgrund
zur Programmgeschichte des Deutschen Fernsehens
Übersicht über diemedienwissenschaftliche Forschung
rechtlicher Problematik für Wis-senschaftler nur in Ausnahmefäl-len zugänglich - der Forschungs-bereich Bildschirmmedien an derUniversität – in Siegen hat mit denFernseharchiven Nutzungsver-träge abgeschlossen. Ausgehendvon dieser Problematik engagiertsich der ehemalige RIAS-IntendantHelmut Drück für die Gründungeines deutschen Medienarchivs,das auch für Wissenschaftler zurVerfügung stehen soll.Die Programmgeschichtsschrei-bung des Fernsehens erfolgte seitden achtziger Jahren vor allem imRahmen der produktbezogenenliteraturwissenschaftlich orientier-ten Medienwissenschaft. HelmutKreuzer hat nach seinem Postulatüber das “Fernsehen als Gegen-stand der Literaturwissenschaft”(Saarbrücken 1971) 1980 ein Son-derheft der Zeitschrift für Litera-turwissenschaft und Linguistikzum Thema: “Fernsehforschungund Fernsehkritik” herausgege-ben, das den Gegenstandsbereichvorstellte. Bislang dominiert dasBausteinprinzip der Programm-geschichtsschreibung die For-schungsvorhaben. Helmut Kreuzerund Karl Prümm legten in ihremSammelband “Fernsehsendungenund ihre Formen” 1979 eine ersteÜbersicht über die Programmfor-men des Fernsehens und ihre his-torische Entwicklung vor. KnutHickethier hatte bereits 1980 eineumfassende Darstellung der histo-rischen Entwicklung des Fernseh-spiels veröffentlicht.Mit dem Ziel der Schließung beste-hender Forschungslücken imBereich der Programmgeschichtedes Deutschen Fernsehens grün-dete die DFG den Siegener Son-derforschungsbereich “Ästhetik,Pragmatik und Geschichte derBildschirmmedien. Schwerpunkt:Fernsehen in der BundesrepublikDeutschland”. Der Sonderfor-schungsbereich arbeitet seit 1986in Kooperation mit Wissenschaft-lern der Universitäten Aachen undMarburg und legte auf der Basiseiner Vielzahl von genrebezogenenEinzeluntersuchungen3 - etwa zurGeschichte des Magazinformats,der Nachrichten, des Kinderfern-sehens, der Werbung, des Doku-mentarfilms, der Serien und derFernsehgeschichte der Literatur -mit dem von Helmut Kreuzer undHelmut Schanze herausgegebenenBand “Fernsehen in der Bundes-republik Deutschland: Perioden -Zäsuren - Epochen” einen erstenVersuch übergreifender Zäsuren-bildung vor. Datensammlungen alsBasis der Programmgeschichte desFernsehens und der Entwicklungseiner speziellen Sendeformen bil-den Joan Kristin Bleichers Chronikzur Programmgeschichte des
sondere des Kinder- und des Bil-dungsfernsehens ist Gegenstandeiner Vielzal von Untersuchungen.Ellen Marga Schmidt befaßte sichmit der Entwicklung des “Schul-fernsehen in der ARD 1964-1971.”Hans Dieter Erlinger hat imRahmen seines Teilprojektes imSiegener Sonderforschungs-bereich diverse Publikationen zurhistorischen Entwicklung des Kin-derfernsehens herausgegeben.Programmgeschichte ist auch Teilvon Versuchen neuer Geschichts-modellbildung. Axel Schildt hat inseiner kulturhistorischen Arbeit zuden fünfziger Jahren auch dieFernsehgeschichte berücksichtigt.Hans Ulrich Gumbrecht, PeterSpangenberg, Thomas Müller undMonika Elsner haben in diversenPublikationen versucht, histo-rische Fernsehentwicklung undMentalitätsgeschichte zu ver-knüpfen.Eine Modellbildung hinsichtlichder Parallelen von historischenEreignissen mit aktuellen Pro-grammentwicklungen ist Teil einerUntersuchung, die gegenwärtig imRahmen des von Knut Hickethiergeleiteten DFG-Projektes “Fern-sehen in den neunziger Jahren” ander Universität Hamburg durch-geführt wird. Strategien der Pro-grammkonkurrenz zwischen ARDund ZDF in den sechziger Jahrenwerden mit aktuellen Programm-planungsstrategien kommerziellerAnbieter verglichen. Es zeigt sich,daß die bisherige Fernsehentwick-lung viele Erklärungsmöglichkei-ten für aktuelle Programmentwick-lungen liefert und darüber hinausviel Informationen über Erfolgs-potentiale von Programmplazie-rungen und der Gestaltung vonFernsehsendungen enthält.
Joan Kristin BleicherJoan Kristin Bleicher ist wissenschaftlicheMitarbeiterin in einem DFG-Projekt an derHamburger Universität, das sich mit derEntwicklung des Fernsehens in den 90erJahren befaßt. Von ihr liegen zahlreicheUntersuchungen zu Aspekten der Pro-grammentwicklung des deutschen Fern-sehens vor.
1. Friedrich P. Kahlenberg:Voraussetzungder Programmgeschichte - Die Erhaltungund Verfügbarkeit der Quellen. In: STRGM1982 Nr.1 S.18-27.2. Projektgruppe Programmgeschichte:Zur Programmgeschichte des WeimarerRundfunks. Frankfurt am Main 1986.3. Jeweils aktualisierte Bibliographiengeben eine Übersicht über den For-schungsstand der einzelnen Teilprojekte.Zuletzt: Sara Bernshausen; Susanne Pütz;Veröffentlichungen aus dem Sonderfor-schungsbereich “Bildschirmmedien” III.Siegen 1996.
Eine übersichtliche Bibliographie zurProgrammgeschichte des deutschenFernsehens erhalten Sie on-line:http://www.obs.c.strasbourg.fr/sequen-tiamain.htm.
Deutschen Fernsehens und GerdHallenbergers/Joachim Kaps “Hät-ten Sie’s gewußt” zur Entwicklungvon Game-shows.
Als projektübergreifendes zen-trales Werk des Sonderforschungs-bereichs ist die Veröffentlichungder von Helmut Kreuzer und Chris-tian W. Thomsen herausgegebenenfünfbändigen “Geschichte desFernsehens in der BundesrepublikDeutschland” (München 1993), zunennen. Band 1 befaßt sich mitGrundlagen und Rahmenaspektender Programmgeschichte desFernsehens, etwa der Technik-und Institutionsgeschichte. KnutHickethier behandelt die Pro-grammgeschichte des Fernsehensin der BRD; Peter Hoff setzt sichmit der Programmgeschichte desDDR-Fernsehens auseinander.Band 2 befaßt sich mit der histori-schen Entwicklung künstlerischerDarstellungsformen des Fern-sehens, Band 3 mit der Entwick-lung von Informationssendungen,Band 4 mit sonstigen Sendefor-men, Band 5 mit Handlungsrollen,wie etwa der Autorschaft.
Einen Schwerpunkt der Pro-grammgeschichtsschreibung bildetdie Entwicklung des deutschenFernsehens in der Zeit des Natio-nalsozialismus. Klaus Winkler hatin seiner materialreichen Disserta-tion “Fernsehen unterm Haken-kreuz. Organisation, Programm,Personal”. (Köln 1994) die Ent-wicklung des NS-Fernsehensanhand vorhandener Unterlagenaufgearbeitet. Pionier des The-menkomplexes ist Erwin Reiss, der1979 “Wir senden Frohsinn. Fern-sehen unterm Faschismus” publi-zierte. William Uricchio hat sich indem von ihm 1991 herausgegebe-nen Sammelband mit den Pro-grammangeboten des NS-Fern-sehens auseinandergesetzt. Auchpersönliche Erinnerungen vermit-telten subjektive Einsichten inTeilbereiche der frühen Programm-entwicklung. Kurt Wagenführ be-schreibt in zahlreichen BeiträgenTeilbereiche der Fernsehge-schichte auf Basis seiner lang-jährigen Erfahrungen als Fernseh-kritiker. Wiederholt sind in denFernseh-Informationen auch Erin-nerungen von Programmitarbeiteraus früheren Phasen der Fern-sehentwicklung enthalten. Etwadie Erinnerungen von GerhatGoebel zum Fernsehsender “PaulNipkow” in Berlin aus den Fern-seh-informationen Jg. Nr. 33 1982oder die Reihe mit ErinnerungenPeter A. Horns “Damals in Berlinund Paris” (1981) zum BerlinerFernsehen und dem deutschen Besatzungsfernsehen in Paris.
Auch die historische Entwicklungvon Spartenprogrammen, insbe-