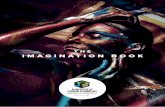Selbstvergleich und Selbstbehauptung: Die historische Imagination imperialer Eliten
Transcript of Selbstvergleich und Selbstbehauptung: Die historische Imagination imperialer Eliten
Selbstvergleich und Selbstbehauptung: Die historische Imagination imperialer Eliten1
Eva Marlene Hausteiner
»Zur Analyse politischer Systeme und politischen Handelns gehört […] die Gedächtnisdimension unabdingbar dazu«, postuliert Helmut König in sei-ner erinnerungspolitischen Studie Politik und Gedächtnis (2008: 11). König arbeitet diese These an vier Fallbeispielen ab – dem biblischen Bund, der Hobbes‘schen Vertragstheorie, nationalen und postnationalen Konstellatio-nen. Diese Klassifizierung ist insofern unvollständig, als ein fünfter Modus politischer Vergangenheitspraxen, nämlich jener der imperialen Geschichts-referentialisierung, nicht der Analyse unterzogen wird. Doch auch imperia-les politisches Handeln bezieht sich auf Vergangenes, appropriiert Geschich-te und entwirft, aus einer Reihe von Motivationen seiner Eliten heraus, historische Narrative. Mit nationalem Gedächtnis in Form des kollektiv-ge-meinschaftlichen Erinnerns haben imperiale Geschichtsbezüge indes wenig gemein: In der Legitimation wie in der Selbstreflexion imperialer Herrschaft nimmt die Berufung auf historische Ereignisse und historisches Wissen eine bedeutende Rolle ein, die sich grundlegend insbesondere von nationalstaat-lichen Geschichtsreferentialisierungen unterscheidet. Doch Gemeinsamkei-ten existieren – nicht zuletzt, wenn es um die Selektivität und Konstruiert-heit von Geschichtsbezügen geht. Wie Ernest Gellner in seiner Studie Nations and Nationalism (1983) weist Helmut König auf die begrenzte Be-deutung der materiellen Grundlage für ordnungs- und sinnstiftende Erinne-rung hin – die erinnerte Epoche wird in den Deutungen der Erinnernden nicht allein neuen narrativen Mustern unterzogen, sondern regelrecht neu erzeugt. Der Nationalismus geht somit der Materialität der Nation voraus. Geschichte wird nicht rezipiert, sondern konstruiert und letztlich transfor-miert; dies gilt auch für imperiale Anverwandlungen historischer Narrative.
1 Für wertvolle Hinweise danke ich den Teilnehmern der Tagung »Strategien imperialer Legitimation und Integration« im November 2011 sowie den Diskutanten der Forschungs-kolloquia »Theorie der Politik«, Humboldt-Universität zu Berlin, und »Neuere und Neu-este Geschichte«, Universität Konstanz.
16 Eva Marlene Hausteiner
Und dennoch: Es ist aufschlussreich zu überprüfen, welche historische Pha-se, beziehungsweise welches Bild einer historischen Phase für welche rezipie-rende Gesellschaft oder Epoche Attraktivität entfaltet (vgl. Burrow 1981: 1). Im Folgenden sollen einige grundsätzliche und dabei idealtypisch angelegte Überlegungen über einen spezifisch imperialen Modus des Geschichtsbezugs als Legitimations- und Selbstreflexionsstrategie angestellt werden. Hierfür wird zunächst der national- und territorialstaatliche Erinnerungsmodus als Gegentypus skizziert, bevor ich Grundzüge imperialer Geschichtsappropria-tion entwerfe und sie anhand eines zentralen Fallbeispiels aus dem späten 19. Jahrhundert illustriere.
I
In den vergangenen Jahren – ungefähr gleichzeitig mit dem neuerlichen Be-deutungszuwachs des demokratisch verfassten Nationalstaats in der »dritten Welle« der Demokratisierung (Huntington 1991) – hat sich eine Hochkon-junktur der Forschung zu Erinnerungskultur und Geschichtspolitik, Ur-sprungs- und Gründungsmythen von (National-)Staaten herausgebildet (vgl. grundlegend Nora 1984–1992; Assmann 2006; Münkler 2009), deren Zenit möglicherweise bereits überschritten ist. Häufig demonstrieren diese Darstellungen den Prozess nationaler Selbstkonzeption und -integration im Spiegel der Geschichte, was König folgendermaßen rechtfertigt:
»In der jüngeren Geschichte nimmt keine politische Ordnung so sehr das Gedächt-nis in Anspruch wie der Nationalstaat. Die nationale Legitimation, die in Europa seit dem Ende des 18. Jahrhunderts die dynastische Legitimation politischer Ordnungen ablöst, hat einen besonders großen Bedarf an Gemeinsamkeitsglauben, der wieder-um durch die Erinnerung an eine gemeinsame Vergangenheit eine starke Unterstüt-zung erfährt« (König 2008: 13).
Die gewählten Fallbeispiele der jüngeren Erinnerungskulturindustrie sind nicht grundlos der Geschichte der Flächenstaaten seit etwa dem 18. Jahrhun-dert bis zu den Staatsbildungen der Gegenwart entlehnt, denn in diesen Ordnungen, die prinzipiell als imagined communities konstituiert sind (An-derson 2006 [1983]), ist die integrative Herstellung von Zusammenhalt und die Stabilisierung und Legitimierung desselben unabdingbar. Sie sind im Resultat Erinnerungsgemeinschaften (Weber 1980 [1921]: 238) oder »com-m u nit[ies] of recollection« (Mill 1975 [1861]: 380), die auf eine aktive, oft
Selbstvergleich und Selbstbehauptung 17
genug intentionale Erinnerungs- und Geschichtspolitik in Wort und Tat, also durch Rhetorik und Interpretation wie auch durch Rituale, angewiesen sind. Die Nation als locus classicus von Erinnerungskulturen bedarf dieser Erinnerungsstrategien und der Bezugnahmen auf eine »eigene« Vergangen-heit zur Konstitution und Selbsterhaltung. Entsprechend ist zwar die Kons-truktion nationalhistorischer Narrative durchaus Angelegenheit von Deu-tungseliten – den nationalistischen Dichtern und Denkern des frühen 19. Jahrhunderts im Deutschen Bund zum Beispiel; doch die Adressaten sind Mitglieder der imaginierten Gemeinschaft, weshalb Massenkommunikation auch eine zentrale Rolle in der Generierung und Perpetuierung historischer Narrative spielt.2 Diese enge Verknüpfung von Nationalstaat und Ge-schichtsbezug mag auch das scheinbare Paradoxon erklären, dass einerseits der Niedergang des Nationalstaats besungen wird, also die Relativierung der Bedeutung von Nationen und institutionellen Flächenstaaten unter den Bedin gungen von Globalisierung und Interdependenz (vgl. exemplarisch Leibfried/Zürn 2006; Reinhard 2007), andererseits aber beträchtliche wis-senschaftliche Energien in die Erforschung eben nationalstaatlicher Ge-schichtspraxen investiert werden. Empirisch wie auch theoretisch-strukturell bietet die Nation die reichste Anschauung und ein evidentes Archiv für po-litische Referentialisierungen und Instrumentalisierungen von Vergangenheit.
Ein Schlüsselbegriff in der Auseinandersetzung um nationale Gemein-schaftsbildung ist jener der kollektiven Identität (vgl. Giesen 1991). Er zeigt ein grundlegendes Spannungsfeld in der Frage nationaler Geschichtsverhält-nisse auf: Einerseits setzt die Referenz auf eine gemeinsame Geschichte ein Mindestmaß an kollektiver Identifikation voraus, andererseits generiert sie erst eine tragfähige Grundlage für ebendiese Identifikation. Die nationale Gemeinschaft ist Produkt und Nährboden historischer Imaginationen zu-gleich. Daher hat die Rede von europäischer Erinnerungskultur, europäi-schen lieux de mémoire etc. stets einen präskriptiven Beigeschmack: Der As-pekt der gezielten Konstruktion überwiegt das möglicherweise erforderliche Minimum an präexistierender kollektiver Gemeinsamkeit, um nicht künst-lich zu wirken und steril zu bleiben. Denn ein Erfordernis für das Gelingen scheint die Glaubwürdigkeit des historischen Narrativs zu sein, um die sich jene Deutungseliten, die die klassischen Akteure nationaler Geschichtspoli-tik sind (König 2008: 394ff.; Münkler 2009), bemühen müssen, um nicht
2 Vgl. zum Aspekt der Massenkommunikation und den technischen Voraussetzungen der Nationenbildung Anderson (2006 [1983]).
18 Eva Marlene Hausteiner
allzu artifizielle und in der Folge wenig tragfähige Gemeinschaftskonstituti-onen zu verfechten.
Die Gefahr einer übermäßig evidenten Konstruiertheit steht dabei auch in Zusammenhang mit den Grundzügen, Strategien und verbreiteten Topoi nationaler Geschichtsreferentialisierung. Zentral ist nämlich die Idee der Vergemeinschaftung, also die Schaffung einer substantiell integrierten, hin-sichtlich bestimmter Merkmale auch homogenen Gemeinschaft. Zu diesem Ziel wird häufig eine gemeinsame, historisch verortbare Herkunft, oft im durchaus genealogischen Sinne, betont.3 Gründungsmythen sind historische Kondensationen dieser Idee genealogischer Herkunft in einem immer wie-der erzählten Schlüsselereignis – für deutsche Einigungsbestrebungen durch das ganze 19. Jahrhundert hindurch ist sicherlich der Kampf des Cheruskers Arminius ein solcher nationaler politischer Mythos, in dem sich die Behaup-tung von Herkunft mit dem Nachweis eines begründenden politischen Prin-zips vereint, nämlich des Widerstands gegen Rom (Münkler 2009: 165–180).
Der Verweis auf eine so oder auch anders aussehende Vergangenheit, die jedenfalls den Mitgliedern der Nation ein gemeinsames Ursprungs-, Her-kunfts- und Entwicklungsnarrativ bietet und je nach Reichweite und Dauer-haftigkeit als politischer Mythos gelten darf (ebd.), ist eine von mehreren Varianten der Herstellung einer stabilen Basis nationaler Gemeinschaft: »Als Minimalkonsens darf […] gelten, daß die Konstruktion nationaler Identität als Versuch zu begreifen ist, kollektive Identität auf der Basis einer Kombina-tion von primordialen (historischen, territorialen, sprachlichen, ethnischen) Faktoren bzw. Symbolen und politischen Grenzen herzustellen«, wie Eisen-stadt zusammenfasst (1991: 21). Geschichtsevokation ist neben Religion, Sprache, Ethnie oder Territorium nur ein Instrument des ethnischen Natio-nalismus, der, wie in den jüngeren Debatten mit Blick auf die wechselhaften Entwicklungen der Staaten des postsowjetischen Raumes deutlich wurde, ein voraussetzungs- und nebenwirkungsreiches Unterfangen ist. Trägt man die mittlerweile klassische Unterscheidung zwischen ethnic und civic natio-nalism mit (vgl. Smith 2000),4 so muss man allerdings feststellen, dass sogar nicht-essentialistische Varianten der Nationenkonstruktion ohne die Bemü-hung von Herkunftsnarrativen, die eine lineare Verbindung zur zu legitimie-
3 Die Erfindung des keltischen Dichters Ossian durch den schottischen Politiker und Autor James McPherson in den 1760ern etwa löste eine emphatische Behauptung schottischer und insgesamt gälischer Ursprünge in der Spätantike aus.
4 Diese neuere Unterscheidung ist nur teilweise kompatibel mit der älteren Unterscheidung zwischen Staats- und Kulturnation.
Selbstvergleich und Selbstbehauptung 19
renden Gegenwart postulieren, kaum auskommen.5 Die Behauptung einer gemeinsamen Herkunft, eines gemeinsamen Ursprungs oder einer gemein-samen Vergangenheit ist für größere Gemeinschaftsbildungen ein wieder-kehrendes Muster.
II
Wenn der locus classicus von kollektivem Gedächtnis und politisch wirksa-men Geschichtsreferentialisierungen der (National-)Staat westfälischer Prä-gung ist, dessen Niedergang seit geraumer Zeit angekündigt und diagnosti-ziert wird, so bedeutet dies nicht, dass andere Staatsformen auf ein legitimatorisches oder selbstreflexives Verhältnis zur Vergangenheit verzich-ten können. Insbesondere imperiale Diskurse haben einen engeren Ge-schichtsbezug als ihre häufig exzeptionalistische Rhetorik es vermuten ließe. Der Verweis auf und die Konstruktion von historischen Narrativen spielt in Belangen der Stabilisierung durch Legitimation eine signifikante Rolle für Imperien6 – wenn auch in anderer Weise als in nationalstaatlichen Gebilden und eng integrierten politischen Gemeinschaften.
Für diese These ist die Annahme von grundlegender Bedeutung, dass es sich beim Imperium um eine spezifische Form politischer Ordnung handelt. Imperien unterscheiden sich strukturell – so die zentrale Prämisse der Impe-rientheorien des vergangenen Jahrzehnts – vom institutionalisierten Flä-chenstaat, obgleich historisch meist, und gerade seit dem 19. Jahrhundert, eine enge Verknüpfung beider vorliegt (vgl. Leonhard/von Hirschhausen 2009 sowie der Beitrag von Jörn Leonhard in diesem Band). Imperien ruhen fundamental auf dem Gegensatz und Zusammenhang von Zentrum und Peripherie, zwischen denen ein strukturelles Herrschaftsgefälle besteht; dies hat ausfransende, verschwimmende und halbdurchlässige Grenzen zur Fol-ge. Imperien sind großräumig und äußerst heterogen in ihrer Bevölkerungs-struktur, was bei langfristig bestehenden Imperien seitens der einflussreichen
5 Zu denken ist hier einerseits an die anhaltenden Bezüge auf den amerikanischen Unab-hängigkeitskampf im kollektiven Gedächtnis der USA, die auch von Hannah Arendt in dieser Weise affirmiert werden (Arendt 1963). Zum anderen beruht sogar die anti-essentia-listische Idee des Verfassungspatriotismus auf der Vorstellung, dass die nationale Vergan-genheit im modernen Verfassungsstaat erheblichen Einfluss auf das kollektive Zugehörig-keitsgefühl der Bürger hat und haben muss (vgl. Müller 2010).
6 Vgl. auch den Beitrag von Herfried Münkler in diesem Band.
20 Eva Marlene Hausteiner
Imperialeliten im Zentrum wie in der Peripherie ein elaboriertes Differenz-management und differenzierte Herrschaftstechniken impliziert.7
Der Kolonialtheoretiker Frederick Cooper spricht in solchen Konstellati-onen von der Notwendigkeit des »thinking like an empire« (2005: 154) – also vom Erfordernis für einflussreiche Akteure, jene imperiale Raison in der politischen Praxis zu beachten, die zur Stabilisierung und Aufdauerstellung der eigenen Ordnung eben anderes beinhaltet als nationale Staatsraison (Münkler 2005). »Thinking like an empire« beinhaltet, über die Handlungs-logik hinaus, ganz entscheidend auch die Logik imperialer Selbstreflexion und Legitimation, also das Nachdenken über Wesen und Rolle des eigenen Imperiums, über dessen Herkunft, Rechtfertigung und Zukunftsaussich-ten.8 Nicht nur imperiale Politik und Herrschaftspraxis, sondern auch impe-riale Selbstreflexion folgt spezifischen Mustern und Deutungsvarianten. Die-se strukturellen Besonderheiten elitärer Debatten in Imperien hängen zwar nicht von der Selbsttitulierung als »Imperium« oder »Reich« ab, durchaus aber vom reflexiven Schritt der betreffenden Eliten, die eigene Rolle als Welt-macht wie auch die inneren Strukturen der Herrschaftsordnung evaluieren zu wollen. Die Spezifik imperialer Elitendebatten umfasst auch die Strategi-en imperialer Geschichtsbezüge, Deutungen und Appropriationen histori-scher Ereignisse und historischen Wissens.
Die Notwendigkeit und Spezifik der Muster historischer Imagination in Imperien ergibt sich daraus, dass imperiale Gebilde nicht allein aufgrund ihres Unterdrückungs- und Aggressionspotentials unter hohem Legitima-tions- und Selbsterklärungsdruck stehen. Imperiale Ordnungen sind in be-sonderem Maße künstlich formierte Gebilde, die tendenziell keinen An-spruch auf Naturalität erheben und daher in noch höherem Maße als die imagined community der Nation von Legitimationsnarrativen abhängig sind; diese richten sich dann freilich nicht an die Gesamtbevölkerung des Imperi-ums, sondern an die Bevölkerung des imperialen Kerns, oft aber auch ledig-lich an die leitenden Eliten. In diesen Narrativen spielt geschichtlicher Rück-griff eine zentrale Rolle; der Historiker Sheldon Pollock schreibt: »It is only by looking at past empires that people have learned how to be imperial at all,
7 Vgl. exemplarisch aus der mittlerweile (gerade im angloamerikanischen Raum) fest etab-lierten imperientheoretischen Literatur: Münkler (2005), Osterhammel (2009), Burbank/Cooper (2010).
8 Ann Stoler betont die Bedeutung imperialer Imagination ebenfalls: »Colonial empires were always dependent on social imaginaries, blueprints unrealized, borders never drawn, administrative categories of people and territories to which no one was sure who or what should belong« (2006: 52).
Selbstvergleich und Selbstbehauptung 21
since empire is a cultural practice and not some kind of natural state« (Pol-lock 2006: 176; vgl. auch Pitts 2010: 226). Die elitär-diskursive Konstruktion einer imperialen Mission ist aufgrund der Künstlichkeit der Herrschafts-struktur zentral für Imperien, mindestens in dem Maße, in dem Identitäts-konstruktion für Nationen zentral ist (Pollock 2006; Pitts 2010).
Die zunächst vielleicht bekannteste, wenn auch auf den ersten Blick nur für mittelalterliche und frühneuzeitliche Imperien relevante Form imperialer Geschichtsappropriation ist jene der translatio imperii (Thomas 1999; vgl. auch Pocock 2003: 127 et passim; Wendehorst 2009: 878). Darin wird die Imperialität als materiell weitergegeben gedacht, das eine Imperium also als ontologisch gleich mit dem vorherigen gedeutet – wobei die Behauptung materiell-genealogischer Kontinuität zumeist von einer eschatologischen Heilsbotschaft begleitet wird: Die translatio imperii ist eine Konzeption der Weltgeschichte als Abfolge von Weltreichen, die auf dem Vier-Reiche-Sche-ma des alttestamentarischen Buchs Daniel beruht. Das vierte der betreffen-den Reiche als katechón verhindere demnach das Kommen des Antichristen. Dieser Aufhalter des Antichrist wird mit Rom identifiziert, aber in der Deu-tung der translatio imperii auf das jeweilige nach-antike Reich übertragen – letzteres sei nicht wie Rom, nicht Roms Nachahmer und Nachfolger, son-dern es gilt als welthistorische Verlängerung des Imperium Romanum und identifiziert sich legitimationsstrategisch im ontologischen Sinne damit: Rom ist nicht untergegangen. Die kaiserliche Gewalt wird gedeutet als trans-feriert auf Byzanz, auf das Frankenreich etc. Dahinter steht eine streng line-are Geschichtsauffassung, bei oft sogar genealogischer Ausdeutung der onto-logischen Identität. Die zentrale Funktion der translatio imperii ist die Legitimation in Form des Exzeptionalismusnachweises imperialer Herr-schaft.9
Dieses Deutungsmuster ist jedoch zumeist in hohem Maße vom christ-lich-eschatologischen Selbstbild der Imperien abhängig; mit Säkularisie-rungstendenzen in den Nationalstaaten, die Kern der modernen Imperien sind,10 scheint die klassische translatio imperii als Legitimationsnarrativ hin-fällig oder zumindest schwieriger anwendbar zu werden – allerdings ohne, dass einige ihrer Grundzüge aus den Legitimationsdiskursen der imperialen Eliten ganz verschwänden. Die Lehre von der identitären Fortsetzung von
9 Vgl. die schon relativ späte Anwendung dieses Motivs im Großfürstentum Moskau als »drittes Rom« (Kozyrev 2011).
10 Als klassische Beispiele gelten Großbritannien, Frankreich und die USA, im Gegensatz zu Russland oder Byzanz (vgl. für Russland Hosking 1997).
22 Eva Marlene Hausteiner
Imperialität wird abgelöst von einer säkularisierten, aber auch systematische-ren Form der Geschichtsreferentialisierung, die eng mit der Beschaffenheit des Selbstverständnisses imperialer Eliten verknüpft ist. Durch selektive ins-trumentelle Appropriation imperialer historischer Narrative verfolgen Eli-ten, zumal in neuzeitlichen und modernen Imperien, zweierlei Ziele: Einer-seits die direkte Rechtfertigung imperialer Herrschaft (Stoler 2006), andererseits aber auch deren Optimierung oder Effizienzsteigerung durch den Versuch des Lernens aus der Geschichte anderer Imperien, also durch ergebnisorientierte Vergleichsbildung und Imitation (Pollock 2006).11 Vier Spezifika zeichnen diese geschichtsbasierte Legitimationsstrategie aus:
1) Ein Charakteristikum der instrumentellen Appropriation ist die zent-rale Stellung des Selbstvergleichs und der Analogisierung anstelle von ontolo-gischer Identifikation: Imperien vergleichen sich mit vergangenen Reichsbil-dungen, ohne aber eine Identität oder Herkunft zu postulieren.12 Her- kunftsbehauptungen fixieren identitäre Entwürfe, während Imperien nicht an Identitätsfestlegung interessiert sind, sondern ihre politische Herrschaft und Entwicklung untermauern wollen. Das Imperium ist nicht denkbar als prädeterminierte oder festlegbare Gemeinschaft und steht nicht unter dem Imperativ der Vergemeinschaftung; vielmehr ist es definiert über sein sich prozessual ausbreitendes Kerngebiet sowie über seinen Charakter als »poly-ethnisch, multikulturell und zentrifugal« – eine imperiale »Gesamtgesell-schaft« oder gar -gemeinschaft existiert nicht (Osterhammel 2009: 610, 612). Für imperiale Ordnungen als künstliche Produkte der Expansion, und nicht der Vereinigung, wäre eine Identitätsfestlegung über die Definition einer im-perialen Mission oder Aufgabe hinaus potentiell kontraproduktiv. Integrati-onsversuche einer fixen Bevölkerung oder eines begrenzten Territoriums sind weniger attraktiv als die (Selbst-)Definition über eine dynamische Mission sowie Wohlstands- und Friedensversprechen, deren Adressatenkreis sukzessi-ve ausweitbar und der jeweiligen Entwicklungsphase anpassbar ist. Der Ver-gleich des imperialen Gebildes mit anderen Imperien dagegen ist hier eine besonders erfolgversprechende Legitimationsstrategie, da so die strukturel-len Dynamiken der Eroberung, des Differenzmanagements etc. gleichsam durch Policy-Vergleiche in den Vordergrund treten können. Es wird keine
11 Auch der Anspruch der eigenen Lernfähigkeit auf historischer Grundlage kann als legiti-matorisches Argument gebraucht werden; hier ist primär der Versuch des Lernens im In-teresse einer – als solche wahrgenommenen – Optimierung der eigenen Politik und Herr-schaft gemeint.
12 Stephan Wendehorst konkludiert: »Im Unterschied zu Nationen kennen Imperien kein uniformes nationales Gedächtnis […]« (2009, S. 884).
Selbstvergleich und Selbstbehauptung 23
Gemeinschaft durch Kontinuitätspostulate integriert, sondern strukturbil-dende Politiken werden dem legitimierenden Vergleich unterzogen.
2) Wenn geschichtsbezogene Rückgriffe weniger auf Herkunftsbestim-mungen als auf den imperial-imitierenden Selbstvergleich abzielen, so wirft dies die Frage nach geeigneten Vergleichsgrößen und somit der Vergleichbar-keit auf. Im Kern des imperialen Selbstverständnisses liegt ein nachdrückli-cher Exzeptionalismus, der insbesondere einen synchronen Vergleich mit gleichzeitigen oder gar mit kleineren Mächten unattraktiv macht. Die Histo-rikerin Ann Stoler beschreibt diesen Exzeptionalismus, indem sie für die Ko-lonialismusforschung fordert: »ask not only what is new […], but why ›new-ness‹ is always a part of imperial narratives«. Imperiale Formationen gerierten sich mit Vorliebe als »states of exception«, im doppelten Wortsinne. Exzepti-onalistische Argumente sind fundamentale Bestandteile des imperialen Re-pertoires (Stoler 2006: 54ff.). Edward Said präzisiert die Elemente dieser Auffassung, wenn er schreibt: »Every single empire in its official discourse has said that it is not like all the others, that its circumstances are special, that it has a mission to enlighten, civilize, bring order and democracy, and that it uses force only as a last resort« (zit. nach ebd: 57). Ein Vergleich mit konkur-rierenden Großmächten ist in dieser weltpolitischen Konzeption wenig at-traktiv.13 Die Suche nach Vergleichsgrößen verlagert sich für sich als »unver-gleichlich« verstehende Imperien stattdessen in die Weltgeschichte: Durch den Vergleich mit vergangenen Imperien bleibt der Exzeptionalismusan-spruch weitgehend gewahrt, während gleichzeitig auf den Glanz welthistori-scher Mission als Legitimationsressource sowie auf politische Implikationen offen zurückgegriffen werden kann.
3) Die Funktionalität der Geschichtsreferentialisierung durch einen Selbstvergleich mit Imperien der Vergangenheit ist ebenfalls spezifisch und unterscheidet sich von den Rekonstruktionsversuchen einer »eigenen« Ge-schichte wie im nationalstaatlichen Fall: Neben dem Versuch der Legitimie-rung des imperialen bzw. imperialistischen Politikstils durch direkte Verwei-se auf Glanz und Größe vergangener Imperien steht vor allem der Versuch der Herrschaftssicherung und Effizienzsteigerung durch die Evaluierung und Appropriierung bestimmter Herrschaftsstrategien wie etwa infrastruktureller Politik, ökonomischer Regime oder Nationalitätenpolitik im Mittelpunkt imperialer historischer Imagination. Die Implikationen dieses – tatsächli-
13 Insofern ist die von Sönke Neitzel (2000) dargestellte Weltreichslehre in Debatten des 19. Jahrhundert, die auf dem Modell weniger konkurrierender Mächte beruht, nicht mit im strengen Sinne imperialen Ansprüchen vereinbar.
24 Eva Marlene Hausteiner
chen oder vorgeblichen – Versuchs imperialer Eliten, aus historischen Präze-denzen politisch zu lernen, sind weitreichend: »The empire form was conti-nuously re-created through historical imitation, a process that seems to have run along two axes: vertically in time (through historical memory), and his-torically across space« – in der Geschichte von Imperien sei, so Pollock, ein politischer Imitationsprozess beobachtbar, der regelrecht in »[i]nstitutionel-len Isomorphismus« münde (Pollock 2006: 178f.).14 Imperien übernehmen voneinander erfolgreiche Herrschaftspraxen, auch über Epochengrenzen hinweg. Pollock geht also wie Jane Burbank und Frederick Cooper jüngst mit ihrer Rede von tradierten imperialen Machtrepertoires (Burbank/Cooper 2010: 3ff.) so weit, die institutionellen Folgen der »actual convergence in the development of the empire form across time and space because of the imita-tive dynamic of empire building« (Pollock 2006: 179) zu identifizieren. Der Wille zum Lernen aus historischen Analogien bei imperialen Eliten habe, so schlussfolgern diese Autoren, tatsächlich politische Konsequenzen von gro-ßer Tragweite und führe zu einer transhistorischen Konvergenz imperialer Politikstile.
Insbesondere aber für den Versuch historischen Lernens ist als geschichts-philosophische Grundannahme der Glaube an die Möglichkeit historischen Fortschritts von entscheidender Bedeutung. Wenn Peter J. Bowler in The Invention of Progress (1989) zeigt, dass die gesamte viktorianische Debatten- und Wissenschaftslandschaft durchzogen ist vom Motiv eines gleichsam spiral-förmigen Fortschrittsprozesses, in dem zyklische und lineare Geschichtsmo-delle kombiniert werden, so gilt dies im Besonderen für die Argumentationen imperialer Eliten. In ihrer Rhetorik manifestiert sich dieses Modell in der Figur der Überbietung der Vergleichsgröße vor dem Hintergrund der zykli-schen Imperientradition eines rise, decline and fall: Das gegenwärtige Impe-rium ist stets besser, zivilisierter, technisch versierter, stabiler etc. als andere Imperien der Weltgeschichte; die USA sind humaner als das British Empire, die Briten moralischer als die Römer, die Russen zivilisierter als die Mongo-len usw. – eine welthistorische Aufgabe verbinde aber gegenwärtige und ver-gangene Imperialität, trotz aller Unterschiedlichkeit.
4) Wie bereits mehrfach angedeutet, sind die maßgeblichen Akteure im-perialer Politik und Selbstreflexion imperiale Eliten. Zwar sind auch in Na-tionalstaaten vornehmlich Deutungseliten an der Konstruktion nationaler Geschichtsbilder und Identitäten beteiligt, doch imperiale Herrschaft ist
14 Die Begrifflichkeit des institutionellen Isomorphismus stammt aus der Theorieströmung des Neoinstitutionalismus.
Selbstvergleich und Selbstbehauptung 25
insgesamt hierarchischer und elitenzentrierter orientiert. Der Fokus auf das von Robinson und Gallagher so titulierte »official mind« (1961: 19 et pas-sim), also auf Amtsträger des Zentrums, vernachlässigt zwar die entscheiden-de Rolle kooptierter Lokaleliten und intermediaries (Burbank/Cooper 2010: 13f.), trägt aber der eklatanten Ungleichheit der Machtverhältnisse gerade in Imperien Rechnung.
Besonders in der Frage der Legitimationsstrategien erweist sich der As-pekt der Elitenzentrierung als bedeutsam: Imperien sind, wie bereits gesagt, unscharf begrenzte Ordnungen, in denen eben keine kollektive Integration möglich ist,15 sondern lediglich Elitenintegration;16 wodurch auch die Legi-timationsstrategien von Eliten einerseits in hohem Maße selbstreflexiv wer-den – sie sind also hauptsächlich von Eliten für Eliten entworfen –, auf der anderen Seite sich aber als politisch durchaus relevant darstellen, da Eliten die imperiale Politik entscheidend gestalten und ihren Kurs vorgeben. Das bedeutet, dass historische Referentialisierungen zu einem gewissen Grade elitäre Autosuggestionen bleiben, was ihren Aufbau, Inhalt und ihre eliten-spezifischen Codes beträchtlich prägt (Tietze Larson 1999). Paradoxerweise sind also diese Autosuggestionen als zentrale Deutungsmuster eines immens einflussreichen Herrschaftszirkels keineswegs folgenlos.
III
Im spätviktorianischen und edwardianischen Großbritannien nun greifen imperiale Eliten häufig auf diese Form spezifisch imperialer Geschichtsrefe-rentialisierung zurück. Insbesondere imperialistische Autoren, ehemalige Kolonialadministratoren und Politiker, aber auch an der Debatte beteiligte Imperiumskritiker bemühen mit besonderer Vorliebe Vergleiche mit dem Imperium Romanum.17 Das British Empire erweist sich aus mehreren
15 Osterhammel spricht treffend von einer »Zwangsintegration von oben statt Konsensinte-gration von unten« (2004: 397).
16 Osterhammel definiert diese »Elitensolidarität« als einen Modus, der »über die subordi-nierte Inkorporation einheimischer Eliten in den imperialen Apparat, wenn auch manch-mal nur symbolisch,« funktioniere (2009: 559).
17 Zur Untermauerung von Positionen, die den imperialen Alleinherrschaftsstatus des Em-pire bereits im Lichte der ansteigenden internationalen Rivalität verabschieden und eine Koexistenz mehrerer konkurrierender Großmächte anerkennen, werden dagegen auch synchrone Vergleiche mit anderen Mächten herangezogen (vgl. Neitzel 2000; Gollwitzer
26 Eva Marlene Hausteiner
Gründen als exemplarischer Fall: Erstens ist der imperiale Legitimations-druck zum Ausgang des 19. Jahrhunderts hoch, da die deklarierte Zivilisie-rungsmission in offensichtlichem Widerspruch zum wachsenden kolonialen Widerstand und zur zunehmend expandierenden und formalisierten Herr-schaft in der Peripherie steht. Zweitens ist aus diesem Grund der Legitimati-onsdiskurs in Großbritannien besonders elaboriert und verhandelt eine Rei-he von Argumenten und Motiven über einen längeren Zeitraum hinweg (z.B. Thornton 1985 [1959]). Drittens sind die entscheidenden imperialen Eliten im British Empire in besonderem Maße integriert: Trotz der Expansi-on von Massenmedien und den zwischenzeitlichen Versuchen, auch die brei-tere Bevölkerung für imperiale Themen zu aktivieren,18 bleibt die Debatte über die imperiale Politik und ihre Rechtfertigungs- und Optimierungsbe-dingungen auch an der Schwelle zum 20. Jahrhundert weitgehend die Ange-legenheit einer integrierten Herrschafts- und Deutungselite (Robinson/Gal-lagher 1961: 19ff.).
Drei Positionen aus dem breiteren Elitendiskurs des imperialen Selbst-vergleichs, der ungefähr zwischen 1870 und dem Beginn des Ersten Welt-kriegs zu verorten ist (vgl. Vasunia 2005; Parchami 2009; Bradley 2010; Hausteiner 2010), sollen die historische Imagination im British Empire ex-emplifizieren.
Der Kolonialadministrator Charles Prestwood Lucas veröffentlicht 1912 die Vergleichsstudie Greater Rome and Greater Britain. Lucas, der seine hoch-rangige Position im Colonial Office im Jahr 1911 aufgibt, um sich der Propa-gierung einer engeren Einigung des Empire zu widmen, bemüht sich darin um einen systematischen Vergleich des eigenen Imperiums mit dem Imperium Romanum, stets mit einer Betonung der Distanz zum historischen Objekt: Das römische Reich insbesondere der Kaiserzeit wird in keine Herkunftslinie zum British Empire gestellt, sondern als instruktiver welthistorischer Ver-gleich präsentiert. Verschiedene Funktionsbereiche und Charakteristika der beiden Imperien, von Raumordnung über Rassenverhältnisse bis hin zu Fra-
1982; Friedberg 1988). John Robert Seeleys kanonisches Buch The Expansion of England (1895 [1883]) vereint beide Betrachtungsweisen in sich, wenngleich geographisch segmen-tiert: In der Beschreibung der europäischen und atlantischen Machtverhältnisse rekurriert Seeley auf Vergleiche insbesondere mit Russland und Deutschland; in der Diskussion des »Indian Empire«, in dem die Stellung der Briten eine unangefochten imperiale ist, ver-weist er dagegen konsequent auf das Imperium Romanum (insbes. ebd.: 207 et passim).
18 Zu den einschlägigen Vertretern dieser seit geraumer Zeit andauernden Debatte über die zweifelhafte Breitenwirkung des Imperialismus zählen David Cannadine und Bernard Porter.
Selbstvergleich und Selbstbehauptung 27
gen der Infrastruktur, werden in einer Bestandsaufnahme von Gemeinsam-keiten und Schlussfolgerungen parallel geführt. Charles Lucas wählt als Deutungsmuster für die gegenwärtige Imperialpolitik Britanniens die Ana-logie statt der direkten Anverwandlung; er formuliert Versuche, etwa aus der römischen Infrastrukturpolitik in den Bereichen von Transport und Wasser-wirtschaft, aber auch aus dem römischen Umgang mit sprachlicher und reli-giöser Diversität Lehren zu ziehen (Lucas 1912: insbes. Kap. IV, V, VII). Dabei verortet er das British Empire in der römischen Tradition imperialer Herrschaft und Zivilisierung – einer Tradition von Völkern mit der »innate capacity for ruling« (ebd.: 154) –, geht aber mit einem technokratisch-analy-tischen Gestus vor, dessen Erkenntnisinteresse die institutionellen und poli-tischen Bestandsbedingungen des Empire betreffen.
Evelyn Baring, Earl of Cromer und ehemaliger Generalkonsul von Ägyp-ten, legt 1910 das Buch Ancient and Modern Imperialism vor, das eine ganz ähnlich systematische Vergleichsstudie für ein explizit akademisch-elitäres Publikum der Classics Association bietet, die wenig später auch für ein breite-res Publikum verlegt wird. Hier lässt sich das Ineinandergreifen von (vorgeb-lich) genuiner Lernabsicht und Legitimationsinteresse beobachten: Cromer evaluiert, auf einen historisch-instruktiven »value of repitition« verweisend (Baring 1910: 3), administrative, militärische und wirtschaftliche Praktiken der Römer auf ihre moderne Anwendbarkeit, wenn er etwa die Verwaltungs-reformen unter Augustus mit den Modernisierungsversuchen Englands im Indian Civil Service vergleicht (ebd.: 51 et passim). Andererseits betont er wiederholt, dass die Leistungen Britanniens unter erschwerten Bedingungen nicht hoch genug gelobt werden könnten, und rechtfertigt damit den Status quo des imperialen Politikstils: »The comparative success of the Romans is easily explained. Their task was far more easy than that of any modern Impe-rial nation« (ebd.: 91). Cromers Schrift veranschaulicht, dass der Selbstver-gleich mit einem Imperium der Vergangenheit nicht notwendigerweise des-sen Affirmation einschließt:19 Auch er vertritt die These des Fortschritts innerhalb einer weltgeschichtlichen Tradition zivilisierender Imperien und betont die Überlegenheit des British Empire in dieser imperialen Sukzession. Nicht nur sei das Empire in der Moderne mit deutlich größeren Herausfor-derungen konfrontiert als die Imperien der Antike; zweitens und vor allem
19 Hierin ist Duncan Bell (2007) zu widersprechen, der die explizite Ablehnung des römi-schen Modells etwa durch die Imperial Federalists als Zeichen für den Bedeutungsverlust Roms wertet: Auch ablehnende Diskussionen des römischen Modells erweisen eine evalu-ative Bindung (vgl. Hausteiner 2010).
28 Eva Marlene Hausteiner
aber schlägt sich sogar der Technokrat Cromer, der wie in seiner Rechen-schaft über die Herrschaft in Ägypten offen die Ziele von Effizienz und »good government« vor jenen der Liberalität und Zivilisierung verteidigte (ebd.: 70, 111), auf die Seite jener, die das British Empire als aufgeklärtes, humanitär engagiertes Imperium – kontrastiert mit einem tendenziell amo-ralischen Rom (ebd.: 57) – glorifizieren. Aus dieser Perspektive präsentiert Cromer Rom in einer anachronistischen Wendung als Nachfolger des briti-schen Ideals: Nur »a few faint traces of the modern spirit of humanitaria-nism« (ebd.: 108) seien in Rom noch zu finden.
Hierin schließt sich ihm Howard Booth in seiner kürzeren Schrift The Meaning of British Imperialism aus dem Jahr 1913 an. Er lehnt insbesondere die synchrone Vergleichbarkeit des British Empire mit den USA und Russ-land, trotz deren offenkundigem Großmächtestatus, ab: Nur mit Rom ver-binde das Empire eine weltgeschichtliche Aufgabe, wobei Britannia leisten solle, »what Rome could not – combine Liberty with Empire« (Booth 1913: 940). Dies gelinge Britannien – und hierin schließt sich Booth den Motiven bei Lucas und Cromer an – insbesondere dank technologischer Errungen-schaften, die die Welt näher zusammenrücken ließen und insbesondere die engere Integration des Empire ermöglichen (ebd.: 939).
Die drei Autoren sind sich somit in den Grundzügen ihrer Analyse und ihres Umgangs mit dem historischen Modell römischer Imperialität einig: Im distanzierten Selbstvergleich, den sie in seiner Nützlichkeit explizit dem synchronen Vergleich mit anderen Großmächten wie Russland oder den USA vorziehen, liegt die Annahme einer weltgeschichtlichen Tradition und Ähnlichkeit herausragender Imperien – potenziell mit welthistorischer Mis-sion – sowie die Überzeugung historischer Lernpotentiale, die zuvorderst im Bereich der Organisation, Administration und Infrastruktur angesiedelt sind. Eine moralische Modellhaftigkeit Roms wird dagegen, im Sinne der Ideologie des zivilisierten und zivilisierenden Großbritanniens (vgl. Stuchtey in diesem Band), abgelehnt. Dieses Argument bildet neben anderen die Basis für die exzeptionalistische Behauptung einer nicht nur weltpolitischen, son-dern welthistorischen Überlegenheit und Fortschrittlichkeit britischer Impe-rialität.
Diese Form imperialer Geschichtsreferentialisierung ist jedoch auch in der britischen Debatte an die Identifikation Britanniens als imperiale Welt-macht seitens der Autoren gebunden. Eine Orientierung am imperialen Mo-dell nämlich steht im viktorianischen und edwardianischen Elitendiskurs nicht außer Konkurrenz: Insbesondere im Zeitalter der »imperialisierenden
Selbstvergleich und Selbstbehauptung 29
Nationen« und »nationalisierenden Imperien« (Leonhard/von Hirschhausen 2009: 13) werden selbst globale Herrschaftsverhältnisse von vielen Beobach-tern nach einem tendenziell nationalstaatlichen Modell konzipiert – mit sichtbaren Folgen für die gewählten Vorbilder und Selbstvergleiche. Wie Duncan Bell in seiner Überblicksstudie über die Imperial Federalists zeigt, wendet sich deren Fokus explizit vom Imperium Romanum oder anderen Imperien der Vergangenheit ab: »In a political culture obsessed with prece-dent and the moral value of history and tradition, many of the proponents of Greater Britain disavowed the rich intellectual resources of the ancient world, a world that for centuries had played a regulatory function in the imagining of empires« (Bell 2007: 207). Stattdessen wandert der Blick in die Gegenwart, und insbesondere über den Atlantik: Selbstvergleiche mit den Vereinigten Staaten, als nicht-imperialem Modell großräumiger Herrschaft, treten in den Vordergrund einer Argumentation, die auf ostentative Weise hierarchische Herrschaftsmodelle ablehnt. Im British Empire des 19. Jahr-hunderts konkurrieren also verschiedene Deutungsmuster, und zwar insbe-sondere nationale und imperiale Aspirationen; die Debatten um eine impe-riale Föderation können als Hybridbildung beider Modelle gedeutet werden. Gerade in Imperien, deren Kern ein Nationalstaat ist, und insbesondere im 19. Jahrhundert sind rein imperiale Deutungsmuster schwer aus dem histo-rischen Kontext zu isolieren und in idealtypischer »Reinform« betrachtbar. Zudem wird die Identifikation einer spezifisch imperialen Form der Ge-schichtsreferentialisierung dadurch erschwert, dass im England des späten 19. Jahrhunderts nicht nur die Imperialität, sondern das allgemeinere intel-lektuelle Klima die oben angedeutete, oftmals imperial gebrauchte Praxis des historischen Selbstvergleichs begünstigt – nämlich einerseits durch die soge-nannte »comparative method« (Collini 1983b),20 also jene Praxis des System-vergleichs, die in den Wissenschaften in den 1860ern und 1870ern vermehrt Zuspruch findet, sowie durch die häufigen Betonungen der Instruktivität und Nützlichkeit von Geschichte für die Gegenwart (Collini 1983a ).21 Der Nachweis einer eindeutigen Kausalität – ob die Imperialität also historische Vergleiche begünstigt habe oder die historisch-vergleichende Wissenschafts-
20 Collini zitiert einen Ausspruch Diceys aus dem Jahr 1885, der diesen Trend pointiert be-nennt: »It were far better, as things now stand, to be charged with heresy, than to fall under the suspicion of lacking historical-mindedness, or of questioning the universal validity of the historical method« (1983b: 214).
21 Ein Schlüsselautor für beide Tendenzen ist sicherlich wiederum John Robert Seeley.
30 Eva Marlene Hausteiner
kultur sich bis in die imperiale Debatte erstreckte – ist in diesem Zusam-menhang allerdings schwer zu leisten.
Festzuhalten bleibt jedoch, unabhängig von der Frage der Kausalität, dass sich im viktorianischen und edwardianischen imperialen Diskurs eine be-sonders elaborierte Diskussion über die Instruktivität des römisch-imperia-len Modells manifestiert. Auch für Elitendebatten in anderen imperialen Diskursen lassen sich ähnliche historische Imaginationstendenzen beobach-ten, etwa im bisweilen so bezeichneten American Empire: Insbesondere nach 9/11 mehren sich Forderungen amerikanischer Intellektueller, »lessons from empire« zu ziehen (Calhoun 2006; darin insbesondere der Beitrag von Geor-ge Steinmetz) – zu verschiedenen Zwecken, und wenn auch nur zur nach-drücklichen Absage an unilaterale Großmachtphantasien (vgl. Huhnholz in diesem Band). Vor allem in der Deutungselite, und weniger in der politi-schen Führungsetage, ist der Vergleich mit dem Imperium Romanum, aber auch mit anderen Imperien der Weltgeschichte seit 9/11 en vogue (gewesen), und zwar durchaus im Sinne des historischen Lernversuchs. Auch in diesen Positionen lässt sich eine weitgehend säkularisierte Version der translatio im-perii identifizieren – wenngleich eben durch Vergleichsbildung anstelle einer Identitätsbehauptung. Rom fungiert nicht als Herkunftsort oder Ursprungs-narrativ, sondern wird als recht divers konnotierte Vergleichsfolie herangezo-gen. Es dominieren strategische Vergleiche statt Herkunftserzählungen – wobei sich auch hier freilich wieder die enge Verwobenheit imperialer und nationaler Geschichtsbezüge erweist, denn natürlich werden in den USA, wenn es um die Belange der nation geht, Gründungsmythen sondergleichen herangezogen.
Weitere, systematische Vergleiche werden sicherlich erforderlich sein, um die Reichweite der These einer spezifisch imperialen Geschichtsreferentiali-sierung durch imperiale Eliten gänzlich zu bestimmen.22 Einstweilen aber spricht Vieles dafür, in der Analyse imperialer Diskurse nicht nur nach nati-onalstaatlichen Geschichtsappropriationen wie den für viele Kontexte mitt-lerweile gut erforschten Gründungsmythen Ausschau zu halten, sondern die analytische Grammatik zu erweitern – also auch den beschriebenen imperi-alen Modus der Legitimation durch historischen Rückgriff freizulegen.
22 Für einen entsprechenden Hinweis auf die imperiale Praxis des Fremdvergleichs im spani-schen Kolonialreich in Bezug auf das Inkareich, wiederum in häufiger Referenz auf Rom (MacCormack 2001), danke ich Stefanie Gänger, Universität Konstanz.
Selbstvergleich und Selbstbehauptung 31
Literatur
Anderson, Benedict (2006 [1983]), Imagined Communities. Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, London/New York.
Arendt, Hannah (1963), On Revolution, New York.Assmann, Aleida (2006), Der lange Schatten der Vergangenheit. Erinnerungskultur und
Geschichtspolitik, München.Baring, Evelyn, 1st Earl of Cromer (1910), Ancient and Modern Imperialism, London.Bell, Duncan (2007), The Idea of Greater Britain. Empire and the Future of World
Order, 1860–1900, Princeton/Oxford.Booth, Howard (1913), The Meaning of British Imperialism, United Empire. The
Royal Colonial Institute Journal, Jg. 4, H. 12, S. 939–947.Bowler, Peter J. (1989), The Invention of Progress. The Victorians and the Past, Oxford.Bradley, Mark (Hg.) (2010), Classics and Imperialism in the British Empire, Oxford.Burbank, Jane/Cooper, Frederick (2010), Empires in World History. Power and the
Politics of Difference, Princeton.Burrow, John (1981), A Liberal Descent. Victorian Historians and the English Past,
Cambridge.Calhoun, Craig/Cooper, Frederick/Moore, Kevin W. (Hg.) (2006), Lessons of Em-
pire. Imperial Histories and American Power, New York.Collini, Stefan/Winch, Donald/Burrow, John (1983a), All that glitters: political sci-
ence and the lessons of history, in: Dies. (Hg.), That Noble Science of Politics. A study in nineteenth-century intellectual history, Cambridge, S. 183–206.
– (1983b), The clue to the maze: the appeal of the Comparative Method, in: Dies. (Hg.), That Noble Science of Politics. A study in nineteenth-century intellectual his-tory, Cambridge, S. 207–246.
Cooper, Frederick (2005), Colonialism in Question. Theory, Knowledge, History, Ber-keley.
Eisenstadt, Shmuel N. (1991), Die Konstruktion nationaler Identitäten in verglei-chender Perspektive, in: Bernhard Giesen (Hg.): Nationale und kulturelle Identi-tät. Studien zur Entwicklung des kollektiven Bewusstseins in der Neuzeit, Frankfurt, S.21–38.
Friedberg, Aaron L. (1988), The Weary Titan. Britain and the Experience of Relative Decline 1895–1905, Princeton.
Gellner, Ernest (1983), Nations and Nationalism, Ithaca.Giesen, Bernhard (Hg.) (1991), Nationale und kulturelle Identität. Studien zur Ent-
wicklung des kollektiven Bewusstseins in der Neuzeit, Frankfurt.Gollwitzer, Heinz (1982), Geschichte des weltpolitischen Denkens, Bd. 2: Zeitalter des
Imperialismus und der Weltkriege, Göttingen.Hausteiner, Eva M. (2010), The Attraction of Rome in the Age of Empire: The Im-
perium Romanum as a Precedence for Imperial Britain, Mediterraneo Antico, Jg. XIII, H. 1–2, S. 31–48.
Hosking, Geoffrey (1997), Russia. People and Empire 1552–1917, Cambridge.
32 Eva Marlene Hausteiner
Huntington, Samuel P. (1991), The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century, London.
König, Helmut (2008), Politik und Gedächtnis, Göttingen.Kozyrev, Ilya (2011), Moskau – das dritte Rom. Eine politische Theorie mit ihren Aus-
wirkungen auf die Identität der Russen und die russische Politik, Göttingen.Leonhard, Jörn/von Hirschhausen, Ulrike (2009), Empires und Nationalstaaten im
19. Jahrhundert, Göttingen.Leibfried, Stephan/Zürn, Michael (Hg.) (2006), Transformation des Staates? Frank-
furt.Lucas, Charles P. (1912), Greater Rome and Greater Britain, Oxford.MacCormack, Sabine (2001), Cuzco, another Rome?, in: Susan E. Alcock/Terence
N. D’Alroy/Kathleen D. Morrison/Carla M. Sinopoli, Empires. Perspectives from Archeology and History, Cambridge, S. 419–435.
Mill, John S. (1975 [1861]), Three Essays. On Liberty/Representative Government/The Subjection of Women, Oxford.
Müller, Jan-Werner (2010), Verfassungspatriotismus, Berlin.Münkler, Herfried (2009), Die Deutschen und ihre Mythen, Berlin.– (2005), Imperien. Die Logik der Weltherrschaft – vom Alten Rom bis zu den Verei-
nigten Staaten, Berlin.Neitzel, Sönke (2000), Weltmacht oder Untergang. Die Weltreichslehre im Zeitalter des
Imperialismus, München/Paderborn.Nora, Pierre (Hg.) (1984–1992), Les Lieux de Mémoire, 3 Bd., Paris.Osterhammel, Jürgen (2009), Die Verwandlung der Welt. Eine Geschichte des 19. Jahr-
hunderts, München.– (2004), Symbolpolitik und imperiale Integration: Das britische Empire im 19.
und 20. Jahrhundert, in: Bernhard Giesen/Jürgen Osterhammel/Rudolf Schlögl (Hg.), Die Wirklichkeit der Symbole, Konstanz, S. 395–421.
Parchami, Ali (2009), Hegemonic Peace and Empire. The Pax Romana, Britannica, and Americana, Abingdon.
Pitts, Jennifer (2010), Political Theory of Empire and Imperialism, Annual Review of Political Science, Jg. 13, S. 211–235.
Pocock, John G. A. (2003), Barbarism and Religion, Bd. 3: The First Decline and Fall, Cambridge.
Pollock, Sheldon (2006), Empire and Imitation, in: Craig Calhoun/Frederick Cooper/Kevin W. Moore (Hg.), Lessons of Empire. Imperial Histories and Ameri-can Power, New York, S. 175–188.
Reinhard, Wolfgang (2007), Aufstieg und Niedergang des modernen Staates, Zeit-schrift für Staats- und Europawissenschaften, Jg. 5, H. 1, S. 8–24.
Robinson, Ronald/Gallagher, John (1961), Africa and the Victorians. The Climax of Imperialism in the Dark Continent, New York.
Seeley, John R. (1895 [1883]), The Expansion of England. Two Courses of Lectures, London.
Selbstvergleich und Selbstbehauptung 33
Stoler, Ann L. (2006), Imperial Formations and the Opacities of Rule, in: Craig Calhoun/Frederick Cooper/Kevin W. Moore (Hg.), Lessons of Empire. Imperial Histories and American Power, New York, S. 48.
Smith, Anthony D. (2000), The Nation in History. Historiographical Debates about Ethnicity and Nationalism, Hannover.
Stuchtey, Benedikt (2010), Die europäische Expansion und ihre Feinde. Kolonialismus-kritik vom 18. bis in das 20. Jahrhundert, München.
Thomas, Heinz (1999), Translatio Imperii, Lexikon des Mittelalters, Bd. 8, Stuttgart, S. 944–946.
Thornton, A. P. (1985 [1959]), The Imperial Idea and its Enemies. A Study in British Power, London.
Tietze Larson, Victoria (1999), Classics and the Acquisition and Validation of Power in Britain’s »Imperial Century« (1815–1914), International Journal of the Classical Tradition, Jg. 6, H. 2, S. 185–225.
Vasunia, Phiroze (2005), Greater Rome and Greater Britain, in: Barbara Goff (Hg.), Classics and Colonialism, London, S. 38–64.
Weber, Max (1980 [1921]), Wirtschaft und Gesellschaft. Grundriss der verstehenden Soziologie, Tübingen.
Wendehorst, Stephan (2009), Reich, in: Friedrich Jaeger (Hg.), Enzyklopädie der Neuzeit, Bd. 10, Stuttgart/Weimar, S. 873–888.