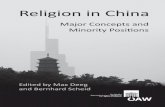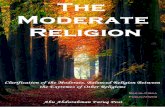2010 - Zwischen Rationalismus und Ritualismus: Zur Entstehung des Diskurses "Religion" bei Varro
Politik, Religion und Jahrmärkte: Zur Rolle der Volksversammlungen im eisenzeitlichen und...
Transcript of Politik, Religion und Jahrmärkte: Zur Rolle der Volksversammlungen im eisenzeitlichen und...
71
Politik, Religion und Jahrmärkte: zur Rolle der Volksversamm-lungen im eisenzeitlichen und frühmittelalterlichen Europa
Manuel A. Fernández-Götz
Zusammenfassung
Volks- und Ratsversammlungen bildeten einen wesentlichen Bestandteil der sogenannten „keltischen“ und „ger-manischen“ Gesellschaften. Sie fanden auf unterschiedlichen Niveaus statt, von der Ebene der lokalen Gruppen bis hin zu ganzen Königreichen oder sogar supraethnischen Bündnissen. Durch ihre Abhaltung wurden vielfältige Aspekte des gemeinschaftlichen Zusammenlebens der Gemeinschaften organisiert, z. B. Rechtsspruch, Regelung der Zugangsrechte zu Land und Produktionsmitteln, Entscheidung über Krieg und Frieden, etc. Ausgehend von einer Zusammenfassung der vorhandenen Informationen über das späteisenzeitliche Gallien wird diese Thematik im vorliegenden Aufsatz auch anhand der viel ausgiebigeren Überlieferungen aus dem alten Irland (óenach) und dem skandinavischen Raum (Thing) erläutert. Neben der allgemeinen Zusammenstellung wird auch auf spezifische Fragestellungen wie die oftmals beobachtete Verbindung zwischen Gräbern und Versammlungsplätzen eingegan-gen.
Abstract
Public assemblies and council meetings were an important element of so-called ‘Celtic’ and ‘Germanic’ societies. They took place at a number of levels, from that of local groups to entire kingdoms or even supra-ethnic alliances. They were held in order to organise a variety of aspects of the collective life of the communities, for example judge-ments, regulation of access to land and means of production, decisions about war and peace, etc. Starting with a summary of the available information on Late Iron Age Gaul, in this article the topic is also discussed on the basis of the much more abundant sources from Ancient Ireland (óenach) and Scandinavia (thing). As well as a general survey, specific questions are also addressed, such as the relationship which is often to be observed between burials and assembly places.
R. Karl, J. Leskovar [Hrsg.] (2013), Interpretierte Eisenzeiten. Fallstudien, Methoden, Theorie. Tagungsbeiträge der 5. Linzer Gespräche zur interpretativen Eisenzeitarchäologie. Studien zur Kulturgeschichte von Oberösterreich, Folge 37, Linz, 71–82.
72
Die Volksversammlung als Grundstein des poli-tischen Lebens
„Die Institution der Volksversammlung ist im Bereich von Stammesgesellschaften und sonstigen archaischen politischen Einheiten so weithin verbreitet, dass die Frage interessanter wäre, wo und unter welchen Be-dingungen sie gefehlt hat.“ (Wenskus 1984: 444).
Die Institution der Volksversammlung, das heisst der Versammlung aller Vollbürger der jeweiligen poli-tischen Gemeinschaft (meistens die freien, erwachse-nen Männer), bildet einen wesentlichen Bestandteil von zahlreichen Stammesgesellschaften und frühen Staats-gebilden. Sowohl in den sogenannten „keltischen“ und „germanischen“ Gesellschaften als auch bei vie-len anderen Bevölkerungen der Antike, wie z. B. den Griechen, war eine dreigliedrige Grundstruktur der Verfassung mit 1) König bzw. Magistrat, 2) Ältestenrat bzw. Senat und 3) Volksversammlung weit verbrei-tet (Fernández-Götz 2011; Wenskus 1984). Volksver-sammlungen (griechisch ekklesia; lateinisch comitia; germanisch Thing) stellten kollektive Zusammenkünf-te dar, die auf unterschiedlichen Niveaus stattfanden, von der Ebene der lokalen Gruppen bis hin zu ganzen Königreichen oder sogar supraethnischen Bündnis-sen. Unter den bekanntesten Beispielen befindet sich zweifellos die athenische Volksversammlung, die ihre Blütezeit im 5. Jh. v. Chr erlebte und in der die männ-lichen Vollbürger an einem festgelegten Ort über die wichtigsten Belange des Staates entschieden (Rhodes 1997). Große Berühmtheit erlangten auch die comi-tia centuriata in der Römischen Republik (Gizewski 1997).
Zwar weisen diese großen Zusammenkünfte in ih-rem äußeren Erscheinungsbild und Verlauf einige Un-terschiede zwischen den verschiedenen Kulturen und Epochen auf, aus einer strukturellen Perspektive über-wiegen aber die Ähnlichkeiten in Hinsicht auf ihre Rolle für das Funktionieren der Gesellschaften. Durch ihre Abhaltung konnten vielfältige Aspekte des ge-meinschaftlichen Zusammenlebens organisiert werden, darunter Gesetzgebung, Rechtsprechung, Regelung der Zugangsrechte zu Land und Produktionsmitteln zwischen den verschiedenen Verwandtschaftsgruppen, gemeinsame Verteidigung, Kriegserklärung, etc. Darü-
ber hinaus spielten sie eine beachtliche Rolle bei der Ausführung von Kulthandlungen und bei der Heraus-bildung und Aufrechterhaltung von politischen und ethnischen Gebilden (Fernández-Götz 2013; Wens-kus 1984). Schließlich führte das Zusammentreffen von einer bedeutenden Personenzahl an einem selben Ort häufig auch zur Abwicklung von wirtschaftlichen Aktivitäten, z. B. Jahrmärkten, die sich an vielen Plät-zen sozusagen als Nebenerscheinung der eigentlichen politischen Veranstaltung entwickelten (vgl. dazu Ligt, Neeve 1988). Mit anderen Worten: Die Volksversamm-lungen vereinten politische, religiöse und wirtschaft-liche Komponenten und waren somit entscheidend für die Organisation des Zusammenlebens und für die Konstruktion von kollektiven Identitäten.
Ausgehend von einer Zusammenfassung der vor-handenen archäologischen und literarischen Informa-tionen über das spätlatènezeitliche Gallien wird die Thematik der eisenzeitlichen und frühmittelalterlichen Volksversammlungen im vorliegenden Beitrag auch am Beispiel der viel ausgiebigeren Überlieferungen aus dem alten Irland und dem skandinavischen Raum erläutert. Neben der allgemeinen Zusammenstellung wird auch auf einige spezifische Fragestellungen ein-gegangen, z. B. auf die oftmals beobachtete Verbindung zwischen Gräbern und Versammlungsplätzen. Unge-achtet einiger methodischer Schwierigkeiten, die sich aus der Benutzung von verschiedenen Quellengat-tungen ergibt, besteht das Ziel darin, auf die Wichtigkeit dieser kollektiven Veranstaltungen für die Identität und die sozialen Organisationsformen der eisenzeitlichen und frühmittelalterlichen Personen hinzuweisen.
Volksversammlungen und öffentliche Plätze im späteisenzeitlichen Gallien
Die zentrale Rolle von Räten und Versammlungen im politischen Leben des spätlatènezeitlichen Galli-ens wird von Caesar an verschiedenen Stellen seines Werkes De Bello Gallico hervorgehoben. So berich-tet er im Buch VI, dass es verboten sei, außerhalb der Volksversammlung über Politik zu sprechen (BG VI, 20, 3). Neben den eigentlichen Volksversammlungen existierten auch andere Arten von kollektiven Zu-sammenkünften, die auf unterschiedlichen soziopoli-tischen Ebenen stattfanden und sowohl regelmäßig als
73
manchmal auch außerplanmäßig zu besonderen An-lässen einberufen werden konnten (Fernández-Götz 2011 und 2013; Fichtl 2012a: 121–124). Hier sei z. B. an die jährliche Versammlung der Druiden im heili-gen Zentrum Galliens im Land der Carnuten erinnert, die Camille Jullian (1908: 97) nicht ganz ohne Grund mit der Amphiktyonie von Delphi im antiken Grie-chenland verglich: „Zu einer bestimmten Zeit des Jahres tagen die Druiden an einem geweihten Ort im Gebiet der Carnuten, das man für das Zentrum ganz Galliens hält. Von allen Seiten kommen dort alle die zusammen, die einen Streitfall auszutragen haben, und unterwerfen sich den Ent-scheidungen und Urteilen der Druiden“ (BG VI, 13, 10). Ferner muss auch die Landtagsversammlung ganz Gal-liens (concilium totius Galliae) hervorgehoben werden, in der sich die Abgeordneten der verschiedenen gal-lischen Stämme traffen (BG I, 30, 4–5; IV, 6, 5; V, 2, 4; V, 24, 1; VI, 3, 4; VI, 44, 1–3; VII, 63) (Abb. 1). Weniger bekannt aber dennoch relevant ist auch die Erwäh-nung einer „Versammlung aller Belger“ (concilium com-mune Belgarum, vgl. BG II, 4, 4).
Viel zahlreicher als die genannten Treffen dürf-te aber die Veranstaltung von Volksversammlungen auf der Ebene der einzelnen civitates gewesen sein. Die am besten überlieferte gallische Volksversamm-lung ist zweifellos diejenige, die im Jahre 54 v. Chr. im Treverergebiet von Indutiomarus ausgerufen wur-de: „Sobald er erkannte, dass die Stämme aus freien Stücken zu ihm kamen [...] berief er einen bewaffneten Landtag ein. Nach gallischer Sitte bedeutet das den Kriegsausbruch. Alle erwachsenen Wehrfähigen sind nach allgemein verbindlichem Volksbeschluß gezwungen, sich bewaffnet einzufinden. Wer von ihnen als letzter eintrifft, wird vor den Augen der Menge auf jede mögliche Art gefoltert und anschließend getötet. Auf dieser Versammlung erklärte Indutiomarus den Führer der anderen Partei, seinen Schwiegersohn Cingetorix [...], zum Landesfeind und zog sein Vermögen ein. Anschließend ver-kündete er in der Versammlung, die Senonen, Carnuten und mehrere andere Stämme Galliens hätten ihn zu Hilfe geru-fen; er werde seinen Weg dorthin durch das Gebiet der Remer nehmen, ihre Felder verwüsten, vorher aber noch das Lager des Labienus bestürmen. Hierfür traf er seine Anordnungen“ (BG V, 56). Wie aus diesem Bericht klar hervorgeht, war die treverische Volksversammlung ein politischer Akt (Kriegserklärung, Degradierung des wichtigsten politischen Gegners), der auch religiöse Handlungen
beinhaltete (Menschenopfer, wahrscheinlich an eine Kriegsgottheit).
Auch unter den Haeduern wird von einem groß-en Volkstreffen berichtet, bei dem sich eine gewaltige Menschenmenge versammelte: „Da es nach den Geset-zen der Haeduer den Inhabern des höchsten Amtes nicht gestattet war, das Stammesgebiet zu verlassen, beschloß er [Caesar], selbst zu den Haeduern aufzubrechen, um den Anschein zu vermeiden, er habe in ihre Verfassung und ihre Gesetze eingegriffen. Er berief den gesamten Senat und die Vertreter der streitenden Parteien zu sich nach Decetia. Als sich dort fast der gesamte Stamm eingefunden hatte, wur-de Caesar darüber unterrichtet, dass bei einer heimlichen Zusammenkunft einiger weniger zu ungesetzlicher Zeit an einem ungesetzlichen Ort ein Bruder von dem anderen als gewählt ausgerufen worden sei. Da die Gesetze es unter-sagten, dass zwei Mitglieder einer Familie bei beider Leb-zeiten zu Beamten gewählt würden, es auch streng verboten
Abb. 1: Veranstaltungsorte des concilium totius Galliae in den Jahren 58-52 v. Chr. nach dem Bericht von Caesar (nach Fichtl 2012a).
74
war, dass sie beide in dem Senat saßen, zwang Caesar Cotus daher, die Herrschaft niederzulegen, und ordnete an, dass Convictolitavis, der nach Stammesbrauch in der beamten-losen Zeit unter dem Vorsitz von Priestern gewählt worden war, das höchste Amt übernehmen solle.“ (BG VII, 33). Ob-wohl in diesem konkreten Fall die Versammlung vom römischen Prokonsul einberufen wurde, zeugt die strenge Reglementierung der politischen Macht unter den Haeduern und die zumindest äußere Rücksicht von Caesar auf deren Gesetze, dass solche Massenzu-sammenkünfte zur indigenen, vorrömischen Tradition gehörten. Darüber hinaus veranschaulicht die Tatsache, dass die Wahl unter dem Vorsitz der Priester (Druiden) stattfand, wie eng politische und religiöse Macht mit-einander verbunden waren.
Aber nicht nur die antiken Schriftquellen sind für die Analyse der gallischen Volksversammlungen von Belang, sondern auch die Archäologie. In der Tat ver-mehren sich in den letzten Jahren die Hinweise auf
öffentliche Plätze innerhalb der Oppida, in denen sol-che Zusammenkünfte stattgefunden haben könnten (Fernández-Götz 2012 und 2013; Fichtl 2010; 2012b; Metzler et al. 2006; Ramona 2011). Angesichts der Tat-sache, dass bei einer Volksversammlung auf der Ebene der civitas mehrere Tausend bzw. sogar Zehntausen-de von Menschen eintrafen, benötigte man als ers-tes einen großen freien Platz unter freiem Himmel, der höchst wahrscheinlich in irgendeiner Weise abge-grenzt war, und dies vor allem aus symbolischen und religiösen Gründen. Als bestes Beispiel bietet sich das Oppidum von Titelberg im heutigen Luxemburg an, das von Jeannot Metzler seit Jahrzehnten vorbildlich untersucht wird (Metzler 1995; 2006; Metzler et al. 2006). Um das Jahr 100 v. Chr. wurde dort ein ca. 10 ha großes Areal durch einen 4 m breiten und 2,5 m tiefen Graben und eine Lehmziegelmauer vom Rest des Oppidums abgegrenzt (Abb. 2). In der Verfüllung des Grabens fand man zahlreiche Tierknochen, Fi-
Abb. 2: Plan des Oppidums vom Titelberg. 1: Kultgraben zur Abgrenzung des öffentlichen Platzes. 2: Heiligtum (nach Metzler et al. 2006, verändert).
75
beln, Lanzenspitzen, Miniaturwaffen, Rädchenanhän-ger, Münzen, Fragmente von menschlichen Schädeln, etc. Diese Funde beweisen, dass es sich bei dem Gra-ben nicht nur um eine funktionale, sondern vor allem um eine symbolische Grenze handelte.
In einer ersten Etappe blieb der Kultbezirk vom Titelberg praktisch unbebaut. Lediglich zur Abhaltung von Wahlveranstaltungen wurde das Gelände zeitweise durch bewegliche, über 60 m lange, parallel verlaufende Palisaden in schmale Gänge unterteilt. Diese Einrich-tungen können mit den saepta von italischen Städten wie Rom oder Paestum verglichen werden. Befunde mit einer ähnlichen Deutung wurden auch in ande-ren gallischen Fundstellen wie Villeneuve-Saint-Ger-main und Gournay-sur-Aronde identifiziert (Brunaux et al. 1985; Peyre 2000). Ferner zeugen die mehr als 100.000 geborgenen Tierknochen von einer Metzger-tätigkeit von quasi industriellem Ausmaß, was vermu-ten lässt, dass im 1. Jh. v. Chr. auf dem abgegrenzten Bezirk vom Titelberg auch große Jahrmärkte stattge-funden haben, wahrscheinlich im Zusammenhang mit der Veranstaltung von politischen Versammlungen und öffentlichen Kulthandlungen. Mit anderen Worten, es handelte sich um „une immense place destinée à ac-cueillir les manifestations politiques et cultuelles de la Cité“ (Metzler 2006: 194). Auf dem höchsten Punkt des Geländes wurde noch vor dem Gallischen Krieg eine 15 × 14 m große, dreischiffige Halle errichtet, auf deren Vorplatz sich ein Altar befand. In römischer Zeit baute man auf derselben Stelle einen monumentalen Umgangstempel, der bis ins 3. Jh. n. Chr. existierte.
Aufgrund der geschilderten archäologischen Ent-deckungen wurde in der Forschung wiederholt die These aufgestellt, dass die oben erwähnte treverische Volksversammlung, die laut Caesar im Jahre 54 v. Chr. von Indutiomarus ausgerufen wurde, im öffentlichen Bereich vom Titelberg stattgefunden hat. In der Tat würden die 10 ha dieses Areals genügend Platz bieten, um eine so große Personenzahl aufzunehmen. Natür-lich bleibt dies nur eine mehr oder minder plausible Hypothese, die wahrscheinlich nie zu beweisen sein wird, aber auf jeden Fall belegt der caesarische Be-richt, dass diese Art von Zusammenkünften zwischen den Treverern existierte.
Wenngleich die Funde und Befunde vom Titelberg die besten Hinweise auf die Abhaltung von gallischen
Volksversammlungen liefern, finden sich auch an anderen spätlatènezeitlichen Fundstellen wie Bibracte, Corent oder Fesques Beispiele für öffentliche Be-zirke, die für vergleichbare identitätsstiftende Veran-staltungen Platz boten (Fernández-Götz 2012 und 2013; Fichtl 2010; 2012b; Metzler et al. 2006; Ramona 2011). Besonders interessant erscheint in diesem Zu-sammenhang das Oppidum von Corent, Hauptstadt des mächtigen Stammes der Arverner, in dessen Zen-trum die Triade von Tempel, offenem Versammlungs-platz und Markt archäologisch nachgewiesen werden konnte (Poux 2011) (Abb. 3).
Interessant in der longue durée ist das Oppidum von Bibracte. In spätkeltischer Zeit bestand auf einem der höchsten Punkte des Oppidums die ca. 110 × 92 m große Einfriedung von „La Terrasse“, die höchstwahr-scheinlich als Versammlungsplatz genutzt wurde und vielleicht schon vor Beginn des Oppidums existier-te. Nach Aufgabe der Besiedlung auf dem Berg vom Mont Beuvray wurde in der unmittelbaren Nähe die-
Abb. 3: Rekonstruktionsversuch des Heiligtums von Corent, im Vordergrund der öffentliche Platz (nach Poux 2011).
76
ser Einfriedung ein römischer Tempel erbaut, später auf derselben Stelle eine katholische Kirche und eine Ka-pelle, die bis heute besteht. Darüber hinaus fand bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts ein großer Jahrmarkt statt, der seit dem Mittelalter schriftlich belegt ist (Fleischer, Rieckhoff 2002; Romero 2006) (Abb. 4).
Volksversammlungen im Norden: von Irland bis Skandinavien
Obwohl die vorhandenen Informationen sehr lü-ckenhaft sind, belegen sowohl Schriftquellen als auch archäologische Daten die Wichtigkeit der Volksver-sammlungen im späteisenzeitlichen Gallien. Wie zu Beginn des Aufsatzes bereits erwähnt, ist diese po-litische Institution aber ein viel weiter verbreitetes Phänomen, für das sich auch in zahlreichen anderen europäischen und außereuropäischen Kulturen Bei-spiele finden lassen. Von großem Interesse erscheinen die Versammlungen im alten Irland und im skandi-navischen Raum; beide können aufgrund ihrer ver-hältnismässig guten Quellenlage zu einem besseren Verständnis des Verlaufes von solchen Zusammen-künften beitragen. In Irland gab es die óenacha, große Volksversammlungen, zu denen die Mitglieder eines túath oder einer Provinz angereist kamen (Alberro 2006; Binchy 1958; Mac Niocaill 1972; Melmoth 2010; Raftery 1994). Unter den wichtigsten Stand-orten befanden sich z. B. Tara, Emain Macha, Uisnech oder Tailtiu, die auch häufig in der Inselmythologie Erwähnung finden (Abb. 5). Was die Termine betraf, waren die Feierlichkeiten oft an die großen Jahresfes-te von Beltane, Lughnasadh oder Samhain gebunden. Die Versammlungen vereinten eine ganze Reihe von Komponenten, die nur als Teil eines Ganzen verstan-den werden können, darunter Spiele, Musik, Essen und Trinken, Rechtsspruch, Viehmarkt, religiöse Zeremo-nien oder Überlieferung von Sagen. Die Menschen,
Abb. 4: Darstellung vom Jahrmarkt auf dem Mont Beuvray gegen Ende des 19. Jahrhunderts (nach Romero 2006).
Abb. 5: Links: Lia Fáil, „Stein von Fal“ in Tara, legendärer Krönungsstein der irischen Hochkönige. Rechts: Rekonstruktionsversuch des zeremoniellen Zentrums von Emain Macha (nach Melmoth 2010).
77
die in ihrem Alltag verstreut in kleinen Weilern und Gehöften wohnten, trafen sich an diesen Tagen, um zusammen Nachrichten auszutauschen, Güter zu ver-handeln, soziale Bindungen zu festigen, Hochzeiten zu vereinbaren, etc. (Alberro 2006; Binchy 1958). Bezeichnenderweise wurde das Wort für die irische Volksversammlung óenach zum Ausdruck für den Vieh-markt (Wenskus 1984: 451).
Auch ein kurzer Blick auf die Volks- und Ge-richtsversammlungen im skandinavischen Raum, die sogenannten „Ding“ oder „Thing“, erweist sich von Interesse (Barnwell, Mostert 2003; Pantos, Semple 2004; Semple, Sanmark 2013; Wenskus 1984). Diese Zusammenkünfte von freien Männern existierten auf unterschiedlichen Ebenen, sodass neben den großen überregionalen Thingversammlungen auch kleinere regionale Treffen tagten. Die Termine waren einer-seits genau festgelegt und fanden in regelmäßigen
Abständen statt, andererseits konnte man sich zu be-sonderen Ereignissen wie dem Kriegsfall aber auch außerplanmäßig treffen. Zu den Versammlungen wa-ren im Allgemeinen alle freien, erwachsenen Männer eines bestimmten Gebietes verpflichtet, Frauen, Kin-der, Fremde oder Sklaven dagegen ausgeschlossen, wenngleich es gelegentlich Ausnahmen geben konnte. Innerhalb des Thingplatzes galt der „Thingfriede“.
Eines der besten Beispiele für eine überregionale Volksversammlung war der „Thing aller Schweden“, der jährlich in Gamla Uppsala (Alt-Uppsala) stattfand und zugleich eine politische Versammlung, einen groß-en Jahresmarkt und religiöse Feierlichkeiten umfasste (Duczko 1998; für eine neue archäologische Annähe-rung vgl. Ljungkvist et al. 2011) (Abb. 6). Eine sehr aufschlussreiche Beschreibung verdanken wir dem is-ländischen Historiker Snorri Sturluson, der in seinem Werk Heimskringla (geschrieben um 1230 n. Chr.) u. a.
Abb. 6: Gamla Uppsala. Karte aus dem Jahr 1709. Im Mittelpunkt die drei königlichen Großgrabhügel (nach Duczko 1998).
78
folgendes zu berichten weiß: „In Svithjod it was the old custom, as long as heathenism prevailed, that the chief sacrifice took place in Goe month at Upsala. Then sacrifice was offered for peace, and victory to the king; and thither came people from all parts of Svithjod. All the Things of the Swedes, also, were held there, and markets, and meetings for buying, which continued for a week: and after Christianity was introduced into Svithjod, the Things and fairs were held there as before“ (Saga of Olaf Haraldson, part II). Sehr bekannt ist auch der isländische Althing, der seit dem 10. Jh. bestand und noch heute als Ursprung des Parlaments von Island an-gesehen wird (Bell 2010; Lugmayr 2002). Im Mittelal-ter war diese Versammlung der freien und volljährigen Männer neben gesetzgebender Versammlung auch eine Art Volksfest, in dem Zelte standen und sich Kaufleu-te und Handwerker trafen. Im symbolischen Zentrum lag der „Gesetzesfelsen“ (Lögberg), von dem der Geset-zessprecher (Lögsögumaður) zu der Menge sprach und die Veranstaltung leitete. Neben diesen großen über-regionalen Thingversammlungen wie Gamla Uppsala und Althing gab es in der skandinavischen Welt auch regionale und kleinere Versammlungen, die sich mit alltäglichen Angelegenheiten befassten.
Vor dem Grab tagt der Rat: Versammlungsplätze und Ahnenkult
„Das ganze heisst Leichenagon und ist doch ein Fest der Lebenden“ (Malten 1923–24: 340)
Zum Abschluss dieses Aufsatzes möchte ich noch ein weiteres Element in die Diskussion einbringen. Im Falle der irischen óenacha fanden die Zusammenkünf-te vorwiegend an Orten statt, an denen sich alte Grab-stätten befanden, sodass ihr Ursprung eng mit dem Bereich des Totenfestes und der Ahnenverehrung in Verbindung zu stehen scheint (Alberro 2006: 179; Ettlinger 1953–54; Raftery 1994: 82). Auch im „ger-manischen“ Raum tagten viele Dingversammlungen in unmittelbarer Nähe zu Grabhügeln heroisierter Ah-nen, wie schon Goessler (1938) in einer ersten, noch sehr im Geiste seiner Zeit verhafteten Annäherung vertrat: „Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des Volkes treten miteinander in Verbindung, wenn an dem Platz, wo der Ahn auf ererbtem Besitze und in die mys-tischen Urkräfte der Erde eingebettet liegt, die Sip-
pe zu Beratung und Verehrung zusammenkommt und so erst recht Tote und Lebende die wahre und ewi-ge Sippengemeinschaft bilden.“ (Goessler 1938: 39). Als ein gutes Beispiel gilt Gamla Uppsala, wo sich drei große Hügelgräber befinden, die noch heute im Ge-lände deutlich sichtbar sind und traditionellerweise als Königsgräber bezeichnet werden (siehe Abb. 6). Auf vergleichbare Phänomene wurde auch im frühmittel-alterlichen Britannien hingewiesen (Williams 2006).
Eine ähnliche Verbindung zwischen Versammlungs-platz bzw. Heiligtum und Grabstätten findet man auch in vielen anderen Gebieten, unter anderem in der griechischen Welt. So wird in der Ilias (X, 414–415) berichtet, dass die Ratssitzung der Trojaner neben dem Grabmal des Ilos, dem mythischen Gründer Tro-jas, tagt. Ferner sei z. B. an das weltberühmte Heilig-tum im griechischen Olympia erinnert, das sich rund um einen großen Tumulus aus dem 3. Jahrtausend v. Chr. entwickelte (Senff 2012). Die antiken Griechen sahen in diesem Grabhügel die Ruhestätte des Pelops, dem mythischen Gründer der Olympischen Spiele und Namengeber für die Halbinsel des Peloponnes. Es ist deshalb keineswegs abwegig, den Ursprung der Olympischen Spiele in Leichenspielen bzw. Totenfes-ten zu sehen.
Der hier aufgezeigte Bezug zwischen Versamm-lung der Lebenden und Orte der (realen oder my-thischen) Ahnen ist keineswegs überraschend. In der Tat stellt der Rückgriff auf die Vorfahren in nahe-zu allen traditionellen Gesellschaften einen entschei-denden Grundstein für den inneren Zusammenhalt der Gruppen, für die Konstruktion ihres kulturellen Gedächtnisses und für die Untermauerung von Machtansprüchen und Statusbeziehungen dar (Helms 1998; Insoll 2011; Williams 2003). Wie Assmann (2007: 61) zutreffend bemerkt: „Wenn Erinnerungskultur vor allem Vergangenheitsbezug ist, und wenn Vergan-genheit entsteht, wo eine Differenz zwischen Ges-tern und Heute bewusst wird, dann ist der Tod die Ur-Erfahrung solcher Differenz und die an den To-ten sich knüpfende Erinnerung die Urform kulturel-ler Erinnerung“.
Es stellt sich natürlich die Frage, ob eine vergleich-bare Verknüpfung zwischen Gräbern und Versamm-lungsplätzen bzw. Heiligtümern auch gelegentlich im west- und mitteleuropäischen Festland existier-
79
te. Auch wenn dieses Thema noch einer gründlichen Analyse bedarf, findet man auf den ersten Blick schon einige Beispiele, die sich in das besagte Schema ein-fügen lassen (vgl. vor allem Almagro-Gorbea, Lorrio 2011; Häussler 2010). In der frühen Eisenzeit könnte man z. B. das große Henge-Heiligtum von Goloring in der Nähe des heutigen Koblenz nennen, das von zahlreichen Gräberfeldern umgeben wurde (Haffner 1998; Wegner 2007) (Abb. 7). Auch der Glauberg, mit seinem heroon und der 350 m langen Prozessionsstraße, muss in diesem Zusammenhang natürlich berücksich-tigt werden (Herrmann 2005).
Für die späte Eisenzeit möchte ich unter anderem auf die offene Siedlung von Acy-Romance hinwei-sen, deren Mittelpunkt ein Grabhügel aus der Spät-bronzezeit war (Lambot 2006), oder auf das Oppidum von Villeneuve-Saint-Germain, das sich gegenüber des bedeutenden frühlatènezeitlichen Gräberfeldes von Bucy-le-Long befand (Desenne et al. 2009). Sehr bedeutend für den hier behandelten Themenbe-reich sind die Funde und Befunde aus Manching, wo sich innerhalb der Großsiedlung zahlreiche Hinwei-se auf einen Ahnenkult finden lassen (Sievers 2007; 2010). Dies hat Krausse (2006: 371–372) zur Aufstel-
lung folgender These veranlasst: „Es ist in Erwägung zu ziehen, dass die Wurzeln von Manching in einem multifunktionalen unbefestigten Siedlungs- bzw. Ver-sammlungszentrum der Stufe Lt B2 liegen, dessen Kern eine Ansammlung von Nekropolen und zugehö-rigen Ahnenheiligtümern bildete“. Ferner sei darauf hingewiesen, dass sich das picardische Heiligtum von Gournay-sur-Aronde höchstwahrscheinlich in unmit-telbarer Nähe eines Hügelkenotaphs aus dem 4. Jh. v. Chr. entwickelte (Brunaux et al. 1985; vgl. auch die Ausführungen in Krausse 2006: 359–365). Auch im Oppidum von Corent hat man einen großen Grab-hügel aus der späten Bronzezeit in unmittelbarer Nähe zum spätlatènezeitlichen Heiligtum entdeckt: Even-tuell könnte es sich für die eisenzeitlichen Menschen sogar um das Grab des vermeintlichen Gründerahnen des Stammesverbandes der Arverner gehandelt haben (Ramona 2011). Sehr interessant ist auch das Beispiel aus der gallischen Siedlung von Ymonville, wo ein äl-teres Kriegergrab beim Bau des öffentlichen Platzes respektiert und mit einbezogen wurde (Josset 2010) (Abb. 8). Schließlich möchte ich noch das Oppidum von Heidengraben am Rand der Schwäbischen Alb erwähnen, in dessen Innerem sich die bedeutende ur-
Abb. 7: Goloring. Plan des Heiligtums mit Grabungsschnitten und Rekonstruktionsversuch (nach Haffner 1998 und Wegner 2007).
80
nenfelder- und hallstattzeitliche Nekropole vom Bur-renhof befindet. Neben den Grabhügeln hat man auch einige Grabenanlagen aus der jüngeren Latène-zeit identifiziert, die mit einem Toten- oder Ahnenkult in Verbindung zu stehen scheinen (Ade et al. 2012) (Abb. 9). Zugegeben, die vorhandenen Informationen
aus dem west- und mitteleuropäischen Festland sind noch lückenhaft und in ihrer Deutung nicht unprob-lematisch. Und dennoch zeichnen sich auch hier mit wachsender Forschungsarbeit immer mehr ähnliche Phänomene wie im mediterranen, irländischen oder skandinavischen Raum ab.
Abb. 9: Heidengraben-Oppidum. Oben: Wie-deraufgeschüttete Grabhügel der Hallstattzeit beim Burrenhof (Foto: A. Lehmkuhl). Unten: Schemati-sierter Gesamtplan des Gräberfeldes mit den bislang dokumentierten jüngerlatènezeitlichen Graben-strukturen (nach Ade et al. 2012).
Abb. 8: Die gallischen Siedlungen von Ymonville (oben) und Acy-Romance (unten), mit den jeweiligen Grabhügeln des ver-meintlichen Gründerahnen (nach Ramona 2011).
81
Literatur
Ade, D., Fernández-Götz, M., Rademacher, L., Stegmaier, G., Willmy, A. (2012), Der Heidengraben – Ein keltisches Op-pidum auf der Schwäbischen Alb. Stuttgart: Konrad Theiss Verlag.
Alberro, M. (2006), La feria-fiesta-asamblea óenach de Irlanda y sus posibles paralelos en la antigua Hispania Céltica. Habis 37: 159–181.
Almagro-Gorbea, M., Lorrio, A. (2011), Teutates. El Héroe Fun-dador y el culto heroico al antepasado en Hispania y en la Keltiké. Madrid. Real Academia de la Historia.
Assmann, J. (2007), Das kulturelle Gedächtnis. Schrift, Erinnerung und politische Identität in frühen Hochkulturen. München: Verlag C. H. Beck.
Barnwell, P. S., Mostert, M. [Hrsg.] (2003), Political Assemblies in the Earlier Middle Ages. Turnhout: Brepols.
Bell, A. (2010), Þingvellir: Archaeology of the Althing. Unpub-lished Masters Thesis: Reykjavík.
Binchy, D. A. (1958), The Fair of Tailtiu and the Feast of Tara. Ériu XVIII: 113–138.
Brunaux, J.-L., Méniel, P., Poplin, F. (1985), Gournay I: les fouilles sur le sanctuaire et l’oppidum (1975–84). Revue Archéologi-que de Picardie, nº sp. Amiens.
Desenne, S., Pommepuy, C., Demoule, J.-P. [Hrsg.] (2009), Bucy-le-Long (Aisne). Une nécropole de La Tène ancienne (Ve-IVe siècle avant notre ère). Revue Archéologique de Picardie, nº sp. 26. Amiens.
Duczko, W. (1998), Gamla Uppsala. Reallex. d. Germ. Altkde. 10: 409–418.
Ettlinger, E. (1953–54), The Association of Burials with Popular Assemblies, Fairs and Races in Ancient Ireland. Études Celt-iques 6: 30-61.
Fernández-Götz, M. (2011), Niveles sociopolíticos y órganos de gobierno en la Galia de finales de la Protohistoria. Habis 42: 7–26.
Fernández-Götz, M. (2012), Die Rolle der Heiligtümer bei der Konstruktion kollektiver Identitäten: das Beispiel der treve-rischen Oppida. Arch. Korrbl. 42 (4): 509–524.
Fernández-Götz, M. (2013), Identity and Power: The transforma-tion of Iron Age societies in northeast Gaul. Amsterdam: Am-sterdam University Press.
Fichtl, S. (2010), Les places publiques dans les oppida. L’Archéologue, archéologie nouvelle 108: 36–40.
Fichtl, S. (2012a), Les peuples gaulois. IIIe-Ier siècle av. J.-C. Paris: Errance.
Fichtl, S. (2012b), Places publiques et lieux de rassemblement à la fin de l’âge du Fer dans le monde celtique. In: Bouet, A. [Hrsg.], Le forum romain en Gaule et dans les régions avoisi-nantes. Ausonius, Bordeaux: 41–54.
Fleischer, F., Rieckhoff, S. (2002), Bibracte – Eine keltische Stadt. Das gallo-römische Oppidum auf dem Mont Beuvray (Frank-reich). In: Cain, H.-U., Rieckhoff, R. [Hrsg.], Fromm – Fremd – Barbarisch. Die Religion der Kelten. Mainz: Verlag Philipp von Zabern: 103–118.
Gizewski, C. (1997), Comitia. Der Neue Pauli. Enzyklopädie der Antike. Band 3: 94–97.
Goessler, P. (1938), Grabhügel und Dingplatz. In: Festgabe für Karl Bohnenberger. Beiträge zur Geschichte, Literatur und Sprach-kunde vornehmlich Württembergs. Tübingen: Mohr: 15–39.
Haffner, A. (1998), Goloring. Reallex. d. Germ. Altkde. 12: 392–395.
Häussler, R. (2010), From tomb to temple. On the rôle of hero cults in local religions in Gaul and Britain in the Iron Age and the Roman period. In: Arenas-Esteban, J. A. [Hrsg.], Celtic Religion across Space and Time. Molina de Aragón: CEMAT: 200–226.
Helms, M. W. (1998), Access to Origins: Affines, Ancestors, and Aristocrats. Austin: University of Texas Press.
Herrmann, F.-R. (2005), Glauberg – Olympia des Nordens oder unvollendete Stadtgründung? In: Biel, J., Krausse, D. [Hrsg.], Frühkeltische Fürstensitze. Älteste Städte und Herrschafts-zentren nördlich der Alpen? Archäologische Informationen aus Baden-Württemberg 51. Esslingen: 18–27.
Insoll, T. (2011), Ancestor Cults. In: Insoll, T. [Hrsg.], The Oxford Handbook of the Archaeology of Ritual and Religion. Ox-ford: Oxford University Press: 1043–1058.
Josset, D. (2010), Le site d’Ymonville «les Hyèbles», Bulletin de l’AFEAF 28: 7–10.
Jullian, C. (1908), Histoire de la Gaule. II: La Gaule indépendante. Paris: Hachette:
Krausse, D. (2006), Eisenzeitlicher Kulturwandel und Romanisie-rung im Mosel-Eifel-Raum. Röm.-Germ. Forsch. 63. Mainz: Verlag Philipp von Zabern.
Lambot, B. (2006), Religion et habitat. Les fouilles d’Acy-Roman-ce. In: Goudineau, C. [Hrsg.], Religion et société en Gaule. Paris: Errance: 176–189.
Ligt, L. de, Neeve, P.W. de (1988), Ancient Periodic Markets: Fes-tivals and Fairs. Athenaeum 66: 391–416.
Ljungkvist, J., Frölund, P., Göthberg, H., Löwenborg, D. (2011), Gamla Uppsala – structural development of a centre in Middle Sweden. Arch. Korrbl. 41 (4): 571–585.
Lugmayr, H. (2002), The Althing at Thingvellir. Reykjavík: Iceland Review.
Mac Niocaill, G. (1972), Ireland before the Vikings. Dublin: Gill and Macmillan.
Malten, L. (1923–24), Leichenspiel und Totenkult. Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts, Römische Abtei-lung XXXVIII/XXXIX: 300–340.
Melmoth, F. (2010), Les rois celtes et les lieux d’assemblée des peuples. L’Archéologue, archéologie nouvelle 110: 16–23.
Metzler, J. (1995), Das treverische Oppidum auf dem Titelberg (G.-H. Luxemburg). Zur Kontinuität zwischen der spätkeltischen und der frührömischen Zeit in Nord-Gallien. Luxemburg. Dossiers d’Archéologie du Musée National d’Histoire et d’Art 3.
Metzler, J. (2006), Religion et politique. L’oppidum trévire du Titelberg. In: Goudineau, C. [Hrsg.], Religion et société en Gaule. Paris: Errance: 190–202.
82
Metzler, J., Méniel, P., Gaeng, C. (2006), Oppida et espaces publics. In: Haselgrove, C. [Hrsg.], Celtes et Gaulois, l’Archéologie face à l’Histoire. 4: Les mutations de la fin de l’âge du Fer. Actes de la table ronde de Cambridge, 7–8 juillet 2005. Collection Bibracte 12/4. Glux-en-Glenne: Centre archéologique euro-péen: 201–224.
Pantos, A., Semple, S. [Hrsg.] (2004), Assembly Places and Practices in Medieval Europe. Dublin: Four Courts Press.
Peyre, C. (2000), Documents sur l’organisation publique de l’espace dans la cité gauloise. Le site de Villeneuve-Saint-Germain et la Bilingue de Verceil. In: Verger, S. [Hrsg.], Rites et espaces en pays celte et méditerranéen. Rom: Collection de l’École fran-çaise de Rome 276. 155–206.
Poux, M. [Hrsg.] (2011), Corent – Voyage au coeur d’une ville gauloise. Paris: Errance.
Raftery, B. (1994), Pagan Celtic Ireland. The Enigma of the Irish Iron Age. London: Thames & Hudson.
Ramona, J. (2011), Agglomérations gauloises. Nouvelles considé-rations. Les Dossiers d’archéologie H.-S. 21: 46–51.
Rhodes, P. (1997), Ekklesia. Der Neue Pauli. Enzyklopädie der Antike. Band 3: 934–936.
Romero, A.-M. (2006), Bibracte, Archéologie d’une ville Gauloise. Glux-en-Glenne: Centre Archéologique Européen.
Semple, S., Sanmark, A. (2013): Assembly in North West Europe: Collective Concerns for Early Societies? European Journal of Archaeology 16 (3): 518–542.
Senff, R. (2012), Olympia – Geschichte eines Heiligtums. Antike Welt 4/2012: 10–19.
Sievers, S. (2007), Manching – Die Keltenstadt. Stuttgart: Konrad Theiss Verlag.
Sievers, S. (2010), Die Waffen aus dem Oppidum von Manching. Wiesbaden. Die Ausgrabungen in Manching 17.
Wegner, H.-H. (2007), Die Kelten an Mittelrhein und Mosel. Von ihren Anfängen bis zur römischen Eroberung. In: Uelsberg, G. [Hrsg.], Krieg und Frieden. Kelten – Römer – Germanen. Darmstadt: Primus Verlag: 59–71.
Wenskus, R. (1984), Ding. Reallex. d. Germ. Altkde. 5: 444–455. Williams, H. [Hrsg.] (2003), Archaeologies of Remembrance.
Death and Memory in Past Societies. New York: Kluwer Aca-demic/Plenum Publishers.
Williams, H. (2006), Death and Memory in Early Medieval Brit-ain. Cambridge. Cambridge University Press.
Manuel A. Fernández-GötzSchool of History, Classics and ArchaeologyUniversity of [email protected]