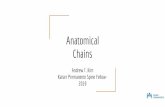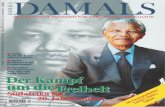Kaiser Schier AHF Jb2008 FB1
Transcript of Kaiser Schier AHF Jb2008 FB1
Mobilität, Migration und Innovation als archäologischer ForschungsgegenstandExzellenzcluster 264 „Topoi – The Formation and Transformation of Space and Knowledge in Ancient Civilizations“ an der Freien Universität Berlin und der Humboldt Universität zu Berlin (gefördert seit 2007) Research Group A-II „Spatial effects of technological innovations and changing ways of life“ Projektleitung: Prof. Dr. Wolfram Schier, Prof. Dr. Hermann Parzinger Koordinatorin: Dr. Elke Kaiser Doktoranden: Claudia Gerling M.A., Ivo Popov M.A., Christine Schuh M.A., Manfred Woidich M.A.
Einleitung
Das Exzellenzcluster Topoi ist der Erforschung der Interdependenzen von Raum und Wissen in Kul-turgemeinschaften gewidmet, die zwischen dem 6. Jt. v. Chr. und dem frühen Mittelalter im Alten Orient, dem Mittelmeer- und Schwarzmeerraum sowie Teilen der eurasischen Steppe verbreitet waren. Dabei kommt der interdisziplinären Betrachtung des Raumes als einem konstitutiven Element in der Entstehung und Transformation von Kulturen und Gesellschaften eine tragende Bedeutung zu. Dem-gemäß sind sehr unterschiedliche Forschungsansätze verschiedener Disziplinen vertreten (Abb. 1). Das hier vorgestellte Projekt der Research Group A-II „Spatial effects of technological innovations and changing ways of life“ beruht auf prähistorisch-archäologischen Grundlagen, auf denen aufbauend ein Konzept für naturwissenschaftliche Analysen erarbeitet wurde. Es geht dabei um die Untersu-chung von Genese und Ausbreitung raumbezogener und raumwirksamer Innovationen (Wagen und Zugtiernutzung, frühes Hirtentum, Reiternomadismus) und ihrer demographischen, sozial- und kul-turhistorischen Begleit- und Folgeerscheinungen. Geographisch stehen die Steppengebiete nördlich des Schwarzen Meeres und daran angrenzende Regionen sowie ausgewählte Regionen Zentralasiens im Fokus.
Zu den Faktoren, die bei Genese und Ausbreitung von Innovationen eine wesentliche Rolle spielen, gehören gerichtete/ungerichtete Mobilität sowie Migration von Bevölkerungsgruppen, ökonomische Diversifikation und Spezialisierung und die daraus resultierenden weiträumigen Austauschvorgänge, denn Hirtenkulturen und Nomaden benötigen ökonomisch komplementäre Produzentengruppen. Im interkulturellen und diachronen Vergleich zeigen Hirten- und Nomadenkulturen zudem ein erstaun- liches Potential für soziale Dynamik und Stratifizierung.
Viehhaltung ermöglicht in weit höherem Maße als Ackerbau Besitzakkumulation, aber auch Redistribution, mit den ethnosoziologisch bekannten Konsequenzen der Entstehung hierarchischer Gesellschaftsstrukturen auf der Basis von Status und Charisma (M. Weber), Abhängigkeit und Gefolg- schaft, schließlich Legitimation durch Abstammung bis hin zu sakral legitimierten, komplexen Häupt-lingstümern. Die Dynamik dieser Prozesse in der eurasischen Steppenzone ist – in einem globalen Maß- stab – sowohl für historisch bezeugte (Mongolen, Awaren, Hunnen) als auch für prä historische Popu-lationen frappierend.
Während wir für die Entstehung historischer Nomadenreiche wenige, dafür umso beeindrucken-dere indigene schriftliche Quellen besitzen (z. B. die „Geheime Geschichte der Mongolen“ aus der Zeit Dzhingis Khans), ist die Rekonstruktion der formativen Phasen räumlich hochmobiler und sozial stratifizierter Hirten- und Nomadenkulturen für prähistorische Zeiten weitaus komplexer.
Forschungsberichte
18
Mobilität von prähistorischen Bevölkerungsgruppen ist für viele Zeiten und Räume immer wieder postuliert, allerdings nur selten mit archäologischen Quellen überzeugend nachgewiesen worden. Für den osteuropäischen Steppenraum war aufgrund der Überlieferungen antiker Schriftsteller bezüglich der skythischen und sarmatischen Stämme und vor allem der historisch belegten Züge reiternoma-discher Verbände oft ohne kritische Reflexion das Vorhandensein von mobilen Gruppen auch auf die Prähistorie übertragen worden. Die angebliche Domestikation des Pferdes bereits im 5. Jt. v. Chr. führte dann zu überzogenen Vorstellungen von Reiterkriegern und ihren verheerenden Überfällen auf sesshaft lebende Kulturen vor allem im Karpaten-Balkan-Raum bereits während der Kupferzeit. Sind diese Ansichten durch neuere archäologische Untersuchungen und vor allem die Erkenntnis, dass das Pferd nicht so früh domestiziert wurde, weitgehend revidiert, stellt sich doch die Frage, wie sich bestimmte, großräumig verbreitete Kulturerscheinungen bzw. Innovationen über große Räume ausbreiten konnten. Dabei stehen sich die Modelle von Diffusion und Migration antithetisch gegen-über, teilweise werden auch Konvergenzphänomene diskutiert.
Mobilität begünstigt die Ausbreitung technischer Innovationen, ist zum Teil offenbar aber auch deren Folge. Prozesse der Mobilisierung von Bevölkerungsgruppen sind allerdings nicht nur mit Innovationen im Bereich von Subsistenz, Transport und räumlicher Kontrolle verbunden, sondern auch mit Veränderungen von Klima und Naturraum, insbesondere in den semiariden Steppenland-schaften Eurasiens.
A-IIIA-IIA-I
C-IIIC-IIC-I
E-IIE-IRESEARCHGROUP
RESEARCHGROUP
RESEARCHGROUP
RESEARCHGROUP
RESEARCHG
ROU
P
B-IB-II
B-IIIB-IV
RESE
ARCH
GRO
UP
D-ID-IID-IIID-IV
C-IVCC IIIIIICCCC IIIICCCC IIRESRESRESEAREARCHCHCH CC IIVVCC
AA IIIIIIAAAA IIIIAAAA IIGROGROUPUP
IIVVVV
BBBBBBBB
E IIE IGROGROUPUP GROGROUPUP
E-IV: C
ROSS SECTIONAL GROUPS I – V
ASpatial Environment
and Conceptual Design
CPerception and
Presentation
BMechanisms
of Control andSocial Spaces
DTheory
andScience
EThe Processing
of Space
Abbildung 1: Topoi Research Areas
19
Mobilität, Migration und Innovation
Grundbegriffe
Im Folgenden werden kurz gefasst die theoretischen Voraussetzungen dargestellt, auf denen das Projekt basiert. Selbstverständlich stellt jeder der aufgeführten Aspekte einen eigenen Forschungsge-genstand dar und wäre an einer anderen Stelle ausführlicher zu erörtern, als es hier der Platz erlaubt.
Der Terminus ‚Archäologische Kultur‘, mit dem in den altertumswissenschaftlichen Fächern ständig operiert wird, beinhaltet eine räumliche und eine zeitliche Dimension. Eine archäologische Kultur wird definiert anhand starker Ähnlichkeiten im Sachgut, in Grabbau und Bestattungssitten sowie in den Sied-lungsstrukturen, die auf verbindende Gemeinsamkeiten im sozialen, wirtschaftlichen und religiösen Leben der jeweiligen Kulturgemeinschaft schließen lassen. Auf den Raum bezogen wird einer archäo-logischen Kultur jeweils ein kohärentes und homogenes Verbreitungsgebiet unterstellt, das sich räumlich von den Arealen anderer archäologischer Kulturen abgrenzen lässt. Überlappungen sind jeweils an der Peripherie möglich, sogar wahrscheinlich. Lassen sich nun in ein und demselben Raum verschiedene Kulturen feststellen, so werden diese a priori meist als nicht gleichzeitig betrachtet. Finden sich einzelne, eine archäologische Kultur kennzeichnende Funde außerhalb ihres Haupt verbreitungsgebiets, dann wer- den diese als Exporte bzw. Importe in eine fremde Kultur angesehen.
Archäologisch gut zu fassen ist die zeitliche Dimension von archäologischen Kulturen jedes Mal dann, wenn es zu einer einschneidenden Änderung kommt. Hierbei sind endogene und exo-gene Ursachen zu unterscheiden, die zu einem Kulturwandel führen können. Häufig ist von einer Gemenge lage aus verschiedenen Ursachen auszugehen, die so weitreichende Folgen wie einen Kultur-wandel bewirkten.
Zu den endogenen Ursachen gehört u. a. die soziale Dynamik innerhalb von Gemeinschaften, wenn z. B. ihre innere Stratifizierung komplexer wird. Krisen innerhalb der Gesellschaft können zu einem System-Kollaps führen. Die Gründe hierfür können im sozialen, ökonomischen oder/und im politischen Bereich liegen. Auch Bevölkerungswachstum kann hier eine Rolle spielen, wobei „demo-graphischer Druck“ nicht nur einen Zusammenbruch der sozioökonomischen Struktur bewirkt, sondern auch zur Abwanderung von Bevölkerungsgruppen führen kann. Aus dem Projekttitel „ Spatial effects of technological innovations and changing ways of life“ geht bereits hervor, dass hier der Fokus insbesondere auf Innovationen gerichtet ist, die nicht nur im technologisch-ökonomischen, sondern auch beispielsweise im religiös-kultischen Bereich auftreten können. Es sei hier nur an das Aufkommen der Kollektivbestattungen in großen Teilen Alteuropas während der Zeit der Megalith-gräber erinnert.
Eine der häufig erwogenen exogenen Ursachen von Kulturwandel sind kurzfristige Schwankungen oder gar grundlegende Veränderungen im Klima, die sich auf Flora und Fauna sowie den Wasser-haushalt auswirken können. Während ein Klimawandel meist über längere Zeit vor sich geht, sind Naturkatastrophen einmalige oder zumindest sehr kurzzeitige Ereignisse, die aber ebenfalls in der betroffenen Region zu weitreichenden Veränderungen führen können. Die Adaption an veränderte Umweltbedingungen im Verbreitungsgebiet einer archäologischen Kultur kann ebenso zu einem Wechsel ihres materiellen Erscheinungsbildes führen, wie die Abwanderung aus dieser Region in eine andere.
Letztgenannte Strategie führt zu den als Kontaktphänomene zu bezeichnenden Ereignissen zwi-schen archäologischen Kulturen, die ebenfalls nicht ohne Folgen bleiben. Dabei erstreckt sich die Skala zwischen den in der englischsprachigen Literatur als „cultural diffusion“ und „demic diffusion“ bezeichneten Gegensätzen.1 Bei der „cultural diffusion“ oder Ideenwanderung wird von einer Weiter-
Forschungsberichte
20
gabe von Technologien, Wirtschaftsformen, Glaubensvorstellungen usw. ausgegangen, bei der sich Menschen nicht über längere Zeit in anderen Gebieten aufgehalten haben, sondern das Wissen über Kommunikation weitergegeben wurde (z. B. Tausch- oder Handelsbeziehungen).
Bei den meisten der anderen Kontaktphänomene wird von der Mobilität Einzelner oder gar ganzer Bevölkerungsgruppen ausgegangen. Zu den ersteren zählen Wanderhandwerker, Prospektoren auf der Suche nach Ressourcen, Spezialisten und Entrepreneure, aber auch Heiratspartner zwischen exo-gamen Gemeinschaften. Sind ganze Gruppen in Bewegung, so spricht man von Migration, wobei diese alters- und geschlechtsspezifisch differenziert sein können, wie z. B. Krieger oder Hirten. In sogenannten Völkerwanderungen sind alle Mitglieder einer Gemeinschaft unterwegs. Das gilt eben-falls für Umsiedlungen und Vertreibungen. Migrationen können friedlich verlaufen, aber ebenso gut invasorischen Charakter haben.
Innovationen in der Prähistorie
Die Untersuchung von Innovationen in vorgeschichtlichen Perioden beginnt mit der Frage nach ihrem Entstehungsgebiet, um zu klären, ob es sich um eine Erfindung handelt, die nur einmal und an einem Ort stattgefunden hat und von hier aus weitervermittelt wurde. Genauso große Bedeutung kommt der Datierung des Zeitpunkts der Innovation zu, an dem diese erstmals archäologisch zu fassen ist. Letzteres bildet wiederum die Grundlage für die Ermittlung der Ausbreitungsgeschwindig-keit, beides ist nur mit ausreichender Datierungsqualität überhaupt valide zu belegen. Für die Frage nach der Schnelligkeit der Ausbreitung und ihrer räumlichen Reichweite ist ferner der Nachweis von Kulturkontakten von besonderer Wichtigkeit, die uns erst die Möglichkeit geben, sicher auf die direkte Vermittlung von Innovationen zu schließen. In den Empfängergebieten wiederum müssen verschiedene Voraussetzungen gegeben sein, damit eine Erfindung oder auch Neuerung im sozialen oder religiös-kultischen Bereich überhaupt auf Akzeptanz stoßen kann. Denkbar, aber archäologisch seltener eindeutig nachweisbar, ist auch das gegensätzliche Szenario: eine Innovation wird von einer aus ökonomischen oder naturräumlichen Bedingungen nicht aufnahmebereiten Gemeinschaft nicht angenommen. Ebenso muss über die Gründe und den Auslöser einer Neuerung nachgedacht wer-den.
Ein sehr prägnantes Fallbeispiel, bei dem viele der genannten Aspekte zum Tragen kommen, ist die Erfindung des frühen Wagens mit Scheibenrädern.2 Kaum jemand wird ernsthaft bezweifeln, dass es sich dabei um eine bedeutende, fast revolutionäre Erfindung handelt, die man lange Zeit im Glauben an die zivilisatorische Vorrangstellung der Kulturen im Vorderen Orient und entsprechenden Darstel-lungen auf Tontafeln, die in das späte 4. Jt. v. Chr. datieren, in Mesopotamien verorten wollte. Doch in den letzten Jahrzehnten konnten in Regionen Mittel-, Südost- und Ost europas Fundkomplexe geborgen werden, die die Erfindung des Scheibenrads und damit verbunden auch des Wagens hier älter erscheinen lassen. Besondere Stellung nehmen dabei die Fundplätze mit guter Erhaltung von organischen Materialien, die Feuchtbodensiedlungen, ein, wie z. B. das Rad und die profilierte Achse aus dem Laibacher Moor oder Scheibenräder und ein Joch aus verschiedenen Pfahlbausiedlungen nördlich der Alpen. Sie datieren um 3500 bis 3400 v. Chr. und zusammen mit den Wagenmodellen aus ungarischen Grabkomplexen der Badener Kultur, Karrenspuren in einem Megalithgrab in Nord-deutschland, hölzernen Radresten in Gräbern Südrusslands, die alle ebenfalls in die zweite Hälfte des 4. Jt. v. Chr. zu stellen sind, wird immer deutlicher, dass zu jener Zeit diese Innovation in weiten Teilen Europas bekannt war.
21
Mobilität, Migration und Innovation
Die frühen Räderfahrzeuge können somit eine polyzentrische Innovation darstellen, aber ebenso gut mittels einer Diffusion ohne einen für uns auf archäologischem oder naturwissenschaftlichem Wege bislang fassbaren Zeitgradienten verbreitet worden sein. Demgemäß ist auch das Ursprungs-gebiet dieser Erfindung nicht erkennbar. In letzter Zeit hat J. Maran auf die tönernen Radmodelle der Tripol’e-Kultur aufmerksam gemacht, die wahrscheinlich als Rollen an Tierfigurinen befestigt waren und die ältesten Nachweise von Rädern und damit auch ein Indiz für die Verwendung von Wagen darstellen.3 Diese bislang nur vereinzelten Funde aus dem Waldsteppengebiet der heutigen Ukraine und Republik Moldova datieren in die erste Hälfte des 4. Jt. v. Chr. Vor dem Hintergrund ihrer sehr weiträumigen und weitverzweigten Austauschkontakte erscheint die Tripol’e-Kultur als Ursprung der Innovation und ihrer raschen Verbreitung sehr plausibel, dennoch fehlt der Nachweis. Die Ausbreitung verlief, wenn uns die fragmentarische Fundüberlieferung nicht in die Irre führt, ausgesprochen schnell, zudem auch in verschiedene Richtungen. Demgemäß dürfte die Akzeptanz in vielen Kulturräumen sehr hoch gewesen sein. Auch der Vermittlungsweg liegt derzeit noch im Dunkeln, so dass es fraglich bleibt, ob hier das Wissen sozusagen von Mund zu Mund weitergege-ben wurde, oder ob Spezialisten, die sich auf die Fertigung früher Wagen verstanden, ihr Wissen auf Wanderungen vermittelt haben. Auch Migrationen von größeren Bevölkerungsgruppen aus dem nördlichen Schwarzmeergebiet in angrenzende Regionen wurden immer wieder postuliert, was am Fallbeispiel der Jamnaja-Kultur illustriert wird.
Migrationen in der Prähistorie
Die Jamnaja- oder auch Grubengrabkultur ist die älteste der drei Kulturen, die in der russischsprachi-gen Forschung bereits als bronzezeitlich gelten, obwohl sie den absoluten Daten zufolge in die erste Hälfte des 3. Jt. v. Chr. zu stellen ist, und deren Gräber unter oder in Grabhügeln errichteten wurden. Charakteristisch für die Jamnaja-Kultur ist die Errichtung von rechteckigen oder ovalen Gruben, auf deren Sohle der Tote in gehockter Stellung, meist mit Ocker gefärbt, lag. Die Gräber können noch mit Holzbalken oder Steinplatten abgedeckt sein, zusätzliche Konstruktionsmerkmale tragen und entweder als Primärbestattung mit einer Aufschüttung überdeckt oder als Nach bestattung in einen schon bestehenden Hügel eingelassen worden sein. Mit der Jamnaja-Kultur verbreitete sich ab 3100/3000 v. Chr. ein sehr einheitlicher Bestattungsbrauch zusammen mit einer im gesamten Raum gleichen Grabkonstruktion im Steppengürtel vom südlichen Ural bis zur unteren Donau. Ab der Mitte des 3. Jt. v. Chr. tritt zunehmend ein anderer Grabbautyp, die Katakombe, in den Grabhügeln in Erscheinung.
Die Jamnaja-Kultur bildete die dritte Welle der sogenannten Kurgan-Kulturen,4 die M. Gimbutas als aggressive Bevölkerungsbewegung der Indoeuropäer aus dem eurasischen Steppengebiet beschrieb, die in Form einer Invasion in das Balkan-Karpaten-Gebiet eindrang und die dortige sesshafte Bevöl-kerung überrannte.5 D.W. Anthony rückte zwar von dem Bild der gleich einer Soldateska einfallenden Nomaden ab, benannte aber ausdrücklich die Jamnaja-Kultur als ein Fallbeispiel für den gelungenen archäologischen Nachweis von Migration großer Bevölkerungsteile in ein neues Gebiet.6
Er bezieht sich dabei auf die westlich des Schwarzen Meeres entdeckten Gräber der Jamnaja-Kultur nördlich und südlich der unteren Donau, im bulgarischen Marica-Becken, im nördlichen Serbien und entlang der mittleren Theiß in Ungarn. Die Gräber entsprechen vom Ritus und der Anlage jenen im nördlichen Schwarzmeergebiet, liegen unter Grabhügeln, was für die Region ansonsten ein völlig fremdes Element ist, und die vereinzelten Beigaben sind ebenfalls kennzeichnend für die Jamnaja-
Forschungsberichte
22
Kultur. Es besteht somit kaum Zweifel, dass die Gräber tatsächlich von Migranten aus der Steppe angelegt wurden. Kann die Aufsiedlung der ebenen Flusstäler nördlich und südlich der unteren Donau noch aufgrund des sehr ähnlichen Naturraums als ein einfaches Vordringen auf der Suche nach Weideplätzen der vermutlich auf Viehzucht spezialisierten Gruppen erklärt werden, musste zum Erreichen des Theißbeckens zunächst ein Gebirgszug überwunden werden.
Da wir nur die Gräber kennen und nur ein Bruchteil der Grabhügel in Südosteuropa archäologisch untersucht wurde, ist es schwierig, den Umfang der Einwanderung in der ersten Hälfte des 3. Jt. v. Chr. zu schätzen. Aufgrund der geringen Anzahl an absoluten Datierungen ist es zudem völlig unmöglich, die Zeitspanne, in der die Migration(en) stattfand(en), einzugrenzen.7 Tatsächlich lassen sich jedoch auch Importe bzw. Nachahmungen von Gefäßen, die typisch für die einheimischen Kulturen im Balkan-Karpaten-Gebiet sind, in den Gräbern und den vereinzelten Siedlungen der Jamnaja-Kultur im nordpontischen Raum feststellen.8 Nach der Lesart von Anthony handelt es sich dabei um Belege für einen Rückstrom, also Gegenstände, die von den ehemaligen Migranten in ihre Heimatregion bei gelegentlicher Rückkehr aus der „Fremde“ mitgebracht wurden. Objektiv betrachtet weisen diese ver-schiedenen Gefäßformen zunächst nur auf einen – wie auch immer gearteten – Kontakt zwischen den beiden Regionen hin. Bei diesem Austausch können Emigranten aus dem Steppenraum eine tragende Rolle gespielt haben. Der Beweis dafür wird nur schwer zu erbringen sein.
Nicht nur über die Karpaten und die Donau hinweg sind zwischen den dort ansässigen Kulturen und der Jamnaja-Kultur Beziehungen feststellbar. In der nordwestlichen Ukraine finden sich bis in die nördliche Peripherie der Jamnaja-Kultur hineinreichend Gräber der Kugelamphoren-Kultur, deren Kerngebiet in Ostmitteleuropa zwischen Elbe und Weichsel liegt. M. Szmyt hat überzeugend eine Ostgruppe im Gebiet der Oberläufe der Flüsse Dnepr, Bug, Dnestr, Prut und Siret herausarbeiten können.9 Einzelne ihrer Leitformen finden sich auch in Grabkomplexen der Jamnaja-Kultur in der Steppe. Völlig ungeklärt ist bislang die Herkunft der Steinkistengräber im Steppengebiet der Krim und im südlichen Bereich der Ukraine, von denen zumindest ein Teil zeitgleich mit der Jamnaja-Kultur ist. Die Ausgestaltung der Grabgruben mit Steinplatten, die für die Jamnaja-Kultur völlig unüblich ist, wird manchmal mit Kontakten aus dem nordkaukasischen Raum erklärt. Die Kugelamphoren-Kultur als Impulsgeber für diese außergewöhnliche Grabgestaltung wäre aber ebenfalls in Betracht zu ziehen. Dass weitreichende Kontakte vom Nordpontikum bis nach Mitteldeutschland bestanden, bestätigt das schnurkeramische Grab von Nord-Egeln (Bleckendorf), in dem drei für die Jamnaja-Kultur typische Beigaben neben einem für die Region typischen Becher geborgen wurden.10 Diese Beispiele sollen genügen, um die doch eher komplexen und vor allem vielseitigen Austauschbeziehungen der Jamnaja-Kultur mit direkt und auch nur mittelbar benachbarten Kulturräumen aufzuzeigen. Die Dar-stellung bleibt ebenfalls auf die westlich von ihr gelegenen Räume beschränkt, wäre aber genauso auf Kaukasien und andere Regionen auszudehnen.
Neue Ansätze zur Ermittlung von Migrationen und ihrer Rolle beim Kulturtransfer
Die archäologischen Argumente sind, wie oben skizziert, weitgehend ausgetauscht, ohne dass eine eindeutige Antwort aus ihnen abzuleiten ist. Doch bieten inzwischen verschiedene naturwissenschaft-liche Verfahren die Möglichkeit, vermutete Wanderungsbewegungen von Mensch und Tier anhand des Skelettmaterials zu fassen. Dazu gehören die Analyse von stabilen Isotopen, insbesondere des Strontiumisotopenverhältnisses 87Sr/86Sr, und paläogenetische Untersuchungen.
23
Mobilität, Migration und Innovation
Derzeit werden zwei Projekte komplementär zueinander durchgeführt (Abb. 2). Das Exzellenz-cluster Topoi fördert an der Freien Universität im Projekt „Spatial effects of technological innovations and changing ways of life“ unter der Leitung von W. Schier und H. Parzinger die Analysen von stabi-len Isotopen, insbesondere Strontium, die in Kooperation mit der Universität Bristol vorgenommen werden. Die gleichfalls kostenintensiven aDNA-Verfahren bilden den Teilbereich 1 in einem vom BMBF unterstützten Projekt „Palaeogenetische Untersuchungen zu wirtschaftlichen Innovationen und sozialer Mobilität in der eurasischen Steppe 3500–300 v. Chr.“.
Die Strontiumisotopenanalyse
Die Erfassung von Ortswechseln anhand von Zähnen und Knochen aus archäologischen sicheren Kontexten beruht auf der Variabilität der Gesteine in ihrer Zusammensetzung von Strontium isotopen, abhängig von ihrem geologischen Alter.11 Je nach vorherrschendem Ausgangsgestein bestehen zwischen benachbarten Regionen unter günstigen Umständen markante Unterschiede in ihrem Strontiumisotopenverhältnis. Gemessen wird hier aus isotopenchemischen Gründen das Verhältnis von 87Sr/86Sr. Durch Verwitterung gelangt das Strontium aus dem Untergrundgestein sowohl in den umliegenden Boden als auch in das Grund- und Oberflächenwasser und kann über den Einbau in Pflanzen oder bei Wasseraufnahme in die Nahrungskette von Organismen gelangen. Als Spuren-element wird Strontium dann anstelle von Calcium in biogenes Gewebe eingebaut. Die Unterschiede des absoluten Strontiumgehaltes in den verschiedenen Trophiestufen in den Organismen spielen
Research Group A-IISpatial Effects of Technological Innovations and Changing Ways of Life
DFG BMBF
Principal Researchers
Prof. Dr. H. ParzingerProf. Dr. W. Schier
Leitung der Nachwuchsgruppe
Dr. Elke Kaiser Arbeitsgruppe Paläogenetik
DoktorandinMartina Unterländer
Populationsgenetik früher eisenzeitlicher Bevölkerungen
Zentralasiens
Arbeitsgruppe Paläogenetik
DoktorandinSandra Wilde
Paläogenetische Untersuchungen zu den Bevölkerungsstrukturen-
der nordpontischen Steppe zwischen 3500 - 300 v. Chr.
Paläogenetik Mainz
Prof. Dr. J. Burger
Promotionsstipendium
„Die westliche Kugelamphorenkultur“
Manfred Woidich M.A.
Promotionsstipendium
„Äneolithisch-frühbronzezeitliche
Grabformen im nord- und westpontischen Raum“
Ivo Popov M.A.
Promotionsstipendium
„Mobilität von Mensch und Haustier im Licht stabiler
Isotopen“
Claudia Gerling M.A.
Promotionsstelle
„Archäologische Gruppierungen und paläogenetische Netzwerke
im westlichen Eurasien“
Christine Schuh M.A.
Abbildung 2: Research Group A-II
Forschungsberichte
24
keine Rolle, da immer das obengenannte Isotopenverhältnis gemessen wird, welches dadurch nicht berührt wird.
Strontium wird auch in Zahnschmelz eingebaut, der härtesten Substanz in Organismen. Sein Einbau beginnt bereits im fetalen Alter und endet mit dem Abschluss der Schmelzbildung am dritten Molar, im Durchschnitt mit 12 bis 14 Jahren (Abb. 3). Danach finden keine weiteren Umbauprozesse im Zahnschmelz statt, somit bleibt das Strontiumisotopenverhältnis, welches in der Kindheit und Jugend eines Individuums in einer bestimmten geologischen Region vorhanden war und über die Nahrungskette aufgenommen wurde, im Zahnschmelz konserviert.
Um Unterschiede zwischen dem 87Sr/86Sr-Verhältnis, das im Zahnschmelz ermittelt wurde, und dem lokalen Wert, an dem das Individuum bestattet wurde, feststellen zu können, wird auch der kompakte Bereich eines Knochens analysiert. Knochen bilden sich im Laufe des Lebens um, so dass sich bei einem Ortswechsel in eine andere geologische Region nach entsprechend langer Umbauzeit das hier vorherrschende Strontiumisotopenverhältnis einstellt und auch messbar wird.12
Weicht beim Vergleich der für den Zahnschmelz, den Knochen und teilweise auch am Dentin ermittelten 87Sr/86Sr-Isotopenverhältnisse der Wert des Zahnschmelzes von dem lokalen Wert ab, so folgt, dass das Individuum aus einer Region mit anderem geologischen Untergrund eingewandert sein muss. Unbekannt ist dabei zunächst meist die Herkunftsregion, da flächendeckende, kleinmaßstäbige Kartierungen der 87Sr/86Sr-Verhältnisse weitgehend fehlen.
Populationsgenetische Untersuchungen an menschlicher aDNA
„Die Begriffe Palaeogenetik bzw. ‚ancient DNA‘ bezeichnen die spurenanalytische, molekular-genetische Charakterisierung von degradierter DNA verstorbener Organismen aus historischem oder naturgeschichtlichem Interesse“ (Burger 2005, 279). Im Laufe der Bodenlagerung degradiert die DNA eines Organismus aufgrund endogener Nuklease, die Geschwindigkeit ist abhängig von dem die Kno-chen und Zähne umgebenden Milieu. Auch nach der archäologischen Bergung wird bei ungünstigen Lagerungsbedingungen die Degradierung sogar noch verstärkt. Demgemäß muss die noch erhaltene aDNA mit molekulargenetischen Techniken aufbereitet werden, um überhaupt Sequenzen erhalten zu können, die noch aussagekräftig sind. Diese werden im aDNA-Spurenlabor unter optimalen steri-len Bedingungen durchgeführt, denn ein weiteres Problem stellt die nachträgliche Kontamination der Proben bei der paläogenetischen Arbeit dar.13
Am Beginn der molekulargenetischen Techniken steht die Extraktion der DNA aus Knochen und Zähnen, die aus archäologischen Kontexten stammen (Abb. 4). Das geschieht mittels einer mechani-schen Pulverisierung des mineralischen Probenmaterials, bei dem die DNA aus dem Knochen bzw. Zahn herausgelöst wird und als Lösung von Verunreinigungen befreit wird. Im nächsten Schritt wird der so gewonnene Auszug der DNA mittels einer Polymerase-Kettenreaktion (PCR) vervielfältigt. Die verschiedenen PCR-Produkte werden in weiteren Verfahren (z. B. Klonierung) noch weitergehend separiert und analysiert. Am Ende steht die Sequenzierung, die die Ansprache von DNA-Sequenzen erlaubt. Alle genannten Techniken werden ständig weiterentwickelt, um die Resultate und die Aus-sage qualität zu verbessern.
In dem Projekt „Spatial effects of technological innovations and changing ways of life“ und dem parallel stattfindenden Projekt „Palaeogenetische Untersuchungen zu wirtschaftlichen Innovationen und sozialer Mobilität in der eurasischen Steppe 3500–300 v. Chr.“ kommen vor allem populations-genetische Analysen zum Tragen. Diese erlauben ein Nachvollziehen des Genflusses in verschiedenen
25
Mobilität, Migration und Innovation
Populationen – auch prähistorischen – anhand von Allelen.14 Veränderungen in der Genvariabilität werden unmittelbar durch Mutationen hervorgerufen, daran anschließende Selektionsfaktoren bewir-ken bei einem gemeinsamen Genpool in Populationen eine unterschiedliche Häufigkeitsverteilung von Genen. Unabhängig von der Selektion kommt es aber auch zu zufälligen Veränderungen in der Genfrequenz, die sogenannte genetische Drift, wozu der bottleneck und der founder effect gehören, die für verschiedene Zeiten in der Prähistorie nachgewiesen werden konnten. Neben anderen bildet auch die Migration einen weiteren Faktor für die unterschiedliche Häufigkeit von Allelen im Genpool.
Eine der Voraussetzungen für populationsgenetische Untersuchungen an menschlicher aDNA sind Proben aus Komplexen über einen Zeitraum von mehreren Jahrhunderten, für deren archäologischen Hintergrund davon ausgegangen wird, dass es zu Veränderungen in der Genfrequenz gekommen ist. In unserem Fall wird vor allem von Migrationen ausgegangen. Für eine sinnvolle Interpretation der palaeogenetischen Resultate werden anhand vorliegender populationsgenetischer Modelle in Kombi-nation mit den archäologisch bekannten Fakten Computersimulationen durchgeführt.
Vorgehensweise
Für die Untersuchung des Steppenraums im nördlichen Schwarzmeergebiet und benachbarten Arealen werden vornehmlich Grabkomplexe aus Grabhügeln ausgewertet. Dabei lässt sich das Fund-material in drei Zeitscheiben untergliedern (Tab. 1). Die erste Zeitscheibe umfasst die zweite Hälfte des 4. Jt. v. Chr., die von dem Ende einer über rund ein Jahrtausend existierenden Kultur erscheinung,
M1 P2 P1 C I2I1
3. Molar (M3)
2. Molar (M2)
2. Prämolar (P2)
1. Prämolar (P1)
Eckzahn (C)
2. Schneidezahn (I2)
1. Schneidezahn (I1)
1. Molar (M1)
Milchzähne
(Geburt) Lebensjahre
1 Beckenkamm2 Rippe3 Gesamtskelett4 Oberschenkel
Lebensjahre
B 100
80
60
40
20
0
M3M2
0 10 20 30 40 50 60 70 80
4
Knoc
henu
mba
urat
e %
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
3
2
1
Abbildung 3: Strontiumisotopenanalyse
Forschungsberichte
26
der Cucuteni-Tripol’-Kultur in der nordwestlichen Ukraine, im östlichen Rumänien sowie in der Republik Moldova, geprägt ist. Für sie sind Siedlungen typisch, die zum Teil große Ausmaße hat-ten. Bestattungen treten erst in ihrer letzten Phase auf und werden teilweise auch als Einfluss aus dem südlich und östlich an sie grenzenden Steppenraum und den dort bekannten archäologischen Kulturen aufgefasst. Letztere sind wiederum vor allem aufgrund ihrer Grabfunde, die u. a. auch den Beginn der Grabhügelsitte kennzeichnen, bekannt. Die fast 1000 Gräber des sogenannten Steppen-äneolithikums sind vor kurzem umfassend publiziert worden15 und lassen sich hinsichtlich ihres Ritus in vier verschiedene Typen unterteilen. Demgemäß wird an die Palaeogenetik die Frage nach einem Zusammenhang zwischen der anthropologischen Identität und der Bestattungssitte gerichtet.
Auch in dem Zeitraum von 3500 bis 3000 v. Chr. sind im archäologischen Material Kontakte zwi-schen dem nordpontischen Steppenraum und zum Beispiel dem Karpatenbecken festzustellen. In diese Zeit gehört offenbar auch die Ausbreitung der Innovation des Wagens auf Scheibenrädern. So finden sich Radmodelle, wie oben dargelegt, u. a. in Siedlungen der Cucuteni-Tripol’-Kultur, ganze Wagenmodelle aus Ton aber auch in ungarischen Fundstellen der Badener Kultur. Doch auch der im nordkaukasischen Vorgebirgsraum verbreiteten Majkop-Kultur wird eine große Impulskraft auf die Steppenkulturen zugesprochen. So wird sie – von anderen Forschern – als mögliche Beteiligte im Transfer der Wagentechnologie angesehen. Sicher kommt ihr eine tragende Rolle im Bereich der Metallurgie und dem Aufkommen der Kupfer-Arsen-Legierungen im Steppenraum zu. Hier bleiben sowohl die palaeogenetischen als auch die isotopenchemischen Resultate abzuwarten, die neue Hin-weise auf die Verbindungen der vielen Kulturen untereinander, u. a. auch der kleinen Einheiten, die sich nach dem Zerfall der Cucuteni-Tripol’-Kultur bildeten, ergeben können.
Zeitscheiben Archäologische Kulturen Fragestellungen
Zeitscheibe 1: 3500–3000 v. Chr.
SteppenäneolithikumUsatovo-/Cernavodă I-KulturBadener KulturMajkop-Kultur Steinkistengräber
Überprüfung archäologischer Migrationshypothesen –Spezialisierte, mobile Viehhaltung? –Rolle der Majkop- und Badener Kultur beim Technologie- –transfer (früheste Wagen)Zusammenhang zwischen Bestattungssitte und –anthropologischer Identität
Zeitscheibe 2: 3000–2500 v. Chr.
Jamnaja-KulturKugelamphorenkulturKemi-Oba-Kultur
Überprüfung archäologischer Migrationshypothesen –Spezialisierte, mobile Viehhaltung –Kontakte zwischen Jamnaja- und Kugelamphorenkultur –populationsgenetisch nachweisbar?Rolle der Jamnaja-K. (Wagengräber !) und Kugel- –amphorenkultur (Bestattung von Rindergespannen !) beim Technologietransfer (Wagen, Zugtiernutzung)Zusammenhang zwischen Bestattungssitte und –anthropologischer Identität
Zeitscheibe 3: 2500–2000 v. Chr.
Jamnaja-KulturKatakombengrabkultur
Zusammenhang zwischen Grabbau und anthropologischer –IdentitätÜberprüfung archäologischer Migrationshypothesen –
1. Jt. v. Chr. Skythenzeitliche Grabkomplexe Ermitteln von Mobilitätsmustern in historisch bekannten reiternomadischen Gemeinschaften
Tabelle 1: Überblick über die Forschungsziele in den einzelnen Zeitscheiben
27
Mobilität, Migration und Innovation
Eine weitere Innovation im Steppenraum steht im direkten Zusammenhang mit der Subsistenz-strategie seiner Bewohner: die Entwicklung der spezialisierten Viehzucht, die in dem trockenen Gebiet als einzige langfristig sinnvolle und auch größere Populationen ernährende Wirtschaftsform angesehen wird. Die Suche nach Weidegründen für die Herden, wobei je nach Aridität in den einzel-nen Regionen das Schaf oder das Rind vorwiegend gehalten wurde, soll schnell zu einer erweiterten Mobilität der Hirten geführt haben, wobei wahlweise von Transhumanz, Halbnomadismus oder auch Vollnomadismus ausgegangen wird. Um dieser Frage näher zu kommen, werden auch Tierzähne aus Siedlungen mittels Strontiumisotopenanalyse untersucht. Diese Untersuchungen werden für alle drei Zeitscheiben durchgeführt, um so auch mögliche Veränderungen in der Zeit feststellen zu können.
Die zweite Zeitscheibe umfasst die Periode der Jamnaja-Kultur, die nach absoluten Daten von 3100/3000 v. Chr. bis 2500 v. Chr. währte (Tab. 1). Wie oben geschildert, werden für sie aufgrund archäo-logischer Indizien Migrationsbewegungen in die Balkan-Karpaten-Region angenommen, die mittels Analysen von aDNA überprüft werden. Aber auch das insgesamt recht komplexe Netz der Austauschbe-ziehungen mit Kulturen in Mittel- und Ostmitteleuropa, wie der Kugelamphorenkultur, weist auf einen recht hohen Grad an Mobilität, wahrscheinlich nicht nur seitens der Population der Jamnaja-Kultur. Für letztere wird aber auch mittels isotopenchemischer Verfahren die Mobilität im Steppengebiet untersucht und mit den Resultaten von Tierzähnen aus Siedlungen in Beziehung gesetzt.
Abbildung 4: Populationsgenetische Untersuchungen an menschlicher aDNA
Forschungsberichte
28
In der dritten Zeitscheibe, der zweiten Hälfte des 3. Jt. v. Chr., dringt von den Regionen am unteren Don oder der Wolga kommend allmählich eine neue Grabkonstruktion bis an die untere Donau vor (Tab. 1). Statt in Gruben werden nun die Verstorbenen in den Grabhügeln in Anlagen beigesetzt, die aus einem seitlichen Eingangsschacht bestehen, an den seitlich eine Grabkammer in die Erde eingegraben ist. Diese Grabanlagen werden als Katakomben bezeichnet, die auch namengebend für die archäologische Kultur zwischen 2500 und 2000 v. Chr. sind. Die neue Grabkonstruktion wird meist mit einem Bevölkerungswechsel gleichgesetzt, obwohl in der ersten Zeit die Beigaben denen aus der Jamnaja-Kultur sehr ähneln. Erst mit einer entwickelten Phase kommen neue Gefäßformen auf, zudem lässt sich eine starke Regionalisierung in einzelnen Gebieten der Steppen feststellen. Aus-tauschbeziehungen zumindest in westliche Richtung sind im Sachgut kaum noch zu fassen, so dass sich die palaeogenetischen Untersuchungen vor allem auf den Wechsel von der Jamnaja- zur Kata-kombengrabkultur konzentrieren.
Ergänzend werden noch Proben aus früheisenzeitlichen Komplexen in verschiedenen Regionen Eurasiens genommen. Die palaeogenetischen Analysen bilden einen weiteren Teilbereich innerhalb des BMBF-Projektes. Von jeweils abgegrenzten Grabhügelfeldern in drei Regionen, Tuva, Kazachs-tan und südliche Ukraine, werden zusätzlich noch Proben für die Strontiumisotopenuntersuchung genommen. Für die früheisenzeitlichen Gemeinschaften der Skythen im Steppengebiet mangelt es nicht an historischen Überlieferungen ihrer nomadischen Lebensweise. Die isotopenchemischen Ergebnisse werden zum einen der näheren Beschreibung des Nomadismustyps dienen, zum anderen aber auch eine Referenz zum Vergleich der Muster bilden, die sich aus den Resultaten der gleichartigen Analysen für das 4. und 3. Jt. v. Chr. ergeben. Bislang wurde das Verhältnis von 87Sr/86Sr insbesondere für die Untersuchung der Mobilität innerhalb sesshafter Populationen unternommen, während es noch aussteht, mit ihrer Hilfe den Grad und Typ mobiler Gemeinschaften zu ermitteln.
Am Ende dieser Untersuchungen steht die Synthese aller verfügbaren Daten: jenen, die aus den beschriebenen naturwissenschaftlichen Methoden gewonnen wurden, wobei die Isotopenchemie noch in Auswahl durch Sauerstoff-, Kohlenstoff- und Stickstoffanalysen ergänzt wird, sowie den konventionell anthropologischen Resultaten der beprobten Individuen und selbstverständlich den archäologischen Fakten für die drei Zeitscheiben. Die Anwendung neuer naturwissenschaftlicher Ver-fahren und ihrer Verknüpfung mit den bereits auf archäologischem Weg erarbeiteten Interpreta tionen stellt einen völlig neuen Weg im Bereich der osteuropäischen Archäologie und der Erforschung eines Naturraums, der Steppe, und seinen kulturhistorischen Prozessen in der Vergangenheit dar.
Damit bildet das Projekt einen integralen Bestandteil im Forschungskonzept der Exzellenzinitiative Topoi, da die Zusammenhänge von Raum und Wissen für prähistorische Zeiten unter Einbindung von neuen naturwissenschaftlichen Methoden erkundet werden. Eine wie auch immer geartete Mobilität wurde häufig für die Vermittlung von innovativen Elementen vorausgesetzt, wobei es außer ihrem Nachweis ebenso gilt, die Formen der Raumnutzung durch den Menschen in schriftloser Zeit näher zu beschreiben.
Elke Kaiser, Wolfram Schier
29
Mobilität, Migration und Innovation
Anmerkungen
Zu den Begriffsdefinitionen s. Prien 2005, 9–10.1 Vgl. hierzu die Ausführungen von Burmeister 2004. Hier finden sich auch die Literaturverweise auf die 2 nachfolgend genannten frühen Komplexe mit Scheibenrädern.Maran 2004.3 In der russischen Terminologie ist das turksprachige Wort „Kurgan“ für Grabhügel gebräuchlich.4 Gimbutas 21997, 74–117.5 Anthony 1992.6 Auch wenn das wiederholt versucht wurde, vgl. Anthony 2007, 305.7 Es handelt sich dabei z. B. um Amphoren mit asymmetrisch angebrachten Henkeln (vgl. Rassamakin/Nikolova 8 2008) und Kreuzfußschalen (vgl. Kaiser 2005).Szmyt 1999.9 Behrens 1952.10 Vgl. hierzu die grundlegenden Ausführungen von Knipper 2005.11 In letzter Zeit wird auf die diagenetische Veränderung des Isotopenverhältnisses in Knochen in Folge der 12 Bodenlagerung über die Jahrhunderte und Jahrtausende aufmerksam gemacht. Vgl. hierzu u. a. Horn/Müller-Sohnius 1999; Grupe u. a. 1999.Burger 2007.13 Grupe u. a. 2005, 139–168.14 Rassamakin 2004.15
Literaturverzeichnis
D.W. Anthony, Migration in Archeology. The Baby and the Bathwater, American Anthropologist 92 (1990) 895–914.
D.W. Anthony, The Horse, the Wheel and Language. How Bronze-Age Riders from the Eurasian Steppes Shaped the Modern World, Princeton, Oxford 2007.
J. Burger, Palaeogenetik, in: G.A. Wagner (Hrsg.), Einführung in die Archäometrie, Berlin, Heidel-berg 2007, 279–298.
St. Burmeister, Der Wagen im Neolithikum und in der Bronzezeit: Erfindung, Ausbreitung und Funktion der ersten Fahrzeuge, in: St. Burmeister und M. Fansa (Hrsg.), Rad und Wagen. Der Ursprung einer Innovation, Wagen im Vorderen Orient und Europa. Beiheft der Archäologi-schen Mitteilungen aus Nordwestdeutschland 40, Mainz 2004, 13–40.
M. Gimbutas, The Kurgan culture and the Indoeuropeanization of Europe. Selected articles from 1952 to 1993. Journal of Indo-European studies, Monograph 18, Washington DC 21997.
G. Grupe, T.D. Price, P. Schröter; F. Söllner, Mobility of Bell Beaker people revealed by Sr isotope ratios of tooth and bone: a study of southern Bavarian skeletal remains: A reply to the comments by Peter Horn and Dieter Müller-Sohnius, Applied Geochemistry 14 (1999) 271–275.
G. Grupe, K. Christiansen, I. Schröder und U. Wittwer-Backofen, Anthropologie. Ein einführendes Lehrbuch. Berlin, Heidelberg, New York 2005.
P. Horn and Dieter Müller-Sohnius, Comment on ‘Mobility of Bell Beaker people revealed by Sr iso-tope ratios of tooth and bone: a study of southern Bavarian skeletal remains’ by Gisela Gruppe, T. Douglas Price, Peter Schröter, Frank Söllner, Clark M. Johnson and Brian L. Beard, Applied Geochemistry 14 (1999) 263–269.
E. Kaiser, Kuriľnicy katakombnoj kuľtury i čaši na podstavkach Severnogo Pričernomor’ja – k voprosu o novoj tipologii, Materialy i issledovanija po archeologii Kubani 5 (2005) 121–138.
Forschungsberichte
30
C. Knipper, Die Strontiumisotopenanalyse: Eine naturwissenschaftliche Methode zur Erfassung von Mobilität in der Ur- und Frühgeschichte, Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentralmuseums Mainz 51 (2004) 589–685.
J. Maran, Kulturkontakte und Wege der Ausbreitung der Wagentechnologie im 4. Jahrtausend v. Chr., in: St. Burmeister und M. Fansa (Hrsg.), Rad und Wagen. Der Ursprung einer Innova-tion, Wagen im Vorderen Orient und Europa. Beiheft der Archäologischen Mitteilungen aus Nordwestdeutschland 40, Mainz 2004, 429–442.
R. Prien, Archäologie und Migration. Vergleichende Studien zur archäologischen Nachweisbarkeit von Wanderungsbewegungen. Universitätsforschungen zur prähistorischen Archäologie 120, Bonn 2005.
Ju. Ja. Rassamakin, Die nordpontische Steppe in der Kupferzeit: Gräber aus der Mitte des 5. Jts. bis Ende des 4. Jts. v. Chr. Archäologie in Eurasien 17, Mainz 2004.
Ju. Ja. Rassamakin und A.V. Nikolova, Carpathian Imports and Imitations in Context of the Eneo-lithic and Early Bronze Age of the Black Sea Steppe Area, in: P.F. Biehl und Ju. Ja. Rassamakin (Hrsg.), Import and Imitation in Archaeology. Schriften des Zentrums für Archäologie und Kulturgeschichte des Schwarzmeerraumes 11, Langenweißbach 2008, 51–87.
M. Szmyt, Between West and East. People of the Globular Amphora Culture in Eastern Europa: 2950–2350 BC. Baltic-Pontic-Studies 8, Poznań 1999.
Th. Tütken, C. Knipper und K.W. Alt, Mobilität und Migration im archäologischen Kontext: In-formationspotential von Multi-Element-Isotopenanalysen (Sr, Pb, O), in: J. Bemmann und M. Schmauder (Hrsg.), Kulturwandel in Mitteleuropa. Langobarden – Awaren – Slawen. Akten der Internationalen Tagung in Bonn vom 25.–28. Feb. 2008, Bonn 2008, 13–42.