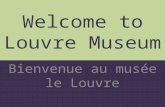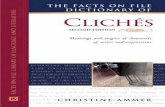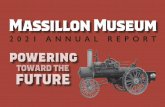"Das Museum of Islamic Art in Cairo – Revisited," in Experimentierfeld Museum: Internationale...
Transcript of "Das Museum of Islamic Art in Cairo – Revisited," in Experimentierfeld Museum: Internationale...
Das Museum of Islamic Art in Kairo – revisited
IMAN R. ABDULFATTAH In der Nähe von Bab al Khalq, wo sich die Port Said-Straße und die Muhammad Ali-Straße kreuzen, steht ein wunderschöner rosa bemalter Nachbau eines Mamlu-kengebäudes [Mamluken: Militärsklaven im islamischen Herrschaftsbereich, Anm. d. Übers.], dessen architektonische Details die nicht weit entfernten Namensbrüder im historischen Kairo nachbilden.1 Es handelt sich bei dem Gebäude um das MUSEUM OF ISLAMIC ART (MIA), eines der Museen, die unter der Schirmherrschaft des MINISTRY OF STATE FOR ANTIQUITIES (MSA)2 stehen. Das Museum beherbergt die wichtigsten Kunstgegenstände, die den ganzen Reichtum und die Fülle des Kunsthandwerks islamischer Länder widerspiegeln. Das MIA ist ein ziemlich ein-zigartiges Museum in Ägypten, denn es umfasst nicht nur einen langen historischen Zeitraum, seine Objekte decken auch eine große geografische Ausdehnung ab, vom
1 Das als «historisches Kairo» bezeichnete Gebiet wurde 1979 auf die Liste des Weltkul-
turerbes der UNESCO gesetzt. Seine komplizierten Grenzen würden eine ausführliche Beschreibung erfordern; Karten, Berichte und genaue Informationen sind auf der Websei-te der UNESCO zu finden unter dem Stichwort «historisches Kairo» und abrufbar unter: http://whc.unesco.org/en/list/89/. Zuletzt gesehen am 7. Januar 2014.
2 Die vier nationalen Museen präsentieren – bis auf eine Ausnahme – die gesamte Vielfalt der langen Geschichte Ägyptens, indem sie durch ihre Kunst und ihre archäologischen Objekte ein entsprechendes Narrativ konstruieren. Die drei anderen Museen sind das MUSEUM OF EGYPTIAN ANTIQUITIES am Tahrir-Platz (das sich 1835 ursprünglich in der Nähe des Azbakiyya-Gartens befand, das heutige EGYPTIAN MUSEUM bezog seinen Sitz 1902 in der Kairoer Innenstadt); das GRAECO-ROMAN MUSEUM in Alexandria (1892) und das COPTIC MUSEUM in Alt-Kairo (1910). Vor 2011 unterstanden alle archäologi-schen Stätten, archäologischen Museen und Denkmäler dem SUPREME COUNCIL OF
ANTIQUTIES (SCA), einer Körperschaft des Ministeriums für Kultur. 2011 wurde die Al-tertumsabteilung dann ein unabhängiges Ministerium und in MSA umbenannt.
254 | IMAN R. ABDULFATTAH
südlichen Spanien bis zum Iran und von vielen Regionen dazwischen. Das Museum steht zudem an einer Stelle, die das mittelalterliche Kairo vom Khedival-Kairo trennt, dem modernen Kairo,3 sodass es dem/der Besucher_in die Möglichkeit bie-tet, viele der Museumsobjekte ägyptischer Herkunft mit denjenigen Monumenten und archäologischen Stätten zu kontextualisieren, aus denen sie ursprünglich stammten, in diesem Fall vor allem aus dem historischen Kairo und Fustat [Stadtteil in Kairo, Anm. d. Übers.]. Dieser Kontext ermöglicht dem/der Besucher_in, eine direkte Beziehung zwischen der Archäologie und dem Museum herzustellen sowie zwischen seinen Objekten und den Denkmälern.
Obwohl das heutige Gebäude an der Port Said-Straße aus dem Jahr 1903 stammt,4 entstand die Idee, einen Ort zu schaffen für die Objekte, die Ägyptens is-lamisches Erbe repräsentieren, bereits ein paar Jahrzehnte früher. Manifest wurde diese Idee 1881, als Khediven Tawfiq (1879-1892) das COMITÉ DE CONSERVATION
DES MONUMENTS DE L’ART ARABE gründete. Ziel des Komitees war es, die stark vernachlässigten islamischen und koptischen Monumente in Ägypten zu erforschen und sich um ihren Erhalt zu kümmern.5 Die Fatimid-Moschee von al-Hakim (990-1013), die sich innerhalb der Stadtmauern von Fatimid Kairo befand, diente als er-ster Sitz des Museums. Die Aufgabe des Komitees war es, die religiösen und welt-lichen Denkmäler zu prüfen, wenn nötig Maßnahmen zu ihrer Restaurierung vorzu-schlagen und besonders bewahrenswerte architektonische Elemente und Möbel zur Aufbewahrung in die Moschee von al-Hakim zu bringen. Die Maßnahmen des Ko-mitees wurden jeweils mit dem Datum der Sanierungsarbeiten gekennzeichnet, wobei jedes der Denkmäler eine eigene Gebäudenummer bekam.6 Als die Bestände des Museums durch die Objektspenden des Komitees wuchsen, wurde es 1903 an seinem heutigen Standort neu eröffnet. Der Umzug fällt mit der Übernahme mehre-rer privater Sammlungen sowie den gut dokumentierten Ausgrabungen von Fustat
3 Khedival Kairo ist Kairos modernes Viertel, das sich westlich von der Port Said-Straße
befindet und 1863 von Vizekönig Ismail (1863-1879) sowie von Ali Pasha Mubarak ent-worfen wurde, dem Minister für öffentliche Arbeiten, Vergleiche Reid 2002. 215-216.
4 Das Gebäude wurde von Alfonso Manescalco entworfen, einem in Ägypten geborenen italienischen Architekten, der Chefarchitekt des Ministeriums für öffentliche Arbeiten war. Das Museum hieß bis 1952 Museum for Arab Art.
5 Das Komitee und seine verschiedenen Unterausschüsse waren nach seiner Gründung bis zur Auflösung 1961 sehr aktiv. Vergleiche dazu Reid 2002: 222-226, sowie al-Habashi und Warner1998: 81-82.
6 Kairos historische Denkmäler wurden mehrmals vom Komitee erfasst und aufgelistet, 1951 enthielt der endgültige Index 623 Einträge über Denkmäler in verschiedenem Kon-servierungszustand (Habashi und Warner 1998: 92-93).
DAS MUSEUM OF ISLAMIC ART IN KAIRO – REVISITED | 255
zusammen, die der damalige Direktor des MUSEUMS OF ISLAMIC ART, Ali Bahgat, in den 1910er und 1920er Jahren durchführte.7
2002 schloss das MUSEUM OF ISLAMIC ART seine Türen für die Öffentlichkeit, um es der ersten großen Sanierung seit 1983 zu unterziehen. Nach einer achtjähri-gen Pause wurde das MUSEUM OF ISLAMIC ART im Oktober 2010 mit einer reorga-nisierten Sammlung und einem renovierten Gebäude wiedereröffnet – drei Monate vor dem Beginn der Revolution am 25. Januar 2011 und mit wenig internationaler Presse und Öffentlichkeit.8
Eine der Hauptursachen der achtjährigen Schließung war – abgesehen von Ägyptens staatlicher Bürokratie – die Suche nach Wegen gewesen, die strukturellen Probleme zu lösen, welche die Stabilität des 110 Jahre alten und unter Denkmal-schutz stehenden Gebäudes bedrohten. Neben der starken Belastung durch die Um-gebung des Museums war vor allem die gleichzeitige Sanierung der NATIONAL
LIBRARY AND ARCHIVES OF EGYPT (DAR AL-KUTUB) im oberen Stockwerk eine große Belastung für das Gebäude.
Die SCA stellte unter der Leitung von Dr. Zahi Hawass ein internationales Team zur Erarbeitung des neuen Designs zusammen. Den Plan und die Konzepte sowie ihre Umsetzung hatte sich ein Kollektiv ausgedacht, bestehend aus den Kura-tor_innen des MUSEUMS FOR ISLAMIC ART, dem Museografen und Designer Adrien Gardère, seinem Kairoer Projektmanager Arnaud du Boistesslin sowie Sophie Ma-
7 Bahgat begann die Ausgrabungen in Fustat 1912 und führte sie bis zu seinem Tod 1924
fort (Reid 1998: 255-257).
8 Auch das VICTORIA AND ALBERT MUSEUM in London, THE METROPOLITAN MUSEUM
OF ART in New York und der LOUVRE in Paris hatten ihre islamischen Galerien etwa im selben Zeitraum geschlossen – ihre Wiedereröffnung 2006, 2011 beziehungsweise 2012 fand jedoch jeweils unter einem Ansturm internationaler Presse statt. Dass das Kairoer Museum keine angemessene internationale Beachtung fand, kann auf mehrere Faktoren zurückgeführt werden: unzureichende Kommunikation zwischen dem SCA und nicht-ägyptischen Medienvertretern; die Wiedereröffnung des MIA wurde mehrfach verscho-ben; und auf einer eher akademischen Ebene ließ das Fehlen aktueller wissenschaftlicher Publikationen das Museum in Vergessenheit geraten. So hat es keinen umfassenden Kata-log über die Sammlung mehr gegeben seit den mehrbändigen Folianten von Gaston Wiet aus den 1930er Jahren (Catalogue général du Musée arabe du Caire), der Führer ist nicht mehr aktualisiert worden seit der 1961 von Mohamed Mostafa geschriebenen Zusammen-fassung, und das Museums-Journal (Islamic Archaeological Studies) hat es nur auf fünf Ausgaben im Jahr 1982 gebracht. Allerdings hat die AMERICAN UNIVERSITY in den letz-ten Jahren bei CAIRO PRESS einen knappen Katalog veröffentlicht, TREASURES OF
ISLAMIC ART IN THE MUSEUMS OF CAIRO (2006), sowie zuletzt 2012 THE ILLUSTRATED
GUIDE TO THE MUSEUM OF ISLAMIC CERAMICS AND ISLAMIC TEXTILES.
256 | IMAN R. ABDULFATTAH
kariou, Direktorin des DÉPARTEMENT DES ARTS DE L‘ISLAM des LOUVRE. Die Auf-schriften auf den Tafeln und Schildern des Museums und andere didaktische Infor-mationen wurden vom Französischen ins Arabische durch das Kairoer INSTITUT
FRANÇAIS D'ARCHÉOLOGIE ORIENTALE (IFAO) übersetzt. Die Mehrzahl der Ausstellungsobjekte wurden von Restaurator_innen der SCA
bearbeitet; allerdings wurden die Reinigung und die Konservierung einer Reihe der größeren architektonischen Marmor- und Steinelemente von einem Restauratoren-team der AGA KHAN CULTURAL SERVICES (AKCS) durchgeführt – ein Geschenk von H. H. Karim Aga Khan an die Stadt Victorious. Für diese Objekte wurden indi-viduell von GOPPION [ital. Manufaktur für Museums- und Ausstellungstechnik, Anm. d. Übers.] gestaltete Schaukästen gebaut. Zwei entscheidende Personen, die leider nicht mehr unter uns sind, leisteten ebenfalls einen großen Beitrag zum Pro-jekt: der Architekt Dr. Sayed el-Komi, dessen Firma die Modernisierung durchführ-te, und Farid Mansour, Präsident der inzwischen aufgelösten FRIENDS OF THE
MUSEUM OF ISLAMIC ART (FMIA).
Abbildung 14: Der Museumsgarten verbindet das Museumsgebäude mit dem neuen Anbau.
Foto: Ahmed Amin.
Ich kam im April 2006 zu dem Projekt hinzu ohne vorherige Erfahrung in der Ar-beit mit einem Umbau solchen Ausmaßes. Als Projektkoordinatorin war ich ver-antwortlich für die Begleitung der Vorbereitungen zur Wiedereröffnung des Muse-
DAS MUSEUM OF ISLAMIC ART IN KAIRO – REVISITED | 257
ums sowie für die Verbindung zwischen den verschiedenen Beteiligten, seien es die lokalen Mitarbeiter_innen (Direktor_in, Kurator_in, Restaurator_innen, Archi-tekt_innen, Ingenieure/Ingenieurinnen und Berater_innen), der Designer und Mu-seograf Adrien Gardère oder die oben bereits genannten externen Institutionen. Im Nachhinein betrachtet, bestand meine Aufgabe außerdem in der Überwindung der zahlreichen Hindernisse, welche die Wiedereröffnung des Museums verzögerten. Weil zum Beispiel keine regelmäßigen Treffen zwischen dem Team des LOUVRE und seinen ägyptischen Kolleg_innen auf Seiten des MIA stattfanden, gab es re-gelmässig Missverständnisse darüber, welche Objekte in welcher Weise ausgestellt werden sollten; dazu kamen Differenzen eher ideologischer Art.
Während die Renovierung anschließend von einigen Expert_innen Kritik erfuhr – etwa an den spartanisch bestückten Schaukästen und den einsprachigen Erklärun-gen (der Volltext in Arabisch und die Bildunterschriften in Englisch), an der Kura-tierung und ihrer Logik bezüglich Auswahl und Anordnung der Objekte sowie an den Wänden, die in letzter Minute noch schlachtschiffgrau lackiert worden waren – sind solche «Mängel» für den Besucher/die Besucherin freilich nicht unbedingt of-fensichtlich.
Abbildung 15: Der renovierte Südflügel des Museums zeigt nicht nur Objekte ägyptischer Provenienz, sondern auch zahlreiche universelle Themen wie etwa Monumente der Begräbniskulturen (Raum 17).
Foto: Ahmed Amin
258 | IMAN R. ABDULFATTAH
Er/sie ist eher von der Einzigartigkeit der ausgestellten Werke gefangen, von den erneuerten und großzügigeren Schaukästen sowie der hellen und frischen Atmo-sphäre. Letztlich ging es, bei allen Unstimmigkeiten in der französisch-ägyptischen Zusammenarbeit, darum zu versuchen, das MIA, welches zunächst eine reine Stu-diensammlung war und für die das EGYPTIAN MUSEUM ursprünglich gebaut wurde, in ein Museum umzuwandeln, das in der Lage ist, auf zeitgenössische kulturelle und intellektuelle Fragen zu antworten.
Was ist heute also anders im MUSEUM OF ISLAMIC ART und warum sollte man es besuchen? Für diejenigen, die das Museum bereits kannten, war wohl der erste sichtbare Unterschied, dass entschieden wurde, zum ursprünglichen Haupteingang an der Port Said-Straße zurückzukehren, statt den zum Museumsgarten führenden Nebeneingang zu nutzen. Da sich der Haupteingang genau in der Mitte der langen Nord-Süd-Achse des Gebäudes befindet, teilt er die 25 Ausstellungsgalerien in zwei Flügel. Die in den Schaukästen präsentierte Sammlung wurde entsprechend chrono-logisch und thematisch unterteilt, sodass nun auch Objekte aus unterschiedlichen Materialien zusammengestellt zu finden sind. Das mag vielen keine große Verände-rung zu sein scheinen, ist aber dennoch erwähnenswert, da die ehemaligen Galerien fast ausschließlich nach bestimmten Materialien geordnet waren, die wiederum ent-sprechende kuratorische Bereiche widerspiegelten. Dadurch befanden sich Holz, Metall, Stein, Keramik, Textilien, Elfenbein, Glas und Münzen nicht in derselben Vitrine oder in demselben Schaukasten. Begründet wurde diese drastische Neue-rung damit, den Objekten eine zusätzliche Kontextebene hinzuzufügen, indem sie in einer gemischten Zusammenstellung betrachten werden können und zu Überlegun-gen über die Entwicklung von Stil, Technik und Ästhetik anregen. Da viel Ausstel-lungsfläche an die EGYPTIAN NATIONAL LIBRARY AND ARCHIVES abgetreten werden musste, wurden des Weiteren alle Verwaltungsbüros des Museums in eine neu ge-baute Anlage in den Garten des Museums verlagert. Hier befinden sich außerdem eine Cafeteria, ein Konferenzraum, eine Bibliothek und ein kleines konservatori-sches Labor.
Beim Betreten des Museum ist die erste Galerie, die der/die Besucher_in zu se-hen bekommt, die Einführungshalle (Galerie 00), an deren Eingang ein Paar stei-nerner Löwen steht, die dem Bahri Mamluk Sultan al-Zahir Baybars (1260-1277) zugeordnet werden und deren Rückseiten verraten, dass sie geplünderte antike Ka-pitelle sind, die im 13. Jahrhundert geschickt wiederverwendet wurden. Zwölf emaillierte Moschee-Lampen begrüßen die Besucher_innen, die meisten von ihnen hergestellt für den Bahri Mamluk-Komplex von Sultan Hasan (1356-1361), umge-ben von einem Glaskubus, der an die Kaaba in Mekka erinnert. Die dreisprachigen Informationstafeln an den Wänden, die von Sylvie Denoix und anderen Histori-ker_innen der IFAO verfasst wurden, betonen die Geschichte Ägyptens seit der Ankunft des Generals ’Amr ibn al-ʿAs und der muslimischen Eroberung Ägyptens 641 C.E.
DAS MUSEUM OF ISLAMIC ART IN KAIRO – REVISITED | 259
Der Löwe auf der rechten Seite führt die Besucher_innen in den rechtsseitigen Nord-Flügel mit dem Herzstück der Museumssammlung, die sich auf Objekte ägyp-tischer Herkunft konzentriert – beginnend mit einer einzelnen Galerie (Galerie 01), die sich den meist Kairo und seiner Umgebung zugeschriebenen Umayyaden-, Ab-basiden- und Tuluniden-Perioden des 8. und 9. Jahrhunderts widmet. Die Artefakte sind in einem einzigen Raum zusammengefasst, weil diese Perioden, zumindest rein quantitativ gesehen, nicht die Stärke der Sammlung ausmachen und weil die Objek-te aus diesen Zeiträumen in diesem Flügel thematisch zusammengestellt sind. Eini-ge der Glanzstücke sind der sogenannte «Marwan»-Krug, ausgegraben in Abu Sir (Inventar-Nr. 9281); eine Holztafel mit Intarsien aus Knochen und verschiedenen Holzarten (Inventar-Nr. 9518), deren Zwillingsbruder im METROPOLITAN MUSEUM
OF ART in New York zu sehen ist;9 eine Stuck- und Holzschnitzerei aus der Tulun-iden-Periode; und ein Kelch aus der Abbasiden-Dynastie (Inventar-Nr. 23284.), ei-nes der frühesten Stücke aus lackiertem Buntglas überhaupt, ausgegraben 1972 in Fustat von Prof. George T. Scalon von der AMERICAN UNIVERSITY in Cairo (AUC) (Scalon1981: 66).10
Die folgenden drei Galerien 02-04 sind den Künsten der Fatimid-Periode (969-1171) gewidmet. Sie führten allerdings zu einer Auseinandersetzung zwischen den Kurator_innen der französischen und des ägyptischen Teams: Obwohl die Stärke der Kairoer Kunstsammlungen in der Periode der Fatimiden und dann der Mamlu-ken liegt, hielten es die Mitglieder des SCA und der Vorstand der Museumsdirek-tor_innen für nicht hinnehmbar – wenn nicht gar für apokryph – Kairos schiitischen Stadtgründern eine derart große Ausstellungsfläche einzuräumen. Aus einer rein «geografischen» Sicht erlaubt die Ausstellung hier allerdings, viele der Artefakte in einer gemeinsamen Runde zu versammeln, wie etwa die im Grabkomplex von Qalawun (1284), erbaut auf den Ruinen des westlichen Fatimiden-Palastes, wieder verwendeten Holztafeln. Um die Verbindung zwischen den ausgestellten Objekten und dem gesellschaftlichen Leben mit seinen Ideen und Vorstellungen zu erleich-
9 Die Holztafel in New York wurde vom METROPOLITAN MUSEUM 1937 (Inventar-Nr.
37.103) erworben, ähnliche Holztafeln finden sich im LOUVRE, im ARCHÄOLOGIE
MUSEUM der Cairo University und im Museum für Islamische Kunst – STAATLICHE
MUSEEN ZU BERLIN (vergleiche hierzu Carboni und Hausdorf 2011: 42-43). Durch sol-che Informationen auf den Ausstellungstafeln wurden die entsprechenden Objekte in ei-nen übergreifenden Kontext gestellt.
10 Obwohl undatiert wie der Becher aus lackiertem Buntglas im Corning Museum of Glass (Inventar-Nr. 69.1.1) sowie ein weiteres Fragment aus Fustat im MIA, wird auch dieser Kelch der zweiten Hälfte des 8. Jahrhunderts zugeschrieben. Das ist bedeutsam, weil es die Anwendung von Lüstermalerei auf Glas beweist, bevor sie im Irak dann im 9. Jahr-hundert auf undurchsichtiger, weiß-glasierter Keramik populär wurde.
260 | IMAN R. ABDULFATTAH
tern, wurden Unterthemen mit gezielten Bezügen eingerichtet, zum Beispiel höfi-sches Leben, Lüsterware [lustreware, Töpferware mit metallisch glänzendem Über-zug, Anm. d. Übers.] oder architektonische Einrichtungen von einigen der ältesten religiösen Stiftungen Kairos, wie etwa die großen Holztüren aus den Moscheen von al-Hakim und al-Salih Tala’i (1160).
Abbildung 16: Blick nach den Renovierungsarbeiten in den thematischen Flügel des MUSEUMS OF ISLAMIC ART.
Foto: Ahmed Amin.
DAS MUSEUM OF ISLAMIC ART IN KAIRO – REVISITED | 261
Der weiteren Chronologie folgend, konzentrieren sich die Galerien 05-06 auf die Ayyubiden (1171-1250) [sunnitisch-muslimische Dynastie kurdischer Herkunft, Anm. d. Übers.] sowie auf eine Übergangsperiode innerhalb der Kunst, nämlich des Übergangs von der Vorherrschaft der eckigen Kufi-Schrift zur besser lesbaren Schreibschrift sowie dem Entstehen der ersten Einlegearbeiten in Metall. Eines der vielleicht interessantesten Objekte ist das Fragment einer Keramikschale, das die Kreuzabnahme Christi und die Umarmung der trauernden Maria zeigt (Inventar-Nr. 13174).11 Weitere Höhepunkte sind in den drei Galerien zu sehen, die sich den Künsten der Mamluken (1259-1517) widmen, von denen viele Werke (Lampen, Koranschachteln und Kerzenständer) aus Kairos zahlreichen religiösen Stiftungen stammen. Nicht übersehen werden sollte eine kleine Auslage von Keramiken mit verschiedenen Wappenzeichen, die auf den Sitz eines Mamluken-Emir oder -Sultan verwiesen und viele Gebäude und Gegenstände des täglichen Lebens zierten. Die thematischen Ausstellungen im Südflügel links vom Haupteingang stellen die Viel-falt der Keramik aus dem osmanischen Hof und dem Iran vor sowie die islamische Kunst im Allgemeinen, wie etwa – um nur eine Auswahl zu nennen – Grabbeiga-ben, Kalligrafie und Epigrafik, Textilien und Teppiche (ausgestellt im einzigen Blindenzimmer), Geometrie oder Wissenschaft und Medizin; viele Artefakte dieser Sektionen sind ägyptischen Ursprungs.
Indes gilt es immer noch eine Menge zu erreichen, auch und gerade heute, nachdem das Museum seit mittlerweile vier Jahren wiedereröffnet ist. So sollte überlegt werden, ob es nicht an der Zeit ist, Kommunikationskanäle mit anderen Museen und kulturellen Institutionen einzurichten, die den Aufbau und die Ent-wicklung eines Managementsystems unterstützen, einschließlich einer Datenbank für die Sammlung ähnlich der des REGISTRATION, COLLECTIONS MANAGEMENTS
AND DOCUMENTATION DEPARTMENT (RCMDD) im EGYPTIAN MUSEUM. Zudem stellt die neue Stellfläche Platz für temporäre Ausstellungen sowie für Kinder-Aktivitäten bereit.
Bei mir persönlich hat diese Erfahrung – abgesehen davon, dass ich in das Pro-jekt ohne große Erfahrung im Koordinieren einer Museumsmodernisierung einge-stiegen bin – zum Nachdenken über den Status des Museums geführt. Das Studium islamischer Kunst und Architektur ist nicht länger auf seinen eigenen Bereich be-
11 Das Fragment erhielt das MUSEUM OF ISLAMIC ART 1936 vom berühmten Sammler und
Händler Maurice Nahman; weitere Fragmente der gleichen Schale wurden 1939 vom BENAKI MUSEUM (Athen) und 1996 vom WALTERS ART MUSEUM (Baltimore) erworben (vergleiche Vorderstrasse 2007: 82). Diese Fragmente sind für Kunsthistoriker besonders interessant wegen ihrer eklektischen Ikonografie, die sich aus verschiedenen Traditionen des östlichen Mittelmeerraums und des Nahen Ostens aus dem 13. und 14. Jahrhundert zusammensetzt.
262 | IMAN R. ABDULFATTAH
schränkt, im Gegenteil, es ist zu einem expandierenden Thema geworden, das mit angrenzenden Themenbereichen interagiert und allmählich eine zentrale Stellung innerhalb der Kunstgeschichte eingenommen hat. Dieser Trend zur methodischen und theoretischen Interdisziplinarität fehlt jedoch im kulturellen Kontext der ägyp-tischen Gesellschaft, und er ist auch in der SCA auffallend abwesend, trotz vieler ambitionierter Präzedenzfälle, die es in jüngster Zeit gegeben hat. Angesichts dieser neueren Entwicklung sollten neue Ansätze für die ästhetische und konzeptuelle In-terpretation von Kunst angewendet werden – sei es islamischer oder anderer Künste – um den typischen segmentierten chronologischen Aufbau zu ersetzen, den die Be-sucher_innen ägyptischer Museen gewohnt sind. Da viele der Denkmäler, der ar-chäologischen Stätten und der Artefakte immer noch in einer isolierten Weise prä-sentiert werden, ohne Einbindung in die sich überschneidenden interkulturellen Prozesse und Entwicklungen, müsste ein Mechanismus eingeführt werden, der ver-schiedene Unterkategorien zusammenführt und sie in einen größeren historischen und regionalen Rahmen stellt. Bezogen auf den Museumsbereich wäre auch eine Studie über die Geschichte der Sammlungen Ägyptens ein wichtiges Thema. Über die Erforschung des Kontextes, der in Ägypten im 19. Jahrhundert zur Gründung des MUSEUMS OF ISLAMIC ART und dem Vorläufer des SCA geführt hat (sowie der drei anderen nationalen Museumsprojekte), wäre es für jeden möglich, die jahr-zehntelange abgeschottete Haltung gegenüber dem Studium der Kunst und der Ar-chitektur zu verstehen. Kurz gesagt, wir brauchen eine Neubestimmung der frag-mentarischen «Geschichte» Ägyptens, die unter kolonialer Herrschaft entstanden ist und weiterhin die Präsentation des kulturellen Erbes in seiner Gesamtheit be-herrscht und beeinflusst. Es ist diese Neubestimmung, die auch die Modernisierung des MIA trotz gewisser Begrenzungen in Angriff nehmen könnte: ein Schritt in Richtung Umdenken und Neuausrichtung im Umgang mit den islamischen Alter-tümern in der heutigen ägyptischen Gesellschaft.12
LITERATUR al-Habashi, Alaa, und Nicholas Warner. «Recording the Monuments of Cairo: An
Introduction and Overview.» Annales Islamologique. 32, 1998. 81-99. Carboni, Stefano, und Daniel Hausdorf. «Panel (Lid from a Chest).» Masterpieces
from the Department of Islamic Art in The Metropolitan Museum of Art. Hg. Maryam D. Ekhtiar. New York: The Metropolitan Museum of Art, 2011. 42-43.
12 Kurz vor Fertigstellung des vorliegenden Buches, am 24. Januar 2014, wurde das
MUSEUM OF ISLAMIC ART durch eine Denotation einer Autobombe vor dem Museums-gebäude fast vollständig zerstört. Anmerkung der Herausgeberinnen.
DAS MUSEUM OF ISLAMIC ART IN KAIRO – REVISITED | 263
Reid, Donald Malcom. Whose Pharaohs: Archaeology, Museums and Egyptian Na-tional Identity from Napoleon to World War I. Cairo: The American University in Cairo Press, 2002.
Scanlon, George T. «Fustat Expedition: Preliminary Report.» 1972, Teil I. Journal of the American Research Center in Egypt. Vol. 18, 1981. 57-84.
UNESCO. Historic Cairo. Abgerufen unter: http://whc.unesco.org/en/list/89/. Zu-letzt gesehen am 7. Januar 2014.
Vorderstrasse, Tasha. «Multi-Cultural Aspects of Pottery: A Christian Bowl found in Mamluk Egypt in its Cultural Context.» Early Christian Art. Vol. 4, 2007. 81-94.